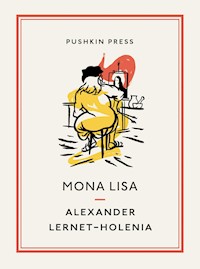11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Alexander Lernet-Holenias Roman gleicht einem Uhrwerk, dessen Räder sich mit einer Präzision ohnegleichen auf das Ende zu bewegen, die Zeit messend und ihr gleichzeitig ausgeliefert. Die Zeit, das sind die Jahre zwischen den beiden Weltkriegen, in denen Philip Branis seinen Nebenbuhler erschlägt, einen Bastard aufzieht und vergeblich versucht, den Tod seiner eifersüchtig geliebten Frau zu überwinden. Die Zeit, das sind die Jahre des heraufdämmernden Nationalsozialismus mit dem Geruch nach noch nicht geflossenem Blut, mit dem Warten auf den Sprung lauernder Bestien und mit tragisch-lächerlichen Versuchen, diese ganze unwirkliche, brüchige, unerträgliche Realität abzuschütteln. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 296
Ähnliche
Alexander Lernet-Holenia
Der Graf von Saint-Germain
Roman
FISCHER Digital
Inhalt
Alle Figuren und Charaktere dieses Buches, die historischen ausgenommen, sind frei erfunden und spielen weder auf lebende noch auf verstorbene Personen an.
Vorbemerkung
In den Blättern, die ich hiermit der Öffentlichkeit vorlege, spielt der sogenannte Graf von Saint-Germain eine entscheidende, wenngleich räumlich nicht ausgedehnte Rolle. Es ist unwahrscheinlich, daß er in der Tat geheißen habe, wie er vorgegeben; und ein Mitglied der Familie gleichen Namens hat mir versichert, daß die wirklichen Grafen von Saint-Germain jeden Zusammenhang mit dem Abenteurer ablehnen. Dennoch ist er unter den zweifelhaften Figuren des achtzehnten Jahrhunderts die bedeutendste, ja es steht dahin, ob man ihn, im eigentlichen Sinne, einen Scharlatan überhaupt nennen darf. Doch hatte er seine Hände in einer Menge von unklaren Geschäften, und in der europäischen Politik zur Zeit des Siebenjährigen Krieges sowie bei der russischen Thronumwälzung vom Jahre 1762 soll er eine nicht unwesentliche Rolle gespielt haben. Saint-Germain hatte, wie fast alle verdächtigen Charaktere, ungemeines Sprachentalent; er beherrschte fast alle lebenden Idiome, und sein Gedächtnis war so groß, daß er jedes Buch, welches er einmal überlesen, auswendig wußte. Er spielte fast alle Instrumente, namentlich aber die Geige, mit so wunderbarer Vollendung, daß man ein ganzes Quartett zu hören glaubte, und vermochte mit beiden Händen zugleich auf zwei Bogen Papier, was man ihm diktierte, zu schreiben. Aus der Handschrift wollte er nicht nur den Charakter, sondern sogar den Namen des Briefstellers erraten können. Als Stilist war er vortrefflich. Er behauptete, kaum irgendwelcher Nahrung zu bedürfen, und wirklich hat man ihn nur sehr selten essen oder trinken sehen. Oft verfiel er in Starrsucht und wollte dann, erwachend, in fernen Gegenden, etwa jenseits des Himalajagebirges, ja sogar fern von der Erde gewesen sein und dort Aufklärung über die Zukunft erhalten haben. In der Tat sagte er den Tod Ludwigs des Fünfzehnten richtig voraus.
Er war ein Sammler von Büchern, Gemälden, Juwelen und Altertümern. Zuweilen verschwand er auf mehrere Monate.
Zu gewissen Mysterien, die damals die Gemüter beschäftigten, soll er in Beziehungen gestanden haben, und die Behauptung, daß er nichts als ein Schwindler gewesen sei, hätte sich von der Untersuchung abhängig zu machen, ob auch jene Mysterien nichts als Schwindel gewesen waren. Wenngleich es nämlich äußerst unwahrscheinlich ist, daß es Übernatürliches gibt, so ist es doch auch ebenso schwierig, zu beweisen, daß es dergleichen nicht gibt. Aus den natürlichen Ereignissen des Daseins und aus den unerklärbaren scheint sich vielmehr ein mythischer Vorgang zu bilden, welcher das eigentliche Schauspiel der Welt ist.
Jedenfalls läßt sich das Unbekannte nicht mit größerem Rechte bestreiten, als man daran glauben kann. Es ist aber anzunehmen, daß Saint-Germain von diesen Dingen genauere Vorstellungen gehabt habe. Seine Neigung, die eigene Persönlichkeit durch fortwährende Verwendung anderer Namen zu verwischen und sozusagen aufzuheben, spricht nicht weniger dafür als seine Behauptung, er sei Jahrtausende alt. Man vermutet, er habe sich selber nicht so sehr als einzelne, umgrenzte Person, wie vielmehr als eine Reihe von Personen betrachtet, welche, vom Reiche des Geistes abgesandt, im Laufe der Zeit in den verschiedensten Gestalten, aber immer im gleichen Auftrag, erschienen seien. Doch paßte, wie bei aller Welt, seine physische Existenz nicht durchaus zu seiner moralischen. Als Illuminat mag er einwandfrei gewesen, um aber das Leben führen zu können, das ihm gefiel, ein Betrüger geworden sein; und wenngleich er vorgegeben haben soll, daß er unsterblich sei, starb er dennoch, zu Eckernförde, gegen das Ende seines Jahrhunderts.
Alexander Lernet-Holenia
Die Verwandlung des Herrn des Esseintes
Beilage 6zu der von der Geheimen Staatspolizei, Wien, aus dem Anlasse der Beschlagnahme der gesamten in- und ausländischen Hinterlassenschaft des Industriellen Philipp Branisangelegten Sicherstellungsakte, verfaßt 1938, 1944 nach Leonstein in Oberösterreich verlagert, aufgefunden im Juni 1945
Erster Teil
Die Widersperg sagt, daß die andern gar nichts bemerkt hätten. Sie sagte es natürlich nicht mit diesen Worten – als sie mir aber nachgekommen war, um mich zu fragen, ob ich schon zu Bett gehn wolle, fügte sie hinzu, man habe sich unten inzwischen zum Spielen hingesetzt. Hat man jedoch soeben erfahren, daß jemand, der mit am Tisch gesessen, einen andern – und sei’s auch vor Jahrzehnten gewesen – erschlagen hat, so setzt man sich nicht, oder zumindest nicht sogleich, zu den Karten.
Was sie erfahren haben, ist dies: daß dieser Mensch, der für meinen Sohn gilt, sich einbildet, oder vielmehr sogar glaubt, sich ganz deutlich erinnern zu können, er sei eines Nachts, offenbar im Herbst (doch unbestimmt in welchem), in einer Uniform – die er aber in Wirklichkeit niemals getragen – die Singerstraße hinabgegangen und auf den Franziskanerplatz eingebogen; daß er dort das Tor des Mautnerschen Hauses mittels eines Schlüssels, den er bei sich geführt, geöffnet und im Dunkeln die Treppe hinaufgegangen; und daß ihn im ersten Stock, an einer der Wohnungstüren, erhellt von dem wenigen Lichte, das auf den Vorplatz gefallen, eine junge Frau, die ihn an die Bilder seiner Mutter erinnert, empfangen habe; worauf die Vorstellung von diesen Dingen, oder dieser wache Traum, oder wie immer man’s nennen will, erloschen sei.
Was sie nicht erfahren haben, oder was ihnen nicht weiter aufgefallen, oder woraus sie keine Schlüsse gezogen haben, ist dies: daß die Uniform, beziehungsweise der braune Mantel, den mein Sohn getragen haben will, weiße Vorstöße gehabt; daß es also nur der Uniformmantel eines ganz bestimmten Regimentes, welches, als einziges seiner Truppengattung, keinerlei sogenanntes Gegenregiment mit andersfarbigen Knöpfen hatte, silbernen statt goldnen, oder goldnen statt silbernen, kann gewesen sein; daß des Esseintes in jenem Regimente, und in keinem andern, gedient hat; daß meine Frau, während und nach ihrer Ehe mit Rzeplinsky und vor ihrer Ehe mit mir, in jenem Stockwerk des Mautnerschen Hauses gewohnt; und daß also, wenn mein Sohn Erinnerungen hat, die nicht nur sein eigenes Leben betreffen, sondern, unglaublicherweise, auch das seines – wirklichen – Vaters (denn von wem sonst sollte er dergleichen Erinnerungen ererbt haben!), dieser sein wirklicher Vater nicht ich sein kann, sondern daß es des Esseintes gewesen sein muß, welchen meine Frau, unmittelbar bevor ich sie geheiratet, in ihrer Wohnung empfangen; was ich nicht gewußt hatte, woran jedoch mein Sohn sich – ich weiß nicht durch welche teuflische Verwirrung in der Natur – erinnert.
Zum Abendessen war Marklowsky zu spät gekommen. Er entschuldigte sich mit dem Umstande, daß er, bis weit in den Nachmittag, im Kanzleramt sei aufgehalten worden. – Ob man sich denn dort mit einem Male so überanstrenge? ward er gefragt. Er schwieg zuerst eine Zeit, dann erwiderte er, er könne es uns ebensogut jetzt schon sagen, anderntags werde man’s ja doch aus den Zeitungen erfahren: der Kanzler sei, in kleiner Begleitung, verreist, um mit der deutschen Regierung zu verhandeln.
Dieser Eröffnung folgte eine vollkommene Stille. Dann fragte jemand – ich glaube mich erinnern zu können: mit reichlich belegter Stimme –, worüber man denn verhandeln werde. – Über ein bestimmtes Abkommen aus dem Jahre 1936, die zwischenstaatlichen Beziehungen betreffend, entgegnete Marklowsky. Augenblicks erhob sich Stimmengewirr. Alles rief, daß zweifellos der gräßliche Österreicher, der in Deutschland regiere, den Kanzler kurzerhand zu sich müsse befohlen haben und daß das Abenteuer dieser Reise verderblich enden werde. Warum denn der Kanzler der präpotenten Einladung gefolgt sei, und weshalb er’s nicht einem Gesandten überlassen habe, die vorgeblichen Verhandlungen zu führen! Mit Deutschland könne man überhaupt nicht verhandeln, am wenigsten in Deutschland selbst. Die Reise, jedenfalls, sei ein Zeichen so vollkommener Schwäche, daß sie einem Aufgeben des Staates gleichkomme. Sicca erhob sich mit den Worten: »Auf Wiedersehen in der Closerie des Lilas!« Er setzte sich aber, nachdem er eine Zeit erregt hin und her gegangen war, wieder zu Tische. Marklowsky, weil er keine weiteren Aufschlüsse gab, mußte es über sich ergehen lassen, daß man ihn eine »phantasielose Beamtennatur« nannte. Er verteidigte sich, indem er rief, ihm selbst sei der Vorgang ja von allem Anfang unheimlich genug gewesen. Das Abendessen war vollkommen gestört. In einem fort ging die Auseinandersetzung weiter. Und nach Tisch, um die Aufgeregten auf andre Gedanken zu bringen, kam Bouvines auf den unseligen Einfall, wiederum mit den sogenannten Erinnerungen meines Sohnes zu experimentieren. Das hatte zur Folge, daß man sich zwar für diese Erinnerungen nicht wirklich interessierte, aber wenigstens so weit abgelenkt ward, daß man, um nur irgend etwas zu tun, Karten zu spielen begann; mich jedoch hatte, was mein Sohn gesagt, wie ein Schuß ins Herz getroffen.
Mit Leuten, welche französische Namen haben, habe ich niemals Glück gehabt, am wenigsten mit des Esseintes, fast ebensowenig mit Bouvines. Er gilt für einen Heiligen, und als Großprior, der er nun einmal ist, kleidet ihn das gut. Alles aber, was er, in der Güte seines Herzens, zum Vorteile andrer unternimmt, wird sogleich zum Unglück für diese – wie, zum Beispiel, sein Versuch, mir durch Donati Gott beweisen zu lassen, wodurch ich auf ein Haar um meinen Glauben gekommen wäre; und ohne weiteres hätte denn auch er selbst es sein können, der etwa dem Kanzler die Reise nach Deutschland vorgeschlagen.
Es wäre ganz oberflächlich, das Zusammentreffen der beispiellosen Niederlage, die mein Sohn mir bereitet hat, und des Unheils, welches den Staat betrifft, für ein zufälliges zu halten. Zwar ist das Ende dieses Staates, zufolge von des englischen Außenministers im November vorigen Jahres nach Berlin unternommener Reise, vorauszusehen gewesen, doch hat man’s nicht wahrhaben wollen; und das entehrend-lächerliche Unglück, das mir persönlich widerfährt, ist überhaupt ohne jede Vorbereitung geschehen. Dennoch ist mir, als drücke mir der ungeheuer schmerzende Ring, der aus dem Bewußtsein beider Ereignisse geschmiedet ist, schon seit unerinnerlich langer Zeit das Haupt zusammen, und ich bin gewiß, daß diese Qual, die ich vor kurzem noch nicht einmal geahnt habe, so lange weiterwähren wird, wie sie in meiner Einbildung schon gewährt hat. Oder mit andern Worten: wenn die Geschicke sich von uns nicht bloß wollen ertragen lassen, sondern wenn sie entschlossen sind, uns wirklich niederzuwerfen, so tun sie sich zusammen, so verzetteln sie sich nicht mehr als einzelne, so sammeln sie sich um uns wie Geier um die Sterbenden auf einem Schlachtfelde. Ich stehe jetzt an dieser Stelle, an der die Richtungen der beiden Katastrophen sich kreuzen – wer, wenn nicht ich, wüßte, daß es diese Stelle geben muß, wo die Schicksale unsrer Welt und dieses Menschen, dieses des Esseintes, einander begegnen! Ich, ich selbst bin diese Stelle, und ich wage nicht, die Augen zu heben, aus Furcht, daß ich sehen könnte, wie sich unzählig und, gleichsam inmitten einer Windrose, auch die Strahlen andrer und immer wieder andrer Verderben in mir treffen. Ich hatte geglaubt, mit dem Tode meiner Frau, mit dem Tode ihres Liebhabers sei alles, was damals geschehen war, zu Ende gegangen. Nun erweist sich, daß die beiden, noch bevor sie zu nichts geworden sind, mich selbst vernichtet haben, nun stehen sie wieder auf und richten mich zugrunde.
Ich bin anderntags im Begriffe, nach Wien zu reisen, um angesichts der Lage, die durch die Reise des Kanzlers geschaffen worden ist, in meinen Angelegenheiten zu tun, was noch irgend zu tun sein könnte – das meiste freilich ist längst getan –, das Haus ist zwar voll von Gästen, doch mögen sie sich selbst überlassen bleiben; und ich bin schon daran, den Wagen zu bestellen, als mir der Bediente einen Bauern aus der Umgebung meldet. Ich erkläre natürlich, keine Zeit zu haben; der Bediente, mit eigentümlicher Dringlichkeit, legt mir nahe, den Menschen dennoch zu empfangen. Was man denn, um aller Heiligen willen, von mir wolle? rufe ich. Der Bediente glaubt vermuten zu können, es handle sich um einen Gegenstand von einiger Bedeutung. Kurz, ich gehe die Treppe hinab, einige Worte mit dem Besucher zu wechseln – und bin alsbald in eines der seltsamsten Gespräche meines Lebens verwickelt.
Der Bauer ist ein Mann zwischen fünfzig und sechzig, über mittelgroß, ein wenig beleibt, mit gelichtetem Haar. Seine Haltung ist eine gute, er hat natürlichen Anstand. Der Bediente, als sei er mit ihm in einer Art von Einverständnis, stellt, um die Wichtigkeit des Gespräches, welches sogleich beginnt, durch eine Art von Bewirtung zu betonen, eine Karaffe mit Schnaps und zwei Gläser auf den Tisch – ohne von mir Auftrag dazu erhalten zu haben. Der Bauer, ein wenig altmodischerweise und offenbar, weil ich das Gut besitze, nennt mich »gnädiger Herr«, während die andern Bauern mich sonst »Herr Präsident« nennen. Das Gespräch, wie auf dem Lande üblich, fängt mit gleichgültigen Wendungen an; der Bauer bestreitet’s fast alleine, ohne durch meine Schweigsamkeit und Zerstreutheit aus der Fassung zu kommen. Um auch von meiner Seite zur Unterhaltung beizutragen, ja zuletzt um nur überhaupt irgend etwas vorzubringen, frage ich, während ich den Bedienten, durch eine Handbewegung, die Gläser vollschenken heiße, ob man denn auch hier in der Gegend schon von der Reise des Kanzlers gehört habe.
Natürlich hat man hier von dieser Reise noch nichts vernommen. Aber das Ereignis verfehlt auch vollkommen, Eindruck auf den Bauern zu machen. Als Grundeigentümer – er ignoriert durchaus, daß ich Werke in der Hauptstadt betreibe und daß mein Gut hier, so ausgedehnt es auch sein mag, nur einen geringfügigen Teil meines Vermögens darstellt – als Grundeigentümer, erklärt er, seien wir unabhängig von den Unternehmungen der Politik, ja wir täten sogar gut daran, uns so wenig wie möglich darein zu mischen. Dabei weiß ich, daß er auf die Entschließungen der Gemeinde, ja des Landtags Einfluß übt. Er lehnt also, im Augenblicke, jede Unterhaltung über derlei Dinge ab. Statt dessen kommt er, während der Bediente die Gläser vollschenkt und sich dann zurückzieht, auf die Landwirtschaft zu sprechen und redet zuerst von meinem, dann ausführlich von seinem Besitztume.
Er ist vermöglich und hat, aus erster Ehe, zwei Töchter, die beide verheiratet sind. Aber seine Schwiegersöhne, eröffnet er mir, mißfallen ihm, er wünscht nicht, daß einer von ihnen später den Besitz übernehme; und so hat er denn, vor wenigen Jahren, zum zweiten Male geheiratet, doch ist er kinderlos geblieben.
In der Tat erinnerte ich mich dieses Umstands, und daß seine zweite Frau, als Mädchen, für eine Art von Schönheit gegolten. Sie war blond, mit weißer, jedenfalls kaum gebräunter Haut, und fast so hochgewachsen wie er selbst.
Im übrigen war ich, während er sprach, mit meinen Gedanken ganz woanders und hatte überdies, unauffälligerweise, häufig zur Wanduhr geblickt. Wie also hätte ich auf die Wendung gefaßt sein sollen, die das Gespräch mit einem Male nahm!
Er fuhr nämlich fort: sein Eigentum nicht in fremde Hände gelangen zu lassen, sei er durchaus entschlossen, und da die Ursache der Kinderlosigkeit nicht bei seiner Frau, sondern bei ihm selbst liege, er aber Kinder dringlichst wünsche, so bäte er mich, ihm die Auszeichnung zu erweisen, der Vater eines zukünftigen Kindes seiner Frau zu werden.
Er brachte dieses Ansinnen zwar mit einer gewissen Feierlichkeit, jedoch ohne alle Befangenheit und ohne jedes Stocken vor. Ich glaubte, nicht richtig gehört zu haben, ja ich war sprachlos. Schließlich stotterte ich, vielleicht liege die Ursache der Kinderlosigkeit eben doch nicht an ihm, sondern an seiner Frau. – Nein, an ihm selber, erklärte er so gelassen, als stehe es niemandem zu, den Ablauf des Natürlichen zu kritisieren; und wenn er mich nun bäte, ihm die Ehre, auf die er angespielt habe, wirklich zu erweisen, so geschehe es nicht zuletzt aus dem Umstande, daß weder er selbst sich wegen des Aussehens seiner Frau zu schämen brauche, noch auch ich mich, ihres Aussehens wegen, würde zu schämen haben.
Diese Rede ward mit solcher Würde, ja Eindringlichkeit gehalten, daß ich nicht mehr wußte, wie ich mich aus der Affäre ziehen sollte. Es gelang mir aber wenigstens, ein Kompliment in betreff des guten Aussehens seiner Frau hervorzustottern. Gott mochte wissen, wie sich hier, seit den Tagen der Leibeigenschaft, dergleichen Bräuche erhalten hatten! Hatten sie sich aber wirklich erhalten, oder war das Ansinnen, das er mir gestellt, ein Einfall, den er ganz aus sich selbst gehabt hatte? Offenbar nicht – wenngleich mir sonst noch nichts dergleichen zu Ohren gekommen. Man hatte zwar zuzeiten gehört, daß Prinzen in Wirklichkeit oft genug von den Bedienten ihrer nominellen Väter stammten. Aber diese Bedienten waren nicht offiziell um die Vaterschaft gebeten worden. Ich konnte mich rühmen, in dem Falle der ganz wenigen Menschen zu sein, denen man feierlicherweise einen solchen Antrag gemacht hatte.
Ich dachte an meine Frau, an ihre Ehe mit dem unglücklichen Rzeplinsky, an die Fahrigkeit ihrer Beziehungen zu mir, an ihr Verhältnis zu des Esseintes, an den Betrug, den die beiden an mir begangen hatten, ich dachte an die Frau des Bauern – und die geborene Komtesse Klercker, des Esseintes, mein Sohn, ich selbst, unsere Beziehungen zueinander, dies alles schien mir mit einem Male unglaublich überschätzt und fadenscheinig. Ich brachte hervor, ob denn er, der Bauer, schon mit seiner Frau gesprochen habe. Er sah mich an, etwa als wolle er damit ausdrücken, es sei gar nicht erst nötig gewesen, mit ihr weitschweifig darüber zu verhandeln, dann antwortete er: freilich habe er mit ihr gesprochen. Es war nun wirklich unmöglich geworden, sein Ansinnen abzulehnen, mit einer Weigerung hätte ich nicht nur ihn, ich hätte auch seine Frau herabgesetzt. Der Begriff dessen, was man sonst Betrug nennt, ward hier vollkommen hinfällig. Und wenngleich ich, weiß Gott! alles andre eher im Sinn gehabt hatte als ein Abenteuer mit einem Bauernweibe – mir war nun mit einem Male selbst, als sei mir dergleichen zumindest nicht ganz so bedeutungslos, wie es mir vernünftigerweise hätte sein müssen, ja ich kam mir in Gegenwart dieses Menschen, der mich ruhig ansah, nicht einmal mehr so lächerlich vor, wie ich mir im Anfange der Unterredung vorgekommen. Einwände, die ich eigentlich hätte machen können, etwa daß sich, was man mir zumute, mit den heutigen Begriffen von Anstand nicht mehr vertrage, oder daß die seltsamsten Unannehmlichkeiten entstehen könnten, wenn das Kind aus einer solchen Verbindung später entdeckte, es sei nicht seins, sondern meines, ließ ich fallen, und ich lenkte sein Augenmerk auch nicht auf den Umstand, daß ich das Gut erst vor wenigen Jahren gekauft, daß meine Familie hier keinesfalls seit Jahrhunderten saß und daß weder ich selbst noch meine Vorfahren auf ihn und sein Eigentum jemals Grundherrenrechte geübt. Ich wäre nicht verstanden worden. Besitz war Besitz, und Besitz war heilig. Ich hatte von den Heisters offenbar nicht nur das Gut, ich hatte auch ihre Verpflichtungen übernommen. Dieser Mensch hatte sich immer noch an mich gewendet, nicht an einen Knecht, einen Herumtreiber, einen Habenichts wie etwa an jenen des Esseintes, an den meine Frau sich gewandt.
Ich erhob mich, gab ihm die Hand und sagte, ich wolle noch am gleichen Tage, gegen den Abend, zu ihm kommen. Er trank sein Glas aus, dann stand auch er auf, dankte mir wie für etwas Selbstverständliches, und ging. Ich trat an das Fenster und tat, als sähe ich ihm nach, um dabei dem Bedienten, der wieder eingetreten war und die Karaffe und die Gläser forträumte, den Rücken kehren zu können.
Ich heiße Philipp Branis. Meine Familie ist zu Ende des sechzehnten Jahrhunderts aus Freiberg in Mähren ins Kärntnerische gezogen, wo sie ein Hammerwerk erworben. Um 1720 erwarb ein Elysäus Branis ein zweites Hammerwerk sowie, durch Heirat, die Herrschaft Winkel, wonach wir uns zeitweilig Branis zu Winkel genannt haben. Einer seiner Söhne, Raphael, ist bei Rivalta gefallen, einer seiner Neffen bei Hochkirch. (Ist’s nicht seltsam, daß man die Ehre einer Familie immer noch nach Toten, nicht nach Lebenden zählt?) Zur Zeit der Napoleonischen Kriege hat Winkel wieder müssen verkauft werden. Unter der Regierung Kaiser Ferdinands gründete mein Großvater Fabriken in der Hauptstadt und brachte es zu bedeutendem Reichtum. Mein Vater war Franz Josef Branis, meine Mutter Sophie Merenberg. Die Ehe meiner Eltern hätte eine glückliche sein können, wenn die Merenberge sich nicht veranlaßt gesehen hätten, aus der vermöglichen Verwandtschaft dasjenige Kapital zu schlagen, welches sie selber nicht mehr besaßen. Immerzu machten sie Anleihen, die sie vertaten. Mein Vater wurde es schließlich müde, die zahlende Rolle eines Emporkömmlings zu spielen, der er im Grunde gar nicht war, und setzte seine Schwäger vor die Türe.
Meine Frau, Marie Klercker, habe ich im März 1918 in Wien kennengelernt. Damals noch mit Rzeplinsky, einem Major der Karabiniere, verheiratet, war sie die Tochter des Adelsmarschalls von Kurland gewesen. Als die Truppen des Generals Steinau, dabei das Karabinierregiment, gegen Riga vorgedrungen, war Rzeplinsky eine Zeit in ihrer Nachbarschaft einquartiert worden und hatte bei ihrem Vater Besuch gemacht – wobei sie sich in den Major verliebte. Der alte Klercker hatte zahlreiche, ja fast zahllose Familie, meine Frau war sein jüngstes Kind, es war ihm, glaube ich, unmöglich geworden, sich um alle seine Kinder zu kümmern, man führte ein durchaus vegetatives Dasein, und wer eine der Töchter heiraten wollte, dem wurde sie einfach gegeben, wofern er nur von einigem Stande war. Auch die Ehe zwischen Rzeplinsky und meiner späteren Frau ward nur wenige Wochen, nachdem sie einander kennengelernt hatten, geschlossen.
Als Kind muß meine Frau so gut wie ganz sich selbst überlassen gewesen sein, fortwährend entlief sie ihren Erzieherinnen, und die seltsame Neigung, die ich an meinem Sohne beobachtet habe, stundenlang und allein auf den Feldern, meist den traurigsten und zur herbstlichen Zeit, umherzustreifen, dem Wind in den Hecken zu lauschen und auf das Wogen baumloser Hügel zu blicken, muß er von seiner Mutter geerbt haben. Dabei täte ich ihr unrecht, wenn ich sagen wollte, daß sie oberflächlich gewesen sei. Wahrscheinlich war sie sogar zu wenig oberflächlich für das Leben; sie hatte einfach nicht genug Sinn für die Wirklichkeit und vermochte nicht, sie mit der unwirklichen Welt, in welcher sie lebte, zur Übereinstimmung zu bringen.
Selbstverständlicherweise entsprach Rzeplinsky, der zwanzig Jahre älter war als sie, auf die Dauer der Zeit nicht den Illusionen, die sie sich von ihm gemacht hatte. Kurz nach seiner Eheschließung hatte er um einen Posten bei einer Gesandtschaft nachgesucht und war als Militärattaché an die Deutsche Botschaft nach Wien befohlen worden. In Kurland, umgeben von der Aufmachung – wenn anders man’s so nennen kann – und von den Erfolgen des Krieges, war er für seine Frau eine glänzende Erscheinung gewesen. Überdies hatte er sie aus der Einsamkeit geholt. In Wien jedoch, wo er im Diplomatischen Korps keinerlei wichtige Rolle zu spielen vermochte, sank er in ihren Augen zu einer Figur zweiten oder dritten Ranges herab. Dazu kam, daß sie sich für mich zu interessieren begann.
Ich habe Rzeplinsky aus wirklicher Nähe kaum kennengelernt, kann ihm aber dennoch meine Achtung nicht versagen. Er erkannte jedenfalls seine eigenen Grenzen. Als er merkte, daß er seiner Frau, um derentwillen er aus dem Kriege heimgekommen war, nichts mehr bedeutete, ging er, mit der Unkompliziertheit eines Mars, wieder in den Krieg zurück, übernahm ein Kommando im Westen und fiel in der zweiten Marneschlacht, im Sommer 1918. Er hinterließ mehrere Sättel, drei Pferde, worunter einen irischen Springer, einige Reitpreise, einen hohen Orden und, schließlich, seine Frau. Ich habe selten einen Menschen mit so klar abgeschlossener Rechnung aus dem Leben scheiden sehen.
Eines Abends, im Oktober des gleichen Jahres, war ich mit meiner Verlobten bei meinem – inzwischen verstorbenen – Bruder zu Tische gebeten worden. Wir fanden als weiteren Gast einen gutaussehenden, noch sehr jungen Menschen vor, der im Regimente meines Bruders diente und sich, der Ausheilung einer Wunde wegen, in Wien aufhielt.
Dieser Mensch war Karl des Esseintes.
Ich habe mich später oft gefragt, ob dieses mein erstes Zusammentreffen mit ihm, der mein Schicksal werden sollte, merklichen Eindruck auf mich gemacht, und ob ich etwa gefühlt oder geahnt, was kommen werde. Offenbar nicht. Als ich, auf dem Vorplatze, seinen braunen Mantel mit den weißen Vorstößen hängen sah – den gleichen, den mein Sohn nun in seiner Erinnerung, oder in seinem Traume, glaubt getragen zu haben –, dachte ich, entweder sei es ein Mantel meines Bruders oder eben der irgendeines andern Offiziers, welcher genau so gleichgültig und uninteressant sein werde wie die übrigen alle. Indem wir eintraten, sahen wir des Esseintes in einem Fauteuil sitzen und sich mit meiner Schwägerin unterhalten. Er trug den dunkelblauen Rock mit weißen, an den Rändern schon abgenutzten Rabatten. Im ungewissen Licht, das im Raume herrschte, schimmerten seine Augen und sein Gesicht, und weil ich zuerst nur diese schimmernden Stellen sah, schien mir das Gesicht ein wenig unsymmetrisch – wie es uns seltsamerweise bei hübschen Gesichtern oft der Fall ist. Als er aufstand, fand ich ihn fast schmächtig.
Über Tische zeigte sich, daß er durch seine Wunde am richtigen Gebrauch von Messer und Gabel noch behindert sei. Meine Schwägerin schnitt ihm das Essen vor. Wir erkundigten uns nach seiner Verletzung, er gab eine, im ganzen, oberflächliche Antwort und fügte hinzu, daß er jedenfalls um sein Leben niemals besorgt gewesen sei. Ich sagte, dergleichen sei leider meist bloße Redensart. »Nein, wahrhaftig«, sprach er lachend, »ich bin aus einem ganz bestimmten Grunde gewiß, daß mich kein Krieg, zumindest aber nicht dieser jetzige, das Leben kosten wird.«
Wir baten ihn um eine Erklärung, und er erzählte uns, was hier, freilich nicht in seiner eigenen ziemlich flüchtigen Darstellung, folgt, sondern von mir in einer Zahl von Zügen ergänzt ist.
Ein des Esseintes war um das Jahr 1760 Gehilfe des kaiserlichen Gesandten von Bernes im Haage gewesen. Es hatte sich damals, inmitten des Siebenjährigen Krieges, in Frankreich eine Friedenspartei gebildet, welcher der Marquis von Belle-Isle und die Pompadour angehörten, ja vielleicht sogar der König selbst. Doch war dieser letztere Umstand von geringer Bedeutung, zumindest gefiel La France – wie die Pompadour den König nannte – sich selber so sehr in der Rolle des Einflußlosen, daß er eines Tages einem Manne, der sich mit einer Petition an ihn gewendet hatte, erklärte: »Mein Herr, Ihre Angelegenheit steht schlecht. Denn Sie haben niemanden auf Ihrer Seite als mich.«
Die Verhandlungen wurden im Haage geführt. Der Emissär, der dabei für Preußen tätig gewesen sein soll, wird in der Korrespondenz zwischen Friedrich dem Zweiten und seinem Kammerdiener Fredersdorf meist nur als »der Mensch« bezeichnet.
Dieser »Mensch« war der Graf von Saint-Germain.
Wer Saint-Germain in Wirklichkeit gewesen ist, weiß niemand.
Einige halten ihn für den Sohn eines italienischen Steuereinnehmers. Er selbst soll behauptet haben, er sei der Sohn eines Fürsten von Siebenbürgen. Er trat unter den verschiedensten Namen auf: als Marquis von Belmar, als Graf Tzagory, als Chevalier Schöning, als Graf Welldone, als Herr de Surmont. Er gab sich so viele Namen, daß man ihm zuletzt ihrer keinen mehr glaubte. Wahrscheinlich war es sein Geheimnis, niemand mehr zu sein.
Es ist dies vielleicht die einzige Art, auf die man noch man selbst sein kann. Doch ist nicht zu vermuten, daß er die Unmenge seiner Namen bloß um dieses Umstandes willen geführt habe. Er wollte sich nur nicht auf die Spur kommen lassen wie wir andern, denen man immerzu auf die Spur kommt. Denn unsere Vergangenheit wird schließlich unvergleichlich stärker als der fortwährende Augenblick, den wir Gegenwart nennen. Das Leben, das wir noch führen, ist nichts gegen unser schon gelebtes Leben, und was wir begangen haben, überwältigt uns zuletzt. Er aber löschte seine Vergangenheit immer wieder aus. Er hatte keine mehr. Dummköpfen freilich, welche glaubten, daß ihre Herkunft alles sei, erzählte er, er habe eine ungeheure Herkunft. Jedenfalls sei er unvergleichlich älter, als man ahnen könne, er besitze ein Elixier, das ihn am Leben erhalte, ja manchmal gab er sogar vor, Christus und die Apostel noch persönlich gekannt zu haben. (Gott allein weiß, was für Zusammenhang zwischen dieser seiner Behauptung, sich »erinnern« zu können, und der gleichen Fähigkeit meines Sohnes bestehen mag.) War er aber in geheimen politischen Missionen tätig, so erzählte er solchen Unsinn natürlich nicht. Er wandelte ihn ab, er sublimierte ihn, er behauptete – was die Leute, mit denen er in solchen Fällen zu tun hatte, vor allem anging – die Zukunft vorauszuwissen.
Denn die Zukunft ist nichts als vorausgespiegelte Vergangenheit, und wenn man sie kennenlernen will, so kommt es darauf an, sie nicht, wie’s die Leute mit der Vergangenheit tun, nach der bloßen Erfahrung zu beurteilen, sondern nach der Notwendigkeit. Wie das Vergangene nicht anders hat geschehen können, als es geschehen ist, kann auch das Zukünftige nicht anders geschehen, als es geschehen wird, und wenn wir’s nicht voraussehen, so ist es unsere Schuld, weil wir nur an das glauben, was geschehen kann, nicht an das, was geschehen muß. Im Innersten wissen wir das Kommende genau voraus; wir dürfen nur nicht fürchten oder hoffen, es könne anders kommen. Vor einigen wenigen von uns aber liegt das Künftige so wehrlos da wie das Vergangene, und ihrer ist der Augenblick.
Es ist klar, daß sich die landläufige Diplomatie diesem gefährlichen Schatten, diesem Saint-Germain, der Frankreich aus der Großen Koalition gegen Preußen herauszusprengen drohte, nicht gewachsen fühlte; und wenn die Verhandlungen schließlich zu nichts geführt haben, so ist es nicht etwa einer Ungeschicklichkeit Saint-Germains oder der Geschicklichkeit seines diplomatischen Gegenspielers Choiseul zuzuschreiben, sondern lediglich dem Umstande, daß die französische Friedenspartei nur eine dilettierende Gruppe, nicht Regierungspartei war, und daß vor allem Friedrich der von der wirklichen französischen Regierung für den Fall eines Friedens geforderten Abtretung von Wesel und Cleve nicht zustimmen wollte.
Einer der heftigsten Zusammenstöße der widereinander streitenden Kräfte fand auf einem Empfange bei dem Spanischen Gesandten statt. Schon der Eintritt des Abenteurers geschah auf die seltsamste Art. Kaum war er nämlich, in einem einfachen braunen, nur mit wenigen Borten besetzten Rocke und einer Weste mit Diamantknöpfen, unter der Tür erschienen, als er den Österreicher von Bernes neben seinem Legationssekretär, Herrn des Esseintes, stehen sah und, statt als ersten den Hausherrn zu begrüßen, vor des Esseintes hintrat und sich tief gegen ihn verneigte. Der Vorgang rief Aufsehen, Getuschel, Gelächter hervor. Des Esseintes meinte, vor Betretenheit in den Boden sinken zu müssen, und der englische Gesandte, York, rief aus: »Was für seltsame Emissäre schickt uns doch der König von Preußen, daß sie die einfachsten Regeln des Anstands nicht kennen!« Erst nachdem es heraus war, fiel ihm ein, daß er damit einen Verbündeten in die Rippen gestoßen hatte.
Saint-Germain aber, indem er nun auch dem Spanier eine mäßige Verbeugung machte, sprach: »Ist es nicht Sitte, sich vor dem vornehmsten Anwesenden zuerst zu verneigen?« Und als ein verblüfftes Schweigen folgte, setzte er hinzu: »Sie, meine Herren, wissen nicht, was ich meine. Aber Herr des Esseintes weiß es genau.«
Dabei sah er den Legationssekretär auf so zwingende Art an, daß dieser, obwohl er, wie er später gestand, durchaus nicht ahnte, was gemeint sein könne, auf zustimmende Art nickte. Eine Gruppe bildete sich sogleich um ihn und bat ihn um eine Erklärung. Da er aber keine zu geben wußte, so versuchte er, sich durch vieldeutiges Lächeln aus der Affäre zu ziehen.
Inzwischen bemühte sich der General York, den Fehler, den er begangen hatte, wettzumachen, indem er sprach: »Herr von Saint-Germain ist uns in unserer Kenntnis von den Rangstufen zweifellos überlegen. Wenn man tausend Jahre und länger gelebt hat, fällt es nicht schwer, zu wissen, woher wir eigentlich stammen.«
»Dazu bedarf es keiner tausend Jahre«, erwiderte Saint-Germain, der mit dem Märchen von seinem Alter hier offenbar nicht aufzuwarten wünschte. »Es genügen dazu meist schon die Geständnisse unserer Mütter.«
Man war freimütig genug, zu diesen Worten zu lachen.
»Nun«, sagte Herr von Bernes, »und was hat Ihnen Ihre eigene Mutter gestanden?«
Diese insolente Frage ließ die ganze Versammlung bald auf Bernes, bald auf Saint-Germain blicken.
»Ich habe es vergessen«, antwortete der Abenteurer, indem ein Schatten über sein Gesicht zog. »Es ist ja, wie Sie gehört haben, auch schon mehr als tausend Jahre her.«
Einiges Gelächter ließ sich vernehmen. Der russische Gesandte jedoch, der seinem Verbündeten an die Seite treten wollte, sprach: »Das ist schade. Denn wenn schon Sie selbst sich nicht entscheiden wollen, von welchem Fürsten, Markgrafen oder Grafen Sie stammen, so hätten Sie uns doch sagen können, ob Frau von Saint-Germain sich wenigstens für einen Steuereinnehmer entschieden hat.«
»Für jemand noch Geringeren«, erwiderte Saint-Germain. »Für einen ganz gewöhnlichen Lakaien, den sie aber freilich erst aus seinen Diensten bei der Zarin in die ihren hat nehmen müssen.«
Dies war eine mehr als deutliche Anspielung auf die geheime Ehe der Kaiserin Elisabeth von Rußland mit ihrem Kammerdiener Razumowskij. Das Gelächter wurde nun ein allgemeines. Der Russe wollte sich empören, doch ward ihm bedeutet, er befinde sich hier nicht auf seiner Steppe. So solle er sich denn über das erfahrene Mißgeschick mit der sonst in aller Welt üblich gewordenen Libertinage hinwegsetzen. Irgendein Harmloser, der die allgemeine Aufgeregtheit tuschen wollte, fragte den Abenteurer, ob es wahr sei, daß er die Heilige Familie noch gekannt habe, und wie sie denn ausgesehen. Der Spanier, der voraussah, daß eine Gotteslästerung folgen werde, bat Saint-Germain dringend, jede Auskunft zu verweigern. Inzwischen ließ Herr von Bernes seinen Grimm an des Esseintes aus, indem er ihm sagte, er verbiete dem Gesandtschaftspersonal ein für allemal, sich für vornehmer auszugeben als das übrige Diplomatische Korps, insbesondere das verbündete. Seine, des Esseintes’, Überhebung werfe das schlechteste Licht auf die ohnedies schon vorhandene Windigkeit seines ausländischen Adels. Des Esseintes, der in einem fort nicht wußte, wie ihm geschah, beteuerte, daß er sich in nichts überhoben habe. – Aus welchem Grunde er dann dem hergelaufenen Intriganten bestätigend zugenickt? fuhr Herr von Bernes ihn an. – Es sei ihm gewesen, sagte des Esseintes, als habe ihn eine sehr starke, fast schmerzende Hand im Nacken ergriffen und zum Neigen des Kopfes gezwungen.
Unterdessen war Saint-Germain auf Herrn d’Affry, den Französischen Gesandten, zugetreten und sprach: »Endlich, mein Herr, kann ich mich auch Ihnen widmen! Es ist nichts unbequemer, als seine Zeit auf die Beantwortung nichtiger Fragen verschwenden zu müssen, die einem nur gestellt werden, weil man berühmt ist – insbesondere wenn dieser Ruhm auf einem Mißverstehen edler Bemühungen durch eitle Neugier beruht, was allerdings fast immer geschieht.«
Damit zog er den Franzosen in eine Fensternische und begann mit ihm ein Gespräch in gedämpftem Tone. Je länger es währte, desto mehr verbreitete sich ein Ausdruck von Befriedigung, ja von Heiterkeit auf seinem Gesichte, so daß Herr von Bernes, der den Vorgang mit wachsendem Ärger verfolgt hatte, sich, statt zu schließen, daß Saint-Germains Angelegenheit schlecht stehe und daß er sich verstelle, zu dem Spanier hinbegab und ihn mit so lauter Stimme, daß es überall zu vernehmen war, fragte, ob er sein Haus weiterhin zur Vorbereitung eines Komplotts zur Verfügung stellen wolle, welches gegen die gerechte Sache, die das Erzhaus vertrete, gerichtet sei. Es folgte im Augenblicke eine betretene Stille, auch in der Fensternische unterbrach man das Gespräch, dann wandte sich Saint-Germain an Herrn von Bernes und sprach:
»Mein Herr, ich hätte dieses Hauses, so sehr ich seine Gastlichkeit zu schätzen weiß, so wenig bedurft, um dem Grafen d’Affry zu sagen, was alle Welt hören kann, wie Ihrer Aufforderung, ein Gespräch, das ohnedies zu Ende ist, zu unterbrechen. Sie nehmen den Auftrag, den Sie hier im Haage haben, zu wichtig. Was verteidigen Sie so leidenschaftlich die Interessen einer Dynastie, deren Schicksal ohnedies beschlossen ist! Ist nicht, zum Beispiel, der Boden, auf dem Sie jetzt stehen, einst im Besitze des kaiserlichen Hauses gewesen? Nun aber gehört er längst den Generalstaaten. Und so wird es auch weitergehen. Denn ich sage Ihnen, mein Herr, es werden selbst die Tage des Namens dieses Herrn des Esseintes hier, von dem Sie so wenig halten, länger währen als die Tage Österreichs.«
Und mit diesen Worten verbeugte er sich und verließ das Haus.