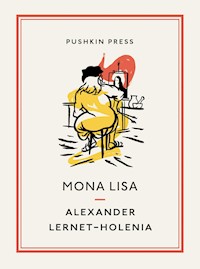11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Es ist noch nicht allzu lange her, daß eine junge Ungarin, Madeleine Farago, geborene Pilath, in zweiter Ehe einen Herrn Spangenberg heiratete, der die meiste Zeit im Auslande gelebt hatte und für vermögend galt. Da man aber nichts weiter von ihm wußte, so fehlte es nicht an Stimmen, die sie vor ihm warnten. Und das mit dem schrecklichsten Rechte, wie ihr bald schien ... (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 270
Ähnliche
Alexander Lernet-Holenia
Die Inseln unter dem Winde
Roman
FISCHER Digital
Inhalt
Statt aufzuzählen, was wie Hut und Mantel
aus Hermelin, wie Spruch und Wappenhalter
den großen Namen, den Du führst, umgibt:
die Herrschaft, die gefürstete, im Kleggau,
das Grafentum von Sulz, die Herzogswürde
Krumau, das Bürgerrecht der freien Schweiz,
den Anspruch auf die Ritterschaft des Vließes,
den Sitz, den erblichen, im Herrenhause
von Österreich – statt allen diesen Titeln,
von denen Zeit die Macht hinweggerafft hat,
laß mich nur eines rühmen, das Du uns
gesagt hast und sie alle überwiegt:
Wenn Du nur könntest, sprachst Du, wie Du wolltest,
und noch die Mittel hättest, würdest Du
das Geistesleben unsres Vaterlands
durch Deine Unterstützung fördern, wie es
den Überlieferungen Deines Hauses
seit je entsprochen hat; und macht Dir auch
die Gegenwart unmöglich, Deinen Willen
ins Werk zu setzen, bitte ich Dich dennoch,
als Dank der Künste und der Wissenschaften
dies Buch aus meinen Händen zu empfangen.
I
Es ist noch nicht allzu lange her, daß eine junge Ungarin, Madeleine Farago, geborene Pilath, in zweiter Ehe einen Herrn Spangenberg heiratete, der die meiste Zeit im Auslande gelebt hatte und für vermögend galt. Da man aber nichts weiter von ihm wußte, so fehlte es nicht an Stimmen, die sie vor ihm warnten. Sie heiratete ihn aber dennoch.
Einige Monate brachte das Paar auf Reisen hin. Inzwischen kaufte Spangenberg in Paris, wo man sich ansiedeln wollte, ein Haus und ließ es umbauen und instandsetzen. Dann riefen ihn Geschäfte nach Spanien; und aus Madrid bat er seine Frau, nach Paris zu kommen und sich dort mit ihm zu treffen. Denn das Haus, berichtete er, sei unterdessen so gut wie fertig geworden.
Er hatte angefügt, daß er sie an der Bahn erwarten werde. Als sie aber am Morgen des festgesetzten Tages aus dem Zuge stieg, ward sie von niemandem erwartet. Sie fuhr also ins Plaza, wo sie und ihr Mann sonst stets gewohnt hatten. Doch wußte man auch dort nichts, oder noch nichts, von ihm; und da er sich auch im Laufe der nächsten Stunden nicht zeigte, so zog sie, beunruhigt, Erkundigungen auf dem Meldeamt ein und erfuhr zu ihrem Erstaunen, er befinde sich zwar schon in Paris, habe aber in einem ganz andern als seinem üblichen Hotel, nämlich in einem zweit- oder drittrangigen Hause, Quartier genommen.
Sie rief dort sogleich an. Spangenberg, hieß es, sei ausgegangen, habe jedoch hinterlassen, daß er in ein paar Minuten zurücksein werde. So eilte sie denn hin. Das Hotel war klein und lag in einem schlechten Viertel. Doch nahm sie sich weder die Zeit, die Häßlichkeit der Gegend, noch die Ärmlichkeit des Hotels zu beachten, und verlangte Herrn Spangenberg zu sprechen. Man wies sie in eine Art von Empfangsraum und bedeutete ihr, Spangenberg werde alsbald erscheinen. Sie war schon im Begriffe zu sagen, daß sie ihn auf seinem Zimmer aufsuchen wolle, denn sie sei seine Frau; eine Befangenheit jedoch, in welche die sonderbaren Umstände dieses Morgens sie versetzt hatten, hinderte sie daran.
Der Empfangsraum war leer, und sie hatte zu warten. Nach einiger Zeit erschien ein Mensch zwischen Fünfunddreißig und Vierzig, mittelgroß, brünett, guten Aussehens, streifte Madeleine mit einem Blick, nahm Platz und begann, eine der aufliegenden Zeitschriften durchzusehen. Dabei schien ihr, daß er sie über den Rand des Heftes beobachte. Doch nahm ihre Ungeduld, ihren Mann endlich zu sprechen, sie zu sehr in Anspruch, als daß das Interesse jenes Menschen vermocht hätte, sie zu beschäftigen.
Es war alles still, nur hin und wieder hörte sie, daß der andre ein Blatt umwendete. Spangenberg jedoch erschien nicht; und nach ein paar Minuten legte der andre seine Zeitschrift zurück auf den Tisch, stand auf und verließ, mit der Andeutung einer Verbeugung, das Zimmer.
Madeleine wartete noch kurze Zeit, dann stand sie gleichfalls auf, trat zum Portier und fragte ihn, wann denn Herr Spangenberg endlich erscheinen werde.
Herr Spangenberg, erwiderte der Portier, sei doch schon dagewesen. Ob sie ihn denn nicht gesprochen habe?
Herrn Spangenberg?
Herrn Spangenberg.
In jenem Zimmer?
In jenem Zimmer.
Aber da sei doch, rief sie, nur jener Herr erschienen, den sie gar nicht gekannt habe.
Das sei eben, entgegnete der Portier, Herr Spangenberg gewesen.
Es war klar, daß der Mensch, der in diesem schlechten Hotel wohnte, zwar gleichfalls Spangenberg hieß, daß aber der andre, ihr Mann, wohl noch gar nicht in Paris angekommen war. Aus irgendwelchen Gründen mochte er sich verspätet haben.
Mit flüchtigem Kopfnicken dankte sie dem Portier und war schon im Begriff, das Haus zu verlassen, als sie sich besann, nochmals zurückwendete und fragte: «Und dieser Herr heißt in der Tat Ferdinand Spangenberg?»
Der Portier warf einen Blick auf das Schlüsselbrett, legte die Hand auf eines der Fächer, das leer war, griff dann unter sein Pult, zog eine Anzahl von Meldezetteln hervor, durchblätterte sie und hob ihrer einen, indem er die Brille auf die Stirn rückte, näher an die Augen.
«Allerdings», sagte er.
Sie suchte, den Blick auf den Zettel gerichtet, aus ihrer Handtasche eine Banknote hervor, legte sie auf den Tisch und streckte die Hand nach dem Zettel aus. Der Portier, nach einem Moment, überließ ihr das Blatt und nahm die Banknote an sich.
Madeleine überflog die Daten, die auf dem Zettel standen, insonderheit aber den Namen des Geburtsortes und die Geburtsdaten des Gemeldeten.
Es waren der Geburtsort und die Geburtsdaten ihres eigenen Mannes.
Sie hätte später nicht mehr zu sagen vermocht, wie sie aus dem Hause gekommen; und als sie wieder auf der Straße war, meinte sie, wie ein Blatt Papier, vom Winde erfaßt, die Häuser entlanggetrieben zu werden. Nirgends vermochte sie sich festzuhalten, nirgends stehenzubleiben, weiter und weiter wirbelte es sie fort. Dazu schien ihr der Lärm der Stadt verzehnfacht, verhundertfacht und gellte gräßlich in ihren Ohren.
Man hatte sie vor ihrer Ehe gewarnt, und nun stellte sich heraus, daß man sie mit dem schrecklichsten Rechte davor gewarnt hatte. Denn wenn diese beiden, ihr Mann und der andere, sich für einen und denselben ausgaben, wenn der eine von ihnen behauptete, der andere zu sein, so konnte es nur geschehen, weil einer von ihnen mit dem Aussatze des Verbrechens bedeckt war. Welcher von den zweien aber? Wahrscheinlich sogar beide. Denn irgendeinem Schuldlosen – so schloß sie in ihrer Verstörtheit –, einem Menschen, an dessen Händen nicht die Spuren einer scheußlichen Tat klebten, widerfuhr es nicht, daß ein anderer von ihm sagen konnte: «Ich bin er»; und ein anderer als ein Verbrecher sagte das von einem andern nicht. Im Falle des einen wie des andern wäre es völlig sinnlos gewesen, es zu sagen, wenn nicht irgendein abscheuliches Geheimnis alle beide aneinandergebunden und zugleich entzweit hätte. Ja offenbar, weil sie sich nun in der gleichen Stadt eingefunden hatten, lag dieses Geheimnis, dieses Verbrechen, nicht bloß irgendwo im Vorleben der beiden, es war immer noch im Gange.
Sie hatte der Stimmen, die sie vor ihrem Manne gewarnt hatten, nicht geachtet, oder vielmehr: sie hatte bloß geglaubt, ihrer nicht geachtet zu haben. Nun aber merkte sie, daß sie dennoch nicht aufgehört hatten, Verdacht in ihre Ohren zu flüstern. Nun erhoben sie sich furchtbar laut und schrien ihr die Gefahr zu, in der sie an der Seite eines Menschen schwebte, der ihr so gut wie unbekannt war. Denn als sie ihn geheiratet, hatte sie von ihm nichts gewußt, und seit sie seine Frau war, hatte sie von ihm nichts erfahren.
Ihre Gedanken begannen mit unaufhaltsamer Schnelligkeit abzulaufen wie das Räderwerk einer Uhr, deren Hemmung zerbricht. Sie jagten dahin wie in einem grauenhaften Traume und rissen alle Ansätze zu vernünftiger Überlegung mit sich fort. Überall entdeckte sie die Möglichkeiten zu neuen Schrecken, und ihr Gehirn arbeitete so unnatürlich schnell, daß wie bei Menschen, die in einen Abgrund stürzen, oder wie bei Ertrinkenden die ganze letzte Zeit ihres Lebens, ja ihr Leben überhaupt, voll von Fehlern, voll von Verwirrungen und entsetzlichem Vorwurf, in einigen wenigen Augenblicken an ihr vorüberflog. Am Ende aber überschlug sich die Woge ihres Denkens, sie dachte überhaupt nicht mehr und empfand nur noch das Tosen ihrer Angst.
Wenn ihr Mann oder wenn der andre, der sich für ihren Mann ausgab, entdeckte, daß sie, und sei es auch nur durch bloßen Zufall, auf die Spur des abscheulichen Geheimnisses gekommen war, das die beiden verband, so mußten sie, dieser wie jener, alles daran setzen, sich der Mitwisserin zu entledigen. Ja selbst wenn ihr Mann auch nichts davon merkte, so war sie an der Seite eines Menschen, der ein Verbrecher sein konnte und wahrscheinlich auch war, ihres Lebens keinen Augenblick mehr sicher. Sie war es niemals gewesen. Doch hatte sie’s nicht gewußt. Nun aber wußte sie’s; und wenn es ihr nicht gelang, ihn von sich abzuschütteln, so war sie verloren.
Auf dem Weg ins Plaza beschloß sie, ihre Sachen zu packen, Paris zu verlassen, ehe ihr Mann angekommen sein würde, und zu ihrer Mutter zurückzukehren. Als sie aber, um in ihr Zimmer zu eilen, aus dem Lift trat, stand Spangenberg vor ihr.
Sein Zug hatte in der Gegend von Orléans einen Unfall gehabt, das heißt: zwei Wagen waren aus dem Geleise gesprungen; und bis der Zug wieder in Fahrt gekommen, hatte es einige Stunden gedauert, während welcher Zeit, da der Vorfall auf offener Strecke geschehen, niemand imstande gewesen war, telegraphisch oder auf anderm Wege Nachricht zu geben.
An der Seite des Menschen, der vor dem Gesetz ihr Mann war und vor dem sie sich mehr fürchtete als vor jedem andern, verbrachte Madeleine den schrecklichsten Tag ihres Lebens; und der Zustand, in dem sie sich befand, ward ihr um so unerträglicher, als Spangenberg die Unruhe, die er ihr anmerkte, für eine Nachwirkung der Sorge um seinen Verbleib hielt und besonders liebenswürdig zu ihr war. Man nahm das zweite Frühstück in einem vortrefflichen Restaurant, und nach Tische besichtigte man das neuerworbene Haas. Der Umbau war so gut wie beendet, und auch dieses und jenes Möbelstück stand schon in den Räumen. In einigen Tagen, sagte Spangenberg, werde man einziehen können. Auch auf die Terrasse trat man hinaus und unternahm einen Gang durch den Garten, der noch verwildert lag. Er war so groß, daß man hätte meinen können, auf dem Lande zu sein. Doch glaubte Madeleine, sie sei nicht auf dem Lande, sondern sie quäle sich durch die Gestrüppe der Unterwelt; und dieser Gang durch die Straßen, die Lokale und über die Rondpoints einer Hölle ward bis zum späten Abend fortgesetzt.
Als man endlich ins Plaza zurückkehrte, begann Madeleine davor zu zittern, dieser Mensch, ihr Mann, der ihr mit einem Male fremder und unheimlicher geworden war als irgend jemand, der sie in einer scheußlichen Gasse angesprochen hätte, könne zudringlich werden. Sie hätte es unmöglich ertragen. Zwar hätte sie keinen Widerstand gewagt; aber sie wäre vor Furcht gestorben. Doch verabschiedete sich Spangenberg von ihr im Salon, der zwischen den beiden Schlafzimmern lag. Dabei schien ihr, daß er über ihr ungewohntes Wesen nicht bloß erstaunt, sondern sogar ein wenig amüsiert sei. Er wußte den Grund davon nicht. Aber wenn er sich auch keinen Reim darauf machen konnte, so erheiterte ihn ihre Unruhe ganz offensichtlich; und daß er sich darüber lustig zu machen schien, erschreckte sie nur noch mehr.
Sie kam aus einfacheren Verhältnissen als er, das war ihr klargeworden; die meisten hübschen Frauen kommen aus einfacheren Verhältnissen als ihre Männer; und ihres Mannes gelassene Art, seine Sicherheit, seine ausgezeichneten Manieren hatten ihn ihr unzugänglicher gemacht, als er eigentlich sein mochte. Sie hatte sich vor allem behindert gefühlt, ihn, etwa um die Zeit, zu der man sie vor einer Ehe mit ihm gewarnt hatte, nach denjenigen Einzelheiten seines Lebens zu fragen, die sie interessiert hätten. Ja im Grunde hatte sie ihn niemals nach irgend etwas Wirklichem zu fragen gewagt; und nun ward sie von der Vorstellung ergriffen, die Vornehmheit seines Wesens sei nichts als die Maske, hinter der sich seine Gefährlichkeit verberge. Denn selbst daß er nicht zudringlich geworden war, schien ihr auf einmal keine bloße Rücksicht auf ihre Nervosität mehr, sondern ein Beweis, daß er wisse, was in ihr vorging.
In ihrem Schlafzimmer blieb sie auf dem Bette sitzen und lauschte verstört in den Nebenraum; und es brauchte eine ganze Zeit, bis sie sich wieder zur Tür wagte, um das Ohr, horchend, an einen der Flügel zu legen. Nebenan war alles still, und auch auf der Straße vor den Fenstern begann der Lärm zu verebben. Sie huschte zu ihrem Kleiderschrank und kleidete sich hastig um, warf ein paar Sachen in einen Handkoffer, lauschte von neuem, nahm einen Mantel um die Schultern, lauschte wiederum, ergriff den Koffer und trat, so leise sie konnte, auf den Gang.
Die dicken Teppiche, mit denen der Gang belegt war, verschlangen alles Geräusch ihrer Schritte. Sie rief nicht den Lift, sondern eilte die Treppe hinab. Als sie die Halle durchquerte, zeigte die Uhr auf halb vier. Sie bestellte einen Wagen, um sich zur Gare de l’Est fahren zu lassen und den ersten möglichen Zug zu nehmen.
«Sie verreisen?» sagte der Nachtportier, während er mit ihr vor das Hotel trat und ein verschlafener Page, mit dem Handkoffer, hinter ihnen dreinkam. «Und Monsieur? Er bleibt?» Sie ärgerte sich, trotz ihrer Verstörtheit, oder eben deshalb, wütend über die französische Art, nach Dingen, die ohnedies augenscheinlich waren, rhetorische Fragen zu stellen. Sie wolle bloß einen Ausflug machen, murmelte sie. Zugleich fuhr auch schon der Wagen vor, sie stieg ein, der Handkoffer ward neben den Fahrer gehoben, und der Portier schloß mit den Worten: «Viel Vergnügen!» den Schlag.
Aber kaum, daß der Wagen in Fahrt war, fiel ihr ein, daß es Wahnsinn sei, was sie tat. Denn diese Flucht mußte den Verdacht ihres Mannes, der ja noch gar keinen wirklichen Verdacht geschöpft hatte, erst eigentlich erwecken. Er würde nun sicher sein, daß sie sein Geheimnis wisse, und alles daran setzen, ihrer wieder habhaft zu werden und ihr den Mund zu verschließen. Sie bei ihrer Mutter zu finden, war für ihn überhaupt nur eine Angelegenheit weniger Stunden.
Wohin also? Anderswohin? Sie hatte zwar einiges Geld zu sich gesteckt, und auch ihren Schmuck, aber wie lange würde das reichen? Zudem hatte ihr Mann, weil er eben ihr Mann war, das Recht, alle Mittel des Gesetzes anzuwenden, um ihren Aufenthaltsort auszukundschaften, und das lief auf dasselbe hinaus, wie wenn er ihr zu ihrer Mutter nachgereist wäre. Wie eine Lähmung fiel diese Erkenntnis auf sie, und ohne einen weiteren Gedanken fassen zu können, wünschte sie nichts andres, als daß wenigstens dieser Wagen immer weiterfahren und nie zum Bahnhof gelangen möchte. Aber der Wagen fuhr mit unheimlicher Schnelligkeit durch die leeren Straßen, der Fahrer – so fand sie zumindest – raste wie ein Betrunkener, und nach wenigen Minuten hielt er vor der Gare de l’Est. Sie stieg nicht aus, sie saß im Fond wie erschlagen, und nach einiger Zeit sagte der Fahrer: «Madame?» Irgend etwas mußte sie nun tun, irgendwelche Entschlüsse fassen – gleichgültig welche; und weil ihr Kopf wie ausgebrannt war, kam sie auf den Gedanken zurück, den sie von allem Anfang gehabt, aber immer wieder verworfen hatte. Doch fiel ihr nichts andres mehr ein. «Fahren Sie mich zu einem Polizeikommissariat», verlangte sie. «Zu irgendeinem.» Und der Wagen setzte sich aufs neue in Bewegung.
Sie empfand es als ungeheure Erleichterung, daß man wenigstens wiederum fuhr. Sogleich aber kamen auch ihre Gedanken wieder in Gang und begannen zu toben, nur in verkehrter Richtung, und fuhren fort, den Entschluß zu zerpflücken, den sie gefaßt hatte und den sie nicht hatte fassen wollen, weil sie ihn ja auch bishin abgelehnt. Denn was konnte sie auf dem Kommissariat vorbringen? Daß es zwei Menschen gab, von denen der eine ihr Mann war, und daß beide vorgaben, einer und derselbe zu sein? Gut, man würde den Fall untersuchen. Aber es war ganz unwahrscheinlich, daß man sogleich zu einer Verhaftung schritt; und wenn man damit zögerte, so würden beide, wenn man aber den falschen verhaftete, so würde der, der noch in Freiheit war, ihr ans Leben gehen. Zudem fürchtete sie sich zwar vor ihrem Manne wie vor nichts auf der Welt, aber er war schließlich ihr Mann, sie wußte nicht, ob er wirklich schuldig war, und sie liebte ihn oder hatte ihn zumindest geliebt, ja soviel Furcht sie auch vor ihm empfand, so sehr fühlte sie, daß sie ihn immer noch liebe. Man sagt, daß Liebe mit Mitleid zu tun habe. Es ist ebensogut möglich, ja es ist sogar wahrscheinlich, daß sie auch mit Angst zu tun hat und überhaupt mit jedem starken Gefühl, dessen ein Herz fähig ist: mit Haß, mit Erbarmen, mit Grausamkeit und mit der Lust jedes Wesens, sich selbst aufzugeben. Liebe ist eine Erregung, ein Außersichkommen des Herzens schlechthin, gleichgültig wodurch es erregt wird, wodurch es außer sich selbst gerät; und sie sagte sich, daß ihr Mann, ob er nun schuldig oder schuldlos war, ihr niemals verzeihen werde, wenn sie sich nicht an ihn, sondern an fremde Leute wendete, ja sie gestand sich, daß auch sie selber nie wieder fähig werden könne, sich’s zu verzeihen.
Sie starrte durch die Wagenfenster. Es dämmerte längst, ja der Tag hatte bereits begonnen. Die Droschke fuhr an den Hallen vorüber, Marktwagen luden Obst, Gemüse, Blumen ab. Die Farben leuchteten stark, und weiße Tauben mit purpurfarbenen Füßen schritten zwischen den Abfällen auf dem Pflaster umher. Ein zarter Dunst spann sich um die Dächer der Häuser und schwebte gegen den gereinigten Himmel, der sich wie eine Kuppel aus Perlmutter über der Stadt wölbte. Aber all dies sah sie nicht, vor ihren Augen bildeten die Farben einen Wirbel wie in den Kaleidoskopen, in die sie als Kind geblickt.
Wenn nicht sie selber zu ermitteln vermochte, wer von den zweien der Schuldige war, ihr Mann oder der andre, oder wenn es ihr nicht gelang, zu erfahren, wer von beiden mehr Schuld hatte, wenn nicht sie selbst fähig sein würde, das Geheimnis zu entdecken, das die beiden verband, wenn sie andre damit befaßte, ihm auf die Spur zu kommen, so war vielleicht wohl nicht ihr Leben, aber es war alles andre verloren. Die Intimität, auf die sie sich durch die Ehe mit ihrem Manne eingelassen hatte, duldete keine andere Lösung – ja fast fühlte sie sich als die Frau beider Männer. Es lag ein vollkommen schrecklicher Reiz in dieser Vorstellung. Nicht daß sie sich dessen bewußt gewesen wäre; aber sie fühlte es in jeder Ader. Zu lösen, wirklich zu lösen, mochte das Rätsel, in das sie verstrickt war, nur in den sinnlichen Distrikten der Seele sein, wo sich die Menschen einander ganz hingaben.
Sie rief dem Fahrer zu, er solle ins Plaza zurückkehren. «Ah», sagte dort der Portier, «Madame ist schon wieder zurück?» Sie hatte nicht einmal mehr die Kraft, sich darüber zu ärgern. Sie erreichte ihr Zimmer, warf den Handkoffer in den Kleiderschrank, schlug den Schrank zu, streifte die Kleider ab und ließ sich in ihr Bett fallen. Sie vermochte überhaupt nichts mehr zu denken, alle ihre Gedanken waren wie abgerissen, und sie verfiel in einen Schlaf, der einer Betäubung glich.
II
Sie erwachte erst gegen Mittag und hatte alle Mühe, sich der Ereignisse des Vortags zu erinnern. Vor allem begriff sie die Schrecklichkeit dieser Ereignisse nicht mehr. Ihr Gefühl hatte sich, zumindest für eine Zeit, daran abgestumpft, ja erschöpft, oder die Dinge selbst hatten alle Schrecken, deren sie fähig waren, verschwendet: jedenfalls war nun, oder es schien zumindest, alles mit einem Male ganz anders. Der Sommerwind, der nach den Blüten aus den nahen Anlagen duftete, wehte in die Fenster und spielte mit den Vorhängen, wie zu den Tönen eines melodischen Instruments von ungeheuren Ausmaßen war der Straßenlärm zusammengestimmt, Spangenberg erschien, setzte sich zu ihr ans Bett und plauderte lächelnd mit ihr, und sie vermochte ihm fast so unbefangen Antwort zu geben wie an jedem andern Morgen vor dem gestrigen gräßlichen Tage. Zwar war sie sich der Gefahr, in der sie schwebte, noch immer bewußt; aber offenbar hatte sie schon angefangen, sich daran zu gewöhnen. Sie hatte ihre Fassung sogar so weit wiedergewonnen, daß sie, während sie mit ihrem Mann sprach, ihre Gedanken zu sammeln vermochte; das heißt: sie dachte, seit vierundzwanzig Stunden, zum ersten Male wirklich.
Insbesondere war sie gestern von der Vorstellung in sinnlose Angst versetzt worden, daß ihr Mann und der andre, der vorgab, Spangenberg zu sein, oder daß ihr Mann, der vorgab, der andre zu sein, in die gleiche Stadt gekommen wären, um einander zu treffen und ihre Verbrechen fortzusetzen. Nun aber sagte sie sich, daß eine solche Vermutung unsinnig sei. Denn was hätte es, nicht zwar wie in dem Falle, wo jeder von ihnen für den andern gelten wollte, aber was hätte es, für die beiden, für Zweck gehabt, als eine und dieselbe Person zu gelten? Sie befanden sich ja wohl kaum in der Lage etwa eines überbeschäftigten Monarchen, der, zum Beispiel, ein Kriegsschiff tauft, während sein sogenanntes Double gleichzeitig eine Ausstellung eröffnet. Sie drehten auch keinesfalls einen von jenen Filmen, bei denen das Double die gefährlichen Passagen aus der Rolle des eigentlichen Schauspielers zu übernehmen hat. Wahrscheinlich war’s überhaupt bloß Zufall, daß sie sich nun am gleichen Orte befanden, wahrscheinlich, wenn anders sie dieses Zusammentreffen geahnt, hätten sie Paris sogar gemieden. Denn das Verbrechen, das sie verband, konnte nur in der Vergangenheit liegen. Vielleicht waren sie zwar, jeder einzeln und für sich, bereit, neue Verbrechen zu begehen; bestimmt aber waren sie nicht mehr zur gemeinsamen Fortsetzung dessen bereit, was schon längst zurücklag. Von ihrer vorgetäuschten Identität hatten sie ja keinen Vorteil mehr, sie gefährdeten einander dadurch nur wechselseitig, und offenbar geschah es überhaupt auch gar nicht freiwillig, daß sie vorgaben, sie seien einer und derselbe. Irgendein Ereignis, das nur ihnen selber genau bekannt war, mochte sie dazu veranlaßt, ja vielleicht sogar dazu gezwungen haben. Denn wenn schon einer von ihnen eine falsche Identität angenommen hatte, oder wenn sie’s sogar beide getan hatten, welchen Zweck hätte es gehabt, nicht eine erfundene, sondern die Identität eines andern, obendrein noch lebenden Menschen anzunehmen? Es handelte sich dabei wohl um den wirklichen Namen und die wirklichen Daten des einen von den zweien; es konnte aber auch sein, daß sie sich Namen und Daten einer dritten – sei’s nun einer wirklichen, sei’s einer erfundenen – Person zu eigen gemacht hatten. Hatten sie das nun getan, hatten sie’s nicht getan? Und wenn sie’s getan hatten, welche dieser Möglichkeiten mochten sie gewählt haben? Doch behaupteten sie ja nicht, die Söhne etwa eines englischen Herzogs zu sein, um in einen Titel oder in ein großes Erbe eintreten zu können. Immerhin gab ihr der Name Spangenberg zu denken. Sie zerbrach sich den Kopf, ob sie jemals von einer bedeutenden Familie dieses Namens gehört hätte; aber mit Ausnahme einer geborenen Gräfin Spangen von Uyternesse, der Frau eines Gutsbesitzers bei Stuhlweißenburg, kam ihr nicht gleiches oder ähnliches in den Sinn.
Dagegen fiel ihr eine andre Sache ein, die seltsam genug war. Sie kannte nämlich eine Baronin Leerodt, die ihren Mann, einen Obersten, der, obwohl Deutscher, in der österreichischen Armee diente, früh verloren hatte. Wenigstens aber war ihr, aus dieser Ehe, ein Sohn geblieben. Mit diesem Sohn allein jedoch gab sich die Leerodt nicht zufrieden, und einige Jahre nach des Obersten Tode fühlte sie sich wiederum Mutter. Sie heiratete sohin zum zweiten Male, und zwar einen Seeoffizier aus einer Emigrantenfamilie, einen gewissen Dupont. Allein diese Ehe war eine denkbar unglückliche, oder vielmehr: es war eigentlich überhaupt gar keine Ehe. Denn schon unmittelbar nach der Trauung war Dupont, glitzernd vom Golde der Epauletten und Borten seiner Gala, alleine in einen Wagen gestiegen und davongefahren, und seine ihm eben erst angetraute Gattin sah ihn nicht wieder. Sie brachte aber wenige, allzu wenige Monate später einen Sohn – ihren zweiten – zur Welt, und von diesem Sohne hieß es, daß er gar nicht von Dupont sei. Der wirkliche Vater des Kindes nämlich – so sagte man – habe die Leerodt nicht heiraten können, weil er Malteserritter und, durch Gelübde, zur Keuschheit verpflichtet gewesen sei. Das stimmte zwar nicht ganz – weder in bezug auf das Rittertum, denn er war nur Ehrenritter der Malteser gewesen und konnte, im großen und ganzen, tun und lassen, was er wollte; und schon gar nicht – wie figura gezeigt hatte – stimmte es in betreff der Keuschheit. Doch so oder so, er hatte die Leerodt nicht geheiratet. Was jedoch den Schiffsleutnant Dupont veranlaßt haben mochte, die Leerodt zu heiraten, blieb unklar, bis der Umstand, daß er wenig später, unter Verlust seines Ranges, aus der Marine zu scheiden genötigt war, den Verdacht bestätigte, er habe sich, bewußt und offenbar auch nicht unentgeltlich, als Stellvertreter für den Malteser brauchen lassen.
Gleiches oder Ähnliches mochte schon öfter geschehen sein, und soweit war denn auch nichts allzu Ungewöhnliches an dem Falle. Was aber in der Tat für absonderlich, ja unglaublich gelten konnte, war dieses:
Hinter dem schlichten Namen Duponts verbarg sich eine große Herkunft. Denn obwohl die Duponts unbedeutenden Standes waren, behaupteten sie, in denselben nur hineingeglitten zu sein, vorzeiten aber du Pont à Mousson geheißen und das gleichnamige Marquisat in Lothringen, nicht weit von Metz, innegehabt zu haben. Dies jedoch sei aus dem Anlasse der Emigration verlorengegangen. Ja woferne den Überlieferungen der Familie wirklich zu trauen sein mochte, war der erste Marquis du Pont sogar der natürliche Sohn eines Herzogs von Bar, aus dem Hause Capet, gewesen.
Man hätte nun meinen sollen, daß der vorgebliche Sohn Duponts, der, weil er eben nicht der Sohn Duponts war, auch weder aus dem Marquisat «an der Brücke, unter der das Wasser schäumte», noch von den Capetingern stammte, auf keinerlei gleich oder ähnlich hohe Herkunft hätte pochen können, wenn er seinen wahren Vater in Rechnung stellte. Doch stand es dann womöglich sogar noch besser um ihn. Denn zufolge eines abenteuerlichen Spieles des Zufalls leitete sich auch sein wahrer Vater, ein Baron Kraig, aus einem Hause her, das wohl ebenso berühmt, wahrscheinlich aber sogar noch berühmter war als das seines Ehestellvertreters. Er stammte nämlich von einem natürlichen Sohne des Kaisers Maximilian des Ersten, der, um das Jahr 1500, jenen seinen Bastard, einen Herrn Viertaller oder Fierthaler, mit der Standesherrschaft Kraig in Kärnten belehnt hatte; und auch noch in neuerer Zeit waren die Kraiger vom Erzhause stets ein wenig kajoliert worden – vielleicht nicht einmal so sehr aus wirklicher Neigung wie aus einer Art von Unsicherheit des Gewissens; denn das Erzhaus hatte wenig wirkliche Neigungen – es war bloß nicht mehr so habsburgisch wie die Kraiger selbst, sondern längst schon lothringisch. Der junge Dupont war also, offiziell, zwar immer noch nichts weiter als der junge Dupont; wenn es ihm aber Vergnügen machte, so konnte er sich schmeicheln, auf die Lilien nur verzichtet zu haben, um sie gegen den Doppeladler einzutauschen; und der Streit in seinem Busen, welchem von den zwei Emblemen der Vorzug zu geben sei, war nicht jetzt und hier, sondern nur in der Antike und in Troja zu schlichten, woher die beiden Häuser seiner Herkunft, Frankreich sowohl wie Österreich, ebenso mythologischer wie übertriebener Weise zu stammen glaubten.
Der Fall war so unwahrscheinlich, daß selbst die abgebrühtesten Genealogen die Köpfe schüttelten und daß man darüber nur hätte lachen können, wäre er, zumindest für Frau Dupont, trotz oder eben wegen ihrer feinen Nase für souveräne Häuser, nicht so traurig gewesen. Aber traurig oder lächerlich, Madeleine mußte sich sagen, daß die Wiederholung eines solchen Ereignisses so gut wie ausgeschlossen war. Zudem wäre ihr ein derartiges Spiel des Schicksals mit lauter natürlichen Söhnen und Abstammungen, auf die niemand mehr Wert legte, auch von keinerlei Nutzen gewesen; denn ihr eigener Fall, oder vielmehr der Fall ihres Mannes, war offensichtlich ein ganz andrer, und ihre Gedanken schienen ihr rechte Backfischphantasien. Man wird nicht mehr so ohne weiters von Baronen, die auf ihre Titel verzichtet haben, oder gar von Prinzen ohne Land geheiratet. Überdies hatte ihr Mann ja auch nicht einmal behauptet, von Adel zu sein. Vielmehr stand zu vermuten, daß der eine von den beiden Männern den Namen des andern nur deshalb angenommen, weil er nicht gewußt hatte, daß der andre noch lebte. Was aber war der wirkliche Grund gewesen, aus dem der eine, überhaupt, sein eigenes Selbst aufgegeben und das des andern angezogen hatte wie ein fremdes Kleid?
Nicht daß ihr Mann ihr von seinem Vorleben gar keine Andeutung gemacht hätte; aber er hatte ihr immer nur die eine oder die andre belanglose Einzelheit erzählt und sich nie auf Zusammenhänge eingelassen. Nun entschloß sie sich endlich, geradewegs zu fragen.
Er sah sie einen Augenblick gedankenvoll an, dann sagte er: «Interessiert dich denn das wirklich? Es gibt vielleicht nur einen interessanten Umstand im Leben, nämlich das Zukünftige. Das Vergangene aber ist vergangen und ganz uninteressant geworden. Ich bin viel gereist, das ist wahr; aber wer ist denn heutzutage nicht gezwungen, viel zu reisen! Der Bauer reist in die nächste Stadt, der Kaufmann um die Welt; doch von all den Reisen, die man tut, seien es nun die von andern oder seien es die eigenen, gibt es nichts Wesentliches zu berichten. Früher war das vielleicht anders – jetzt aber sind fremde Länder wie das eigene Land geworden, nur sind sie ausländisch, und fremde Leben sind wie das eigene Leben, nur sind sie fremd. Ja sogar mein eigenes Leben habe ich – vielleicht nicht ohne Absicht, ich gebe es zu – bis zu dem Augenblick vergessen, seit welchem ich dich liebe. Erst seit ich dich liebe, lebe ich.»
Dabei küßte er ihr die Hände.
Sie hätte darauf schwören mögen, daß er ihr in diesem Augenblick, ebenso höflich wie zurückhaltend, die Hände küssen werde. Dahinter verbarg sich ein Wesen, das viel gefährlicher sein konnte als alle Unbeherrschtheit eines Leidenschaftlichen. Sie schwieg einen Moment, um ihr Erschauern zu verbergen, dann sagte sie:
«Aber ich habe dich ja eigentlich gar nicht fragen wollen, was für ein Leben du geführt hast.»
«Sondern?»
«Sondern wer du bist.»
«Niemand», sagte er, indem er den Blick von ihr abwandte und aus dem Fenster sah, «niemand ist etwas andres als das, was er gelebt hat. Er ist nicht mehr und nicht weniger, als was er aus den Umständen gemacht hat – oder was die Umstände aus ihm gemacht haben.»
«Aber wer seid ihr denn eigentlich, du und die Deinen, von denen du mir nie erzählt hast? Wer waren, zum Beispiel, deine Eltern?»
Sie hatte das Gefühl, auf keine sehr geschickte Art gefragt zu haben. Denn die Namen seiner Eltern kannte sie ja aus den Heiratsdokumenten. Doch hatte freilich nicht dabeigestanden, was sie gewesen waren. «Ach so», sagte er. «Nun, mein Vater war der Sohn eines wenig bemittelten Ehrenmannes, der sich als Senatspräsident einen Namen gemacht hatte. Es war das Geschäft meines Großvaters, diejenigen zur Verantwortung zu ziehen, deren Geschäfte weniger ehrenhaft waren als das seine. Damals hatte er noch nicht allzuviel zu tun – der Welt fehlte noch so gut wie jede Gelegenheit zur Unehrenhaftigkeit; heute jedoch hat sie deren im Übermaß, und der arme Mann, wenn anders er noch lebte, vermöchte seinen zahllosen Verpflichtungen wohl kaum mehr nachzukommen. Aber schon sein Sohn, mein Vater, machte sich’s einfacher und heiratete ziemlich vermögend. Meine Mutter brachte ihm, unter anderem, ziemlichen Waldbesitz in Oberösterreich zu. Doch verkaufte er ihn schließlich wieder und starb in der Stadt.»
Sie fand, daß diese Schilderung der Zustände in seiner Familie nicht eben aufschlußreich sei.
«Und», sagte sie, «sein Großvater wiederum … ich meine, wo kam der her?»
Es war ihr von neuem ganz ungeschickt von den Lippen gekommen. Denn wie konnte eine Frau sich bloß für ihres Mannes Urgroßvater interessieren!
«Das weiß ich nicht mehr so genau», lächelte er. «Ich weiß nur, daß wir, letzten Endes, aus Augsburg gekommen sein sollen. Es gibt da auch noch ein Haus, das ‚zum Spangenberg‘ heißt, obwohl weit und breit kein Berg zu sehen ist und das Haus auch nicht einmal auf einem Hügel liegt, sondern am großen Marktplatz. Eines Tages, als ich noch ein Kind war, nahm mich mein Vater mit auf eine Reise, wir kamen dabei auch nach Augsburg und besichtigten das Haus. Es machte einen prächtigen Eindruck auf mich, denn es war, außen und innen, ganz mit Malereien und goldenen Arabesken bedeckt. Es muß das Haus reicher Leute gewesen sein. Aber natürlich ist es längst nicht mehr in unserm Besitz. Bist du nun zufrieden mit den Auskünften, die ich dir über mich gegeben habe?»
Es klang wie Spott.
Mit seiner Herkunft aus einer großen Familie, in der es noch etwas zu erben gegeben hätte, war es also, trotz des freskenbedeckten Renaissancehauses in Augsburg, offensichtlich nichts; und da sie zudem überzeugt war, sich durch ihre Fragen nur bloßgestellt zu haben, so brach sie das Gespräch ab und bat ihn, sie alleinzulassen. Denn sie wolle, sagte sie, aufstehen und sich ankleiden.