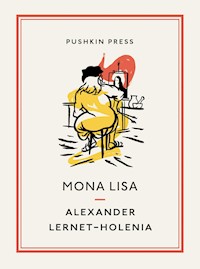11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Wien – Westbahnhof: Ein Taxichauffeur nimmt einen Fahrgast aus dem Pariser Spätzug auf, den er ins Hotel Bristol bringen soll. Unterwegs bekommt er plötzlich auf seine Fragen keine Antwort mehr und stellt fest, daß er einen Toten durch die nächtliche Stadt fährt. Er hat keine Schüsse gehört, niemanden gesehen. Wird die Polizei ihm glauben, wenn er den Unbekannten auf dem Revier abliefert? Werden sie ihn nicht festnehmen? Was wird aus dem Chauffeur, diesem anständigen Menschen, der Ruf und Existenz in Frage gestellt sieht und der von dem grausigen Ereignis getroffen worden ist wie von einem Steinwurf? Lernet-Holenia verstrickt den Leser in einen Wirbel wilder Begebenheiten, in ein tolles Gewebe von Abenteuern, geknüpft von einer ironischen und geistreichen Phantasie. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 232
Ähnliche
Alexander Lernet-Holenia
Ich war Jack Mortimer
Roman
FISCHER Digital
Inhalt
1
Auf dem Hohen Markt, hinter einer Front von Mietwagen, die, nebeneinander aufgefahren, an der Fahrbahn standen, unterhielten sich in Gruppen die Chauffeure, plauderten und rauchten Zigaretten.
Schwärme von Tauben, graue, schillernde und purpurfüßige weiße, pickten zwischen den Verkaufsständen die Abfälle vom Pflaster des hügelig ansteigenden Platzes oder flatterten von Zeit zu Zeit auf, um oben zu kreisen und sich auf die Simse der Häuser, insbesondere eines rosenrot getünchten Palais, niederzulassen, auf dem die meisten von ihnen nisteten.
Der Himmel war trüb. Die Fensterreihen blinkten wie erblindetes Silber. Überall roch es nach Gemüse, Blumen und Obst.
Es war ein lauer Tag im November.
Zwei Wagen am linken Ende der Aufstellung verließen, mit Fahrgästen, rasch nacheinander den Platz, und schon rief jemand den Namen auch des nächsten Fahrers, der, im offenen Mantel und mit aufgestützten Ellbogen, an der Balustrade des Denkmals lehnend, das dort steht, mit einigen andern sich unterhielt.
Er war ein junger Mensch von etwa dreißig Jahren, mit brünetten Brauen und mit Augen von fast schwarzem Blau.
Er tat, als er sich rufen hörte, rasch noch einen Zug aus seiner Zigarette, warf sie fort und eilte, den Mantel schließend, seinem Wagen zu.
Eine Dame in einem dunklen, zart gestreiften Kostüm, einen Fuchs um die Schultern, war eben im Begriff einzusteigen. Einen Fuß hatte sie schon mit einer Bewegung, die entzückend war, auf das Trittbrett gesetzt, in der behandschuhten linken Hand hielt sie, geöffnet, ihre Tasche und sah sich im Spiegel an, mit der rechten, bloßen, richtete sie sich das Haar unterm Hut zurecht.
Sie mochte kaum zwanzig sein; sie war gut, wenn auch mit einer Spur jener Nachlässigkeit gekleidet, die bei ganz jungen Mädchen so reizend ist.
Mit dem kleinen Finger verwischte sie nun die Schminke auf ihren Lippen und sah ihren Mund prüfend an, als der Chauffeur eben herantrat. Er konnte ihr Gesicht nicht sehen. Er sah es, hinter ihr stehend, nur einen Augenblick lang im Spiegel. Große, graue Augen, unter dem Rand eines kurzen Schleiers, blickten ihm entgegen, als sie den Spiegel hob, um zu sehen, wer hinter ihr stünde.
Der Chauffeur verbeugte sich, trat zurück und zog den Schlag auf.
„Prinz-Eugen-Straße 62“, sagte sie, ohne sich umzuwenden, und die Tasche schließend, schob sie sie unter den Arm und stieg in den Wagen.
Der Chauffeur drückte den Schlag zu. Zwei andere, während er sich an den Volant setzte, machten ihm Zeichen.
Indem er den Motor anspringen ließ, sah er sie fragend an.
„Hübsch!“ deuteten sie.
„Wie?“ fragte er, als verstünde er nicht.
Die zwei zeigten in den Wagen.
Er murmelte irgend etwas und machte, daß er weiter kam; denn schon als er auf die Fahrbahn einbog, stieg ihm eine Röte ins Gesicht.
Die zwei, die seine Verlegenheit bemerkt hatten, grinsten ihm nach.
Als er den großen Gang im Wagen hatte, fuhr er sich mit der freien Hand über die Stirn.
Er war nun schon mitten im Gewühl der Straße.
Trotzdem wendete er plötzlich kurz den Kopf zurück, konnte aber, weil die Scheiben blendeten, das Mädchen im Fond nicht sehen.
Nach ein paar Augenblicken griff er nach dem Spiegel am Windschutz und drehte ihn langsam hereinzu, bis er sie sah.
Sie saß mit überschlagenen Beinen, hielt die Tasche auf dem Schoß und blickte aus dem Fenster.
Er mußte an der nächsten Straßenkreuzung anhalten. Er saß und starrte, während er hielt, in den Spiegel. Auch im Weiterfahren blickte er immerzu hinein.
Demzufolge stieß er in der Kärntnerstraße fast mit einem andern Wagen zusammen, der aus einer Seitengasse hervorkam. Er hielt aber, im letzten Moment noch, mit einem heftigen Ruck an, und der andere Fahrer, kopfschüttelnd, bog vor ihm herein. Er folgte ihm dichtauf, bis der andere, knapp bevor man zur Oper kam, anhielt, was er neuerlich übersah, indem er ihm, ehe er zum Stehen kam, den Wagen mit dem Stoßfänger noch eine Handbreit weiterschob.
Der Vordere drehte sich laut fluchend um, stieg aus und rannte nach rückwärts, um nachzusehen, was geschehen sei, und auch der Schutzmann, der an der Kreuzung stand, kam, als er die Szene sah, herbei.
„Er kann nicht fahren!“ schrie der Gerammte, indem er den Benzintank seines Wagens abgriff, „er wäre auch schon vorhin fast in mich hineingerannt!“
„Wie heißen Sie?“ rief der Schutzmann.
„Ferdinand Sponer“, gab der junge Mensch betreten an. Da sich aber herausstellte, daß weiter nichts passiert sei, so winkte der Schutzmann, weiterzufahren. „Passen Sie besser auf!“ befahl er, indem er an seinen Platz zurückkehrte, und der andere Chauffeur stieg, immer noch fluchend, wieder auf seinen Sitz. Sponer aber wendete sich herum und sagte zur Schönen in seinem Wagen: „Verzeihen Sie vielmals!“
„Warum“, rief sie ihm aus dem Fond zu, „sind Sie denn nicht über die Seilerstätte, wenn Sie schon nicht fahren können?“
Die Seilerstätte ist eine ruhige Parallelgasse zur Kärntnerstraße, mit wenig Verkehr.
„Ach, ich kann ja fahren“, murmelte er und lächelte unsicher.
„Vorwärts!“ schrie der Polizist. Der vordere Wagen war inzwischen schon weg. Hinter Sponer stauten sich die andern. Er drehte sich hastig wieder nach vorn und brachte den Wagen in Gang. Bei der Oper bog er nach links in die Gasse hinterm Grand-Hotel, dann nach rechts, kam über die Ringstraße, überquerte, nun mit stets wachsender Schnelle, den Schwarzenberg platz und raste, in großem Stil, die Prinz-Eugen-Straße hinauf. Bei Nummer 62 wendete er im Schwung herum und hielt, mit der Richtung wieder gegen die Stadt zu, vor dem Hause an.
„Entschuldigen Sie nochmals!“ sagte er, als die Schöne ausstieg. Sie zahlte, warf ihm einen Blick zu und schüttelte den Kopf. Er versuchte wieder zu lächeln. Sie wandte sich ab und schritt auf das Haustor zu. Die Bewegung, mit der sie den in das große Tor eingelassenen kleinen Flügel aufschob, war wundervoll.
Er sah ihr nach, bis der Flügel hinter ihr wieder zufiel.
Dann starrte er das Tor an.
Nach einigen Minuten bemerkte er, daß er das Geld noch immer in der Hand hielt, wie er es genommen.
Er brachte den Wagen in Gang, führte ihn aber nur ein paar Schritte weiter, hielt dann wieder an und stieg aus. Nachdem er ein paar Momente neben dem Wagen zögernd gestanden, ging er auf das Haustor zu und trat gleichfalls ein.
In der hohen, holzgepflasterten Einfahrt, durch deren anderes gläsernes Tor ein verwildernder Garten hereinwinkte, sah er rechts die Portierloge, links die offene Tür zum Treppenhaus.
Eine mächtige, vergoldete Laterne hing vom dekorierten Plafond, und kleine Gehsteige führten rechts und links von der Einfahrt nach rückwärts.
Er trat in das Treppenhaus und blickte den hohen, weiten Schacht, in dem die Treppe sich um den Lift schlang, hinauf. Kein Schritt war mehr auf den Stufen und auf den Treppenabsätzen zu hören.
An der Wand hing ein schwarz poliertes, gerahmtes Brett mit numerierten weißen Klingelknöpfen. Unter jedem der Knöpfe war eine Visitenkarte mit dem Namen der Parteien eingelassen, zu denen die Leitungen führten.
Er las die Namen, indem er, weil es hier unten schon ziemlich dunkel war, ein Streichholz anriß. Offiziere, Beamte, Aristokraten, dazwischen auch, irgendwie auffällig, ein Industrieller, wohnten im Hause.
Er versuchte sich vorzustellen, wer von diesen Leuten eine Tochter haben könne wie die Schöne, die er hergebracht hatte, oder zu wem von ihnen ein Mädchen wie sie gegangen sein mochte, in einem dunkelgrauen Kostüm, mit einem Fuchs um die Schultern, oder wen eine junge Dame, sehr gut, wenn auch mit einer leichten, bezaubernden Spur von Nachlässigkeit gekleidet, hier besucht haben könne.
Aber die Namen verrieten nichts.
Sie verrieten nicht, in welche der Wohnungen sie gegangen war, oder was sie dort tat, ob sie nun bei ihren Eltern war oder bei Bekannten, mit denen sie Tee trank, oder bei einem Freund, der sie umarmte und den sie küßte.
Das Streichholz brannte zu Ende und versengte ihm die Finger. Er ließ es fallen, trat es aus und stand im Halbdunkel.
Schließlich verließ er das Treppenhaus, blieb einen Moment lang unschlüssig vor der Portierloge stehen und trat ein. Er öffnete die Glastür, durchschritt die Loge und klinkte die Wohnungstür auf. Zwei Stufen führten in eine Art von Küche oder Wohnzimmer hinab.
Ein Kind spielte mitten im Raume, und neben der Tür, an einem mit blau gemusterter Leinwand überzogenen Tisch, saß, bei Licht natürlich, eine Frau von etwa fünfundvierzig und tat, was Portiersleute in ihren Wohnungen stets tun: bei Licht dasitzen, Kaffee trinken, Zeitung lesen und an familiäre Angelegenheiten denken.
Sie blickte, als Sponer eintrat, auf.
„Ist hier nicht“, fragte er, „eine junge Dame ins Haus? Vor fünf Minuten etwa.“ Und als sie ihn ansah: „In einem grauen Kostüm, mit einem Fuchs.“
„Warum?“ fragte die Frau, tunkte ein Stück Semmel in den Kaffee und sah wieder in die Zeitung.
„Ich habe einen Brief für sie.“
Die Frau streckte die Hand aus, um ihn in Empfang zu nehmen.
„Persönlich abzugeben“, erklärte er.
„Zweiter Stock rechts“, sagte die Frau, „Gräfin Dünewald.“ Und sie steckte den Bissen in den Mund und blätterte die Zeitung um.
So? dachte er. Eine Gräfin? Wahrscheinlich die Tochter. Und indem er der Portiersfrau in die Zeitung blickte, in der Mordtaten in Federzeichnung dargestellt waren, sagte er: „Nein, nicht die …“
„Die was?“ fragte die Frau.
„Nicht die Gräfin.“ Und es fiel ihm ein, in seinen Taschen zu suchen und irgendeinen Brief hervorzuziehen. Er tat, als sähe er die Adresse nach.
„Die Nichte?“ fragte die Frau.
„Jawohl“, sagte er auf gut Glück, „die Komtesse.“
„Die ist ja gar keine Komtesse.“
„Nicht? Nun“, meinte er, „es steht ja auch nicht hier. Aber scheinbar ist es doch die Nichte.“
„Zeigen Sie her“, sagte sie und streckte die Hand wiederum nach dem Brief aus.
„Nein“, meinte er, „ich möchte wissen, ob der Name stimmt.“
„Raschitz?“
„Ja“, sagte er, denn es blieb ihm nun nichts übrig, als es zu bestätigen. „Und der Vorname?“
Sie wollte wiederum in den Brief sehen.
Er steckte ihn ein. „Es wird schon stimmen“, meinte er. Den Vornamen bekam er nicht heraus. „Zweiter Stock rechts also?“ sagte er. „Danke.“ Und er schob die Kappe zurecht und ging. Sie sah ihm nach, er merkte es, als er die Logentür schloß. Sie war neugierig geworden und an die Wohnungstür getreten. Er mußte also so tun, als wollte er hinauf, den Brief abgeben. Er trat in das Treppenhaus, ging ein paar Stufen hinauf und blieb stehen. Es fiel ihm aber ein, daß er wirklich hinaufgehen könne. Er ging also weiter treppauf. Im zweiten Stock, an der Tür rechts, sah er eine Messingtafel, darauf den Namen: „Dünewald“.
Er wartete zwei oder drei Minuten, dann ging er die Treppe wieder hinab. Als er in die Einfahrt kam, sah er, daß die Portiersfrau noch immer an der Wohnungstür stand und heraussah. Vor dem Hause setzte er sich in seinen Wagen und begann zu warten.
Hin und wieder fuhr eine Straßenbahn die Prinz-Eugen-Straße hinauf oder hinab, und ein paar Autos jagten vorüber.
Aus dem Belvedere duftete das welkende Laub.
Der Tag ging in sanfter Melancholie zu Ende.
Zwei Leuten, die einsteigen wollten, erklärte Sponer, er sei bestellt.
Er wartete bis gegen halb acht Uhr.
Es war längst dunkel geworden, ein starker Wind begann zu wehen, und die Laternen flackerten und schwankten.
Einmal trat die Portiersfrau aus dem Haustor, erkannte ihn aber nicht, weil er das Gesicht wegwendete.
Um halb acht ungefähr erschien die Schöne, in Begleitung zweier älterer Herren, die ausgezeichnet aussahen und etwa auf die Art gewesener Kavallerieoffiziere gekleidet waren. Die drei nahmen von dem Wagen keine Notiz. Sie gingen vorbei und plauderten vom Bridge.
Sie gingen die Straße hinab. Sponer fuhr langsam hinter ihnen her. Nach einiger Zeit bogen sie nach links in eine Quergasse, dann wieder nach rechts in die Alleegasse. Vor dem Hause Nummer 16 blieben sie stehen. Die beiden Herren verabschiedeten sich, das Mädchen trat in das Haus ein, und die Herren gingen stadtwärts davon.
Von den Portiersleuten in der Alleegasse und vom Oberkellner des nahe gelegenen Café Attaché, insbesondere aber von einem Kommissionär, der da meist entweder an der Ecke saß oder in einem Gasthaus, das an einem Schild mit zwei weißen Pferden kenntlich war, gegenüber, ermittelte Sponer noch im Laufe des Abends und des nächsten Vormittags: die Schöne hieß Marisabelle von Raschitz, sei Tochter eines Majors und in der Tat die Nichte der Gräfin Dünewald in der Prinz-Eugen-Straße, der Witwe nach einem Grafen Dünewald, gewesenem Oberhofmeister der Erzherzogin Maria Isabella, nach der auch das Fräulein, das der Kommissionär schon von Kind auf kannte, getauft worden. Der Major Raschitz, sagte er, gelte immer noch für vermögend. Marisabelle hätte auch noch einen Bruder. Auch den kannte der Kommissionär von jeher. Er hätte, sagte er, mit den beiden schönen Kindern oft geplaudert, wenn man sie spazierengeführt. In Wien plauderten die Kinder auch exklusiver Leute früher gerne mit den Dienstmädchen an den Straßenecken oder mit den alten Invaliden im Belvederegarten. Diese Invaliden trugen noch die Uniformen längst vergangener Zeiten, waren einarmig oder hatten Stelzbeine, beaufsichtigten die Parkanlagen und unterhielten sich mit den Kleinen und den Kinderfrauen. Und der Kommissionär kam auf vergangene Zeiten zu sprechen, auf die Erzherzogin, auf die alte Hofhaltung und die Wagen mit den goldenen Rädern. Sponer hörte ihm eine Zeitlang zu, nickte dann zerstreut und stieg wieder in seinen Wagen.
In der nächsten Quergasse gab es einen Autostandplatz. Dahin stellte er den Wagen, stieg aus und ging bis zur Ecke vor, von der aus er das Haus beobachten konnte. Als aber die Wagen, die vor ihm gestanden hatten, Fahrgäste gefunden und als die Reihe nun an ihn gekommen wäre, erklärte er, nachdem er schon vorgefahren war, plötzlich, er hätte einen Defekt, und ließ andere an die Tour. Ein paar von den übrigen Chauffeuren wollten den Defekt nachsehen helfen. Er lehnte es jedoch ab. Er machte sich allein am Motor zu schaffen.
Gegen elf Uhr sah er Marisabelle aus dem Haus kommen. Sie trug einen braunen Rock und dazu eine kurze Pelzjacke. Die langen Handschuhe hatte sie noch unterm Arm, begann aber, stadtwärts gehend, sie anzuziehen.
Unmittelbar darauf öffneten sich die Torflügel des Hauses, und es erschien ein geschlossener Cadillac. Zwei Herren saßen im Fond. Der Cadillac bog in die Querstraße ein, in der Sponer an seinem Motor laborierte.
Er unterbrach die Arbeit, trat zum Kommissionär hin und fragte, wem der Wagen gehöre.
Einem Fabrikanten, gab der Kommissionär an, einem gewissen Soundso, der gleichfalls dort im Haus wohne. Sponer merkte sich den Namen nicht. Aber ob auch die Raschitz einen Wagen besäßen? fragte er.
Ja, sagte der Kommissionär, die hätten auch einen.
Sponer nahm nun einen Fahrgast an, später, bei der Kirche zu den Neun Chören der Engel, einen zweiten, der eine Menge Besorgungen in unterschiedlichen Kanzleien und Ämtern zu erledigen hatte und Sponer zwischendurch warten ließ, als er aber, gegen ein Uhr, in der Schwarzspanierstraße, mit diesen Angelegenheiten noch immer nicht zu Ende zu sein schien, erklärte ihm Sponer, er solle aussteigen, er hätte jetzt keine Zeit mehr. In schnellster Fahrt kehrte er in die Alleegasse zurück und postierte sich dort, um Marisabelle nach Hause zurückkehren zu sehen.
Allein sie kam nicht, und gegen zwei Uhr mußte er sich gestehen, daß er sie wohl versäumt hätte. Er aß ein paar Bissen im Wirtshaus zu den Zwei Schimmeln, in Gesellschaft des Kommissionärs, der daneben Bier trank und immerzu ihm und anderen von der ehemaligen kaiserlichen Hofhaltung erzählte. In Wien gibt es noch eine Menge solcher alter Kommissionäre, kleiner Beamter, früherer Bedienter und ähnlicher Leute, die Bartkotelettes tragen und vom Hof schwärmen, von der Arcièrenleibgarde, von den ungeheuren Trinkgeldern ausländischer Potentaten, die beim Kaiser zu Gast gewesen waren, und von ähnlichem mehr. Sponer, der neunundzwanzig war und von dem allem nur mehr eine vage Vorstellung besaß, hörte ziemlich unaufmerksam zu und sah fortwährend über die Gasse hinüber, zu den mit gerafften Vorhängen verhängten Fenstern des Hauses, das er beobachtete.
Ich werde mich, dachte er, so vor ihr Haus stellen, daß ich sie, wenn sie nachmittags ausgeht, fragen kann, ob sie einen Wagen wünscht.
Er zahlte, ging hinaus und fuhr den Wagen in die Alleegasse. Vor dem Haustor hielt er, mit der Richtung gegen die Stadt zu, an. Nach einiger Zeit fragte ihn ein Schutzmann, was er da so lange stünde. Er sei hierherbestellt, erklärte Sponer. Der Fahrgast käme eben so lange nicht. Er sei noch oben im Hause.
Auch der Kommissionär, dem Sponers Benehmen nun aufzufallen begann, trat heran und stellte eine Frage, auf die Sponer jedoch nicht achtgab. Denn in diesem Moment trat Marisabelle aus dem Hause. Sie trug einen dunklen Mantel und einen zweifarbigen Hut.
Sponer sprang sofort von seinem Sitz auf und trat auf sie zu.
„Einen Wagen?“ fragte er.
Sie schüttelte den Kopf und war schon im Begriff vorüberzugehen, als sie ihn wiedererkannte.
„Ach?“ sagte sie, und weil er so nahe bei ihr stand: „Sie sind das?“, ging dann aber sogleich weiter.
„Ja“, sagte er, „ich“, und er probierte, nach Worten suchend, ihr irgendwie in den Weg zu treten. „Möchten Sie … wollen Sie nicht doch mit mir fahren? Es war mir gestern so unangenehm, daß Sie nicht zufrieden gewesen sind. Ich fahre sonst wirklich ganz gut …“
Sie sah ihn an. Der Schatten eines Lächelns huschte um ihren Mund. Für einen Augenblick lang sah man den schneeigen Blitz ihrer Zähne.
„So?“ meinte sie. „Seit wann sind Sie eigentlich Fahrer?“
„Seit vier Jahren. Chauffieren Sie selbst?“
„Ich?“ fragte sie erstaunt.
„Ja.“
„Ein wenig“, meinte sie.
„Ich dachte ja, daß Sie einen Wagen hätten. Auch ich“, setzte er rasch hinzu, „habe natürlich woanders chauffieren gelernt … bei Verwandten, nicht wahr?“ Und er machte einen Augenblick lang eine Pause. Sie sah ihn an, als wisse sie nicht, warum er „nicht wahr?“ sagte. Was für Verwandte? dachte sie wohl. Was können das schon für … „Ich hätte ja“, fuhr er aber eilig fort, „ursprünglich etwas ganz anderes werden sollen …“
„Ach“, meinte sie und machte gleichzeitig eine Bewegung, als wendete sie sich wieder zum Gehen.
„Ja“, sagte er rasch, „ich war sogar noch ein Jahr lang in … in einer Kadettenschule … Vater war nämlich …“
Daß er Kadett gewesen war, schien ihr gleichgültig zu sein. „Na ja“, sagte sie, „es gibt ja jetzt Chauffeure aus ganz verschiedenen Milieus. Es ist eben … man muß eben …“
Er versuchte sie anzulächeln. Sie blickte woanders hin, sah ihn dann aber wieder an. Er war über mittelgroß, gut gewachsen, nur hatte er ein wenig derbe Hände. Als sie ihm ins Gesicht sah, fand sie, er hätte hübsche Augen.
Eine leichte Röte stieg ihr ins Gesicht. Sie nickte kurz und wandte sich ab.
„Keinen Wagen also?“ fragte er.
„Nein, danke“, sagte sie rasch und ging.
Er starrte ihr nach.
2
Um sechs Uhr wurde er abgelöst. Er brachte den Wagen aber nicht heim, sondern übergab ihn in der Margarethenstraße, samt der Verrechnung, dem Fahrer Georg Haintl. Dann fuhr er mit der Straßenbahn nach Fünfhaus, einem der äußeren Bezirke, wo er, in der Nähe seiner Garage, bei einem Bahnbediensteten, Oxenbauer, ein Zimmer bewohnte.
Er setzte sich, im Mantel, auf sein Bett und lehnte sich mit dem Rücken an den Wandteppich, ein verschlissenes Ding, auf dem ein Brakierhund einen Hasen jagte.
Aus dem Nebenzimmer roch es, durch die geschlossene und mit einem Waschtisch verstellte Tür, nach Petroleum.
Er stand auf und stieß das Fenster auf.
Jenseits des Hofes, der bloß von einer niederen Mauer abgegrenzt war, blinkten, um ein großes, unbebautes Grundstück, die Laternen der Straßenzüge. Buschwerk, das im Nebenhof wuchs, rauschte im Wind aus dem Dunkel herauf. Er zog den Mantel aus, warf sich aufs Bett und zündete sich eine Zigarette an.
Kurz darauf brachte ihm die Tochter des Oxenbauer, ein halbwüchsiges Mädel, auf einem schwarzen, mit abgeschabtem Gold gemusterten Tablett das Abendessen. Sie wollte es auf den Nachttisch stellen, er machte ihr jedoch mit dem Kopf ein Zeichen, sie solle es auf den Tisch setzen.
Warum es von nebenan so nach Petroleum röche? fragte er.
Es röche doch gar nicht, sagte sie.
Natürlich! fuhr er sie an. Aber immer, wenn es wo röche, hieße es, es röche nicht, und wenn eine Suppe sauer sei, würde behauptet, sie sei gar nicht sauer, und so weiter!
Sie ging hinaus und schlug die Tür zu. Er sah ihr unter zusammengezogenen Brauen nach.
Sie konnte ihn nicht leiden, weil sie die Marie Fiala nicht mochte.
Marie war seine Freundin.
Sie erschien etwa zehn Minuten später. Als sie eintrat, lag er noch immer auf dem Bett und hatte nichts gegessen.
Sie küßte ihn und fragte, warum er nichts angerührt hätte. Ob er nicht essen wolle? Sie würden ins Kino zu spät kommen. Außer, er wolle gar nicht ins Kino. Dann brauchten sie nicht zu gehen. Ihr läge nicht soviel daran. Und sie setzte sich, im Mantel, zu ihm.
Er wolle eigentlich wirklich nicht gehen, meinte er. Sie nickte, stand auf und zog den Mantel aus. Er trat inzwischen an den Tisch und aß ein paar Bissen. Sie setzte sich gleichfalls zum Tisch. Sie war nicht hübsch, hatte aber eine gute Figur und einen wundervollen blonden Haaransatz, der nun im Licht der Lampe flimmerte.
Ob sie ihm vielleicht ein paar von seinen Sachen in Ordnung bringen solle, fragte sie.
Das wäre sehr lieb von ihr, murmelte er, nahm die Tasse mit dem Essen und stellte sie vor die Tür. Ob sie übrigens schon gegessen hätte, fragte er, als er zurückkam. Ja, sie hätte schon, sagte sie. Sie hatte den Schrank geöffnet, nahm ein paar Wäschestücke heraus und hielt sie, um sie nachzusehen, unter das Licht der Lampe.
Aber sie könnten ja auch später noch ins Kino, meinte er.
Es sei ihr wirklich nicht darum zu tun, erwiderte sie. Sie nahm ihre Tasche zur Hand und suchte nach einer Nadel und Faden. Er bot ihr zu rauchen an, und mit der Zigarette im Mund begann sie zu arbeiten.
Er schloß das Fenster und setzte sich wieder aufs Bett, stützte sich auf den Ellbogen und sah ihr zu. Das Licht schimmerte auf ihrem Haar.
Sie hatten früher einander heiraten wollen, es aber immer wieder hinausgeschoben, unter verschiedenen Vorwänden, in Wirklichkeit aber wohl nur, weil sie einander schon zu lange kannten. Eine Stellung als Verkäuferin in einem Vorstadtwarenhaus hatte sie inzwischen verloren, war dann monatelang ohne Beschäftigung gewesen, nun half sie hie und da bei einer Freundin aus, die Hauswäsche zum Nähen übernahm und Monogramme stickte.
Sie hoffte natürlich immer noch, daß er sie heiraten werde, allein sie sprach nie davon.
Er sah sie, während sie arbeitete, an und machte manchmal eine Bemerkung. Sie fragte ihn, wo er tagsüber gewesen sei, und er fragte sie, was sie getan hätte.
Hin und wieder trug sie die durchgesehenen Sachen zum Schrank zurück und holte neue zum Tisch.
Dann steckte sie die Nadel weg. Er küßte ihr die Hände, zog sie zu sich empor und küßte sie auf den Mund. Dann schmiegten sie die Wangen aneinander.
So blieben sie eine Zeitlang und hörten, wie der Wind ums Haus strich. Und sie dachten, wie lange sie einander schon kannten. Vielmehr: sie dachten es nicht, sie spürten es bloß, wie traurig sie waren.
Um neun Uhr gingen sie doch noch ins Kino.
Dann brachte er sie nach Hause.
Er hatte dienstfrei bis zu Mittag am nächsten Tag.
Gegen neun Uhr morgens fuhr er mit der Straßenbahn in die Stadt.
Den Kommissionär sah er in der Alleegasse nicht. Er hatte offenbar einen Auftrag erhalten. Er konnte also, ohne sich lästigen Gesprächen auszusetzen, vor Marisabelles Haus auf und ab gehen.
Es war ein sonniger Herbsttag. Oben, wo die Straße schon anstieg, wehte der Wind welkes Laub aus dem Garten des Theresianums. Die hohen Fensterscheiben der Palais spiegelten den Himmel.
Sponer blieb vor einem Packard stehen, der vor einem der Häuser hielt.
Der Chauffeur begann ein Gespräch mit ihm, gleich darauf aber erschien der Eigner des Packard, und der Wagen fuhr davon.
Gegen elf kam Marisabelle aus dem Tor. Sie trug wieder das graue Kostüm und den Fuchs um die Schultern.
Sponer trat sogleich auf sie zu, noch ehe sie das Tor geschlossen hatte, und sein Herz begann ihm bis in den Hals hinauf zu schlagen.
„Verzeihen Sie“, sagte er, „daß ich Sie gestern belästigt habe, ich wollte … ich bin …“
Sie sah ihn, indem sie das Tor zufallen ließ, an.
„Ich bin aber“, fuhr er rasch fort, „heute ohne Wagen da, ich wollte nur um Entschuldigung bitten.“
Sie antwortete nicht sogleich. „Warum?“ fragte sie schließlich.
„Wegen gestern“, sagte er. „Ich wollte Ihnen damit nicht lästig fallen, daß ich Ihnen den Wagen angetragen habe.“
„Ach so“, meinte sie und schien noch etwas dazusetzen zu wollen. – „Ich hätte aber“, sagte er, „sonst keine Gelegenheit gehabt, Sie zu sprechen …“
„Sie wollten mich sprechen?“
„Ja“, sagte er und blickte zu Boden.
Sie lehnte mit der Schulter am Tor und lächelte, er merkte es jedoch nicht, denn als er wieder aufblickte, fragte sie bloß: „Warum wollten Sie mich sprechen?“
„Ich wollte“, sagte er nach einem Moment, „Sie nur überhaupt … Sie nur überhaupt sehen …“
Sie zog die Tasche, die sie unterm linken Arm trug, hervor, schob sie unter den rechten und drehte einen Moment lang an ihren Handschuhfingern.
Dann blickte sie Sponer wieder an.
„Sie gingen aber“, sagte er, „so rasch fort … Ich begreife ja, daß es Ihnen wahrscheinlich unangenehm war, von mir angesprochen zu werden, verzeihen Sie das, aber ich hatte doch sonst keine Gelegenheit, Sie …“
Sie sah ihn, während er sprach, an, auch als er abbrach, blickte sie ihm weiter ins Gesicht, schließlich schlug sie die Augen nieder. „Hören Sie“, sagte sie, indem sie die Handschuhstulpen hochzog, „Sie können mich ja auch wirklich hier nicht ansprechen.“
„Würden Sie mir“, fragte er, „wenigstens erlauben, Sie ein paar Schritte zu …“
Sie gab keine Antwort.
„… zu begleiten?“ ergänzte er.
„Nein“, sagte sie. Sie stand noch einen Augenblick still, zog den Fuchs um die Schultern und ging.
Er tat zwei oder drei Schritte ihr nach, blieb stehen und warf einen raschen Blick um sich. Niemand schien auf die Szene aufmerksam geworden zu sein. Er tat noch ein paar Schritte, zögerte, folgte dann aber Marisabelle auf eine Distanz von etwa dreißig Schritten.
Sie ging stadtwärts davon, ohne sich auch nur ein einziges Mal umzusehen. An der nächsten Quergasse blieb sie einen Moment stehen, dann überschritt sie die Fahrbahn. Einmal griff sie mit der Hand zur Schulter und zog den Pelz zurecht. Einem Herrn, der ihr bei der Karlskirche entgegenkam und sie grüßte, dankte sie. Ihr Gang war völlig unbefangen, als sei sie ganz uninteressiert daran, ob jemand ihr folge.
Auf dem Karlsplatz, zwischen den Parkanlagen, holte Sponer sie ein.
Sie schien weder erstaunt darüber, noch zeigte sie, ob sie damit gerechnet hatte, daß er ihr nachkommen werde oder nicht. Sie blieb aber stehen, am Rande der Anlagen, in denen das Laub von den Bäumen fiel. Ein paar große Krähen trieben sich auf dem Rasen herum. Sie setzte einen Fuß auf den Sockel des niedrigen Gitters, das die Wiesen begrenzte, klappte die Tasche auf, sah in den Spiegel und zog sich den kurzen Schleier weiter herab. Dann ließ sie die Tasche sinken und sah ihn an.
Er hatte die Brauen zusammengezogen. „Sie wissen“, sagte er, „was ich Ihnen zu sagen habe.“
Sie hob den Spiegel wiederum und blickte auf ihren Mund. „Und was“, fragte sie, „erwarten Sie, daß ich Ihnen darauf antworte?“
Er schwieg.
Sie wischte ein wenig Puder von ihrer Wange weg. Dann klappte sie die Tasche zu. „Nun?“ sagte sie.
Er zuckte die Achseln.
„Sie müssen ziemlich verwöhnt sein“, meinte sie.
„Warum?“ fragte er erstaunt.
Sie blickte ihm ins Gesicht. Sie war schon im Begriff, ihm zu sagen: Weil Sie so hübsche Augen haben. – „Weil Sie mich zuerst ansprechen“, sagte sie schließlich, „sich dann herstellen und erwarten, daß ich weiterrede. Machen Sie das immer so?“
Er errötete momentan. „Nein“, sagte er.
Jede Frau hat den Wunsch, bei dem Mann, dem sie gefällt, Abenteuer vorauszusetzen.
„Sie hätten mich doch sonst gar nicht angesprochen“, meinte sie.
Er zögerte einen Augenblick. „Ich habe mich in Sie verliebt“, sagte er.