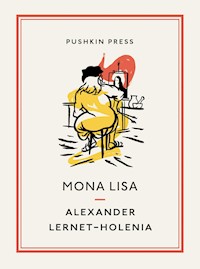11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Im Dämmer des unerforschten Zwischenreiches, das nur von Dichtern und Ekstatikern bereist wird, im Grenzgebiet zwischen Leben und Tod verläuft diese seltsame Geschichte eines österreichischen Reserveoffiziers, der – aus einem beginnenden Liebesabenteuer jäh herausgerissen – in das wilde Abenteuer des Krieges stürzt. Mars im Widder – der rote Planet im Sternbild des Widders – wird astrologisch als Kriegsomen gedeutet. Hier ist die Konstellation das metaphysische Symbol für das Eingreifen übersinnlicher Mächte in das Schicksal des Einzelnen. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 269
Ähnliche
Alexander Lernet-Holenia
Mars im Widder
Roman
FISCHER Digital
Inhalt
Der Roman «Mars im Widder» ist in der Zeit zwischen dem 15. Dezember 1939 und dem 15. Februar 1940 entstanden und wenig später unter den Auspizien meiner Freunde Paul Wiegler und L.E. Reindl in einer Zeitschrift des Deutschen Verlags vorabgedruckt worden. Nicht nur in Deutschland selbst, sondern auch bei den Truppen im Felde hatte der Vorabdruck (wenn er gelesen worden war, wie ich ihn gemeint hatte) so viel Aufmerksamkeit hervorgerufen, daß das Buch, im Frühjahr 1941 in 15000 Exemplaren zu Leipzig für den Verlag S. Fischer hergestellt, vom Propagandaministerium und von der Wehrmacht verboten wurde. Die gesamte Auflage wurde versteckt, verbrannte aber bei den Angriffen auf Leipzig im Winter von 1943 auf 1944. Ein einziges Exemplar, in meinem Besitze, war erhalten geblieben. Ihm folgt, von geringfügigen stilistischen Verbesserungen abgesehen, der Text, der hiermit neu vorgelegt wird.
ALEXANDER LERNET-HOLENIA
Kapitel I
Zu Anfang des Sommers 1939 entschloß sich die Hauptperson – um nicht zu sagen: der Held – dieses wahrheitsgetreuen Berichts, ein gewisser Wallmoden, eine soldatische Übung, zu der er verpflichtet war, mit dem 15. August zu beginnen. Er hätte aber schwerlich angeben können, warum er diesen und nicht irgendeinen andern Zeitpunkt gewählt hatte. Denn es wäre ihm überlassen geblieben, sich ebensogut, ja noch eher zum 1. September zu entschließen, – was in der Folge einen großen Unterschied gemacht hätte; und niemand wäre dagegen gewesen, hätte er sich etwa auch zum 15. September oder gar erst zum 1. Oktober gemeldet. Er erschien aber, wie gesagt, schon am 15. August bei seinem Regimente. Später erklärte er, er habe sich diesen Termin eben zurechtgelegt. Wie er ihn sich jedoch zurechtgelegt habe, konnte er nicht sagen. Er vermochte nur anzugeben, daß er das Gefühl gehabt: er sei dort, an jenem Tage, erwartet worden. Von wem aber? Denn beim Regimente konnte es nicht wirklich gewesen sein, daß man ihn erwartet hatte. Es kannte ihn da noch niemand, und auch ohne ihn hätte der Dienst sich gewiß nicht verzögert.
Wahrscheinlich waren seine Zurechtlegungen oder Berechnungen eben durchaus anderer Art gewesen, – und vielleicht geht überhaupt das Leben, auch sonst, nur weiter, weil es auf solchen oder ähnlichen, jedenfalls aber ganz unbewußten Entschließungen beruht. Denn wären die Menschen bloß auf die Leistungen ihres Verstandes angewiesen, sie erreichten offenbar nicht einmal das Alter, in welchem es ihnen möglich wäre, sich dieses ihres Verstandes zu bedienen. Manche Leute behaupten zwar: wie man lebe, sei lediglich vom eigenen Willen abhängig, und alle übrigen Ansichten könnten für nichts als für phantastisch gelten. Aber es gibt auch solche, die wahrhaben wollen, daß die Lose der Lebenden von niemand anders als vom Schicksal geworfen würden. Wahrscheinlich hängt jede Existenz eben von beidem ab. Allein die zwei Machtbereiche, des Willens sowohl wie des Schicksals, sind inkongruent. Sie decken sich niemals vollkommen. Bestimmt ist nur eines: daß diese Sphären ineinandergreifen und daß das Schicksal dem Willen und der Wille letzten Endes nur dem Schicksal dient, – wovon das Folgende ein Beispiel sein möge.
Schon als Wallmoden die Vorbereitungen traf, sein Haus zu verlassen, meinte er zu fühlen, es sei diesmal ein Abschied von größerer Bedeutung. Freilich ist die menschliche Empfindung für geliebte Personen oder Dinge beständig mit der Furcht, sie zu verlieren, vereinigt, und so nimmt man eigentlich immer schon etwa von der Geliebten oder von der Heimat Abschied, – so daß also auch, im Augenblicke der wirklichen Trennung, vom Abschied bereits so viel vorweggenommen ist, daß er am Ende fast leicht fällt. Wallmoden aber empfand diesen seinen Abschied von daheim durchaus nicht als leicht, er litt vielmehr unter der Stärke des unklaren und unbegreiflichen Eindrucks, den diesmal das Abschiednehmen auf ihn machte, ja er hatte damals zum erstenmal die sich später oft wiederholende und verstärkende Empfindung, mit irgend etwas, wie mit einem Saum oder Zipfel seiner Kleider, in ein Räderwerk von Geschehnissen geraten zu sein, das ihn an sich riß und in welchem er fortwährend sollte herumgetrieben werden … Stand er, zum Beispiel, am Fenster und blickte auf den Garten, so schien ihm, es habe dieser Garten seine Rechnung mit ihm bereits abgeschlossen und rausche gleichgültig und unter einem bedeckten Himmel für irgendeinen ganz andern; und ging er durch die Zimmer, so war ihm auch der Anblick der Bilder derjenigen, aus denen er selber hervorgegangen war, keine Beruhigung, sondern sie blickten ihn, unter hochgezogenen Brauen, ein wenig spöttisch, ja geradezu abweisend an, als sei es ihnen unbegreiflich, wie er in eine Stimmung und zweifelvolle Unruhe habe geraten können, die sie selber nie gekannt. Nimm Abschied, schienen sie zu sagen, nimm doch Abschied! Denn wenn du nicht Abschied genommen hast, so kann es auch nicht sein, daß du wiederkehrst. – Daß sein Gemüt wahrhaftig auf ganz ungewohnte Weise zu schwanken begonnen habe, mußte er sich eingestehen, als er, in einer der letzten Nächte – er wußte selber nicht wie und weshalb – mit einem Kerzenlicht durch das Haus ging, in den oberen Flur geriet, in welchem die Geweihe hingen, und den Eindruck empfing: mit dem riesigen Schatten der Sechzehnender, die, bei jeder Bewegung des Lichts, über die Wände liefen, fliehe auch eine Schar schattenhafter Menschen von einer Seite des Saals auf die andre, als ob Wild durch Stangengehölz bräche.
Bereits am ersten Tage, den er beim Regiment verbrachte, wurde er Zeuge und Teilnehmer eines merkwürdigen Gesprächs der Offiziere.
Dieses Gespräch begann damit, daß ein Oberleutnant Mauritz, welcher den Pionierzug führte, zu erzählen wußte: ein junger Mensch aus der Stadt, Sohn eines Bäckers, sei beim Baden im Fluß ertrunken, und man suche die Leiche bereits seit zwei Tagen, könne sie aber nicht finden.
Schon daß es einem Manne gelungen war, in dem verhältnismäßig seichten Fluß zu ertrinken, bezeichnete Mauritz als ein ähnliches Kunststück wie das seitherige Verschwundensein des Unglücklichen.
Nachdem die Unterhaltung sich einige Zeit auf die Mittel, mit denen man die Nachsuche betrieb: Stangen, Netze und dergleichen, und auf die Undurchsichtigkeit des Flußwassers bezogen, schlug der Leutnant Obentraut als bestes Mittel, den Aufenthaltsort des Ertrunkenen zu erfahren, vor, zu einer Sitzung zusammenzutreten, den Geist des Ertrunkenen zu zitieren und ihn nach dem Verbleibe seines Leichnams zu befragen.
Dies ward, zunächst, allgemein für einen Scherz genommen, den man sich, um ein unergiebig werdendes Gespräch zu beenden, in kleinem Kreise unter Umständen leisten konnte. Zum Erstaunen aller Anwesenden aber stellte sich schon nach kurzer Zeit heraus, daß Obentraut seinen Antrag denn doch nicht ganz ohne wirkliches Interesse an dem vorgeschlagenen Experiment gestellt habe. Der Leutnant war ein trotz seiner Jugend ziemlich zurückgezogen lebender Mensch, der an der abendlichen Geselligkeit der Kameraden wenig teilnahm und sich statt dessen der Lektüre von einer Menge von Büchern hingab, aus denen er eine gewisse Eigenwilligkeit seiner Ansichten über Gott und die Welt mochte bezogen haben.
Noch erstaunter aber war man, als auch der sonst durchaus nüchtern denkende Major Baron Dombaste die Anschauungen des Leutnants Obentraut nicht so ganz von der Hand zu weisen schien. Der Major nämlich sagte: Daß es möglich sei, Tote zu zitieren, glaube er zwar nicht; Lebende aber könne man zweifellos zitieren. Und er erzählte folgende Geschichte:
«Einer meiner Vettern war lange Zeit in eine junge Russin verliebt, die wir Nadja nennen wollen. Aber diese Liebe, die, von beiden Seiten, eine sehr große, ja übergroße war, sollte tragisch enden. Denn eben weil ihre Leidenschaft über das Maß der landläufigen Gefühle so sehr hinausging, verließ die Russin meinen Vetter, von dem sie sich überdies einbildete, daß er sie betröge. Nun ist es zwar möglich, daß er sie wirklich betrogen hatte. Allein vielleicht war seine Handlungsweise im Grunde nichts anderes gewesen als eine ähnliche Art von Flucht wie die ihre.
Von Nadja, jedenfalls, hieß es, daß sie nach Konstantinopel gegangen und bald darauf gestorben sei. So glaubten wir zumindest. Eines Abends, zur Zeit der herbstlichen Jagden, kam man im Hause meines Vetters auf den Gedanken, eine spiritistische Sitzung abzuhalten. Man hatte dabei nicht etwa die Absicht, einen bestimmten Geist heraufzurufen. Weil aber mein Vetter, während der ganzen Zeit, intensiv an seine tote Geliebte mochte gedacht haben, so meldete sich alsbald, durch Klopfsignale, ein unsichtbares Wesen, das sich Nadja nannte.
Mein Vetter, aufs tiefste erschüttert, unterbrach die Sitzung sofort.
Einige Tage später konnte einer seiner Gäste nachts nicht schlafen und begab sich, um ein Buch zu holen, in die Bibliothek. Hier fand er zu seinem Erstaunen eine junge Dame vor, die er weder persönlich kannte, noch unter den im Hause Anwesenden jemals bemerkt hatte.
Es war eine auffallend schöne Person, und er unterhielt sich mit ihr etwa eine Viertelstunde lang, worauf sie sich erhob und den Raum durch eine Tapetentür verließ, die er bis dahin nicht wahrgenommen.
‚Wer war eigentlich die junge Dame, die gestern nachts in der Bibliothek gewesen ist?‘ fragte er am andern Morgen meinen Vetter.
‚Was für eine junge Dame?‘ sagte mein Vetter, und der andre versuchte, sie ihm zu beschreiben. ‚Sie sah so und so aus‘, sagte er; ‚sie plauderte auf bezaubernde Art, und wenn sie lächelte, so sah man die schönsten Zähne. Allein neben dem linken Augenzahn hatte sie eine kleine Unregelmäßigkeit, etwa als ob ihr, als sie noch ein Kind gewesen, ein Zahn nicht richtig hervorgewachsen wäre. Doch eben dieser Fehler machte ihr Lächeln besonders reizvoll.‘
Mein Vetter wurde weiß wie die Wand. Er glaubte nach dieser Schilderung nicht mehr daran zweifeln zu können, daß dies Nadjas Geist gewesen sei, der sich, seit man ihn beschworen hatte, in der Nähe herumtreibe.
Ein paar Nächte später ward im Hause alle Welt durch das Krachen mehrerer Schüsse geweckt. In seinem Schlafzimmer fand man meinen Vetter verwundet in seinem Blute liegen, und über ihn geworfen, in Tränen aufgelöst, Nadja, die ihn und sich selber hatte töten wollen.
Denn es war natürlich gar nicht Nadjas Geist, sondern Nadja aus Fleisch und Blut gewesen, die die Schüsse abgegeben hatte. Selbstredend hätte keine Macht der Welt ihren Geist beschwören können. Allein sie hatte nur vorgegeben, tot zu sein, um der Verbindung mit meinem Vetter, die ihr unerträglich schien, zu entgehen. Die Lebende zurückzurufen, hatten seine beschwörenden Gedanken während jener Sitzung genügt. Sie war, einem plötzlichen, ihr selber ganz unbegreiflichen Zwange folgend, aus dem Auslande zurückgekehrt und hatte ihrer unseligen Leidenschaft durch einen mit meinem Vetter gemeinsamen Tod ein Ende bereiten wollen.
Doch sollten die Schüsse in Wahrheit nicht tötend, sondern läuternd wirken wie Donner in der Spannung einer gewittrigen Luft. Die beiden, Nadja und mein Vetter, sind nun schon seit Jahren glücklich verheiratet.»
Diese Erzählung befriedigte, durch die Vernünftigkeit ihrer Lösung, allgemein. Wallmoden aber sagte: «Vielleicht haben dennoch diejenigen Berichte am meisten für sich, die weder ganz geisterhaft noch ganz natürlich sind.»
«Weshalb dieses?» fragte der Rittmeister von Sodoma.
«Weil sich auch unser ganzes Leben eigentlich nirgendwo anders als in einem solchen Zwischenreich abspielt», sagte Wallmoden. «Von meinem Urgroßvater, zum Beispiel, erzählt man sich, daß ihm eine sehr merkwürdige Geschichte widerfahren sei, die man aber im Grunde weder gespenstisch noch selbstverständlich nennen könnte.»
«Und was für eine Geschichte ist dies?» fragte Sodoma.
«Er war Oberst-Inhaber eines Regiments», sagte Wallmoden. «Wenige Tage vor der Schlacht von Santa Lucia, in welcher er ein Armeekorps befehligte, wollte er sein Regiment besichtigen. Er hatte sich jedoch nicht ansagen lassen. Um so erstaunter war er, daß, als er mit seinem Stabe erschien, das Regiment schon Aufstellung genommen hatte. Die Panzerreiter, zwei Glieder tief, hielten bewegungslos in einer Linie, die gerader war als ein Sonnenstrahl, die weißen Röcke waren fleckenlos gekreidet, keine Schnalle gab es, die nicht geglänzt hätte, kein Knopf fehlte und, an den Helmen, kein Feldzeichen aus Eichenlaub, so selten dies in der Gegend auch war.
Er fragte den Oberstleutnant, der ihm das Regiment meldete, sofort, woher man denn gewußt habe, daß er kommen werde.
Der Oberstleutnant antwortete: ‚Exzellenz hatten sich doch angesagt.‘
‚Angesagt?‘ rief mein Großvater. ‚Durch wen?‘
‚Aber doch persönlich!‘ erwiderte der Oberstleutnant, und der General hatte Gelegenheit, unter dem Stoß papageiengrüner Federn auf seinem Hut ein grenzenlos verblüfftes Gesicht – sein eigenes – im tadellos glänzenden, kupfernen Halsschild auf dem Küraß des Untergebenen wie in einem Rasierspiegel zu studieren.
Er nahm schon an, ein Indiskreter aus seinem Stabe habe mit dem Regiment unter einer Decke gesteckt. Aber nach einem längeren Verhör konnte er nicht mehr daran zweifeln, daß er selber, zwei Stunden zuvor, ganz allein reitend, im Lager erschienen war und den Kürassieren zugerufen hatte: ‚Kinder, um vier Uhr will ich das Regiment besichtigen. Daß ihr mir also keine Schande macht!‘
Ihn ohne Begleitung zu sehen, war man freilich erstaunt gewesen. Während der Zeit dieses seines Rittes durch das Lager aber hatte er in Wirklichkeit – es war knapp nach Tisch – ein paar Minuten im Zelte geschlafen. Daß er jedoch ins Lager zu reiten etwa geträumt, konnte er sich nicht erinnern.»
«Solche Vorgesetzte lobe ich mir», sagte Oberleutnant Mauritz.
«Und hatte er etwa auch sonst dergleichen Erlebnisse?» fragte der Major Dombaste.
«Es ist nichts davon überliefert», sagte Wallmoden. «Doch waren seine Soldaten seitdem die besten, weil sie fest daran glaubten, er komme als Geist überall hin.»
«Nun, das ist gut!» lachte Sodoma. «Daß man’s nicht einmal selber wissen soll, wenn man gerade geistert, ist sogar sehr gut! Ich, jedenfalls, stehe dafür ein, daß mir dergleichen nicht wider meinen Willen passieren könnte, und ich erkläre mich bereit, Sie sofort davon zu verständigen, wenn ich dennoch einmal geistern sollte.»
Der Leutnant Obentraut jedoch sah ihn mit seinen nachdenklichen Eulenaugen an und sagte: «Vielleicht werden Herr Rittmeister dazu imstande sein, – vielleicht aber auch nicht.»
«Wieso nicht?» rief Sodoma.
«Weil es nicht ganz sicher ist, ob man es, wenn man tot ist, auch weiß. Ich habe zum Beispiel gelesen, daß jemand einmal einen Straßenunfall und dabei das Bewußtsein verloren hatte. Als er wieder zu sich kam, fand er sich in seinem Bette liegen, und neben dem Bette saß einer seiner Freunde, von dem er wußte, daß er seit langem verstorben sei.
‚Wie kommst du hierher?‘ fragte er ihn. Du bist doch tot!‘
‚Du auch‘, sagte der andre.»
Sodoma wußte nicht sogleich, was er erwidern solle. Schließlich sagte er: «Das wird ja immer konfuser! Denn erstens war ja Wallmodens Großvater – oder Urgroßvater, oder was er sonst mag gewesen sein – noch gar nicht gestorben, als er geisterte. Und wenn, zweitens, die beiden Leute, von denen Sie erzählt haben, wirklich tot gewesen sind, woher weiß dann die Welt überhaupt von jenem lichtvollen Gespräch zweier Gespenster!»
Obentraut aber zuckte bloß die Achseln und sagte: «Nun, Herr Rittmeister werden ja sehen.»
«Was werde ich sehen?» rief Sodoma. «Gar nichts werde ich sehen! – Und Ihnen gegenüber», wandte er sich an Wallmoden, «verpflichte ich mich hiermit feierlich, Ihnen jedesmal ausdrücklich Mitteilung zu machen, ob ich selber es bin oder ob es mein Geist ist, dem Sie gerade das Vergnügen haben zu begegnen.»
«Sehr liebenswürdig!» sagte Wallmoden, der nicht wußte, was er andres erwidern solle.
Kapitel II
An diesem Tage, einem Dienstag, erbat Wallmoden sich, gegen Abend, einige Stunden Urlaub, um nach Wien zu fahren, und es ergab sich, daß er hierbei, in seinem Wagen, Sodoma mitnahm.
Von der kleinen Garnisonstadt aus, in der das Regiment lag, dauerte die Fahrt ungefähr eine Stunde.
«Kommen Sie doch auf einen Augenblick zu uns herauf», sagte Sodoma, als sie angelangt waren. «Auch meine Frau ist hier. Sie wohnt für ein paar Tage bei ihren Eltern.»
Als sie bei Frau von Sodoma eintraten, fanden sie sie in Gesellschaft einer Dame, die sie beide nicht kannten. Aus irgendeinem Grunde erinnerte sie Wallmoden sofort an die junge Russin, von der, nach Tisch, der Major Dombaste erzählt hatte, – an jene Nadja, die für tot gegolten und des Majors Vetter hatte erschießen wollen. Der Major hatte sie in seiner Erzählung nicht beschrieben, allein Wallmoden hätte schwören mögen: nur so wie diese hier und nicht anders könne sie ausgesehen haben. Denn auf sonderbare Weise begann er, Erzähltes und Erlebtes zu verwechseln. Ja der Eindruck war so stark, daß er, als er vorgestellt ward und die junge Frau ihn für einen Moment anlächelte, sogleich auch bei ihr die kleine Unregelmäßigkeit der Zähne zu entdecken suchte, die Dombaste von der andern erwähnt. Aber ihre Zähne schimmerten wie die Perlen einer ausgesuchten Schnur.
Mochte sie auch keine Französin oder Spanierin sein, so hätte man dennoch vermuten können, sie sei zumindest französischer oder spanischer Herkunft. Ihre Haltung, vor allem die Art, auf die sie das Haupt trug, war eine ungewöhnlich gute, und sie hatte den schönsten Haaransatz. Es war eigentlich ein Ansatz blonder Haare. Aber das Haar selbst, mattglänzend, war dunkelbrünett bis schwarz, die Frisur verhältnismäßig hoch und ein wenig schräge nach rückwärts reichend wie die Frisuren französischer Damen aus der Zeit vor der Großen Revolution. Sie hatte Augen von dunklerem und hellerem, in Strahlen um die Pupillen geordnetem Blau, und lange, gebogene Wimpern. Ein kaum merklicher Schatten bedeckte ihre Wangen.
Zu diesem Gesichte paßte der Mund nicht ganz. Er war ein wenig zu breit, fast gewöhnlich, – jedoch «von höchst reizvoller Gewöhnlichkeit», wie Wallmoden fand. Er drückte Leidenschaftlichkeit aus, wies aber, zugleich, Züge von Spaßhaftigkeit um die Winkel auf, als amüsiere er sich heimlich über sein eigenes Temperament.
«Wer ist das eigentlich?» fragte Wallmoden halblaut den Rittmeister, während die Damen ein Gespräch fortzusetzen begannen, das durch den Eintritt der Herren war unterbrochen worden.
Sodoma antwortete, er wisse es nicht, teilte Wallmoden aber einige Zeit nachher, als man sich bereits verabschiedete, und nachdem er ein paar Worte mit seiner Frau gewechselt hatte, mit: es sei eine Baronin Pistohlkors, – die seiner Frau jedoch gleichfalls erst seit gestern, aus einer Gesellschaft, bekannt sei.
Die Pistohlkors sprach fast ausschließlich mit Frau von Sodoma und sah die Herren jedesmal mit einem gewissen Erstaunen an, wenn es auch einem von ihnen einfiel, eine Bemerkung zu machen. Daß, zum Beispiel, der Rittmeister seine Frau nach dem Befinden der Kinder fragte, die er mehrere Tage nicht gesehen hatte, trug ihm einen geradezu strafenden Blick ein. Eine solche Art von Unterhaltung war natürlich weder für Sodoma noch für Wallmoden angenehm. Die beiden saßen am Ende bloß noch Zigaretten rauchend da, und Sodoma schenkte seinem Gast und sich selber wiederholt Schnaps aus einer Flasche in bereitstehende Gläser, während die Pistohlkors auch weiterhin tat, als ob die Herren Luft wären, bis sie sich endlich erhob und mit einem Seufzer, etwa als sei ihre Zusammenkunft mit Frau von Sodoma hoffnungslos gestört worden, erklärte, sie müsse nun gehen, – worauf denn auch Wallmoden zusah, daß er fortkam.
Indem er sie über die Treppe begleitete, fragte er höflichkeitshalber, wohin er sie in seinem Wagen etwa bringen dürfe, und sie nannte ihm sogleich eine Adresse in der Salesianergasse. Im Wagen gab sie sich auf einmal auch ganz anders als bei Frau von Sodoma, vor allem spielte sie nicht mehr die dumm Erstaunte, wenn man sie ansprach, – so daß Wallmoden sie, als sie ausstieg, fragte, ob er sie wiedersehen dürfe.
«Wann?» meinte sie nach einem Augenblick.
«Am besten heute noch», erwiderte er.
Das sei nicht gut möglich, sagte sie.
Warum es nicht möglich sei? wollte er wissen.
Sie habe noch zu tun.
Was sie denn zu tun habe? erkundigte er sich.
Bekannte, sagte sie, hätten ihr einen Brief anvertraut und sie gebeten, ihn, diesen Abend noch, an eine bestimmte Adresse abzugeben.
Das sei doch kein Grund, erklärte er, daß sie beide einander nicht mehr treffen sollten. Denn den Brief zuzustellen könne unmöglich so viel Zeit in Anspruch nehmen. Überhaupt mache er selber sich den Brief zu überbringen erbötig. Indessen könne sie sich umkleiden. Wo der Brief also abzugeben sei?
Sie warf einen – wie er fand – zweifelnden Blick auf seine Uniform. Auch hätte er erwartet, daß sie eine sehr entfernte Adresse, etwa in Rodaun oder Heiligenstadt, nennen werde. Doch sagte sie, der Brief sei in die Piaristengasse zu bringen.
«In die Piaristengasse?» rief er. «Es ist doch nur ein paar Minuten bis dorthin.»
«Ich möchte Sie aber bitten, mich dennoch nicht vor acht Uhr wieder abzuholen. Denn so lange brauche ich, mich umzukleiden.»
«Geben Sie mir den Brief.»
Dieser Brief, den sie aus ihrer Tasche holte, war ziemlich großen Formats, verklebt und ohne Anschrift.
«Haben Sie sich die Adresse gemerkt?» fragte sie.
«Natürlich.»
«Auf acht Uhr also», sagte sie nach einem Moment.
«Auf acht Uhr.»
Es war jetzt ein paar Minuten nach sieben. Es dämmerte schon, und eine Gaslaterne warf auf das unregelmäßige Pflaster der Gasse ihr flackerndes Licht. Denn ein Windstoß war in die Gasse gefahren, er machte die Flamme schwanken, und ein offenstehender Fensterflügel an einem der Häuser begann zu schlagen. Das Laub eines Eschenbaums, der über eine hohe Mauer hing, rauschte. Wie eine ungeheure Kirchenkuppel aus durchscheinendem Smaragd wölbte sich der Himmel über der dunkelnden Stadt. In Richtung der Strohgasse, die hier die Salesianergasse kreuzte, zeigte sich ein einzelner roter Stern wie eine Lanzenspitze aus poliertem Kupfer.
Während die junge Frau unter ihr Haustor trat, blickte Wallmoden ihr nach. Er sah, daß sie bemerkenswert schöne Beine hatte. Und es fiel ihm der Ausspruch eines Bekannten ein: mit einer Frau mit wirklich guten Beinen solle man nie etwas anfangen. Denn wenn eine Frau ein hübsches Gesicht habe, so könne sie sich über ihre Wirkung vielleicht noch täuschen. Habe sie aber schöne Beine, so sei sie sich ihrer Wirkung unter allen Umständen bewußt und nütze sie aus.
Als Wallmoden in der Piaristengasse in dem Hause, welches die Pistohlkors ihm angegeben hatte, an der bezeichneten Wohnung klingelte, öffnete ihm ein Diener. Wallmoden übergab ihm den Brief und war schon im Begriff, sich wieder zurückzuziehen, als der Diener ihn bat, einzutreten und einen Moment zu warten.
Wallmoden, wenngleich er nicht wußte, was er hier weiter solle, trat in das Vorzimmer, und der Diener, mit dem Brief auf einem Tablett, verschwand durch eine der Zimmertüren. Wallmoden blieb im Vorzimmer kurze Zeit allein. Er hatte keine Vorstellung, in wessen Wohnung er sich eigentlich befand. Denn an der Eingangstür war keinerlei Schild angebracht gewesen. Das Vorzimmer hatte mit grünem Tuch tapezierte Türen und war mit ein paar Jagdstücken und Trophäen dekoriert.
Die Wohnung lag im zweiten Stock.
Nach einigen Augenblicken erschien der Diener wiederum und bat ihn weiterzukommen. In dem Zimmer, welches Wallmoden betrat, sah er sich einem gutaussehenden, ein wenig hageren Menschen mit bräunlichem Teint und grauen Schläfen gegenüber, der sich mit ihm bekannt machte – ohne daß Wallmoden den Namen, der ihm genannt wurde, verstanden hätte – und der ihn bat, Platz zu nehmen.
Aus irgendeinem Grunde bildete Wallmoden sich ein, einem Ungarn gegenüberzusitzen.
«Die Baronin Pistohlkors», sagte der Unbekannte, «hat mich telephonisch davon verständigt, daß Sie so freundlich sein würden, mir diesen Brief» – und er wies auf den Tisch, auf welchem der Brief, noch uneröffnet, lag – «zu bringen. Ich danke Ihnen vielmals. Eine scharmante Frau, diese Baronin! Nicht wahr?»
«Nun», sagte Wallmoden, «scharmant … aber jedenfalls so hübsch, daß Sie bestimmt bedauern werden, den Brief nicht von ihr persönlich erhalten zu haben.»
Der andre bot ihm Zigaretten an. «Ich treffe die Baronin hin und wieder», sagte er obenhin. «Früher, zumindest, habe ich sie häufig getroffen. Es ist, nebenbei bemerkt, die Frau mit so ziemlich den besten Beinen, die ich je gesehen habe.»
«Merkwürdig, daß Sie davon sprechen», sagte Wallmoden.
«Aus welchem Grunde merkwürdig?»
«Weil Sie damit einen Gedankengang fortsetzen, den ich selber vor kurzem gehabt habe.»
«Das finde ich nicht so merkwürdig.»
«Nicht?»
«Nein.»
«Wieso nicht?»
«Weil Sie ja dieser Frau, nachdem Sie sich von ihr verabschiedet hatten, zweifellos werden nachgesehen haben. Denn auch sonst ist sie ja eine höchst reizvolle Person. Vor allem konnten Sie sie, als sie ging, ungestört beobachten. Dabei aber müssen ihre Beine Ihnen aufgefallen sein.»
Und er gab ihm Feuer.
Wallmoden sah ihn an.
«Erstaunt Sie das so?» fragte der Unbekannte. «Es ist doch ziemlich naheliegend. Übrigens – wenn wir schon von solchen Dingen reden –: ich teile die momentan so allgemeine Bewunderung für gute Beine nicht unbedingt. Ich finde es sogar ein wenig oberflächlich, daß man etwas bewundert, in dem sich so gut wie gar kein Verstand und keine Seele ausdrückt. Mir persönlich sind schöne Augen lieber. Allein ich muß natürlich zugeben, daß es unserer Zeit vorbehalten geblieben ist, wirklich gute Beine zu sehen. Denn früher hatten die Frauen bestimmt keine so hübschen Beine.»
«Sie glauben?« fragte Wallmoden.
«Ich bin davon sogar überzeugt. Die Beine der Frau, zum Beispiel, die mich vor allem begeistert hat, sind gar nicht so besonders schön.»
«Das ist schmerzlich», sagte Wallmoden.
«Doch nicht so ganz.» Und dann fragte er unvermittelt: «Waren Sie je in Rom? Sie haben dort das einzig Sehenswerte wahrscheinlich übersehen.»
«Inwiefern?»
«Oder, zumindest, das Sehenswerteste. Kennen Sie das Thermenmuseum? Im Hof, der von Michelangelo entworfen sein soll, stehen lauter langweilige römische Statuen aus jenem trostlos grauen Stein, der eben noch gut genug war, die Romreisenden des achtzehnten Jahrhunderts zu entzücken. Aber es gibt da – ich glaube, wenn man in den westlichen Flügel tritt – ein Kabinett, das sein Licht durch ein gläsernes Dach empfängt, und dem Eintretenden bleibt förmlich der Atem stehn bei dem Anblick der einzigen, unerhörten Figur im Raum: eines an einen Delphin gelehnten Mädchens oder einer jungen Frau, einer Aphrodite aus parischem Marmor, dessen Wachs- oder Honigfarbe aus dem Steine in Strahlen hervorzubrechen und die Gestalt wie Weihrauch oder wie ein Nebel aus Gold zu umgeben scheint. Das Haupt und die Arme fehlen ihr, doch schließt man aus der Haltung des übrigen Körpers, daß es eine Meerentstiegene ist, die sich das Wasser aus den Haaren windet. Und man hat Gründe anzunehmen, dies könne keine andre als die berühmte Anadyomene sein, die Apelles nach einer Freundin Alexanders des Großen geschaffen hat, und zwar so wundervoll, daß der König dem Künstler das Mädchen schließlich schenkte.»
«Scharmant», sagte Wallmoden. «Allerdings haben dem Eroberer ja wirklich die Frauen der ganzen Welt zur Verfügung gestanden. Jedenfalls aber: es war dies der liebenswürdigste Gebrauch, den er von der Herrscherwürde machen konnte. Und ich bin auch durchaus damit einverstanden, wenn die Schönste dem Besten zufällt. Sie pflegt sich sonst dem Schlechtesten zuzuwenden. Mein Gott, muß der Bildhauer glücklich und muß das Mädchen unglücklich gewesen sein! –Allein wie heißt das Kunstwerk, von dem Sie so sehr schwärmen?»
«Aphrodite von Kyrene», sagte der Unbekannte, indem er von einer Dose mit Bonbons, die auf dem Tisch stand, den Deckel abhob und sie Wallmoden hinhielt. «Jedoch», fuhr er fort, «die Beine dieses göttlichen Geschöpfs, in das ich vom ersten Augenblick an verliebt war, sind nicht die besten. Und so mögen denn zum Beispiel auch Helenas Beine oder die der rothaarigen Phryne oder der weißen Prokris zu wünschen übriggelassen haben. Das lag, leider, im Stil der Zeit. Auch Alkibiades oder Antinous lassen sich ja in Reitstiefeln schwer vorstellen. Sie hätten viel zu plump gewirkt. Wir selber sind eben um genau so vieles reduziert, wie die Schicht stark ist, mit der unsere Kleider uns bedecken. – Wo aber, nebenbei bemerkt, sind eigentlich die Stiefel her, die Sie tragen? Es sind gute Stiefel.»
«Ach», sagte Wallmoden und blickte an sich hinab, «ich hatte sie schon im Kriege. Sie sind über zwanzig Jahre alt. Es ist das einzige Paar, das mir geblieben ist.»
«Das einzige? Dann gebe ich Ihnen den Rat, sich ein zweites machen zu lassen, und zwar bald.»
«Warum?»
«Weil Sie es brauchen werden.»
«Sie meinen?»
«Gewiß. Und anderwärts werden Sie keine Gelegenheit mehr haben, sich eins zu bestellen.»
«Anderwärts?»
«Allerdings. Ich wundere mich, offengestanden, daß Sie überhaupt noch hier sind.»
«Auch ich», sagte Wallmoden nach einem Moment und sah auf die Uhr, «wundere mich eigentlich darüber. Allein Sie haben so amüsant gesprochen! Nun aber werden Sie mich entschuldigen.» Und er stand auf.
«Wie? Sie wollen schon gehen?» rief der Unbekannte.
«Ich habe eine Verabredung.»
«Wiederum mit der Baronin, nicht wahr?»
«Woher glauben Sie das zu wissen?»
«Ich glaube es nicht nur, ich weiß es.»
«Hätte sie», fragte Wallmoden, «etwa für nötig befunden, Ihnen auch das zu telephonieren?»
«Nein», lachte der Unbekannte. «Sie hat natürlich kein Wort davon gesagt.»
«Woraus, also, schließen Sie es sonst?»
«Wenn man weiß», sagte der Unbekannte, «daß man mit einer Dame ausgehen wird, geht man nicht in Stiefeln aus, mögen sie auch so gut sein wie die Ihren, soeben besprochenen. Man zieht Salonhosen an. Ihre Verabredung muß also erst vor kurzem erfolgt sein. Denn Sie hatten ja keine Gelegenheit mehr, sich umzukleiden. Vor kurzem aber sind Sie wohl kaum in Gesellschaft einer andern Dame als der Baronin gewesen. Folglich gehen Sie mit der Baronin aus.»
«Sie haben wieder einmal recht», seufzte Wallmoden. «Aber um so eher werden Sie begreifen, daß ich nun fort muß.»
«Ach, bleiben Sie doch noch!» sagte der Unbekannte. «Es war eben so unterhaltend, und ich langweile mich, wenn ich allein bin. Aber ich schäme mich dessen nicht. Es gibt nichts Trostloseres als Menschen, die behaupten, daß sie sich nie langweilen.»
«Ich muß dennoch, fürchte ich, gehen.»
«Frauen pflegen zu spät zu kommen.»
«Aber nicht immer.»
«Bleiben Sie trotzdem. Denn kommt eine Frau einmal rechtzeitig, und der Mann, der sie erwarten soll, ist noch nicht da, so kehrt sie, wenn ihr nur irgend etwas an ihm liegt, um, um später wiederzukommen und so zu tun, als ob auch sie zu spät gekommen wäre. Und liegt ihr nichts an ihm, so steht ohnedies das ganze Rendezvous nicht dafür.»
«Auch das», sagte Wallmoden, «mag richtig sein. Es ist zwar eine Art Platitüde, aber es ist richtig, wie leider alle Platitüden.»
«Eben», sagte der Unbekannte. «Und meist ist nur das, was falsch ist, von einigem Geist. Es ist, als ob die Menschheit dadurch ihre Abneigung gegen die Wirklichkeit ausdrücken wollte, – die völlig phantasielos ist.»
«Sie glauben?»
«Ja. Selbst der schlechteste Schriftsteller ist doch imstande, bessere Geschichten zu erfinden als das Leben. Es zu ertragen ist uns nur möglich, weil wir es ganz unwirklich führen. Es gibt nichts Hoffnungsloseres, als in der Tat zwischen die Mühlsteine des Lebens zu geraten. Man wird dann genau wie die andern.»
«Ich bin nicht ganz Ihrer Meinung», sagte Wallmoden. «Ich habe, besonders in letzter Zeit, das Gefühl, daß das Leben auch sehr phantastisch werden könnte.»
«Das spricht nur für Sie», sagte der Unbekannte. «Denn wenn Sie sich prüfen, werden Sie finden, daß Sie selber alles dazu getan haben, während das Leben gar nichts dazu getan hat.»
Wallmoden, den diese Wendung des Gesprächs interessierte, war im Begriff, etwas zu erwidern. Aber der Unbekannte hatte sich inzwischen gleichfalls erhoben und sagte, er wolle Wallmoden nun doch nicht länger aufhalten. Denn es sei möglich, daß die Pistohlkors wirklich schon warte.
Und damit begleitete er den Gast in den Vorraum und verabschiedete ihn, – im Grunde ebenso plötzlich, wie er ihn hereingebeten hatte.
Als Wallmoden wieder im Wagen saß, begann er erst, sich über dieses Gespräch zu wundern. Denn wenngleich es eigentlich nur den Zweck gehabt haben mochte, eine Viertelstunde mit höflichen Phrasen auszufüllen, so war es, von dem andern, dennoch mit solcher Geschicklichkeit geführt worden, daß Wallmoden weder Gelegenheit gefunden hatte, das Zimmer anzusehen, in welchem es stattgefunden, noch die Züge seines Gegenübers zu studieren. An den Vorraum erinnerte er sich noch. Das Zimmer aber war um den unablässig Redenden verschwommen. – Ein kleiner Zwischenfall hatte sich ereignet, als Wallmoden das Haus verlassen. Im Hausflur nämlich war, aus einem dunklen Gange, der zur Wohnung des Hausmeisters führen mochte, ein Mensch auf ihn zugetreten, aber sogleich wieder umgekehrt, als er seiner ansichtig geworden. Daß sich der andre so rasch zurückzog, schrieb Wallmoden seiner – nämlich der eigenen – Uniform zu, vor allem einem Halsorden, den er trug. Es war ein – nebenbei bemerkt – ganz belangloser Orden. Er war ihm verliehen worden, als er einst, in Konstantinopel, einige Zeit Ordonnanzoffizier gewesen.
Es war doch schon ein wenig nach acht Uhr, als er wieder vor dem Hause der Pistohlkors hielt. Aber sie war noch nicht da. Er zündete sich eine Zigarette an und blickte zu den Fensterreihen hinauf. Das Haus war altmodisch und unansehnlich. Es fiel ihm auf, daß sowohl die Pistohlkors wie der Unbekannte in so vernachlässigt aussehenden Häusern wohnten. Das Haus des Unbekannten war geradezu häßlich gewesen.
Die Pistohlkors erschien nach einigen Minuten. Sie trug ein wenig Schmuck, und über dem Kleid einen weißen Mantel, – eine Art Abendmantel mit gerafftem und gefälteltem Kragen.
«Wer war eigentlich der Mann, zu dem Sie mich geschickt haben?» fragte Wallmoden.
«Gefiel er Ihnen denn nicht?» erkundigte sie sich.
«Doch. Ganz gut. Aber wer war es?».
«Ein Herr von Örtel.» Danach schwieg sie einen Moment, schließlich fragte sie: «Wohin fahren wir überhaupt?»
«Wohin Sie wollen.»
Er hatte gedacht, sie werde den Kahlenberg oder den Prater vorschlagen. Aber sie sagte: «Ins Grand Hotel?»