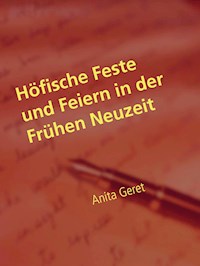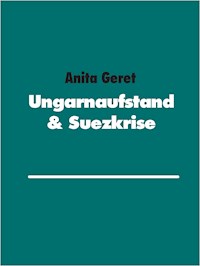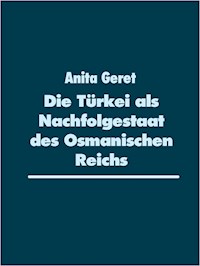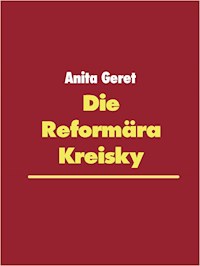3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Im 13. und 14. Jahrhundert kam es zur Gründung vieler Hospitäler, die als Vorläufer für die heutigen Krankenhäuser und Altersheime gelten. In diesem Buch werden die verschiedenen Funktionen dieser Hospitäler ebenso wie ihre Verwaltung und wirtschaftliche Bedeutung geschildert. Auch die Hospitalstatuten; die den Alltag in einem Hospital regelten, werden erläutert und das sogenannte Pfrundwesen, durch das sich reichere Bürger eine Versorgung in den Hospitälern kaufen konnten, wird thematisiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 36
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Das Hospital im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit
TitelseiteInhaltsverzeichnisEinleitung1. Das Hospital und seine Funktionen2. Verbürgerlichung des Spitals3. Das Leben im SpitalResümeeLiteraturverzeichnisImpressumKlappentext:
Im 13. und 14. Jahrhundert kam es zur Gründung vieler Hospitäler, die als Vorläufer für die heutigen Krankenhäuser und Altersheime gelten. In diesem Buch werden die verschiedenen Funktionen dieser Hospitäler ebenso wie ihre Verwaltung und wirtschaftliche Bedeutung sowie die medizinische Versorgung geschildert. Auch die Hospitalstatuten; die den Alltag in einem Hospital regelten, werden erläutert und das sogenannte “Pfrundwesen”, durch das sich reichere Bürger eine Versorgung in den Hospitälern kaufen konnten, wird thematisiert.
Über die Autorin:
Anita Geret wurde 1991 in Wels geboren. Sie studierte Germanistik und Geschichte in Salzburg und ist seither als Schriftstellerin, Lektorin und Historikerin tätig.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Das Hospital und seine Funktionen
1.1 Die Aufgaben des mittelalterlichen
Spitals
1.2. Arten von Spitälern
1.3 Das Hospital als Wirtschaftsbetrieb
1.4. Spitalstiftungen
2. Verbürgerlichung des Spitals
2.1. Der Prozess der Kommunalisierung
2.2. Die Verwaltung des Hospitals
2.3. Die Vergabe von Pfründen
2.3.1. Pfrundverträge
2.3.2. Hierarchie der Pfründer
3. Das Leben im Spital
3.1. Hospitalstatuten
3.1.1. Die Seckauer Hospitalordnung als
Beispiel
3.2. Die Hospitalinsassen
3.2.1. Zweiteilung der Insassen in „Arme und „Herrenpfründer“
3.3. Medizinische Verpflegung in den
Spitälern
3.3.1. Das Amt des Stadtarztes
4. Die Hohen Hessischen Spitäler als
Beispiel
Resümee
Literaturverzeichnis
Einleitung
Im 13. und 14. Jahrhundert stieg die Zahl an Hospitalgründungen stark an, denn der Anteil der Bevölkerung, der von Armut betroffen war, nahm in Europa zu dieser Zeit rasant zu und war zum einen durch Witterungskatastrophen und Überschwemmungen bedingt, zum anderen auch durch das Ansteigen der Preise. Im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit konnte man also aufgrund des drastischen Ausmaßes der Armut in Europa wahrhaft von einer regelrechten Massenarmut sprechen. Folglich sahen sich sowohl Privatleute – Bürger wie auch Adelige – als auch die Kirche gezwungen, Maßnahmen zu treffen, um dieses Problem unter Kontrolle zu bringen. Vor allem in den Städten, wo die Armut ihre größten Ausmaße erreichte, entwickelte sich bereits Ende des 13. Jahrhunderts die Tendenz, das Armutswesen besser in den Griff zu bekommen, und zwar durch Organisation, Zentralisierung und durch Kontrolle. Es vollzog sich daher eine Entwicklung hin von der persönlichen milden Gabe, die ein Privatmann einem Bettler reichte, um für sein eigenes Seelenheil zu sorgen, wie es im Mittelalter der Brauch war, zur organisierten Armutspolitik, die ihre Anfänge im 14. Jahrhundert fand. Zudem wurde in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts die Differenzierung zwischen Armutswirklichkeit und Armutsbewertung, also zwischen sogenannten würdigen und unwürdigen Armen vollzogen.
Bei der institutionell-amtlichen Armenfürsorge wird allgemein zwischen „geschlossener“ und „offener Armenpflege“ unterschieden. Unter „geschlossener Armenfürsorge“ versteht man die Pflege für Arme, Kranke, Alte und Waisen in einer eigenen Anstalt, dem sogenannten Hospital, während unter offener Pflege die gelegentliche oder auch regelmäßige Unterstützung von Armen gemeint ist, die nicht in solchen Anstalten lebten. Die Form der geschlossenen Armenpflege gilt als Vorläufer des modernen Krankenhauses. „Einen grundlegenden Ansatzpunkt hierfür bildeten die Hospitäler, wie sie im Mittelalter vor allem in den Städten überwiegend als multifunktionale Universalanstalten für jegliche Gattung von gesunden und mehr noch von kranken und gebrechlichen Armen eingerichtet wurden.“1
Dieses Buch soll nun ein umfassendes Bild über das spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Hospital in Europa liefern und dabei mehrere Aspekte, die mit diesen Fürsorgeeinrichtungen in Zusammenhang stehen, berücksichtigen.
Zuallererst werden die Aufgaben der damaligen Hospitäler erläutert, die oftmals vielfältiger sind, als es auf den ersten Blick scheinen mag. So wurden Hospitäler nicht nur aus Gründen christlicher Nächstenliebe, sondern auch aufgrund von wirtschaftlichen Zwecken und Prestigegründen errichtet.
Sowohl Einzelpersonen als auch Gruppen, wie etwa ein Laienkollektiv oder Institutionen wie der Rat einer Stadtkommune konnten von außen Einfluss auf die Hospitäler ausüben, ebenso wie diverse Wohltäter, die bestimmte Hospitäler durch Schenkungen oder Legate unterstützten. In manchen Spitälern wirkte eine Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern, die sich zwar einem religiösen Leben verschworen hatten, aber nicht Mitglieder eines bestimmten Ordens waren. Zudem gab es sogenannte Laienbruderschaften, die die Hospitäler zwar betrieben, sich aber nur um die Verwaltung kümmerten und diese kontrollierten, sich jedoch nicht in den Hospitalbetrieb selbst einmischten.
Überdies unterschieden sich die meisten Spitäler in Bezug auf die Insassen, da es beispielsweise eigene Einrichtungen für spezifische Krankheiten gab, die im Folgenden kurz angeführt werden. Außerdem werden die wirtschaftlichen Funktionen der Hospitäler aufgegriffen, da die Spitäler in der damaligen Zeit oftmals richtige Großbetriebe darstellten. Anschließend wird die Kommunalisierung – ein Prozess, der etwa im 14. Jahrhundert in den Städten einsetzte – näher behandelt werden, da er zu großen Veränderungen im Spitalwesen führte. In Zusammenhang mit der Loslösung der Spitäler aus kirchlichen Händen und der zunehmenden Verbürgerlichung werden auch die Pfründe angeführt, denn viele städtische Spitäler, die ursprünglich Fürsorgeanstalten für Arme und Kranke gewesen waren, bekamen durch das Pfrundwesen zunehmend den Charakter eines Altersheims im heutigen Sinne, da sich Bürger, die über ein gewisses Vermögen verfügten, mittels Pfründe einkaufen konnten.