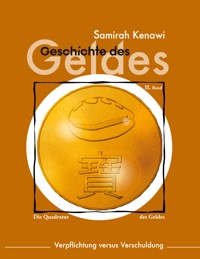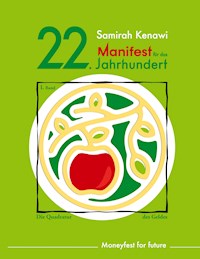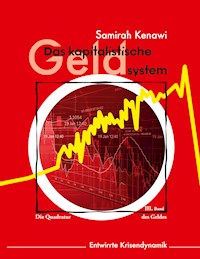
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Die Quadratur des Geldes
- Sprache: Deutsch
Kapitalismus bedeutet profitorientiertes Wirtschaften. Wie diese Idee entstand, wurde in der "Geschichte des Geldes" erzählt. Dieser Band zeigt, welche Auswirkung die Profitorientierung auf die Geldversorgung und den Wirtschaftskreislauf hat. Das Buch erklärt, das Geldakkumulation nicht grundsätzlich von Gier angetrieben wird. Es analysiert auch die Mechanismen, die zu einer immer schlechteren Geldverteilung im Kreislauf führen. Auf verständliche Weise wird das erschreckend banale Wesen der Finanzmärkte beschrieben. Vor allem aber wird der Ursprung der erstaunlichen Kreativität und Wandlungsfähigkeit des Kapitalismus blossgelegt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 222
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wir leben im Zeitalter des organisierten Diebstahls; eines so raffinierten Diebstahls, daß der Geschädigte kaum merkt, wie er bestohlen wird, und der Dieb seine Finger gar nicht beschmutzen braucht, um fremdes Gut an sich zu bringen.
Argentarius1
(Der Name ist ein Pseudonym. Das Wort stammt aus dem Lateinischen und bedeutet Bankier.)
Technische Hinweise
Zitierweise
In Zitaten wurde die Schreibweise des Originals beibehalten, die teilweise erheblich von der heutigen abweicht.
Bei Verweisen auf andere Teile der Tetralogie „Die Quadratur des Geldes“, siehe Seite 110, wird oft nur die Nr. des Teils angegeben.
Links
Unterstrichene Textteile sind im e-Buch als Link angelegt. Der Link findet sich in den Anmerkungen am Ende des Buches.
Gender
Soweit mir das Geschlecht der Akteur*innen nicht eindeutig bekannt war, habe ich mich um geschlechtsneutrale Formulierungen bemüht. Es ist ein Versuch auch in dieser Hinsicht Ansichten zu hinterfragen und neu zu denken.
Endnoten
1, 2, 3... Hochgestellte Zahlen verweisen auf Quellenangaben oder weiterführende Ergänzungen zum Text, siehe Anmerkungen am Ende des Buches.
Fußnoten
A, B, C... Hochgestellte Großbuchstaben verweisen auf Worterklärungen oder kurze Ergänzungen zum Text am Fuß der jeweiligen Seite.
Abkürzungen
d.A.
die Autorin
H.d.A.
Hervorhebung der Autorin
H.i.O.
Hervorhebung im Original
Jh.
Jahrhundert
Jhs.
Jahrhunderts
Ü.d.A.
Übersetzung der Autorin
Inhalt
1. Falschgeld
Ein elegantes Mittel zum Raub
2. Ausbeutung
Zivilisation besteht darin, die Peitsche durch Geld zu ersetzen
3. Nachfragelücke
Einfallstor für systematischen Diebstahl
4. Profitquelle
Feudales Geld finanziert seinen eigenen Untergang
5. Innovationskraft
Kreatives Potential wird zum destruktiven Zwang
6. Profitstreben
Vor der Gier kommt der Selbstschutz
7. Finanzmärkte
Eine destruktive Dynamik
7.1. Börsengeschichte
Kurze Geschichte des Wertpapierhandels
7.2. Geldmärkte
Vom Liquiditätszauber zur Geldschwemme
7.3. Kapitalmärkte
Das Geheimnis der Aktien – Wertsteigerung trotz Geldvernichtung
7.4. Finanzprodukte
Virtuelle Wertschöpfung
8. Geldkreislauf
Konträre Dynamiken
8.1. Kontokorrentkredite
Warengedeckte Geldschöpfung
8.2. Wirtschaftswunder
Intermezzo – Erfolg wider Willen
8.3. Investitionskredite
Gelddeckung durch Produktionsmittel
8.4. Hypothekenkredite
Bauen, weil wir Geld brauchen
8.5. Konsumkredite
Ratenkauf ermöglicht Profit
8.6. Auslandsverschuldung
Wär't ihr nicht arm, wär'n wir nicht reich
8.7. Staatsverschuldung
Staatsschulden ermöglichen private Vermögen
8.8. Sparen
Intermezzo – Drei Wege der Zukunftsangst zu begegnen
8.9. Innerbankenkredite
Der Finanzierungssektor als Geldmaschine
9. Geldfluss
Inflation – eine Therapie, die krank macht
9.1. Gelddeckung
Vom Verhältnis zwischen Geld- und Warenmenge
9.2. Geldmengen
Deflation, Inflation, Stagflation
9.3. Geldverwendung
Falsche Geldverwendung als Folge schlechter Verteilung
10. Landwirtschaft
Die Primärwirtschaft als Energiequelle der industriellen Revolution
11. Neuorientierung
Vom Sinn des Lebens
12. Anhang
12.1. Die Quadratur des Geldes – Eine Tetralogie
12.2. Danksagung
12.3. Vita
12.4. Literaturverzeichnis
12.5. Anmerkungen
Textkästen
Die Währungsreform 1948 in Deutschland
Deutsche Staatsschulden
1. Falschgeld
Ein elegantes Mittel zum Raub
Stiehlt einer ein Goldstück, dann hängt man ihn. Wer öffentlich Gelder unterschlägt, wer durch Monopole, Wucher und tausenderlei Machenschaften und Betrügereien noch so viel zusammenstiehlt, der wird unter die vornehmen Leute gerechnet.
Erasmus von Rotterdam2
In der Kunst gilt die Kopie eines Originals als falsch. Bei Kunstdrucken wird jede Kopie nummeriert und die Auflage möglichst klein gehalten. Auch Geldscheine werden nummeriert. Ihre Auflage steigt allerdings ins Unüberschaubare. Geld ist offensichtlich keine Kunst. Geld bezeichnen wir nur als falsch, wenn es unbefugt gedruckt wird. Doch Gelddrucken allein macht noch kein Geld. Aus den Bilanzen einer Zentralbank lässt sich klar erkennen, dass Geldscheine erst durch das Verleihen zu Geld werden.3 Erst die Scheine, die in Umlauf gelangen, sind Geld. Vorher sind sie gewissermaßen nur Kunstdrucke, d.h. kunstvolle Drucke, die im Tresor der Zentralbank verwahrt werden.
Die illegale Geldherstellung ist zweifelsfrei kriminell, doch erst die unbefugte Geldverwendung macht Geld zu einem Mittel des Raubs. Klar erkennbar wird das bei geraubtem Geld. Derart illegal angeeignetes Geld ermöglicht es, sich die Arbeitsergebnisse anderer anzueignen, ohne eine entsprechende Gegenleistung erbringen zu müssen. Illegale Geldherstellung ist verboten, weil das die Vorbereitung zu einem solchen Raub ist.
Was aber, wenn ganz legale Geldschöpferinnen, die Geschäftsbanken, Geld schaffen, ohne dass jene, die sich dieses Geld durch legale Geschäftspraktiken aneignen, dafür irgendwelche reale Gegenleistungen erbringen müssen? Erzeugen diese Banken dann nicht Falschgeld, nämlich Geld mit dem andere unbemerkt beraubt werden? Geld entstand doch ursprünglich, um den Gegenwert in einem Tauschakt zu vertreten. Geld, hinter dem kein Gegenwert existiert, macht aus einem Kauf folglich Diebstahl.
Derart definiertes Falschgeld wird heute weniger durch illegales Gelddrucken, sondern in gigantischem Ausmaß durch legale Geldschöpfung der Geschäftsbanken geschaffen. Dieses Falschgeld wird selten durch Diebstahl, sondern gewöhnlich durch legale Geschäfte erworben. Es unterscheidet sich von echtem Geld nicht im Aussehen, sondern dadurch, dass es leistungslos erworben wird. Die größte Geldfälschung wurde und wird so stets durch legale Geldschöpfung betrieben. Dieses Buch will zeigen, wie diese gewaltige Falschgeldproduktion entstand und wie sie funktioniert.
2. Ausbeutung
Zivilisation besteht darin, die Peitsche durch Geld zu ersetzen
Moderne Sklavenhändler reden sich ein, dass es besser sei, wenn verarmte Menschen einen Dollar am Tag verdienen, statt gar nichts, und dass sie ihnen die Gelegenheit bieten, sich in die Weltwirtschaft einzugliedern. Auch sie wissen, dass diese Menschen unverzichtbar sind für ihre eigene Wirtschaftsform, dass sie die Grundlage bilden für die Aufrechterhaltung ihrer Lebensform.
John Perkins4
Dieses Buch beschreibt das kapitalistische System der Ausbeutung. Es ist ein raffiniertes System. Es setzt weniger auf die Peitsche der Sklaventreiber*innen, dafür mehr auf ein ganz legales Mittel zur Aneignung fremder Güter: Geld. Möglich ist das, da nur ein Teil der Menschen für den Erwerb von Geld arbeiten muss. Den durch das Erbringen realer Leistungen erworbenen Arbeitseinkommen stehen gigantische, leistungslos erworbene Kapitaleinkommen gegenüber. Werden mit diesen Kapitaleinkommen Infrastrukturnetze, Grundstücke oder staatliche Immobilien gekauft, wird die Gesellschaft enteignet, denn reale Werte werden dann gegen nur scheinbar wertvolles Geld getauscht. Die komplexen Mechanismen der Verschleierung von Ausbeutung mit derartigem Falschgeld sollen hier aufgedeckt werden. Wann und warum begann die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen? War der Übergang von der nomadischen zur sesshaften Lebensweise der Auslöser, oder der damit einhergehende Übergang von der (durch Sammeln und Jagen) aneignenden zur (durch Ackerbau und Viehhaltung) produzierenden Wirtschaftsweise? Oder haben Knechtschaft und Sklaverei ihren Ursprung erst in der Herstellung von Bronzegeräten? Sicher ist, dass Ausbeutung eine lange Tradition hat. Sie ist ein finsterer Bestandteil der Menschheitsgeschichte. Schon die antiken Hochkulturen haben u.a. Knechte, Sklavinnen und Tributpflichtige stolz in ihren Wandreliefs verewigt. Ausbeutung erscheint dadurch wie ein in Stein gemeißelter Bestandteil menschlicher Gesellschaften. Sie hat sich im Laufe unserer Geschichte als scheinbar unvermeidliches Element tief in unser Bewusstsein eingebrannt.
Wir mögen Ausbeutung heute verbal verdammen. Doch der Kapitalismus hat ein System der Ausbeutung geschaffen, in dem wir sie oft gar nicht mehr erkennen. Möglich wurde das, weil sich nicht nur das Wesen des Geldes im Laufe seiner Evolution verändert hat. Auch die Formen der Ausbeutung haben sich im Laufe der letzten Jahrtausende gewandelt. Zwar gibt es auch heute noch Sklaverei und Zwangsarbeit, doch neben diesen direkten, sichtbar brutalen Formen der Ausbeutung findet Ausbeutung heute überwiegend unbemerkt statt. Diebe tragen schon lange Maßanzüge, Diebinnen Designermode.
Der allumfassende Raub findet im Kapitalismus auf so verschlungenen Wegen statt, dass es schwer ist Ross und Reiter*in zu enttarnen und das Gespinst zu entwirren. Das zentrale Mittel der Ausbeutung ist im Kapitalismus das Geld. Geld ist im Kapitalismus zu einem notwendigen Tauschmittel geworden. Es gibt kaum noch Möglichkeiten autark zu leben und sich dem Gebrauch von Geld zu entziehen. Doch es müssen nicht alle Menschen für Geld arbeiten. Der Kapitalismus hat völlig neue Möglichkeiten hervorgebracht, sich Geld ohne das Erbringen einer adäquaten Gegenleistung anzueignen. Problematisch ist, dass Falschgeld zu einem notwendigen Element im kapitalistischen Geldkreislauf wurde, denn dieser besteht aus zwei konträren Geldkreisläufen. Chronischer Geldmangel herrscht in der Realwirtschaft, dem Teil des Geldkreislaufes, in dem Lohngelder für real erbrachte Leistungen gezahlt werden. Die komplexen Ursachen für diesen chronischen Geldmangel werden in den folgenden Kapiteln dargelegt. Der Mangel erzeugt einen permanenten Druck auf die Arbeitseinkommen. Ohne Gegensteuerung würde es zu AbsatzkrisenA und daraus folgender Arbeitslosigkeit kommen. Deshalb erscheint es als Wohltat, dass in der Finanzwirtschaft Geld losgelöst von realen Leistungen geschaffen wird. Mit derartigem Falschgeld können sich die Profiteur*innen die Arbeit anderer formal legal aneignen. Die leistungslos erworbenen Kapitaleinkommen werden als selbstverständlich, ja als notwendig angesehen, weil durch sie dem chronischen Geldmangel in der Realwirtschaft entgegen gewirkt wird.
Wir werden sehen, warum die Summe der Arbeitseinkommen nie ausreicht, das gesamte produzierte Warenangebot zu kaufen. Wir werden sehen, auf welchen verschlungenen Pfaden die Kaufkraft, die fehlt, um den Markt leer zu kaufen, in den realwirtschaftlichen Geldkreislauf eingespeist wird. Ohne das zusätzliche Geld würden unverkaufte Waren den Anschein einer ÜberproduktionskriseB erzeugen. Produktionseinschränkungen hätten Entlassungen und sinkende Arbeitseinkommen zur Folge. Weiterer Absatzrückgang würde weiteren Produktionsrückgang bewirken. Diesem kapitalistischen Teufelskreislauf ist nicht durch Vergesellschaftung der Produktionsmittel, sondern nur durch Beseitigung der Fehlsteuerungen im Geldkreislauf beizukommen.
A Auf den Konflikt zwischen sozialen und ökologischen Problemen wurde bereits im 1. Teil (Kenawi (2021a), Kapitel 4.1 und 4.2: Sozialer bzw. Ökologischer Kollaps) hingewiesen. Heute erscheint Wegwerfproduktion notwendig, um Lohneinkommen zu sichern, was katastrophalen Ressourcenverbrauch, also ökologische Zerstörung zur Folge hat.
B Wegwerfproduktion und Konsumterror lassen es absurd erscheinen, das Phänomen Überproduktionskrise zu hinterfragen. Bei genauer Betrachtung zeigt sich jedoch vor allem Überfluss an Sinnlosem und zugleich Mangel an Notwendigem. Dieser scheinbare Widerspruch folgt aus dem destruktiven kapitalistischen Geldkreislauf, der zugleich Geldmangel und Geldüberfluss erzeugt.
3. Nachfragelücke
Einfallstor für systematischen Diebstahl
... so zirkuliert das Geld immer weiter, bis eines Tages jemand ein Darlehen zurückbezahlt. Dann verschwindet das Geld, kehrt es wieder in das Nichts zurück, aus dem es geschaffen wurde ...
Bernard A. Lietaer 5
Eine Grundthese der Schulökonomie besagt, dass die Produktion stets ihren eigenen Absatz schafft.A Gemeint ist, dass das durch die Produktionskosten in Umlauf gebrachte Geld ausreicht, die produzierten Waren zu kaufen. Mit anderen Worten: die Summe aller Arbeitseinkommen entspricht theoretisch der Summe aller Warenpreise. Doch diese Grundannahme, sämtlicher an den Universitäten gelehrten Volkswirtschaftstheorien, ist falsch. Ein Grund dafür findet sich in den geltenden Kreditgesetzen. Diese bewirken, dass die betrieblichen Ausgaben fremdfinanzierter (d.h. zumindest teilweise kreditfinanzierter) Unternehmen höher sind als die daraus entstehenden Arbeitseinkommen. Ein zweiter Grund findet sich in der ProfitideologieB. Machen wir zunächst tabellarisch transparent, warum die Summe der Arbeitseinkommen nicht ausreicht, die Gesamtheit der produzierten Waren zu kaufen. Analysieren wir, warum die Summe aller Warenpreise stets höher ist als die Summe aller Arbeitseinkommen. Die strukturelle Differenz zwischen Warenpreisen und Kaufkraft führt dazu, dass die Nachfrage nach Waren geringer ist als das Warenangebot. Es entsteht eine chronische Nachfragelücke.
Im Kapitel 8: Geldkreislauf wird schrittweise gezeigt, wie diese Lücke durch immer neue Geldquellen geschlossen wird. Doch bevor wir im Weiteren untersuchen, welche ökonomische Dynamik durch die chronische Nachfragelücke erzwungen wird, soll untersucht werden, wodurch sie entsteht. Die folgende Tabelle zeigt die zwei oben benannten Ursachen für das Entstehen der Nachfragelücke: die Kreditgesetze sowie die Profitideologie.
Tabelle 1: Preiskalkulation – Nicht alle Ausgaben werden zu Einkommen
Betriebsausgaben/Preisanteile
resultierende Einkommen/Kaufkraft
Materialkosten inklusive Strom, Gas etc.
Einkommen in Zuliefer, Netzbetreiber- sowie Versorgungsbetrieben
+
Lohnkosten
+
Einkommen der Beschäftigten
+
Steuern
+
Einkommen im Staatsdienst
+
Krankenversicherung
+
Einkommen im Gesundheitssektor
+
Rentenversicherung
+
Renteneinkommen
+ Ausgaben für Miete oder Pacht
+ Einkommen der Verwalter*innen und/oder Eigentümer*innen
Kreditrate/Kapitalkosten bestehend aus:
+
Zinsrate
+ Tilgungsrate
+
Einkommen der Bankangestellten
Kein Einkommen → Geldvernichtung
Weitere Unternehmenskosten
+
Gewinnauszahlung
+
Rücklagenbildung
+
Unternehmer*inneneinkommen
+
Reinvestitionen ins Unternehmen
Profit (möglicher, aber nicht
+
zwingender Gewinnanteil)
Keine Kaufkraft → Einnahmen der Unternehmen, die oft direkt oder indirekt in die Finanzwirtschaft fließen
C
Summe Warenpreise >Summe Kaufkraft
In der linken Spalte wurden alle betrieblichen Ausgaben aufgelistet. Diese Ausgaben muss ein Unternehmen natürlich später wieder einnehmen und deshalb in seine Preise einkalkulieren. Die betrieblichen Ausgaben bilden zugleich die Geldmenge, aus der spätere betriebliche Einnahmen entstehen können, denn die Ausgaben des Unternehmens werden bei anderen zu Einkommen.
Die Preiskalkulation zeigt nun aber, dass nicht alle Ausgaben der Unternehmen zu Einkommen werden. Zwischen der Summe der Ausgaben (aus der die Preissumme folgt) und der Summe der Einkommen (aus der die Kaufkraft folgt) besteht eine Differenz. Sie entsteht zum einen, weil das vom Unternehmen für die Kredittilgung ausgegebene Geld nicht zu Einkommen wird, da die Banken dieses Geld vernichten. Denn im heutigen Kreditgeldsystem führt Kredittilgung folgerichtig zum Verschwinden des zuvor für die Kreditvergabe geschaffenen Geldes. Aus diesem Grund müssen getilgte Kredite stets durch neue ersetzt werden, was z.T. ökologische Probleme erzeugt. Zum anderen wird die Differenz zwischen Warenpreisen und Kaufkraft durch einen Geldabfluss aus der Realwirtschaft vergrößert, den ich Profit nenne.6 Infolge dieses Geldabflusses reicht es nicht aus, getilgte Kredite einfach durch gleich große, neue zu ersetzen. Profit erzwingt, dass getilgte Kredite stets durch größere Kredite ersetzt werden müssen. Der durch die Profitideologie erzeugte stetige Geldabfluss aus der Realwirtschaft erzwingt so ein ständiges Wachstum der Gesamtgeldmenge.
Doch folgen wir zunächst der ersten Ursache der Nachfragelücke. So wie Geschäftsbanken bei Kreditvergabe Geld schöpfen, vernichten sie es bei Kredittilgung wieder. Wegen dieser Geldvernichtung werden die in den Preisen enthaltenen Tilgungsraten nicht zu Einkommen. Infolgedessen ist die Summe der Preise notwendigerweise höher, als die Summe der aus der Produktion resultierenden Arbeitseinkommen. Ohne ständigen Geldzufluss unabhängig von Warenproduktion würde der chronische Mangel an Arbeitseinkommen zu einer permanenten AbsatzkriseD führen, da die Summe der Arbeitseinkommen nie ausreicht, die Gesamtheit der Waren zu kaufen. Infolge des chronischen Mangels an Lohngeldern hat der Kapitalismus die Arbeitserlaubnis erfunden. Erwerbsarbeit wird zum Privileg, denn sie erlaubt, bei der Verteilung der knappen Arbeitseinkommen dabei sein zu dürfen. Menschen durch Verweigern einer Arbeitserlaubnis der Möglichkeit zu berauben für sich selbst zu sorgen, gehört zu den entwürdigenden, sozial zerstörerischen Elementen kapitalistischer Ökonomie.
Vergrößert wird die Differenz zwischen der Summe aller Preise und der Summe aller Arbeitseinkommen durch die zweite Ursache der Nachfragelücke: den Profit. Gewinne werden nach meiner Definition zu Profit, wenn sie aus der Realwirtschaft abfließen. Das geschieht, wenn Gewinnanteile weder durch Konsumausgaben der Unternehmer*innen noch durch Reinvestitionen ins Unternehmen in die Realwirtschaft zurückfließen.
Profit ist der Teil der Einnahmen, der zum Kauf von KapitaleigentumE verwendet wird. Die Existenz von Finanzmärkten macht einen Abfluss von Geld aus der Realwirtschaft nicht nur möglich, Renditeaussichten machen ihn auch verlockend. Da Profit als Gewinnanteil nur aus betrieblichen Einnahmen gezahlt werden kann, muss er in den Preisen enthalten sein. Ob Gewinn zu Profit gemäß meiner Definition wird, entscheidet sich jedoch erst durch die Geldverwendung. In Tabelle 1 ist Profit deshalb als möglicher, aber nicht zwingender Gewinnanteil ausgewiesen, da Profit eine schwer zu fassende ökonomische Größe ist.
Profit wird oft mit Gewinn gleichgesetzt. Doch Gewinn und Profit sind nicht unbedingt identisch. Beispielsweise muss, wer freiberuflich tätig ist, jährlich eine Gewinn- und Verlustrechnung beim Finanzamt einreichen. Der in dieser Rechnung ausgewiesene Gewinn ist zunächst das Einkommen der steuerpflichtigen Freiberufler*in. Eine Aktiengesellschaft weist in ihrer Gewinnund Verlustrechnung hingegen einen Gewinn aus, der nach Bezahlung aller im Unternehmen Tätigen, einschließlich der Manager*innen, verbleibt. Während der von freiberuflich Tätigen ausgewiesene Gewinn also deren Arbeitseinkommen darstellt, ist der von einer Aktiengesellschaft ausgewiesene Gewinn das Geld, das nach Auszahlung aller Arbeitseinkommen übrig bleibt. Der Gewinn einer AG wird zu Kapitaleinkommen, wenn er als Dividende ausgezahlt wird.
Hier zeigt sich, wie unbrauchbar der Begriff „Gewinn“ für eine kreislauftechnische Untersuchung ist. Zum einen sagt der Begriff nichts über die Herkunft des Geldes aus, also nichts darüber, ob es sich um Arbeitseinkommen oder um Kapitaleinkommen handelt. Zum anderen sagt er nichts über die Verwendung aus. Erst die Verwendung von Geld entscheidet aber über seine Wirkung im Geldkreislauf; darüber ob der Kreislauf gesichert oder gestört wird. Eine realwirtschaftliche Geldverwendung (für Konsum oder Investitionen) sorgt auch künftig für Lohngelder. Eine Geldverwendung für Wertpapierkäufe oder andere Vermögenswerte lässt, wie sich zeigen wird, Lohngelder knapp werden.
Um die Wirkung von Geldflüssen im Kreislauf Schritt für Schritt untersuchen zu können, müssen wir begriffliche Klarheit schaffen. Dazu müssen wir Geldgrößen stets von zwei Seiten betrachten. Auf der Einnahmenseite unterscheide ich zwischen Arbeitseinkommen u n d Kapitaleinkommen, also zwischen Lohneinkommen, die für reale Wertschöpfung gezahlt wurden und Einkommen, die aus dem Einsatz von Geld- und/oder Sachvermögen resultieren. Auf der Ausgabenseite unterscheide ich zwischen real- und finanzwirtschaftlichen Ausgaben, also zwischen Ausgaben für Konsum und Profit. Der Kürze wegen umfasst Konsum alle Ausgaben, die für direkten Konsum, aber auch für direkte Investitionen in die Realwirtschaft zurück fließen. Profit wird hingegen zum Kauf von Vermögenswerten wie Wertpapiere oder Sachvermögen verwendet. In jedem Fall ist Profit insofern überschüssiges Geld, als es nicht für die direkte Bedürfnisbefriedigung benötigt bzw. verwendet wird. Solcherart begrifflich gerüstet, können wir uns auf den Weg machen und der Spur des Geldes folgen.
A Gemeint ist das Saysche Theorem, siehe Kapitel 9.1: Gelddeckung. Die Behauptung des Ökonomen JeanBaptiste Say, dass jedes Angebot seine eigene Nachfrage erzeugt, wurzelt in der Idee, Geldwirtschaft sei nur eine verschleierte Tauschwirtschaft und Geld ein neutrales Tauschmittel. Doch Geld ist keineswegs neutrales Tauschmittel. So müssen die meisten viel für wenig Geld leisten, doch einige leisten wenig oder nichts für sehr viel Geld. Da Geld nicht neutral ist, kann Ausbeutung nicht durch Vergesellschaftung der Produktionsmittel aufgelöst werden. Um kapitalistische Ausbeutung zu beseitigen, ist eine tiefgreifende Neugestaltung des Geldsystems notwendig. So eine Neugestaltung muss von einer Reform des Eigentumsrechts sowie von weiteren gesellschaftlichen Reformen begleitet werden, siehe Teil 4.
B … der unhinterfragten Erwartung, eine Investition müsse mehr Geld einbringen, als sie kostet.
C Profit wird statt für Konsum zum Kauf von Vermögensgütern verwendet. Durch Kauf von Wertpapieren fließt Profit direkt in die Finanzwirtschaft. Werden Immobilien gekauft und ver mietet, stellen erst daraus resultierende Miet- oder Pachteinnahmen Kapitaleinkommen dar.
D In Zeiten von Konsumterror und Wegwerfproduktion zugleich von Absatzkrisen zu sprechen, scheint widersinnig. Tatsächlich muss dieses Problem dialektisch betrachtet werden. Absatzkrisen entstehen, da die Arbeitseinkommen nie reichen, die damit produzierte Warenmenge zu kaufen. Dem Kaufkraftmangel wird jedoch nicht durch Lohnerhöhung begegnet, sondern durch Ausweitung der Warenproduktion. Dazu werden zunehmend sinnlose und immer kurzlebigere Wegwerfprodukte hergestellt, denn ohne Wirtschaftswachstum würde der Lohnmangel zu Absatzkrisen und in der Folge zu steigender Arbeitslosigkeit führen. Hier zeigt sich ein Konflikt zwischen sozialen und ökologischen Zielen. Um die sozialen Probleme zu begrenzen, werden schnell verschleißende Konsumgüter produziert und Ressourcen sinnlos verschwendet.
E Kapitaleigentum ist Eigentum, das nicht selbst genutzt wird, sondern u.a. durch Vermieten oder Verpachten, aber auch durch Wertpapierhandel und andere Spekulationsgeschäfte zur Quelle leistungsloser Kapitaleinkommen wird. Zum Kapitaleigentum gehören folglich alle Arten von Wertpapieren, aber auch nicht selbst genutzte Immobilien, sowie andere spekulative Vermögensgüter wie z.B. Kryptowährungen oder Kunstobjekte.
4. Profitquelle
Feudales Geld finanziert seinen eigenen Untergang
Das reichste Land der Welt lebt von Schulden.A Schon 1543, als Potosis Reichtum noch unbekannt ist, doch die ungeheure Edelmetallbeute von Cajamarca, aus der Plünderung der märchenhaften Schätze von Cuzco und anderer Städte dem spanischen Staatssäckel unerwartete Nahrung liefert, müssen 65 Prozent der Einnahmen des Hofes verwendet werden, um die Gläubiger zu befriedigen: die Fugger, Welser, Doria, Grimaldi und andere Bankhäuser Europas.
Günter Ludwig7
Die Anfänge des Kapitalismus waren von Schweiß, Blut und Tränen geprägt. Der Manchesterkapitalismus wurde von einem entfesselten Profitstreben angetrieben. Möglich wurden die Profite durch ständige Ausweitung der Geldmenge. Nicht allein Profitstreben, sondern auch die von Lohnarbeit abhängig werdenden, wachsenden Arbeitsheere erzwangen die Ausgabe immer neuer und immer größerer Kredite. Private Profitinteressen schufen einen Anreiz – gesellschaftliche Krisen infolge Erwerbslosigkeit hingegen einen Zwang – zu ständiger Kreditausweitung. Privater Anreiz und gesellschaftlicher Zwang trugen und tragen gleichermaßen zur enormen Wandlungsfähigkeit und innovativen Kraft des Kapitalismus bei, weil neue Kredite meist hohe Profite versprechen, wenn in neue Technik investiert wird.
Während im Feudalismus Arbeit der Befriedigung der natürlichen Lebensbedürfnisse dienen sollte, zielt sie im Kapitalismus darüber hinaus auf ungebremste Geldakkumulation, denn Geldbesitz macht nun doppelt Sinn. Geld dient nicht mehr nur dem Konsum, sondern es kann im Börsenhandel auch ohne den Umweg über irgendeine Warenproduktion vermehrt werden. Kreditgeld und Börsen erzeugen die spezifische ökonomische Logik und Dynamik des Kapitalismus. Wir akzeptieren beides unhinterfragt, da beides seit Jahrhunderten existiert und nicht erst die Generationen unserer Eltern und Großeltern in dieser Logik aufgewachsen sind. Trotzdem stellt sich die Frage, wie dieses System entstehen konnte? Wie konnte die ökonomische Logik sich so tiefgreifend verändern? Wie konnte aus der feudalistischen, auf Bedürfnisbefriedigung orientierten Ökonomie die kapitalistische, auf Profitakkumulation orientierte Ökonomie entstehen?
Im Frühkapitalismus ab dem 15. Jh. war die freie Münzprägung des Adels und KlerusB die Quelle des Profits. Wenn Kaufleute aus dem nahen und fernen Osten und von den afrikanischen Küsten des Mittelmeeres mit exotischen Waren zurückkamen, verkauften sie ihre Luxusgüter vorzugsweise an den zahlreichen Höfen Europas oft für ein Mehrfaches des Einkaufspreises. Die hohen Preise schienen durch die hohen Transportkosten und die hohen Verluste während des Transportes sowie die zahlreichen Wegesteuern gerechtfertigt. Doch im Allgemeinen überstiegen die Einnahmen sämtliche Ausgaben deutlich. Mit Pfeffer ließ sich damals so viel Geld verdienen, dass reiche Leute Pfeffersäcke genannt wurden. Folglich begann durch Fernhandel verdientes Geld die Truhen der Kaufleute nach und nach zu füllen. Möglich war das, weil Geldschöpfung durch Münzprägung völlig unabhängig von der Warenproduktion stattfand.
Münzherren ließen oft so viele Münzen prägen, wie es das vorhandene Edelmetall hergab. Diese freie Münzprägung ermöglichte es dem spanischen Hof nach der Eroberung Amerikas etwa eineinhalb Jahrhunderte lang Luxusgüter zu finanzieren, die wie das Münzmetall überwiegend aus dem Ausland kamen.
Was Adel und Klerus an Münzgeld in die Welt setzten, wurde von den Kaufleuten jedoch nicht nur gehortet. Da Europa damals wenig produzierte, was im Ausland Absatz fand, mussten Kaufleute begehrte Luxusgüter im Ausland mit Münzgeld bzw. Edelmetall bezahlen. Feudales Münzgeld diente (genau wie in der Bronzezeit, als das Metallgeld entstand) zunächst dem Fernhandel. Folglich war das mittelalterliche Geld zunächst Handelskapital. Nicht nur antike römische Münzen, sondern auch mittelalterliche europäische Münzen werden deshalb bei archäologischen Grabungen oft außerhalb Europas, weit entfernt von den Prägeorten gefunden. Infolge des stetigen Geldabflusses ins Ausland wuchs die europäische Münzmenge nicht kontinuierlich durch ständiges Prägen neuer Münzen. Vielmehr bewirkten unkoordinierte Zu- und Abflüsse von Geld eine schwankende Geldversorgung. Stabilisiert wurde die Wirtschaft, weil große Bereiche noch von Selbstversorgung oder direktem Tauschhandel geprägt waren. Doch das Gleichgewicht zwischen Münzprägung und Münzabwanderung war fragil. Als die freie Münzprägung infolge knapper werdender Edelmetalle Anfang des 14. Jhs. zu schrumpfen begann,8 geriet der Frühkapitalismus in eine Krise. Durch eine Kette von Ereignissen, an deren Anfang der überschuldete englische Hof stand, kam es Mitte des 14. Jhs. in Florenz zum Bankrott.
Die Peruzzi wissen, was jetzt geschehen wird. Sie warten den Ansturm ihrer Gläubiger erst gar nicht mehr ab, sondern erklären Ende Oktober [1343] ihren Bankrott und übergeben die Geschäftsbücher der Stadt. … Auch die beiden anderen großen Handelshäuser der Stadt brechen zusammen: die Acciaiuoli im Oktober 1343, die Bardi im April 1346.
In Italien, dem Land in dem die Entwicklung des Kreditgeldes vom Münzwechsel zum Eigenwechsel ihren Anfang genommen hatte, gefährdete dieser Zusammenbruch ein Ausreifen des Kreditgeldsystems. In der Kinderstube des Kapitalismus drohte das neue Wirtschaftssystem den Kindstod zu sterben. Doch die Idee, mit Geld Geld um des Geldes willen zu verdienen, war nicht mehr aus der Welt zu schaffen. Allerdings lag dieser Idee, wie bereits erwähnt, der Bedarf an Handelskapital für den Fernhandel zugrunde. Europas Mangel an Gütern, die auf den asiatischen und afrikanischen Märkten Nachfrage fanden, hatte zur Folge, dass Münzgeld ein notwendiges Arbeitsmittel für die Fernhandelskaufleute war. Aus der spezifisch europäischen Notwendigkeit Edelmetall für den Fernhandel zu benötigen, erwuchs vor dem Hintergrund des christlichen Zinsverbots das spezifisch europäische Kreditsystem mittels Rückwechsel.9
Solange der Adel das Geld für seinen Luxusbedarf durch eigene Münzprägung schuf und den Geldabfluss ins Ausland sowie in die Truhen der Kaufleute durch Erzgewinnung und neue Münzprägung ausgleichen konnte, funktionierte die Geldversorgung irgendwie. Aus den Fugen geriet dieses System zum einen durch Erzmangel, in besonderer Weise aber durch den gewaltigen Erzzufluss aus Amerika. Der im 16. Jh. einsetzende Zufluss an Edelmetall ermöglichte eine enorme Ausweitung der Münzprägung. Dadurch schwollen die Geldhorte in den Truhen der Kaufleute an. Sie begannen nach neuen Anlagemöglichkeiten für dieses Geld zu suchen. Das setzte die Dynamik des Kapitalismus in Gang.
Neben Kredite für den Fernhandel traten Kredite für den Adel und in Italien auch für die Städte. Der Staat wurde als Rentenzahler entdeckt. Die Zinsen auf Staatsschulden verschafften denen, die diese Schuldscheine besaßen, oft dauerhafte Einnahmen. So bezogen jene, die dem Staat ihr überschüssiges Geld verleihen konnten, aus den Steuern der Allgemeinheit eine Rente als Kapitaleinkommen. Auf lange Sicht förderten das amerikanische Gold und Silber nicht den Reichtum des Adels, sondern den der Kaufleute. Zwar wurden die Münzen noch frei geprägt, doch dienten sie in immer größerem Umfang nur noch zum Bezahlen der Schulden.10 Insbesondere der spanische Hof lebte bedenkenlos auf Pump, nicht ahnend, dass er für seinen Luxus doppelt und dreifach bezahlen musste. Die selbst ernannten Eigentümer der eroberten Gebiete westlich des Atlantiks gaben Geld aus, in Erwartung künftiger Gold- und Silberlieferungen aus der „Neuen Welt“. Diese Staatskredite wurden mit Wechseln abgewickelt. Diese Wechsel wurden mit all den anderen Handelswechseln auf den großen Messen verrechnet. Da der Staat keinen Handel trieb, musste er, anders als die Mehrheit der Kaufleute, seine Wechsel in klingender Münze bezahlen. Durch Kreditrückzahlungen der Spanier flossen im 16. und 17. Jh. so gewaltige Mengen an Gold und Silber in Europas Wirtschaft. Auch die Fugger waren im lukrativen Kreditgeschäft mit dem spanischen Hof aktiv. Fuggers Hauptbuchhalter Matthäus Schwarz resümiert in seinen Hinterlassenschaften:
Interesse [Zins, d.A.] ist höfflich gewuchert, Finantzen [Finanzgeschäfte treiben, d.A.] ist hofflich gestolen11
Finanzgeschäfte mit den Staaten versprachen nicht nur enorme Profite, sie lieferten den Treibstoff für die sich entwickelnde kapitalistische Profitwirtschaft. Durch Rückzahlung von Staatsschulden floss immer neues Münzgeld in die Truhen der Kaufleute. Möglich wurde das Rückzahlen immer größerer Staatskredite durch das Ausplündern der amerikanischen Erzlagerstätten.
Das historische Zusammentreffen der Entwicklung des Kreditgeldes im christlichen Abendland (im 14. Jh.) und der etwas zeitverzögerten Eroberung und Plünderung Amerikas durch europäische Christen (ab dem 16. Jh.) ermöglichte im 16. und 17. Jh. eine mehr oder weniger kontinuierliche Profitakkumulation. Gigantische Geldvermögen sammelten sich in dieser Zeit in wenigen Händen. Als es 1557 zu einem ersten, fast europaweiten Staatsbankrott kam,12 konnte nichts und niemand die Idee aus der Welt schaffen, wirtschaftliche Aktivitäten müssen in jedem Fall mehr Geld einbringen als sie erforderten. Vor allem Staatskredite brachten viel mehr Geld ein, als sie kosteten. Deshalb konnte Spanien im 16. und 17. Jh. trotz wiederholter Staatsbankrotte13 immer wieder neue Kredite aufnehmen. Zwar schlugen Verluste bei Einzelnen schwer zu Buche, doch waren andere zuvor an den Krediten reich geworden.
Als der Holländer Piet Hein 1627 aber mit seiner Flotte 22 von 30 Schiffen einer spanischen Silberflotte eroberte und damit umgerechnet 11-15 Mio. Gulden erbeutete, war der Kredit der spanischen Krone aufgebraucht. Diese Seeschlacht löste den 5. spanischen Staatsbankrott aus.14