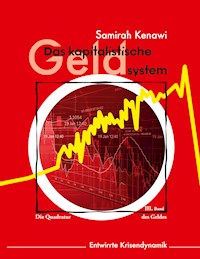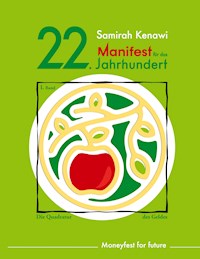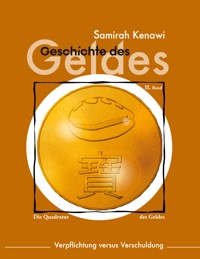
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Die Quadratur des Geldes
- Sprache: Deutsch
David Graeber sieht in Schulden eine Ursache für Kriege, was historisch vielfach stimmt. Doch Schulden werden auch Verbindlichkeiten genannt. Tatsächlich können Schulden auch Verpflichtungen darstellen, die eine soziale Gemeinschaft binden, statt sprengen. Dieses Buch geht den Unterschieden von Geschenkwirtschaft, Tauschwirtschaft und Geldwirtschaft nach und wirft auch einen Blick auf das Kerbholzsystem. Es rekonstruiert die Entstehung, Entwicklung und Veränderungen des Geldes vom prähistorischen Tauschhandel bis zum heutigen Kreditgeld. Diese Geldgeschichte ermöglicht einen neuen Blick auf die Zukunft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 317
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Man kann das Geld nur erschöpfend wissenschaftlich behandeln, wenn man es mit dem Auge des politischen Ökonomen betrachtet. Die bisherige Methode aber gleicht der des Botanikers. Wie dieser eine Pflanze in der Natur nach ihren Merkmalen bestimmt und in sein System eingliedert, so hat man die Münze nach kulturhistorischer Vergangenheit und gegenwärtigem Gebrauchszweck studiert, ohne zu beachten, daß man eine bloße Erscheinungsform mit dem Wesen der Sache verwechselt.
Friedrich Bendixen1
Technische Hinweise
ZITIERWEISE
In Zitaten wurde die Schreibweise des Originals beibehalten, die teilweise erheblich von der heutigen abweicht.
Bei Verweisen auf andere Teile der Tetralogie „Die Quadratur des Geldes“ wird nicht immer der volle Titel aufgeführt, sondern meist nur die Nr. des Teils.
Kurze Inhaltsangaben zu den einzelnen Teilen finden sich auf S. →.
LINKS
Unterstrichene Textteile sind im EBuch mit einem Internetlink hinterlegt.
GENDER
Soweit mir das Geschlecht der Akteur*innen nicht eindeutig bekannt war, habe ich mich um geschlechtsneutrale Formulierungen bemüht. Es ist ein Versuch auch in dieser Hinsicht Ansichten zu hinterfragen und neu zu denken.
ENDNOTEN
1, 2, 3... Hochgestellte Zahlen verweisen auf Quellenhinweise am Ende des Buches, siehe Anmerkungen im Anhang.
FUSSNOTEN
A, B, C... Hochgestellte Großbuchstaben verweisen auf Worterklärungen bzw. Ergänzungen zum Text am Fuß der jeweiligen Seite.
ABKÜRZUNGEN
d.A.
die Autorin
H.d.A.
Hervorhebung der Autorin
H.i.O.
Hervorhebung im Original
Jh.
Jahrhundert
Ü.d.A.
Übersetzung der Autorin
u.Z.
unsere Zeit
v. Chr.
vor Christus
v.u.Z.
vor unserer Zeit
Inhalt
1. Vorwort
Geschichte eröffnet neue Horizonte
2. Tauschsysteme
Tausch im sozioökonomischen Kontext
2.1. Geschenkwirtschaft
Seit Anbeginn
Ein Netzwerk aus Verbindlichkeiten und Verpflichtungen
2.2. Tauschwirtschaft
Wahrscheinlich seit 10 000 Jahren
Wertausgleich ohne Maßstab
2.3. Geldwirtschaft
Seit etwa 5 000 Jahren
Der Doppelcharakter des Geldes – Kaufmittel und Kapital
2.4. Kerbholzwirtschaft
Seit grauer Vorzeit bis Anfang des 20. Jahrhunderts
Ein Sonderweg mit langer Tradition
3. Entwicklung des Münzgeldes
Vom Tauschgut zum Tauschmittel
3.1. “Prestigegeld“
Seit grauer Vorzeit
Wertvolle Geschenke – Verschenkte Wertsymbole
3.2. Nutzgeld
Wahrscheinlich seit 10 000 Jahren
Ware und Geld – Geld oder Ware
3.3. Gerätegeld
Vor etwa 5 000 bis 3 000 Jahren
Tauschmittel im Fernhandel
3.4. Hortfunde
Seit etwa 4 000 Jahren
Verschollenes Handelskapital – Sinnbild nutzloser Arbeit
3.5. Kümmerformen
Vor etwa 3 200 Jahren
Vom Warenwert zum Wertsymbol
3.6. Barrengeld
Vor etwa 4 000 bis 2 500 Jahren
Die Geburt des Geldschöpfungsgewinns
3.7. Münzgeld
Seit etwa 2 600 Jahren
Kaufleute als Akzeptanten
4. Münzwert
Vom Wert des Vertrauens
5. Münzerfolg
Naturalwirtschaft als Stabilisator
6. Münzversagen
Geldkrisen und Kulturkollaps
7. Brakteaten
Intermezzo – Mitte 12. bis Mitte 14. Jahrhundert
Münzverrufung zur feudalen Geldbeschaffung
8. Entstehen des Kreditgeldes
Kreditgeld: 1. Teil – Das Geld der Kaufleute
8.1. Wechsel
Seit dem 12. Jahrhundert
Ein Wechselbrief ersetzt den Geldtransport
8.2. Zinsverbot
Seit dem 5. Jahrhundert
Ein Tabu wird zum Entwicklungstreibstoff
8.3. Rückwechsel
Spätestens seit dem 14. Jahrhundert
Verwirrspiel zur Verschleierung des Kreditzinses
8.4. Eigenwechsel
Wahrscheinlich seit dem 14. Jahrhundert
Mit dem Kreditgeld entsteht der Kredithebel
8.5. Wechselübertragung
Spätestens seit dem 15. Jahrhundert
Indossament – Eine Urkunde wird Zahlungsmittel
8.6. Bankakzept
Wahrscheinlich seit dem 16. Jahrhundert
Die Bank als Bürgin – Der gute Name der Bank
8.7. Buchhalten
Doppelte Buchführung seit Ende des 15. Jahrhunderts
Übersicht über das Vermögen
9. Kreditfalle
Die neue Macht des Großbürgertums
10. Entwicklung des Kreditgeldes
Kreditgeld: 2. Teil – Das Geld der Banken
10.1. Golddepotscheine
Mitte des 17. Jahrhunderts
Die Illusion der Golddeckung
10.2. Banknoten
Seit 1695
Deckung durch Staatsschulden
10.3. Bankbilanz
Seit 1695
Das Geheimnis des neuen Midas
10.4. Wertpapiere
Spätestens seit dem 14. Jahrhundert
Staatsentschuldung durch Schuldscheinhandel
10.5. Zettelgeld
Seit dem 10. Jh. in China, seit dem 13. Jh. in Europa
Staatliche Bankzettel – ein chinesisches Modell
10.6. Notenbank
Seit 1695
Entlassung aus der persönlichen Haftung
10.7. Goldstandard
Seit 1695, offiziell erst seit dem 19. Jahrhundert
Von der Götzenanbetung zum Ende der Bareinlösung
10.8. Zentralbank
Faktisch seit dem 18., offiziell erst seit dem 20. Jahrhundert
Von der Notenbank zum zweistufigen Bankensystem
10.9. Papiergeld
Endgültig seit dem 20. Jahrhundert
Schuldscheine, Devisenstandard und Petrodollar
10.10.Buchgeld
Seit dem 20. Jahrhundert
Doppelte Befreiung des Geldes von der Arbeit
11. Geldstoff
Entmaterialisierung des Zahlungsmittels
12. Zinsen
Älter als das Geld
13. Machtwechsel
Politische Folgen verlorener Geldschöpfungshoheit
14. China
Beispiel für eine außereuropäische Geldentwicklung
15. Geldschöpfungsmacht
Markt oder Staat
16. Anhang
16.1. Danksagung
16.2. Vita
16.3. Tetralogie
Übersicht über die 4 Teile der „Quadratur des Geldes“
16.4. Literaturverzeichnis
16.5. Anmerkungen
TEXTKÄSTEN
Kapitel: 3.7. Münzgeld
Salzgeld
Geldwert – Gesetzeskraft versus Marktkräften
Das Geld der Griechen
Kapitel: 10.2. Banknoten
Die Stockholms Banco – Die schwedische Notenbank
Kapitel: 12. Zinsen
Das elfte Lederstück/Ist Zins unmöglich?
GRAFIKEN
Kapitel: 2.4. Kerbholzwirtschaft
Abbildung 1: Gespaltenes Kerbholz zum Aufzeichnen von Guthaben und Schulden
Kapitel: 5. Münzerfolg
Abbildung 2: Wertschöpfungskonflikt bei konstanter Warenund Münzproduktion
Abbildung 3: Verzögertes Sichtbarwerden des Wertschöpfungskonfliktes
TABELLEN
Kapitel: 10.3. Bankbilanz
Tabelle 14: Modellhafte Bankbilanzen der Bank von England
Kapitel: 10.7. Goldstandard
Tabelle 5: Auslösen der Deflationskrise vom 22.8. bis 24.10.1907
1. Vorwort
Geschichte eröffnet neue Horizonte
Wer in der Zukunft lesen will, muss in der Vergangenheit blättern.
André Malraux2
Wer über Geld schreibt, steht vor einem Dilemma, denn das Thema ist komplex. Aspekte weglassen, diskreditiert das Buch in den Augen der Fachleute. Zu viele Aspekte berücksichtigen, macht es für Fachfremde verwirrend. Diese Geschichte des Geldes wagt den Spagat. Beim Streifzug durch die Jahrtausende blickt das Buch nur soweit nötig auf die vielfältigen Erscheinungsformen des Geldes. Es sucht jedoch immer nach dem Wesen der jeweils verwendeten Zahlungsmittel. Ziel ist es, Entstehung, Entwicklung sowie die verschiedenen Veränderungen des Geldes bis hin zum heutigen Kreditgeld zu rekonstruieren.
Wie alles was existiert, ist auch Geld dem ewigen Wandel unterworfen. Geld hat gewissermaßen eine Evolution durchlaufen. Die Spuren dieser Entwicklung finden sich bis heute in den finanztechnischen Regelwerken. Diese Geschichte des Geldes ist deshalb kein Selbstzweck. Erst das Wissen über die Entwicklung des Geldes macht die Gegenwart verständlich. Nur auf dieser Grundlage können tragfähige Reformen geplant werden. Erst ein Verständnis der Vergangenheit ermöglicht, Zukunft zu gestalten. Doch die Gegenwart wird uns erst im 3. Teil und die Zukunft erst im 4. Teil dieser Tetralogie (siehe S. 162) beschäftigen.
Bevor wir unsere Reise durch die Geschichte des Geldes beginnen, möchte ich einen Überblick über die Entwicklung der Austauschverhältnisse geben. Ich glaube, auch hier eine Entwicklung zu sehen. Nach meinem Verständnis haben sich die Austauschverhältnisse in Wechselwirkung mit den Produktionsverhältnissen entwickelt. Ursachen für die entstehende Ausbeutung sehe ich sowohl in den Produktionsverhältnissen als auch in den Austauschverhältnissen.
Unsere Geschichte beginnt lange vor Entstehung der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen. In grauer Vorzeit lebten Menschen als Nomaden von der Hand in den Mund. Ihr Überleben war von der Natur, aber auch von der Gemeinschaft ihrer Horde, ihres Clans abhängig. Die Abhängigkeiten innerhalb der Menschengemeinschaften schufen Verbindungen, gegenseitige Verpflichtungen. Im Laufe des Prozesses des Sesshaftwerdens wurden Personenbindungen immer stärker durch Sachbindungen verdrängt. Aus Geschenken wurden Tribute. Verpflichtungen wurden zur Pflicht. Indem Verpflichtungen festgeschrieben wurden, entstanden erdrückende Schulden. Dazu war nicht zwingend Geld erforderlich.
2. Tauschsysteme
Tausch im sozioökonomischen Kontext
Solange das Volk, der Stamm, das Geschlecht die Wirtschaftseinheiten waren, gab es innerhalb derselben keinen Handel; ebensowenig innerhalb der Marktgenossenschaft, der Grundherrschaft, der ihr untertänigen Dorfgemeinschaft. … Handel fand bloß mit Angehörigen fremder Wirtschaftseinheiten statt, wenn solche gelegentlich mit Gütern nahten, mittels derer sie die Begehrlichkeiten und neue Bedürfnisse weckten, um das, wonach sie verlangten, zu erhalten.
Alfons Dopsch3
David Graeber ist wie Gunnar Heinsohn und Otto Steiger der Ansicht,
Geld und Schulden tauchen im selben Augenblick auf der Bühne auf.4
Heinsohn und Steiger vertreten diese Ansicht, weil sie das heutige Kreditgeldsystem in die Vergangenheit zurück projizieren. Wie wenig glaubwürdig mir dies erscheint, habe ich bereits im 1. Teil dieser Tetralogie (siehe S. 162) im Zusammenhang mit der Geschichte des Eigentums skizziert.
Auch Graebers Ansicht, dass Geld und Schulden im gleichen historischen Augenblick entstanden sind, teile ich nicht. Zum einen sehe ich eine Wurzel der Verschuldung im Übergang von der Geschenkwirtschaft zur Tauschwirtschaft, im Verleihen von Saatgetreide. Zum anderen sehe ich nicht, dass Geldschulden zeitgleich mit dem Geld entstehen. Kreditaufnahme in Geld wird erst notwendig, wenn Geld notwendiges Tauschmittel geworden ist. Als Geld erstmals in die Welt trat, kann es aber noch kein notwendiges, sondern nur ein mögliches Tauschmittel neben anderen gewesen sein. Für eine Kreditaufnahme in Geld gab es daher im Augenblick der Geldentstehung keinen Grund. Kreditaufnahme in Geld wurde erst nötig, als Geld bereits übliches, wenn nicht sogar notwendiges Tauschmittel geworden war. Voraussetzung für die Kreditaufnahme war zudem, dass Geld inzwischen sehr ungleich verteilt war. Kredit konnte nur geben, wer Geld im Überfluss hatte und Kredit musste nur nehmen, wer unter Geldmangel litt. All das kann nicht bereits im Augenblick der Entstehung des Geldes da gewesen sein. Natürlich stellt sich die Frage, was ist Geld?
Tatsächlich tut sich hier ein weites Feld für Interpretationen auf. Wenn wir Schuldkontrakte Jahrtausende vor dem Prägen der ersten Münze finden, stellt sich die Frage, was waren das für Schulden? Um auf all diese Fragen Antworten zu finden, muss unsere Geschichte des Geldes vor dem Entstehen des Geldes beginnen. Wir müssen versuchen, die Welt vor dem Auftauchen von Geld zu verstehen.
Es gibt Theorien, die behaupten, Geld sei nicht aus dem Tauschhandel entstanden. Diese Theorien gründen sich mehr oder weniger darauf, unser heutiges Kreditgeldsystem in die Geschichte zurück zu projizieren. Danach soll Geld ursächlich aus Kreditaufnahme hervor gegangen sein. Wie oben skizziert, ergibt diese These für mich keinen Sinn. Ich halte das Naheliegende – Geld entstand im Tauschhandel – auch für das Logische. Allerdings denke ich, dass es vor dem Entstehen von Geld bereits zwei eigenständige Tauschsysteme gab. In beiden Tauschsystemen sehe ich die Wurzeln des Geldes. Beide haben ganz unterschiedlich zur Geldentwicklung beigetragen. Ein Blick in diese Vorgeschichte des Geldes ermöglicht uns, alle scheinbar absonderlichen Geldentwicklungen zu erklären.
Werfen wir also zunächst einen Blick auf die Geschenkwirtschaft. Diese Form des Austausches lässt sich bis ins Tierreich zurück verfolgen. Mit dem allmähli chen Übergang zu einer sesshaften Lebensweise hat sich eine neue Austauschform entwickelt, die ich „Tauschwirtschaft“ nenne, siehe Kapitel 2.2. (S. 14ff.) Erst aus dieser Tauschwirtschaft ist im Fernhandel schließlich die Geldwirtschaft entstanden, wie die Geschichte zeigen wird. Nachfolgend werde ich genauer definieren, was ich unter Geschenkwirtschaft, Tauschwirtschaft und Geldwirtschaft verstehe.
2.1. Geschenkwirtschaft
Seit Anbeginn
Ein Netzwerk aus Verbindlichkeiten und Verpflichtungen
Kaufen und Verkaufen kennen sie allerdings nicht: Sie bitten um Hilfe. Großzügigkeit ist die höchste Tugend in Samoa. Man macht Geschenke, damit andere Geschenke machen können.
Gabriele Hoffmann5
Einst lebten alle Menschen als Nomaden. In den immergrünen Tropen war es leicht von der Hand in den Mund zu leben. In warmen Klimazonen, in denen Bäume das ganze Jahr Früchte tragen, hat sich diese Lebensweise deshalb oft bis in die Neuzeit erhalten. Für Nomaden machte es keinen Sinn, Vorräte zu horten. Sinn machte es, heutigen Überfluss an Früchten und Jagdbeute zu teilen, denn das förderte Freundschaften und Bündnisse. Solche sozialen Bindungen waren nicht nur von sozialer, sondern auch von entscheidender ökonomischer Bedeutung. Sammlerinnen und Jäger waren deshalb stets bereit, schwankendes Sammelund Jagdglück durch wechselseitige Geschenke auszugleichen. Das stärkte die Position in der Gruppe und damit die Überlebenschancen aller. Für Nomaden waren persönliche Bindungen lebenswichtig. Sie fortwährend durch gegenseitige Geschenke zu pflegen, war deshalb sozial und ökonomisch sinnvoll.
Da jedes Geschenk die Aufforderung zu einem späteren Gegengeschenk enthielt, bestand ein kontinuierliches Geflecht gegenseitiger Verpflichtungen. Aus diesem Netzwerk verstoßen zu werden, war die härteste Strafe, die über Nomaden verhängt werden konnte. Es kam einem Todesurteil gleich, denn allein zu überleben war kaum möglich.
Mit der beginnenden Sesshaftigkeit begann sich das Verhältnis der Menschen zueinander zu verändern. Neben sozialen Bindungen entstanden nun auch Sachbindungen. Trotz dieses Wandels hat sich Geschenkwirtschaft als älteste Austauschform bis heute erhalten. Noch heute machen wir Geschenke um soziale Bindungen zu pflegen bzw. aufoder auszubauen. Noch immer gehört es zum Wesen eines Geschenks, dass sein Preis unerwähnt bleibt. Ein Geldgeschenk ist deshalb eine (faktische) Unmöglichkeit; es kann sich nur um eine finanzielle Unterstützung handeln. Einer Geldgabe fehlt die Seele eines Geschenks, das Individuelle, das unbestimmt Verpflichtende. Geschenke sollen Verbindungen schaffen, stärken oder erhalten. Sie sind eine (mehr oder weniger) sanfte Aufforderung zu gegenseitiger Verpflichtung. Sie sollen auch Eindruck machen, zuweilen nicht nur auf die oder den Beschenkte*n, sondern ggf. auch auf das soziale Umfeld. Sie sind nicht nur eine Gabe, sondern auch ein Statement der oder des Schenkenden.
Dieser Aspekt des Schenkens hatte im Ritual des Potlatch bei den kanadischen Einheimischen eine besondere Entwicklung erfahren. Halliday schreibt darüber:
Gradually the privilege of giving began to be abused and distorted...6
Das Vorrecht zu schenken wurde zunehmend missbraucht und verdreht... [Ü. d.A.]
Potlatch stellte eine Art Geschenkewettkampf dar und kann als entfesselte Form von Imponiergehabe und Prestigestreben verstanden werden. Während eines Potlatchs wurden die Geschenke der Schenkenden öffentlich vernichtet und diese zugleich mit Gegengeschenken überhäuft, die jene ebenfalls vernichteten. Man kann das als Versuch verstehen, sich der sozialen Verpflichtung zu entledigen, die aus dem Annehmen eines Geschenkes erwächst. Mit dem Zurückweisen der Geschenke war wohl auch ein Prestigegewinn verbunden, weil sich nur ein starker Clan leisten konnte, das durch die Geschenke ausgedrückte Angebot von Freundschaft, Zusammenarbeit oder Frieden abzulehnen. Das Zerstören von Geschenken im Ritual des Potlatch kann als Demonstration sozialer und ökonomischer Stärke verstanden werden. Schenken wiederum ist nicht nur Ausdruck eigener Leistungsfähigkeit, sondern kann die Beschenkten auch demütigen. Indem beide die Geschenke zerstörten, bewiesen sie ihre soziale und ökonomische Unabhängigkeit. Auch zeigten sie durch Überreichen von Geschenken, von denen sie wussten, dass sie nicht angenommen werden, ihre Fähigkeit, ohne erkennbaren Nutzen zu produzieren.
Das Potlatch könnte auch als Ausdruck kulturell geformter Ehrbegriffe verstanden werden. Vielleicht waren in grauer Vorzeit, aus welchen Gründen auch immer, Geschenke durch Zerstören zurück gewiesen worden. Um einen Gesichtsverlust zu vermeiden, konnten dann auch die Schenkenden keine Gegengabe annehmen.7 Sollte es ein solches „erstes“ Potlatch gegeben haben, kann das Festhalten an diesem Ritual als Bemühen verstanden werden, trotzdem eine Verbindung aufrecht zu halten. Denn auch wenn die Geschenke im Potlatch demonstrativ zurück gewiesen wurden, so hielt die Begegnung als solche sowie das gemeinsame Ritual eine Verbindung lebendig.
Die gegenseitige Ehrerbietung zeigte sich trotz des Aktes der Zerstörung in der Größe der dargebrachten Geschenke. Das Potlatch könnte so auch als soziales Lehrstück gelesen werden. Es könnte uns unter anderem lehren, dass Rituale niemals vereinfacht, sondern eher verkompliziert werden. Die starke soziale Bindungskraft von Ritualen zeigt sich immer wieder in der Schwierigkeit ihrer Überwindung. So bedurfte es harter Repressionen seitens der neuen Kolonialmächte, um das Potlatch in Nordamerika abzuschaffen.A
Schenken entspringt uralten Riten. Es ist eine Form des Austausches, die es mindestens schon unter Primaten gibt. Geschenke hatten und haben oft primär soziale Funktionen. Doch für Nomaden ließen sich soziale Rückversicherungen kaum von existenzsichernden ökonomischen Funktionen trennen. Damals wäre wohl niemand auf die Idee gekommen, Menschen als homo oeconomicus zu beschreiben. Menschen waren und sind sozioökonomische Wesen.
Die Idee menschliches Verhalten rein ökonomisch erklären zu können, konnte erst im Kapitalismus entstehen, als selbst die Zeit zu Geld wurde. Das Credo dieses neuen Zeitalters lautet nicht: Zeit kostet Geld, sondern schonungslos: Zeit IST Geld. Doch bis zum Entstehen der Geldwirtschaft sollte noch viel Zeit vergehen. Zeit, in der Menschen anfingen sesshaft zu werden. Zeit, in der Menschen anfingen sich auf bestimmte Hauptnahrungsmittel und Kulturgüter zu spezialisieren.
2.2. Tauschwirtschaft
Wahrscheinlich seit 10 000 Jahren
Wertausgleich ohne Maßstab
Jeder legt seine Waare, die er mit einem Zeichen versehen, an einen Ort und lässt sie da zurück. Dann kommt er wieder und findet eine Waare, die er für sein Land brauchen kann, daneben gelegt. Ist er damit zufrieden, so nimmt er das zum Tausch Gebotene und lässt seine Waare dafür zurück; ist er es nicht, so nimmt er diese wieder weg. Käufer und Verkäufer bekommen einander dabei nicht zu sehen.
Christian Martin Frähn8
Im Zuge der neolithischen Revolution veränderte sich die Wirtschaftsweise der Menschen grundlegend. Das Aneignen von Nahrung durch Sammeln und Jagen wurde allmählich ersetzt durch Nahrungsproduktion. Diese Revolution war kein eruptives Ereignis, sondern ein Jahrtausende währender Prozess. Ackerbau und Viehhaltung veränderten das Verhältnis der Menschen zur Natur radikal. Mit dem Übergang von der aneignenden zur produzierenden Wirtschaftsweise entstanden Nahrungsvorräte. Mit dem Sesshaftwerden entwickelte sich auch erstmals so etwas wie Hausrat. Nomaden besaßen nicht mehr, als sie tragen konnten. Sesshafte konnten Vorräte an Werkzeugen, Kleidung oder Tongeschirr anlegen. Besitz bestand nun nicht mehr nur aus dem Tragbaren. Besitz ließ sich nun absetzen und besetzen. Es entstanden Sachbindungen, die über den Augenblick der direkten Inbesitznahme hinausgingen.
Das Aufgeben der nomadischen Lebensweise brachte nicht nur Vorteile. Die Ernährung wurde einseitiger. Archäologische Funde beweisen, dass der Gesundheitszustand der ersten sesshaften Menschen schlechter war als der nomadischer Zeitgenossen. Abhängig vom Siedlungsraum spezialisierten sich Menschen auf Hauptnahrungsmittel. Das machte es attraktiv Reis gegen Fleisch, Fleisch gegen Wurzeln, Wurzeln gegen Fisch zu tauschen. Wegen der Spezialisierung der ersten Dorfgemeinschaften waren solche Tauschgeschäfte stets bilateral.9 Einen Markt gab es nicht und er war auch nicht nötig. Die Menschen wussten in welchem Dorf sie Reis tauschen konnten und wo sie für ihren Fisch Wurzeln bekommen würden. In diesem archaischen Umfeld hat sich der „stumme Handel“ entwickelt. Ethnologische Berichte aus fast allen Erdteilen beschreiben diese Form des Austausches erstaunlich ähnlich. Einer der ältesten Berichte stammt von Herodot:
Weiter sagen die Karthager, dass es auch jenseits der Säulen des Herakles zu Libyen gehöriges Land und Menschen darin gäbe. Wenn sie zu denen kämen, brächten sie ihre Waren ans Land und legten sie Stück für Stück am Strande aus; darauf gingen sie wieder auf ihre Schiffe und machten Rauch. Wenn die Einwohner den Rauch sähen, kämen sie an den Strand, legten dort Gold hin für die Waren und gingen dann wieder weg. Alsdann kämen die Karthager wieder von ihren Schiffen, um nachzusehen, und wenn sie das Gold für einen angemessenen Preis hielten, nähmen sie es mit und führen nach Hause. Wäre es ihnen aber nicht genug, so gingen sie wieder an Bord und warteten die Sache ab. Dann kämen die anderen wieder und legten immer noch mehr Gold hin, bis sie, die Karthager, zufrieden wären. Auf beiden Seiten ginge es dabei ehrlich zu; denn sie nähmen das Gold nicht mit, bevor sie die Waren damit beglichen, und jene die Waren nicht, bis sie das Gold an sich genommen hätten.10
Typisch für den stummen Handel war stets, dass eine Partei ihre Waren an einem Handelsplatz unbewacht zurück ließ und manchmal erst am nächsten Tag das Tauschangebot der Gegenseite prüfte. Akzeptierte sie den Gegenwert, zog sie mit diesen Waren davon. Der Handel war für sie vollzogen. Erst dann eignete sich auch die Gegenseite die niedergelegten Waren an. Empfand die anbietende Partei das Tauschangebot jedoch als nicht ausreichend, zog sie sich zurück und wartete auf ein höheres Angebot. Blieb das aus oder war auch das neue Angebot unbefriedigend, nahm sie ihre eigenen Waren und verließ den Handelsplatz, ohne dass es zu einem Austausch kam.
Die meist europäischen Ethnologen hat erstaunt, wie ehrlich stummer Handel ablief. Auch wenn stummer Handel zwischen Nomaden und Sesshaften abgewickelt wurde, war jede Partei bemüht, die andere nicht zu übervorteilen, wie folgender Bericht des englischen Reisenden George Grenfell zeigt:
These little people, unless they are in intimate relations with kindly big neighbours …, creep into the banana plantations at night, or into the maize fields, take away as much as they can carry, in loads of plantains or of corn cobs, and leave behind a present of game – meat from the bush (often very high) – which they know will be appreciated by the owner of the plantation or cornfield. The latter winks at the procedure and tacitly accepts the exchange.11
Diese kleinen Menschen [Pygmäen, d.A.], wenn sie nicht in enger Beziehung zu freundlichen großgewachsenen Nachbarn stehen, schleichen nachts in die Bananenplantagen oder in die Maisfelder, nehmen so viel Kochbananen oder Maiskolben wie sie tragen können und lassen ein Geschenk zurück – Fleisch aus dem Busch (oft sehr viel) – von dem sie wissen, dass es von den Besitzenden der Plantage oder des Maisfeldes geschätzt wird. Letztere segneten das Verfahren ab, indem sie den Austausch stillschweigend akzeptieren.“ [Ü.d.A.]
Mir erscheint es plausibel, dass sich diese Form des Austausches aus dem Geschenketausch entwickelt hat. Bei dieser primären Tauschform ging es darum, die Beschenkten nicht zu übervorteilen, sondern sich durch eine Gabe (ein Geschenk) für die Zukunft Verbündete zu schaffen. Bestätigt sehe ich diese These, da gerade die nomadisch lebenden Pygmäen reichlich Fleisch für ihre geraubten Feldfrüchte zurück ließen. Dieter Veerkamp bringt in seiner Dissertation „Stummer Handel“ zahlreiche weitere Beispiele für solchen Handel zwischen Völkern ähnlicher oder unterschiedlicher Kulturen. Auch wenn dieser Handel zuweilen von Misstrauen oder Furcht geprägt war, so blieb stets erkennbar, dass beide Seiten eine Gabe stets mit einer Gegengabe ausgleichen wollten. Interessant ist dabei, dass Handelsplätze oder Handelsriten teilweise magisch aufgeladen waren. Möglicherweise hing das damit zusammen, dass Herkunft oder Entstehen der begehrten aber unbekannten fremden Güter mystisch erklärt wurden.12 In jedem Fall lassen Berichte über archaischen Tauschhandel erkennen, dass dieser Austausch vom Geist der Geschenkwirtschaft geprägt war. Zwischen Tauschparteien mag nicht immer Freundschaft bestanden haben, aber es ging immer darum einen Austausch zum beiderseitigen Vorteil auch für die Zukunft zu sichern.
Berichte über komplizierte Ringtauschtransaktionen können erst aus späterer Zeit stammen, denn sie setzen einen Markt voraus. Wollte auf so einem Markt z.B. jemand Früchte gegen Schuhe tauschen, musste sie zum Schuster gehen und fragen, was der für das gewünschte Paar Schuhe haben wollte. Erbat sich der Schuster ein Gewand im Tausch gegen die Schuhe, musste die Frau mit ihren Früchten zum Schneider gehen. Wollte der das vom Schuster gewünschte Gewand nur gegen Tuch hergeben, musste die Frau zur Tuchmacherin gehen. Nahm die die Früchte im Tausch gegen das Tuch entgegen, konnte die Frau den Ringtausch abwickeln. Sie trug das Tuch zum Schneider, das Gewand zum Schuster und erhielt dort schließlich die gewünschten Schuhe. Von derartigem Ringtausch berichtet z.B. Heinrich Barth als er im 19. Jh. durch Nordafrika reiste.13 Für diesen Handel mag die Frau einen ganzen Tag gebraucht haben, aber sie hat an diesem Tag auch viele Geschichten gehört. Anders als wir, hatte sie keine Eile, den Markt schnell wieder zu verlassen. Austausch von Waren und Austausch von Informationen gehörten in vielen Kulturen zusammen.
Wir müssen Berichte stets zeitlich und geographisch einordnen, um sie beurteilen zu können. In den letzten 200 Jahren hat sich, ausgehend von Europa, unser Verhältnis zur Zeit und in den letzten 20 Jahren unser Verhältnis zu Informationen radikal verändert. Lust am Handeln und Interesse an Neuigkeiten sind uns verloren gegangen. Unabhängig davon kann Ringhandel keine ursprüngliche Form des Handels gewesen sein, weil er das Vorhandensein eines breiten Warenangebots im Besitz unterschiedlicher Personen voraussetzt. Eine derartige Arbeitsteilung hat sich erst nach Ausbreitung der Geldwirtschaft entwickelt. Ringtausch ist deshalb eher eine Rückkehr zum Tauschhandel, infolge Verfalls eines früheren Geldsystems. Solche Rückfälle haben im Laufe der Geschichte wiederholt stattgefunden, wie Alfons Dopsch in seinem Buch „Naturalwirtschaft und Geldwirtschaft in der Weltgeschichte“ beschreibt. Beispiele für Ringtausch liefern deshalb keine Argumente für die Annahme, Geld sei erfunden worden, um den Tausch zu erleichtern. Tauschhandel entstand mit der kulturellen Ausdifferenzierung der Menschheit. Diese Ausdifferenzierung begann bereits in der Steinzeit mit dem Herstellen unterschiedlichen Schmucks. Mit Beginn der Sesshaftigkeit verschwimmen allmählich die Grenzen zwischen Geschenkwirtschaft und Tauschwirtschaft, u.a. weil mit dem Sesshaftwerden die kulturelle Ausdifferenzierung weiter zunahm. Innerhalb einer Sprachgemeinschaft blieben die Unterschiede in der Lebensweise durch ständigen Ideenaustausch wahrscheinlich vergleichsweise gering. Sprachbarrieren behinderten den Austausch jedoch und förderten das Herausbilden von Unterschieden in Ernährung und Gebrauchsgüterherstellung. Deshalb war Tauschhandel vor allem zwischen Gruppen interessant, die sich sprachlich kaum verständigen konnten. Sprachschwierigkeiten sind sicher einer der Gründe für die weite Verbreitung des stummen Handels in archaischer Zeit.
Das anfangs überschaubare Warenangebot und die Kenntnis wo welche Waren hergestellt wurden, erforderte weder Marktplätze noch Geld, um Tauschhandel in Gang zu bringen. Tausch konnte zunächst bilateral zwischen zwei Parteien abgewickelt werden. Die Rituale des stummen Handels waren dafür vollkommen ausreichend. Die Ehrlichkeit dieser Tauschgeschäfte kann dadurch erklärt werden, dass alle Beteiligten mit den Gepflogenheiten des Geschenketausches vertraut waren. Unabhängig davon machte übermäßiges Anhäufen von Naturalien wenig Sinn. Zudem war Tauschhandel anfangs wohl eine Bereicherung für alle Beteiligten, aber sicher zunächst noch keine Lebensnotwendigkeit.
Erst eine Revolution in der Werkzeugherstellung bewirkte tiefgreifende sozioökonomische Veränderungen. Mit der Bronze entstand ein Werkstoff, dessen Herstellung (nach Erschöpfung der ersten Zinnlagerstätten) Fernhandel erforderte und deshalb förderte. Mit der Bronze begann auch die Entwicklung der Geldwirtschaft. Sie veränderte den Tauschhandel. Sie erschütterte den Geist der Geschenkwirtschaft, der auf gegenseitigen Vorteil gerichtet war. Doch sie hat diesen Geist nicht völlig zerstört. Zum einen sind wir eben nicht nur ökonomisch denkende, sondern immer auch soziale Wesen, zum anderen wurden und werden Geschenkwirtschaft und Tauschwirtschaft teilweise weiter praktiziert. Geschenkwirtschaft lebt bis heute in Familien und sozialen Zusammenhängen fort. Tauschwirtschaft findet noch immer in wirtschaftlichen Nischen statt. In monetären Krisenzeiten erlebte Tauschhandel oft eine erstaunliche Wiedergeburt. Aber Tauschwirtschaft kann die Geldwirtschaft längst nicht mehr ersetzen.
2.3. Geldwirtschaft
Seit etwa 5 000 Jahren
Der Doppelcharakter des Geldes – Kaufmittel und Kapital
Die alte Welt hat lange Zeit mit Werthmessern verkehrt ohne Münze zu besitzen und ist in ihrem letzten Stadium gewissermaßen wieder zu diesem System zurückgekehrt; auch heute noch könnte man, namentlich im Großverkehr, allenfalls der Münze entrathen.
Theodor Mommsen14
Heutige hochkomplexe Gesellschaften können ohne universelles Tausch- bzw. Kaufmittel nicht existierten. Monetäre Krisen machen die Abhängigkeit vom Geld immer wieder deutlich. Wenn die Mehrheit der Banken schließt, folgt nach dem Run auf die Schalter und Geldautomaten bald das Plündern der Geschäfte. Dann droht die allgemeine Versorgung zusammen zu brechen.
Die alles durchdringende Bedeutung, die Geld inzwischen erlangt hat, war vor seiner Entstehung nicht im Mindesten absehbar. Es wurde bereits erwähnt, dass das Argument: Geld erleichtert den Handel, die Geldentstehung keineswegs erklärt, denn es gab lange gar keine Motivation den Tausch zu erleichtern.
Geldwirtschaft unterscheidet sich fundamental von der Tauschwirtschaft, weil der Tausch durch das Geld in Kauf und Verkauf bzw. Verkauf und Kauf zerfällt. Auf das Verbindende zwischen beiden Wirtschaftsformen kommen wir später. Während im prähistorischen Tauschhandel beide Parteien direkt das eintauschten, was sie begehrten, wurde Geld zum Vermittler zwischen Warenangebot und Warennachfrage. Es vermittelt seitdem zwischen den Produzierenden und Konsumierenden. Diese beiden Tauschparteien waren sich schon beim stummen Handel nie direkt begegnet, aber sie hatten bei diesen Tauschgeschäften noch direkt miteinander gehandelt.
Mit dem Geld trat von Anfang an etwas zwischen beide Tauschparteien. Mit dem Geld kamen die Kaufleute. Falsch! Das Geld entstand durch die Kaufleute! Fernhandelskaufleute traten zwischen die Tauschparteien. Ihr Handel diente nicht primär ihrer direkten Bedürfnisbefriedigung, sondern dem Tausch heimischer Erzeugnisse gegen fremde, die sie in der Heimat weiter tauschen konnten. Im Fernhandel eingetauschte Waren waren folglich grundsätzlich dazu bestimmt, weiter getauscht zu werden. Genau hier findet sich der Ursprung des Geldes als eines Tauschvermittlers. Jede im Fernhandel erworbene Ware war potentielles Tauschmittel in der Heimat. Hieraus erwuchs der Brauch, diese Waren auch direkt auf den Fernhandelsmärkten als Tauschmittel zu verwenden. Im Kapitel 3.3. Gerätegeld (S.34ff.) wird ausführlicher gezeigt, dass das Geld im Fernhandel entstand. Da die Kaufleute den Fernhandel hervor brachten und der Fernhandel zugleich die Kaufleute erschuf, nahmen die Kaufleute von Anfang an eine entscheidende Funktion im Geldsystem ein. Kaufleute, die wohl lange Zeit vor allem reisende Kaufmänner waren, waren die Geburtshelfer des Geldes. Kaufleute haben das Geld auch immer wieder verändert, wie diese Geschichte zeigen wird. Für sie war Geld von Anfang an mehr als nur Kaufmittel für Waren. Während Geld für die Produzierenden und Konsumierenden lange nur Mittel zur Bedürfnisbefriedigung war,B war es für die Kaufleute immer schon auch Handelskapital und damit Arbeitsmittel für ihr Gewerbe.
Die Schicht der Fernhandelskaufleute vermittelte zwischen unterschiedlichen Gruppen von Produzierenden, die stets zugleich auch Konsumierende waren. Kaufleute produzierten nicht, sondern handelten mit den Erzeugnissen anderer. Um vom Handel leben zu können, mussten sie den Wert der Tauschgüter bewahren, um sie weiter tauschen zu können. Für sie war ein Tausch nie vollendet. Handel wurde zu ihrer Lebensgrundlage. Wertunterschiede zwischen Einkauf und Verkauf mussten die Vertriebskosten inklusive ihrer eigenen Lebenshaltungskosten decken. Blieb dabei etwas übrig, konnten die verbliebenen Tauschgüter für neue Handelsgeschäfte genutzt werden. Bronze erlaubte es, diese Restgüter für spätere Fernhandelsgeschäfte aufzusparen. Dadurch wurde aus Tauschgütern Handelskapital. Infolgedessen hatte Geld seit seiner Entstehung einen Doppelcharakter. Es wurde zugleich als Kaufmittel für Waren wie auch als Handelskapital geboren. Es ist bis heute zugleich Kapital und Kaufmittel geblieben. Dieser Doppelcharakter hat seit Entstehen des Geldes zu unzähligen, oft verheerenden Krisen geführt. Dieser Doppelcharakter prägt bis heute die Komplexität des Geldes. Dieser Doppelcharakter ist Ursache der Krisenhaftigkeit aller bisherigen Geldsysteme. Im 3. Teil dieser Tetralogie (siehe S. 162) werden Probleme beschrieben, die sich aus dem Doppelcharakter ergeben.C Im 4. Teil wird ein Maßnahmenpaket unterbreitet, wie dieser Doppelcharakter aufgelöst werden kann, um nach weit mehr als 5 000 Jahren Geldwirtschaft aus dem Krisenmodus heraus zu finden.
Aber Evolution besteht nicht nur aus Brüchen, sondern auch aus Kontinuität. Jeder Umbruch sprengt zwar hinderlich gewordene Elemente, aber es wird auch immer etwas bewahrt oder gar Verschüttetes wieder belebt. So finden sich im Geld Elemente der Geschenkwirtschaft. Geld besitzt wie Schmuck einen gewissen Fetischcharakter. Durch Kindheitsmärchen geprägt, halten wir lange nach Aufhebung des Goldstandards Gold noch immer für das ursprüngliche und einzig wahre Geld. Die Assoziation Gold ist Geld stirbt nicht aus, sondern erlebt eine Konjunktur. Bis heute werden Geldreformvorschläge unterbreitet, die Geld wieder an Gold binden wollen.15 Auf den Fetischcharakter des Geldes wird im Kapitel 3.1. Prestigegeld (S. 26ff.) näher eingegangen.
Geld verbindet jedoch noch mehr mit der Geschenkwirtschaft. Geld kann wie ein Geschenk genutzt werden, um sich Verbündete, ja sogar Kriegskameraden zu schaffen. Während Tausch wohl immer nur ein Mittel sein kann, Frieden zu stiften oder zu festigen, können Geschenke und Geld beides bewirken: Krieg und Frieden. Geld ist aber weit mehr als eine Negation der NegationD des Geschenks.
Die Ambivalenz des Geldes zeigt sich in der Verbindung, die Geld zwischen Geben und Nehmen schafft. Hier modifiziert Geld sowohl die Geschenkals auch die Tauschwirtschaft. Geld ermöglicht den Zerfall des Tauschaktes in Verkauf und Kauf bzw. in Kauf und Verkauf. Zwischen beiden Tauschakten konnte nun mehr oder weniger viel Zeit vergehen.
Wurde in der Tauschwirtschaft z.B. Getreide gegen Fleisch getauscht, hatten beide Parteien gleichzeitig ver- und gekauft, also gegeben und genommen. Geld verschleiert, dass Kauf mittels Geldes den ursprünglichen Tausch in zwei Tauschakte zerlegt. Denn Geld vertritt beim Kauf das fehlende Gebrauchsgut. Wer in der Geldwirtschaft verkauft (gibt), muss das Nehmen der Tauschwirtschaft in einem zweiten Tauschakt realisieren. Das durch Geben (verkaufen) erworbene Geld kann erst durch Kauf (nehmen) den ursprünglichen Tauschhandel vollenden.
Sofern Geld als voller Wertersatz für das Gegebene angesehen wird, kann Geldwirtschaft als Form der Tauschwirtschaft verstanden werden. Doch weil Geld zwischen Geben und Nehmen vermittelt, bleibt beim Geldhandel zuweilen ein Rest. Dieser schwer auszumachende Rest (der im weiteren Profit genannt wird) ist ein Kriterium, das Geldwirtschaft von Tauschwirtschaft unterscheidet.
Was Geldwirtschaft mit Geschenkwirtschaft verbindet, ist die Zeit, die zwischen Geben und Nehmen vergeht. Auch auf ein Geschenk erfolgt nicht zwingend sofort ein Gegengeschenk, sondern es bleibt zunächst eine offene Rechnung. Ein Geschenk schafft eine Verbindung. Diese „Verbindlichkeit“ entsteht, weil wer schenkt eine Art Guthaben erwirbt und wer beschenkt wird eine Art Schuld trägt, wobei ich hier eher von Verpflichtung sprechen würde. Ein Zusammenhang zwischen Guthaben und Schuld besteht auch im modernen Kreditgeld. Allerdings wurde dieser Zusammenhang entkoppelt, mehr dazu im 3. Teil dieser Tetralogie.
Es war eine lange komplizierte Entwicklung, bis aus den Verbindlichkeiten der Geschenkwirtschaft Geldschulden wurden. Auf verschlungene Weise reicht wohl auch der Zins in die Geschenkwirtschaft zurück. Mehr geben als ich bekommen habe, kann ein Dankeschön sein. Wird aus dem Dank ein Muss kann das zu Schuldsklaverei führen, die bereits in der Natural- bzw. Tauschwirtschaft einsetzte. Deshalb sind Zinsen älter als das Geld, zumindest älter als das Metallgeld.
Als Geld im engeren Sinne betrachte ich erst Metallgeld, das seinen Gebrauchswert bereits verloren hat. Den Ursprung des Zinses sehe ich dagegen im Verleihen von Saatgetreide. Meine Thesen dazu lege ich im Kapitel 12. Zinsen (S. 141ff.) dar. Stimmen sie, dann beginnt die eigentliche Geschichte des Geldes nach der Geschichte des Zinses. Doch das ist eine Frage der Definition von Geld. Wie auch immer wir Geld definieren, ändert es nichts an Graebers Feststellung:
Der Unterschied zwischen Schulden und Verpflichtungen ist die Möglichkeit, Schulden präzise zu quantifizieren.16
Sein Nachsatz:
Dazu ist Geld erforderlich.
verweist auf ein Problem von Geldschulden. Sie können nur in Geld zurück gezahlt werden – in einer genau definierten Art von Geld. Daraus ergibt sich eine andere Möglichkeit Geld zu definieren. Geld ist, was in einem Schuldvertrag als Rückzahlung gefordert wird. Das muss nicht Metall oder Münzgeld sein. Es kann auch Getreide oder Vieh sein. Wird jedoch Geld gefordert, dann eine bestimmte Sorte. Das gilt bis heute. Es ist nicht egal, ob ich meine Rechnung in Rubel oder US- Dollar bezahle. Wegen all dem ist Geldwirtschaft schwer zu fassen. Die Schwierigkeiten beginnen bereits bei der Definition von Geld. Unabhängig von einer Gelddefinition sind die Übergänge zwischen den drei Tauschsystemen fließend. So ist ein geldwirtschaftlicher Kauf formal nur ein halbes Tauschgeschäft. Doch durch Bezahlen gilt ein Handel als abgeschlossen. Obwohl Geld nur Kaufmittel und nicht Gebrauchsgut ist, hat Bezahlung einen entbindenden Charakter. Hierin steht die Geldwirtschaft der Tauschwirtschaft somit näher als der Geschenkwirtschaft. Die drei Systeme haben sich nacheinander aus dem jeweils früheren entwickelt und dabei alte Elemente übernommen bzw. modifiziert.
Neben dieser Evolution hat ein Tauschsystem möglicherweise seit der Steinzeit bis zum Beginn des 20. Jhs. parallel existiert. Es lässt sich in keines der bis her beschriebenen Systeme einordnen. Gerade deshalb und wegen seiner langen Existenz und Stabilität können wir aus diesem System viel für die Zukunft lernen.
2.4. Kerbholzwirtschaft
Seit grauer Vorzeit bis Anfang des 20. Jahrhunderts
Ein Sonderweg mit langer Tradition
Die Anfänge des Gebrauchs der Kerbhölzer reichen nicht bloss, wie man früher meinte, in die germanische Zeit hinein, sie gehen vielmehr noch Jahrzehntausende weiter zurück ins Paläolithikum, in die Zeit der Höhlenbewohner. Holzstücke aus dieser Periode sind nicht mehr vorhanden, aber man hat eine Anzahl von paläolithischen Knochen gefunden, welche offenbar Eigentums- oder Ursprungsmarken tragen; andere wieder sind mit einfachen Zahlen versehen, indem vielleicht derart die Jagdbeute notiert wurde. [H.i.O.]
Max Gmür17
Das Neue an der Geldwirtschaft war also, dass eine Schuld in Quantität und Qualität festgeschrieben wurde. In der Geschenk- oder Tauschwirtschaft stand mir frei, wie ich eine Gabe erwidere. Zumindest gab es einen Spielraum. In der Geldwirtschaft gibt es diesen Spielraum nicht mehr. Das Festschreiben von Schuldhöhe und Schuldtilgungsmittel verwandeln eine geschenkwirtschaftliche Verpflichtung in eine geldwirtschaftliche Verschuldung. In der Tauschwirtschaft kommt ein Tauschgeschäft gar nicht erst zustande, wenn sich beide Seiten nicht auf wechselseitigen Wertausgleich einigen. Schuld kann hier gar nicht entstehen. Doch auch die Evolution des Tausches nahm verschiedene Wege. Ich würde Kerbhölzer dabei nicht als ein Nebengleis bezeichnen, sondern als eine eigene Entwicklung, die sich wahrscheinlich Jahrtausende lang krisenfrei bewährt hat. Ob Ritzungen auf paläolithischen Knochen allerdings tatsächlich auf Kerbholzgebrauch in der Steinzeit schließen lassen, wie Gmür annimmt, wage ich zu bezweifeln. Vielleicht waren es reine Ornamente.
Ungeachtet dessen belegt Gmür einen Gebrauch von Kerbhölzern als Verrechnungsmittel, der weit in die Geschichte zurück reicht. Kerbhölzer sind nach allem bisher gesagten keinem der drei Tauschsysteme zuzuordnen. Denn Kerbhölzer sind Verrechnungsmittel, die Guthaben und Schulden genau fixieren, aber das Mittel zum Begleichen der Schuld nicht festlegen. Die gespaltenen Kerbhölzer lassen am besten erkennen, wie Guthaben und Schulden im gleichen Atemzug entstehen. Denn bei der Übergabe von Ware werden auf beiden Teilen gleich viele Kerben geschnitten. Wer gegeben hat, erhält das Gläubigerholz; wer genommen hat, das Quittungsholz, siehe Abbildung 1.
Abbildung 1:
Gespaltenes Kerbholz zum Aufzeichnen von Guthaben und Schulden
Geben und Nehmen fallen wie in der Geschenk- und Geldwirtschaft zeitlich auseinander. Das haben Kerbhölzer mit beiden Tauschsystemen gemeinsam. Von der Geschenkwirtschaft unterscheiden sich Kerbhölzer aber, weil Guthaben und Schulden genau quantifiziert werden. Sie werden zwar nicht festgeschrieben, aber eingekerbt. Genau das verbindet Kerbhölzer mit der Geldwirtschaft. Doch Kerbhölzer legen nicht fest wann, was und wie viel als Gegenleistung erbracht werden muss. Das unterscheidet Kerbhölzer von der Geldwirtschaft. Die Gegenleistung bleibt Verhandlungssache. Das verbindet Kerbhölzer mit der Tauschwirtschaft. Weil Geben und Nehmen aber zeitlich auseinander fallen, sind Kerbholzgeschäfte keine Tauschgeschäfte. Kerbhölzer sind Verrechnungsmittel. Damit erfüllen sie eine Funktion des Geldes. Kerbhölzer können zwischen zeitlich auseinander liegenden Tauschakten vermitteln. Sie können einen Wert übertragen, ohne selbst Wert zu besitzen. Sie sind reines Tauschmittel, also Wertsymbol. Doch ihre Erzeugung ist nicht monopolisiert oder an Vorleistungen gebunden, wie das Prägen von Münzen. Es erfordert keine (bzw. nur minimale) Arbeit ein gespaltenes Kerbholz herzustellen. Trotzdem sind Kerbhölzer fälschungssicher.
Allerdings erlauben sie nur einen bilateralen Handel. Außerdem können Guthaben nie größer werden, als die Anzahl an Kerben, die auf ein Gläubigerholz passen. Kerbhölzer ermöglichen also kaum zu sparen, um zu investieren. Die Kerben auf einem Quittungsholz können aber auch nicht in Schuldsklaverei münden. Sie sind zwar eine Verpflichtung zum Leisten einer Gegengabe, doch es lag in den Händen der Verschuldeten, wie sie ihre Verpflichtungen einlösten. Solange sie in der Lage waren, etwas zu leisten, konnten sie sich entpflichten. Hatten Unfall oder Tod jemand der Fähigkeit beraubt, den Verpflichtungen nachzukommen, gab es die Familie (den Haushalt), an die sich die Gläubiger*innen mit ihrem Kerbholz wenden konnten. Die Familie (das Haus) konnte dann wahrscheinlich verhandeln, welche Gegenleistung sie zu erbringen in der Lage war. Weder in der Geschenkwirtschaft noch im Kerbholzsystem besaßen Tote Rechte oder Pflichten.
War nicht Tod, sondern ein Unfall Ursache dafür, dass Kerbholzschulden unbeglichen blieben, werden die Gläubiger*innen kaum offene Rechnungen präsentiert, sondern eher Hilfe angeboten haben. Sowohl in der Geschenkwirtschaft als auch in Sozialordnungen, in denen mit Kerbhölzern verrechnet wurde, war das vermutlich lange eine ungeschriebene Sozialklausel. Eine solche Klausel ist nicht aufgeschrieben worden. Es hätte nur einen Grund gegeben, sie nieder zu schreiben: wenn jemand sie übertreten hätte. Gesetze und Regeln werden immer erst erlassen, wenn Menschen etwas gegen das Rechtsempfinden der Mehrheit tun.18 Solange niemand das allgemeine Rechtsempfinden verletzt, gibt es keinen Anlass undenkbare Rechtsbrüche zu verbieten.