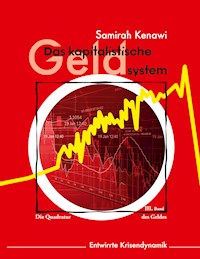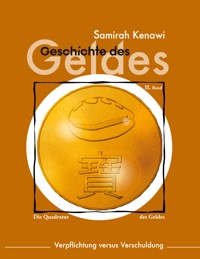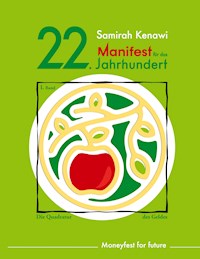
3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Die Quadratur des Geldes
- Sprache: Deutsch
Carmen Losmanns Dokumentarfilm Oeconomia zeigt, dass Kreditvergabe Geldschöpfung (also Geldvermehrung) und Kredittilgung Geldvernichtung (also Geldverminderung) ist. Kreditaufnahme ist folglich notwendig für die Geldversorgung der Wirtschaft. Da private Unternehmen Kredite nur aufnehmen, wenn sie Profit erwarten, hängt die Geldversorgung der Wirtschaft unter anderem von der Profiterwartung der Unternehmen ab. Um die Geldversorgung zu sichern, muss deshalb die Profiterwartung der Unternehmen gesichert werden. So gesehen erhalten Gesetze wie CETA und TTIP eine völlig neue Bedeutung. Der Profit der einen ist aber nur durch Verschuldung anderer möglich. Ein Teufelskreis, denn Kreditaufnahme erfordert Profiterwartung. Profiterwartung jedoch braucht eine Ausweitung der Geldmenge, also wachsende Kreditaufnahme. Das Wachstum der Geldmenge darf unter keinen Umständen abreißen, sonst bricht die Geldversorgung unserer Wirtschaft zusammen. Wie sind wir in dieses System hineingeraten und wie gelangen wir wieder heraus? Die Quadratur des Geldes geht diesen Fragen in vier Büchern Schritt für Schritt nach.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 186
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Für Lea,
die konsequent
jeden Tag
zukunftsorientiert handelt.
Krisenmanagement
Am Ende dieses Jahres werden wir feststellen, dass 2020 in Deutschland nicht mehr Menschen gestorben sind, als durchschnittlich in jedem anderen Jahr sterben. Die Einen werden das der rigiden Politik der Bundesregierung zuschreiben. Andere werden sich vielleicht fragen, ob wir aus Angst vor dem Tod gesellschaftlichen Selbstmord begangen haben. Dabei hat die Coronakrise vorgeführt, welche radikalen Änderungen in einer Ausnahmesituation durchsetzbar sind. Leider fehlte dem Krisenmanagement jeder Weitblick. Wie stünden wir heute da, wenn politische Akteur*innen mit Zukunftsvision, statt die Wirtschaft mit frischem Geld zu fluten, folgendes Maßnahmenpaket beschlossen hätte?
Bankfeiertage ausrufen, d.h. den gesamten Börsenhandel schließen und damit die Kurse einfrieren.
Zahlung von Kaltmiete, aber auch die Bedienung der Kredite für Kauf von Boden und Immobilien aussetzen. Betriebskosten und Instandsetzungsrücklagen dürfen nur in begründeten Notfällen gestundet werden.
Vermögenssteuer und Einkommenssteuer für fünfstellige Monatseinkommen deutlich erhöhen, um Lohnerhöhungen in systemrelevanten Berufen – auch in der Landwirtschaft – finanzieren zu können. Das wäre gelebte Solidarität.
Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln durch einheimische Arbeitskräfte sicherstellen.
Neuausrichten der Industrie im Zuge des Stilllegens von Produktionsstätten.
Pflege und Ausbau der Infrastruktur durch Neuorientierung freiwerdender Industriearbeitskräfte.
Fördern regionaler Produktion, um sichere Versorgung ohne lange Transportwege zu gewährleisten.
Entwickeln von Konzepten, um die ökologischen Verbesserungen, die die Krise durch drastische Reduktion des Pendel- und Reiseverkehrs gebracht hat, dauerhaft zu bewahren. Dazu müssen Arbeitsorganisation, Wohnen, Transportwesen und Tourismus überdacht werden.
Programme zum Aufforsten und Pflegen der Wälder starten, um dadurch langfristigen Klimaschutz zu betreiben und zugleich in der Krise gesunde Arbeitsplätze zu schaffen.
Überschaubare Informationssysteme schaffen, um gemeinsame Meinungsbildung durch gemeinsamen Informationsaustausch zwischen allen relevanten Akteur*innen zu ermöglichen.
Wir lieben die Wahrheit,
solange sie uns gleichgültig läßt.
Simone Weil1
Technische Hinweise
Endnoten
1, 2, 3... Hochgestellte Zahlen verweisen auf Quellenhinweise am Ende des Buches.
Fußnoten
A, B, C... Hochgestellte Großbuchstaben verweisen auf Worterklärungen bzw. Ergänzungen zum Text am Fuß der jeweiligen Seite.
Abkürzungen
v.u.Z.
vor unserer Zeit
Jh.
Jahrhundert
d.A.
die Autorin
Textkästen für Eilige!
Der zentrale Inhalt dieses Buches ist in nur zwei Textkästen zusammengefasst. Natürlich bietet dieses Buch weitaus mehr Gedanken und Anregungen, von denen nicht alle richtig sein müssen. Was diese beiden Textkästen betrifft, bin ich mir jedoch sicher, dass sie zum Verständnis der umfassenden destruktiven Dynamik des Kapitalismus beitragen können.
Eigentum
57-58
Kapitalismus
66-68
Inhalt
Vorwort
Prolog
– SehnSucht nach Meer/Mehr
Probleme
– Gestörte Kreisläufe
3.1.Der Wasserkreislauf – Verbrauch statt Gebrauch
3.2.Der Stoffkreislauf – Schöner Schrott
3.3.Der Lebenskreislauf – Vertreibung aus dem Paradies
3.4.Der Energiekreislauf – Das Heizplattenproblem
3.5.Der Geldkreislauf – Ökologie versus sozialer Frieden
Ursachen
– Kapitalistischer Wahnsinn
4.1.Sozialer Kollaps – privater Geldabfluss
4.2.Ökologischer Kollaps – falscher Geldzufluss
4.3.Eigenkapital – Ein ökonomisches Mysterium
4.4.Profitgier – menschlich oder nur kapitalistisch?
4.5.Die Welt kauft bei Amazon – Amazon kauft die Welt
4.6.Schuldenkrise – Staaten als Prügelknaben
4.7.Staatsschulden – (Einst) Basis des Rentensystems
4.8.Beschränkte Haftung – Unbeschränkter Profit
Zusammenhänge
– Eigentümliches Eigentum
5.1.Besitz und Eigentum – Der feine Unterschied
5.2.Wie entstand das Eigentum? – Eine alte Frage
5.3.Wie sinnvoll ist Eigentum? – Macht Enteignung Sinn?
Irrtümer
– Mythos Marx
6.1.Respekt – Auf den Schultern von Riesen
6.2.Der Mehrwert – Mehr Werttheorie
6.3.Der Kapitalist – Ausbeuter ohne Kapital!?
6.4.Das Kapital – Ein elegantes Mittel zum Raub
6.5.Die Produktionsmittel – Mittel zur Ausbeutung?
6.6.Die Arbeiterklasse – Kein Ende der Geschichte
6.7.Die Klassenfrage – Ein Schichtenproblem
6.8.Die Geschlechterfrage – Keine Nebenbemerkung
Visionen
– Wege in die Zukunft
7.1.Unbequeme Gesetze – Trübe Aussichten
7.2.Bedingungsloses Grundeinkommen – Eine (Zu)Flucht?
7.3.Shut down – Die vier apokalyptischen Reiter
7.4.Digitale Revolution – Von der Idee zur materiellen Gewalt
Danksagung
Quellenangaben
Zusätzliche Leseempfehlungen
Anmerkungen
1. Vorwort
Ich stehe vor einem Problem. Ich möchte die Matrix, in der wir denken und leben umgestalten. Doch unsere Worte sind Teil dieser Matrix. Wie kann ich mit diesen missverständlichen Worten die Missverständnisse nicht nur erklären, sondern auch auflösen? Woher die Worte nehmen, um eine neue Welt zu beschrei - ben?
Vor allem aber – wie kann ich die hundert Einwände, die es gibt, ausräumen, ohne zu langweilen? In einem Gespräch könnte ich auf individuelle Einwände eingehen, sie entwirren und auflösen. In einem Buch müsste ich alle denkbaren Einwände aller Leser*innen berücksichtigen und entkräften. Das wäre möglich. Aber es entstünde ein sehr mehrgleisiger, sehr komplizierter Text, der – gerade, weil er jede Frage beantworten will – alle verwirrt und ermüdet.
Mehrfach sah ich mich beim Schreiben mit Sachverhalten konfrontiert, die sehr umfangreiche, in die Breite und Tiefe gehende Erklärungen erfordern würden. Ich habe immer wieder auf textgewaltige Erklärungen verzichtet und mich um Kürze und Klarheit bemüht. Denn die Vielzahl möglicher Einwände und die Fülle von Problemen, vor denen wir stehen, lassen Lösungen immer unmöglicher erscheinen. Aus dem unlösbaren Dilemma sehe ich nur einen Ausweg. Ich hoffe, dass die Leser*innen dieses Buches ihre Kreativität einbringen – nicht um die Unmöglichkeit von Veränderung zu beweisen, sondern um theoretische und praktische Schwierigkeiten, die es in Hülle und Fülle gibt, aus dem Weg zu räumen. Ein neuer Gesellschaftsentwurf muss wahrlich gut durchdacht sein. Dazu braucht es viele Köpfe.
Es gibt keine Superheld*innen, die die Welt quasi im Alleingang retten. Wir können das nur gemeinsam tun. Dieses Buch will einen Beitrag dazu leisten. Es sucht nach dem Wesen hinter den Erscheinungen, den unhinterfragten Mechanismen hinter dem Offensichtlichen. Ziel ist es, durch Blick auf das nackte Skelett des Kapitalismus eine Basis für gemeinsames Handeln zu schaffen. Wenn wir nicht gemeinsam untergehen wollen, müssen wir gemeinsam neue Wege gehen. Dazu sollten wir weniger nach Schuldigen und mehr nach Ursachen suchen.
Lassen wir uns nicht länger teilen und beherrschen. Zeigen wir nicht länger mit Fingern aufeinander, sondern suchen nach Strukturen, die unser Handeln bestimmen. Das Sein schafft das Bewusstsein. Das Bewusstsein schafft aber auch das Sein. Marx fasste das sinngemäß in die Worte: Eine Idee wird zur materiellen Gewalt, wenn sie die Massen ergreift. Neue Ideen können neue Strukturen hervorbringen. Neue Strukturen können die Muster auflösen, aus denen heute Täter*innen und Opfer entstehen. Ich weiß nicht, ob uns dies gelingt. Mit diesem Buch möchte ich jedoch meinen Beitrag zu einem möglichen Gelingen leisten. Ich tue dies im Gedenken an die Philosophin Simone Weil, die im Sommer 1933 in einem Artikel schrieb: „In unserer Tätigkeit die Hoffnung, welche eine kritische Prüfung als beinahe grundlos erwiesen hat, dennoch ungeschmälert aufrechterhalten: das ist Mut im wahrsten Sinne des Wortes.“2 Mit anderen Worten: Ich habe keine Hoffnung und genau deshalb habe ich dieses Buch geschrieben.
2. Prolog – SehnSucht nach Meer/Mehr
Giacomo Casanova soll laut Internet sinngemäß gesagt haben: „Willst du Menschen beflügeln ein Boot zu bauen, wecke in ihnen die Sehnsucht nach dem Meer.“ Ich habe Sehnsucht nach einer Welt, in der wir notwendige und sinnvolle Arbeit auf alle verteilen und deshalb nur noch durchschnittlich 4 Stunden am Tag oder 3-4 Tage in der Woche arbeiten müssen. Ich habe Sehnsucht nach einer Welt, in der die Kapitaleinkommen sinken und die Lohneinkommen steigen, so dass alle in Würde leben und arbeiten können. Ich habe Sehnsucht nach einer Welt, in der wir wieder Zeit haben, die kleinen Dinge im Leben zu genießen: einen entspannten Feierabend im Kreis von Freund*innen oder Familienangehörigen, weil uns Alltagssorgen wie Angst um die Arbeitsstelle, die nächste Mieterhöhung, die zu kleine Rente, die Zusatzkosten bei der Zahnbehandlung etc. fremd geworden sind. Ich habe Sehnsucht nach einer Welt, in der Wörter wie Konsumterror und Wachstumswahn, Klimakatastrophe und Umweltzerstörung in Vergessenheit geraten sind. Ich habe Sehnsucht nach einer Welt, in der wir Menschen nicht zu vermeintlich autarken Egoist*innen erziehen, sondern zu Menschen, die sich ihrer Stärken, aber auch ihrer Schwächen bewusst sind und gelernt haben, sich in ihrer Unterschiedlichkeit zu akzeptieren und zu gegenseitigem Nutzen zu ergänzen. Ich habe Sehnsucht nach einer Welt, in der Menschenrechte für alle gleichermaßen gelten und nicht davon abhängen, welchen Pass die Menschen haben. Ich habe Sehnsucht nach einer Welt, in der das Summen der Bienen und Hummeln wieder öfter zu hören ist. Ich habe Sehnsucht nach Sommer ohne Angst vor Dürre und Winter mit Schnee und Eis. Ich habe Sehnsucht nach einem Alltag voller Gelassenheit und Freude auf den nächsten Tag. Ich habe Sehnsucht nach einer Welt, die unteilbar ist, weil alle Menschen in ihr einen Platz haben, an dem sie in Frieden und Würde leben können, weil in dieser Welt untrennbar Rechte mit Pflichten und Freiheit mit Verantwortung verbunden sind.
Doch reicht es wirklich “Her mit dem schönen Leben!” zu fordern? Vor gut 100 Jahren hatten Millionen Menschen eine Sehnsucht nach sozialer Gerechtigkeit und Chancengleichheit. Viele haben in blindem Vertrauen das Schiff des Marxismus bestiegen, und auf dem Meer der Revolution ihr Leben gegeben. Der Traum erlitt Schiffbruch, weil Ingenieur*innen und Bootsbauer*innen zu ängstlich oder zu unwillig waren, die Baupläne für das Schiff gründlich zu diskutieren. Gescheitert ist das Experiment Sozialismus nicht an der Lust der „Matros*innen“ zu fernen Ufern aufzubrechen. Im Gegenteil: Viele „Matros*innen“ habe sich in bester Absicht für den Traum geopfert. Rückblickend war ihr Tod umsonst, ihr Kampf um die Macht erfolglos und ihr Ringen mit den Mühen der Ebene vergeblich. 30 Jahre nach dem Untergang der sozialistisch regierten Staaten bzw. des Ostblocks haben viele Opfer des Sozialismus ihre Leiden nicht verwunden, während zugleich von den sozialen Errungenschaften kaum etwas geblieben ist. Das historische Scheitern des Marxismus hat nicht nur Millionen Opfer gefordert, es hat auch viel Idealismus aufgebraucht. Es hat den Glauben zerstört, Menschen könnten soziale Gerechtigkeit und Frieden schaffen. Sehnsucht allein reicht nicht. Ein Aufbruch muss auch gut geplant werden.
Aber lässt sich nach der Erfahrung dieses furchtbaren Scheiterns der Glaube an ein gutes Leben für alle überhaupt wiederbeleben? Ergibt es Sinn, neue unrealistische Luftschlösser in die Wolken zu bauen? Ist es nicht endlich Zeit, der Realität offen ins Antlitz zu sehen? Woher soll das schöne Leben kommen, da unsere Welt immer offensichtlicher am Abgrund dahin taumelt? Wäre es nicht notwendig Maß zu halten und Regeln durchzusetzen? Das klingt wahrlich nicht nach Sehnsucht nach dem Meer, sondern nach Mühe, Arbeit und Bescheidenheit. Also welche Sehnsucht kann ich in Süchtigen wecken? Und süchtig sind wir, die wir in den sogenannten Industriestaaten leben, alle. Wir sind süchtig nach einem bequemen Leben. Längst ist uns klar, dass sich die Welt unseren Lebensstandard nicht leisten kann. Weniger klar ist, dass auch wir selbst uns unseren Lebensstandard nur leisten können, weil wir eben nichts Äquivalentes dafür leisten müssen. 40% des EU-Haushaltes fließt in Agrarsubventionen. Diese Milliarden sind unsere Droge. Sie sorgen zum einen dafür, dass unsere Lebensmittel so billig sind, dass wir in Deutschland etwa die Hälfte davon wegwerfen können. Zum anderen stützen sie unser Glaubensgebäude, dass wir mehr arbeiten als wir konsumieren. Deutschland war lange Zeit Exportweltmeister. Exportüberschüsse entstehen, weil wir der Welt mehr verkaufen als wir von ihr kaufen. In den Büchern der Konzerne sorgt das für gute Profite. Doch die Rechnung ist manipuliert. Da Agrarsubventionen landwirtschaftlichen Betrieben Einkommen unabhängig vom bzw. zusätzlich zum Verkaufserlös aus ihren Produkten verschaffen, können sie Lebensmittel zu Preisen unter den Herstellungskosten auf den Markt zu bringen. Dadurch drücken wir die Weltmarktpreise für Lebensmittel. Sogenannte Agrarstaaten müssen deshalb zu Dumpingpreisen produzieren. Das senkt ihr allgemeines Lohnniveau. In den so erzwungenen Billiglohnländern können wir dann auch Textilien und andere Konsumgüter unterhalb unserer Herstellungskosten einkaufen. Dank unserer Agrarsubventionen kaufen wir auf dem Weltmarkt folglich viele Konsumgüter unter unseren Herstellungskosten ein. Unsere Importausgaben sinken dadurch unter die realen Kosten. Unsere Exporterzeugnisse können wir dagegen zu Preisen, die deutlich über den Herstellungskosten liegen, verkaufen, denn wir exportieren vor allem Hightech und Waffen. Dank Patentrechten und technischem Knowhow können wir unsere Exportwaren mit Preisaufschlägen verkaufen. Ob solche extra Profite gerechtfertigt sind, darüber lässt sich vielleicht streiten. Aber ist es fair Lebensmittel- und Konsumgüterpreise künstlich unter den Marktpreis zu drücken? In einer wirklich freien Marktwirtschaft wäre das unmöglich, denn die müsste ohne Subventionen auskommen. Es zeigt sich, dass Subventionen freie Marktwirtschaft verhindern, uns aber enorm zum Vorteil gereichen, weil sie unsere Handelsbilanz positiv erscheinen lassen. In Preisen ausgedrückt exportieren wir mehr als wir importieren. Infolge der Preismanipulation importieren wir jedoch mehr Arbeitsleistung und Ressourcen als wir exportieren. Wir drücken unsere Importpreise künstlich runter und treiben unsere Exportpreise künstlich hoch.
Vor diesem Hintergrund Sehnsucht nach einem guten Leben wecken, heißt Sehnsucht nach einem bescheidenen Leben wecken. Ich bezweifle, dass ein tiefes Gefühl von Gerechtigkeit der neuen Bescheidenheit Glanz verleihen kann. Nach dem Scheitern des Sozialismus sind Visionen von sozialer Gerechtigkeit, von Frieden unter den Menschen und einem Leben im Einklang mit der Natur offensichtlich nur noch schwer vermittelbar. Gerechtigkeit – was soll das sein?
Versuche, allgemein gültige Kriterien für Gerechtigkeit aufzustellen, sind bisher gescheitert. Ich denke es liegt u.a. daran, dass wir Menschen zu unterschiedlich sind in unseren Anlagen und unserer soziokulturellen Ausgangslage. Infolge dieser Unterschiedlichkeit lassen sich wohl kaum allgemein gültige Prinzipien aufstellen, die alle als gerecht empfinden werden. Weil wir Menschen unterschiedlich sind, können wir uns einer Idee von Gerechtigkeit nur annähern. Für mich gibt es daher nur ein Streben nach Gerechtigkeit. Ziel des Gerechtigkeitsstrebens sollte es sein, Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit wahrzunehmen und sie gerade deshalb unterschiedlich zu behandeln, allerdings allein mit dem Ziel, Chancengleichheit zwischen ihnen zu ermöglichen.
Denn gerade die Unterschiedlichkeit von Menschen macht eine Gesellschaft erfolgreich. Je besser wir einander in unserem Anderssein akzeptieren und fördern, desto besser können wir uns ergänzen. Erst unsere Unterschiede bewirken, dass das Ganze mehr als die Summe der Einzelteile ist. Wenn wir in unserer individuellen Befähigung zusammenfinden und zusammenarbeiten, wenn wir alle teilhaben lassen und alle einbeziehen, dann habe ich Hoffnung, dass meine eingangs formulierte Sehnsucht Wirklichkeit werden kann. Dann können wir mit weniger Arbeit glücklicher und entspannter leben. Für diese Sehnsucht will ich ein Schiff entwerfen. Ich will aus den Fehlern früherer Schiffbrüche lernen und den Bauplan offen zur Diskussion stellen. Doch zunächst – eingedenk des Vorwortes – eine kurze Bestandsaufnahme des sehr komplexen Systems aus Ökologie und Ökonomie.
3. Probleme – Gestörte Kreisläufe
3.1. Der Wasserkreislauf – Verbrauch statt Gebrauch
Nahezu unbemerkt vom öffentlichen Bewusstsein sind 150 Städte weltweit dabei, im Boden zu versinken. Tokio soll sich bereits um 4 Meter abgesenkt haben. Venedig, Teheran, Singapur, Ho-Chi-Minh-Stadt, Jarkata... die Liste lässt sich fortsetzen. Ein Grund dafür ist die ungehemmte Nutzung von Grundwasser für den täglichen Bedarf. Grundwasser ist oft seit Jahrmillionen im Boden gespeichert. Wird davon aus dem Untergrund mehr hochgepumpt, als sich durch Versickerung neu bildet, entstehen Hohlräume. Diese Hohlräume verdichten sich nach und nach durch den Druck des oberen Erdreichs. Dadurch geht der Raum, in dem Grundwasser gespeichert werden kann, dauerhaft verloren. Was in tiefen Bodenschichten an Hohlraum verschwindet, wird irgendwann an der Erdoberfläche durch Erdabsenkungen sichtbar. Die hemmungslose Nutzung des Grundwassers bleibt nicht ohne Folgen.
Dass wir heute in wachsendem Maße Grundwasser für unsere alltägliche Wasserversorgung nutzen, hat seine Ursache darin, dass wir Wasser heute nicht mehr wie in den zurückliegenden Jahrmillionen gebrauchen, sondern verbrauchen. Bis zum Beginn der Industrialisierung gab es einen funktionierenden Wasserkreislauf. Wasser verdampfte und bildete Wolken. Diese brachten Regen und Schnee über das Land. Die Niederschläge versorgten den Boden mit Feuchtigkeit. Was die Pflanzen nicht sofort nutzten, versickerte oder sammelte sich in Flüssen und Seen. Sowohl Flüsse als auch Seen waren einmal Trinkwasserreservoire. In den Wasserleitungen der Antike wurde Fluss- bzw. Seewasser in die Städte und auf die Felder gepumpt – nicht wie heute Grundwasser. Ein Teil des Schnees verblieb als saisonaler Wasserspeicher auf den Berggipfeln. Die Berggipfel konnten in Mittelgebirgslagen dank ihrer Vegetation und in Hochgebirgslagen dank der Kälte den Schnee mehr oder weniger lange speichern. Diese verschneiten Berggipfel speisten die Flüsse in den meisten Regionen das ganze Jahr über mit Wasser.
Wasser ist auf der Erde nicht knapp. Wir leben auf einem wasserreichen Planeten. Der Menschheit ist es seit Entfesselung des Kapitalismus jedoch gelungen, Trinkwasser zu einem knappen Gut zu machen. Durch globale Verschmutzung der Flüsse und Seen haben wir viele Süßwasserreservoire als Trinkwasserquellen zerstört. Der Kapitalismus schafft Überfluss an Sinnlosem und Mangel an Notwendigem. Beim Wasser zeigt sich das exemplarisch. Mehr oder weniger sinnhafte bis sinnlose Produkte vermüllen am Ende ihrer oft gezielt kurzen Nutzungsdauer sichtbar oder unsichtbar unser Wasser. Nicht nur Tümpel, Teiche, Seen, Bäche und Flüsse, auch die Meere haben wir in Mülldeponien verwandelt. Längst ist uns klar, was das Hauptproblem ist: sichtbarer Müll aller Art sowie Munitionsreste, Mikro- und Nanoplastik, chemische und pharmazeutische Schadstoffe aus Industrie, Medikamentenproduktion und Landwirtschaft sowie multiresistente Keime infolge der Verwendung von Antibiotika als Wachstumsförderer in der Tiermast. Unsere Technik ist bisher weit davon entfernt, den von uns produzierten Müll sowie Unrat aller Art aus dem Wasser wieder heraus zu holen.
So wird auf unserem wasserreichen Planeten Mangel an Trinkwasser erzeugt – ja geradezu produziert. Eine immer kleiner werdende Gruppe von Menschen verdient am Verkauf von durch Verknappung zur Ware gewordenem Wasser.
3.2. Der Stoffkreislauf – Schöner Schrott
Aus Erde werden Pflanzen, Tiere fressen Pflanzen, Tiere fressen Tiere. So kennen wir die Nahrungskette, an deren Ende wir uns sehen. Doch die Nahrungskette ist ein Stoffkreislauf. Denn Pflanzen und Tiere sterben irgendwann. Und aus dem, was übrig bleibt, machen Pilze, Würmer, Insekten und Bakterien wieder Erde. Diesen Teil des Stoffkreislaufes haben wir größtenteils ausgeblendet.
Bis Menschen die chemische Industrie schufen, entging nichts und niemand diesem Stoffkreislauf. Zwar gibt es Bestandteile wie Zähne und Knochen, die (zur Freude der Archäologen und Paläontologen) teilweise faszinierend lange brauchen, um endgültig wieder zu Erde zu werden. Doch Reste biologischer Prozesse wurden nur in Ausnahmefällen zu Museumsstücken. Bestenfalls erfreuen sie uns als Kreidefelsen oder Kohleflöze. Doch immer blieben sie Teil des Kreislaufes des Werdens und Vergehens.
In diesem Werden und Vergehen bemühen sich nicht nur Menschen um Vorratshaltung. Hamster, Mäuse, Bienen etc., ja auch Pflanzen legen Nahrungsvorräte an. Letztere speichern Nährstoffe in Zwiebeln, Knollen, Stängeln und in zum Teil erstaunlich großen Samen. Tiere speichern Nahrung in unterirdischen Verstecken, luftigen Bauten oder in beachtlichen Fettschichten. Dank dieser können zum Beispiel Kaiserpinguine mehrere Monate ohne Nahrung in klirrender Kälte aushalten. Vorratshaltung (Sparen) ist zweifelsfrei sinnvoll.
All diese Nahrungsvorräte sind auf Zeit angelegt. Das aufgespeicherte Fett verbraucht sich infolge fehlender Nahrungszufuhr. Aber auch alle anderen Vorräte müssen innerhalb bestimmter Zeiten verbraucht werden, sonst verrotten sie. Zwiebeln, Knollen, Kornvorräte, Bienenhonig etc. lassen sich nicht ewig dem Stoffkreislauf entziehen. Die Haltbarkeitsdauer ist begrenzt. Infolgedessen werden unverbrauchte Vorräte irgendwann wieder zu Erde, zu Rohstoff für neues Leben. Vorratshaltung bzw. Sparen haben in ihrem Ursprung einen Sinn und ein Ziel. Meist gilt es den Winter zu überstehen. Für uns Menschen sind weitere Ziele hinzugekommen. Unsere Vorratshaltung dient nicht nur dazu, über den nächsten Winter zu kommen. Wir sparen auch, um Mittel für Investitionen zu haben. Das so entstandene Kapital hat im Kapitalismus ganz neue Methoden der Kapitalverwertung hervorgebracht. Doch dazu später mehr.
Betrachten wir die Zerstörung des natürlichen Stoffkreislaufs zunächst vor dem Hintergrund der kapitalistischen Verwertungslogik. Wir wollen, dass von uns produzierte Nahrungsmittel möglichst lange halten. Durch genetische Manipulation und Konservierungsstoffe verrotten sie immer langsamer. Inzwischen sind wir Menschen selbst zwar nicht unsterblich, aber schwer verrottbar geworden. Unsere toten Leiber lagern wie Mumien in der Erde. Wenn wir so weiter machen, müssen wir uns fragen: Woher soll in tausend Jahren die Erde kommen, aus der neues Leben sprießen kann?
Doch es ist nicht nur unser Bestreben, das Verrotten der Nahrungsmittel aufzuhalten, welches den Stoffkreislauf zerstört. Umgekehrt beschränken wir die Lebensdauer von Industrieprodukten künstlich. Geplante „Sollbruchstellen“ sollen die Gebrauchsfähigkeit von Gütern beenden, die aus unvergänglichem Material gebaut sind. Für diese gezielte faktische Selbstzerstörung gibt es längst einen Begriff: geplante Obsoleszenz. Der Sinn besteht darin, eine ununterbrochene Produktion neuer Güter in Gang zu halten. Warenproduktion erhält Arbeitsplätze. Das sichert nicht nur Lohnzahlungen, sondern auch Profit. Ziel ist die Produktion von Waren, die im Laden möglichst lange haltbar sind, nach dem Verkauf aber möglichst schnell ersetzt werden müssen.
Die Logik ist die gleiche: Nahrungsmittel sollen vor ihrem Verbrauch möglichst lange lagerbar sein. Das ermöglicht auch extrem lange Transportwege. Faktisch endlos lagerbare Industrieprodukte sollen nach dem Verkauf möglichst schnell verbraucht – d. h. unbrauchbar – sein. Das ermöglicht es, immer neue Industriegüter zu verkaufen. Lange Lagerbarkeit und kurze Nutzungsdauer führen bei Nahrungs- wie Industriegütern in die gleiche Sackgasse. Chemisch behandelte Lebensmittel verrotten langsamer und nicht schadstofffrei. Industriegüter bilden infolge kurzer Nutzungszeit immer gigantischere Müllberge. Neben den sichtbaren Müllbergen zerstört unsichtbarer „Müll“ den Stoffkreislauf. Böden und Gewässer werden durch Dünger, Pestizide, Fungizide und Insektizide vergiftet. Industrie, Energiewirtschaft und Verkehr verschmutzen die Luft. Die Natur wird immer lebloser, weil artenärmer. Wir stehen nicht am Ende einer gedachten Nahrungskette, wir sind Teil eines Stoffkreislaufes. Wenn wir weiter so tun, als gäbe es ein Ende der Nahrungskette, werden wir als Spezies bald am Ende sein. Leben kann es nur geben, solange Kreisläufe existieren. Mit der Zerstörung des Wasser- und des Stoffkreislaufes untergraben wir unsere Lebensgrundlagen. Wollen wir diese erhalten, müssen wir lernen in Kreisläufen zu denken.
3.3. Der Lebenskreislauf – Vertreibung aus dem Paradies
Die Zerstörung der natürlichen Kreisläufe wird im Zuge der Entwicklung der kapitalistischen Produktions- und VerteilungsweiseA immer offensichtlicher. Der Sündenfall der Menschheit liegt jedoch schon sehr viel weiter zurück. Wenn nachfolgend aus der Bibel zitiert wird, dann dient dies keineswegs einer Beweisführung, sondern lediglich der Illustration einer historischen Entwicklung. Die Paradiesgeschichte hat geradezu etwas Prophetisches. Allerdings ist diese Geschichte erstaunlich missverstanden worden. Dabei ist der Text bestechend klar in seiner Aussage.
Adam ist keineswegs der erste Mensch. So schusselig waren die Autoren der Bibel nicht, dass sie die kurz zuvor erzählte Schöpfungsgeschichte schon vergessen hätten. Menschen gab es bereits, aber kein Mensch war da, der das Land bebaute. Adam ist der erste Landwirt. Er wird von Gott aus der Erde vom Acker geformt und in den Garten Eden gesetzt. Erde und Himmel, Pflanzen und Tiere gab es schon. Nun aber beginnen all die Sträucher auf dem Felde und all das Kraut auf dem Felde zu wachsen. Der Garten Eden ist keine unberührte Natur mehr, sondern bereits gestaltete Umwelt.