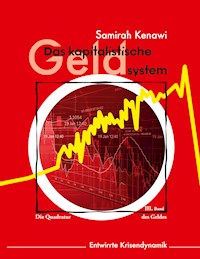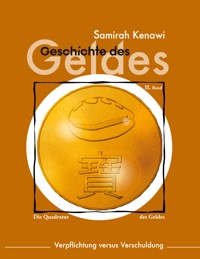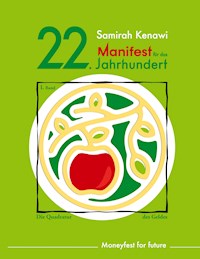Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Die Quadratur des Geldes
- Sprache: Deutsch
Der umfassende Reformvorschlag zielt darauf, unser heutiges selbstzerstörerisches Geldsystem durch ein auf Selbstregulierung programmiertes System zu ersetzen. Die Regeln bauen auf der Analyse der drei vorangegangenen Teile der Quadratur des Geldes auf. Der Kerngedanke besteht darin, ein Verrechnungssystem im Sinne Proudhons und Keynes' zu schaffen, in dem Geldschöpfung konsequent an reale Wertschöpfung gekoppelt ist, so dass keine Finanzblasen entstehen können. Voraussetzung dafür ist es, Profit nicht einfach zu verbieten, sondern Profit in jeder Hinsicht überflüssig zu machen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 356
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Es scheint, daß erst wieder eine Generation darüber hinsterben muß, bis man die Geldnatur der Giroguthaben begreift, bis man zwischen Kaufmittel und Rechnungsmittel zu unterscheiden lernt, bis man sich gewöhnt, die Geldschöpfung als planmäßige menschliche Tätigkeit aufzufassen und unter wissenschaftliche Regeln zu stellen.
Friedrich Bendixen1
Technische Hinweise
Zitierweise
In Zitaten wurde die Schreibweise des Originals beibehalten, die teilweise erheblich von der heutigen abweicht.
Bei Verweisen auf andere Teile der Tetralogie „Die Quadratur des Geldes“ wird nicht immer der volle Titel aufgeführt, sondern meist nur die Nr. des Teils.
Links
Unterstrichene Textteile sind im E-Buch mit einem Internetlink hinterlegt.
Gender
Soweit mir das Geschlecht der Akteur*innen nicht eindeutig bekannt war, habe ich mich um geschlechtsneutrale Formulierungen bemüht. Es ist ein Versuch auch in dieser Hinsicht Ansichten zu hinterfragen und neu zu denken. Mir ist bewusst, dass der * beim Lesen eine Art Stolperstein ist. Alle, die einmal gesehen oder gehört haben, was Menschen mit unklarer Geschlechtsidentität in der Vergangenheit von der Medizin und der Gesellschaft angetan wurde, werden darin eine Bitte um Verzeihung erkennen.
Endnoten
1, 2, 3... Hochgestellte Zahlen verweisen auf Quellenangaben und weiterführende Erklärungen zum Text am Ende des Buches, siehe Anmerkungen im Anhang.
Fussnoten
A, B, C... Hochgestellte Großbuchstaben verweisen auf Worterklärungen bzw. Ergänzungen zum Text am Fuß der jeweiligen Seite.
Abkürzungen
d.A. die Autorin H.d.A. Hervorhebung der Autorin H.i.O. Hervorhebung im Original Ü.d.A. Übersetzung der Autorin
Inhalt
1. Hoffnung
Gefangen in der Büchse der Pandora
2. Grundgesetze
Dialektik – Grundprinzip in Natur und Gesellschaft
3. Grundwerte
Gedanken zu einem neuen Gesellschaftsvertrag
3.1. Freiheit?
Freiheit erfordert Verantwortung und ökonomischen Freiraum
3.2. Gleichheit?
Chancengleichheit statt Gleichmacherei
3.3. Brüderlichkeit?
Alle Menschen werden Schwestern?
4. Blickverschiebung
Versuch einer Entsorgung ökonomischer Glaubenssätze
5. Geldschöpfungsrecht
Ohnmacht und Unwissenheit schützen vor Strafen
6. Kapitalakkumulation
Handelskapital – Ein Geburtsfehler der Geldwirtschaft
7. Tauschgerechtigkeit
Ein vollendeter Tausch hinterlässt keine offene Rechnung
8. Vordenker
George, Marx, Proudhon, Gesell und Keynes
9. Kritikerinnen
Luxemburg, Weil und der Marxismus
10. Reformideen
Krisenmanagement statt radikalem Umbruch
Zinskritik
Schwundgeld
Komplementärwährungen
Tauschringe
Golddeckung
Modern Monetary Theorie
Vollgeld
Staatsfinanzierung
Schulden- und Vermögensschnitt
Grundeinkommen
Finanztransaktionssteuer
Gemeinwohl-Ökonomie
Purpose Unternehmen und Genossenschaften
Barter-Clubs
WIR-Bank
11. Kapitalersatz
Chancengleichheit durch Beseitigen des Eigenkapitalbedarfs
11.1. Boden- und Erbrecht
Auflösen des Bodenkapitals durch geldlose Nutzungsübertragung
11.2. Umlaufmittelbeschaffung
Verrechnungsbanken im Sinne Pierre-Joseph Proudhons
11.3. Investitionsfinanzierung
Geld für gute Ideen ohne Investitionszwang
12. Preisbildung
Der Preis im Spannungsfeld von Kosten und Einkommen
12.1. Marktillusion
Freier Wettbewerb ist gegenwärtig ein Mythos
12.2. Wettbewerb
Voraussetzung für faire Preise
13. Spargrenzen
Das Sparvolumen dem Investitionsbedarf anpassen
14. Politikwechsel
Grundlagen für Tauschgerechtigkeit
14.1. Staatsentschuldung
Entschulden durch Bilanzverkürzung
14.2. Steuerreform
Staatsfinanzierung durch Henry Georges single tax
14.3. Bargeldkontrolle
Abschaffen oder kontrollieren?
14.4. Kryptowährung
Die Welt verbessern durch Anonymisierung?
15. Geldflusssicherung
Demokratische Kontrolle des gesellschaftlichen Tauschmittels
15.1. Geldmengensteuerung
Geldschöpfung durch Warenkredite
15.2. Warenversorgung
Kaufleute – Vermittler zwischen Produktion und Konsum
15.3. Geldumlauf
Modernisierung einer Idee Silvio Gesells
15.4. Spargeldverwaltung
Gute Geldverteilung sichert kontinuierlichen Geldfluss
15.5. Welthandel
Keynes Clearing Union statt Gold oder Leitwährung
15.6. Wechselkurse
Fairtrade durch internationale Verrechnungssysteme
16. Kreislaufmodell
Krisenfrei durch Schließen der Kreisläufe
17. Wirtschaftsring
WIR-Bank – Ein Erfolgsmodell auf dem Prüfstand
18. Wirtschaftspolitik
Den Arbeitsmarkt zum sozialen Kitt der Gesellschaft umgestalten
19. Bildung
Informationsflut verhindert Wissenserwerb
20. Graswurzelprojekte
Keimzellen einer neuen Ordnung
21. Auswege
Voneinander lernen – miteinander siegen
22. Fazit
Den Fluch des goldenen Zeitalters überwinden
23. Anhang
23.1. Danksagung
23.2. Vita
23.3. Die Quadratur des Geldes
23.4. Literaturverzeichnis
23.5. Anmerkungen
Textkästen
Bedingungsloses Grundeinkommen
Hoffnungsschimmer oder Irrlicht
Investieren
Ein gesamtgesellschaftlicher Akt
Vorschlag zur Gründung einer Internationalen Clearing-Union
Auszüge/Zitate und
kursiv eingefügte Kommentare
1. Hoffnung
Gefangen in der Büchse der Pandora
Einzig die Hoffnung verblieb im unzerbrechlichen Hause, drinnen unter den Lippen des Kruges, und nicht aus der Öffnung flog sie heraus...1
Hesiod2
Unsere Gesellschaft taumelt immer spürbarer auf eine große Krise zu. In diesem Klima wächst die Sehnsucht nach einem Ausweg, einer Alternative zur bestehenden Ordnung. Doch neue Ideen haben es schwer in der Informationsfülle des Informationszeitalters Gehör zu finden. Am leichtesten finden Vorschläge Anklang und Zulauf, die einen Wechsel ohne gravierende Einschnitte und Veränderungen versprechen und ein schönes Leben verheißen. Solche Reformideen sprechen nicht von Arbeit, Verzicht, Kampf, Entbehrung, Einschränkung oder radikaler Neuorientierung, sondern davon, ohne großen Aufwand an Geld zu kommen. Es gibt doch genug Geld in der Welt. Warum also nicht einfach Geld verschenken, um alle am schönen Leben teilhaben zu lassen? Hierzulande, wo die Geschäfte stets voller Waren sind, mit deren Herstellung keine eigene Erfahrung verbunden ist, scheint das vielen ein realistischer Vorschlag. Berichte über die Produktionsbedingungen dieser Waren werden dabei ausgeblendet. Doch wer sich die, in hier übervollen Geschäften angebotenen Waren aneignet, akzeptiert (un)wissentlich die sklavenähnlichen Herstellungsbedingungen auf den Feldern und in den Fabriken, von/aus denen diese Waren kommen. Die heutige globale Wirtschaft hat es nicht vermocht, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass kein Volk, keine Nation auf Kosten anderer Völker, Länder oder Nationen in Frieden ein gutes Leben genießen kann. Als Menschheit haben wir jedoch nur eine Überlebenschance, wenn wir alle nachhaltig wirtschaften und friedlich miteinander leben. Wir kommen nicht umhin global zu denken. Das heißt aber nicht, dass Veränderungen immer ein global koordiniertes Handeln erfordern.
Wir leben in einer hegemonialen Welt, d.h. es gibt dominante Ordnungsmächte. Das sind heute nur noch zum Teil staatliche Strukturen. Es gibt längst Machtstrukturen jenseits staatlicher Kontrolle. Neben internationalen Konzernen sind das auch kriminelle Organisationen. Die italienische Mafia ist für solche familiär oder national basierten Organisationen namengebend, aber nur eine unter vielen. Auch solche Strukturen müssen entmachtet werden.
Das klingt nach einer unmöglichen Aufgabe. Doch alle nutzen Geld als elegantes Mittel zum Raub, wie im 3. Teil dieser Tetralogie (Kapitel 1) dargelegt wurde. Geld ist eine zentrale Ursache der komplexen sozialen und ökologischen Krisen.3 Da Geld heute fast nur noch in digitaler Form existiert, besteht theoretisch die Möglichkeit, große Geldvermögen und daraus erwachsende Machtstrukturen durch das Einfrieren von Konten auszuschalten. In der Politik findet das bereits Anwendung. Nachhaltig können solche Maßnahmen aber nur sein, wenn damit Änderungen des Regelwerkes des heutigen Geldes einhergehen, die verhindern, dass neue private Großvermögen entstehen. Erst solche Regeländerungen schaffen die Voraussetzungen für ein friedliches und nachhaltiges Miteinander. Dazu muss das heutige Kapitalakkumulation erzwingende Geldsystem durch ein Geldsystem ersetzt werden, das Tauschgerechtigkeit (siehe Kapitel 7) ermöglicht, ja fördert.
Um bekannte Pfade zu verlassen, uns neuen Ideen zu öffnen und uns rational mit unserem Weltbild auseinander setzen zu können, müssen wir die emotionalen Erschütterungen aushalten, die das Infragestellen vermeintlicher Wahrheiten auslöst.4 Zu den Erschütterungen gehört die Irritation, dass Dinge vielleicht nicht so sind, wie wir gelernt haben sowie die Angst, aus unseren sozialen Netzwerken herauszufallen. Doch Einstein hat sehr treffend festgestellt:
Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.5
Wir müssen aus den historischen Erfahrungen lernen. Dabei dürfen wir uns nicht entzweien lassen. Vielmehr müssen wir in einer Kultur des Miteinanders nach einem Allen gerecht werdenden sinnvollen Regelwerk im Sinne John Rawls' suchen. Rawls forderte in seiner Theorie der Gerechtigkeit6 dazu auf, grundlegende Regeln und Gesetze des gesellschaftlichen Zusammenlebens in einem gedachten Urzustand zu beschließen; in einem Urzustand in dem die Menschen nicht wissen, ob sie arm oder reich, klein oder groß, Frau oder Mann, schwarz oder weiß, rund oder dünn, krank oder gesund, gläubig oder ungläubig ... sind. Bei dieser Suche dürfen wir keinen Trugbildern nachjagen.
Mit dem bedingungslosen Grundeinkommen (BGE)7 hat der Milliardär Götz Werner ein wirkmächtiges Trugbild beworben und seiner Klasse, der Klasse der Reichen, damit einen hervorragenden Dienst erwiesen. Ich habe vollstes Verständnis dafür, dass Menschen große Sehnsucht haben, inhumanen Arbeitsverhältnissen und entwürdigendem Anstehen nach Almosen zu entkommen. Ein BGE löst das Problem zermürbender Arbeit sowie demütigender Arbeitslosigkeit jedoch nicht. Es ist kein Ausweg, sondern ein Fluchtversuch. Es entspringt dem zutiefst verständlichen Wunsch dem Schlachtfeld der heutigen Arbeitswelt zu entkommen. Der Wunsch ist sehr menschlich, aber auch unsolidarisch und deshalb kurzsichtig. Die Flinte ins Korn werfen, kann das eigene Leben retten – den Krieg beendet das nicht. Das Schlachtfeld wird dadurch nur denen überlassen, die nicht fliehen können. Ideen wie die eines BGE's machen es der Klasse der Reichen leicht, den Krieg der Reichen gegen die Armen zu gewinnen.8 Nichts verhindert einen Aufstand effektiver, nichts sichert die Macht der Herrschenden besser, als falsche Hoffnungen. Die Hoffnung, durch ein BGE von der inhumanen Fron schlecht bezahlter Erwerbsarbeit erlöst zu werden, ist verständlich. Diese Hoffnung zu nähren, ist jedoch nur eine billige Methode, die Massen davon abzuhalten, sich zu organisieren, um die Arbeits- und Lohnverhältnisse zu verbessern. Der Komödiendichter Sophokles mag es amüsant gemeint haben, als er schrieb:
So einen schlage ich für nichts an, der sich als Sterblicher an leeren Hoffnungen erwärmt,9
doch für uns wird der Untergang unserer Ordnung bitterer Ernst werden, wenn wir uns weiter an falsche Hoffnungen klammern. Die Menschheit steht an einem Scheideweg. Die durch die Chaostheorie10 und die dialektischen Gesetze11 beschriebenen evolutionären Kräfte werden sich in jeder Krise Bahn brechen. Wir Menschen besitzen die Fähigkeit diese Kräfte zu analysieren und in konstruktive Bahnen zu lenken. Auf einen guten Ausgang können wir jedoch nur hoffen, wenn wir Veränderungen schnell in Gang setzen. Dabei verfolgen uns Schatten der Vergangenheit, vor allem die Enttäuschung über das Scheitern des marxistischen Experiments. Der Sozialismus war gut gemeint, aber nicht gut durchdacht. Marx ökonomische Analyse hat ein Gesellschaftsmodell hervorgebracht, das keine breite Akzeptanz fand. Daraus müssen wir lernen und einen besseren Plan zur Neuordnung der Produktions- und Austauschverhältnisse erarbeiten und diskutieren. Wir haben nicht mehr viel Zeit eine soziale und ökologisch nachhaltige Gesellschaftsordnung zu erschaffen. Die verbleibende Zeit sollten wir nutzen, eine klare Vorstellung zu entwickeln, wie ein Regelwerk beschaffen sein muss, das krisenfreies Wirtschaften ermöglicht.
1 Von Hesiod stammt die älteste uns bekannte Erzählung von der Büchse der Pandora. Zeus lässt diese Büchse (das „unzerbrechliche Haus“) von Hephaistos (dem Gott des Schmiedefeuers) schmieden und mit allen Übeln, allen „schmerzlichen Leiden“ der Welt füllen. Nach Hesiods Erzählung bleibt die Hoffnung in der Büchse gefangen, da Pandora die Büchse „nach Willen des Zeus des Wolkenversammlers“ schnell wieder zuwarf. Erst in späteren Varianten der Sage, wird die Hoffnung durch ein zweites Öffnen der Büchse als Trost in die Welt entlassen. Doch die Hoffnung ist oft ein lähmender Trost. Sie lässt uns vielfach untätig bleiben, weil wir mehr Angst vor den Folgen unseres Tuns als vor den Folgen unseres Nichttuns haben. Die Hoffnung ist völlig zu Recht ein Teil der „schmerzlichen Leiden“. So wie nach Hesiods Erzählung die Hoffnung in der Büchse der Pandora gefangen bleibt, hält uns die Hoffnung in Untätigkeit gefangen. – Immer wenn Gott spricht: „Lächle und sei froh, es könnte alles viel schlimmer sein,“ verführt uns die Hoffnung zu lächeln und froh zu sein und genau deshalb kommt alles viel schlimmer.
2. Grundgesetze
Dialektik – Grundprinzip in Natur und Gesellschaft
Es ist also die Geschichte der Natur, wie der menschlichen Gesellschaft, aus der die Gesetze der Dialektik abstrahirt werden. Sie sind eben nichts andres als die allgemeinsten Gesetze dieser beiden Phasen der geschichtlichen Entwicklung; sowie des Denkens selbst. Und zwar reduziren sie sich der Hauptsache nach auf drei: das Gesetz des Umschlagens von Quantität in Qualität und umgekehrt; das Gesetz von der Durchdringung der Gegensätze, das Gesetz von der Negation der Negation.
Friedrich Engels12
Zunächst möchte ich das grundlegende gesellschaftliche Wertesystem offen legen, das durch diese Geldreform befördert werden soll. Während die anhaltende ökonomische Krise heute einen Verfall des Gesellschaftsvertrages zur Folge hat, soll eine Geld- und Wirtschaftsreform einem neuen Gesellschaftsvertrag den Boden bereiten. Da auf den Zusammenbruch einer Ordnung irgendwann das Entstehen einer neuen Ordnung folgt, ist es sinnvoll sich über die gewünschte neue Ordnung Gedanken zu machen. Die ökonomischen Strukturen bilden dabei stets den Boden, in dem das soziale Gefüge, das kulturelle Miteinander und das politische Leben wurzeln.
Nach mehrtausendjähriger Entwicklung steht unser Geldsystem an der Schwelle einer entscheidenden Negation der Negation. Evolution geht immer den Weg, Neues durch das Überwinden (Negieren) früherer Stadien der Entwicklung in die Welt zu setzen. Evolution – die Lehre von der ständigen Veränderung des Bestehenden – kann daher auch als Lehre von einer immer wieder stattfindenden Negation früherer Negationen verstanden werden. Goethe lässt das Mephisto in die Worte fassen:
... denn alles, was entsteht, ist wert, daß es zugrunde geht.13
In unserer Sprache hebt sich eine doppelte Verneinung auf. Etwas doppelt Verneintes wird also bejaht. Die Evolution greift im Laufe ihrer Entwicklung durch Negation der Negation auf frühere Konzepte zurück. Diese Konzepte werden natürlich nicht identisch, sondern nur abgewandelt wieder aufgegriffen. Die Geschichte verläuft nicht geradlinig, sondern eher spiralförmig. Frühere Prinzipien werden immer wieder aufgegriffen und modifiziert.
Gelingt die Negation der Negation indem das alte Kerbholz-Verrechnungssystem in einem neuen Kreditgeldsystem breite Anwendung findet, kann Geld endlich als ein wirklich neutrales Tauschmittel die Rahmenbedingungen für eine soziale und ökologische Gesellschaft schaffen. Gelingt diese Modifizierung nicht, droht ein Rückfall in Tausch- bzw. Naturalwirtschaft mit verheerenden politischen und kulturellen Konsequenzen.
Während der Zusammenbruch des bestehenden Geld- und Wirtschaftssystems unabwendbar ist, wie im 1. Teil im Kapitel 7.1 Unbequeme Gesetze durch Bezugnahme auf die Chaostheorie dargelegt wurde, liegt es in unseren Händen, die auf den Untergang folgende neue Ordnung zu gestalten.
Jede gesellschaftliche Ordnung erwächst aus Gesetzen, die von Menschen verfasst sind. Geraten die menschengemachten Gesetze mit dem menschlichen Wesen oder mit natürlichen Prozessen in Konflikt, erzwingen die dialektischen Gesetze evolutionäre Umbrüche, die wir Revolution nennen. Die Kenntnis der von Friedrich Engels (siehe Kapitelzitat) formulierten dialektischen Gesetze versetzt uns in die Lage, Umbrüche vorauszusehen, auf die unsere Gesellschaft zusteuert. Dadurch sind wir theoretisch vorgewarnt und könnten uns vorbereiten, unsere Zukunft nach unseren Wünschen zu gestalten.
Das dialektische Gesetz vom Umschlagen von Quantität in Qualität lässt vorhersagen, dass der Kapitalismus zusammenbrechen wird, denn das Gesetz ist eine Variation der Chaostheorie. Diese – naturwissenschaftlich vielfach belegte Theorie – besagt, dass jedes Ordnungssystem unweigerlich ins Chaos stürzt, wenn sich in ihm einzelne Faktoren immerfort nur in eine Richtung entwickeln.14 Da in der kapitalistischen Wirtschaftsordnung Arme immer ärmer und Reiche immer reicher werden, Armut und Reichtum sich durch positive Rückkopplung also beständig verstärken, entspricht der Kapitalismus einer sich selbst zerstörenden Ordnung. Mit zunehmender Quantität beider Größen wird der Kapitalismus immer unregulierbarer. Das bedeutet, alle Regelsysteme versagen irgendwann. Aus dem Chaos wird sich eines Tages eine neue Ordnung entwickeln. Wann dieser Übergang sich ereignen wird, wann Quantität in eine neue Qualität (eine neue Ordnung) umschlägt, ist nicht vorhersagbar. Sicher ist nur, dass das kapitalistische Geldsystem auf die eine oder andere Weise kollabieren wird. Die Chaostheorie bezeichnet den Übergang von einer Ordnung (einem Ordnungsfenster) in eine andere Ordnung (ein anderes Ordnungsfenster) als chaotischen Sprung. Tatsächlich können chaotische Übergänge lange dauern. Ein historisches Beispiel ist die Zeit der Völkerwanderung nach dem Zerfall des Römischen Imperiums.
Welche Bedeutung in diesem evolutionären Prozess der Durchdringung der Gegensätze zukommt, kann hier nur skizziert werden, weil das weit über ökonomische Prozesse hinausführt. Sich durchdringende Gegensätze finden wir überall in Natur und Kultur, denn Dualität ist ein universales Prinzip. Gegensatzpaare wie gut und böse, arm und reich, groß und klein, schwach und stark ... prägen unser Denken. Es gibt jedoch kein einziges Paar, bei dem wir einen der Gegensätze prinzipiell als gut oder eindeutig als böse definieren können. Nicht einmal gut und böse selbst lassen sich klar voneinander trennen. Jeder ernste Streit basiert darauf, dass keine Streitpartei eindeutig als gut oder böse definiert werden kann. Es ist immer Maßlosigkeit – das Verlorengehen von einem Gefühl für Verhältnismäßigkeit – das Positionen, Ansprüche oder Ideen böse werden lässt. Das Maß der Dinge lässt Quantität in eine neue Qualität umschlagen.
Das Maß selbst ändert sich mit dem Kontext. Eine Ameise wirkt groß gegenüber einer Bakterie und klein gegenüber einer Maus. Der Mensch erscheint groß gegenüber der Ameise und klein gegenüber dem Blauwal. Vergleiche in der makroskopischen Welt mögen sinnvoll oder unsinnig sein, sie bewegen sich jedoch stets in einer Dimension. In der subatomaren Welt herrschen dagegen ganz andere Gesetze, wie die Nanotechnologie erkennbar macht. Deshalb macht es keinen Sinn beispielsweise eine Maus mit der Größe eines Atoms zu vergleichen. Mit der Größenordnung (der Quantität) ändert sich die Qualität.
Die inzwischen erreichte Diskrepanz zwischen Armut und Reichtum sprengt diesen Rahmen, da hier Vergleiche innerhalb einer Dimension irrational werden. 2018 sollen nur 26 Menschen genauso viel Vermögen besessen haben wie die gesamte ärmere Hälfte der Weltbevölkerung.15 Wenn wir annehmen, wir leben in einer Leistungsgesellschaft, müssten jene 26 genauso viel für das Wohl der Menschheit geleistet haben, wie die gut dreieinhalb Milliarden Armen. Das ist, als wollten wir eine Maus mit einem Atom vergleichen. Dieser Vergleich sprengt jeden Rahmen, denn er sprengt die Grenzen einer Dimension. Das bedeutet nicht, dass Reichtum grundsätzlich schlecht ist. Aber Reichtum, der vollständig von individuellem Leistungsvermögen und persönlichem Konsumbedarf abgekoppelt ist, wirkt destruktiv, weil ihm jedes Maß fehlt.16 Mit anderen Worten, nicht Geld an sich ist das Übel, das die Gesellschaft zerstört, sondern lediglich die extreme Ungleichverteilung von Geld in der kapitalistischen Ordnung. Es gilt daher nicht das Geld abzuschaffen, sondern die bestehende Geldordnung zu verändern.
Ich stelle meinem Vorschlag für eine Geldreform einige Gedanken zum angestrebten gesellschaftlichen Ziel voran, ehe ich das ökonomische Regelwerk erkläre.
3. Grundwerte
Gedanken zu einem neuen Gesellschaftsvertrag
3.1. Freiheit?
Freiheit erfordert Verantwortung und ökonomischen Freiraum
Es ist das Versprechen, uns von den Strapazen der Freiheit zu entlasten, von den Mühen der Autonomie. Denn im Gegensatz zu den sonnigen Zeiten der Achtundsechziger ist „Freiheit“ heute weniger ein Zauberwort als eine Einschüchterungsformel.
Thomas Assheuer17
Freiheit gilt in der westlichen Welt als hoher Wert. Da erstaunt es, dass Assheuer in einem Zeit-Artikel vom 11.10.2007 mitteilt, dass sich die Gesellschaft an der neuen These der Hirnforschung, dass es
weder persönliche Schuld noch Freiheit gibt ... jubelnd berauscht.18
So fraglich diese These über das Fehlen von Schuld ist, so verständlich ist der Jubel eines Teils der Gesellschaft. Dass hier über Schuld und Freiheit in einem Atemzug gesprochen wird, weist auf den Zusammenhang zwischen Freiheit und Verantwortung hin. Frei sein, erfordert für das eigene Tun Verantwortung zu tragen. Diese Verantwortung belastet die Freiheit. Der Jubel über die Schuldfreiheit offenbart den Wunsch, für das eigene Tun keine Verantwortung tragen zu müssen.
Genauso wie ein Raum ohne Wände kein Freiraum ist, weil er keinen Schutz gegen das Außen bietet, braucht auch Freiheit Grenzen. Erst Wände schaffen einen Freiraum. Erst Verantwortung schafft Freiheit. Erst durch die Verantwortung, die Freiheit von uns verlangt, erhält Freiheit ihren Wert. Auch Freizeit wird erst wertvoll, wenn wir einen Teil unserer Zeit notwendigem Tun widmen müssen. Freiheit, Freiraum, Freizeit erhalten ihren Wert dadurch, dass sie nur begrenzt verfügbar sind.
Allerdings können sich Menschen in der heutigen Welt von Verantwortung freikaufen. Aus gigantischen Vermögensunterschieden erwachsen nicht nur extreme soziale Hierarchien. Gleiches Recht für alle wird durch die Vermögensunterschiede genauso sinnentleert wie ein einheitlicher Bußgeldkatalog für alle.
Sofern ein Vermögen tatsächlich durch eigene Arbeit für die Gesellschaft entstanden ist, lässt sich ein dadurch erworbenes größeres Maß an Freiheit eventuell als gerechtfertigt betrachten. Nichtsdestoweniger ist hierbei zu berücksichtigen, dass Milliardenvermögen niemals durch adäquate Leistungen zu rechtfertigen sind, sondern durch destruktive Mechanismen im heutigen Geldsystem entstehen, die vor allem im 3. Teil dieser Tetralogie analysiert wurden. Durch Marktmanipulation, Patentrechte oder Börsenspekulation erworbene oder ererbte Vermögen legitimieren keine aus der Größe des Vermögens ableitbaren größeren Freiheitsrechte. Wer Vermögen erwirbt, ohne eine der Größe des Vermögens entsprechende Leistung für die Gesellschaft erbracht zu haben, erwirbt heute Freiheit, ohne eine entsprechende Verantwortung tragen zu müssen. Dadurch wird die soziale Ordnung in Frage gestellt.
Ein Dilemma der Freiheit zeigt sich auch im Straßenverkehr. Der Schlachtruf „Freie Fahrt für freie Bürger“ führt sich umso mehr ad absurdum, je mehr von ihm Gebrauch machen. Die unbegrenzte Freiheit aller endet im grenzenlosen Stau. Um sich daraus zu befreien, sind Strukturen und Regeln notwendig. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen kann der Staat dem individuellen Straßenverkehr durch Schaffen entsprechender Infrastruktur (breite Straßen, viele Brücken für kreuzungsfreien Verkehr, verkehrsstromgesteuerte Verkehrsleitanlagen etc.) Freiraum schaffen. Das hat allerdings ein Begrenzen der Freiheit all jener zur Folge, die nicht am individuellen Autoverkehr teilnehmen. Insbesondere die Freiheit der Kinder wird dem individuellen Mobilitätsbedürfnis geopfert. Im dichten Verkehr der Großstädte verbleiben den Kindern nur Spielplatzinseln und Parks als Freiräume, in denen sie selbstvergessen spielen und ihre Umwelt angstfrei entdecken können. Analog werden die natürlichen Wanderbewegungen frei lebender Tiere durch Autobahnen und Schnellstraßen be- bzw. verhindert. Die Freiheit des Autoverkehrs beschneidet die Freiheit vieler anderer. Die zweite Möglichkeit Staus zu verhindern, besteht im Ausbau öffentlicher Verkehrsnetze. Bahnfahren ist vor allem mit Kindern entspannter als eine Fahrt mit dem eigenen Auto. Bei entsprechend dichtem Streckennetz ist der öffentliche Nah- und vor allem Fernverkehr zudem schneller als der Individualverkehr und zwar nicht nur infolge fehlender Staus.
Freiheit wird nicht nur durch Strukturen (wie Verkehrsnetze), sondern auch durch Regeln gestaltet. Auch hier zeigt Qualität oft bessere Wirkung als Quantität. Untersuchungen haben gezeigt, dass ein Verzicht auf Verkehrsregeln mitunter mehr Schutz (d.h. Freiraum für Schwache) schafft, als eine Fülle von Vorschriften und Verboten. Wenn nur eine Regel gilt: „Aufmerksam und rücksichtsvoll!“ und niemandem ein besonderes Vorfahrtsrecht eingeräumt wird (weil alle Straßen gleichberechtigt sind), wirkt diese eine Regel verkehrsberuhigend. Abbau von Privilegien machen den Verkehr langsamer, aber dadurch für alle sicherer.
Rücksichtnahme als gesellschaftliches Ordnungsprinzip folgt der Gerechtigkeitsidee Rawls'. Vorteile und Nachteile müssen stets gegeneinander abgewogen werden. Freiheit ist oft das Ergebnis eines Kompromisses zwischen verschiedenen Interessengruppen. Ein Optimum an allgemeiner Freiheit kann deshalb nur durch immer neues Austarieren der unterschiedlichen Freiheitsansprüche erreicht werden. Dazu sind Gesetze und Regeln hilfreich, sofern sie auf ein notwendiges Maß beschränkt bleiben. Sie funktionieren umso besser, je geringer der Aufwand für ihre Durchsetzung ist, mit anderen Worten, je höhere Akzeptanz sie besitzen. Freiheit ist im Grunde eine Art Freiraum, der an andere Freiräume grenzt. In einer Gesellschaft geht es also darum, die Freiheit der einen im Interesse der Freiheit anderer zu begrenzen. Legitim sind derartige Beschränkungen, wenn langfristig ein Zuwachs an Freiheit für die Mehrheit geschafft wird.
Hierfür allgemeingültige Regeln aufzustellen ist unmöglich. Freiheitsrechte können immer nur als Folge gesellschaftlicher Aushandlungsprozesse entstehen. Dafür kann es hilfreich sein, Freiheitsrechte an Verantwortungspflichten zu koppeln. Gesetze müssen dann dazu beitragen, auch für die Folgen von Entscheidungen, die über den eigenen Lebenskreis hinausgehen, Verantwortung zu übernehmen. Durch solches In-Verantwortung-Nehmen, stellt sich allen die Aufgabe, eigene Freiheitsansprüche auf ein für sie tragbares Maß zu beschränken. Es geht also nicht darum, die Freiheit aller, aus paternalistischer Rücksicht, auf ein für alle gleiches Maß zu beschränken. Ziel sollte es vielmehr sein, individuelle Unterschiede einzuräumen, um Freiraum für Kreativität zu sichern. Individuelle Freiräume sollten dabei an die Bereitschaft zur Übernahme individueller Verantwortung gekoppelt werden.19
Zweifellos ist eine Kette nur so stark wie ihr schwächstes Glied, doch eine Gesellschaft ist keine einfache Kette, sondern ein komplexes Netzwerk. In einem Netzwerk müssen nicht alle gleich stark sein. Punktuelle Schwäche kann durch ein gutes Netzwerk ausgeglichen werden. Nicht überall im Netz wirken gleich große Kräfte. Menschen sollen sich in diesem Netzwerk einen Platz suchen, der ihren Fähigkeiten, ihren Neigungen, ihren Möglichkeiten, aber auch ihren Grenzen gerecht wird. Je mehr Menschen ihren Platz finden, umso stärker wird das gesellschaftliche Gewebe. Allen Menschen gebühren in diesem Gewebe Rechte. Abgesehen von den durch die UNO proklamierten Grundrechten sollen Menschen jedoch keine absoluten Rechte besitzen, sondern weitergehende Rechte nur im Zusammenhang mit weitergehenden Pflichten erwerben. So wie Kinder im Laufe ihrer Entwicklung mit wachsender Fähigkeit zur Verantwortung auch wachsende Freiheit erwerben, soll für alle Individuen Freiheit stets an Verantwortung gekoppelt sein. Schließlich sind wir am Ende unserer Kindheit keineswegs alle gleich.
3.2. Gleichheit?
Chancengleichheit statt Gleichmacherei
Die Vorstellung, dass alle Menschen als Menschen etwas Gemeinsames haben, und soweit dies Gemeinsame reicht, auch gleich sind, ist selbstverständlich uralt. Aber hiervon ganz verschieden ist die moderne Gleichheitsforderung; diese besteht vielmehr darin, aus jeder gemeinschaftlichen Eigenschaft des Menschseins, jener Gleichheit der Menschen als Menschen, den Anspruch auf gleiche politische resp. soziale Geltung aller Menschen, oder doch wenigstens aller Bürger eines Staates, oder aller Mitglieder einer Gesellschaft abzuleiten.
Friedrich Engels20
Als die Französische Revolution 1789 die Gleichheit aller Bürger (!)2 auf ihre Fahnen schrieb, forderte sie damit die Gleichheit vor dem Gesetz. Für den Adel sollten hinfort keine anderen Gesetze mehr gelten als für die übrigen Bürger des Landes. Es sollte unter Männern kein Vorrecht der Geburt mehr geben, keine Privilegien, die sich allein auf die Herkunft gründeten. Die Forderung nach Gleichheit hatte das Ziel, ererbte, also nicht selbst erworbene Vorteile zu beseitigen. Es ging um Gleichbehandlung durch das Gesetz. Doch entsteht Gerechtigkeit dadurch, dass alle Menschen gleich behandelt werden?
Wir Menschen sind nicht gleich. Von Geburt an schlummern in uns unterschiedliche Potentiale. Natur und Kultur bewirken, dass wir unterschiedliche Interessen und Fähigkeiten ausprägen. Unterschiede zwischen uns Menschen sind sinnvoll, weil Unterschiede die Effektivität eines Gemeinwesens erhöhen. Eine Gemeinschaft ist umso widerstands- aber auch leistungsfähiger, je ausgeprägter die Spezialisierung ihrer Mitglieder ist. Spezialisierung bedeutet natürlich immer auch Reduzierung. Das Ganze ist genau dann mehr als die Summe der Einzelteile, wenn spezialisierte Individuen miteinander kooperieren. Eine Gemeinschaft von Fachleuten ist insgesamt leistungs- und damit lebensfähiger als eine Gruppe autarker, ähnlich befähigter Individuen. Die Bereitschaft sich zu spezialisieren geht gewöhnlich mit dem Vernachlässigen anderer Fähigkeiten einher. Infolgedessen sind Fachleute auf andere angewiesen. Gebraucht werden und andere brauchen, gehen so Hand in Hand. Während die Spezialisierung der Individuen die Produktivität der Gemeinschaft erhöht, stärkt das dadurch aufeinander-angewiesen-Sein den Gemeinschaftssinn. Letzteres allerdings nur, wenn alle Menschen einen Platz im gemeinsamen Schaffensprozess finden und für ihren Beitrag für die Gemeinschaft eine angemessene Anerkennung und Wertschätzung erfahren. Wertschätzung und Respekt sollten allein davon abhängen, wie gut ein Mensch seinen Platz in der Gesellschaft ausfüllt, nicht davon, auf welcher Ebene der Hierarchie oder in welchem Bereich ein Mensch tätig ist.
Durch zunehmende Spezialisierung wurden die technischen Spitzenleistungen möglich, die unsere heutige Existenz prägen. Doch Spezialisierung ist nur möglich, wenn sich die Fachleute darauf verlassen können, dass für ihre elementaren Lebensbedürfnisse wie Essen, Trinken, Wohnen etc. durch andere gesorgt wird. Die Spitzenleistungen der einen erfordern die Basisleistungen anderer. Sie alle brauchen einander. Deshalb verdienen alle im gesellschaftlichen Gewebe angemessene soziale und monetäre Anerkennung.
Das kapitalistische Geldsystem verhindert eine angemessene Entlohnung gesellschaftlicher Basisarbeit. Gerade für die immer neu zu verrichtenden Arbeiten des Pflanzens, Erntens, Kochens, Waschens, Putzens... steht immer weniger Geld bereit. Solche Arbeiten versprechen keinen Profit. Doch dank solcher Arbeiten werden die Grundlagen unserer Existenz immer wieder neu geschaffen. Weil für diese grundlegenden, aber unprofitablen Arbeiten heute immer weniger Geld zur Verfügung steht, gerät der Wirtschaftskreislauf mehr und mehr ins Stottern. Wenn gerade Menschen, die die Grundversorgung der Gesellschaft sichern, vom Lohn ihrer Arbeit nicht leben können, stimmt etwas Grundsätzliches am Lohngefüge nicht.
Leistung soll sich nicht nur lohnen, sie muss sich lohnen, um Menschen zu motivieren, ihren Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Doch statt nach den Ursachen für das Lohndumping zu suchen, verkündet Professor Olaf Sievert, einst Mitglied des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung:
Sicher ist man sich hingegen, daß die Lohnstruktur nicht stimmt, daß namentlich die Löhne für einfache Arbeit viel zu hoch sind.21
Eine Leistungsgesellschaft durch wertschätzende Entlohnung zu sichern, war offensichtlich kein Ziel des Sachverständigenrates. Wachsende Armut wird von dieser ökonomischen Schule billigend in Kauf genommen. Meine Kritik an dieser Haltung mündet jedoch nicht in einer Forderung nach gleichem Lohn für alle, sondern in der Forderung, alle müssen das gleiche Recht haben, vom Lohn ihrer Arbeit in Würde leben zu können. Arbeit, die kein selbstbestimmtes Leben ermöglicht, ist keine freie Lohnarbeit, sondern nur eine Variante von Leibeigenschaft oder Sklaverei.
Auch 200 Jahre nach der französischen Revolution ist die Forderung nach Gleichheit vor dem Gesetz so aktuell wie am ersten Tag, denn nach der Revolution wurde der Geburtsadel nur durch einen Geldadel ersetzt. Das leistungslose Kapitaleinkommen des Geldadels ist die zentrale Ursache für die Unterbezahlung wertschöpfender Lohnarbeit.
Um das Recht auf angemessene Entlohnung für alle durchsetzen zu können, müssen alle Quellen für leistungslose Einkommen beseitigt werden. Außerdem muss sich der Staat aus der Schuldenfalle befreien, denn Schulden machen ihn erpressbar und behindern so seine politische Handlungsfreiheit auch in Rechtsfragen. Genauso wie die Armut des Staates verhindern auch private Hypervermögen gleiches Recht für alle. Der Geldadel kann – als heute scheinbar notwendige Geldquelle für die Wirtschaft – Gesetze zu seinen Gunsten erzwingen, erinnert sei an CETA. Dieses Gesetz sichert Konzernen zu, dass für Investitionen erwartete Profite ggf. vom Staat gezahlt werden, wenn der Markt sie nicht hergibt. Auch sonst werden große Vermögen immer wieder geschont. So berichtete die Süddeutsche Zeitung am 3.2.2009 in Auseinandersetzung mit der Finanzkrise 2007/08:
764 Manager wurden wegen Betrugs vor Gericht gestellt... Geldbußen über acht Millionen Dollar wurden verhängt. ...
Allerdings blieben am Ende Kosten von 124 Millionen Dollar, für die die Steuerzahler aufkommen mussten.22
Statt legitime Forderungen dort einzutreiben wo reichlich Geld vorhanden ist, erlässt der Staat oft gerade jenen, die überschüssiges Geld besitzen berechtigte Forderungen. Es wird ganz offensichtlich nicht mit gleichem Maß gemessen. Auch für Wirtschaftskriminelle gilt oft, je größer der Schaden, desto milder das Urteil. Markus Kohl stellt in seiner Dissertation nüchtern fest, dass Wirtschaftskriminalität als Element kapitalistischer Ökonomie akzeptiert wird.
Charakteristisch für die moderne Gesellschaft ist jedoch heute, daß der Täter immer häufiger seinen Angriff aus der Gesellschaftsmitte heraus startet und sich vor, während und auch nach der Tat noch als Mitglied der Gesellschaft fühlt, die er schädigt.23
Ganz unverkennbar muss das ökonomische Regelwerk neu justiert werden, um Gleichheit vor dem Gesetz überhaupt durchsetzen zu können. Freiheit und Gleichheit reichen als Schlachtruf nicht mehr aus. Wie steht es um die Brüderlichkeit?
2 Siehe nächstes Kapitel 3.3 Brüderlichkeit
3.3. Brüderlichkeit?
Alle Menschen werden Schwestern?
Und nun die kostbare Reliquie aus matriarchaler Vorzeit: Das Wort Geschwister, abgeleitet von Schwester. Für diese feministische Ungeheuerlichkeit in unserem Wortschatz gibt es nur eine Erklärung: Die Brüder müssen gepennt haben.
Luise F. Pusch24
Vielleicht haben die Brüder nicht gepennt. Vielleicht ist der Brüderlichkeit durch die Jahrtausende lange Sonderstellung des Erstgeborenen im Erbrecht der Gedanke der Gleichheit verloren gegangen. Im Osten erzählte ein Witz von zwei Soldaten aus Bruderarmeen, die ihre letzte Ration teilen müssen. Der Sowjetsoldat3 bietet an, brüderlich zu teilen, worauf der andere erwidert: Nein, lieber Halbe-Halbe.
Als die Französische Revolution Brüderlichkeit zum Ideal erhob, stand dieser Begriff zwar für das Streben nach Solidarität unter den Menschen. Allein das Wort macht bereits deutlich, dass Frauen in diesen Solidaritätsgedanken nicht eingeschlossen waren. Klar wurde das spätestens, als jene Frauen aufs Schafott geschleppt wurden, die auch für Frauen Gleichheit vor dem Gesetz forderten. Diese Forderung schien damals vermessen. Inzwischen haben sich die Zeiten geändert. Frauen werden zwar noch immer keine Brüder, doch sie sind den Männern sehr viel gleichwertiger geworden. Die Zeit scheint reif, die Forderung nach Brüderlichkeit durch ein Streben nach Geschwisterlichkeit zu ersetzen.
Vor der Frage, wie Geschwisterlichkeit geschaffen werden soll, steht die Frage, was Geschwisterlichkeit überhaupt ist. Vielleicht kann Veronika Bennholdt-Thomsens Buch Juchitán - Stadt der Frauen25 eine Idee davon vermitteln. Juchitán ist eine Region in Mexiko, in der die Frauen das Geld verdienen, während Männer zwar nicht die Hausarbeit, aber doch unbezahlte Subsistenzarbeit leisten. Die Frauen verarbeiten die Produkte der Männer und verkaufen sie auf dem Markt. Infolgedessen nehmen sie das Geld ein und verwalten es. Natürlich erfährt die landwirtschaftliche Produktion der Männer eine Gegenleistung. Doch werden sie für ihre Arbeit nicht mit Geld entlohnt, sondern durch die häusliche Versorgungsarbeit, die die Frauen neben ihrer bezahlten Arbeit für den Markt leisten.
Bevor gezeigt wird, welche ökonomischen Folgen dieser Rollentausch hat, muss klar gestellt werden, dass es bei der Suche nach einer neuen Geschwisterlichkeit nicht darum geht, auf das technologische Niveau von Juchitán zurück zu kehren. Überhaupt geht es nicht darum, Juchitán als ein Ideal und die dortigen Geschlechterverhältnisse als Vorbild anzusehen. Worum es in der Auseinandersetzung mit dieser Kultur geht, ist die andere Verwendung des Geldes durch die Frauen in Juchitán und die sich daraus ergebenden Folgen für den Geldkreislauf. Bennholdt-Thomsen beschreibt,
daß das Ziel des Wirtschaftens in der Befriedigung alltäglicher Bedürfnisse und in der guten Stellung innerhalb der Gemeinschaft besteht, nicht in der Akkumulation. ... Das Prinzip des Handels besteht darin, daß mindestens der Unterhalt für den Tag verdient werden muß, Essen und Trinken für Mutter und Kinder und eine anteilige Summe für Haushaltsmittel, Kleidung und Schule - sowie das „Kapital“, so sagen die Frauen, für das Handelsgeschäft am nächsten Tag. ... Auch wird in die Erweiterung der Produktion „investiert“, doch stets nur in dem Maße, in dem das Geschäft selbst handhabbar bleibt ...26
Der Gedanke im Geld ein Tauschmittel zur Bedürfnisbefriedigung und kein Mittel zum Erlangen von Prestigeobjekten zu sehen, zeigt sich in den Einwänden der
Früchte-Händlerin Maria Ciro ... [als sie] von einem Vertreter einer staatlichen Entwicklungsbehörde aufgefordert wird, führend bei einer Unternehmensgründung mitzuwirken ...27
Ihre Bedenken und Vorbehalten gegen eine Mitarbeit in einem Großunternehmen schließen mit den Worten:
Aber selbst wenn es klappen sollte, dann könne sie nicht mehr über ihre Zeit bestimmen. Was, wenn sie auf ein Fest gehen wolle? Sie habe doch so viele soziale Verpflichtungen. Fazit: Nein, das Unternehmen brächte ihr zu viel Unsicherheit. Außerdem habe sie genug zum Leben.28
Das erinnert an Heinrich Bölls portugiesischen Fischer, der nach ausreichendem Fang am helllichten Tag glücklich am Strand liegt und seine Muße genießt, statt wieder und wieder auszufahren, um Fische für den Markt zu fangen, das dadurch verdiente Geld zu akkumulieren, es später in eine Fischfangflotte zu investieren, um irgendwann eines fernen Tages von der Arbeit anderer leben zu können.29 Es geht also nicht um Weiblichkeit versus Männlichkeit, sondern um Konsum versus Prestige oder Lebendigkeit versus Statusdenken.
Die Menschen arbeiten in Juchitán offensichtlich, um zu leben und leben bedeutet in Juchitán miteinander feiern. Was uns daran sicher verunsichert ist, dass vielfach von der Hand in den Mund gelebt wird.4 Das erscheint uns unzeitgemäß, irgendwie archaisch. Doch genau darin liegt das Geheimnis der allgemeinen Zufriedenheit.
Während wir aus Angst, morgen keine Arbeit und damit kein Einkommen mehr zu haben glauben, uns durch Sparen absichern zu müssen, folgt die Zukunftsgewissheit in Juchitán genau daraus, dass niemand über den konkreten Bedarf hinaus spart. Weil so fast das gesamte Geld ständig zirkuliert, und weil alle ständig arbeiten (sofern sie nicht feiern, was oft vorkommt) bleiben Geld und Ware ständig im Fluss. Gerade daraus ergibt sich für alle die Gewissheit, dass sie ihren Lebensunterhalt auch morgen werden verdienen können.
In Juchitán funktioniert die Wirtschaft besser als im übrigen Mexiko, weil die Frauen in dem Geld, das täglich durch ihre Hände fließt, nichts als ein Tauschmittel zur Befriedigung ihrer Lebensbedürfnisse sehen. Der Gedanke, Geld zu horten, um daraus später ein arbeitsloses Einkommen zu ziehen, ist ihnen so fremd, wie Bölls Fischer.
Diese zweckorientierte Beziehung zum Geld scheint nicht auf Juchitán beschränkt zu sein. Es ist kein Zufall, dass Mikrokreditprojekte und auch kleine Entwicklungshilfeprojekte sich oft vor allem an Frauen wenden, da diese tendenziell anders mit Geld umgehen.
Was wir von dieser Art des Wirtschaftens lernen können, ist das Denken in Kreisläufen und das Denken in Zusammenhängen von Geben und Bekommen sowie von Arbeiten und Feiern. Es ist ein dialektisches Denken in Gegensatzpaaren. Es ist geschwisterliches Denken. Das Geheimnis nachhaltiger Ökonomie liegt in seiner Ausrichtung auf ein lebendiges Gegenüber, statt auf ein totes Prestigeobjekt. Darin liegt das Ideal einer neuen Geschwisterlichkeit. Dazu brauchen wir nicht nur eine neue Geldordnung, sondern auch ein neues Verhältnis zum Geld und zur Arbeit.
3 Die UdSSR – die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, kurz Sowjetunion – wurde in der sozialistische Welt zuweilen „der große Bruder“ genannt. Diesem Titel folgte oft der Nachsatz: Freunde kann man sich aussuchen, Brüder nicht.
4 Bennholdt-Thomsen (1994) erzählt auf S. → von dem Muxe Chente. (Ein Muxe ist ein homosexueller Mann, der die soziale Rolle einer Frau übernimmt.) „Er würde mit dem Gehalt eines Lehrers nicht leben können. Die würden höchstens 350.000 bis 450.000 Pesos in 14 Tagen bekommen. Aber so wie er sein Geld einnimmt, würde er es auch wieder ausgeben, sagt er, und schickt einen Nachbarjungen los, um Bier zu holen. Dann wird aufgefahren, Totopos und Käse, Camarones, ein großer delikater geräucherter Fisch, den er mitgebracht hat. Wieder wird der Junge losgeschickt und bringt vom Markt kleine Päckchen „Tamales“ (in Bananenblättern gedämpfte, salzige, fleischgefüllte Maispasteten) und eine Portion Tacos... Musik muß her, meint Chente. Ein Gitarrist wird aus der nahe gelegenen Cantina geholt ...“
4. Blickverschiebung
Versuch einer Entsorgung ökonomischer Glaubenssätze
Im Sinne der politischen Ökonomie ist der Grundsatz, daß jede Arbeit einen Überschuß hinterlassen muß, nichts anderes, als die Bestätigung des verfassungsmäßigen Rechts, unseren Nächsten zu bestehlen... [H.i.O.]
Pierre-Joseph Proudhon30
Bevor das komplexe Reformpaket in allen seinen Elementen vorgestellt und erklärt wird, hier eine Zusammenstellung der wichtigsten Probleme. Es wurde im 3. Teil dieser Tetralogie dargelegt, dass das kapitalistische Geldsystem auf Selbstzerstörung programmiert ist, da positive (selbstverstärkende) Rückkopplungsprozesse destruktive Wirkungen verstärken. Um einen totalen Zusammenbruch des Systems zu verhindern, müssen die positiven Rückkopplungsprozesse durch negative (selbstregulierende) Regelwerke ersetzt werden.
Die größten Irrtümer, die sich aus überholten Vorstellungen über unser Geldsystem ergeben, sind der Glaube:
die Geldversorgung der Wirtschaft – die heute durch Geldschöpfung im Zuge von Kreditvergabe erfolgt –
müsse
durch das Beleihung von Geld- oder Sachvermögen gesichert werden,
Eigenkapital
sei
eine sinnvolle und notwendige Voraussetzung für unternehmerische Tätigkeit und ein solides Bankwesen,
Profit (d.h. Gelderwerb, der nicht dem Konsum, sondern dem Erwerb leistungsloser Einkommen dient)
sei
eine sinnvolle und notwendige Triebkraft für wirtschaftliches Handeln,
der Zins
sei
ein Instrument zur Steuerung der Gesamtgeldmenge und für diesen Zweck auch notwendig,
das Heiligsprechen JEDER Form von Eigentum
sei
eine notwendige Voraussetzung für wirtschaftliche Prosperität.
Die Analyse unseres heutigen Geldsystems hat stattdessen gezeigt:
Da die Geldversorgung im Kapitalismus von der Profiterwartung der Kreditnehmenden abhängt, Profit für die Mehrheit aber nur möglich ist, wenn die Geldmenge unentwegt wächst, ist stetiges Geldmengenwachstum notwendig. Das erzwingt anhaltendes Wirtschaftswachstum.
Grenzenloses Wachstum der Geldvermögen erfordert ein entsprechend grenzenloses Wachstum der Verschuldung durch Unternehmen, Staat, Privatpersonen sowie Banken.
Kapitaleigentum ist eine Quelle leistungslosen Einkommens.
Kreditzinsen sind notwendig, sofern sie der Finanzierung des Geldsystems (Bargeldherstellung, Kontenverwaltung, Kreditbearbeitung,) dienen. Als Betriebseinnahmen der Bank erzeugen sie keinen Wachstumszwang, solange sie vollständig zu Einkommen der Bankangestellten werden.
Leistungslose Einkommen fördern den Erwerb weiterer renditeträchtiger Vermögenswerte und also zunehmende Eigentumskonzentration.
Das Problem liegt dabei NICHT:
in der Kreditgeldschöpfung an sich (also der Geldschöpfung aus dem Nichts), sondern lediglich in der Geldschöpfung aus dem Nichts
für Nichts,
5
im Sparen an sich, sondern nur in einer unbegrenzten Geldhortung über den individuellen und den gesellschaftlichen Bedarf hinaus,
im Eigentum an sich, sondern nur im Kapitaleigentum, weil Kapitaleigentum arbeitslose Einkommen ermöglicht, die das Leistungsprinzip verletzen,
im Zins an sich, sondern nur in Zinseinnahmen, die nicht wieder für Konsum verausgabt werden, aber auch in Kreditzinsen, die fremdfinanzierte Unternehmen gegenüber Unternehmen mit Eigenkapital benachteiligen, da erstere Kreditzinsen zahlen müssen, letztere jedoch nicht; Eigenkapital schafft infolgedessen einen Marktvorteil, während hohe Kreditzinsen eine Marktzugangsbarriere bilden.
Die komplexe Problemlage erfordert eine entsprechend komplexe Lösung. Eine Geldreform kann nur dann nachhaltig wirksam sein, wenn das neue Regelwerk alle Teilprobleme berücksichtigt. Neben der Eigentumsbegrenzung muss jede Falschgeldschöpfung31 (d.h. jede, von realer Wertschöpfung entkoppelte Geldschöpfung, wie z.B. Geldschöpfung für Wertpapierkauf) strukturell unmöglich gemacht werden. Erst dann kann Geld zu dem werden, was es angeblich schon immer ist – ein neutrales und damit faires Tauschmittel für Waren und Dienstleistungen.
Heute erinnert manches an den Vorabend des Ersten Weltkrieges. Carl Fürstenberg (Direktor der Berliner Handelsgesellschaft) sagte rückblickend:
Dieses Verkennen der Situation erklärt sich nicht daraus, daß keine Anzeichen der herannahenden Krise vorhanden waren. Im Gegenteil waren sie seit Jahren so häufig wiedergekehrt, daß sich schließlich die Nerven abgestumpft hatten.32
Auch unsere Nerven sind durch wiederholte Wirtschafts- und Finanzkrisen sowie durch eine anhaltende Coronakrisenpolitik abgestumpft. Doch wir wollen nicht auf den drohenden Zusammenbruch starren, sondern unser Augenmerk auf eine mögliche neue Ordnung richten.
In den drei bereits erschienenen Teilen der Quadratur des Geldes wurde eine umfassende Analyse der Entstehung, Entwicklung und Funktionsweise des heutigen Geldsystems dargelegt. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit einer umfassenden Neuordnung der ökonomischen und eigentumsrechtlichen Verhältnisse. Das nachfolgende Reformpaket bildet kein Reparaturset, aus dem Einzellösungen entnommen werden können, um das gegenwärtige Geldsystem auszubessern. Teillösungen können die Wirkung einer Maßnahme nicht nur aufheben, sondern sogar ins Gegenteil verkehren. Das vorgestellte visionäre Geldsystem bildet eine Systemlösung, die nur als Gesamtkonzept die beabsichtigten Resultate hervorrufen kann.
Das bedeutet nicht, dass alles im Geld-, Bank- und Kreditsystem, sowie im Eigentumsrecht neu erfunden werden muss. Viele Verwaltungs- oder Kontrollsysteme im Bankbetrieb sowie technische Entwicklungen im Buchungs- und Zahlungsverkehr lassen sich auch für ein reformiertes Geldsystem nutzen.
Die geplanten Geldreformen werden nicht zwingend die Erscheinungsform, in jedem Fall jedoch das Wesen des Geldes verändern. Dazu müssen die destruktiven Mechanismen des gegenwärtigen Geld- und Eigentumsystems aufgelöst werden. Da es sich hierbei um fast mythische Grundprinzipien des heutigen Wirtschaftssystems handelt, nämlich um:
Eigentum (Geld- oder Sachvermögen) als Kreditbasis,
Eigenkapital als Unternehmensbasis/Liquiditätsbasis,
Profit als Entwicklungstriebkraft,
Zins als Geldmengenregulator,
ist für eine grundlegende Neuordnung der ökonomischen Verhältnisse ein radikales Umdenken notwendig. Dabei ist es wichtig, solche Kreditregeln und Eigentumsgesetze zu schaffen, durch die individuelle und gesamtwirtschaftliche Interessen nicht in Konflikt geraten. Erinnert sei daran, dass primär nicht aus persönlichem Profitstreben, sondern aus betriebswirtschaftlicher Notwendigkeit, Eigenkapital gebildet wird.33 Da Eigenkapital gesamtwirtschaftlich zu Problemen führt und langfristig wirtschafts- und gesellschaftszerstörend wirkt, kommt es zwischen den mikro- und makroökonomischen Interessen zu einem Zielkonflikt, der aufgelöst werden muss. Kernthema der Geldreform ist es daher, den Eigenkapitalbedarf zu beseitigen.
Es liegt eine Logik darin, dass es zum Überwinden des Kapitalismus notwendig ist, den privaten Kapitalbedarf zu überwinden. Eine soziale, wirklich demokratische Gesellschaft kann erst entstehen, wenn insbesondere das Geld als gesellschaftliches Tauschmittel in allen Aspekten demokratischen Regeln unterliegt. Dieses Buch will Grundlagen hierfür aufzeigen.
Um die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen zu beenden, muss Geld strukturell Tauschgerechtigkeit sichern. Tauschgerechtigkeit meint, dass beide Tauschparteien eigene Wünsche befriedigen, ohne einander zu übervorteilen, mehr dazu im Kapitel 7. Die Entwicklung zunehmender Tauschungerechtigkeit gründet in einem Problem, das bereits mit dem Entstehen des Metallgeldes vor etwa 5000 Jahren entstand. Während Verrechnungsmittel (wie Kerbhölzer) jederzeit im Moment des Tausches entstehen, erforderte das Metallgeld einen Geldschöpfungsprozess, der vom Prozess der Warenproduktion entkoppelt wurde. Sobald Geld nicht mehr direkt im Handel entstehen konnte,34 musste es als Voraussetzung für den Warenhandel gehortet werden. Das Tauschmittel Geld wurde dadurch zugleich Handelskapital, das akkumuliert werden musste. Aus dem Zwang zur Kapitalakkumulation hat sich heute eine alles verschlingende Vermögenskrise entwickelt. Dieser Zwang behindert Tauschgerechtigkeit nicht nur, er macht sie gänzlich unmöglich.