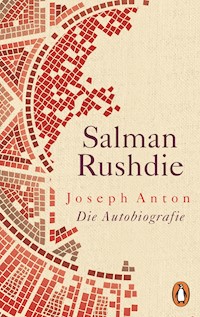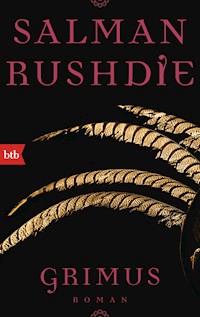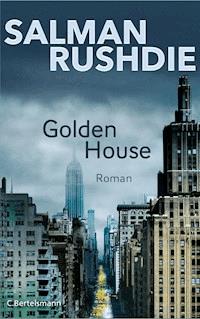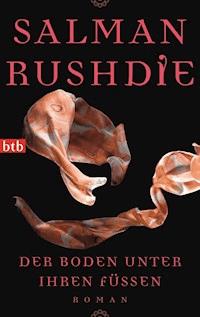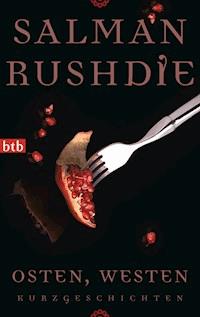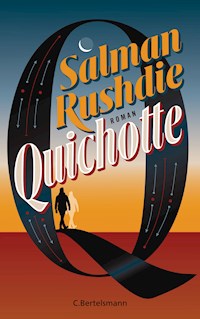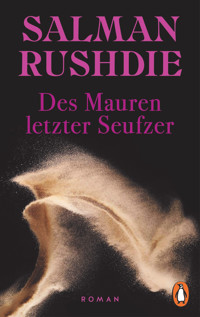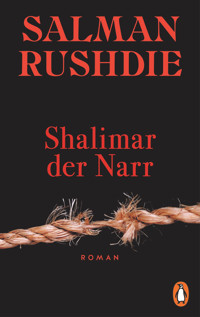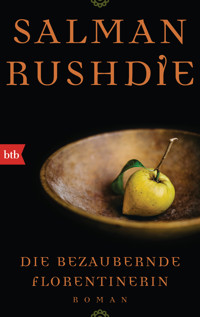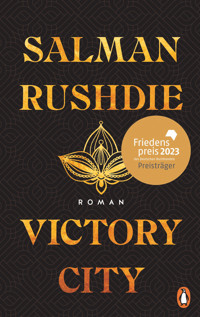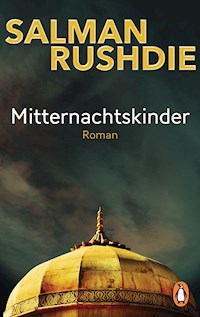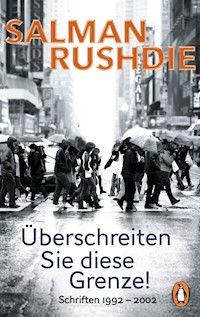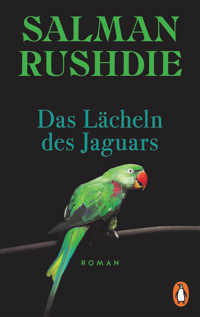
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Salman Rushdie erhält den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2023 »für seine Unbeugsamkeit, seine Lebensbejahung und dafür, dass er mit seiner Erzählfreude die Welt bereichert.« (Aus der Begründung der Jury)
»Als ich nach Nicaragua fuhr, hatte ich nicht die Absicht, ein Buch darüber zu schreiben oder überhaupt zu schreiben; doch die Begegnung mit dem Land hat mich so tief bewegt, dass mir keine andere Wahl blieb.« Als Salman Rushdie 1986 nach Nicaragua reist, ist er überwältigt: von den Menschen und ihrer Kultur, von der Schönheit der Natur, aber auch von der komplizierten politischen Lage. Er findet ein Land mitten im Umbruch vor – ein zutiefst widersprüchliches und zugleich wunderschönes Land, dessen Zauber der Erzähler Rushdie mit seiner ganz eigenen, besonderen Sprache erfasst.
- Ein großer Autor bereist ein Land im Umbruch
- »Rushdie zeigt uns das Land in seinen leuchtend bunten Farben.« (New York Times)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 201
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
»Als ich nach Nicaragua fuhr, hatte ich nicht die Absicht, ein Buch darüber zu schreiben oder überhaupt zu schreiben; doch die Begegnung mit dem Land hat mich so tief bewegt, dass mir keine andere Wahl blieb.« Als Salman Rushdie 1986 nach Nicaragua reist, ist er überwältigt: von den Menschen und ihrer Kultur, von der Schönheit der Natur, aber auch von der komplizierten politischen Lage. Er findet ein Land mitten im Umbruch vor – ein zutiefst widersprüchliches und zugleich wunderschönes Land, dessen Zauber der Erzähler Rushdie mit seiner ganz eigenen, besonderen Sprache erfasst.
SALMAN RUSHDIE, 1947 in Bombay geboren, studierte in Cambridge Geschichte. Mit seinem Roman »Mitternachtskinder« wurde er weltberühmt. Seine Bücher erhielten renommierte internationale Auszeichnungen, u.a. den Booker Prize, und sind in zahlreiche Sprachen übersetzt. 1996 wurde ihm der Aristeion-Literaturpreis der EU für sein Gesamtwerk zuerkannt. 2008 schlug ihn die Queen zum Ritter.
SALMAN RUSHDIE BEI BTB:Mitternachtskinder. Roman · Die satanischen Verse. Roman · Des Mauren letzter Seufzer. Roman · Osten, Westen. Kurzgeschichten · Der Boden unter ihren Füßen. Roman · Harun und das Meer der Geschichten · Wut. Roman · Das Lächeln des Jaguars. Eine Reise durch Nicaragua · Shalimar der Narr. Roman · Joseph Anton. Die Autobiographie
Salman Rushdie
Das Lächeln des Jaguars
Eine Reise durch Nicaragua
Deutsch von Melanie Walz
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien 1987 unter dem Titel The Jaguar Smile. A Nicaraguan Journey bei Pan Books, Ltd., London.
Copyright © 1987 Salman Rushdie
All rights reserved.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2014 by btb Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle Rechte an der Übertragung ins Deutsche bei Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg.
Covergestaltung: Favoritbüro nach einem Entwurf von semper smile, München
Covermotiv: © Gallery Stock / Jan Kornstaedt
MI · Herstellung: sc
ISBN 978-3-641-31282-4V001
www.penguin-verlag.de
Für Robbie
Eine Schöne aus Nicaraguaritt lächelnd einst auf einem Jaguar.In den Wald ging’s zu zwei’n,doch heraus kam einer allein,und wer lächelte, das war der Jaguar.Anonym
Inhalt
HOPE: EIN PROLOG
1 – SANDINOS HUT
2 – DIE STRASSE NACH CAMOAPA
3 – DICHTER AM TAG DER FREUDE
4 – DAS BADEZIMMER VON MADAME SOMOZA
5 – ESTELÍ
6 – DAS WORT
7 – LIEBESEIER
8 – ABTREIBUNG, VOLLJÄHRIGKEIT UND GOTT
9 – KATHARSIS
10 – MARKTTAG
11 – EL SEÑOR PRESIDENTE
12 – DIE ANDERE SEITE
13 – DOÑA VIOLETAS SICHT DER DINGE
14 – MISS NICARAGUA UND DER JAGUAR
SILVIA: EIN EPILOG
DANKSAGUNG
Quellennachweis
Hope: Ein Prolog
Vor zehn Jahren bewohnte ich in London SW1 ein kleines Apartment über einer Spirituosenhandlung; eines Tages erfuhr ich, dass die neue Eigentümerin des großen Hauses nebenan die Gattin des nicaraguanischen Diktators Anastasio Somoza Debayle war. Mit der Straße schien es rapide bergab zu gehen, seit der nette Lord Lucan in Nummer 44 das Kindermädchen Sandra Rivett ermordet hatte, und einige Monate später zog ich aus. Hope Somoza habe ich nie kennengelernt, aber ihr Haus war bald jedem in der Straße ein Begriff, weil die Alarmanlage regelmäßig losheulte und weil die ganze Straße mit Rolls-Royce, Mercedes und Jaguars verstopft war, wenn Hope eine Party gab. Daheim in Managua hatte ihr »Tacho« sich eine Mätresse namens Dinorah zugelegt, und wahrscheinlich wollte Hope die Trübsal verscheuchen.
Am 17. Juli 1979 flohen Tacho und Dinorah aus Nicaragua; Nicaragua libre erblickte somit genau einen Monat nach der Geburt meines Sohnes das Licht der Welt. (Der offizielle Unabhängigkeitstag ist der 19. Juli, der Tag, an dem die Sandinisten Managua einnahmen, aber der Tag der Hurrarufe ist der 17., der día de alegría, der Tag der Freude.) Seit jeher habe ich eine Schwäche für derartige Zufälle, und ich war überzeugt, dass die zeitliche Nähe der Geburtstage eine Verbindung schuf.
Als dann die Reagan-Regierung ihren Krieg gegen Nicaragua begann, spürte ich eine noch engere Verbundenheit mit diesem kleinen Land auf einem Kontinent (Mittelamerika), den ich noch nie betreten hatte. Von Tag zu Tag wuchs mein Interesse an diesem Land – schließlich war ich selbst Kind einer erfolgreichen Revolte gegen eine Großmacht, mein Bewusstsein Produkt des Triumphs der indischen Revolution. Und vielleicht war es gar nicht so abwegig zu vermuten, dass die unter uns, die nicht aus den reichen Ländern der westlichen und nördlichen Hemisphäre stammten, etwas miteinander gemeinsam hatten – nichts so Krudes wie eine typische »Dritte-Welt-Mentalität«, aber doch eine Ahnung davon, was es heißt, der Schwache zu sein, ein Bewusstsein dessen, wie die Dinge sich von der Position des Unterlegenen her ausnehmen und wie es ist, wenn man zu dem Stiefel hochblickt, der sich auf einen herabsenkt. Ich unterstützte das Solidaritätskomitee für Nicaragua in London. Dies erwähne ich, um klarzustellen, dass ich im Juli 1986 nicht als völlig unbefangener Beobachter nach Nicaragua fuhr; ich war nicht unvoreingenommen.
Ich besuchte Nicaragua als Gast des Verbands Sandinistischer Kulturschaffender ASTC, der Dachorganisation für Schriftsteller, Maler, Musiker, Kunsthandwerker, Tänzer und so weiter. Anlass der Einladung war der siebte Jahrestag des »Triumphs« der Sandinistischen Befreiungsfront. Ich war neugierig, aber auch sehr nervös. Ich wusste nur zu gut, wie häufig Revolutionen fehlgingen, ihre eigenen Kinder fraßen und zu dem wurden, dessen Überwindung ihr Zweck gewesen war. Ich wusste, wie oft das, was als Idealismus und Hochherzigkeit begann, in betrogenen Erwartungen und enttäuschten Hoffnungen endete. Vielleicht würde ich die Sandinisten nicht mögen? Um einem Volk das Recht darauf zuzugestehen, nicht von den Vereinigten Staaten zermalmt zu werden, musste man es nicht unbedingt mögen – aber hinderlich war die Sympathie gewiss nicht.
Ich fuhr zu einem kritischen Zeitpunkt. Am 27. Juni hatte der Internationale Gerichtshof in Den Haag entschieden, dass die Unterstützung der USA für die Contra, die konterrevolutionäre Armee, die von der CIA ins Leben gerufen, organisiert und mit Waffen ausgerüstet worden war, völkerrechtswidrig war. Das US-Repräsentantenhaus ließ sich davon nicht beirren und bewilligte Präsident Reagan die von ihm beantragten Hilfsgelder für die Konterrevolution in Höhe von hundert Millionen Dollar. Dass der nicaraguanische Präsident Daniel Ortega daraufhin das Verbot der oppositionellen Zeitung La Prensa und die Ausweisung der widerspenstigen Priester Bischof Vega und Monsignore Bismarck Carballo verfügte, roch nach Vergeltung. Gewitterwolken ballten sich zusammen.
Drei Wochen verbrachte ich im Juli in Nicaragua. Die folgenden Aufzeichnungen können und wollen nicht mehr sein als eine Momentaufnahme vom Leben dieses schönen und vulkanreichen Landes. Ich fuhr nicht hin in der Absicht, ein Buch zu schreiben oder überhaupt etwas zu schreiben, doch das, was ich erlebte, beeindruckte mich so tief, dass mir letztlich keine Wahl blieb. Eine Momentaufnahme also, aber, wie ich glaube, von einem entscheidenden und aufschlussreichen Augenblick: weder Anfang noch Endpunkt, sondern etwas dazwischen, eine Zeit nahe dem Angelpunkt der Geschichte, eine Zeit, zu der alle Zukunftsmöglichkeiten (gerade) noch in der Schwebe waren.
Und eine Zeit, die mir keineswegs – wie ich es befürchtet hatte – ohne Hoffnung zu sein schien.
1 Sandinos Hut
»Christoph Kolumbus stach bei Palos de Moguer in Spanien in See. Er suchte die Länder des Großmoguls, wo es Paläste aus purem Gold gab, die Menschen und Tiere wild und wunderlich anzusehen waren und wo man sich nur zu bücken brauchte, um die prachtvollsten Edelsteine aufzusammeln. Statt dieser Welt entdeckte er jedoch eine andere, die ebenfalls reich, schön und voller Bizarrerie war: Amerika.«
Diese Worte las ich auf einer »Tabakkarte« der Insel Kuba am Flughafen von Havanna, und für jemanden, der zum ersten Mal nach Mittelamerika reiste, schienen sie mir eine passende Einstimmung zu sein. Später allerdings, als das Flugzeug über der grünen Lagune im Krater des Apoyeque-Vulkans eine Schleife beschrieb und Managua in Sicht kam, fielen mir die dunkleren Worte aus Nerudas Gedicht »Centro América« ein:
Erdstrich, schlank wie eine Peitsche,
entbrannt wie ein wilder Schmerz,
dein Fuß in Honduras, dein Herzblut
in Santo Domingo, blicken
nachts deine Augen mich an
von Nicaragua her, sie rufen mich, verlangen nach mir,
und hin über die Erde Amerikas
klopf’ ich an Türen, um zu reden,
rühre ich an gefesselte Zungen,
hebe ich die Vorhänge auf, tauche
die Hand in das Blut:
O Schmerzen
meiner Erde, o Röcheln
des großen verhängten Schweigens,
o Völker des langewährenden Todeskampfes,
o Landenge der Seufzer.
Um die Lebenden in Nicaragua zu verstehen, muss man sich zuerst mit den Toten vertraut machen; das begriff ich bald. Das Land war voller Geister. Sandino vive, rief es mir bei meiner Ankunft von einer Mauer entgegen, was von einem großen rosafarbenen Stein aus prompt mit Cristo vive und dem Zusatz viene pronto gekontert wurde. Wenige Minuten später kam ich an dem leeren Sockel vorbei, auf dem bis vor sieben Jahren die Reiterstatue des Ungeheuers gestanden hatte (allerdings war das Standbild in Wirklichkeit gebraucht aus Italien bezogen und mit einem neuen Gesicht versehen worden; das alte Gesicht hatte Mussolini gehört). Die Statue war mit der Diktatur gestürzt worden, aber der leere Sockel trog. Somoza vive: Diese furchterregenden Worte bekam man in Nicaragua nicht oft zu hören, aber die Bestie war noch nicht tot. Tacho war 1980 von argentinischen Partisanen in Paraguay ermordet worden, aber sein Gespenst, ein Phantom mit einem Cowboyhut, suchte die Grenze zu Honduras heim.
Managua wucherte um den eigenen Leichnam herum. Achtzig Prozent der Bausubstanz in der Innenstadt waren dem großen Erdbeben von 1972 zum Opfer gefallen; vom ehemaligen Stadtzentrum war kaum etwas übriggeblieben. Unter Somoza waren Schutt und Trümmer liegengelassen worden; erst nach seinem Sturz hatte man mit Aufräumungsarbeiten begonnen und im früheren Herzen Managuas Rasen angelegt.
Die Leere im Zentrum verlieh der Stadt die provisorische, unwirkliche Atmosphäre einer Filmkulisse. Häuser waren ausgesprochene Mangelware, und die Managuaner mussten sich mit dem behelfen, was da war. Das Außenministerium hatte sich in einer ehemaligen Ladenstraße eingerichtet, die Nationalversammlung tagte in einer umgewandelten Bank. Das Intercontinental-Hotel, eine Art abgesägte Betonpyramide, war leider stehen geblieben. Wie ein Omen erhob es sich inmitten der Gespenster des einstigen Managua: ein hässlicher Amerikaner, aber immerhin ein Überlebender. (Ich merkte, dass ich auf die Dauer nicht umhinkam, diese Stadt mit solchen Symbolen zu verbinden.)
Auch die Menschen waren Mangelware. Nicaraguas Gesamtbevölkerung zählte weniger als drei Millionen Einwohner, und durch den Krieg verringerte sich diese Zahl noch. In meinen ersten Stunden in Managua sah ich auf den Straßen so manches, was dem in Indien und Pakistan geschulten Auge bekannt vorkommen musste: Die wenigen Busse der Hauptstadt – in der Mehrzahl von Alfonsíns Argentinien gespendet – waren bis zum Bersten mit Passagieren vollgestopft, die auf sehr subkontinental anmutende Weise an den Trittbrettern hingen. Und die Baracken der campesinos am Straßenrand, der Bauern, die außer Hoffnung nicht viel in die Stadt mitgebracht hatten, erinnerten verdächtig an die bustees von Kalkutta und Bombay. Später sollte ich begreifen, dass diese Anklänge an menschenreiche Länder genauso irreführend waren wie der leere Sockel des Tyrannen. Nicaragua, ein Land von der Größe des Staates Oklahoma und mit den Umrissen von England und Wales, wenn man sie sich auf den Kopf gestellt denkt, ist das bevölkerungsärmste Land Mittelamerikas. Im Stadtgebiet von New York leben annähernd sechsmal so viele Menschen wie in ganz Nicaragua. Die Leere im Herzen Managuas sagte mehr aus als ein überfüllter Bus.
Diese Leere, diese verlassenen Straßen bevölkerten die Geister, die toten Märtyrer. Der argentinische Romancier Ernesto Sábato hat Buenos Aires als eine Stadt bezeichnet, deren Straßennamen die Schreine für das Gedenken an ihre Helden sind, und auch in Nicaragua hatte ich oft den Eindruck, als seien alle, auf die es ankomme, längst tot und in den Namen von Krankenhäusern, Schulen, Theatern, Landstraßen oder gar (wie im Falle des großen Dichters Rubén Darío) dem einer ganzen Stadt verewigt worden. Im antiken Griechenland konnten Heroen sich erhoffen, dereinst zu Göttern oder zumindest zu Sternbildern zu werden; die Toten eines verarmten Landes des zwanzigsten Jahrhunderts mussten sich mit der weniger aufregenden Unsterblichkeit bescheiden, einem Park oder einem Stadion ihren Namen zu leihen.
Neun der zehn ersten Führer der Frente Sandinista de Liberación Nacional waren vor Somozas Sturz umgekommen. Ihre riesengroßen Gesichter, in den sandinistischen Farben Schwarz und Rot gemalt, starrten auf die Plaza de la Revolución herab. Carlos Fonseca (der die Frente, die Befreiungsfront, 1956 begründet hatte und im November 1976, zweieinhalb Jahre vor dem Sieg der Sandinisten, gefallen war), Silvio Mayorga, Germán Pomares: Namen, die sich wie eine Litanei aufsagten. Der einzige Überlebende, der heutige Innenminister Tomás Borge, fand sich dort oben als Lebender mit den Unsterblichen versammelt. Borge war schwer gefoltert worden und soll sich nach der Revolution, so erzählt man sich, an seinem Folterer dadurch »gerächt« haben, dass er ihm verzieh.
Dass in einem Land, dessen Geschichte während der sechsundvierzig Jahre, in denen die Somozas an der Spitze einer der dauerhaftesten und grausamsten Diktaturen der Welt gestanden hatten, ein beständiges Ritual des Blutvergießens gewesen war, ein Märtyrerkult entstand, war kaum verwunderlich. Überall erzählte man mir die Legenden, die sich um die Toten rankten. Die von dem Dichter Leonel Rugama, der von Somozas Nationalgarde in einem Haus eingekreist worden war und auf die Aufforderung, sich zu ergeben, zurückrief: »¡Qué se rinda tu madre!« (Soll sich doch deine Mutter ergeben!), und bis zuletzt weiterkämpfte. Die von Julio Buitrago, der zusammen mit Gloria Campos und Doris Tijerino in einem konspirativen Versteck in Managua eingekesselt war. Am Ende war er der letzte Überlebende, der Stunde um Stunde Somozas Panzern und Geschützfeuer die Stirn bot – was das ganze Land live am Fernsehapparat miterleben konnte, denn Somoza hatte in dem Glauben, eine ganze FSLN-Zelle erwischt zu haben, ihre Vernichtung als Lektion für das Volk demonstrieren wollen; das war ein großer Fehler, denn als die Leute sahen, wie Buitrago schließlich schießend herauskam und starb, als sie sahen, dass ein einzelner Mensch dem Tyrannen so lange widerstanden hatte, da zogen sie die falsche Lehre daraus: die, dass man Widerstand leisten konnte.
Nach sieben Jahren sprachen die Wände noch immer zu den Toten: Carlos, wir schaffen es, sagten die Graffiti, oder: Julio, wir haben nicht vergessen.
Ein Gemälde der naiven Malerin Gloria Guevara mit dem Titel Cristo guerillero zeigt eine Kreuzigungsszene im felsigen Bergland Nicaraguas. Am Fuß des Kreuzes weinen drei Bäuerinnen, zwei knien, eine steht, und der Gekreuzigte trägt statt Lendentuch und Dornenkrone Jeans und Baumwollhemd. Dieses Bild erschien mir sehr bezeichnend. Die Religion der Menschen am Fuß der Vulkane Mittelamerikas war schon immer stark von Märtyrertum und Totenkult geprägt; und in Nicaragua haben sehr, sehr viele über die Religion zur Revolution gefunden. Die Messe mit ihrem liturgischen Wechselgesang hat die Gestaltung politischer Veranstaltungen beeinflusst. Sandinos Slogan Patria libre o morir (ein freies Vaterland oder sterben) war jetzt die nationale Parole, und am Ende jeder Versammlung rief der jeweilige Redner unfehlbar: »¡Patria libre!«, worauf die Menge »¡O MORIR!« zurückbrüllte, was unsereinem, der der Geschichte dieses Landes als Fremder gegenüberstand und dem der Märtyrerkult in einem anderen, fernen Land, im Iran Khomeinis, eine furchtbare Warnung bedeutete, ziemlich grausig in den Ohren klang.
Die nicaraguanische Revolution war und ist bis heute eine pasión – als Leidenschaft wie als Leidensgeschichte. Die Verschmelzung beider Bedeutungen ist charakteristisch für den Sandinismus, und das brachte Gloria Guevaras Gemälde zum Ausdruck.
Dann aber
werden wir die Toten wecken
mit dem Leben, das sie uns vermacht,
und singen werden wir mit ihnen,
und über ganz Amerika
werden Vögel in Scharen
unsere Botschaft verbreiten.
Aus dem Gedicht »Hasta que seamos libres«
von Gioconda Belli
Die Generationen Toter bildeten den Kontext, außerhalb dessen sich das siebenjährige Nicaragua libre nicht verstehen ließ. Wenn man vor La Loma stand, dem furchteinflößenden »Bunker«, der Somozas Machtzentrale gewesen war, erinnerte man sich: daran, dass der erste Somoza, Anastasio Somoza García, die Ermordung von zwanzigtausend Nicaraguanern hatte vollziehen lassen, bis er zuletzt auf einem Ball in León selbst erschossen wurde, von dem Dichter Rigoberto López (den Nationalgardisten umgehend töteten); und daran, dass nach einer kurzen Liberalisierungsperiode unter der Leitung von Luis, des einen Sohns Tachos I., der andere Sohn 1967 wieder den gewohnten Somoza-Stil einführte. Dieser Sohn war Tacho II., der Letzte und Unersättlichste seines Geschlechts. Es war erst sieben Jahre her, seit der Spuk ein Ende gefunden hatte, sieben Jahre, seit im Privatzoo des Despoten Menschen den Panthern zum Fraß vorgeworfen worden waren, seit Folter, Kastration und Vergewaltigung an der Tagesordnung gewesen waren. Sieben Jahre seit der Zeit der Bestie. La Loma ließ die Behauptung der USA, Nicaragua sei erneut ein totalitärer Staat, obszön klingen. Der Bunker war die Verkörperung des Totalitarismus, entsetzliches Relikt und nicht weniger entsetzliche Mahnung. Tag für Tag bezeugten die enthaupteten, geschändeten, verstümmelten Geister Nicaraguas, was hier geschehen war und was sich nie wiederholen durfte.
Das berühmteste Gespenst, Augusto César Sandino, war bereits gänzlich zum Mythos geworden – beinahe so wie etwa Gandhi. Der kleine Mann mit den gerunzelten Brauen und dem breitkrempigen Hut war zu einem Bündel Legenden geworden. 1927, als es in Nicaragua zu einem bewaffneten Aufstand gegen den von den USA unterstützten Konservativen Adolfo Díaz kam, der von dem Liberalen Sacasa angeführt und von Moncada, dem Stabschef der Armee, unterstützt wurde, war Sandino Leiter der Verkaufsabteilung der Huasteca-Erdölgesellschaft in Mexiko. Er kehrte nach Nicaragua zurück, um sich den Liberalen anzuschließen, und als Moncada sich mit den USA einigte und die Waffen niederlegte, verweigerte Sandino ihm den Gehorsam, sodass Moncada den Amerikanern mitteilen musste: »Alle meine Männer ergeben sich, bis auf einen«, worauf Sandino mit seiner »verrückten kleinen Armee« in die Berge ging … Diese Geschichte war berühmt und auch die Geschichte, wie er verraten worden war und im Februar 1934 von Somozas Häschern ermordet wurde, nachdem er ein Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet hatte und sich auf dem Heimweg vom Festbankett befand. Mir fiel auf, dass nicht etwa Sandinos Gesicht, sondern sein Hut zum wirkungsvollsten Symbol in Nicaragua geworden war. Ein Sandino ohne Hut wäre nicht ohne weiteres identifizierbar gewesen, aber der Hut benötigte nicht länger den Träger, um auf ihn hinzuweisen. Häufig endeten FSLN-Graffiti mit den schematischen Umrissen der berühmten Kopfbedeckung, einer Zeichnung, die aussah wie ein Unendlichkeitssymbol, aus dem ein Vulkankegel emporragte. Unendlichkeit und Eruptionen: Der unehelich geborene Junge aus Niquinohomo hatte sich in lauter Metaphern verwandelt. Oder, anders ausgedrückt: Sandino war zu seinem Hut geworden.
Auf einem niedrigen Hügel im Westen der Stadt lehnten die Buchstaben FSLN – fast wie in Nachahmung des berühmten Wortes HOLLYWOOD. Zuerst dachte ich, die dreißig Meter breiten weißen Buchstaben seien wie die Weißen Pferde in England aus dem Berg herausgehauen oder aus Beton, vielleicht gar aus Marmor gebildet. Aber es waren nur Holzbuchstaben, die aus Latten zusammengenagelt und hier und da mit primitiven Holzbalken abgestützt waren. Als ich sie aus der Nähe zu sehen bekam, fiel mir auf, dass sie schon recht mitgenommen aussahen. Vor der Revolution hatte ein anderes Signet den Hügel gekrönt. Es hatte ROLTER gelautet und für eine Stiefel- und Schuhfabrik in Managua geworben. Diese Entdeckung führte mir wieder vor Augen, dass das Leben im nachrevolutionären Managua ein Provisorium war. Eine hölzerne Reklametafel ließ sich ohne weiteres durch eine andere ersetzen. Und ich konnte nicht umhin, die Tatsache, dass das Zeichen der Sandinistischen Befreiungsfront auf dem einstigen Hügel der Stiefel errichtet worden war, symbolisch zu interpretieren.
Es war Regenzeit in Managua; der Himmel war ständig bedeckt. Von Norden blies ein kalter Wind.
2Die Straße nach Camoapa
Im Haus des Vizepräsidenten Nicaraguas, des Romanciers Sergio Ramírez, waren die Wände mit Masken bedeckt. »Ah«, sagte der Wachposten, der mich in einen mit alten Bäumen bestandenen Innenhof führte, den breite überdachte Veranden umschlossen, »el escritor hindú«. Im Spanischen benutzt man für hindú »indisch«; der Begriff de la India, an dem ich nichts auszusetzen gehabt hätte, beleidigte offenbar nicaraguanisches Sprachgefühl. Folglich war ich für die Dauer meines Aufenthalts der hindú-Schriftsteller und nicht selten sogar poeta, was natürlich eine sehr schmeichelhafte Höflichkeit war.
In Nicaragua sind Masken bei volkstümlichen Festen und Volkstänzen unverzichtbares Requisit. Es gibt Tiermasken, Teufelsmasken und sogar Masken von Männern mit blutenden Schusswunden mitten auf der Stirn. Zur Zeit der Aufstände zogen sandinistische Guerillas oft mit rosa Strumpfmasken in den Kampf, auf die sie mit ein paar Strichen Gesichter gemalt hatten. Auch diese Masken sind Zubehör der Volkstänze. Bei der Vorführung eines Balletts, das sich an volkstümliche Tänze anlehnte, sah ich, dass eine der Tänzerinnen eine solche rosa Maske trug. Die Verbindung dieser Maske mit der Revolution war für mich so zwingend geworden, dass die Tänzerin in meinen Augen zu einem höchst befremdlichen Wesen wurde. Sie war keine maskierte Tänzerin, sondern ein Guerilla im Tutu.
Der wahre Sinn der Masken besteht, wie jeder Schauspieler weiß, nicht darin, dass man sich verbirgt, sondern dass man sich verwandelt. Eine Kultur der Masken ist mit den Prozessen der Metamorphose zwangsläufig sehr vertraut.
In Begleitung von Sergio Ramírez und von Luis Carrión, einem der Mitglieder des neunköpfigen Direktoriums der FSLN, machte ich mich auf den Weg in die Stadt Camoapa in der Provinz Boaco, um mitzuerleben, wie eine der wichtigsten Verwandlungen im neuen Nicaragua vor sich ging. Es war der Tag der Nationalen Agrarreform, und in Camoapa sollten die Besitztitel von siebzigtausend Morgen Land an die campesinos verteilt werden.
Sergio Ramírez war mit seinen ein Meter achtzig Körpergröße für einen Nicaraguaner erstaunlich groß und massig gebaut, und er hatte die ehrfurchtgebietende Aura eines chinesischen Mandarins; Luis Carrión entsprach mit seinem zierlichen Körperbau und dem Schnauzbart, der in der Sprache der Pariser 68er événements als »marxiste, tendance Groucho« bezeichnet worden wäre, schon eher dem Bild, das man sich vom typischen Nicaraguaner machte. Beiden mangelte es auffallend an den Worthülsen und pompösen Floskeln, die üblicherweise das Markenzeichen der Politiker sind. »Wie viele Morgen Land sind seit der Revolution neu aufgeteilt worden?«, fragte ich, und sobald sie sich geeinigt hatten, wie viele manzanas (Einheiten des nicaraguanischen Flächenmaßes) einem Hektar entsprachen, und wir zu einem tragfähigen Kompromiss über das Verhältnis von Morgen zu Hektar gefunden hatten, errechneten wir, dass ungefähr zwei Millionen Morgen Land an etwa hunderttausend Familien übergeben worden waren.
Ich war beeindruckt und sagte das auch. Ramírez nickte. »Das zeigt den Leuten, dass wir willens sind, unsere Versprechungen einzuhalten.«
Als Don Anastasio Somoza dem Land den Rücken kehrte, nahm er alles mit, was er tragen konnte, inklusive sämtlichen Bargelds aus dem Staatssäckel. Sogar die Leichen Tachos I. und Luis Somozas ließ er ausgraben und ins Exil verfrachten. Ohne Zweifel hätte er auch Grund und Boden mitgenommen, wenn er bloß gewusst hätte, wie. Aber er konnte es nicht, und auch seine Kumpane, die mit ihm flohen, konnten es nicht, und so fand sich die Regierung des neuen Nicaragua im Besitz der verlassenen Ländereien, die die Hälfte des Ackerlandes von Nicaragua ausmachten. Das Land, das neu verteilt wurde, waren diese riesigen Güter und nicht etwa, so erklärten Carrión und Ramírez nachdrücklich, die Felder anderer Bauern. »Niemandem, der in Nicaragua geblieben ist und seinen Boden bearbeitete, wurde Land weggenommen«, sagte Ramírez, der ausgezeichnet Englisch sprach, es aber schnell leid wurde und ins Spanische verfiel. »Unsere Prioritäten liegen auf den Gebieten der Produktion und der Verteidigung; warum sollten wir uns mit Leuten anlegen, die etwas produzieren? Im Gegenteil, wir unterstützen zahlreiche private Landeigentümer mit großem Grundbesitz.« Auf der Straße nach Camoapa, die zwischen den beiden größten Seen des Landes verläuft, dem Managuasee und dem Nicaraguasee (der eigentlich ein Binnenmeer ist und das einzige Gewässer der Welt, wo man von Süßwasserhaien gefressen werden kann), waren beide eifrig darauf bedacht, mich auf jeden Bauernhof und jede Fabrik hinzuweisen, die in Privatbesitz verblieben waren. Im Tonfall der nicaraguanischen Führer schwang häufig etwas Defensives mit. »Kein anderes Land wird so durchs Vergrößerungsglas betrachtet wie wir«, drückte Außenminister d’Escoto es mir gegenüber aus. Das Gefühl, dass man sie die ganze Zeit beobachtete und auf den kleinsten Ausrutscher lauerte, machte sie nervös und überempfindlich.