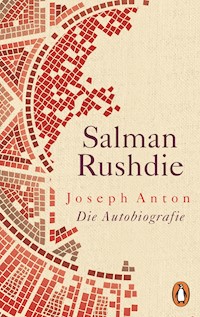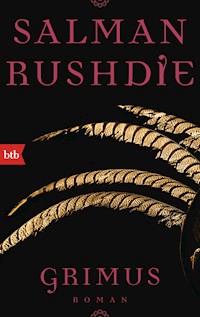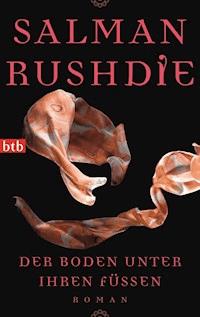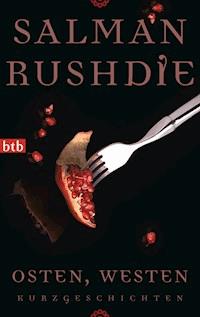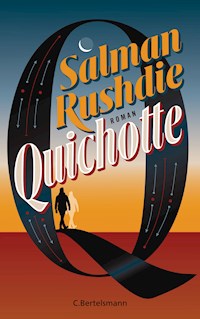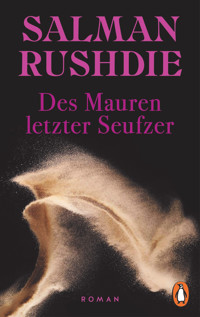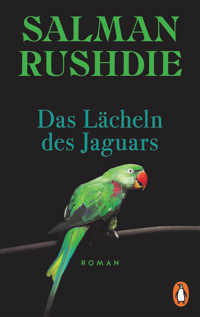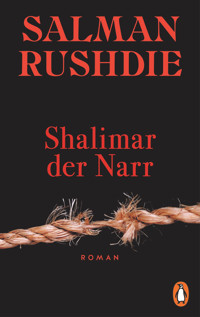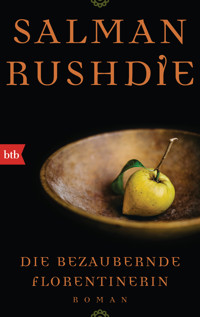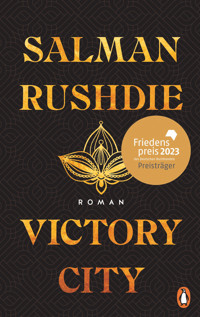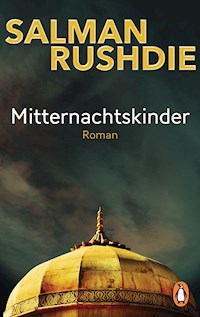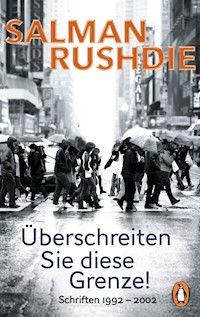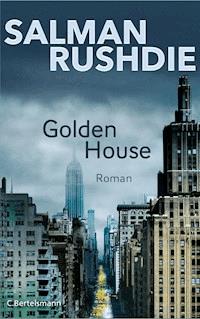
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Salman Rushdie erhält den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2023 »für seine Unbeugsamkeit, seine Lebensbejahung und dafür, dass er mit seiner Erzählfreude die Welt bereichert.« (Aus der Begründung der Jury)
Nero Golden kommt aus einem Land, dessen Namen er nie wieder hören wollte, seit er mit seinen drei erwachsenen Söhnen vor ein paar Jahren nach New York gezogen ist und sich eine junge Russin zur Frau genommen hat. Der junge Filmemacher René wohnt im Nachbarhaus und ist fasziniert von der Familie, die ihm besten Stoff für ein Drehbuch liefert: Aufstieg und Fall eines skrupellos ehrgeizigen, narzisstischen und mediengewandten Schurken, der Make-up trägt und sich die Haare färbt. René wird Zeuge und in einer folgenschweren Episode sogar Teilhaber des dekadenten Treibens im Golden House, dessen Besitzer nicht nur den Vornamen mit Kaiser Nero teilt ...
Salman Rushdie erfasst den irritierenden Zeitgeist und zeichnet mit größter Erzählkunst ein treffendes Bild unserer heutigen Welt. Dieser Roman beweist aufs Neue, dass er einer der besten Geschichtenerzähler unserer Tage ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 682
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
SALMAN RUSHDIE
Golden House
Roman
Aus dem Englischen von Sabine Herting
C. Bertelsmann
Für Alba und Francesco Clemente, durch deren Freundschaft und Gastlichkeit ich die Gärten kennengelernt habe
Gebt mir eine kupferne Münze, und ich erzähle Euch eine goldene Geschichte.
RUF DER GESCHICHTENERZÄHLER AUF DEN STRASSEN IM ALTEN ROM, ZITIERT VON PLINIUS.
Unser Zeitalter ist seinem Wesen nach ein tragisches, also weigern wir uns, es tragisch zu nehmen. Die Katastrophe hat sich ereignet, wir stehen zwischen den Ruinen, wir beginnen, uns neue, kleine Behausungen aufzubauen und neue, kleine Hoffnungen zu hegen. Das ist harte Arbeit. Es gibt keinen ebenen Weg in die Zukunft, aber wir umgehen die Hindernisse oder klettern über sie hinweg. Wir müssen leben, ganz gleich, wie viele Himmel eingestürzt sind.
D. H. LAWRENCE, LADY CHATTERLEYS LIEBHABER
La vie a beaucoup plus d’imagination que nous.
FRANÇOIS TRUFFAUT
Erster Teil
1
Am Tag der Amtseinführung des neuen Präsidenten, als wir Sorge hatten, er könnte, während er Hand in Hand mit seiner außergewöhnlichen Frau durch die jubelnde Menschenmasse ging, ermordet werden, als so viele von uns wegen der geplatzten Hypothekenblase kurz vor dem wirtschaftlichen Ruin standen und als Isis noch eine ägyptische Göttin war, traf ein ungekrönter etwa siebzigjähriger König mit seinen drei mutterlosen Söhnen aus einem fernen Land in New York City ein, um seinen Palast im Exil zu beziehen, dabei verhielt er sich, als gäbe es an dem Land oder an der Welt oder an seiner eigenen Geschichte nichts auszusetzen, und begann wie ein gütiger Herrscher, seine Nachbarschaft zu regieren – doch trotz seines charmanten Lächelns und der Fähigkeit, seine Guadagnini-Geige von 1745 zu spielen, trug er ein schweres, billiges Parfüm, den unverkennbaren Geruch von krasser, despotischer Gefahr, diese Art Duft, der uns warnt, hüte dich vor diesem Kerl, denn er könnte jeden Augenblick deine Hinrichtung anordnen, wenn du zum Beispiel ein T-Shirt anhast, das ihm nicht gefällt, oder wenn er mit deiner Frau schlafen will. Die nächsten acht Jahre, die Jahre des vierundvierzigsten Präsidenten, waren auch die Jahre der zunehmend unberechenbaren und alarmierenden Herrschaft des Mannes über uns, der sich selbst Nero Golden nannte, der nicht wirklich ein König war, und am Ende dieser Zeit brach ein großes – und metaphorisch gesprochen, apokalyptisches – Feuer aus.
Der alte Mann war klein, ja, man könnte sagen, gedrungen und kämmte sein Haar, das trotz seines fortgeschrittenen Alters noch durchwegs dunkel war, ölig glatt nach hinten, um seinen diabolisch spitzen Haaransatz zu betonen. Seine Augen waren schwarz, sein Blick stechend, doch was die Leute als Erstes wahrnahmen – meistens hatte er seine Hemdsärmel aufgerollt, damit sie es auch tatsächlich bemerkten –, waren seine Unterarme, die so dick und stark wie die eines Wrestlers waren und in großen, gefährlichen Händen mit klobigen, smaragdbesetzten Goldringen mündeten. Nur wenige Leute hatten ihn je die Stimme heben hören, obwohl wir nicht bezweifelten, dass in ihm eine Stimmgewalt lauerte, die man besser nicht herausforderte. Er kleidete sich teuer, doch er hatte etwas Lautes, Animalisches an sich, sodass man an das Biest im Märchen denken musste, das sich in menschlicher Kleidung unbehaglich fühlt. Wir alle, seine Nachbarn, fürchteten uns ziemlich vor ihm, obwohl er gewaltige, plumpe Anstrengungen unternahm, sich freundlich und nachbarschaftlich zu zeigen, er winkte uns energisch mit seinem Stock zu und beharrte zu unpassenden Zeiten darauf, dass die Leute für einen Cocktail zu ihm kamen. Er beugte sich vor, wenn er stand oder ging, als müsste er ständig gegen einen starken Wind ankämpfen, den nur er spürte, ein wenig in der Hüfte abgeknickt, aber nicht sehr. Das war ein mächtiger Mann; nein, mehr als das – ein Mann, der die Vorstellung, mächtig zu sein, überaus liebte. Der Stock schien eher dekorativen als funktionalen Zwecken zu dienen. Wenn er durch die Gärten ging, erweckte er den Eindruck, er versuche, unser Freund zu sein. Oft streckte er den Arm, um unsere Hunde zu tätscheln oder das Haar unserer Kinder zu verwuscheln. Aber Kinder und Hunde zuckten vor seiner Berührung zurück. So manches Mal, wenn ich ihn beobachtete, dachte ich an Dr. Frankensteins Monster, ein Abbild des Menschlichen, dem es ganz und gar misslang, wahre Menschlichkeit zu zeigen. Seine Haut war ledrig dunkel, und sein Lächeln blitzte vor Goldfüllungen. Sein Auftreten war derb und nicht unbedingt höflich, aber er war unermesslich reich, und darum war er natürlich akzeptiert; aber in unserer urbanen Gemeinschaft aus Künstlern, Musikern und Autoren alles in allem nicht beliebt.
Wir hätten ahnen müssen, dass ein Mann, der den Namen des letzten julisch-claudischen Kaisers von Rom annahm und sich dann in einer domus aurea niederließ, sich öffentlich zu seinem Irrsinn, seinem Fehlverhalten, seinem Größenwahn und dem bevorstehenden Untergang bekannte und dem Ganzen ins Gesicht lachte; dass so ein Mann dem Schicksal den Fehdehandschuh vor die Füße warf und den sich nähernden Tod verhöhnte, wobei er rief, »Ja! Vergleicht mich, wenn ihr wollt, mit diesem Ungeheuer, das Christen in Öl tauchte und anzündete, um des Nachts seinen Garten zu beleuchten! Das auf der Lyra spielte, während Rom brannte (damals gab es keine Geigen)! Ja: ich selbst habe mir den Namen Nero, aus dem Hause Caesars, gegeben, der letzte dieser blutigen Dynastie, und macht damit, was ihr wollt. Mir gefällt einfach der Name.« Er ließ seine Bösartigkeit vor unseren Nasen baumeln, schwelgte darin, forderte uns heraus, sie zu erkennen, voll Verachtung für unsere Auffassungsgabe und überzeugt von seiner Fähigkeit, jeden zu besiegen, der sich gegen ihn erheben sollte. Und es stimmt: Lange Zeit verstanden wir ihn nicht, und als wir ihn allmählich verstanden, stellten wir uns ihm nicht entgegen, bemühten uns nicht, ihn zu Fall zu bringen.
Er kam wie einer dieser gestürzten europäischen Monarchen in die Stadt, diese Oberhäupter von abgesetzten Häusern, die noch immer die großen Ehrentitel als Nachnamen nutzten, von Griechenland, von Jugoslawien oder von Italien, und die die düstere Vorsilbe Ex- so behandelten, als gäbe es sie nicht. Sein Auftreten zeigte, er war kein Ex-Irgendwas; er war durch und durch majestätisch, mit seinen steifkragigen Hemden, mit seinen Manschettenknöpfen, den maßgefertigten englischen Schuhen, mit seiner Art, auf geschlossene Türen zuzugehen, ohne den Schritt zu verlangsamen, da er wusste, sie würden sich für ihn auftun; auch mit seinem misstrauischen Wesen, das ihn jeden Tag Einzelgespräche mit seinen Söhnen führen ließ, um sie zu befragen, was ihre Brüder über ihn sagten; und mit seinen Autos, mit seinem Gefallen an Spieltischen, seinem unhaltbaren Aufschlag beim Tischtennis, seiner Vorliebe für Prostituierte, Whiskey und höllisch scharf gewürzte, gefüllte Eier und mit seinem oft wiederholten Spruch – an dem absolute Herrscher von Caesar bis Haile Selassie Gefallen hatten –, die einzige Tugend, die es wert sei, beachtet zu werden, sei die Loyalität. Er wechselte oft sein Handy, gab fast niemandem die Nummer und ging nicht dran, wenn es klingelte. Er verweigerte Journalisten oder Fotografen den Zutritt zu seinem Haus, aber in seiner regelmäßig stattfindenden Pokerrunde waren oft zwei Männer zugegen, silberhaarige Schwerenöter, die man stets in hellbraunen Lederjacken und mit breit gestreiften Krawatten sah, denen der Verdacht anhing, ihre reichen Ehefrauen getötet zu haben, obwohl in einem Fall keine Anklage erhoben wurde und sie im anderen Fall nicht standhielt.
Über seine eigene nicht vorhandene Ehefrau schwieg er. In seinem Haus mit den vielen Fotografien, dessen Wände und Kaminsimse von Rockstars, Nobelpreisträgern und Adeligen bevölkert waren, gab es kein Bild der Mrs. Golden, oder wie auch immer sie sich genannt hatte. Ganz eindeutig, es musste etwas mit Schande zu tun haben, und wir tratschten zu unserer Schmach darüber, was das wohl gewesen sein mochte, wir stellten uns das Ausmaß und die Schamlosigkeit ihrer Treulosigkeiten vor, beschworen sie als eine höchst wohlgeborene Nymphomanin herauf, deren Sexleben anstößiger war als das eines Filmstars, von deren Abschweifungen ein jeder wusste, nur ihr Ehemann nicht, der sie, vor Liebe blind, weiterhin anbetungsvoll betrachtete, sie für die liebende, keusche Ehefrau seiner Träume hielt, bis zu dem schrecklichen Tag, als seine Freunde ihm die Wahrheit aufdeckten, sie kamen in Scharen, um sie ihm zu offenbaren, und wie er tobte!, wie er sie beschimpfte!, er nannte sie Lügner und Verräter, sieben Mann mussten ihn festhalten und daran hindern, denen, die ihn gezwungen hatten, der Realität ins Gesicht zu sehen, etwas anzutun, und schließlich sah er ihr ins Gesicht, er akzeptierte sie, er verbannte sie aus seinem Leben und untersagte ihr, jemals wieder ihre Söhne anzusehen. Schlampe, sagten wir uns, hielten uns für weltklug, und die Klatschgeschichte stellte uns zufrieden, und wir beließen es dabei, da wir in Wahrheit mehr mit unseren eigenen Dingen beschäftigt und nur bis zu einem bestimmten Punkt an den Angelegenheiten des N. J. Golden interessiert waren. Wir wendeten uns ab und führten unser Leben weiter.
Welch schrecklichen Fehler wir machten.
2
Was ist ein gutes Leben? Was ist das Gegenteil davon? Diese Fragen beantworten keine zwei Menschen gleich. In diesen unseren feigen Zeiten leugnen wir die Größe des Universalen und verteidigen und verherrlichen unsere lokalen Engstirnigkeiten, und darum können wir uns nicht auf vieles einigen. In diesen unseren degenerierten Zeiten sind die Menschen allein auf Großtuerei und persönlichen Gewinn aus – hohle, aufgeblasene Menschen, für die nichts tabu ist, wenn es ihre kleine Sache voranbringt –, sie behaupten, große Anführer und Wohltäter zu sein, im Sinne des Gemeinwohls zu handeln, und bezeichnen alle, die sich ihnen widersetzen, als Lügner, kleingeistige Neider, Dummköpfe, Spießer – und in der bewussten Verkennung der Wahrheit als unaufrichtig und korrupt. Wir sind so uneins, so feindlich gegeneinander, so getrieben von Scheinheiligkeit und Verachtung, so versunken in Zynismus, dass wir unsere Großspurigkeit Idealismus nennen, so enttäuscht von unseren Herrschenden, so bereit, die Institutionen unseres Staates zu verspotten, dass genau das Wort Tugend seine Bedeutung und Notwendigkeit verloren hat, vielleicht, um für eine Zeit beiseitegeschoben zu werden wie all die anderen vergifteten Wörter, Spiritualität, zum Beispiel, Endlösung, zum Beispiel,und (zumindest wenn es für Wolkenkratzer und Pommes frites angewandt wird) Freiheit.
Aber an jenem kalten Januartag, als der rätselhafte Siebzigjährige, den wir als Nero Julius Golden kennenlernen sollten, in einem Daimler mit drei Söhnen und keinerlei sichtbaren Anzeichen einer Ehefrau in Greenwich Village eintraf, hatte zumindest er eine feste Vorstellung davon, welcher Wert Tugend zukam und wie sich richtiges Handeln vom falschen unterschied. »In meinem amerikanischen Haus …«, so sagte er seinen beflissenen Söhnen in der Limousine, als sie vom Flughafen zu ihrer neuen Residenz fuhren, »… richtet sich Moral nach dem goldenen Standard.« Ob er nun meinte, Moral sei überaus kostbar oder Reichtum definiere Moral oder er persönlich mit seinem glitzernden neuen Namen würde nun allein Richter über Richtig und Falsch sein, sagte er nicht, und aus langer Gewohnheit, Söhne ihres Vaters zu sein, baten ihn die jüngeren Julii nicht um Klarstellung. (Julii, sie alle zogen den imperialen Plural den Goldens vor: Sie waren keine bescheidenen Leute!) Der jüngste der drei, ein träger Zweiundzwanzigjähriger, dem das Haar in schönen Stufen bis auf die Schultern fiel und der das Gesicht eines zornigen Engels hatte, stellte dennoch eine Frage. »Was sollen wir sagen …«, fragte er seinen Vater, »… wenn man von uns wissen will, wo wir herkommen?« Das Gesicht des alten Mannes färbte sich tiefrot. »Darauf habe ich doch zuvor schon eine Antwort gegeben«, schrie er. »Sagt ihnen, scheiß auf die Identitätsfeststellung. Sagt ihnen, wir wären Schlangen, die sich gehäutet haben. Sagt ihnen, wir wären soeben von Carnegie Hill in die Innenstadt gezogen. Sagt ihnen, wir wären erst gestern zur Welt gekommen. Sagt ihnen, wir hätten uns durch einen Zauber materialisiert oder wären mit einem Raumschiff, versteckt im Schweif eines Kometen, aus der Umgebung von Alpha Centauri eingeflogen. Sagt, wir wären von überall und nirgends oder von irgendwo, wir sind Leute, die ständig etwas vortäuschen, Schwindler, Erfinder, wandelbare Gestalten, sprich Amerikaner. Sagt ihnen nicht den Namen des Orts, den wir verlassen haben. Sprecht ihn nie aus. Nicht die Straße, nicht die Stadt, nicht das Land. Ich will diese Namen nie mehr wieder hören.«
Sie stiegen im Zentrum des alten Village aus dem Wagen, in der Macdougal Street, ein Stück unterhalb der Bleecker, in der Nähe des alten italienischen Cafés, das sich noch immer irgendwie durchschlug; und unter Nichtbeachtung der hupenden Autos hinter ihnen und der ausgestreckten flehenden Hand mindestens eines schmuddeligen Bettlers veranlassten sie, dass die Limousine mitten auf der Straße stehen blieb, während sie seelenruhig ihr Gepäck aus dem Kofferraum hoben – sogar der alte Mann bestand darauf, seinen Koffer selbst zu nehmen – und es zu dem großen Beaux-Arts-Gebäude auf der östlichen Straßenseite trugen, zur früheren Murray Mansion, die als Haus Golden bekannt werden sollte. (Nur der älteste Sohn, der sich nicht gerne im Freien aufhielt, der eine sehr, sehr dunkle Brille trug und einen ängstlichen Gesichtsausdruck hatte, schien sich zu beeilen.) So kamen sie an, wie sie zu bleiben beabsichtigten, selbstbewusst und mit schulterzuckender Gleichgültigkeit gegenüber Einwänden anderer.
Die Murray Mansion, das größte aller Häuser an den Gärten, hatte viele Jahre weitestgehend leer gestanden, nur eine auffallend schnippische, italienisch-amerikanische Haushälterin um die Fünfzig und ihre ebenso hochmütige, wenn auch viel jüngere Helferin und Lebensgefährtin hatten dort gewohnt. Oft hatten wir über die Identität des Eigentümers Spekulationen angestellt, aber die grimmigen Hüterinnen des Hauses weigerten sich, unsere Neugierde zu befriedigen. Wie auch immer, das waren die Jahre, in denen viele der reichsten Leute der Welt Immobilien kauften, nur um sie zu besitzen, und sie auf dem ganzen Planeten leer stehen ließen wie ausrangierte Schuhe, daher nahmen wir an, dass irgendein russischer Oligarch oder Ölscheich damit zu tun haben müsse, und achselzuckend gewöhnten wir uns daran, mit dem leeren Haus so umzugehen, als stünde es gar nicht da. Eine weitere Person gehörte zu dem Haus, ein freundlicher Hispano namens Gonzalo, er kümmerte sich um alles und war bei den beiden Drachendamen angestellt, und wenn er manchmal ein wenig freie Zeit hatte, baten wir ihn herüber zu unseren Häusern, um unsere Strom- oder Leitungsprobleme zu beheben und uns zu helfen, im tiefen Winter unsere Dächer und Eingänge vom Schnee zu befreien. Diese Dienste führte er für kleines Geld, das wir ihm diskret in die Hand drückten, mit einem Lächeln aus.
Der Macdougal-Sullivan Gardens Historic District – um seinen überaus sonoren Namen vollständig zu nennen – war ein zauberhaftes, angstfreies Areal, wir lebten und zogen dort unsere Kinder groß, ein Ort des glücklichen Rückzugs von der entzauberten, beängstigenden Welt außerhalb seiner Grenzen, und wir rechtfertigten uns nie dafür, dass wir es innig liebten. Die Häuser auf der Macdougal und der Sullivan Street, um 1840 ursprünglich im neoklassischen Stil gebaut, wurden in den 1920er-Jahren im Neokolonialstil umgestaltet, von Architekten, die für einen gewissen Mr. William Sloane Coffin arbeiteten, der Möbel und Teppiche verkaufte; zugleich wurden damals die Hinterhöfe zu einem Gemeinschaftsgarten zusammengelegt, der im Norden an die Bleecker, im Süden an die Houston Street grenzt, er war ausschließlich für die private Nutzung der Bewohner der anliegenden Häuser bestimmt. Die Murray Mansion war eine Besonderheit, in vielerlei Hinsicht zu groß für die Gärten, ein elegantes Bauwerk, das zwischen 1901 und 1903 ursprünglich für den berühmten Banker Franklin Murray und seine Frau Harriet Lanier Murray von dem Architekturbüro Hoppin & Koen errichtet wurde, das, um Platz für diesen Neubau zu schaffen, zwei der ursprünglichen Häuser abreißen ließ, welche 1844 auf dem Grundstück des Händlers Nicholas Low erbaut worden waren. Es war ein Entwurf im Stil der französischen Renaissance, sollte ausgefallen und modern sein, ein Stil, mit dem Hoppin & Koen bereits an der École des Beaux-Arts und anschließend, als sie für McKim, Mead & White arbeiteten, beträchtliche Erfahrung gesammelt hatten. Wie wir später erfuhren, befand sich das Haus bereits seit den frühen 1980er Jahren im Besitz von Nero Golden. Lange war in der Gegend geraunt worden, der Eigentümer komme und gehe, er verbringe vielleicht zwei Tage im Jahr in seinem Haus, aber keiner von uns sah ihn je, obgleich manchmal in der Nacht mehr Fenster als sonst beleuchtet waren, und ganz selten sah man einen Schatten an einem Fensterladen, sodass wir Kinder zu dem Schluss kamen, das Haus sei verhext, und Abstand hielten.
Es war dieses Haus, dessen breite Eingangstür an jenem Januartag offen stand, als der Daimler die Golden-Männer ausspie, den Vater und die Söhne. Auf der Schwelle stand das Begrüßungskomitee, die beiden Drachendamen, die für die Ankunft ihres Herrn alles vorbereitet hatten. Nero und seine Söhne gingen hinein und fanden die Welt der Lügen vor, die sie von nun an bewohnen sollten: keine funkelnagelneue, ultramoderne Residenz für eine reiche ausländische Familie, die sie sich nach und nach zu eigen machte, während sich ihr neues Leben entwickelte, sich ihre Verbindungen zu der neuen Stadt vertieften, sich ihre Erfahrungen vervielfachten – nein! –, sondern vielmehr ein Ort, an dem die Zeit über zwanzig Jahre stillgestanden hatte, Zeit, die gleichgültig auf abgenutzte Biedermeierstühle glotzte, auf langsam ausbleichende Teppiche und Sechzigerjahre-Lavalampen und mit mildem Amüsement auf die Porträts von all den richtigen Leuten mit Nero Golden, er in jüngeren Jahren mit stadtbekannten Personen, René Ricard, William Burroughs, Deborah Harry, sowohl führende Wall-Street-Leute als auch alteingesessene Familien der gehobenen Gesellschaft, Träger von geheiligten Namen wie Luce, Beekman und Auchincloss. Ehe der alte Mann dieses Haus kaufte, hatte er ein großes hohes Künstlerloft besessen, zweihundertachtzig Quadratmeter groß, an der Ecke Broadway und Great Jones Street, und in seiner fernen Jugend hatte er im Dunstkreis der Factory abhängen dürfen, wo er unbeachtet und dankbar mit Si Newhouse und Carlo De Benedetti in der Ecke der reichen Jungs saß, doch das war lange her. Im Haus befanden sich Erinnerungsstücke aus jener Zeit und von seinen späteren Besuchen in den 1980er Jahren. Viele Möbelstücke waren eingelagert gewesen, und das Wiederauftauchen dieser Gegenstände aus einem früheren Leben hatte etwas von einer Exhumierung, was eine Kontinuität unterstellte, die die Geschichte der Bewohner nicht hatte. Darum empfanden wir das Haus immer als einen schönen Schwindel. Wir murmelten einander Worte von Primo Levi zu: »Die unmittelbarste Folge des Exils, der Entwurzelung, ist: die Vorherrschaft des Unwirklichen über das Wirkliche.«
Nichts in dem Haus ließ auf ihre Herkunft schließen, und die vier Männer blieben hartnäckig unwillig, etwas über ihre Vergangenheit preiszugeben. Doch unvermeidlich sickerte manches durch, sodass wir mit der Zeit ihre Geschichte herausfanden, doch zuvor hatten wir alle eine eigene Theorie über ihre verschwiegene Herkunft, wir wickelten unsere Fiktion um ihre. Obwohl sie alle helle Haut hatten, von dem milchbleichen jüngsten Sohn bis zum ledrigen alten Nero, war jedem klar, dass sie nicht traditionell »weiß« waren. Ihr Englisch war makellos, mit britischem Akzent, sie hatten nahezu sicher eine Oxbridge-Erziehung genossen, und deshalb nahmen wir, die meisten von uns, anfangs fälschlicherweise an, das multikulturelle England sei das Land, das nicht genannt werden durfte, und London, die Stadt der vielen Ethnien. Sie könnten Libanesen oder Armenier oder südasiatische Londoner sein, so mutmaßten wir, oder sogar Wurzeln im europäischen Mittelmeerraum haben, was ihre römischen Fantasien erklären würde. Welche Grausamkeiten waren ihnen dort angetan worden, welch schreckliche Kränkungen hatten sie ertragen, dass sie so weit gingen, mit ihrer Herkunft nichts mehr zu tun haben zu wollen? Nun gut, für die meisten von uns war das ihre Privatsache, und wir waren bereit, es dabei zu belassen, bis es uns nicht mehr möglich war, uns so zu verhalten. Und als dieser Zeitpunkt kam, verstanden wir, dass wir uns die falschen Fragen gestellt hatten.
Dass die Scharade mit ihren frisch angenommenen Namen überhaupt funktionierte, ja, sogar für zwei ganze Amtsperioden des Präsidenten, dass diese erfundenen amerikanischen Gestalten, die in ihrem Palast der Illusionen lebten, so fraglos von uns, ihren neuen Nachbarn und Bekannten, akzeptiert wurden, verrät uns viel über Amerika und noch mehr über die Kraft des Willens, mit der sie wie Chamäleons in ihre neuen Identitäten hineingeschlüpft waren, sodass sie in unser aller Augen zu dem wurden, was sie zu sein vorgaben. Im Rückblick kann man sich nur über das Ausmaß des Plans wundern, über die Vielschichtigkeit der Details, die beachtet werden mussten, die Pässe, die Ausweise, die Führerscheine, die Sozialversicherungsnummern, die Krankenversicherung, die Fälschungen, die Deals, die Bezahlungen, die schiere Schwierigkeit des Unterfangens – und über die Wut oder vielleicht auch die Angst, die das ganze großartige, komplizierte, absurde Projekt vorantrieb. Wie wir später erfuhren, hatte der alte Mann etwa anderthalb Jahrzehnte an seiner Metamorphose gearbeitet, bis er seinen Plan umsetzte. Hätten wir das gewusst, hätten wir begriffen, dass etwas sehr Großes verheimlicht wurde. Aber wir wussten es nicht. Sie waren ganz einfach der selbst ernannte König und seine soi-disant Prinzen, die in einem architektonischen Juwel der Nachbarschaft lebten.
In Wahrheit kamen sie uns nicht sonderlich seltsam vor. Leute in Amerika hatten alle möglichen Namen – im Telefonbuch, damals, als es noch Telefonbücher gab, herrschte eine nomenklatorische Exotik. Huckleberry! Dimmesdale! Ichabod! Ahab! Fenimore! Portnoy! Drudge! Ganz zu schweigen von den Dutzenden, Hunderten, Tausenden Golds, Goldwaters, Goldsteins, Finegolds, Goldberrys. Auch die Amerikaner entschieden ständig, wie sie heißen und wer sie sein wollten, sie warfen ihren Ursprung als Gatz ab, um zu feine Hemden tragenden Gatsbys zu werden und Träumen namens Daisy oder vielleicht einfach nur Amerika nachzujagen. Samuel Goldfish (ein weiterer Goldjunge) wurde zu Samuel Goldwyn, die Aertzoons wurden zu den Vanderbilts, Clemens wurde zu Twain. Und viele von uns – oder unsere Eltern oder Großeltern – hatten als Immigranten beschlossen, die Vergangenheit abzulegen, so wie es die Goldens nun beschlossen; wir ermutigten unsere Kinder, Englisch zu sprechen, nicht die alte Sprache des alten Landes: amerikanisch zu sprechen, sich amerikanisch zu kleiden, amerikanisch zu sein. Das alte Zeug stopften wir in einen Keller, rangierten es aus oder verloren es. Und feiern wir denn nicht, zelebrieren wir denn nicht jeden Tag in unseren Filmen und Comics – in den Comics, zu denen unsere Filme geworden sind – die Vorstellung einer geheimen Identität? Clark Kent, Bruce Wayne, Diana Prince, Bruce Banner, Raven Darkhölme, wir lieben euch. Die geheime Identität mag zuerst eine französische Idee gewesen sein – Fantômas und auch Le Fantômede l’Opéra –, aber unterdessen ist sie tief in der amerikanischen Kultur verwurzelt. Wenn unsere neuen Freunde Caesaren sein wollten, kamen wir gut damit klar. Sie hatten einen exzellenten Geschmack, exzellente Kleidung, sprachen ein exzellentes Englisch und waren nicht exzentrischer als, sagen wir, Bob Dylan oder andere ehemalige Bewohner. Die Goldens wurden akzeptiert, weil sie akzeptabel waren. Sie waren jetzt Amerikaner.
Aber letzten Endes löste sich das Rätsel. Gründe für ihren Fall waren: ein Streit unter den Brüdern, eine unerwartete Metamorphose, das Auftauchen einer schönen, entschlossenen jungen Frau im Leben des alten Mannes, ein Mord. (Mehr als ein Mord.) Und schließlich die gründliche Arbeit des Geheimdiensts in der Ferne, in dem Land, das keinen Namen hatte.
3
Dies hier war ihre bislang nicht erzählte Geschichte, ihr explodierender Planet Krypton: eine rührselige Geschichte, wie es Geheimgehaltenes oft ist.
Das Grandhotel am Hafen wurde von jedem geliebt, selbst von denen, die zu arm waren, um jemals durch seine Tür zu treten. Jeder hatte das Interieur in den Filmen gesehen, in Filmmagazinen, und die Träume: die berühmte Treppe, die faulenzenden Badeschönheiten am Swimmingpool, die glitzernden Flure der Geschäfte, darunter die Maßschneider, die den Lieblingsanzug innerhalb eines Nachmittags kopieren konnten, wenn man das bevorzugte Kammgarntuch oder den Gabardine gewählt hatte. Jeder wusste von dem legendär geschickten, unendlich gastfreundlichen und höchst aufmerksamen Personal, für das das Hotel wie Familie war, das dem Hotel wie einem Patriarchen Respekt zollte und das jedem, der in seine Hallen trat, das Gefühl vermittelte, eine Königin und ein König zu sein. Es war ein Ort, wo man Fremde willkommen hieß, ja, selbstverständlich, von den Fenstern sah der Fremde hinaus auf den Hafen, auf die schöne Bucht, die der unnennbaren Stadt ihren Namen gab, und staunte über das große Aufgebot an seetüchtigen Schiffen, die vor ihm auf und ab tanzten, Motor- und Segelboote und Jachten jeder Größe, jeder Form und jeder Farbe. Jeder kannte die Geschichte von der Entstehung der Stadt, wie die Briten sie eben wegen ihres schönen Hafens hatten haben wollen, wie sie mit den Portugiesen verhandelt hatten, um Prinzessin Catarina mit König Charles II. zu vermählen, und da die arme Catarina keine Schönheit war, hatte die Mitgift verdammt üppig ausfallen müssen, insbesondere da Charles II. ein Auge auf ein wunderschönes Mädchen geworfen hatte, und so wurde die Stadt Teil der Mitgift, und Charles heiratete Catarina und ignorierte sie für den Rest seines Lebens, aber die Briten verlegten ihre Marine in den Hafen und unternahmen ein großes Landgewinnungsprojekt, um ihn mit den sieben Inseln zu verbinden, wo sie ein Fort bauten und dann eine Stadt, und das Britische Empire folgte. Diese Stadt war von Fremden gebaut, und deshalb war es richtig, dass Fremde in diesem großen Hotelpalast, der auf den Hafen hinausging, der der alleinige Grund für die Existenz der Stadt war, willkommen geheißen wurden. Aber er war nicht nur für Fremde, dafür war es ein viel zu romantisches Bauwerk – aus Steinmauern, mit roten Kuppeln, zauberhaft, mit belgischen Kronleuchtern, die auf die Gäste niederleuchteten, auf an den Wänden und am Boden versammelte Kunst, Möbel und Teppiche aus allen Teilen dieses riesigen Landes, dieses Landes, das nicht genannt werden konnte – und wärest du ein junger Mann, der seine Liebste beeindrucken wollte, triebest du irgendwie das Geld auf, um sie in die Lounge am Meer einzuladen, und während die Meeresbrise eure Gesichter streichelte, würdet ihr Tee und Limonensaft trinken und Gurkensandwichs essen und Kuchen, und sie würde dich lieben, weil du sie in das magische Herz der Stadt gebracht hättest. Und vielleicht würdest du sie bei eurer zweiten Verabredung für ein chinesisches Essen hier die Treppe hinunterführen, und das würde den Handel besiegeln.
Die Granden der Stadt sowie das Land und die Welt machten sich das alte Prachthotel zu eigen, nachdem die Briten fort waren – Prinzen, Politiker, Filmstars, religiöse Führer, die berühmtesten und schönsten Gesichter der Stadt, des Landes und der Welt rangelten in seinen Fluren um Positionen – und es wurde ebenso ein Symbol für die Stadt, die nicht genannt werden konnte, wie der Eiffelturm oder das Kolosseum oder die Statue im New Yorker Hafen, deren Name Liberty Enlightens the World lautet.
Das alte Prachthotel umgab ein Gründungsmythos, den nahezu jeder in der Stadt, die nicht genannt werden konnte, glaubte, auch wenn er nicht stimmte, ein Mythos über die Freiheit, über das Stürzen der britischen Imperialisten, ähnlich dem der Amerikaner. Es ging die Geschichte um, dass in den ersten Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts ein prächtiger alter Mann mit einem Fez, der zufällig der reichste Mann des Landes war, das nicht genannt werden konnte, einmal versuchte, ein anderes älteres Grandhotel im selben Viertel zu besuchen und ihm seiner Ethnie wegen der Zutritt verweigert wurde. Der prächtige alte Gentleman nickte bedächtig, ging fort, kaufte ein beträchtliches Stück Land etwas weiter die Straße hinunter und errichtete darauf das schönste und prächtigste Hotel, das die Stadt, die nicht genannt werden konnte, in dem Land, das nicht identifiziert werden konnte, je gesehen hatte, und trieb in kurzer Zeit das Hotel, das ihm den Zutritt verweigert hatte, in die Pleite. So wurde das Hotel in der Vorstellung der Leute ein Symbol der Rebellion, des Siegs über die Kolonialherren mit ihren eigenen Waffen und Des-sie-ins-Meer-Treibens, und selbst wenn es endgültig feststand, dass nichts dergleichen sich wirklich ereignet hatte, änderte es nichts daran, weil ein Symbol der Freiheit und des Siegs mächtiger ist als Tatsachen.
Einhundertundfünf Jahre vergingen. Dann legten am 23. November 2008 zehn Männer mit Maschinengewehren und Handgranaten mit dem Schiff vom feindlichen Nachbarland ab in Richtung Westen des Landes, das nicht genannt werden konnte. In ihren Rucksäcken befanden sich Munition und starke Betäubungsmittel: Kokain, Steroide, LSD und Spritzen. Auf ihrem Weg zu der Stadt, die nicht genannt werden konnte, kaperten sie ein Fischerboot, gaben ihr ursprüngliches Schiff auf, hievten zwei Schlauchboote an Bord und sagten dem Kapitän, wo er hinsteuern solle. Als sie vor der Küste angelangt waren, töteten sie den Kapitän und sprangen in die Schlauchboote. Später wunderten sich viele Menschen, warum die Küstenwache sie nicht gesehen oder versucht hatte, sie abzufangen. Die Küste war angeblich gut bewacht, aber in dieser Nacht hatte es wohl Lücken gegeben. Als die Schlauchboote am 26. November anlandeten, teilten sich die bewaffneten Männer in kleine Gruppen auf und liefen zu ihren vorgegebenen Zielen, einem Bahnhof, einem Krankenhaus, einem Kino, einem jüdischen Zentrum, einem beliebten Café und zwei Fünfsternehotels. Eines davon war das oben beschriebene Hotel.
Der Angriff auf den Bahnhof begann um einundzwanzig Uhr einundzwanzig und dauerte anderthalb Stunden. Die beiden Bewaffneten feuerten wahllos, achtundfünfzig Menschen starben. Sie verließen den Bahnhof und wurden schließlich in der Nähe eines Stadtstrands gestellt, wo einer getötet und der andere verhaftet wurde. Unterdessen jagte um einundzwanzig Uhr dreißig ein anderes Killerteam eine Tankstelle in die Luft und begann, auf die Leute im jüdischen Zentrum zu schießen, als sie an die Fenster liefen. Dann griffen sie das Zentrum selbst an, sieben Menschen starben. Zehn Menschen starben in dem Café. Innerhalb der nächsten achtundvierzig Stunden starben etwa dreißig Menschen in dem anderen Hotel.
Das Hotel, das jeder liebte, wurde gegen einundzwanzig Uhr fünfundvierzig angegriffen. Gäste im Schwimmbadbereich wurden als Erste erschossen, dann gingen die Bewaffneten zu den Restaurants. Eine junge Frau, die in der Lounge am Meer arbeitete, wohin junge Männer ihre Freundinnen einluden, um sie zu beeindrucken, half vielen Gäste, durch eine Personaltür zu entkommen, doch als die Bewaffneten in die Lounge stürmten, fand sie selbst den Tod. Handgranaten wurden gezündet, und es folgte während der drei Tage dauernden Besetzung eine Killerorgie. Draußen standen Fernsehteams und viele Menschen, als jemand schrie: »Das Hotel brennt!« Flammen züngelten aus den Fenstern des obersten Stocks, und auch die berühmte Treppe loderte. Unter denen, die von den Flammen eingeschlossen waren, befanden sich die Frau und die Kinder des Hotelmanagers. Die bewaffneten Männer hatten Grundrisse des Hotels, und ihre Grundrisse waren exakter als die, welche die Sicherheitskräfte in Händen hielten. Die Killer nahmen die Drogen, um wach zu bleiben, und das LSD – was kein Psychostimulans ist – zusammen mit den anderen Drogen, um eine manische halluzinogene Ekstase auszulösen (das war die Absicht), und sie lachten laut auf, als sie töteten. Die Fernsehteams draußen berichteten von entkommenen Hotelgästen, und die Killer sahen die Sendung, um herauszufinden, an welcher Stelle die Gäste entkamen. Am Ende der Besetzung waren über dreißig Menschen tot, darunter viele Hotelangestellte.
◇
Die Goldens lebten unter ihrem abgelegten, ursprünglichen Namen im exklusivsten Viertel der Stadt, in einer bewachten Wohnanlage auf dem exklusivsten Hügel, in einem großen modernen Haus, das Aussicht auf die Art-déco-Villen bot, die die Bucht säumten, wo die rote Sonne jeden Abend kopfüber eintauchte. Wir können sie uns dort vorstellen, den alten Mann, damals noch nicht so alt, und die ebenfalls noch jüngeren Söhne, den erstgeborenen brillanten, unbeholfenen, agoraphobischen Tölpel, den mittleren mit seiner Vorliebe, nachts unterwegs zu sein, und mit seinen Society-Fotos, den jüngsten mit Finsternis und Verwirrung in sich, und es hat den Anschein, dass der alte Mann sie jahrelang ermutigt hatte, das Spiel zu spielen und sich Namen aus der Antike zu geben, ebenso wie er ihnen von Kindesbeinen an beigebracht hatte, sie seien keine normalen Leute, sie seien Caesaren, sie seien Götter. Die römischen Kaiser und später die byzantinischen Herrscher waren bei den Arabern und Persern als Qaisar-e-Rúm, Caesaren von Rom, bekannt. Und wenn Rúm Rom war, dann waren sie, die Könige dieses Ost-Roms, Rumi. Das führte sie zum Studium des weisen Mystikers Rumi, alias Jalaluddin Balkhi, mit dessen Zitaten der Vater und die Söhne um sich warfen wie mit Tennisbällen, was du suchst, sucht dich, du bist das Universum in ekstatischer Bewegung, entfalte deineneigenen Mythos, verkaufe deine Klugheit und beschaffe dirStaunen, zünde dein Leben an und suche die, die deineFlammen nähren, und sei erst krank, wenn du gesund werden willst, bis sie seiner Sinnsprüche überdrüssig wurden und sie nunmehr zitierten, um sich gegenseitig zum Lachen zu bringen, willst du reich sein, mache dich arm, was du suchst, sucht dich, willst du aufrecht sein, stelle dich auf den Kopf.
Danach waren sie keine Rumi mehr und wurden Latinate Julii, die Söhne des Caesar, die selbst eigenständige Caesaren waren oder sein würden. Sie waren eine alte Familie, die behauptete, sie könne ihre Ahnenreihe bis zu Alexander dem Großen zurückverfolgen – von dem Plutarch erklärte, er sei der Sohn des Zeus –, somit waren sie den Julio-Claudianern zumindest ebenbürtig, die behaupteten, Abkömmlinge des Julus zu sein, des Sohns des gottesfürchtigen Aeneas, Fürst von Troja, und folglich auch von Aeneas’ Mutter, der Göttin Venus. Was das Wort Caesar angeht, so hatte es mindestens vier mögliche Ursprünge. Tötete der erste Caesar einen caesai – das maurische Wort für Elefant? Hatte er kräftiges Haar auf dem Kopf – caesaries? Hatte er graue Augen – oculis caesiis? Oder kam sein Name von dem Verb caedere, schneiden, weil er durch einen Kaiserschnitt, eine sectio caesarea, zur Welt gekommen war? »Ich habe keine grauen Augen, und meine Mutter hat mich auf normalem Wege geboren«, sagte der alte Mann. »Und mein Haar, auch wenn es noch vorhanden ist, ist schütter geworden. Ich habe auch keine Elefanten getötet. Zur Hölle mit dem ersten Caesar. Ich beschließe, Nero zu sein, der Letzte dieser Linie.«
»Wer sind dann wir?«, fragte der mittlere Sohn. »Ihr seid meine Söhne«, entgegnete der Patriarch achselzuckend. »Wählt euch einen eigenen Namen.« Als es dann Zeit war aufzubrechen, entdeckten sie, dass er für sie Reisedokumente auf ihre neuen Namen hatte ausstellen lassen, was sie nicht überraschte. Er war ein Mann, der die Dinge durchzog.
Und hier, als wäre sie auf einem alten Foto, ist die Ehefrau des alten Mannes, eine kleine traurige Frau mit ergrautem Haar, das sie zu einem nachlässigen Knoten hochgesteckt hatte, und mit der Erinnerung an Selbstverletzungen im Blick. Caesars Frau: sie sollte über jeden Verdacht erhaben sein, ja, aber sie hatte auch den schlimmsten Job der Welt am Hals.
Am Abend des 26. Novembers ereignete sich etwas in dem großen Haus, irgendein Streit zwischen Caesar und seiner Frau, sie rief nach dem Mercedes und dem Fahrer und verließ bedrückt das Haus, um Trost bei ihren Freundinnen zu suchen, und so geschah es, dass sie in der Lounge am Meer des Hotels saß, das alle liebten, Gurkensandwichs aß und stark gesüßten Limonensaft trank, als die halluzinierenden bewaffneten Männer hineinstürmten – vor Freude kichernd, mit verdrehten Augen und psychedelischen, eingebildeten, um ihre Köpfe schwirrenden Vögeln – und tödliche Schüsse abgaben.
Und ja, das Land war Indien, natürlich, die Stadt war Bombay, natürlich, das Haus gehörte zur luxuriösen Walkeshwar-Kolonie auf dem Malabar-Hügel, und ja, natürlich, das waren die Angriffe muslimischer Terroristen, die von Pakistan aus von Lashkar-e-Taiba, »der Armee der Gerechten«, gelenkt wurden, zuerst auf den Bahnhof, früher als Victoria Terminus bekannt oder auch VT und gegenwärtig, wie alles in Bombay/Mumbai, umbenannt nach dem heldenhaften Mahratta-Prinzen Shivaji – und dann auf das Leopold Café in Colaba, auf das Oberoi Trident Hotel, das Metro Cinema, auf das Cama and Albless Hospital, das jüdische Chabad-Haus und auf das Taj Mahal Palace and Tower Hotel. Und ja, nachdem die dreitägige Besetzung und die Kämpfe vorüber waren, zählte die Mutter der beiden älteren Golden-Söhne (von der Mutter des jüngsten wird später noch die Rede sein) zu den Toten.
Als der alte Mann erfuhr, seine Frau werde im Taj gefangen gehalten, gaben seine Knie nach, und er wäre die Marmortreppe in seinem Marmorhaus, vom Marmorwohnzimmer hinunter auf die Marmorterrasse, gefallen, wäre nicht ein Diener in der Nähe gewesen, um ihn aufzufangen, aber damals war immer ein Diener in der Nähe. Er blieb auf den Knien und vergrub das Gesicht in den Händen, und sein Körper wurde von so lautem, krampfartigem Schluchzen geschüttelt, dass es den Anschein hatte, ein tief in ihm verborgenes Wesen versuche, ihm zu entfliehen. Während der ganzen Dauer der Angriffe verharrte er oben auf der Marmortreppe in der Gebetshaltung, weigerte sich, zu essen oder zu schlafen, schlug sich mit der Faust auf die Brust wie ein Klageweib bei einer Beerdigung und gab sich die Schuld. Ich wusste nicht, dass sie dorthin gehen würde, rief er, ich hätte es wissen müssen, warum habe ich sie gehen lassen. In diesen Tagen war die Luft in der Stadt dunkel wie Blut, selbst am Mittag, dunkel wie ein Spiegel, und der alte Mann spiegelte sich darin, und was er sah, gefiel ihm nicht; und seine Vision hatte eine solche Kraft, dass auch seine Söhne sie sahen, und nachdem die schlechte Nachricht eingetroffen war, die Nachricht, die ihrem ganzen bisherigen Leben ein Ende setzte, verging das Wochenende an der Rennstrecke mit Repräsentanten der großen alten Familien von Bombay und auch mit den Neureichen, Squash, Bridge, Schwimmen, Badminton und Golf im Willingdon Club, Filmsternchen, Hot Jazz, alles für immer vorbei, weil es in einem Meer aus Toten untergegangen war, sie waren einverstanden mit dem, was ihr Vater beabsichtigte, nämlich dieses Marmorhaus für immer zu verlassen und die gebrochene, zerstrittene Stadt, in der es stand, und ebenso das ganze schmutzige, korrupte, verwundbare Land, alles, was ihr Vater nun plötzlich oder vielleicht nicht so plötzlich hasste, sie kamen überein, jede Einzelheit von dem, was es ihnen bedeutet hatte, auszulöschen, auch wer sie dort gewesen waren und was sie verloren hatten: die Frau, deren Ehemann sie angebrüllt hatte, sodass sie ihrem Verhängnis entgegenfuhr, die von ihren beiden Söhnen geliebt wurde und einmal von ihrem Stiefsohn so tief gedemütigt worden war, dass sie versucht hatte, sich umzubringen. Sie würden reinen Tisch machen, würden eine neue Identität annehmen, auf die andere Seite der Welt reisen und andere sein als zuvor. Sie würden dem Historischen entfliehen, sich dem Persönlichen zuwenden, und in der Neuen Welt würde das Persönliche genau das sein, was sie erstrebten und erwarteten, es wäre unvoreingenommen, individuell und einzig, jeder von ihnen würde insgeheim, außerhalb der Geschichte, außerhalb der Zeit, sein eigenes Abkommen mit dem Tagtäglichen treffen. Keinem von ihnen kam es in den Sinn, dass ihre Entscheidung einem kolossalen Anspruch entsprang, der Vorstellung, sie könnten aus ihrem Gestern aussteigen und ein Morgen beginnen, als wäre es nicht Teil derselben Woche, als könnten sie sich jenseits von Erinnerung, Wurzeln, Sprache und Ethnie in das Land des selbstkreierten Selbst begeben, mit anderen Worten, nach Amerika.
Wie unrecht wir ihr taten, der toten Lady, als wir in unserem Tratsch ihre Abwesenheit von New York auf ihre Untreue zurückführten. Es war ihre Abwesenheit, ihre Tragödie, die der Anwesenheit ihrer Familie mitten unter uns den Sinn gab. Sie war der Grund für diese Geschichte.
Als Neros Gemahlin Poppaea Sabina starb, verbrannte er bei ihrer Trauerfeier den zehnjährigen Vorrat an arabischem Weihrauch. Aber im Fall von Nero Golden konnte aller Weihrauch der Welt letztendlich den üblen Geruch nicht überdecken.
◇
Der Rechtsbegriff benami wirkt fast französisch, ben-ami, und narrt den Unachtsamen, der meint, es könne»guter Freund«, bon ami,oder »geliebt«, bien-aimé, bedeuten oder so etwas Ähnliches. Aber das Wort ist persischen Ursprungs, und seine Wurzel ist nicht ben-ami, sondern bé-námi. Be ist eine Vorsilbe, die »ohne« bedeutet, und nám bedeutet Name; also benami, »namenlos« oder anonym. In Indien bezeichnen »benami«-Transaktionen Eigentumserwerb, bei denen der vorgebliche Käufer, in dessen Namen das Eigentum erworben wird, nur ein Strohmann ist, den man einsetzt, um den wahren Eigentümer geheim zu halten. In altem amerikanischem Slang entspräche der benami einem beard.
Im Jahre 1988 verabschiedete die indische Regierung das Benami-Transaktions-(Verbots-)Gesetz, das solche Käufe für rechtswidrig erklärte und es dem Staat ermöglichte, »benami gehaltenes« Eigentum einzuziehen. Doch viele Schlupflöcher blieben. Eine der Maßnahmen, mit denen die Behörden diese Schlupflöcher hat schließen wollen, ist die Einsetzung des Aadhaar-Systems. Aadhaar ist eine zwölfstellige Sozialversicherungsnummer, die jedem indischen Bürger für seine oder ihre Lebenszeit zugewiesen wird, und ihre Benutzung ist zwingend bei jeder Immobilien- und Finanztransaktion, sodass die Verwicklung des Bürgers in derartige Transaktionen elektronisch nachverfolgt werden kann. Jedenfalls war der Mann, den wir als Nero Golden kannten, der über zwanzig Jahre lang amerikanischer Bürger und Vater amerikanischer Bürger war, bei diesem Spiel anderen weit überlegen. Als geschah, was geschah, und alles ans Licht kam, erfuhren wir, dass das Haus der Familie Golden Eigentum einer nicht mehr ganz jungen Lady war, derselben Lady, die Nero als die ältere von seinen beiden zuverlässigen Vertrauten diente, und kein anderes Rechtsdokument konnte vorgewiesen werden. Doch was geschah, geschah, und danach fielen sogar die Mauern, die Nero so sorgsam aufgebaut hatte, in sich zusammen, und das ganze beängstigende Ausmaß seiner Kriminalität lag offen vor uns, nackt im Licht der Wahrheit. Das sollte sich in der Zukunft ereignen. Einstweilen war er einfach N. J. Golden, unser reicher und – und wie wir entdeckten – vulgärer Nachbar.
4
Auf dem verschwiegenen rechteckigen Rasen des Gartens krabbelte ich, ehe ich laufen konnte, lief ich, ehe ich rennen konnte, rannte ich, ehe ich tanzen konnte, tanzte ich, ehe ich singen konnte, und ich tanzte und sang, bis ich Stillhalten und Ruhe erlernte, und ich stand reglos da und lauschte an Sommerabenden, an denen Glühwürmchen funkelten, dem Herzschlag des Gartens und wurde, zumindest meiner Meinung nach, ein Künstler. Um genau zu sein, ein angehender Drehbuchschreiber. Und in meinen Träumen ein Filmemacher, nach der großen alten Begrifflichkeit sogar ein auteur.
Ich habe mich hinter der ersten Person Plural versteckt und tue es womöglich wieder, aber ich komme nun dazu, mich vorzustellen. Ich bin. Aber in gewisser Hinsicht unterscheide ich mich nicht allzu sehr von meinen Figuren, die ebenfalls Selbstverberger sind – von der Familie, deren Eintreffen in meiner Gegend mir das große Projekt lieferte, nach dem ich mit wachsender Verzweiflung gesucht hatte. Setzten die Goldens alles daran, ihre Vergangenheit auszulöschen, so lösche ich mich, der es auf sich genommen hat, ihr Chronist zu sein – und womöglich ihr Animator, ein Begriff, der für die Entwickler von Walt-Disney-Themenparks geprägt wurde –, von Natur aus selber aus. Was sagte noch Isherwood zu Anfang von Leb wohl, Berlin? »Ich bin eine Kamera mit weit geöffneter Blende, passiv aufzeichnend, nicht denkend.« Doch das war damals, und jetzt ist das Zeitalter der smarten Kameras, die einem das Denken abnehmen. Vielleicht bin ich eine smarte Kamera. Ich nehme auf, aber ich bin nicht streng passiv. Ich denke. Ich verändere. Möglicherweise erfinde ich sogar. Ein Animator unterscheidet sich sehr von einem getreuen Abbildner der Wirklichkeit. Van Goghs Gemälde einer Sternennacht sieht nicht aus wie eine Fotografie einer Sternennacht, aber es ist nichtsdestoweniger eine großartige Darstellung einer Sternennacht. Kommen wir überein, dass ich das Gemälde der Fotografie vorziehe. Ich bin eine Kamera, die malt.
Nenne mich René. Es hat mir immer gefallen, dass der Erzähler des Moby Dick uns nicht seinen Namen verrät. Nenne-mich-Ismael mochte in »Wirklichkeit«, das heißt, im unbedeutenden Tatsächlichen, das außerhalb des großen Realen des Romans liegt, er mochte, oh, irgendwie geheißen haben. Er mochte Brad oder Trig oder Ornette oder Schuyler oder Zeke gewesen sein. Vielleicht hieß er sogar tatsächlich Ismael. Wir wissen es nicht, und darum unterlasse ich es wie mein großer Vorläufer, schlichtweg zu sagen, mein Name ist René. Nenne mich René: Mehr kann ich nicht für dich tun.
Wir fahren fort. Meine Eltern waren Hochschulprofessoren (stellst du an ihrem Sohn eine vererbte professorale Note fest?), die damals vor Urzeiten, als es noch billig war, unser Haus an der Sullivan, Ecke Houston Street kauften. Ich stelle sie dir vor: Gabe und Darcey Unterlinden, seit ewigen Zeiten verheiratet, nicht nur respektierte Geisteswissenschaftler, sondern geliebte Lehrer und wie der große Poirot (er ist fiktional, aber man kann, wie Mia Farrow in The Purple Rose of Cairo sagt, nicht alles haben) … Belgier. Vor langer Zeit Belgier, muss ich rasch erklären, seit Ewigkeiten Amerikaner; Gabe pflegte sonderbar beharrlich einen wunderlichen, schweren und weitestgehend erfundenen paneuropäischen, Darcey einen angenehmen Yankee-Akzent. Die Professoren waren Tischtennisspieler (sie forderten Nero Golden, als sie von seiner Vorliebe für dieses Spiel erfuhren, und er schlug sie haushoch, obwohl sie beide ziemlich gut waren). Sie trugen einander Gedichte vor. Sie waren Baseball-Fans, oh, und kichernde, süchtige Anhänger von Reality-TV, Opernliebhaber, die gemeinsam ständig eine Monografie über diese Kunstform planten, die TheChick Always Dies heißen sollte und niemals geschrieben wurde.
Sie liebten ihre Stadt wegen ihrer Unähnlichkeit mit dem übrigen Land. »Rom iss nicht Italien«, belehrte mich mein Vater, »und London iss nicht England, und Paris iss nicht Frankreich, und diss hier, wo wir gerade sind, diss sind nicht die USA. Diss iss New York.«
»Zwischen der Metropole und dem Hinterland«, fügte meine Mutter ihre Fußnote an, »stets Groll, stets Entfremdung.«
»Nach 9/11 versucht Amerika vorzutäuschen, es liebe uns«, sagte mein Vater. »Wie lang wird das anhalten?«
»Nicht so scheißlang«, vervollständigte meine Mutter seinen Gedanken. (Sie benutzte Schimpfwörter. Sie behauptete, sie wisse nicht, dass sie es tue. Sie würden ihr einfach so herausrutschen.)
»Iss wie eine Blase, das meinen jetzt alle«, sagte mein Vater. »Iss wie in dem Jim-Carrey-Film, nur auf das Ausmaß einer Großstadt ausgedehnt.«
»Die Truman Show«, erklärte meine Mutter hilfreich. »Und nicht die ganze Stadt ist in der Blase, weil die Blase aus Geld besteht, und das Geld ist nicht gleichmäßig verteilt.«
»Die Bronx, Queens, vielleicht nicht so sehr in der Blase«, sagte mein Vater.
»Staten Island, definitiv nicht in der Blase.«
»Brooklyn?«
»Brooklyn. Ja, vielleicht in der Blase. Teile von Brooklyn.«
»Brooklyn iss großartig …«, sagte mein Vater, und dann beendeten sie unisono ihren so oft wiederholten Lieblingswitz, »… aber es iss Brooklyn.«
»Der Punkt iss, uns gefällt die Blase und dir auch«, sagte mein Vater. »Wir wollen nicht in einem roten Staat leben, und du – du wärest erledigt zum Beispiel in Kansas, wo sie nicht an die Evolution glauben.«
»In gewisser Hinsicht widerlegt Kansas Darwins Theorie«, grübelte meine Mutter. »Es beweist, dass nicht immer die Fittesten überleben. Stattdessen überleben manchmal die Unfittesten.«
»Aber das sind nicht einfach verrückte Cowboys«, sagte mein Vater, und meine Mutter hakte gleich ein.
»Wir wollen nicht in Kalifornien leben.«
(An diesem Punkt wurde ihre Blase verworren, wurde kulturell und wirtschaftlich, rechte Küste gegen linke Küste, Biggie gegen Tupac. Die Widersprüche in ihrer Haltung schienen sie nicht zu kümmern.)
»Der also bist du«, ließ mein Vater mich wissen. »Der Junge in der Blase.«
»Das sind Tage der Zeichen und Wunder«, sagte meine Mutter. »Nicht weinen, Baby, nicht weinen, verdammt, weine nicht.«
Ich hatte eine glückliche Kindheit bei den Professoren. In der Mitte der Blase waren die Gärten, und die Gärten gaben der Blase eine Mitte. Ich bin im Zauber aufgewachsen, sicher vor Gefahren, wohlgeborgen im Kokon der liberalen städtischen Seide, und dies gab mir einen unschuldigen Mut, selbst wenn ich wusste, dass außerhalb des magischen Zaubers die dunklen Windmühlen der Welt auf den quichotischen Narren warteten. (Doch »die einzige Entschuldigung für Privilegien«, lehrte mich mein Vater, »ist, aus ihnen etwas Nützliches zu machen«.) Ich ging in Little Red zur Schule und am Washington Square aufs College. Ein ganzes Leben in einem Dutzend Blocks. Meine Eltern waren viel abenteuerlustiger gewesen. Mein Vater war mit einem Fulbright-Stipendium nach Oxford gegangen und anschließend mit einem britischen Freund in einem Mini Traveller durch Europa und Asien gefahren – Türkei, Iran, Afghanistan, Pakistan, Indien –, damals, zu den bereits erwähnten Urzeiten, als Dinosaurier durch die Welt streiften und es möglich war, solche Reisen zu unternehmen, ohne geköpft zu werden. Als er nach Hause zurückkehrte, hatte er genug von der großen weiten Welt und wurde, mit Burrows und Wallace, einer der drei großen Historiker von New York City, Coautor mit diesen beiden Herren des mehrbändigen Klassikers Metropolis, der definitiven Geschichte von Supermans Heimatstadt, wo wir alle lebten, wo der Daily Planet jeden Morgen vor der Tür lag und wo sich, viele Jahre nach dem alten Superman, Spiderman niederließ, in Queens. Wenn ich mit ihm durch das Village ging, zeigte er mir, wo einst Aaron Burrs Haus stand, und vor dem Multiplex-Kino auf der Second Avenue und der Thirty-Second Street erzählte er mir einmal die Geschichte der Schlacht an der Kips Bay und wie Mary Lindley Murray Israel Putnams fliehende amerikanische Soldaten rettete, indem sie den britischen General William Howe beschwor, die Verfolgung aufzugeben, und ihn in ihr großes Haus, Inclenberg, zum Tee bat, oben auf der Anhöhe, die als Murray Hill bekannt werden sollte.
Auch meine Mutter war auf ihre Art unerschrocken gewesen. Als junge Frau arbeitete sie im Gesundheitswesen mit Drogensüchtigen und Kleinbauern in Afrika. Nach meiner Geburt verengte sie ihren Horizont und wurde zuerst Expertin für Kleinkinderziehung und schließlich Professorin für Psychologie. Unser Haus, gegenüber dem Garten des Hauses der Goldens, war vollgestopft mit dem bunten, gesammelten Wust ihrer beiden Leben, abgetretene Perserteppiche, geschnitzte afrikanische Holzfiguren, Fotos, Landkarten und Kupferstiche der frühen »neuen« Städte auf Manhattan Island, Amsterdam und York. Eine Ecke war berühmten Belgiern vorbehalten, das Original einer Tintin-Zeichnung hing neben einem Warhol-Siebdruck von Diane von Furstenberg und dem berühmten Hollywoodstandfoto des schönen Filmstars von Frühstück bei Tiffany mit ihrer langen Zigarettenspitze, früher als Miss Edda van Heemstra bekannt, später als die äußerst beliebte Audrey Hepburn; und darunter auf einem Tischchen eine Erstausgabe der Mémoires d’Hadrien von Marguerite Yourcenar, nebst den Fotografien meines Namensvetters Magritte in seinem Atelier, des Radrennfahrers Eddy Merckx und der Singenden Nonne. (Jean-Claude Van Damme hatte es nicht in die Auswahl geschafft).
Trotz dieser Ecke mit Belgiana zögerten sie nicht, ihr Herkunftsland zu kritisieren, wenn man sie fragte. »König Leopold II. und der Kongo-Freistaat«, sagte meine Mutter. »Der grausamste Kolonialist aller Zeiten, das räuberischste System in der Kolonialgeschichte.« »Und heute«, fügte mein Vater hinzu, »Molenbeek. Schaltstelle des fanatischen Islam in Europa.«
An besonderer Stelle auf dem Kaminsims im Wohnzimmer lag ein jahrzehntealtes, nie angerührtes Stück Haschisch, noch in seiner ursprünglichen billigen Zellophanverpackung und mit dem mondähnlichen Gütesiegel der offiziellen afghanischen Regierung. In Afghanistan war zu Zeiten des Königs Haschisch legal und wurde in drei unterschiedlichen, kontrollierten Preis- und Qualitätsklassen angeboten, Goldener, Silberner und Bronzener Afghan. Aber was mein Vater, der sich nie dem Gras hingab, an besonderer Stelle auf dem Sims aufbewahrte, war etwas viel Selteneres, etwas Legendäres, nahezu Okkultes. »Afghan Moon«, sagte mein Vater. »Wenn du das nimmst, öffnet sich das dritte Auge in deiner Zirbeldrüse, mitten auf deiner Stirn, du wirst hellsichtig, und nur wenige Geheimnisse bleiben dir verschlossen.«
»Warum hast du es dann nie genommen«, fragte ich.
»Weil eine Welt ohne Mysterien wie ein Bild ohne Schatten ist«, sagte er. »Du siehst zu viel, und es zeigt dir nichts.«
»Er meint damit …«, ergänzte meine Mutter, »… erstens, dass wir an die Fähigkeit unseres Hirns glauben und es nicht wegblasen wollen, und, zweitens, ist es womöglich mit schrecklichen Halluzinogenen verschnitten oder cut, wie die Hippies sagten, und drittens besteht die Möglichkeit, dass ich heftigst protestieren würde. Ich weiß es nicht. Er hat mich nie auf die Probe gestellt.« Die Hippies, als hätte sie keine Erinnerung an die 1970er-Jahre, als hätte sie nie eine Schafsfelljacke getragen oder ein Bandana oder nie davon geträumt, Grace Slick zu sein.
Es gab kein Afghan Sun, damit du es weißt. Die Sonne Afghanistans war der König Zahir Schah. Und dann kamen die Russen und dann die Fanatiker, und die Welt veränderte sich.
Aber Afghan Moon … es half mir im finstersten Moment meines Lebens, und meine Mutter konnte nicht mehr protestieren.
◇
Und es gab Bücher, unvermeidlich, Bücher wie eine Krankheit, sie verseuchten jede Ecke unseres gemütlichen Zuhauses. Ich wurde Autor, weil ich natürlich diese Vorfahren hatte, und vielleicht entschied ich mich für den Film statt für Romane oder Biografien, weil ich wusste, ich könnte mit den Alten nicht mithalten. Aber bis die Goldens in das große Haus an der Macdougal Street einzogen, dessen Garten schräg gegenüber von unserem war, lag meine Nachexamenskreativität brach. Mit der grenzenlosen Ichbezogenheit der Jugend hatte ich begonnen, mir einen großen Film vorzustellen oder einen Filmzyklus im Stil eines Dekalogs,der von Migration handeln sollte, von Transformation, Angst, Gefahr, Rationalität, Romantik, sexueller Umwandlung, der Stadt, von Feigheit und Mut; nicht weniger als ein panoramaartiges Porträt meiner Zeit. Mein bevorzugter Stil sollte etwas sein, das ich für mich Opernhaften Realismus nannte, mein Thema der Konflikt zwischen dem Ich und dem Anderen. Ich versuchte, ein fiktionales Porträt meiner Nachbarschaft zu entwerfen, aber es war eine Geschichte ohne treibende Kraft. Meine Eltern hatten nicht das dem Untergang geweihte Heldentum von richtigen opernhaft-realistischen Hauptfiguren; unsere Nachbarn ebenso wenig. (Bob Dylan war schon lange fort.) Mein berühmter Filmprofessor, der afroamerikanische Superstar-Regisseur-mit-einer-roten-Baseballkappe, sagte herablassend, nachdem er meine ersten Drehbücher gelesen hatte: »Ja, ganz nett, Junge, aber wo ist das Blut? Es ist zu ruhig. Wo ist der Motor? Vielleicht solltest du eine fliegende Untertasse in diesen verdammten Gärten landen lassen. Vielleicht solltest du ein Haus in die Luft jagen. Da muss was passieren. Mach irgendein Tamtam.«
Ich wusste nicht, wie. Und dann kamen die Goldens, und sie waren meine fliegende Untertasse, mein Motor, meine Bombe. Ich erspürte die Aufregung des jungen Künstlers, dem sein Thema wie ein Geschenk in einem Festtagspaket zugeschickt wurde. Ich verspürte Dankbarkeit.
◇
Es sei das Zeitalter der Non-Fiction, sagte mir mein Vater. »Vielleicht solltest du aufhören, Dinge zu erfinden. Frag in jedem Buchladen«, sagte er. »Es sind die Bücher auf dem Non-Fiction-Tisch, die die Leute kaufen, erfundene Geschichten bleiben liegen.« Doch das war die Welt der Bücher. Im Film war es die Zeit der Superhelden. Im Bereich der Non-Fiction hatten wir Michael Moores Polemiken, den Holzschnitzer Steiner von Werner Herzog, Wim Wenders Pina und einige andere. Aber die dicke Kohle winkte beim Spielfilm. Mein Vater bewunderte und empfahl mir die Arbeiten und Ideen von Dsiga Wertow, dem sowjetischen Dokumentarfilmer, der Theatralisches und Narratives verabscheute. Sein Filmstil, das Kamera-Auge oder Kino-Auge, zielte auf nichts Geringeres als auf die Entwicklung der Menschheit hin zu einer höheren fiktionsfreien Lebensform, »vom sich herumwälzenden Bürger über die Poesie der Maschinen zum vollendeten elektrischen Menschen«. Whitman hätte ihn gemocht. Vielleicht auch Ich-bin-eine-Kamera-Isherwood. Ich jedoch widerstand. Ich überließ die höheren Formen meinen Eltern und Michael Moore. Ich wollte mir die Welt ausdenken.
Eine Blase ist ein fragiles Ding, und oft am Abend äußerten die Professoren ihre Sorge, sie könne platzen. Sie sorgten sich um politische Korrektheit, um ihre Kollegin, der eine zwanzigjährige Studentin im Fernsehen wegen einer Auseinandersetzung über den Campusjournalismus aus einer Entfernung von zehn Zentimetern Missbrauch ins Gesicht schrie; um ihren Kollegen in einer anderen Fernsehsendung, den man beschimpfte, weil er nicht willens war, Pocahontas-Kostüme an Halloween zu verbieten; um einen Kollegen, der gezwungen war, ein Sabbatical zumindest für ein Seminar zu nehmen, weil er den »sicheren Raum« einer Studentin nicht ausreichend vor dem Eindringen von Ideen geschützt habe, die diese Studentin zu »verstörend« für ihren jungen Verstand fand; um ihren Kollegen, der sich einer Studentenpetition widersetzte, welche die Entfernung einer Statue von Präsident Jefferson vom Campus des College forderte, obwohl bekannt war, dass Jefferson Sklaven gehalten hatte; um ihren Kollegen, der von Studenten aus evangelikalen Familien vernichtend kritisiert wurde, weil er sie aufgefordert hatte, die Graphic Novel einer lesbischen Cartoonistin zu lesen; um ihren Kollegen, der gezwungen war, eine Produktion von Eve Enslers Vagina Monologen abzusagen, weil das Stück Frauen als Personen mit einer Vagina definiere und es somit Personen diskriminiere, die eine weibliche Identität, aber keine Vagina hatten; um ihre Kollegen, die sich gegen Bemühungen von Studenten sträubten, abtrünnige Muslime vom Podium zu verbannen, weil deren Ansichten nicht-abtrünnige Muslime verletzten. Sie sorgten sich, dass junge Leute Pro-Zensur-, Pro-Verbots-, Pro-Beschränkungen-Anhänger würden, wie sei das nur möglich, fragten sie mich, diese Verengung des jungen amerikanischen Geists, wir fangen an, uns vor den Jungen zu fürchten. »Nicht vor dir, natürlich, Schatz, wer könnte vor dir Angst haben«, beruhigte mich meine Mutter, worauf mein Vater konterte: »Aber Angst um dich, ja. Mit diesem Trotzki-Bart, auf den du ja so viel Wert legst, siehst du für mich wie ein Ziel für einen Eispickel aus. Meide Mexiko-City, besonders das Viertel Coyoacán. Das rate ich dir.«
An den Abenden saßen sie in gelben Lichtkegeln, Bücher auf dem Schoß, versunken in Worte. Sie sahen wie Gestalten auf einem Rembrandt-Gemälde aus, Zwei Philosophen in tieferMeditation, und sie waren wertvoller als jede Leinwand; vielleicht Mitglieder der letzten Generation ihrer Art, und wir, die wir post- sind, die danach kommen, werden bedauern, dass wir zu ihren Füßen nicht mehr gelernt haben.
Ich vermisse sie mehr, als ich in Worte fassen kann.
5
Die Zeit verging. Ich fand eine Freundin, verlor sie, fand eine andere und verlor auch sie. Meinem geheimen Filmscript, meiner höchst fordernden Geliebten, missfielen meine Versuche dieser falsch verstandenen Beziehungen zu menschlichen Wesen, und es schmollte und weigerte sich, seine Geheimnisse preiszugeben. Meine späten Zwanziger rollten wie ein dampfender Zug auf mich zu, und ich lag wie ein bewusstloser Schmierenkomödiant hilflos auf den Gleisen. (Meine literarisch gebildeten Eltern hätten ohne Zweifel vorgezogen, dass ich stattdessen Bezug nehme auf die Bahngleisszene in E. M. Forsters The Longest Journey, den Höhepunkt des Buchs.) Die Gärten waren mein Mikrokosmos, und jeden Tag sah ich die Figuren meiner Fantasie mich von den Fenstern der Häuser an der Macdougal und Sullivan Street anstarren, hohläugig und flehentlich bittend, geboren zu werden. Zu jeder hatte ich Bruchstücke verfasst, aber die Struktur der Arbeit entzog sich mir. An der #XX Sullivan Street, im Parterre, mit Zugang zum Garten, hatte ich meinen burmesischen Diplomaten – ich sollte sagen, aus Myanmar – angesiedelt, U Lnu Fnu von den Vereinten Nationen, dessen berufliches Herz durch seine Niederlage in der längsten Schlacht aller Zeiten um den Posten des Generalsekretärs gebrochen war, neunundzwanzig aufeinanderfolgende Abstimmungen ohne Sieger, und in der dreißigsten Runde verlor er gegen den Südkoreaner. Durch ihn wollte ich die Geopolitik ergründen, wollte den Druck der autoritärsten Regime der Welt auf die UN in Szene setzen, die darauf drängten, sie möge Religionsbeleidigung ächten, wollte die beunruhigende Frage nach dem Gebrauch des amerikanischen Vetos zur Verteidigung Israels auf die Spitze treiben und einen Besuch von Aung San Suu Kyi der Macdougal-Sullivan-Gärten arrangieren. Ich kannte auch U Lnu Fnus private herzzerreißende Geschichte, ich wusste, dass er seine Frau durch Krebs verloren hatte, und vermutete, dass er durch die doppelte Niederlage in seinem aufrechten Leben entgleist sein, die Redlichkeit ablegen und schließlich durch einen Finanzskandal zu Fall kommen könnte. Gerade als ich dieses dachte, schüttelte der hohläugige Mann am Fenster der #XX Sullivan Street enttäuscht den Kopf und zog sich ins Dunkel zurück. Niemand will der Böse sein.
Meine ausgedachte Gemeinschaft war international bunt gemischt. In der #OO Macdougal Street lebte noch ein weiterer einsamer Mensch, ein argentinischer Amerikaner, dem ich den vorläufigen Arbeitsnamen »Mr. Arribista« gegeben hatte, der Arrivist. Zu ihm hatte ich, wie auch immer sein Name schlussendlich lauten würde, Mario Florída vielleicht oder Carlos Hurlingham, folgendes Treatment:
Arribista, der neue Bürger, taucht in das große Land ein – in »sein« Land, sagt er erstaunt –, wie es ein Mann tut, der das Meer der Verheißung nach einer langen Reise durch die Wüste erreicht, obwohl er nie Schwimmen gelernt hat. Er vertraut darauf, dass das Meer ihn trägt; und das tut es. Er ertrinkt nicht oder zumindest nicht sofort.
Auch dieses hier, das noch weiter ausgeführt werden musste: