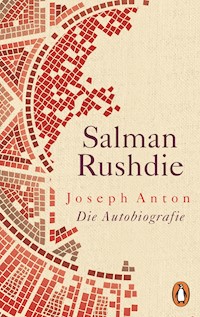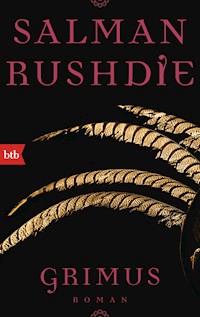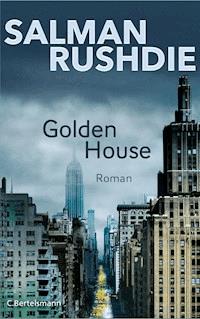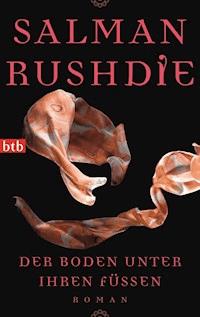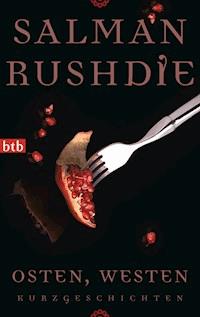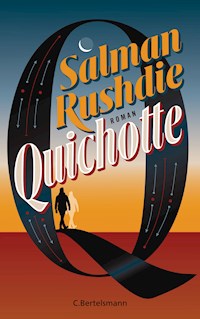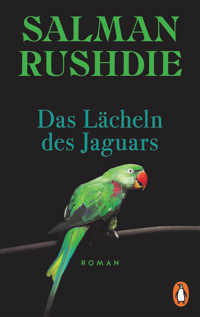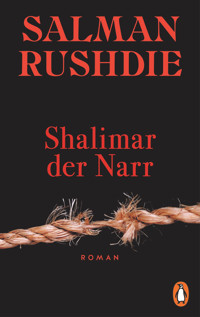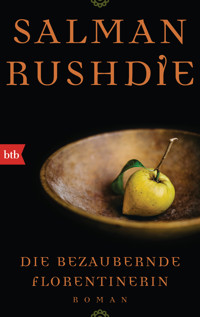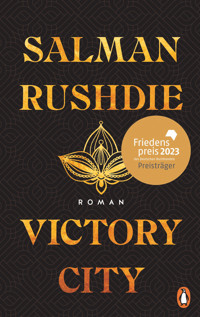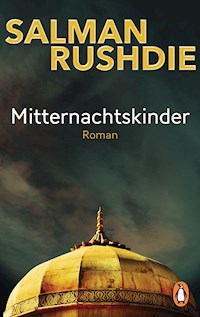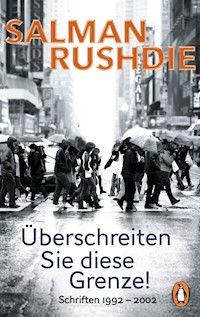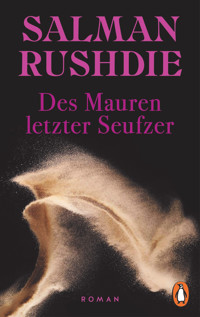
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Ein Feuerwerk der Fantasie« Nadine Gordimer
Moraes Zogoiby, genannt Moor, ist der letzte Spross einer indischen Gewürzhändlerdynastie – und ein erfahrener Geschichtenerzähler. Auf seinem Weg von Indien ins spanische Exil erzählt er die Geschichte seiner Familie. Eine Geschichte, die von erbitterten Fehden, von unheilvollen Verwünschungen und Leidenschaften, vom Glanz und Untergang eines Familienimperiums handelt und gleichzeitig eine Chronik des modernen Indiens ist.
Salman Rushdie erhält den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2023 »für seine Unbeugsamkeit, seine Lebensbejahung und dafür, dass er mit seiner Erzählfreude die Welt bereichert.« (Aus der Begründung der Jury)
- Fabelhaft: Rushdie entführt in eine wunderbar fremde, farbige Welt und schreibt gleichzeitig eine Chronik Indiens
- »Ein Autor mit atemberaubendem Einfallsreichtum.« (Financial Times)
- »Ein literarisches Feuerwerk, das die ungebrochene Erzählfreude des Autors unter Beweis stellt.« (Der Tagesspiegel)
- »Ein Triumph.« (New York Times)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 811
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Moraes Zogoiby, genannt Moor, ist der letzte Spross einer indischen Gewürzhändlerdynastie – und ein erfahrener Geschichtenerzähler. Auf seinem langen Weg von Indien ins spanische Exil erzählt er die Geschichte seiner Familie. Eine Geschichte, die von erbitterten Fehden, von unheilvollen Verwünschungen und Leidenschaften, vom Glanz und Untergang eines Familienimperiums handelt und gleichzeitig eine Chronik des modernen Indiens ist.
SALMAN RUSHDIE, 1947 in Bombay geboren, ging mit vierzehn Jahren nach England und studierte später in Cambridge Geschichte. Mit seinem Roman Mitternachtskinder, für den er den Booker Prize erhielt, wurde er weltberühmt. 1996 wurde ihm der Aristeion-Literaturpreis der EU für sein Gesamtwerk zuerkannt. 2007 schlug ihn die Queen zum Ritter. 2022 ernannte ihn das deutsche PEN-Zentrum zum Ehrenmitglied. Im Penguin Verlag erschien zuletzt sein Roman Victory City (2023).
Salman Rushdie
Des Mauren letzter Seufzer
Roman
Deutsch von Gisela Stege
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien 1995 unter dem Titel The Moor’s Last Sigh bei Jonathan Cape, London.
Copyright © 1995 Salman Rushdie
All rights reserved.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2013 btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, München, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Alle Rechte an der Übertragung ins Deutsche bei Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg.
Covergestaltung: Favoritbüro nach einem Entwurf von semper smile, München
Coverabbildung: © BIWA / Gallerystock
MI · Herstellung: sc
ISBN 978-3-641-31283-1V001
www.penguin-verlag.de
Inhaltsverzeichnis
Für E. J. W.
STAMMBAUM DER FAMILIE DA-GAMA-ZOGOIBY
IEin geteiltes Haus
1
Ich kann sie nicht mehr zählen, die Tage, die vergangen sind, seit ich vor den Schrecken von Vasco Mirandas wahnwitziger Festung in dem andalusischen Bergnest Benengeli geflohen bin; seit ich im Schutz der Dunkelheit dem Tod davongelaufen bin und eine an die Tür genagelte Botschaft hinterlassen habe. Und seit jenem Tag hat es auf meinem hungrigen, hitzeverschleierten Weg immer wieder Bündel beschriebener Blätter gegeben, Hammerschläge, den schrillen Aufschrei von Zwei-Zoll-Nägeln. Vor langer Zeit, als ich noch nicht trocken hinter den Ohren war, sagte meine Geliebte voll Zärtlichkeit zu mir: »Ach, Moor, du merkwürdiger schwarzer Mann, immer vollgestopft mit Thesen und nirgends eine Kirchentür, an die du sie nageln kannst.« (Sie, eine entschieden fromme, unchristliche Inderin, scherzte über Luthers Protest in Wittenberg, um sich über ihren Geliebten, einen entschieden unfrommen indischen Christen, lustig zu machen: Welch seltsame Wege Geschichten doch nehmen, auf welchen Zungen sie letztlich landen!) Leider hörte meine Mutter das; und schoß sofort, blitzschnell wie eine zuschnappende Schlange, zurück: »Vollgestopft mit Fäkalien, willst du wohl sagen.« Ja, Mutter, auch diesmal hattest du wieder das letzte Wort: wie immer.
»Amrika« und »Moskva« hat mal jemand sie genannt, Aurora, meine Mutter, und Uma, meine Liebste, hat die beiden großen Supermächte als Spitznamen für sie benutzt. Und alle Leute sagten, sie sähen sich ähnlich, ich aber vermochte eine solche Ähnlichkeit nicht zu erkennen, ganz und gar nicht. Beide sind inzwischen tot, eines unnatürlichen Todes gestorben, und ich befinde mich in einem fernen Land, den Tod auf den Fersen und ihre Geschichte in meiner Hand, eine Geschichte, die ich an ein Tor, einen Zaun, einen Ölbaum geschlagen, die ich über diese Landschaft meiner letzten Reise verteilt habe, jene Geschichte, die mit mir endet. Auf der Flucht habe ich die Welt zu meiner persönlichen Piratenkarte gemacht, mit verborgenen Hinweisen, verstreuten X-Markierungen, die zum eigentlichen Schatz führen sollen – zu mir. Wenn meine Jäger dieser Spur folgen, werden sie mich finden: wartend, ohne zu klagen, außer Atem, bereit. Hier stehe ich. Ich konnte nicht anders.
(Hier sitze ich, wäre wohl treffender. In diesem finsteren Wald – das heißt, auf diesem Ölberg, in diesem Gehölz, beobachtet von den seltsam schiefgeneigten Steinkreuzen eines kleinen, überwucherten Friedhofs gleich unterhalb der Zufahrt zur Tankstelle von Ultimo Suspiro –, ohne den Trost eines vergilschen Begleiters oder dem Bedürfnis nach ihm, an einem Ort, der die Mitte meines Lebensweges sein müßte, aus vielen, komplizierten Gründen aber zum Ende der Straße geworden ist, breche ich, verdammt noch mal, vor Erschöpfung zusammen.)
Und, jawohl, meine Damen, sehr vieles ist angeschlagen, angenagelt worden. Flaggen, zum Beispiel, die man zeigen will. Doch nach einem gar nicht so langen (wenn auch fahnenbunten) Leben sind mir plötzlich die Thesen ausgegangen. Das Leben selbst ist Kreuzigung genug.
Wenn einem der Dampf ausgeht, wenn der Atem, der einen vorwärtstreibt, beinah erstorben ist, wird es Zeit, Beichte abzulegen. Nennt es Testament oder Letzten Willen, was ihr wollt; den Saloon zum letzten Lebenshauch. Daher dieses »Hier-stehe-oder-sitze-ich« – ich, der ich die Sentenzen meines Lebens in die Landschaft genagelt und die Schlüssel zu einem roten Fort in der Tasche habe. Daher diese Augenblicke des Wartens unmittelbar vor der endgültigen Kapitulation.
Also ist es jetzt angemessen, vom Ende zu sprechen; von dem, was war und wohl nicht mehr sein wird; von dem, was richtig war und was falsch. Ein letzter Seufzer für eine verlorene Welt, eine Träne für ihren Untergang. Aber auch ein letztes Hurra, ein finales, skandalöses Gewirr unentwirrbarer Geschichten (Wörter müssen genügen, denn visuelle Medien sind nicht greifbar), und für die Totenwache eine Reihe von rauhen Männergesängen. Die Erzählung des Moor, eines Mauren, oder auch Mohren, inklusive Ton und Wut. Wollen Sie? Na ja, auch wenn Sie nicht wollen. Und damit kann ich anfangen kann, reichen Sie mir bitte den Pfeffer!
Wie bitte?
Selbst die Bäume sind so verblüfft, daß sie zu sprechen beginnen. (Haben Sie etwa noch nie, wenn Sie einsam und verzweifelt waren, mit den Wänden gesprochen, mit Ihrem blödsinnigen Hund oder in die leere Luft hinein?)
Ich wiederhole: den Pfeffer, bitte; denn ohne die Pfefferkörner hätte das, was in Ost und West heute endet, gar nicht erst begonnen. Der Pfeffer war es, der Vasco da Gamas Dickschiffe veranlaßte, über die Meere zu segeln, von Lissabons Leuchtturm Torre de Belem bis zur Küste von Malabar, anfangs nach Calicut und später, wegen des Lagunenhafens, nach Cochin. Im Kielwasser jener portugiesischen Erstankömmlinge segelten Engländer und Franzosen, so daß wir zur Zeit der Entdeckung Indiens – aber wie konnten wir entdeckt werden, da wir doch zuvor niemals bedeckt gewesen waren? – »weniger ein sub-continent als ein sub-condiment waren, wie meine vornehme Mutter es formulierte: »Von Anfang an war es kristallklar, was die Welt von der verdammten Mutter Indien wollte«, pflegte sie zu sagen. »Scharfe Sachen wollten sie, genau wie ein Mann, der zu einer Hure geht.«
Meine Geschichte handelt von einem hochgeborenen Mischling, der in Ungnade fiel: von mir, Moraes Zogoiby, genannt Moor, fast während meines ganzen Lebens der einzige männliche Erbe der Gewürz- und Großhandelsmillionen der Dynastie Da-Gama-Zogoiby aus Cochin, und von meiner Verbannung aus dem, was ich mit Fug und Recht als mein natürliches Leben betrachtet habe, der Verbannung durch meine Mutter Aurora, geborene da Gama, berühmteste unserer modernen Malerinnen, eine große Schönheit, zugleich aber scharfzüngigste Frau ihrer Generation, die an jeden, der in ihre Reichweite kam, sofort gepfefferte Bemerkungen austeilte. Auch ihre Kinder hatten keine Gnade zu erwarten. »Wir Rosenkranz-Kreuzigungs-Beatnik-Mädchen haben glühheißen Chili in den Adern«, pflegte sie zu sagen. »Keine Sondervorrechte für Fleisch- und Blutsverwandte! Wir leben von Fleisch, meine Lieblinge, und an Blut können wir uns berauschen.«
»Ein Sprößling unserer dämonischen Aurora zu sein«, erfuhr ich schon, als ich noch jung war, von dem goanischen Maler V. (für Vasco) Miranda, »heißt im wahrsten Sinne des Wortes ein moderner Luzifer zu sein. Du weißt schon: Sohn des aufblühenden Morgens.« Damals war meine Familie bereits nach Bombay umgezogen, und derartige Aussprüche galten im Paradies von Aurora Zogoibys legendärem Salon als Kompliment. Mir sind diese Worte jedoch als Prophezeiung im Gedächtnis geblieben, denn es kam der Tag, da ich in der Tat aus jenem legendären Garten vertrieben und ins Pandämonium geschleudert wurde. (So aus meiner natürlichen Umgebung verbannt, was blieb mir übrig, als mich dem Gegenteil zuzuwenden? Das heißt, dem Unnaturalismus, dem einzig wahren Ismus dieser verrückten, überdrehten Zeit. Würde nicht jeder, der aus den Grenzen des Erlaubten verstoßen wird, danach trachten, Licht ins Dunkel des Unerlaubten zu bringen? Und so stürzte Moraes Zogoiby, aus seiner persönlichen Geschichte vertrieben, kopfüber der Weltgeschichte entgegen.)
Und der Ursprung von allem: ein Pfeffersack!
Das heißt, nicht nur Pfeffer, sondern auch Kardamom, Cashewnüsse, Zimt, Ingwer, Pistazien, Nelken; dazu Kaffeebohnen sowie das große, allmächtige Teeblatt persönlich. Tatsache aber bleibt, daß es, um mit Aurora zu sprechen, »der Pfeffer war, zuerst und in einziger Linie – jawohl, in einziger Linie, denn warum in erster Linie sagen? Warum überhaupt in einer Linie stehen, wenn man als einziger und erster dastehen kann?« Was auf die Geschichte im allgemeinen zutrifft, trifft im besonderen auf die Geschicke unserer Familie zu: Pfeffer, das begehrte Schwarze Gold von Malabar, war die erste Handelsware meiner stinkreichen Sippe, der reichsten Gewürz-, Nuß-, Bohnen- und Blätterhändler von Cochin, die ohne jeden anderen Beweis als einer jahrhundertealten Tradition behaupteten, illegitime Nachkommen des großen Vasco da Gama zu sein ...
Keine Geheimnisse mehr. Ich habe sie alle angenagelt.
2
Mit dreizehn Jahren begann meine Mutter Aurora da Gama während der Anfälle von Schlaflosigkeit, mit denen sie eine Zeitlang allnächtlich geschlagen war, barfuß in dem weitläufigen, duftenden Haus ihrer Großeltern auf Cabral Island umherzugeistern und bei diesen nächtlichen Odysseen unweigerlich sämtliche Fenster zu öffnen – zuerst die inneren Insektenfenster, deren feinmaschiger Draht das Haus vor Mücken-Moskitos-Fliegen schützte, dann die bleiverglasten Flügelfenster selbst und schließlich die geschlitzten Holzläden dahinter. Woraufhin die sechzigjährige Matriarchin Epifania – deren persönliches Moskitonetz im Laufe der Jahre eine Anzahl kleiner, aber folgenschwerer Löcher bekommen hatte, die zu bemerken sie zu kurzsichtig oder zu geizig war – allmorgendlich durch juckende Bisse auf ihren knochigen, bläulichen Unterarmen erwachte und dann beim Anblick der Fliegen, die ihr von der Zofe Tereza (diese ergriff auf der Stelle die Flucht) ans Bett gebrachtes Tablett mit dem Frühstückstee und den süßen Keksen umschwirrten, einen spitzen Schrei ausstieß. Anschließend verfiel sie in sinnloses, hektisches Kratzen und Klatschen und warf sich wie wild in ihrem üppigen Bett aus Schiffs-Teakholz herum, wobei sie nicht selten Tee sowohl auf die spitzenbesetzte Baumwollbettwäsche als auch auf ihr weißes Musselinnachthemd mit dem hohen, gerüschten Kragen verschüttete, der ihren ehemals schwanengleichen, inzwischen aber faltigen Hals verbarg. Und während die Fliegenklatsche in ihrer Rechten sauste und pfiff, während die langen Nägel ihrer Linken den Rücken auf der Suche nach weiteren, schwerer zu erreichenden Moskitostichen durchpflügten, rutschte die Nachthaube von Epifania da Gamas Kopf und enthüllte einen Wust langer, wirrer weißer Haarzotteln, durch die man stellenweise (o weh!) nur allzu deutlich die gefleckte Kopfhaut schimmern sah. Sobald die junge Aurora, die an der Tür lauschte, erkannte, daß die Lautstärke der Wutgeräusche ihrer verhaßten Großmutter (Flüche, zerbrechendes Porzellan, das ergebnislose Patschen der Fliegenklatsche, das zornige Summen der Insekten) dem Höhepunkt entgegenging, setzte sie ihr süßestes Lächeln auf und stürmte mit einem fröhlichen Morgengruß ins Schlafzimmer der Matriarchin, wohl wissend, daß die ungezügelte Wut der Mutter sämtlicher da Gamas von Cochin durch das Erscheinen dieser jugendfrischen Zeugin ihrer altersbedingten Hilflosigkeit sogleich alle Grenzen sprengen würde. Mit wild zerzausten Haaren kniete Epifania, die wie ein zerbrochener Zauberstab flatternde Fliegenklatsche in der erhobenen Hand, auf ihren beschmutzten Laken und suchte zum geheimen Entzücken des jungen Mädchens ein Ventil für ihre Wut, indem sie wie eine der Hexen aus Macbeth, eine Rakshasa oder Banshee auf die zur Unzeit eindringende Aurora einbrüllte.
»Oho-ho, Mädchen, hast du mich erschreckt! Eines Tages wirst du mir noch das Herz brechifizieren.«
So kam es, daß der jungen Aurora da Gama die Idee, ihre Großmutter zu ermorden, direkt von den Lippen des in Frage kommenden Opfers eingegeben wurde. Sie begann Pläne zu schmieden, doch die immer makabrer werdenden Phantasien von Giften und schroffen Abgründen wurden ständig von pragmatischen Problemen durchkreuzt, so etwa der Unmöglichkeit, in den Besitz einer Kobra zu gelangen, um sie in Epifanias Bett zu legen, oder der glatten Weigerung der alten Vettel, ein Terrain zu betreten, das, wie sie es ausdrückte »rauf- und runterkippt«. Und obwohl Aurora sehr gut wußte, wo sie eines schönen scharfen Küchenmessers habhaft werden konnte, und sogar sicher war, daß sie längst stark genug sein würde, Epifania den Hals umzudrehen, entschied sie sich auch gegen diese Möglichkeiten, weil sie sich nicht schnappen lassen wollte und ein allzu offensichtlicher Mord unbequeme Fragen nach sich gezogen hätte. Da sich Aurora also keine Gelegenheit zu einem perfekten Verbrechen bot, fuhr sie fort, die perfekte Enkelin zu spielen, sann aber insgeheim weiter auf Böses, wobei ihr kein einziges Mal der Gedanke dämmerte, daß in ihren Überlegungen weit mehr als nur ein bißchen von Epifanias Skrupellosigkeit steckte.
»Geduld ist eine Tugend«, ermahnte sie sich. »Ich werde einfach abwarten.«
Vorerst einmal fuhr sie fort, während der schwülen Nächte die Fenster zu öffnen, und warf zuweilen auch wertvollen Zierat hinaus, lauter geschnitzte, rüsselnasige Figurinen, die auf den klatschenden Wellen der Lagune unterhalb der Mauern der Inselvilla davontrieben, oder kunstvoll bearbeitete Elefantenstoßzähne, die natürlich spurlos versanken. Tagelang hatte die Familie keine Ahnung, was sie von diesen Ereignissen halten sollte. Epifania da Gamas Söhne, Auroras Onkel Aires – wie Irish ausgesprochen – sowie ihr Vater Camoens – Camonsh ausgesprochen, aber nasal, wie bei den Franzosen –, mußten beim Erwachen feststellen, daß mutwillige nächtliche Brisen Buschhemden aus ihren Schränken und Geschäftspapiere aus den Ein- und Ausgangskörben geweht, daß sanfte Winde mit geschickten Fingern die Verschnürung der Probenbeutel gelöst hatten, Jutesäckchen mit großen und kleinen Kardamomen, Karriblättern und Cashewnüssen, die wie Wachsoldaten entlang der schattigen Korridore des Büroflügels standen, so daß Samen von Griechisch Heu und Pistazien weit über den abgetretenen, alten Bodenbelag aus Kalkstein, Holzkohle, Eiweiß und anderen, längst vergessenen Ingredienzen verstreut waren und der Duft der Gewürze, der in der Luft lag, die Matriarchin quälte, weil sie im Laufe der Jahre gegen die Quellen des Familienvermögens immer allergischer geworden war.
Und während die Fliegen durch die geöffneten Drahtfenster hereinsummten und die widrigen Windböen durch die geöffneten Bleiglasfenster ins Haus drangen, kam durch die geöffneten Holzläden alles herein, was es sonst noch gab: der Staub und der Lärm der Schiffe im Hafen von Cochin, die Nebelhörner der Frachter und Schleppdampfer, die derben Scherze der Fischer und das pochende Glühen ihrer quallenverbrannten Arme, das Sonnenlicht, so scharf wie ein Messer, die schwüle Hitze, die jeden ersticken konnte wie ein nasses, fest um den Kopf geknotetes Tuch, die Rufe der Händler in ihren Booten, die weithin vernehmbare Traurigkeit der unverheirateten Juden am anderen Ufer in Mattancheri, die Drohungen der Smaragdschmuggler, die Machenschaften rivalisierender Geschäftsleute, die zunehmende Nervosität der britischen Kolonie in Fort Cochin, die Lohnforderungen der Angestellten und der Plantagenarbeiter in den Spice Mountains, die Berichte von Unruhe stiftenden Kommunisten und der Politik der Kongreß-Wallahs, die Namen Gandhi und Nehru, Gerüchte von Hungersnöten im Osten und Hungerstreiks im Norden, die Gesänge und Trommelrhythmen der Geschichtenerzähler und das schwere, rollende Donnern der auflaufenden Gezeitenströmung der Geschichte, die sich an der brüchigen Mole von Cabral Island brach. »Dieses primitive Land, o Jesus!« fluchte Onkel Aires beim Frühstück, zu dem er bereits in Gamaschen und Hut erschien. »Ist die Welt da draußen vielleicht nicht dreckschmutzig genug, eh, eh? Was für ein mieser Idiot, was für ein rücksichtsloser Mistkerl hat denn das alles wieder hereingelassen? Ist dies ein anständiges Haus, beim Zeus, oder ein Scheißhaus – entschuldigt meine Ausdrucksweise – im Basar?«
An jenem Morgen begriff Aurora, daß sie zu weit gegangen war, denn ihr heißgeliebter Vater Camoens, ein kleiner, spitzbärtiger Mann in einem schreiend bunten Buschhemd, der inzwischen schon einen Kopf kleiner war als seine Bohnenstange von Tochter, ging mit ihr zu der kleinen Mole und vertraute ihr – vor Begeisterung und Aufregung so sehr zappelnd, daß seine Silhouette vor der unglaublichen Schönheit und der merkantilen Geschäftigkeit der Lagune wie eine Märchenfigur wirkte, wie ein Rumpelstilzchen, das auf einer Waldlichtung tanzt, oder wie ein guter Dschinn, der aus einer Lampe entwichen ist – in geheimnisvollem Flüsterton seine große, herzbewegende Erkenntnis an. Nach einem Dichter benannt und mit einem verträumten Naturell begabt (leider aber nicht mit dem entsprechenden Talent), wies Camoens sie schüchtern auf die Möglichkeit einer Geistererscheinung hin.
»Ich glaube«, erklärte er seiner sprachlosen Tochter, »ich glaube fest daran, daß deine geliebte Mummy zu uns zurückgekehrt ist. Du weißt doch, wie sehr sie die Meeresbrisen geliebt, wie sehr sie mit deiner Großmutter um frische Luft gerungen hat. Und nun springen wie durch Magie die Fenster auf. Und außerdem, mein liebes Töchterchen, sieh dir doch an, welche Gegenstände verschwinden! Nur solche, die sie immer gehaßt hat. Verstehst du? Aires’Elefantengötter, hat sie immer gesagt. Und prompt ist nun diese kleine Ganesha-Sammlung deines Onkels verschwunden. Die und das Elfenbein.«
Epifanias Elefantenstoßzähne. Zu viele Elefanten, die auf diesem Haus lasten. Die verblichene Belle da Gama hatte mit ihrer Meinung nie hinterm Berg gehalten. »Ich glaube, wenn ich heute nacht aufbleibe, darf ich vielleicht noch einmal ihr liebes Gesicht erblicken«, vertraute Camoens sehnsüchtig seiner Tochter an. »Was meinst du? Die Botschaft ist doch unverkennbar. Warum wartest du nicht mit mir? Du und dein Vater – sind wir nicht in derselben Situation? Er vermißt seine Missis, und du empfindest Gram über deine Mam.«
Aurora errötete vor Unbehagen und rief: »Aber ich glaube wenigstens nicht an diese idiotischen Geister! « Und lief ins Haus zurück, unfähig, die Wahrheit zu bekennen, die da lautete, daß sie selbst das Phantom ihrer verblichenen Mutter war, deren Handlungen ausführte, mit deren verstummter Stimme sprach; daß die nachtwandelnde Tochter die Mutter am Leben erhielt, ihren Körper der Dahingegangenen als Bleibe anbot, sich an die Tote klammerte, den Tod negierte, auf dem Fortbestehen der Liebe über das Grab hinaus beharrte; daß sie zum neuen Erwachen der Mutter geworden war, Fleisch für ihren Geist, zwei Da-Gama-Frauen in einer.
(Viele Jahre später sollte sie ihr eigenes Haus Elephanta nennen; und so kam es, daß letztlich sowohl Elefanten als auch Geister weiterhin eine Rolle in unserer Familiensaga spielten.)
Belle war gerade erst zwei Monate tot. »Hell’s Belle« pflegte Auroras Onkel Aires sie zu nennen (aber er gab den Leuten ständig Namen, zwang der Welt gewaltsam sein ganz persönliches Universum auf): Isabella Ximena da Gama, die Großmutter, die ich nie kennengelernt habe. Zwischen ihr und Epifania hatte von Anfang an Krieg geherrscht. Mit fünfundvierzig zur Witwe geworden, begann Epifania augenblicklich, die Matriarchin zu spielen; den Schoß voller Pistazien saß sie im Vormittagsschatten ihres Lieblingsgartens, fächelte sich Luft zu, knackte als unüberhörbare, eindrucksvolle Demonstration ihrer Macht die Nußschalen mit den Zähnen und sang dazu mit ihrer hohen, unerbittlichen Stimme:
Booby Shafto’s gone to sea-eaSilver bottles on his knee-ee ...
Ker-räck! Ker-räck! machten die Nußschalen in ihrem Mund.
He’ll come back to bury me-eeBoney Booby Shafto.
In all den Jahren hatte nur Belle niemals Angst vor Epifania gehabt. »Vier dicke Fehler«, erklärte die neunzehnjährige Isabella ihrer Schwiegermutter strahlend, einen Tag nachdem sie das Haus als mißbilligte, aber zähneknirschend akzeptierte Braut betreten hatte. »Nicht booby, nicht bottles, nicht bury, nicht boney. Süß von dir, in deinem Alter ein Liebeslied zu singen, doch mit den falschen Wörtern wird es zum Nonsens, nicht wahr?«
»Camoens«, erwiderte Epifania mit steinerner Miene, »sag deiner lieben Frau, sie soll die Klappe haltifizieren! Sonst werd’ ich ihrem Gesabbere höchstpersönlich den Hahn abdrehen.« In den darauffolgenden Tagen stürzte sie sich unaufhaltsam in ein großes Medley individualisierter Shanties. What shall we do with the shrunken tailor? bewirkte, daß ihre neue Schwiegertochter einen nur unzulänglich unterdrückten Lachanfall bekam, woraufhin Epifania stirnrunzelnd das Lied wechselte. Row, row, row your beau, gently down istream, sang sie, möglicherweise, um Belle zu ermahnen, ihre Pflichten als Ehefrau nicht zu vernachlässigen, und fügte dann den eher metaphysisch wirkenden Nachsatz hinzu: Morally morally morally morally ... ker-räck! ... wife is not a queen.
Ach, die Legenden über die kampflustigen da Gamas von Cochin! Ich gebe sie weiter, wie sie auf mich überkommen sind, poliert und phantasievoll ausgeschmückt durch endloses Weitererzählen. Es sind alte Geister, ferne Schatten, und ich erzähle diese Geschichten, um mit ihnen abzuschließen; sie sind alles, was ich noch habe, also lasse ich sie frei. Vom Cochin-Hafen zum Bombay-Hafen, von der Malabar Coast zum Malabar Hill: die Geschichte unserer Begegnungen und Trennungen, unseres Steigens, unseres Fallens, unseres »Rauf- und Runterkippens«. Und dann heißt es, leb wohl Mattancheri, adieu, Marine Drive ... Jedenfalls, als meine Mutter Aurora in dieses kinderarme Haus kam und zu einer hochaufgeschossenen, rebellischen Dreizehnjährigen heranwuchs, waren die Grenzen deutlich abgesteckt.
»Zu lang für ein Mädchen«, lautete Epifanias mißbilligendes Urteil über ihre Enkelin, als Aurora zum Teenager wurde. »Bosheit in den Augen heißt Teufel im Herzen. Und auch für ihre Fassade sollte sie sich schämen, wie jeder sehen kann. Wölbifiziert sich viel zu weit vor.« Woraufhin Belle ärgerlich zurückgab: »Und was für ein ach-so-perfektes Kind hat dein Liebling Aires vorzuweisen? Hier gibt es wenigstens eine junge da Gama, quicklebendig, und zum Teufel mit ihren großen boobie-shaftoes! Bruder Aires und Schwester Sahara dagegen bringen nicht das geringste zustande, weder boobies noch babies.« Aires’ Frau hieß Carmen, aber Belle, die der Vorliebe ihres Schwagers für das Erfinden von Namen nacheiferte, hatte sie nach der Sahara genannt, »weil sie so dürr und flach ist wie die Wüste und ich in dieser Odnis nirgendwo einen Ort entdecken kann, wo man was zu trinken kriegt«.
Aires da Gama, das dicht gewellte weiße Haar mühsam mit Brillantine gebändigt (vorzeitiges Ergrauen ist schon seit langem ein Charakteristikum unserer Familie; meine Mutter Aurora war mit zwanzig bereits schlohweiß, und welch einen märchenhaften Glanz, welch eine eisige gravitas verliehen diese seidigen Gletscher, die ihr in Kaskaden über den Rücken fielen, ihrer Schönheit!): Wie mein Großonkel sich in Positur warf! Und was machte er auf den kleinen Sechs-mal-sechs-Schwarzweißfotos, an die ich mich erinnere, für eine komische Figur mit seinem Monokel, dem steifen Kragen und dem Dreiteiler aus feinstem Gabardine! In einer Hand hielt er einen Stock mit Elfenbeingriff (es war ein Stockdegen, flüstert mir die Familiengeschichte ins Ohr), in der anderen eine lange Zigarettenspitze, und außerdem hatte er, wie ich zu meinem Bedauern vermelden muß, die Gewohnheit, Gamaschen zu tragen. Denkt man sich eine hochgewachsene Statur hinzu sowie einen gezwirbelten Schnurrbart, schon wäre der Inbegriff eines Operettenbösewichts fertig; aber Aires war genauso ein Taschenformat wie sein Bruder, dazu glattrasiert und mit leicht glänzendem Gesicht, so daß sein Auftreten als imitierter Stutzer möglicherweise eher Mitleid erregte als zu verächtlichem Zischen herausforderte.
Hier, auf einer anderen Seite im Fotoalbum der Erinnerungen, ist auch die krumme, schieläugige Großtante Sahara zu bewundern, die »Frau ohne Oasen«, die mit ihren kamelähnlichen Kiefern Betelnüsse kaute und auch sonst so aussah, als hätte sie einen Höcker. Carmen da Gama war Aires’ Cousine ersten Grades, verwaistes Kind von Epifanias Schwester Blimunda und einem kleinen Drucker namens Lobo. Beide Eltern waren von einer Malariaepidemie dahingerafft worden, und Carmens Heiratschancen waren bereits bei weniger als Null, ja, sogar weit unter dem Gefrierpunkt angelangt, als Aires seine Mutter mit der Ankündigung verblüffte, er werde einer Verbindung mit Carmen zustimmen. Epifania durchlitt eine Woche schlafloser Nächte, außerstande, die Entscheidung zu treffen zwischen ihrem Traum, für Aires einen Fisch zu finden, den zu angeln sich lohnte, und der ständig stärker werdenden, verzweifelten Notwendigkeit, Carmen unter die Haube zu bringen, bevor es zu spät war. Zum Schluß gewann die Verpflichtung gegenüber ihrer verstorbenen Schwester die Oberhand über die Hoffnungen für ihren Sohn.
Carmen wirkte zu keiner Zeit jung, hatte keine Kinder, und ihr größter Traum war es, Camoens’ Seite der Familie auf ehrliche oder auch nicht ganz so ehrliche Weise das Erbe abzuschwindeln. Sie erwähnte keiner Menschenseele gegenüber, daß ihr Ehemann in der Hochzeitsnacht das Schlafzimmer erst sehr spät betreten hatte, seine verängstigte, magere junge Frau, die jungfräulich-zitternd im Bett lag, einfach ignorierte, sich langsam und gewissenhaft entkleidete, um sodann seinen nackten Körper (in den Proportionen dem ihren ganz ähnlich) nicht weniger sorgfältig in das Brautkleid zu zwängen, das ihre Zofe als Symbol für die Vereinigung auf einer Schneiderpuppe zurückgelassen hatte, und den Raum durch die Außentür des Aborts zu verlassen. Carmen hörte unten auf dem Wasser einen Pfiff, und als sie sich, nur mit dem Bettlaken bekleidet, erhob, sah sie das Brautkleid im Mondschein glänzen, während sich die bleischwere Erkenntnis, welch eine Zukunft sie erwartete, auf ihre Schultern herabsenkte und sie für immer niederdrückte. Ein junger Mann ruderte mit der Robe und dem, der darin steckte, eilfertig davon, offenbar auf der Suche nach dem wie auch immer gearteten Ziel, das für diese obskuren Wesen die Seligkeit war.
Die Geschichte von Aires’ Brautkleid-Abenteuer, bei dem Großtante Sahara verlassen in den kalten Dünen ihrer unblutigen Laken zurückblieb, ist mir trotz ihres Schweigens zu Ohren gekommen. Die meisten normalen Familien können ihre Geheimnisse nicht bewahren; in unserem alles-andere-als-normalen Clan landen die tiefsten Mysterien gewöhnlich in Öl auf Leinwand an den Wänden einer Galerie ... Doch schließlich war der ganze Zwischenfall ja vielleicht auch einfach nur erfunden, eine Fabel, erdacht von der Familie, um zwar-zu-schockieren-aber-nicht-allzusehr, die Tatsache von Aires’ Homosexualität also ein wenig verdaulicher, weil exotischer, also ein wenig schöner zu machen! Denn obwohl es zutrifft, daß Aurora da Gama die Szene tatsächlich später malen sollte – auf ihrer Leinwand sitzt der Mann in dem mondbeschienenen Kleid sehr steif dem nackten Oberkörper eines schwitzenden Ruderers gegenüber –, könnte man möglicherweise einwenden, daß dieses Doppelporträt trotz all ihres Bemühens um das Bohemehafte doch nur eine domestizierende und einzig vom konventionellen Standpunkt aus empörende Phantasie gewesen war; daß die Story nämlich in ihrer erzählten und gemalten Version Aires’ geheime Perversität in ein hübsches Kleid verpackte, um den Schwanz, den Arsch, das Blut und das Sperma in der Geschichte zu verbergen, die tapfere, entschlossene Angst des zwergenhaften Dandys, der im Kreis der Hafenratten um wohlbestückte Gefährten buhlte, den exaltierten Schrecken erkaufter Umarmungen, die süßen Zärtlichkeiten der grobfäustigen Schauerleute in finsteren Gassen und üblen Kneipen, die Liebe zu den muskulösen Hinterbacken jugendlicher Rikschafahrer und den Mündern von unterernährten Basarkindern; daß sie die gereizte, streitsüchtige Amour-fou-Realität seiner langen, aber keineswegs treuen Liaison mit dem Burschen aus dem Hochzeitsnachtsboot, den Aires »Prinz Henry der Navigator« getauft hatte ... daß diese Version also die Wahrheit, angenehm erregend verkleidet, der Bühne verwies und anschließend den Blick abwandte.
No, Sir. Die Glaubwürdigkeit des Gemäldes wird nicht geleugnet. Was immer sonst zwischen diesen dreien geschehen sein mag – über die höchst ungewöhnliche Intimität zwischen Prinz Henry und Carmen da Gama an ihrem Lebensabend wird zu gegebener Zeit berichtet werden –, die Episode des gemeinsamen Brautkleides ist jedenfalls der Punkt, an dem alles begann.
Die Nacktheit unter dem entliehenen Brautkleid, das Gesicht des Bräutigams unter dem Brautschleier sind die Gründe, warum die Erinnerung an diesen seltsamen Mann so sehr mein Herz berührt. Es gibt vieles an Aires, das mir nicht gefällt; doch wenn ich mir sein Dasein als »Queen« vorstelle, in dem viele Leute zu Hause (und nicht nur zu Hause) lediglich Erniedrigung sehen würden, erkenne ich seine Courage und, jawohl, die Möglichkeit für ihn, zu Ruhm und Glorie zu gelangen.
»Und wenn’s kein Schwanz im Hintern war«, pflegte meine liebe Mutter, Erbin der furchtlosen Zunge ihrer Mutter, vom Leben mit ihrem ungeliebten Onkel Aires zu sagen, »dann, Liebling, war es mit Sicherheit ein Mühlstein am Hals.«
Da wir allmählich zur Sache kommen, zum Kern der ganzen Familienzwiste, der vorzeitigen Todesfälle und unglücklichen Lieben und wahnsinnigen Leidenschaften und schwachen Lungen, von Macht und Geld und der moralisch noch zweifelhafteren Verführungen und Mysterien der Kunst, wollen wir doch nicht vergessen, wer mit dem Ganzen angefangen hat, wer der erste war, der sein Element verließ und ertrank, durch wessen nassen Tod der Henkersschemel umgestoßen und der Grundstein entfernt wurde, so daß die Familie die schiefe Ebene hinabzugleiten begann (bis schließlich ich selbst in den Abgrund geschleudert wurde): Francisco da Gama, Epifanias dahingegangener Ehegatte.
Jawohl, auch Epifania war einstmals Braut gewesen. Sie kam aus einer alten, inzwischen weitgehend verarmten Handelsfamilie, dem Menezes-Clan von Mangalore, und der Neid war nicht gering, als sie nach einer zufälligen Begegnung auf einer Hochzeit in Calicut den fettesten Fang von allen landete – nach Meinung zahlreicher enttäuschter Mütter wider jede Logik, denn ein so reicher Mann hätte sich von den leeren Bankkonten, dem unechten Schmuck und der billigen Kleidung des heruntergekommenen Clans dieser kleinen Goldgräberin geziemend abgestoßen fühlen müssen. Als das neue Jahrhundert heraufdämmerte, kam sie an Urgroßvater Franciscos Arm nach Cabral Island, dem ersten der vier weltabgeschiedenen, schlangenverseuchten paradiesisch-infernalischen Privatuniversen meiner Geschichte. (Das zweite war der Salon meiner Mutter auf dem Malabar Hill, der Himmelsgarten meines Vaters das dritte; und Vasco Mirandas wunderliche Festung, seine »Kleine Alhambra« in Benengeli, Spanien, war, ist und wird mein letztes in dieser Erzählung sein.) Dort fand sie ein prachtvolles, altes Herrenhaus im traditionellen Stil vor, mit vielen wunderschön ineinander verschachtelten Gärten, grünlichen Teichen und vermoosten Springbrunnen, umrahmt von reich geschnitzten Holzgalerien, von denen ganze Labyrinthe weiterer Zimmer mit hohen, gegiebelten und geziegelten Dächern abzweigten. Es lag inmitten eines üppig wuchernden, tropischen Paradieses, wie es nur reiche Leute besitzen – genau das, was sie brauchte, fand Epifania, die ihre Jugend zwar in einer eher knauserigen Umgebung verbracht hatte, aber dennoch felsenfest von ihrem Talent überzeugt war, sich auf ein Leben auf großem Fuß zu verstehen.
Nun, ein paar Jahre nach der Geburt ihrer beiden Söhne kam Francisco da Gama eines Tages mit einem unglaublich jungen und verdächtig freundlichen Franzosen nach Hause, einem gewissen Charles-Edouard Jeanneret, der sich als architektonisches Genie ausgab, obwohl er kaum zwanzig Jahre alt war. Und ehe Epifania sich’s versah, hatte ihr gutgläubiger Ehemann diesen Bruder Leichtfuß beauftragt, in ihren kostbaren Gärten zwei neue Häuser zu errichten. Und was für verrückte Bauwerke das wurden! Das eine war ein seltsamer, eckiger Steinbau, von dessen Innenräumen der wuchernde Garten so gründlich Besitz ergriff, daß man oftmals nicht sagen konnte, ob man drinnen oder draußen war, und dessen Möbel aussahen, als seien sie für ein Krankenhaus oder den Geometrieunterricht gemacht, nie konnte man sich irgendwohin setzen, ohne sich an einer spitzen Ecke zu stoßen; das andere dagegen war ein Kartenhaus aus Holz und Papier – »im Stil der Japaner«, erklärte Francisco der entsetzten Epifania –, eine schwachbrüstige Feuerfalle, deren Wände aus Pergamentschiebetüren bestanden und in dessen Räumen man nicht sitzen, sondern knien sollte, während man in der Nacht mit dem Kopf auf einem Holzblock schlafen mußte, wie ein Dienstbote auf dem blanken Fußboden, mit nur einer Matte als Unterlage. Diese mangelnde Intimsphäre veranlaßte Epifania zu der Bemerkung, daß »es in einem Haus mit Toilettenpapier statt Badezimmerwänden wenigstens kein Problem darstellt, sich von der gesunden Verdauung der Haushaltsmitglieder zu überzeugen«.
Schlimmer noch: Epifania entdeckte schon bald, daß ihr Mann, als diese Irrenhäuser fertig waren, ihrer wunderschönen Villa immer öfter müde wurde. Er schlug dann mit der flachen Hand auf den Frühstückstisch und verkündete, man werde jetzt »gen Osten ziehen« oder »nach Westen wandern«, woraufhin der gesamten Familie nichts anderes übrigblieb, als mit Kind und Kegel in den einen oder anderen Pavillon des Franzosen umzuziehen, da nützten all ihre Proteste auch nicht ein Jota. Nach ein paar Wochen zogen sie dann wieder um.
Francisco da Gama war nicht nur unfähig, ein ruhiges Leben zu führen wie normale Menschen, sondern war darüber hinaus, wie Epifania verzweifelt feststellen mußte, ein Kunstmäzen. Rum-und-Whisky-saufende, hanfkonsumierende Personen niederer Geburt und mit abstoßendem Kleidungsgeschmack wurden zu längeren Aufenthalten eingeladen und füllten die Pavillons des Franzosen mit ihrer schrillen Musik, ihren Lyrikmarathons, ihren Partys mit Nacktmodellen, Marihuana Orgien, nächtelangen Kartenturnieren und anderen Manifestationen ihres in-jeder-Hinsicht-inkorrekten Verhaltens. Ausländische Künstler kamen und hinterließen seltsame Mobiles, die aussahen wie gigantische, sich in der Brise drehende Kleiderbügel, sowie Bilder von Teufelsweibern mit beiden Augen auf derselben Seite der Nase und riesige Leinwände, die aussahen, als wäre mit der Farbe ein Unfall passiert, und all diese Katastrophen mußte Epifania an die Wände ihres geliebten Heims hängen oder in ihren Gärten aufstellen und tagtäglich ansehen, als sei es richtige anständige Kunst.
»Dein Kunst-Schunst, Francisco«, sagte sie giftig zu ihrem Ehemann, »wird mich mit seiner Häßlichkeit noch blindofizieren.« Aber er war immun gegen ihr Gift. »Alte Schönheit reicht eben nicht«, erklärte er ihr. »Alte Paläste, alte Sitten, alte Götter. Heutzutage ist die Welt voller Fragen, und es gibt ganz neue Möglichkeiten, schön zu sein.«
Vom Tag seiner Geburt an war Francisco aus dem Holz, aus dem Helden geschnitzt sind, ein Mann, der auf Kreuzzug geht, stattzu Kreuze zu kriechen, für Häuslichkeit so wenig geschaffen wie Don Quijote. Er war schön wie die Sünde, aber doppelt so tugendhaft und erwies sich auf den Kokosmatten der Cricketplätze jener Zeit in seiner Jugend als teuflisch langsamer, linkshändiger Werfer und eleganter vierter Schläger. Im College war er der brillanteste Physikstudent seines Jahrgangs, wurde aber frühzeitig zur Waise und entschied sich nach langem Überlegen dafür, auf ein akademisches Leben zu verzichten und statt dessen seiner Pflicht nachzukommen und ins Familiengeschäft einzusteigen. Schon als junger Mann wurde er zum gelehrigen Adepten jener uralten Kunst der da Gamas, Gewürze und Nüsse in Gold zu verwandeln. Er konnte das Geld im Wind riechen, konnte das Wetter erschnuppern und erkennen, ob es Gewinn oder Verlust bringen würde; darüber hinaus war er aber auch ein Philanthrop, gründete Waisenhäuser, eröffnete kostenlose Ambulanzen für die Armen, baute Schulen für die Dörfer entlang der toten Wasserläufe, richtete Institute zur Erforschung der Kokospalmentrockenfäule ein, initiierte Elefantenschutzprogramme in den Bergen hinter seinen Gewürzfeldern und zeichnete die besten Geschichtenerzähler der Region mit Preisen aus: So freizügig war er in seiner Philanthropie, daß Epifania (vergebens) klagte: »Und wenn das Geld verplemperifiziert ist und die Kinder mit dem Hut in der Hand betteln gehen müssen? Was essen wir dann – etwa dieses Ding da, diese Anthropologie?«
Sie kämpfte um jeden Zentimeter mit ihm und verlor jede einzelne Schlacht, bis auf die letzte. Francisco, der Modernist, wurde, den Blick fest auf die Zukunft gerichtet, ein Anhänger erst Bertrand Russells – Religion and Science sowie A Free Man’s Worship waren seine gottlosen Bibeln – und dann der immer fanatischer nationalistischen Politik der Theosophical Society von Mrs. Annie Besant. Erinnern wir uns: Cochin, Travancore, Mysore und Hyderabad waren, technisch gesehen, kein Teil von Britisch-Indien, sondern indische Staaten mit eigenen Fürsten. Einige von ihnen – wie Cochin – waren zum Beispiel stolz auf ihr schulisches und literarisches Niveau, das jenes unter direkter britischer Herrschaft weit übertraf, während es in anderen (Hyderabad) etwas gab, das Mr. Nehru als »perfekten Feudalismus« bezeichnete, und in Travancore wurde sogar der Kongreß für illegal erklärt. Aber wir wollen den Schein nicht mit der Wirklichkeit verwechseln (Francisco tat es nicht); das Feigenblatt ist nicht die Feige. Als Nehru die Landesflagge in Mysore aufzog, zerstörten die einheimischen (indischen) Behörden, kaum daß Nehru die Stadt verlassen hatte, nicht nur die Fahne, sondern auch den Fahnenmast, um nur ja nicht die wahren Herrscher zu verärgern ... Kurz nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs, an seinem achtunddreißigsten Geburtstag, zerbrach etwas in Francisco.
»Die Briten müssen gehen«, verkündete er beim Dinner unter den Olporträts seiner gestiefelten und gespornten Vorfahren.
»O Gott, wo wollen sie denn hin?« fragte Epifania, die nicht gleich begriff, was er meinte. »Wollen sie uns in einer so schlimmen Situation unserem Schicksal und diesem Ungeheuer, Kaiser Bill, ausliefern?«
Da explodierte Francisco, und der zwölfjährige Aires wie auch der elfjährige Camoens erstarrten auf ihren Stühlen. »Dieser Kaiser Bill ist eine Unbill«, donnerte er, »und wir müssen dafür bezahlen: Doppelte Steuern! Unsere jungen Männer sterben in britischen Uniformen! Der Reichtum des Landes wird exportiert, Madam. Hier zu Hause verhungern die Menschen, aber der britische Tommy lebt von unseren Produkten, von Weizen, Reis, Jute und Kokos. Von mir persönlich verlangt man, Waren unter dem Selbstkostenpreis zu verschiffen. Unsere Bergwerke werden ausgebeutet: Salpeter, Magnesium, Glimmer. Verdammt! Die Bombay-Wallahs werden reich, und das Land geht vor die Hunde!«
»Dieses ganze Spintisieren und Politisieren hat dir das Hirn vernebelt«, protestierte Epifania. »Was sind wir denn, wenn nicht die Kinder des Empire? Alles haben die Briten uns gegeben – oder? Zivilisation, Recht, Ordnung, viel zuviel. Selbst deine Gewürze, die unser Haus vollstinken, kaufen sie aus lauter Großzügigkeit und sorgen so dafür, daß unsere Kinder etwas zum Anziehen haben und daß ihre Teller voll sind. Warum also redifizierst du wie ein Verräter und vergiftest die Ohren unserer Kinder mit solch gottlosem Unsinn?«
Von diesem Tag an hatten sie einander nicht mehr viel zu sagen. Aires wandte sich gegen den Vater und ergriff die Partei der Mutter; die beiden waren für England, Gott, Philistertum, die althergebrachte Lebensart und ein ruhiges Dasein. Um Francisco, der ein wahres Energiebündel war, Kontra zu geben, trug Aires bewußt Indolenz zur Schau und lernte seinen Vater durch einen genüßlichen, unbekümmerten Schlendrian in Wut zu versetzen. (In meiner Jugend neigte ich – aus anderen Gründen – ebenfalls zum Schlendrian. Aber ich wollte damit niemanden verletzen; meine Absichtwar es, mit meiner Gemächlichkeit gegen die zunehmende Hast der Zeit selbst Protest zu erheben. Auch auf diese Phase werden wir an gebotener Stelle zurückkommen.)
Einen Verbündeten fand Francisco dagegen in seinem jüngeren Sohn Camoens, dem er die Tugenden des Nationalismus, der Vernunft, der Kunst, des Fortschritts und, das war in jenen Tagen die größte Tugend überhaupt, des Protests einprägte. Francisco teilte Nehrus anfängliche Verachtung für den indischen Nationalkongreß – »nichts weiter als eine Quasselbude für Wogs« wetterte er –, und Camoens stimmte ihm todernst zu. »Annie dies und Gandhi das«, schalt ihn die Mutter. »Nehru, Tilak, all diese schurkischen Gangster aus dem Norden. Hör nicht auf deine Mutter! Mach weiter so! Dann heißt es bald, ab ins Gefängnis mit dir, chop-chop!«
Im Jahre 1916 schloß sich Francisco da Gama der Home-Rule-Kampagne von Annie Besant und Bal Gangadhar Tilak an und machte sich für die Forderung nach einem unabhängigen indischen Parlament stark, das über die Zukunft des Landes entscheiden sollte. Als Mrs. Besant ihn bat, in Cochin eine Home Rule League zu gründen, und er die Kühnheit hatte, nicht nur die einheimische Bourgeoisie, sondern auch Hafenarbeiter, Teepflücker, Basar-Kulis und seine eigenen Arbeiter zum Beitritt aufzufordern, geriet Epifania außer sich. »Massen und Klassen im selben Club! Schimpf, Schande und Skandal! Der Mann hat den Verstand verloren«, schalt sie, einer Ohnmacht nahe und sich wild Luft zufächelnd, dann versank sie in verdrossenem Schweigen.
Ein paar Tage nach Gründung der Liga gab es einen Krawall auf den Straßen des Hafenbezirks von Ernakulam; einigen Dutzend militanten Ligisten gelang es, ein kleines Detachement leichtbewaffneter Truppen zu überwältigen und sie, ihrer Waffen beraubt, in die Flucht zu schlagen. Am Tag darauf wurde die Liga offiziell verboten, und auf Cabral Island landete eine Barkasse, um Francisco da Gama zu arretieren.
Im Verlauf der folgenden sechs Monate wurde er immer wieder in Haft genommen, was ihm die Verachtung seines älteren und die grenzenlose Bewunderung seines jüngeren Sohnes eintrug. Jawohl, ein Held, ganz zweifellos. Während der Phasen im Gefängnis und seines furiosen politischen Aktivismus zwischen den Haftstrafen, als er, Tilaks Anweisungen befolgend, bei zahllosen Gelegenheiten bewußt seine Festnahme herausforderte, erwarb er jene Eigenschaften, die ihn zum Mann der Stunde machten, einem Mann, den man im Auge behalten mußte, einem Burschen mit vielen Anhängern: einem Star.
Stars können abstürzen; Helden können abstürzen; Francisco da Gama gelang es nicht, seine Bestimmung zu erfüllen.
Im Gefängnis hatte er Zeit für jene Arbeit, die seinen Untergang einleitete. Niemand hat je ergründet, in welchem Ramschladen für Ausschußwaren des Verstandes Urgroßvater Francisco sich die wissenschaftliche Theorie holte, die ihn, den aufsteigenden Helden, zur Witzfigur der ganzen Nation machen sollte, aber in jenen Jahren beschäftigten ihn diese Ideen immer stärker, bis sie schließlich sogar mit der nationalistischen Bewegung um seine Sympathie konkurrierten. Vielleicht vermischte sich sein altes Interesse für theoretische Physik mit seinen neueren Leidenschaften, mit Mrs. Besants Theosophie, mit der Erklärung des Mahatma über die Einheit der höchst unterschiedlichen Millionen Indiens, mit der Suche indischer Intellektueller jener Zeit nach einer säkularisierten Definition des geistigen Lebens, jenes abgedroschenen Begriffs, der Seele; wie dem auch sei, gegen Ende des Jahres 1916 ließ Francisco privat eine Abhandlung drucken, die er sodann an alle führenden Zeitschriften jener Zeit »zur freundlichen Beachtung« versandte, einen Artikel mit dem Titel: »Für eine vorläufige Theorie der Transformationsfelder des Bewußtseins«, in dem er die Existenz eines unsichtbaren »dynamischen Netzes geistiger Energie« um uns herum postulierte, »ganz ähnlich den elektromagnetischen Feldern«, und behauptete, daß diese »Bewußtseinsfelder« nichts anderes seien als die Repositorien der – praktischen und moralischen – Erinnerung der menschlichen Spezies, ja, daß sie genau das seien, was James Joyce jüngst seinem Helden Stephen in den Mund gelegt hatte: daß er nämlich in der Schmiede seiner Seele das unerschaffene Gewissen unserer Rasse »prägen« wolle.
Auf ihrer untersten Wirkungsebene erleichterten diese Transformationsfelder des Bewußtseins, kurz TFBs, anscheinend die Ausbildung, so daß alles, was von irgend jemandem irgendwo auf der Erde gelernt wurde, sogleich überall für alle anderen leichter erlernbar wurde; aber es wurde auch angedeutet, daß diese Felder auf ihrer höchsten Ebene, der Ebene, die zugegebenermaßen am schwierigsten zu beobachten war, ethisch wirkten, das heißt, daß sie unsere moralischen Alternativen nicht nur definierten, sondern von ihnen auch definiert wurden, daß sie von jeder moralischen Entscheidung auf unserem Planeten gestärkt und, andererseits, von bösen Handlungen geschwächt wurden, so daß zu viele Missetaten die Gewissensfelder theoretisch irreparabel schädigen mußten und »die Menschheit dann vor der unvorstellbaren Realität eines durch die Zerstörung des ethischen Nexus – des Sicherheitsnetzes, könnte man sogar sagen, in dem wir immer gelebt haben – amoralisch und damit bedeutungslos gewordenen Universums stehen würde«.
Tatsächlich vertrat Francisco in seiner Abhandlung lediglich die untersten, die bildungsbezogenen Funktionen der Felder mit einiger Überzeugung, die moralischen Dimensionen extrapolierte er nur in einer einzigen, relativ kurzen und eingestandenermaßen spekulativen Passage. Dennoch löste sie Hohn und Spott in einem gigantischen Ausmaß aus. Ein Leitartikel der in Madras beheimateten Zeitung The Hindu, mit der Überschrift »Donnerschläge von Gut und Böse«, putzte ihn gnadenlos herunter: »Dr. da Gamas Ängste um unsere ethische Zukunft gleichen denen eines verrückten Meteorologen, der glaubt, daß unsere Handlungen das Wetter bestimmen und daß, wenn wir nicht sozusagen ›himmlisch‹ handeln, von oben nichts anderes kommt als Unwetter.« Der satirische Kolumnist »Waspyjee« im Bombay Chronicle, dessen Chefredakteur Horniman, ein Freund von Mrs. Besant und der nationalistischen Bewegung, Francisco eindringlich gebeten hatte, seinen Artikel nicht zu veröffentlichen, erkundigte sich boshaft, ob die berühmten Bewußtseinsfelder den Menschen vorbehalten seien oder ob andere Lebewesen – Küchenschaben, zum Beispiel, oder Giftschlangen – ebenfalls lernen könnten, davon zu profitieren; oder ob, andererseits, jede Spezies ihre eigenen Felder habe, die um den Planeten wirbelten. »Sollten wir etwa durch zufällige Feldkollisionen eine Verschmutzung unserer Werte – nennen wir sie Gama-Strahlung – befürchten müssen? Könnten die Sexualgewohnheiten der Gottesanbeterin, die Ästhetik der Paviane oder Gorillas, die Politik der Skorpione unsere eigene, arme Psyche eventuell tödlich infizieren? Oder, Gott behüte, haben sie das vielleicht schon getan?«
Es waren diese »Gama-Strahlen«, die Francisco den Garaus machten; er wurde zur Witzfigur, zur willkommenen Ablenkung von einem mörderischen Krieg, von wirtschaftlicher Not und dem Kampf um Unabhängigkeit. Anfangs ließ er sich nicht entmutigen und konzentrierte sich stur darauf, sich Experimente auszudenken, die seine erste, weniger wichtige Hypothese beweisen konnten. Er schrieb eine zweite Abhandlung, in der er behauptete, daß sich die langen Reihen sinnloser Wörter, die Bharat-Natyam-Lehrer benutzten, um Tänze einzustudieren, als Grundlage für Tests eigneten. Eine dieser Sequenzen (tat-tat-taa dreegay-thun-thun jee-jee-kathay to, talang, taka-thun-thun, tai! Tat tai!) könne neben vier weiteren Reihen sinnloser Wörter benutzt und im selben Rhythmus gesprochen werden wie die »Kontrollsequenz«. Studenten in einem anderen Land, die keine Ahnung von indischer Tanzlehre hätten, würde man auffordern, alle fünf auswendig zu lernen; und wenn Franciscos Feldtheorie zutraf, würde es ihnen dann ein leichtes sein, das Tanzunterricht-Kauderwelsch zu erlernen.
Der Test wurde niemals durchgeführt. Schon bald forderte man Franciscos Austritt aus der verbotenen Home Rule League, und ihre Führer, zu denen nun auch Motilal Nehru persönlich zählte, hörten auf, die immer kläglicheren Briefe zu beantworten, mit denen mein Urgroßvater sie bombardierte. Keine Künstlergestalten trafen mehr in ganzen Bootsladungen ein, um sich in einem der Pavillons von Cabral Island zu amüsieren, entweder im papierenen Osten Opium zu rauchen oder im kantigen Westen Whisky zu trinken, obwohl Francisco von Zeit zu Zeit, als der Ruhm des Franzosen stetig wuchs, gefragt wurde, ob er tatsächlich der erste indische Mäzen des jungen Mannes gewesen sei, der sich inzwischen Le Corbusier nannte. Jedesmal, wenn er eine derartige Anfrage erhielt, ließ der gestürzte Held eine kurzgefaßte Antwort vom Stapel: »Nie von dem Kerl gehört.« Nach einiger Zeit hörten auch diese Anfragen auf.
Epifania triumphierte. Während Francisco sich in sich selbst verkroch und sein Gesicht jenen verkniffenen Ausdruck annahm, wie er Männern eigen ist, die überzeugt sind, daß die Welt ihnen unerklärlicherweise ein großes und nicht verdientes Unrecht zugefügt hat, setzte sie unverzüglich zum Todesstoß an. (Wie sich herausstellte, buchstäblich.) Ich bin zu der Schlußfolgerung gelangt, daß sich in den Jahren, während denen sie ihre Unzufriedenheit unterdrückte, ein rachsüchtiger Zorn in ihr aufgestaut hatte – Zorn, mein wahres Erbe! –, der oft von echtem, mörderischem Haß nicht mehr zu unterscheiden war; dabeiwäre sie, hätte man sie je gefragt, ob sie ihren Ehemann liebe, über die Frage allein schon schockiert gewesen. »Wir haben einzig und allein aus Liebe geheiratet«, erklärte sie ihrem niedergeschlagenen Gatten im Verlauf eines endlosen Inselabends, bei dem nur das Radio ihnen Gesellschaft leistete. »Warum hätte ich dir ständig deinen Willen gelassen, wenn nicht aus Liebe? Aber du siehst ja, wohin dich das geführt hat. Jetzt mußt du mir aus Liebe den meinen lassen.«
Die verhaßten Pavillons im Garten wurden verschlossen. Und nie wieder durfte in Epifanias Gegenwart von Politik gesprochen werden: Als die russische Revolution die Welt erschütterte, als der Erste Weltkrieg endete, als die Nachricht über das Amritsar-Massaker vom Norden her durchsickerte und den Indern die fast überall vorherrschende anglophile Einstellung gründlich austrieb (der Nobelpreisträger Rabindranath Tagore gab dem König sogar die ihm verliehene Ritterwürde zurück), verstopfte sich Epifania da Gama auf Cabral Island die Ohren und fuhr in einem Maß, das fast an Blasphemie grenzte, fort, an die allmächtige Güte der Briten zu glauben; und ihr älterer Sohn Aires glaubte genauso fest daran wie sie.
Zu Weihnachten 1921 brachte Camoens, damals achtzehn, schüchtern die siebzehnjährige Waise Isabella Ximena Souza mit nach Hause, um sie seinen Eltern vorzustellen. (Als Epifania sich erkundigte, wo sie sich kennengelernt hätten, erzählten sie ihr unter ständigem Erröten von einer kurzen Begegnung in der St. Francis’ Church, und sie zischte mit einer Verachtung, die ihrer unvergleichlichen Fähigkeit entsprang, alles Unbequeme betreffs ihrer eigenen Herkunft zu vergessen, höhnisch: »Rumtreiberin aus dem Nichts und Nirgends!« Aber Francisco gab dem jungen Mädchen seinen Segen, streckte an der ehrlich-gesagt-nicht-allzu-festlichen Tafel eine müde Hand aus und legte sie auf Isabella Souzas hübschen Kopf.) Charakteristisch für Camoens’ zukünftige Ehefrau war ihre ausgesprochene Freimütigkeit. Mit vor Erregung funkelnden Augen brach sie Epifanias fünf Jahre altes Tabu, um ihrer Freude über den aktiven Boykott Calcuttas und die zahlreichen Demonstrationen in Bombay gegen den Besuch des Prince of Wales (des zukünftigen Edward VIII.) Ausdruck zu verleihen und die Nehrus, Vater und Sohn, für ihre Kooperationsverweigerung vor Gericht zu loben, wegen der sie beide im Gefängnis gelandet waren. »Jetzt weiß der Vizekönig wenigstens, was los ist«, verkündete sie. »Motilal liebt England, aber selbst er hat es vorgezogen, sich einsperren zu lassen.«
Auf einmal kam Bewegung in Francisco; ein altes Leuchten glimmte in seinen längst stumpf gewordenen Augen auf. Aber Epifania kam ihm zuvor. »In diesem gottesfürchtigen Christenhaus ist alles Britische noch immer das Beste, Maddermoyzelle«, fuhr sie auf. »Wenn du Absichten auf unseren Jungen hast, dann hütifiziere bitte deine Zunge! Willst du dunkles oder helles Fleisch? Sag’s frei heraus! Ein Glas importierten Dao-Wein, schön kalt? Kannst du haben. Pudding-Shudding? Warum nicht? Das sind unsere Weihnachtsthemen, mein Frowline. Magst du Füllung?«
Später, am Landungssteg, hielt Belle ebensowenig hinterm Berg und beschwerte sich bitter bei Camoens, daß er sich nicht für sie stark gemacht habe. »Dein Elternhaus ist wie ein Ort, der im Nebel versunken ist«, sagte sie zu ihrem Verlobten. »Wo gibt es hier Luft zum Atmen? Irgend jemand da drinnen hat einen Fluch ausgesprochen und saugt das Leben aus dir und deinem armen Dad. Und was deinen Bruder angeht – wen kümmert’s, der arme Kerl ist ein hoffnungsloser Fall. Du kannst mich hassen oder nicht, aber es ist so klar wie die Farben auf deinem übrigens-entschuldige-bitte-furchtbar-schrecklichen Buschhemd, daß sich hier sehr schnell etwas Schlimmes zusammenbraut.«
»Dann wirst du also nicht wiederkommen?« fragte Camoens sie unglücklich.
Belle stieg in das wartende Boot. »Dummkopf«, schalt sie. »Du bist ein lieber, rührender Junge. Aber du hast nicht die geringste Ahnung davon, was ich für die Liebe tun werde und was nicht, wohin ich kommen werde oder nicht, mit wem ich mich streiten werde oder nicht, und wessen Magie ich mit der meinen entmagisieren werde.«
In den folgenden Monaten war es Belle, die Camoens über die Weltläufte auf dem laufenden hielt, die ihm Nehrus Ansprache vom Mai 1922 anläßlich seiner Verurteilung zu einer weiteren Haftstrafe im exakten Wortlaut wiederholte. Einschüchterung und Terror sind zum Hauptinstrument dieser Regierung geworden. Glauben die Herrschaften, auf diese Weise unsere Zuneigung zu ihnen wecken zu können? Zuneigung und Loyalität sind eine Sache des Herzens. Man kann sie nicht mit aufgepflanztem Bajonett einfordern. »Klingt für mich wie die Ehe deiner Eltern«, erklärte Isabella fröhlich; und Camoens, dessen nationalistischer Eifer durch seine Liebe zu diesem schönen, großmäuligen Mädchen angefacht wurde, besaß den Anstand zu erröten.
Belle hatte sich seine Rettung aufs Panier geschrieben. In jenen Tagen hatte er nämlich begonnen, sehr schlecht zu schlafen und asthmatisch zu keuchen. »Das kommt von all dieser üblen Luft«, erklärte sie ihm. »Wenigstens einen da Gama muß ich vor dem Untergang bewahren.«
Sie ordnete Veränderungen an. Auf ihren Befehl – und zu Epifanias Zorn: »Glaub bloß nicht auch nur für zwei Sekunden, daß ich in diesem Haus kein Huhn mehr servieren werde, nur weil dein kleines Hühnchen, dieses kleine Flittchen-Malittchen, Bettlerfraß essen will« – wurde er zum Vegetarier und lernte, auf dem Kopf zu stehen. Außerdem zerbrach er heimlich eine Fensterscheibe, kletterte in das spinnwebverzierte Westhaus, wo die Bibliothek seines Vaters dahindämmerte, und begann die Bücher mitsamt den Bücherwürmern zu verschlingen. Attar, Khayyam, Tagore, Carlyle, Ruskin, Wells, Poe, Shelley, Raja Rammohun Roy. »Siehst du?« ermunterte ihn Belle. »Du kannst es doch. Auch du kannst dich zu einem Menschen entwickeln, statt ein Fußabtreter in einem potthäßlichen Hemd zu sein.«
Francisco rettete das allerdings nicht. Eines Abends nach dem Regen verließ er die Insel und schwamm davon; vielleicht wollte er jenseits der verhexten Grenzen der Insel ein bißchen frische Luft schnappen. Die Gezeitenströmung riß ihn hinaus; fünf Tage später fanden sie seinen aufgedunsenen Leichnam, der von den Wellen gegen eine rostige Hafenboje geworfen wurde. Eigentlich hätte man ihn wegen seines Anteils an der Revolution, seiner guten Taten, seiner Fortschrittlichkeit und seines Verstandes in Erinnerung behalten sollen, was aber die Familie tatsächlich von ihm erbte, waren Probleme in der Firma (die er in den letzten Jahren sträflich vernachlässigt hatte), das Phänomen plötzlichen Todes und das Asthma.
Epifania schluckte die Nachricht von seinem Tod ohne den geringsten Anflug eines Zitterns. Sie verschlang seinen Tod, wie sie sein Leben verschlungen hatte; und wuchs daran.
3
Direkt neben dem Absatz der breiten, steilen Treppe, die zu Epifanias Schlafzimmer führte, lag die Privatkapelle der Familie. Francisco hatte sie in den alten Zeiten trotz Epifanias heftigem Protest von einem seiner Franzosen umgestalten lassen. Verschwunden war das vergoldete Altarstück mit den kleinen, eingelassenen Gemälden, auf denen Jesus vor einem Hintergrund aus Kokospalmen und Teeplantagen seine Wunder wirkte, ebenso wie die kleinen, goldenen Cherubim, die auf Teakholzpodesten posierten und in ihre Trompeten stießen, die Kerzen in den Glasschalen, die wie riesige Brandy-Schwenker aussahen, die importierten portugiesischen Spitzen auf dem Altar und sogar das Kruzifix selbst, »alles Sachen von Wert«, hatte Epifania geklagt, »Zusammen mit Jesus und Maria einsperrifiziert in der Rumpelkammer.« Und als wäre er mit diesen Entweihungen immer noch nicht zufrieden, hatte der verdammte Kerl den ganzen Raum so blendend weiß gestrichen wie einen Krankensaal, ihn mit den unbequemsten Holzbänken von ganz Cochin möbliert und in diesem fensterlosen Innenraum dann riesige, aus Papier geschnittene Fenster an die Wände geklebt, Imitationen von Buntglasscheiben, »als könnten wir uns keine richtigen Fenster leisten, wenn wir das wollten«, stöhnte Epifania. »Seht euch das an, wie armselig wir dastehen, Papierfenster im Hause Gottes!« Und auf den Fenstern waren nicht mal anständige Bilder, sondern einfach nur Farbkleckse. »Wie die Dekorationen bei einer Kinderparty«, schniefte Epifania. »In einem solchen Raum sollte man nicht Blut und Fleisch unseres Heilands aufbewahren, sondern höchstens eine Geburtstagstorte.«
Um das Werk seines Schützlings zu verteidigen, hatte Francisco entgegnet, daß in diesem Raum Form und Farbe nicht nur die Stelle des Inhalts einnähmen, sondern auch demonstrierten, daß sie, richtig eingesetzt, tatsächlich Inhalt sein könnten, womit er Epifanias verächtliche Entgegnung herausforderte: »Dann brauchen wir ja vielleicht Jesus Christus gar nicht, denn wenn schon die Form des Kreuzes genügt, warum sich erst um eine Kreuzigung bemühen, stimmt’s? Welch eine Blasphemie dein Frenchy-Freund da fertiggebracht hat: eine Kirche, die den Sohn Gottes davon befreit, für unsere Sünden zu sterbifizieren!«
Am Tag nach der Beerdigung ihres Mannes ließ Epifania alles verbrennen, und schon waren sie wieder da, die Cherubim, die Spitzen und Gläser, die dick gepolsterten, mit roter Seide bezogenen Betstühle und die dazu passenden, mit Goldkordel eingefaßten Kissen, auf denen eine Dame von Epifanias gesellschaftlicher Stellung mit Anstand vor dem Herrn niederknien konnte. Alte Gobelins aus Italien mit der Darstellung wie Kebab aufgespießter Heiliger und tandoorigegrillter Märtyrer kehrten an die Wände zurück, umgeben von gerüschten und gerafften Draperien, und sehr bald war die beunruhigende Erinnerung an die strengen Innovationen des Franzosen von der gewohnten muffigen Frömmigkeit verdrängt worden. »Gott ist in seinem Himmel«, verkündete die frischgebackene Witwe. »Alleswieder tipptopp auf der Welt.«
»Von nun an«, entschied Epifania, »führifizieren wir ein einfaches Leben. Das Heil liegt nicht in dem kleinen Mann mit dem Lendenschurz nebst Konsorten.« Und die Einfachheit, die sie suchte, war in der Tat alles andere als gandhianisch. Ihr einfaches Leben sah so aus, daß sie erst spät erwachte, ein Tablett mit süßem Morgentee vorfand, in die Hände klatschte, um die Köchin zu rufen und die Mahlzeiten des Tages mit ihr zu besprechen, eine Zofe hereinbefahl, die sie eincremte und ihr die noch immer langen, aber schnell ergrauenden und sich lichtenden Haare bürstete, nur um diese Zofe dann dafür verantwortlich zu machen, daß an jedem Morgen mehr Haare in der Bürste zurückblieben; es war das einfache Leben der langen Vormittage, zu nichts anderem da, als den Schneider zu beschimpfen, wenn er mit neuen Roben ins Haus kam und mit Nadeln im Mund vor ihr kniete, welche er von Zeit zu Zeit herausnahm, um seine Schmeichlerzunge zu lösen; und anschließend der langen Nachmittage in den Tuchlagern, wo Ballen wundervoller Seidenstoffe auf dem mit weißen Tüchern belegten Boden vor ihr ausgebreitet wurden, wo Stoffbahn um Stoffbahn nur zu Epifanias Vergnügen durch die Luft flog, um sanfte Faltenberge von glanzvoller Schönheit zu bilden; es war das einfache Leben des müßigen Abendgeplauders mit den wenigen gesellschaftlich ihr Gleichgestellten und der Einladungen zu den »Festlichkeiten« der Briten im Fort-Distrikt, ihren sonntäglichen Crikketspielen, ihren Tanztees, dem weihnachtlichen Chorsingen ihrer wenig schönen, hitzegeplagten Kinder, denn schließlich waren sie ja Christen, und obwohl es sich nur um die Kirche von England handelte, egal, die Briten hatten Epifanias Respekt, wenn sie auch niemals ihr Herz haben würden, das natürlich für Portugal schlug, denn insgeheim träumte sie davon, eines Tages am Tejo, am Douro zu flanieren, am Arm eines Granden durch Lissabons Straßen zu paradieren. Es war das einfache Leben der Schwiegertöchter, die sich um fast alle Bedürfnisse Epifanias kümmerten, während sie ihnen das Leben zur Hölle machte, und der Söhne, die den Geldstrom weiter so frei fließen ließen, wie es von ihnen verlangt wurde; und es war die Tatsache, daß alles-an-seinem-Platz-blieb, daß sie endlich im Mittelpunkt des Netzes, auf der Spitze des Berges, wie ein Drache auf einem Haufen von Gold sitzen und, wann immer sie wollte, einen Schwall reinigender, entsetzenerregender Flammen ausstoßen konnte. »Es wird uns ein Vermögen kosten, deiner Mama ihr einfaches Leben zu finanzieren«, beschwerte sich Belle da Gama bei ihrem Mann (sie hatte Camoens Anfang 1923 geheiratet) und nahm damit eine Bemerkung vorweg, die später häufig im Zusammenhang mit M. K. Gandhi gemacht wurde. »Und wenn sie ihren Willen durchsetzt, wird uns das auch noch unsere Jugend kosten.«
Was Epifanias Träume zunichte machte: Francisco hinterließ ihr nichts als ihre Kleider, ihren Schmuck und eine bescheidene Apanage. Mit allem anderen würde sie, wie sie zu ihrem Zorn erfuhr, vom guten Willen ihrer Söhne abhängig sein, denen alles zu gleichen Teilen vermacht worden war – unter der Bedingung, daß die Gama Trading Company nicht aufgeteilt wurde, »es sei denn, die Geschäftslage erfordert es«, und daß Aires und Camoens versuchten, »liebevoll zusammenzuarbeiten, damit das Familienvermögen nicht durch Disharmonie oder Zwietracht geschädigt werde«.
»Selbst nach dem Tod«, jammerte Urgroßmutter Epifania bei der Verlesung des Letzten Willens, »schlägt er mich auf beide Wangen.«
Aber auch das ist Teil meines Erbes: Das Grab beendet keinen Streit.
Zur Verzweiflung der Witwe fanden die Anwälte der Familie Menezes kein einziges Schlupfloch. Epifania weinte, raufte sich die Haare, schlug sich an den winzigen Busen und knirschte mit den Zähnen, wobei ein erschreckend durchdringendes Geräusch entstand; aber die Anwälte wurden nicht müde ihr zu erklären, daß das matrilineare Prinzip, für das Cochin, Travancore und Quilon berühmt waren und nach dem das Verfügungsrecht über den Familienbesitz bei Madame Epifania gelegen hätte und nicht bei dem verstorbenen Dr. da Gama, beim besten Willen nicht auf die christliche Gemeinde angewandt werden könne, da es ausschließlich Teil der Hindu-Tradition sei.
»Dann bringt mir sofort ein Schiwa-Lingam und eine Gießkanne! « soll Epifania der Legende nach gesagt haben, obwohl sie es später leugnete. »Bringt mich zum Ganges, und ich werde unverzüglich hineinspringen. Hai Ram!«
(Ich sollte erwähnen, daß Epifanias Bereitschaft, Puja zu verrichten und eine Pilgerfahrt zu machen, für mich keineswegs überzeugend, ja, unglaubwürdig klang; daß es aber Wehklagen, Zähneknirschen, Haareraufen und Busenschlagen gab, ist wohl unstrittig.)
Die Söhne des verstorbenen Magnaten vernachlässigten die Geschäfte, wie man zugeben muß, und zwar deshalb, weil sie sich allzuoft von weltlichen Problemen ablenken ließen. Aires da Gama, über den Selbstmord seines Vaters bekümmerter, als er zugeben wollte, suchte Trost in der Promiskuität und löste damit eine Flut von Zuschriften aus – Briefe auf billigem Papier, verfaßt in einer kaum lesbaren, nur halbwegs erlernten Schrift. Liebesbriefe, Beteuerungen von Sehnsucht und Zorn, Androhungen von Gewalt, falls der Geliebte nicht von seinen allzu verletzenden Gewohnheiten ablasse. Der Autor dieser angstgetriebenen Mitteilungen war kein anderer als der junge Mann im Hochzeitsnachtsruderboot. Prinz Henry der Navigator persönlich. Glaube nicht, daß ich nicht von allem erfahre, was Du tust. Schenk mir Dein Herz, oder ich schneide es Dir aus dem Leib. Wenn die Liebe nicht die ganze Welt und der Himmel darüber ist, dann ist sie nichts, ist sie schlimmer als Dreck.
Wenn die Liebe nicht alles ist, dann ist sie nichts: Dieser Grundsatz und sein Gegenteil (ich meine die Treulosigkeit) werden in den gesamten Jahren dieser meiner atemlosen Erzählung miteinander kollidieren.
Aires, die ganze Nacht wie ein verliebter Kater auf Pirsch, verbrachte die Stunden des Tages weitgehend damit, die Nachwirkungen von Haschisch oder Opium auszuschlafen und sich von seinen Ausschweifungen zu erholen, außerdem bedurfte er nicht selten der Versorgung seiner zahlreichen kleinen Wunden. Carmen verabreichte ihm wortlos Arzneien und heiße Bäder, um die Schmerzen seiner Blessuren zu lindern; und falls sie, wenn er in diesem aus dem tiefen Brunnen ihres Kummers geschöpften Badewasser in einen dumpfen, schnarchenden Schlaf fiel, jemals daran dachte, seinen Kopf unter Wasser zu drücken, so gab sie dieser Versuchung nicht nach. Schon bald sollte sie ein anderes Ventil für ihre Wut finden.
Camoens dagegen war mit seiner schüchternen, leisen Art ganz der Sohn seines Vaters. Durch Belle kam er mit einer Gruppe junger, nationalistischer Radikaler zusammen, die sich, unzufrieden mit dem Gerede von Gewaltlosigkeit und passivem Widerstand, an den großen Ereignissen in Rußland berauschten. Nach und nach begann er, sich Reden mit Titeln wie »Vorwärts!« oder »Terrorismus: Heiligt der Zweck die Mittel?« anzuhören und später sogar selbst zu halten.
»Ach, mein lieber Camoens, der keiner Mückski was zuleide tun würde!« Belle lachte. »Was wirst du für einen großen, schlimmen Rotski abgeben!«