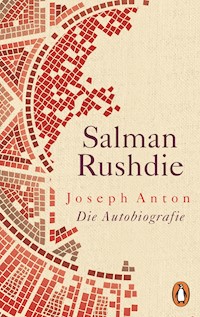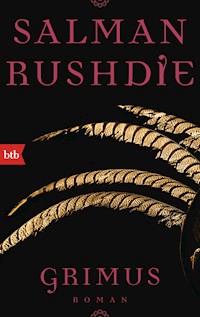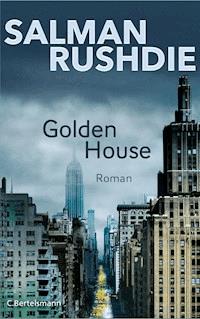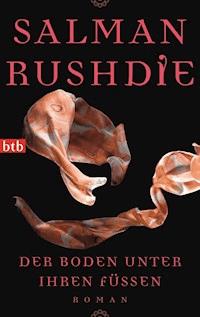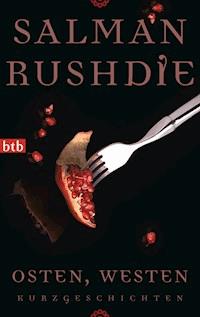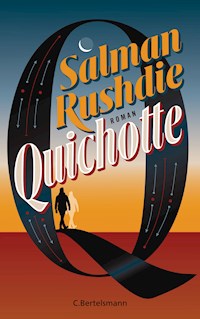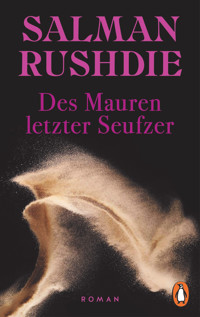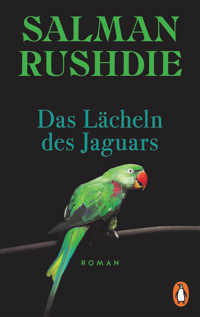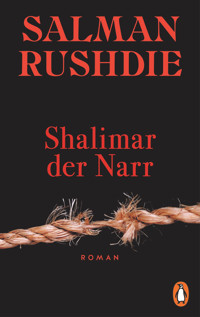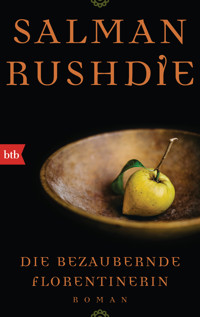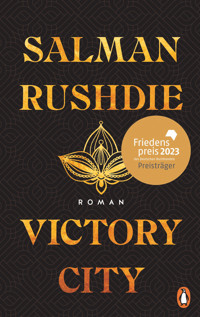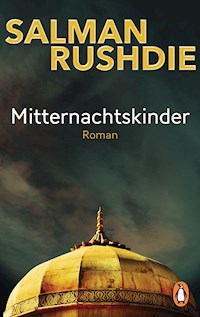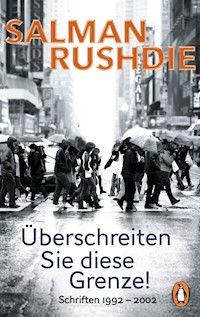
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Salman Rushdie erhält den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2023 »für seine Unbeugsamkeit, seine Lebensbejahung und dafür, dass er mit seiner Erzählfreude die Welt bereichert.« (Aus der Begründung der Jury)
Ob literarischer Essay, politischer Text oder gesellschaftlicher Kommentar – »Überschreiten Sie diese Grenze!« fasst Salman Rushdies scharfe Intelligenz, seinen unverwüstlichen Humor und seinen unerbittlichen Einsatz für die Meinungsfreiheit aus einem bewegten Jahrzehnt zusammen. Neben Texten zum Fußball und zum Zauberer von Oz finden sich Kommentare zum Schreiben, zum Kampf gegen die iranische Fatwa, zur Jahrtausendwende und zum 11. September 2001. Dieser Sammelband ist ein leidenschaftliches Plädoyer für das Miteinander von Menschen und Kulturen und ein Weckruf für unsere Lebens- und Denkart.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 744
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
SALMAN RUSHDIE, 1947 in Bombay geboren, studierte in Cambridge Geschichte. Mit seinem Roman »Mitternachtskinder« wurde er weltberühmt. Seine Bücher erhielten renommierte internationale Preise, er wurde u. a. als der beste aller Booker-Preisträger ausgezeichnet, 1996 wurde ihm der Aristeion-Literaturpreis der EU zuerkannt. 2007 schlug ihn die Queen zum Ritter. Zuletzt erschien bei C. Bertelsmann sein Roman »Golden House«. »Gebt Salman Rushdie den Nobelpreis.« FAZAußerdem von Salman Rushdie lieferbar: Grimus, Roman Mitternachtskinder, Roman Scham und Schande, Roman Das Lächeln des Jaguars, Eine Reise durch Nicaragua Die Satanischen Verse, Roman Harum und das Meer der Geschichten, Roman Heimatländer der Phantasie, Essays und Kritiken Osten, Westen, Kurzgeschichten Des Mauren letzter Seufzer, Roman Der Boden unter ihren Füssen, Roman Wut, Roman Shalimar der Narr, Roman Joseph Anton, Die Autobiografie Zwei Jahre, acht Monate und achtundzwanzig Nächte, Roman Golden House, Roman
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook.
Salman Rushdie
ÜBERSCHREITEN SIE DIESE GRENZE!
Schriften 1992 – 2002
Aus dem Englischen von Gisela Stege, Barbara Heller und Rudolf Hermstein
Die Originalausgabe erschien 2002 unter dem Titel«Step Across This Line. Collected Non-Fiction 1992–2002»bei Jonathan Cape, London. Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
PENGUIN und das Penguin Logo sind Markenzeichenvon Penguin Books Limited und werdenhier unter Lizenz benutzt.
Copyright © 2002 by Salman Rushdie Abb. Seite 153 Copyright © Richard Avedon Alle Rechte an der Übertragung ins Deutsche beim Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg Copyright © dieser Ausgabe 2019 by Penguin Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München Umschlag: buerosued.de unter Verwendung eines Motivs von plainpicture / goZooma / Jörg Dickmann E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-23550-5V001www.penguin-verlag.de
Für Christopher Hitchensund für Gisela Stege (1927–2003)in Dankbarkeit
INHALT
TEIL I: ESSAYS
Out of Kansas
Die besten jungen britischen Romanciers
Angela Carter
Beirut Blues
Arthur Miller mit achtzig
Wieder einmal – Zur Verteidigung des Romans
Bemerkungen über das Schreiben und die Nation
Einfluss
Die Adaptation der Mitternachtskinder
Reservoir Frogs (oder Lokale, die Mama’s heißen)
Heavy Threads: Frühe Abenteuer im Klamottenhandel
In der Voodoo Lounge
Rockmusik – Notizen aus der Hinterhand
U2
Eine alternative Karriere
Über gesäuertes Brot
Über das Fotografiertwerden
Crash: Prinzessin Dianas Tod
Der Volkssport: Notizen eines Fans
Über die Straußenzucht
Eine Commencement-Rede am Bard College, New York
»Imagine There’s No Heaven«: Ein Brief an den sechsmilliardsten Erdenbürger
»Verdammich, das ist eben der Orient!«
Indiens fünfzigster Geburtstag
Gandhi heute
Der Taj Mahal
Das Baburnama
Der Traum von einer glorreichen Heimkehr
TEIL ZWEI: BOTSCHAFTEN AUS DEN JAHREN DER HEIMSUCHUNG
TEIL DREI: KOLUMNEN
Dezember 1998: Drei Staatschefs
Januar 1999: Das Millennium
Februar 1999: Zehn Jahre Fatwa
März 1999: Globalisierung
April 1999: Rockmusik
Mai 1999: Der Trottel des Jahres
Juni 1999: Kaschmir
Juli 1999: Nordirland
August 1999: Kosovo
September 1999: Darwin in Kansas
Oktober 1999: Edward Said
November 1999: Pakistan
Dezember 1999: Der Islam und der Westen
Januar 2000: Terror vs. Sicherheit
Februar 2000: Jörg Haider
März 2000: Amadou Diallo
April 2000: Elián González
Mai 2000: J. M. Coetzee
Juni 2000: Fidschi
Juli 2000: Sport
August 2000: Zwei Abstürze
September 2000: Senator Lieberman
Oktober 2000: Der Human Rights Act
November 2000: Auf ins Wahlmännerkollegium
Dezember 2000: Eine große Koalition?
Januar 2001: Wie der Grinch Amerika gestohlen hat
Februar 2001: Die Korruption meldet sich zurück
März 2001: Tiger und Drache
April 2001: Ich war’s nicht
Mai 2001: Abtreibung in Indien
Juni 2001: Reality-TV
Juli 2001: Die Freilassung der Bulger-Mörder
August 2001: Arundhati Roy
September 2001: Telluride
Oktober 2001: Die Angriffe auf Amerika
November 2001: Nicht um den Islam?
Februar 2002: Antiamerikanismus
März 2002: Gott in Gujarat
TEIL VIER: ÜBERSCHREITEN SIE DIESE GRENZE!
Danksagung
Register
Erläuterungen
TEIL I:ESSAYS
Out of Kansas
Meine erste Kurzgeschichte schrieb ich mit zehn Jahren in Bombay. Ihr Titel lauteteOver the Rainbow. Sie bestand aus etwa einem Dutzend Seiten, von der Sekretärin meines Vaters gewissenhaft auf Durchschlagpapier getippt, und ging bei den vielen Umzügen meiner Familie, die uns zwischen Indien, England und Pakistan hin- und herführten, schließlich verloren. Kurz vor seinem Tod im Jahre 1987 behauptete mein Vater, in einem alten Aktenhefter eine halb vermoderte Kopie gefunden zu haben, legte sie mir aber trotz meiner inständigen Bitten niemals vor. Ich habe oft über diesen Vorfall nachgedacht. Vielleicht hatte er die Geschichte ja gar nicht gefunden, sondern nur den Verlockungen der Phantasie nachgegeben, und dies war das letzte von zahlreichen Märchen, die er mir erzählt hatte. Oder er hatte sie doch gefunden, sie aber als einen Talisman und Erinnerung an problemlosere Zeiten für sich behalten, sie als seinen – nicht meinen – persönlichen Schatz betrachtet, als seinen Topf voll nostalgischem, elterlichem Gold.
An die Geschichte selbst erinnere ich mich nicht mehr genau. Sie handelte von einem zehnjährigen Jungen aus Bombay, der eines Tages zufällig auf den Anfang eines Regenbogens stößt, einen Ort, der ebenso schwer aufzufinden ist wie das Ende mit dem Topf voll Gold und nicht weniger verheißungsvoll. Der Regenbogen ist breit, so breit wie der Bürgersteig, und sieht aus wie eine riesige Treppenflucht. Natürlich beginnt der Junge hinaufzusteigen. Seine Abenteuer habe ich so gut wie vollständig vergessen, bis auf die Begegnung mit einem sprechenden Pianola, dessen Persönlichkeit eine unmögliche Mischung aus Judy Garland, Elvis Presley und den »Playback Singers« der Hindi-Filme ist, gegen dieDer Zauberer von Ozwirkt wie eine biedere Abfolge von Küchenliedern.
Mein schlechtes Gedächtnis – das, was meine Mutter als »Vergesserei« bezeichnen würde – ist vermutlich ein Segen. An alles, was wichtig ist, erinnere ich mich jedenfalls. Ich erinnere mich, dassDer Zauberer von Oz(der Film, nicht das Buch, das ich als Kind nicht gelesen habe) das erste literarische Produkt war, das mich beeinflusste. Mehr noch: Ich erinnere mich, dass ich, als zum ersten Mal die Rede davon war, mich möglicherweise in England zur Schule zu schicken, diesen Vorschlag ebenso aufregend fand wie eine Reise hinter den Regenbogen. England war für mich ein nicht weniger wundervolles Ziel als Oz.
Der Zauberer hingegen wohnte bei uns in Bombay. Mein Vater, Anis Ahmed Rushdie, war ein märchenhafter Vater für kleine Kinder, aber er neigte auch zu Explosionen, donnernden Wutausbrüchen, emotionalen Blitzschlägen, Rauchwolken von schnaubendem Drachenqualm und anderen Einschüchterungsversuchen, wie sie von Oz praktiziert wurden, diesem großen, furchtbaren, dem ersten Zauberer de luxe. Als sich später dann der Vorhang hob und wir, seine heranwachsenden Sprösslinge, (wie Dorothy) die Wahrheit über den Humbug der Erwachsenen entdeckten, fiel es uns leicht, genau wie sie unseren Zauberer für einen wirklich sehr bösen Mann zu halten. Ein halbes Leben lang brauchte ich, um zu entdecken, dass des Großen Oz’apologia pro vita suahaargenau auf meinen Vater passte; dass auch er ein guter Mensch, aber ein ziemlich miserabler Zauberer war.
Ich habe mit diesen persönlichen Reminiszenzen begonnen, weilDer Zauberer von Ozein Film ist, dessen treibende Kraft die Unzulänglichkeit der Erwachsenen ist, selbst der guten Erwachsenen. Anfangs zwingen die Schwächen der Erwachsenen die kleine Dorothy, die Kontrolle über ihr Schicksal (und das ihres Hundes) selbst in die Hand zu nehmen. Damit beginnt ironischerweise für sie der Prozess, selber zur Erwachsenen zu werden. Der Weg von Kansas nach Oz ist ein Ritus des Übergangs von einer Welt, in der Dorothys Pflegeeltern, Tante Em und Onkel Henry, ihr nicht helfen können, ihren Hund Toto vor der bösen Miss Gulch zu retten, in eine Welt, in der die Menschen nicht größer sind als sie selbst und in der sie nicht als Kind behandelt wird, sondern als Heldin. Zu diesem Ruf gelangt sie allerdings rein zufällig, weil sie mit dem Beschluss ihres Hauses, die böse Hexe des Ostens zu zerquetschen, nicht das Geringste zu tun hatte; am Ende ihres Abenteuers ist sie jedoch so groß geworden, dass sie deren Schuhe, die berühmten rubinroten Schuhe, ausfüllen kann. »Wer hätte gedacht, dass ein so gutes kleines Mädchen meine herrliche Bosheit vernichten würde«, lamentiert die böse Hexe des Westens, als sie dahinschmilzt – eine Erwachsene, die kleiner wird als ein Kind und vor einem Kind zurückweicht. Während die böse Hexe des Westens dahinschmilzt, sieht man, dass Dorothy aufzuwachsen scheint. Das ist meiner Ansicht nach eine weitaus zufriedenstellendere Erklärung für Dorothys neu gewonnene Macht über die rubinroten Schuhe als die sentimentalen Gründe, die von der unsäglich gefühlsduseligen guten Hexe Glinda und dann von Dorothy selbst in dem süßlichen Schluss genannt werden, einem Schluss, der für mich nicht zu dem eher anarchischen Geist des Filmes passt. (Mehr darüber später.)
Angesichts der Hilflosigkeit von Tante Em und Onkel Henry gegenüber Miss Gulch, die den Hund Toto vernichten will, beschließt Dorothy, wie Kinder es eben tun, von zu Hause wegzulaufen – zu fliehen. Das ist der Grund, warum sie sich, als der Tornado zuschlägt, nicht mit den anderen im Sturmkeller aufhält, sondern zu einer Flucht davongewirbelt wird, die ihre kühnsten Träume übersteigt. Als sie später jedoch mit der Schwäche des Zauberers von Oz konfrontiert wird, läuft sie nicht davon, sondern zieht tapfer zu Felde – zunächst gegen die Hexe, dann aber gegen den Zauberer selbst. Die Unfähigkeit des Zauberers ist eine der vielen Symmetrien des Films und passt zu den Schwächen von Dorothys Verwandten; wichtig ist jedoch Dorothys unterschiedliche Reaktion auf diese beiden.
Der Zehnjährige, der sich im Metro-Kino von Bombay den FilmDer Zauberer von Ozansah, wusste sehr wenig von fremden Ländern und noch weniger vom Erwachsenwerden. Dafür wusste er sehr viel mehr vom Kino des Phantastischen als jedes westliche Kind im selben Alter. Im Westen warDer Zauberer von Ozetwas Ausgefallenes, ein Versuch, so etwas wie die lebensechte Action-Version eines Comics von Walt Disney zu machen, obwohl die Filmindustrie wusste (wie sich die Zeiten ändern!), dass Fantasy-Filme gewöhnlich ein Flop wurden. Es scheint nur wenig Zweifel daran zu geben, dass es der große Erfolg vonSchneewittchen und die sieben Zwergewar, derMGMveranlasste, einem 39 Jahre alten Buch seine ganze, uneingeschränkte Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Dies war jedoch nicht die erste Filmversion. Den Stummfilm von 1925 habe ich nicht gesehen, aber es heißt, dass er nicht gut sein soll. Immerhin jedoch gab Oliver Hardy darin den Blechmann.
Der Zauberer von Ozspielte so gut wie gar kein Geld ein, bis er Jahre nach seinem ursprünglichen Kinostart zu einem oft wiederholten Film im Fernsehen wurde, obwohl – das sollte man nicht vergessen – die Tatsache, dass er nur wenige Tage vor dem Beginn des Zweiten Weltkriegs anlief, seine Chancen mit Sicherheit verringert hat. In Indien dagegen passte er genau in das, was damals der Mainstream der »Bollywood«-Filmproduktion war und es bis heute geblieben ist.
Es ist leicht, sich über die kommerzielle Filmindustrie in Indien lustig zu machen. In James Ivorys FilmBombay Talkie(deutschHollywood in Bombay) besucht eine Journalistin (die 1984 verstorbene, rührende Jennifer Kendal) ein Aufnahmestudio und beobachtet eine verblüffende Tanznummer, bei der knapp bekleidete Mädchen auf den Tasten einer riesigen Schreibmaschine tanzen. Der Regisseur erklärt ihr, dies sei nichts weniger als die Schreibmaschine des Lebens, und dass wir alle auf dieser gigantischen Maschine »die Geschichte unseres Schicksals« tanzen. »Das ist sehr symbolisch«, sagt die Journalistin. Und der Regisseur antwortet mit leicht verkniffenem Lächeln: »Danke.«
Schreibmaschinen des Lebens, Sexgöttinnen in nassen Saris (das indische Äquivalent zu nassen T-Shirts), Götter, die vom Himmel herabsteigen, um in die Probleme der Menschen einzugreifen, Zaubertränke, Superhelden, dämonische Bösewichter und so weiter waren schon immer das Hauptvergnügen der indischen Kinofans. Die blonde Glinda, die in ihrer magischen Seifenblase im Zwergenland erscheint, mochte Dorothy eine Bemerkung über die hohe Geschwindigkeit und ausgefallene Art der Transportmittel in Oz entlocken, für ein indisches Publikum dagegen erschien Glinda genau so, wie es einem Gott angemessen sein sollte:ex machina, aus ihrer göttlichen Maschine. Auch die orangefarbenen Rauchwolken der bösen Hexe des Westens waren ihrem superbösen Image angemessen. Dennoch bestehen trotz aller Ähnlichkeiten zwischen dem Kino von Bombay und einem Film wieDer Zauberer von Ozgravierende Unterschiede. Gute Feen und böse Hexen mögen, oberflächlich betrachtet, den Gottheiten und Dämonen des Hindu-Pantheons gleichen, in Wirklichkeit aber ist einer der auffallendsten Aspekte des Weltbilds imZauberer von Ozsein fröhlicher und fast vollständiger Säkularismus. Religion wird in dem Film nur einmal erwähnt: Als Tante Em, sprühend vor Wut über die grässliche Miss Gulch, dieser erklärt, dass sie seit Jahren auf eine Gelegenheit warte, ihr mitzuteilen, was sie von ihr hält, »und jetzt … verbietet mir die Nächstenliebe, es Ihnen zu sagen«. Von diesem Moment abgesehen, in dem die christliche Nächstenliebe ein paar gute alte, deutliche Worte verhindert, ist der Film auf eine befreiend frische Art gottlos. In Oz selbst findet man keine Spur von Religion. Böse Hexen werden gefürchtet, gute geliebt, aber keine von beiden wird zur Heiligen erklärt; und obwohl der Zauberer von Oz als nahezu allmächtig gilt, denkt niemand daran, ihn anzubeten. Dieses Fehlen höherer Werte trägt deutlich zum Charme des Films bei und ist ein wichtiger Grund für seinen Erfolg, weil eine Welt gezeigt wird, in der nichts mehr Bedeutung hat als die Liebe, Fürsorge und Bedürfnisse der Menschen (und natürlich der Blechwesen, Strohwesen, Löwen und Hunde).
Der andere Unterschied ist schwerer zu definieren, weil er letztlich eine Frage der Qualität ist. Die meisten Hindi-Filme waren damals und sind jetzt das, was man wirklich nur als Schund bezeichnen kann. Das Vergnügen, das man an solchen Filmen haben kann (und einige sind überaus vergnüglich), ähnelt dem Spaß beim Essen von Junkfood. Der klassischeBombay Talkiestützt sich auf Drehbücher von erschreckender Abgedroschenheit, wirkt grellbunt-geschmacklos und vulgär und verlässt sich voll auf die Beliebtheit seiner Stars bei den Massen und darauf, dass die Musiknummern ein bisschen Schwung hineinbringen.Der Zauberer von Ozverfügt ebenfalls über Filmstars und Musiknummern, ist aber zugleich eindeutig ein guter Film. Er nimmt die Phantasie Bombays und ergänzt sie durch hohen Produktionswert und noch etwas anderes. Nennen wir es imaginative Wahrheit. Nennen wir es (na los, zieht nur schon die Revolver) Kunst.
Doch wennDer Zauberer von Ozein Kunstwerk ist, dann ist es äußerst schwierig zu sagen, wer der Künstler war. Die Geburt des Landes Oz ist selbst bereits Legende geworden: L. Frank Baum, der Autor, benannte seine Zauberwelt nach den Buchstaben O-Z auf der untersten Schublade seines Karteikartenschranks. Baums eigenes Leben glich auf sonderbare Weise einer Achterbahn. Reich geboren, erbte er von seinem Vater eine Kette kleiner Kinos, die er durch Missmanagement alle verlor. Er schrieb ein erfolgreiches Theaterstück und mehrere Stücke, die Flops waren. Die Oz-Bücher machten ihn zu einem der führenden Kinderbuchautoren seiner Zeit, doch seine übrigen Fantasy-Romane fielen allesamt durch.The Wonderful Wizard of Ozsowie eine Musical-Adaptation des Buchs für die Bühne brachten Baums Finanzen zeitweise wieder ins Gleichgewicht, doch ein finanziell katastrophaler Versuch zu einer Tournee durch Amerika, auf der er mit einem so genannten »Fairylogue« aus Dias und Filmen für seine Bücher werben wollte, führte im Jahre 1911 erneut zum Bankrott. Von da an wurde Baum zu einer etwas schäbigen, doch immer noch mit seinem Gehrock bekleideten Gestalt und lebte auf Kosten seiner Frau in »Ozcot« in Hollywood, wo er Hühner züchtete und auf Blumenschauen Preise gewann. Nach dem kleinen Erfolg eines anderen Musicals,The Tik-Tok Man of Oz, besserten sich seine Finanzen, doch er ruinierte sie abermals, als er eine eigene Filmgesellschaft gründete, die Oz Film Company, und erfolglos versuchte, die Oz-Bücher zu verfilmen und zu vertreiben. Nach zwei Jahren, in denen er bettlägerig, aber, wie wir erfuhren, immer noch optimistisch war, starb Baum im Mai 1919. Sein Gehrock dagegen lebte weiter und sollte auf seltsame Weise Unsterblichkeit erringen.
The Wonderful Wizard of Oz, erschienen im Jahre 1900, enthält bereits viele Zutaten des Zaubertranks: Alle wichtigen Personen und Ereignisse sind vorhanden, ebenso die wichtigsten Örtlichkeiten, der gelbe Steinweg, das tödliche Mohnfeld und Emerald City, die Smaragdstadt. Dennoch ist der spätere Film,Der Zauberer von Oz,eine große Seltenheit, denn es handelt sich dabei um einen Film, der besser ist als das gute Buch, aus dem er entstand. Zu den Veränderungen gehört die Erweiterung des Kansas-Teils, der im Roman vor dem Einsetzen des Tornados genau zwei Seiten und am Ende neun Zeilen umfasst. Die Handlung im Oz-Teil dagegen ist vereinfacht, indem mehrere Nebenhandlungen hinausgeworfen wurden, unter anderem der Besuch bei den kämpfenden Bäumen, das zierliche Porzellanland und die Quadlings, die im Roman kurz nach dem dramatischen Höhepunkt, der Vernichtung der Hexe, kommen und den erzählerischen Schwung des Buchs unterbrechen. Außerdem gibt es zwei sogar noch wichtigere Veränderungen: bei der Farbe der Stadt des Zauberers und der Farbe von Dorothys Schuhen.
Frank Baums Smaragdstadt war nur grün, weil jeder Bewohner eine smaragdgrüne Brille tragen musste, während es sich im Film um ein richtig futuristisches Chlorophyllgrün handelt, das heißt bis auf das Chamäleonpferd. Das Pferd verändert in jeder neuen Einstellung seine Farbe, ein Effekt, den man erreichte, indem man es mit pulverisierter Gelatine in vielen verschiedenen Farbtönen einstäubte.1
Auch die rubinroten Schuhe hat Frank Baum nicht erfunden. Er nannte sie Silberschuhe. Baum glaubte, Amerikas Stabilität erfordere einen Wechsel vom Gold- zum Silberstandard, und die Schuhe waren eine Metapher für die magischen Vorteile des Silbers. Noel Langley, der erste der drei preisgekrönten Drehbuchautoren, hielt sich ursprünglich an Baums Vorstellung. Aber in seinem vierten Skript, dem Skript vom 14. Mai 1938, bekannt als dasdo-not-make-changes-Skript, wurde das schwerfällige, metallische und überhaupt nicht märchenhafte Schuhwerk verworfen, und man führte die unsterblichen Juwelenschuhe ein, vermutlich als Reaktion auf die Forderung nach Farbe. (In Einstellung 114 erscheinen »die rubinroten Schuhe an Dorothys Füßen; sie funkeln und glitzern in der Sonne«.)
Auch andere Autoren ergänzten den fertigen Film um wichtige Einzelheiten. Florence Ryerson und Edgar Allan Woolf waren vermutlich für »Es ist nirgends besser als daheim« verantwortlich, einen Satz, der für mich die am wenigsten überzeugende Idee des Filmes beinhaltet (es ist eine Sache, dass Dorothy sich nach Hause sehnt, eine ganz andere jedoch, dass ihr das nur gelingen kann, indem sie den idealen Staat verherrlicht, der Kansas ganz offensichtlich keineswegs ist).2
Doch auch in dieser Hinsicht gibt es verschiedene Meinungen. Eine Mitschrift aus dem Studio lässt darauf schließen, dass es der Co-Produzent Arthur Freed gewesen sein könnte, der als Erster diesen putzigen Slogan ins Spiel brachte. Und nach einigen Auseinandersetzungen zwischen Langley und Ryerson-Woolf war es wohl der Autor der Songtexte Yip Harburg, der das endgültige Drehbuch zusammensetzte und die entscheidende Szene einfügte, in der der Zauberer, da er den Gefährten nicht geben kann, was sie verlangen, ihnen stattdessen Symbole aushändigt, die dann auch, zu unserer Genugtuung, ihre Wirkung tun. Der Name der Rose ist, wie sich herausstellt, letztlich doch Rose.
Wer also ist im Grunde derauteurdesZauberers von Oz?Tatsächlich kann diese Ehre kein einzelner Schreiber für sich beanspruchen, nicht mal der Autor des ursprünglichen Buches. Mervyn LeRoy und Arthur Freed, die Produzenten, haben beide ihre Favoriten. Mindestens vier Regisseure arbeiteten an dem Film, allen voran Victor Fleming, der aber vor dem Ende der Dreharbeiten aufhörte (und nicht gerade rühmlich durch King Vidor ersetzt wurde), umVom Winde verwehtzu drehen, ironischerweise genau den Film, der die meisten Oscars einheimste, währendDer Zauberer von Oznur drei Mal diese Auszeichnung erhielt: für den besten Song (»Over the Rainbow«) und die beste Filmmusik sowie einen Special Award für Judy Garland. In Wahrheit kommt ausgerechnet dieser großartige Film, in dem Zänkereien, Entlassungen und Fehler aller Beteiligten etwas hervorbrachten, das man als reinen, mühelosen und irgendwie unvermeidlichen Glücksfall bezeichnen könnte, verdammt dicht an einen Begriff heran, der noch immer durch die moderne Literaturtheorie geistert: den autorlosen Text.
Das Kansas, wie L. Frank Baum es beschreibt, ist ein trostloses Land, in dem alles grau ist, so weit das Auge reicht – die Prärie ebenso wie das Haus, in dem Dorothy wohnt. Tante Em und Onkel Henry werden wie folgt beschrieben: »Sonne und Wind … hatten das strahlende Leuchten in ihren Augen gelöscht und sie nüchtern-grau werden lassen; auch das Rot von ihren Wangen und Lippen hatten sie vertrieben und sie grau gemacht. Tante Em war dünn und ausgemergelt, und gelächelt hatte sie schon lange nicht mehr.« Und: »Onkel Henry lachte niemals. Auch er war grau, von seinem langen Bart bis zu den derben Stiefeln hinab.« Und der Himmel? »Er war sogar noch grauer als sonst.« Nur Toto blieb diese allgemeine Grauheit zum Glück erspart. Er »rettete Dorothy davor, ebenso grau zu werden wie ihre Umwelt«. Der Hund war zwar nicht gerade sehr farbig, doch seine Augen zwinkerten lustig, und sein Fell war seidenweich. Toto war schwarz.
Aus dieser Grauheit heraus – der zunehmenden, sich zusammenbrauenden Grauheit dieser trostlosen Welt – kommt das Unheil. Der Tornado ist die gebündelte Grauheit; er wirbelt und wirbelt und wird sozusagen gegen sich selbst entfesselt. All diesen Schilderungen folgt der Film erstaunlich werksgetreu, indem die Kansas-Szenen in jenem Ton gedreht werden, den wir Schwarzweiß nennen, der aber in Wirklichkeit aus einer Vielzahl von Grauschattierungen besteht, und die Bilder immer dunkler werden, bis der Wirbelwind sie einsaugt und zerfetzt.
Es gibt jedoch auch noch eine andere Möglichkeit, den Tornado zu sehen. Dorothy hat einen Nachnamen: Gale, zu Deutsch Sturm. Und in vieler Hinsicht ist auch Dorothy der Sturm, der durch diesen kleinen Winkel im Nichts dahinfegt. Sie fordert Gerechtigkeit für ihren kleinen Hund, während die Erwachsenen eingeschüchtert der mächtigen Miss Gulch nachgeben. Sie ist bereit, mit der grauen Unabwendbarkeit ihres Lebens zu brechen, indem sie ausbüxt, kehrt in ihrer Gutherzigkeit jedoch sofort um, als sie von Professor Marvel erfährt, Tante Em sei untröstlich darüber, dass sie davongelaufen ist. Dorothy ist die Lebenskraft von Kansas, genau wie Miss Gulch die Macht des Todes ist; und vielleicht ist es Dorothys innerer Aufruhr, der Wirbelsturm von Gefühlen, die in dem Konflikt zwischen Dorothy und Miss Gulch entstehen, der sich in der großen, finsteren Schlangenröhre der Wolke materialisiert, welche über die Prärie dahintobt und die Welt in sich hineinschlingt.
Das Kansas im Film ist ein bisschen weniger erbarmungslos öde als das Kansas im Buch, wenn auch nur durch die Einführung der drei Farmarbeiter und des Professors Marvel, vier Personen, die ihren »Reim«, ihr Gegenstück, in den drei Freunden von Oz und dem Zauberer selbst finden. Andererseits ist das Film-Kansas auch beängstigender, denn ihm wird noch etwas wirklich Böses hinzugefügt: die knochendürre Miss Gulch und ihr Profil, mit dem man einen Truthahn tranchieren könnte, wie sie mit einem Hut wie ein Plumpudding oder eine Bombe steif auf ihrem Fahrrad umhergondelt und für ihren Kreuzzug gegen Toto den Schutz des Gesetzes fordert. Dank Miss Gulch ist das Film-Kansas nicht nur durch die Trostlosigkeit erdgrauer Armut definiert, sondern auch durch die Bösartigkeit von Möchtegern-Hundemörderinnen.
Unddassoll die Heimat sein, der kein anderer Ort gleichkommt?Dasist das verlorene Paradies, das wir (wie Dorothy) dem Lande Oz vorziehen sollen?
Ich erinnere mich (oder glaube mich zu erinnern), dass mir, als ich den Film zum ersten Mal sah, Dorothys Zuhause ziemlich schäbig vorkam. Ich hatte Glück, denn ich besaß ein schönes, gemütliches Zuhause, was mich zu der Überzeugung brachte, wennichnach Oz versetzt worden wäre, hätte ich mir natürlich gewünscht, nach Hause zurückkehren zu können. Aber Dorothy? Vielleicht sollten wir sie einmal zu uns einladen, dachte ich. Alles schien mir besser zu sein alsdas.
Und noch etwas anderes dachte ich mir, das ich nunmehr wohl eingestehen sollte, denn es flößte mir sowohl eine klammheimliche Hochachtung ein für Miss Gulch und ihr Gegenstück, die böse Hexe, als auch, wie manche sagen würden, ein geheimes Mitgefühl für alle Personen ihrer hexenhaften Veranlagung – alles Gefühle, die sich bis jetzt in mir erhalten haben: Ich konnte Toto nicht ausstehen. Ich kann es immer noch nicht. So wie Gollum es von dem Hobbit Bilbo Baggins in einem anderen großartigen Fantasy-Roman sagte: »Baggins: Wir hassen ihn zu Tode.«
Toto, dieses kleine, kläffende Haarteil von einem Hund, dieser lästige Kehrbesen! Löblicherweise hatte L. Frank Baum dem Hund eine eindeutig mindere Rolle gegeben: Toto hielt Dorothy bei Laune, und wenn sie nicht fröhlich war, neigte er dazu, »jämmerlich zu winseln« – kein besonders liebenswerter Zug. Der einzig wirklich wichtige Beitrag, den er in der Baum’schen Erzählung leistet, besteht darin, dass er zufällig den Wandschirm umstößt, hinter dem sich der Zauberer verbirgt. Der Film-Toto dagegen reißt eher absichtlich einen Vorhang herunter, um den großen Humbug zu entlarven, was ich trotz allem als einen sehr ärgerlichen Kinderstreich empfand. Als ich hörte, dass der Köter, der Toto spielte, regelrechte Starallüren hatte und einmal sogar mit einem Nervenzusammenbruch die Dreharbeiten aufhielt, war ich keineswegs verwundert. Mich hat es immer schon geärgert, dass Toto das einzige Objekt wahrer Liebe in diesem Film sein sollte. Doch jeder Protest ist sinnlos (wenngleich befriedigend). Längst kann mich niemand mehr von diesem quirligen Toupet befreien.
Als ich denZauberer von Ozzum ersten Mal sah, machte das Erlebnis einen Schriftsteller aus mir. Viele Jahre später begann ich das Garn zu spinnen, aus dem letztlichHarun und das Meer der Geschichtenentstand. Ich hatte das starke Gefühl, es müsste – wenn ich den richtigen Ton treffen könnte – möglich sein, die Geschichte so zu erzählen, dass sie sowohl für Erwachsene als auch für Kinder von Interesse sein würde. Die Welt der Bücher ist zu einem stark kategorisierten und abgegrenzten Tummelplatz geworden, auf dem Kinderbücher nicht nur eine Art Ghetto, sondern auch in Literatur für verschiedene Altersgruppen unterteilt sind. Das Kino dagegen hat sich immer wieder über eine derartige Kategorisierung hinweggesetzt. Von Spielberg bis zu Schwarzenegger, von Disney bis zu Gilliam hat das Kino häufig Filme herausgebracht, vor denen Kinder und Erwachsene fröhlich nebeneinander sitzen.Falsches Spiel mit Roger Rabbithabe ich mir an einem Nachmittag in einem Kino voll aufgeregter, lärmender Kinder angesehen und bin dann am folgenden Abend zu einer Zeit, die zu spät für die Kinder war, noch einmal in eine Vorstellung gegangen, damit ich alle Gags genießen, über die Insider-Witze der Filmindustrie lachen und noch einmal das brillante Toontown-Konzept bewundern konnte. Aber von allen Filmen war esDer Zauberer von Oz, der mir die größte Hilfe bei der Suche nach dem richtigen Ton fürHarungeboten hat. Der Einfluss des Films ist deutlich im Text zu sehen. In Haruns Begleitern erkennt man sofort das Echo der Freunde, die mit Dorothy den gelben Steinweg entlangtanzten.
Und nun werde ich etwas Seltsames tun, etwas, das meine Liebe zu diesem Film zerstören müsste, es aber nicht tut: Ich sehe mir eine Videoaufzeichnung an – mit einem Notizbuch auf dem Schoß, einem Stift in der einen und der Fernbedienung in der anderen Hand, während ich denZauberer von Ozder Demütigung der Zeitlupe, des Schnellvorlaufs und des Bildstopps unterwerfe, also versuche, das Geheimnis des Zaubertricks zu entdecken; und tatsächlich, ich sehe Dinge, die mir bis dahin noch nie aufgefallen waren …
Der Film beginnt. Wir befinden uns in der monochromen, der »realen« Welt von Kansas. Ein kleines Mädchen läuft mit seinem Hund einen Feldweg entlang. »Nein, sie kommt uns nicht nach, Toto. Hat sie dir wehgetan? Sie darf dir nichts tun!«Ein reales Mädchen, ein realer Hund und mit der allerersten Textzeile der Anfang eines realen Dramas. Aber Kansas ist nicht real, nicht realer als Oz. Kansas ist ein Ölgemälde. Dorothy und Toto sind in denMGM-Studios ein kurzes Stück des »Feldwegs« entlanggelaufen, und diese Einstellung ist zu einem Bild der Leere gestaltet worden. Die »reale« Leere würde vermutlich nicht leer genug sein. Sie hält sich so dicht an das allgemeine Grau von Frank Baums Geschichte, dass es kaum einen Unterschied gibt; die Leere wird nur durch ein paar Zäune und die vertikalen Striche der Telegrafenmasten durchbrochen. Wenn Oznirgendwoist, dann suggeriert das Kansas-Szenenbild des Studios, dass gerade Kansas ebenfallsnirgendwoist. Das ist notwendig. Eine realistische Darstellung der extremen Armut, in der Dorothy Gale lebt, hätte eine Bürde geschaffen, eine Schwerfälligkeit, die den imaginären Sprung ins Märchenland, den schwerelosen Flug nach Oz hinein unmöglich gemacht hätte. Die Märchen der Gebrüder Grimm sind zwar häufig realistisch. InDer Fischer und seine Frauwohnt dieses eponyme Paar, bis die beiden dem Butt begegnen, in einer Bude, die kurz und bündig als »Pisspott« beschrieben wird. In vielen Kinderversionen der Grimm’schen Märchen wird der Pisspott jedoch zur Elendshütte oder noch etwas Schönfärberischerem herabgemildert. In Hollywood befleißigte man sich stets dieser Weichzeichner-Version. Dorothy wirkt außerordentlich wohlgenährt und ist nicht wirklich, sondernunwirklicharm.
Sie erreichen den Farmhof, und hier sehen wir (wenn wir das Bild anhalten) den Anfang eines visuellen Motivs, das immer wiederkehren wird. In der Szene, die wir angehalten haben, sind Dorothy und Toto im Hintergrund und steuern auf das Hoftor zu. Links in der Szene ist ein Baumstamm zu sehen, eine vertikale Linie, welche die Telegrafenmasten der vorigen Szene wiederholt. An einem annähernd horizontalen Ast hängen ein Triangel (zum Herbeirufen der Farmhelfer zum Abendessen) und ein Kreis (das heißt ein Autoreifen). Im Mittelgrund sehen wir weitere geometrische Elemente: die parallelen Linien des Zaunes, die teilende Diagonale des Holzbalkens am Tor. Wenn wir später das Haus betrachten, entdecken wir abermals diese schlichte Geometrie; alles besteht aus rechten Winkeln und Dreiecken. Die Welt von Kansas, die große Leere, wird durch den Einsatz einfacher, unkomplizierter Figuren zum »Zuhause« gestaltet; hier gibt es keine verstädterte Vielfalt. Im ganzenZauberer von Ozwerden Zuhause und Sicherheit durch diese geometrische Einfalt gekennzeichnet, während Gefahr und Böses unweigerlich gewunden, unregelmäßig und missgestaltet sind.
Eine ebenso unzuverlässige, sich windende, sich ständig verändernde Form ist auch der Tornado. Entfesselt, losgelassen vernichtet er die schlichten Formen des einfachen, schmucklosen Lebens.
Diese Kansas-Sequenz erinnert nicht nur an Geometrie, sondern ganz allgemein an Mathematik. Als Dorothy wie ein aufgewühlter Wirbelwind in ihrer Angst um Toto zu Tante Em und Onkel Henry läuft – womit sind die beiden gerade beschäftigt? Warum schicken sie sie davon? »Wir sind doch jetzt beim Zählen«, tadeln sie sie, während sie die Bilanz ihrer Hühnerzucht ziehen und metaphorische Küken zählen, ihre kleine Hoffnung auf ein Einkommen, die der Tornado kurz darauf davonfegen wird. So errichtet Dorothys Familie mit einfachen Figuren und Zahlen ihre Abwehr gegen die immense und aufreizende Leere; Abwehrmechanismen, die natürlich sinnlos sind.
Nach Oz vorgreifend, wird deutlich, dass diese Gegenüberstellung von Geometrie und Schnörkeln kein Zufall ist. Man braucht sich nur den Beginn des gelben Steinwegs anzusehen: Er ist eine perfekte Spirale. Man beachte Glindas Transportmittel, diese perfekt kugelförmige, leuchtende Luftblase. Man beachte die straffe Aufstellung der Zwerge, die Dorothy begrüßen und ihr für den Tod der bösen Hexe des Ostens danken. Später dann die Smaragdstadt: Aus der Ferne gesehen, besteht sie aus senkrechten Strichen, die in den Himmel emporragen! Und nun dagegen die Welt der bösen Hexe des Westens: ihre geduckte Gestalt, ihr missgestalteter Hut. Wie entschwebt sie? In einer formlosen Rauchwolke … »Nur böse Hexen sind hässlich«, erklärt Glinda Dorothy, eine Bemerkung höchster politischer Inkorrektheit, welche die Animosität des Films gegenüber allem verkörpert, was wirr, krallenkrumm und unheimlich ist. Wälder sind unweigerlich beängstigend – die knorrigen Äste der Bäume könnten zum Leben erwachen –, und der einzige Moment, da Dorothy sogar der gelbe Steinweg Angst einflößt, ist der Moment, als er aufhört, geometrisch (anfangs spiralförmig, dann geradlinig) zu sein, sich teilt und in alle Himmelsrichtungen verzweigt.
Wieder in Kansas, liefert Tante Em die Strafpredigt, welche die Einleitung zu einem der unsterblichen Momente des Kinos ist. »Bilde dir doch nicht immer solche Dinge ein! Du regst dich ganz umsonst auf … Such dir einen stillen Platz und reg dich nicht mehr auf!«
»Einen Platz ganz ohne Aufregungen? Glaubst du, es gibt einen solchen Platz, Toto? Das muss es doch…«Jeder, der die Auffassung des Drehbuchschreibers geschluckt hat, dass dieser Film davon handele, wie viel besser »daheim« als »die Fremde« ist und dass die »Moral« desZauberers von Ozso zuckersüßlich ist wie eine kreuzgestickte Lebensweisheit – »Osten, Westen, daheim ist’s am besten« –, sollte der Sehnsucht in Judy Garlands Stimme lauschen, wenn sie den Blick hoch in den Himmel richtet. Was sie dadurch ausdrückt, was sie mit der Reinheit des Archetypus verkörpert, ist der menschliche Traum des In-die-Fremde-Gehens, ein Traum, der mindestens so mächtig ist wie der entgegenwirkende Traum von den Wurzeln. Im innersten Kern desZauberers von Ozherrscht eine starke Spannung zwischen diesen beiden Träumen, doch wenn die Musik anschwillt und diese große, klare Stimme in die bangen, sehnsüchtigen Höhen des Songs aufsteigt – kann da noch jemand fragen, welche Botschaft mächtiger ist? In seinen kraftvollsten, gefühlvollsten Momenten ist dies ganz unbestreitbar ein Film über die Freuden des In-die-Fremde-Gehens, des Zurücklassens all der Grauheit und des Eintretens in die Farbe, vom Beginn eines neuen Lebens, an einem »Platz ganz ohne Aufregungen«. »Over the Rainbow« ist – oder sollte es zumindest sein – die Hymne aller Migranten der Welt, all jener, die sich auf die Suche nach einem Platz begeben, wo »die Träume, die man zu träumen wagt, tatsächlich wahr werden«. Dieser Song feiert das Entfliehen, ist ein Lobgesang auf das entwurzelte Ich, eine Hymne –dieHymne an das Anderswo.
E. Y. Harburg, Texter von »Brother, Can You Spare a Dime?«, und Harold Arlen, der »It’s Only a Paper Moon« mit Harburg schrieb, haben die Songs für denZauberer von Ozkomponiert, und die Melodie fiel Arlen tatsächlich vor Schwab’s Drugstore in Hollywood ein. Aljean Harmetz notierte Harburgs Enttäuschung über die Vertonung: zu kompliziert für eine Sechzehnjährige, die sie doch singen soll, zu fortschrittlich im Vergleich zu Disney-Hits wie »Heigh Ho, Heigh Ho, It’s Off To Work We Go«. »Harburg zuliebe«, setzt Harmetz hinzu, »schrieb Arlen die Melodie für den geschwätzigen Mittelteil des Songs.«Where troubles melt like lemon drops,/Away above the chimney tops,/That’s where you’ll find me … Kurz gesagt, ein bisschen höher als die Protagonistin in jener anderen Ode an das Entfliehen, »Up on the Roof«.
Dass »Over the Rainbow« Gefahr lief, aus dem Film herausgeschnitten zu werden, ist wohl bekannt und ein Beweis dafür, dass in Hollywood Meisterstücke durch Zufall entstehen, weil es einfach nicht weiß, was es tut. Andere Songs wurden ebenfalls herausgenommen: »The Jitter Bug«, nach fünf Wochen Dreharbeiten, und praktisch alles von »Lions and Tigers and Bears«, das nur als kleine Melodie der Gefährten bestehen bleibt, als sie auf dem gelben Steinweg singen: »Löwen und Tiger und Bären – o weh!« Unmöglich zu sagen, ob der Film mit diesen Songs besser oder schlechter geworden wäre; würdeCatch-22auchCatch-22sein, wenn es unter dem OriginaltitelCatch-18veröffentlicht worden wäre? Fest steht jedoch, dass sich Yip Harburg (keiner von Judys Bewunderern) geirrt hat, was Garlands Stimme betrifft.
Die Hauptdarsteller der Besetzungsliste beschwerten sich, es gebe in diesem Film »nichts zu schauspielern«, und im konventionellen Sinn hatten sie Recht. Aber als Garland »Over the Rainbow« sang, geschah etwas Außergewöhnliches. In diesem Moment verlieh sie dem Film ein Herz. Die Kraft ihrer Wiedergabe ist so stark, süß und tief, dass sie uns durch die ganzen darauf folgenden Spielereien trägt und ihnen sogar einen rührenden Anstrich gibt, einen verletzlichen Charme, der nur durch Bert Lahrs ebenso außergewöhnliche Interpretation des feigen Löwen erreicht wird.
Was könnte man noch über Garlands Dorothy sagen? Die landläufige Meinung besagt, dass sie an Ironie gewinnt, weil ihre Unschuld so krass mit dem kontrastiert, was wir von dem problembeladenen späteren Leben der Schauspielerin wissen. Ich bin nicht sicher, ob das zutrifft, obwohl alle Filmfans dazu neigen, Bemerkungen dieser oder ähnlicher Art zu machen. Ich habe den Eindruck, dass Judy Garlands Erfolg sowohl ihr eigener Verdienst war als auch der des Films. Die Rolle verlangt von ihr einen nahezu unmöglichen Trick. Einerseits soll sie dieTabula rasades Filmes sein, die leere Tafel, auf die sich die Handlung der Geschichte nach und nach selber schreibt – oder, weil dies schließlich ein Film ist, die leere Leinwand, auf der die Handlung stattfindet. Bewaffnet nur mit dem Aussehen großäugiger Unschuld, muss sie ebenso das Objekt des Streifens sein wie sein Subjekt, muss zulassen, dass sie selbst zu dem leeren Gefäß wird, das der Film allmählich füllt. Und dennoch soll sie andererseits – mit ein wenig Hilfe vom feigen Löwen – das gesamte emotionale Gewicht, die ganze zyklonische Wucht des Filmes tragen. Dass sie das schafft, verdankt sie nicht nur der reifen Tiefe ihrer Singstimme, sondern auch ihrer komischen Stämmigkeit, ihrer Ungelenkigkeit, die gerade deswegen so liebenswert wirken, weil sie im Gegensatz zu der affektierten Schönheit, die eine Shirley Temple in die Rolle eingebracht hätte – und es war tatsächlich erwogen worden, Temple diese Rolle zu geben –, halb un-schön ist,jolie-laide. Die sauber geschrubbte, ein klein wenig mollige Geschlechtslosigkeit von Judy Garlands Spiel ist es, die diesem Film seine Wirkung verleiht. Man braucht sich nur die katastrophale Koketterie vorzustellen, auf der die junge Shirley bestanden hätte, und wird dem Glück danken, dass die MGM-Manager sich überreden ließen, es mit Judy zu versuchen.
Der Tornado, von dem ich gesagt habe, er sei das Produkt des »Sturms«(gale)in Dorothys Namen, bestand eigentlich aus drahtverstärktem Musselin. Ein Requisiteur musste sich in die Musselinröhre hinablassen und von innen helfen, die Nadeln hereinzuziehen und wieder hinauszustechen. »Als wir das enge Ende erreichten, wurde es ziemlich unbequem«, gestand er. Diese Unbequemlichkeit war die Sache jedoch wert, denn daraus, dass der Tornado über Dorothys Haus herfällt, entsteht das zweite wahrhaft mythische Bild desZauberers von Oz: sozusagen der archetypische Mythos desmoving house.
In dieser Übergangssequenz des Films, in der die irreale Realität von Kansas der realistischen Surrealität der Welt der Zauberei weicht, gibt es, wie es sich für einen Türschwellenmoment gehört, alle möglichen Fenster- und Türenaktivitäten. Erstens öffnen die Farmarbeiter die Türen des Sturmkellers, während Onkel Henry, heldenhaft wie eh und je, Tante Em davon überzeugt, dass sie es sich nicht leisten können, auf Dorothy zu warten. Zweitens kämpft Dorothy, die mit Toto von ihrem Fluchtversuch zurückkehrt, gegen den Wind, um die äußere Fliegendrahttür des Wohnhauses zu öffnen; diese Außentür wird sofort aus den Angeln gerissen und davongeweht. Drittens sehen wir, wie die anderen die Türen des Sturmkellers schließen. Viertens öffnet und schließt Dorothy im Haus die Türen verschiedener Zimmer, während sie aufgeregt nach Tante Em ruft. Fünftens geht Dorothy zum Sturmkeller, dessen Türen jedoch verschlossen sind. Sechstens sucht Dorothy, deren Rufe nach Tante Em jetzt schwach und angstvoll klingen, im Wohnhaus Zuflucht, woraufhin ein Fenster – Echo der Außentür – aus den Angeln gerissen wird und sie bewusstlos schlägt. Sie fällt aufs Bett, und von nun an regiert die Zauberei. Wir haben die wichtigste Schwelle des Films überschritten.
Dieses Manöver – Dorothy bewusstlos werden zu lassen – ist in Frank Baums Originalversion die radikalste und in gewisser Hinsicht schlimmste Veränderung. Denn im Buch besteht keinerlei Zweifel daran, dass Oz real ist, dass es ein Ort derselben Gattung, wenn auch nicht desselben Typs ist wie Kansas. Der Film bringt hier, wie in der TV-SeifenoperDallas, ein Element des Unglaubens ein, weil er die Möglichkeit zulässt, dass alles, was nun folgt, ein Traum ist. Dieser Unglaube hatDallassein Publikum gekostet und die Serie letztlich erledigt. Dass demZauberer von Ozdas Schicksal der Seifenoper erspart blieb, ist ein Beweis für die allgemeine Integrität des Films, durch die es gelang, dieses haarsträubende Klischee zu überwinden.
Während das Haus durch die Luft fliegt und in der Totale wie ein winziges Spielzeug wirkt, »erwacht« Dorothy. Was sie durchs Fenster sieht, ist eine Art Film – das Fenster dient als Filmleinwand, ein Bild innerhalb eines Bildes –, der sie auf die neue Art Film vorbereitet, in die sie nun eintreten wird. Zu den Spezialeffekten, für die damalige Zeit sehr raffiniert, gehören eine alte Dame, die in ihrem Schaukelstuhl sitzt und strickt, während der Tornado sie vorüberwirbelt, eine Kuh, die gelassen im Auge des Sturmes steht, zwei Männer, rudernd in einem Boot, das sich durch die kreiselnde Luft bewegt, und vor allem Miss Gulch auf ihrem Fahrrad, die sich vor unseren Augen in die böse Hexe des Westens auf ihrem Besenstiel verwandelt, mit wild flatterndem Umhang und einem gackernden Lachen, das sogar den Lärm des Tornados übertönt.
Das Haus landet. Dorothy kommt mit Toto auf dem Arm aus ihrem Schlafzimmer. Wir haben den Moment der Farbe erreicht.
Die erste Farbszene, in der Dorothy von der Kamera fort zur Vordertür des Hauses geht, ist bewusst – an das vorausgegangene Monochrom erinnernd – in einem matten Grau gehalten. Sobald sich aber die Tür öffnet, überflutet die Farbe den Bildschirm. In der heutigen, farbensatten Zeit kann man sich nur schwer in eine Zeit zurückversetzen, in der Farbfilme noch relativ neu waren. Wenn ich noch einmal an meine Kinderzeit im Bombay der fünfziger Jahre zurückdenke, als Hindi-Filme allesamt noch schwarzweiß waren, erinnere ich mich gut, wie aufregend der Beginn der Farbfilmzeit war. In einem Epos über den Großmogul, Kaiser Akbar, mit dem TitelMughal-e-Azamgab es damals nur eine einzige Farbfilmrolle, die einen Tanz bei Hof mit der berühmten Anarkali zeigte. Und doch hat diese Rolle allein den Erfolg des Films garantiert und die Massen zu Millionen in die Kinos gelockt.
Die Filmemacher desZauberers von Ozhatten sich eindeutig dafür entschieden, ihre Farben so farbig wie möglich zu gestalten, genau wie Michelangelo Antonioni, ein ganz anderer Filmemacher, es Jahre später in seinem FarbstreifenDie rote Wüstetat. In dem Antonioni-Film wird die Farbe benutzt, um übertriebene, häufig surrealistische Effekte zu erzielen.Der Zauberer von Ozverwendet ebenfalls starke, expressionistische Farbtupfer: das Gelb des Steinwegs, das Rot des Mohnfelds, das Grün der Smaragdstadt und der Haut der Hexe. So eindrucksvoll waren diese Farbeffekte, dass ich, nachdem ich den Film als Kind gesehen hatte, immer wieder von grünhäutigen Hexen träumte. Jahre später übertrug ich diese Träume auf den Erzähler meines RomansMitternachtskinder, obwohl ich die Quelle total vergessen hatte: »Keine Farben außer Grün und Schwarz die Wände sind grün der Himmel ist schwarz … die Sterne sind grün die Witwe ist grün aber ihre Haare sind schwarz so schwarz.« In dieser Bewusstseinsstrom-Traumsequenz verschmilzt der Albtraum Indira Gandhis mit der ebenso albtraumhaften Gestalt Margaret Hamiltons: eine Vereinigung der bösen Hexen des Ostens und Westens.
Als Dorothy, umrahmt von exotischem Blattwerk mit einer Gruppe von Zwergenhäuschen dahinter, in die Farbe hinaustritt und aussieht wie ein Schneewittchen im blauen Kleid, keine Prinzessin, sondern ein bodenständiges amerikanisches Mädchen, wirkt das Fehlen der gewohnten, heimeligen Grautöne offenbar wie ein Schock auf sie. »Toto, es scheint mir, als ob wir nicht mehr in Kansas wären.« Dieser Camp-Klassiker von Textzeile,Toto, I have a feeling we’re not in Kansas any more,hat sich später verselbständigt und ist zu einem bekannten amerikanischen Schlagwort geworden, immer wieder neu verwendet, bis er schließlich sogar als Epigraph zu Thomas Pynchons paranoider Mammutphantasie über den Zweiten Weltkrieg,Die Enden der Parabel, auftauchte, in der die Bestimmung der Personen nicht »hinter dem Mond, jenseits des Regens« liegt, sondern »jenseits der Null« des Bewussten, in einem Land, das mindestens so seltsam ist wie Oz.
Aber Dorothy hat mehr getan, als aus dem Grau ins Bunt des Technicolor hinauszutreten. Sie wurdeenthaust, und ihre »Hauslosigkeit« wird noch von der Tatsache unterstrichen, dass sie nach all der Türenspielerei der Übergangssequenz, und nachdem sie nunmehr ins Freie hinausgetreten ist, keine einzige Räumlichkeit mehr betreten wird, bis sie die Smaragdstadt erreicht hat. Vom Tornado bis nach Oz hat Dorothy kein einziges Mal mehr ein Dach über den Kopf.
Da draußen, inmitten der riesigen Stockrosen, die Blüten wie alte His-Master’s-Voice-Grammophontrichter tragen, dort draußen in der Ungeschütztheit des freien Raums, der so ganz anders ist als die Prärie, ist Dorothy drauf und dran, Schneewittchen um einen Faktor von etwa fünfzig den Rang abzulaufen. Man kann fast hören, wie die MGM-Studiochefs planen, den Disney-Hit in den Schatten zu stellen, nicht einfach, indem zwischen die Live-Action möglichst viele Zaubereffekte wie die von den Disney-Trickzeichnern gestreut werden, sondern auch was das Problem der Zwerge betrifft. Wenn Schneewittchen sieben Zwerge hatte, dann muss Dorothy Gale von dem Stern namens Kansas dreihundertundfünfzig haben. Die Meinungen, wie eine so große Zahl von Liliputanern nach Hollywood geholt und verpflichtet wurde, gehen auseinander. Die offizielle Version lautet, dass sie von einem Impresario namens Leo Singer zur Verfügung gestellt wurden. John Lahrs Biographie über seinen Vater Bert erzählt jedoch eine andere Geschichte, die ich aus Gründen, die Roger Rabbit verstehen würde – das heißt, weil sie so komisch ist –, hier gern wiedergeben möchte. Lahr zitiert den Leiter des Castings, Bill Grady:
Leo (Singer) konnte mir nur 150 geben. Also ging ich zu einem Liliputaner-Spezialisten namens Major Doyle … Ich hätte 150 von Singer, habe ich ihm gesagt. »Wenn Sie mit diesem Hundesohn Geschäfte machen, werde ich Ihnen keinen einzigen geben.« »Was soll ich tun?«, antwortete ich. »Ich gebe Ihnen 350.« … Also rief ich Leo an und erklärte ihm die Situation … Als ich dem Major sagte, ich hätte Singer angerufen, legte er mitten auf der Straße vor Dinty Moore’s einen Jig aufs Pflaster. Der Major beschafft mir die Liliputaner … Ich holte sie mit Bussen in den Westen … Major Doyle griff sich die (ersten drei) Busse und fuhr direkt vor Singers Haus. Der Major ging zum Türsteher. »Rufen Sie oben an und sagen Sie Leo Singer, er soll aus dem Fenster sehen.« Es dauerte ungefähr zehn Minuten. Dann sah Singer aus dem Fenster im vierten Stock. Und da waren all diese Liliputaner in den Bussen direkt vor seinem Haus und hatten den Busfenstern den nackten Hintern zugekehrt.
Dieser Zwischenfall wurde als Major Doyles Rache bekannt.3
Das, was mit einem Strip begann, setzte sich im Comic-Stil fort. Die Zwerge wurden wie 3-D-Comicfiguren geschminkt und kostümiert. Der Bürgermeister des Zwergenlandes ist eher unglaubwürdig mollig, der Leichenbeschauer (»Ein Ende hat die grause Not/Denn sie ist wirklich mausetot«)liest den Nachruf der Hexe des Ostens von einer Schriftrolle ab und trägt dazu einen Hut mit einem komischen, schriftrollenähnlichen Rand;4die Stirnlocken der Lollipop Kids, die via Bash Street und Dead End nach Oz gelangt zu sein scheinen, stehen steifer auf ihren Köpfen als die von Tintin. Aber was eine groteske und unappetitliche Sequenz hätte werden können – schließlich handelt es sich um eine Totenfeier –, entpuppt sich stattdessen als die Szene, in derDer Zauberer von Ozsein Publikum endgültig fasziniert, indem der Film den natürlichen Charme der Story mit der brillantenMGM-Choreographie verbindet, bei der Massenauftritte sich abwechseln mit hübschen, kleinen Einzelnummern wie etwa dem Tanz der Lullaby League und den Sleepy Heads, die mit Schlafmützen und Nachthemden in einem riesigen Nest aus zerbrochenen Eierschalen erwachen. Und natürlich ist da auch noch die ansteckende Fröhlichkeit von Arlen und Harburgs außergewöhnlich witziger Nummer »Ding, Dong, the Witch is Dead«.
Arlen betrachtete diesen Song und das ebenso unvergessliche »We’re Off to See the Wizard« eher mit Geringschätzung und nannte sie seine »Zitronendrops-Songs« – vielleicht weil die eigentliche Erfindungsgabe in beiden Fällen in Harburgs Texten liegt. In Dorothys Intro zu »Ding, Dong« hat sich Harburg in ein pyrotechnisches Schnellfeuer vonAAA-Reimen gestürzt (the wind began to switch/The house to pitch; bis wir schließlich zurwitchgelangen, die, umto satisfy an itch/Went flying on her broomstick thumbing for a hitch, undwhat happened then was rich …). Wie bei den Alliterationen eines Bänkelsängers begrüßen wir jeden neuen Reim als eine Art turnerischen Triumph. Diese Art von Verbalspielerei beherrscht auch weiterhin beide Songs. In »Ding, Dong« beginnt Harburg, indem er witzige, wie bei einer Wort-Konzertina verschachtelte Wörter benutzt:
Ding, Dong, the witch is dead!
Wicholwitch?
The wicked witch!
Diese Technik fand noch intensivere Anwendung in »We’re Off to See the Wizard«, wo sie zur eigentlichen Attraktion des Songs wurde:
We’re off to see the Wizard
The wonderfulWizzerdavoz;
We hear he is aWhizzavawiz,
If ever awhizztherwoz.
Ifeveroeverawhizztherwoz,
TheWizzardavozis one because …
Ist es allzu weit hergeholt, wenn man annimmt, Harburg habe, als er während des ganzen Films ein Reimschema voll interner Reime und Assonanzen benutzte, bewusst die »Reime« des Plots selbst wiederholt, die Parallelen der Personen in Kansas mit denen in Oz, die Echos der Themata zwischen Monochrom und der Welt des Technicolor?
Weil sie kein Englisch sprachen, konnten nur wenige Zwerge ihre Zeilen selber singen. Im Grunde brauchten sie in dem Film nicht viel zu tun, kompensierten diese Tatsache aber durch ihre Aktivitäten außerhalb des Drehorts. Manche Filmhistoriker versuchen die Geschichten von sexuellen Ausschweifungen, Messerstechereien und allgemeiner Hemmungslosigkeit herunterzuspielen, aber die Legende der Zwergenhorden, die eine Schneise durch Hollywood schlugen, wird wohl nicht so leicht vergessen werden. In Angela Carters RomanWie’s uns gefälltgibt es die komische Schilderung einer fiktiven Hollywoodversion von ShakespearesSommernachtstraum, die den Eskapaden der Zwerge und, jawohl, dem Zwergenland viel zu verdanken hat.
»Der Wald war für eine Elfengeschichte konzipiert, also war alles zweimal so groß wie normal und noch größer. Gänseblümchen, so groß wie Menschenköpfe und weiß wie Schlossgespenster, Fingerhutstauden hoch wie der Turm von Pisa, die wie Glöckchen klingelten, wenn man sie schüttelte. … Selbst die kleinen Elfen waren real – das Studio suchte das ganze Land nach Liliputanern ab. Bald begannen, wahr oder erfunden, wilde Geschichten herumzugehen – wie ein armer Kleiner ins Klo gefallen war und eine halbe Stunde herumpaddelte, bis jemand mal dringend pinkeln musste und auf die Toilette gerannt kam und ihn sah und herausfischte. Einem anderen bot man im Brown Derby, wo er mal einen Hamburger ziehen wollte, das Kinderstühlchen an …«5
Inmitten all dieses Zwergengewimmels werden wir mit zwei Erwachsenenporträts konfrontiert, die sich sehr stark voneinander unterscheiden. Die gute Hexe Glinda ist hübsch rosa (nun ja, ganz hübsch, obwohl Dorothy sich dazu hinreißen lässt, sie sogar als »schön« zu bezeichnen). Sie hat eine hohe, turtelnde Stimme und ein Lächeln, das festgefroren zu sein scheint. Ein einziger ausgezeichneter Gag kommt aus ihrem Munde. Nachdem Dorothy abgestritten hat, selbst eine Hexe zu sein, zeigt Glinda auf Toto und fragt: »Oh, vielleicht ist das die Hexe«.Abgesehen von diesem Scherz verbringt sie die gesamte Szene damit, affektiert zu lächeln und ganz allgemein gütig, liebevoll und ein wenig zu dick gepudert auszusehen. Interessant, dass ihr, obwohl sie die gute Hexe ist, das Gute von Oz nicht innezuwohnen scheint. Die Menschen von Oz sind von Natur aus gut, es sei denn, sie befinden sich in der Macht der bösen Hexe (wie bewiesen durch das eher lockere Verhalten ihrer Soldaten, nachdem die Hexe zerschmolzen ist). In der moralischen Welt des Films ist nur das Böse äußerlich. Es wohnt einzig in der dualen Teufelsgestalt der Miss Gulch/bösen Hexe.
(Nebenbei eine Zwischenfrage, was die Darstellung des Zwergenlandes betrifft: Ist es nicht insgesamt um eine Winzigkeit zu hübsch, zu gepflegt, zu zuckersüß für einen Ort, der sich bis zu Dorothys Ankunft in der absoluten Gewalt der bösen Hexe des Ostens befand? Wieso besaß diese zerquetschte Hexe kein Schloss? Wie kommt es, dass ihr Despotismus so wenige Spuren im Land hinterlassen hat? Warum sind die Zwerge so relativ angstfrei, verstecken sich nur kurz, bevor sie auftauchen, und kichern, während sie sich verstecken? Ein ketzerischer Gedanke drängt sich auf: Vielleicht war die Hexe des Ostensja gar nicht so böse– schließlich hat sie dafür gesorgt, dass die Straßen sauber, die Häuser ordentlich gestrichen und gut instand gehalten waren, und ganz zweifellos waren die Züge, falls es denn solche gab, immer pünktlich. Außerdem und im Gegensatz zu ihrer Schwester scheint sie ohne den Einsatz von Soldaten, Polizisten und anderen Instrumenten der Unterdrückung regiert zu haben. Warum also war sie so verhasst? Ist nur so eine Frage.)
Glinda und die Hexe des Westens sind die beiden einzigen Symbole der Macht in einem Film, der weitgehend ohne Macht auskommt, daher ist es interessant, sie »auseinander zu nehmen«. Beide sind Frauen, und auffallend amZauberer von Ozist, dass es keinen männlichen Helden gibt – denn trotz ihrer Klugheit, ihres guten Herzens und ihrer Courage vermag man weder in der Vogelscheuche noch im Blechmann oder dem feigen Löwen klassische Hollywood-Hauptrollen zu sehen. Das Machtzentrum in diesem Film ist ein Dreieck, dessen Spitzen Glinda, Dorothy und die Hexe sind. Die vierte Spitze, an der man sich während eines großen Teils der Erzählung den Zauberer vorstellen muss, entpuppt sich später als Illusion. Die Macht der Männer ist illusorisch, suggeriert der Film. Die Macht der Frauen ist real.
Sieht man sich die beiden Hexen an, die gute und die böse – würde irgendjemand freiwillig auch nur fünf Minuten mit Glinda verbringen? Die Schauspielerin dieser Rolle, Billie Burke, Ex-Ehefrau von Flo Ziegfeld, redete privat genauso affektiert wie in ihrer Rolle (sie neigte dazu, auf negative Kritik mit zitternder Unterlippe und einem gehauchten Aufschrei: »Oh, Siewollen mir wohl Angst machen!« zu reagieren). Margaret Hamiltons böse Hexe des Westens dagegen erobert die Szene von ihrem allerersten, grüngesichtigen Fauchen an. Gewiss, Glinda ist »gut«, und die böse Hexe ist »böse«, aber Glinda ist eine trillernde Nervensäge, während die böse Hexe schlank und gemein ist. Sehen Sie sich die Kleidung der beiden an: rüschenbesetztes Rosa gegenüber gertenschlankem Schwarz.Kein Vergleich!Betrachten wir ihr Verhalten gegenüber anderen Frauen: Glinda lächelt affektiert, wenn sie als schön bezeichnet wird, und verunglimpft ihre un-schönen Schwestern, während die böse Hexe wütend über den Tod ihrer Schwester ist und sozusagen einen vernünftigen Sinn für Solidarität an den Tag legt. Wir mögen sie beschimpfen, und sie mag uns als Kinder eingeschüchtert haben, aber wenigstens bringt sie uns nicht so in Verlegenheit wie Glinda. Gewiss, Glinda strahlt eine Art gekünstelter mütterlicher Geborgenheit aus, während die Hexe des Westens, jedenfalls in dieser Szene, sonderbar zerbrechlich und hilflos wirkt, weil sie zu leeren Drohungen greifen muss – »Also gut, ich warte meine Zeit ab. Aber hüte dich, kreuze nie meinen Weg«–, aber genau wie der Feminismus versucht, alte, herabsetzende Wörter wie altes Weib, Vettel, Hexe zu rehabilitieren, so könnte man sagen, dass die böse Hexe des Westens das positivere der beiden Bilder kraftvoller Frauen verkörpert, die hier angeboten werden.
Glinda und die Hexe streiten sich hitzig um die rubinroten Schuhe, die Glinda von den Füßen der toten Hexe des Ostens an Dorothys Füße hext und die von der bösen Hexe des Westens anscheinend nicht wieder weggehext werden können. Aber Glindas Anweisungen an Dorothy klingen seltsam rätselhaft, ja sogar widersprüchlich. So sagt sie zu Dorothy (1): »Es muss wohl ein mächtiger Zauber drin wohnen, sonst wäre sie darauf nicht so versessen.« Und später (2): »Du darfst diese roten Schuhe nicht einen Augenblick von deinen Füßen nehmen, sonst fällst du in die Gewalt der bösen Hexe des Westens.« Nun lässt Aussage 1 darauf schließen, dass Glinda über den Zauber der roten Schuhe nicht informiert ist, während Aussage 2 darauf hindeutet, dass sie alles über ihre schützende Macht weiß. Außerdem weist keine der beiden Aussagen auf die Rolle der roten Schuhe hin, die diese später bei Dorothys Heimkehr nach Kansas spielen. Diese Verwirrungen sind höchstwahrscheinlich Spätfolgen der endlosen Meinungsverschiedenheiten bei der Entstehung des Drehbuches, wobei die Funktion der Schuhe Objekt hitziger Diskussionen war. Aber man kann Glindas Widersprüche ebenso gut als Beweis dafür gelten lassen, dass eine gute Fee oder Hexe den Menschen, wenn sie versucht, ihnen zu helfen, nie und nimmer alles gibt. Auf Glinda trifft letztlich also wohl auch ihre eigene Beschreibung des Zauberers von Oz zu: Oh, er ist gut, aber voll von Geheimnissen.
»Folge nur dem gelben Steinweg«, sagt Glinda und kullert in ihrer Seifenblase auf und davon, den fernen blauen Bergen entgegen, während Dorothy, geometrisch beeinflusst, wie es nach einer Kindheit zwischen Dreiecken, Kreisen und Rechtecken wohl jeder wäre, ihre Reise genau an dem Punkt beginnt, von dem die gelbe Spirale ausgeht. Als sie und die Zwerge Glindas Anweisungen mit ihren manchmal schrillen, hohen, manchmal guttural tiefen Stimmen wiederholen, geht etwas mit Dorothys Füßen vor. Ihre Bewegungen nehmen einen synkopenhaften Rhythmus an, der in wunderschönen, gemächlichen Stufen immer ausgeprägter wird. Als schließlich das ganze Ensemble zum ersten Mal in den Titelsong des Films ausbricht – »You’re Off to See the Wizard« –, sehen wir in voller Pracht den flinken, cleveren Wechselhüpfer, der das Leitmotiv der ganzen Reise sein wird:
You’re off to see the Wizard
(hü-hüpf)
The wonderful Wizzardavoz
(hü-hüpf)
So macht sich Dorothy Gale, bereits Nationalheldin vom Zwergenland und schon (wie ihr die Zwerge versichert haben) ein Teil der Geschichte, der »im Ehrensaal aufgestellt werden wird«, munter hü-hüpfend auf ihren Schicksalsweg und wandert, wie es Amerikaner eben müssen, nach Westen.
Off-Camera-Anekdoten über die Produktion eines Films können zugleich köstlich und enttäuschend sein. Einerseits besteht da unleugbar eine gewisse Trivial-Pursuit-Neugier, die befriedigt werden will: Wussten Sie, dass Buddy Ebsen, der spätere Patriarch der Beverly Hillbillies, ursprünglich die Vogelscheuche war, dann aber mit Ray Bolger die Rollen tauschte, weil der nicht den Blechmann spielen wollte? Und wussten Sie, dass Ebsen aus dem Film aussteigen musste, weil er von seinem Blechkostüm eine Aluminiumvergiftung bekam? Und wussten Sie, dass Margaret Hamilton sich beim Drehen der Szene, in der die Hexe an den Himmel über der SmaragdstadtSurrender Dorothy(Liefert Dorothy aus) schreiben musste, ziemlich schwere Brandverletzungen an der Hand zuzog und dass sich ihr Stunt-Double Betty Danko bei der Wiederholung der Szene noch schwerer verbrannte? Wussten Sie, dass sich Jack Haley (der dritte und endgültige Blechmann) in seinem Kostüm nicht setzen, sondern nur an einem extra konstruierten »Lehnbrett« ausruhen konnte? Dass keiner der drei männlichen Hauptdarsteller die Mahlzeiten in derMGM-Kantine einnehmen durfte, weil ihr Make-up zu abstoßend wirkte? Oder dass Margaret Hamilton statt eines richtigen Umkleideraums ein primitives Zelt zugewiesen bekam, als sei sie auch in Wirklichkeit eine Hexe? Oder dass Toto eine Hündin war und eigentlich Terry hieß? Und vor allem, wussten Sie, dass der Gehrock, den Frank Morgan als Professor Marvel/Zauberer von Oz trug, in einem Secondhandstore gekauft worden war und den Namen L. Frank Baum eingestickt trug? Wie sich herausstellte, war der Gehrock tatsächlich für den Autor persönlich angefertigt worden; so trug der Zauberer im Film tatsächlich die Kleider seines Schöpfers.
Viele dieser Geschichten hinter den Kulissen zeigen uns leider, dass bei der Herstellung eines Films, der so viele Menschen glücklich gemacht hat, niemand so richtig glücklich war. Es trifft zwar mit ziemlicher Sicherheit nicht zu, dass Haley, Bolger und Lahr zu Judy Garland unfreundlich waren, wie es in manchen Geschichten heißt, aber Margaret Hamilton fühlte sich eindeutig von den Jungs ausgeschlossen. Sie war einsam auf dem Set, ihre Drehtage fielen nur selten einmal mit denen des Schauspielers zusammen, den sie kannte, Frank Morgan, und sie konnte nicht mal ohne Hilfe pinkeln gehen. Tatsächlich hat wohl kaum jemand – bestimmt nicht Lahr, Haley und Bolger in ihren komplizierten Kostümen, die sie tagtäglich nur höchst ungern anlegten – beim Drehen eines der vergnüglichsten Streifen der Filmgeschichte Vergnügen empfunden. Im Grunde wollen wir das alles gar nicht wissen; und dennoch sind wir eifrig darauf bedacht, uns genau das zu wünschen, was unsere Illusionen zerstören könnte, und so wollen wir es eben wissen, und wollen, wollen, wollen.
Als ich mich in das Geheimnis des Alkoholproblems unseres Zauberers von Oz vertiefte und erfuhr, dass Morgan nach W. C. Fields und Ed Wynn nur die dritte Wahl für diese Rolle gewesen war, und als ich mich fragte, wie viel verächtliche Boshaftigkeit Fields wohl in die Rolle eingebracht haben würde und wie es wohl gewesen wäre, wenn sein weiblicher Gegenpart, die Hexe, von der ersten Wahl, Gale Sondergaard, gespielt worden wäre, die nicht nur eine große Schönheit, sondern überdies ein weiterer »Sturm«(gale)zusätzlich zu Dorothy und ihrem Tornado gewesen wäre, da betrachtete ich ein altes Farbfoto von der Vogelscheuche, dem Blechmann und Dorothy, die in einer Walddekoration posierten, umgeben von buntem Herbstlaub, und merkte auf einmal, dass ich gar nicht die Stars vor mir hatte, sondern ihre Stunt-Doubles, ihre Stand-ins. Es war nur ein wenig bemerkenswertes Studio-Standfoto, aber es raubte mir den Atem, weil auch dieses Foto ebenso traurig wirkte wie faszinierend. In meinen Augen wurde es zum Epitom meiner eigenen zwiespältigen Reaktionen.
Da stehen sie, Nathanael Wests Heuschrecken, die ultimativen Möchtegerns. Garlands Schatten Bobbie Koshay, die Hände hinterm Rücken verschränkt und eine weiße Schleife im Haar, tut tapfer ihr Möglichstes, ein Lächeln zu zeigen, weiß aber nur allzu gut, dass sie eine Fälschung ist: Sie trägt keine rubinroten Schuhe an den Füßen. Das Double der Vogelscheuche blickt ebenfalls finster drein, obwohl der Mann sich vor dem großen Sackleinen-Make-up gedrückt hat, das Bolgers tagtägliches Schicksal war. Gäbe es nicht ein kleines Strohbündel, das aus seinem rechten Ärmel lugt, könnte man meinen, eine Art Tippelbruder vor sich zu haben. Zwischen ihnen steht, ganz in Metall, das noch blechernere Echo des Blechmanns und blickt verdammt bitter drein. Stand-ins kennen ihr Schicksal: Sie wissen, dass wir ihre Existenz zu leugnen suchen. Selbst wenn uns der Verstand sagt, dass wir in dieser oder jener schwierigen Szene – wenn die Hexe fliegt oder der feige Löwe durch ein Glasfenster springt – nicht wirklich die Stars sehen, besteht der Teil von uns, der den Unglauben verbannt hat, energisch darauf, dass wir die Stars und nicht ihre Doubles sehen. So werden die Stand-ins unsichtbar gemacht, selbst wenn sie im vollen Scheinwerferlicht stehen. Obwohl sie auf der Leinwand zu sehen sind, bleiben sie doch immer im Off.