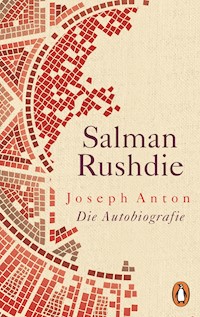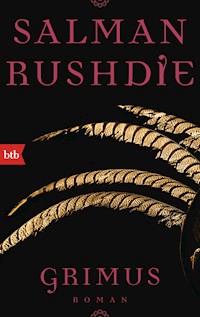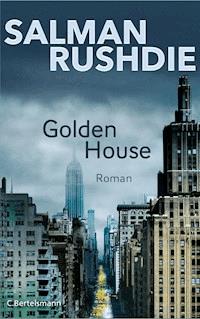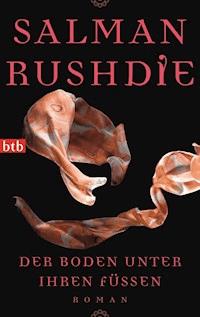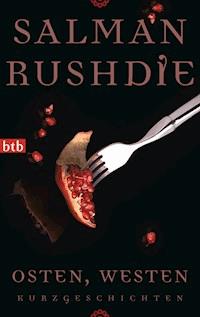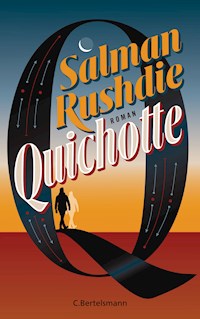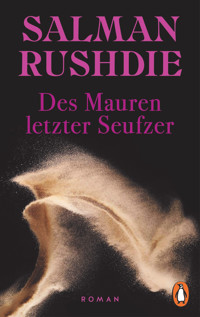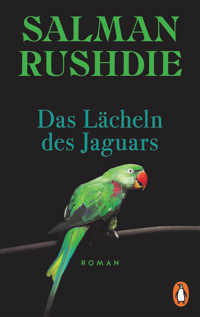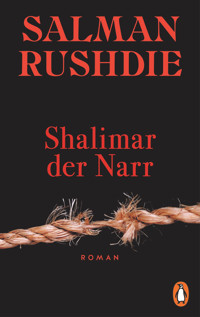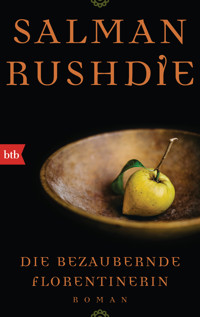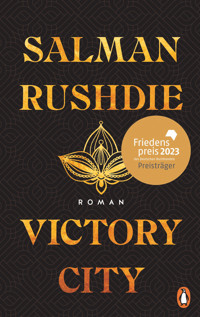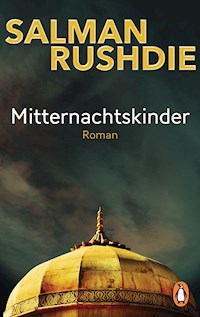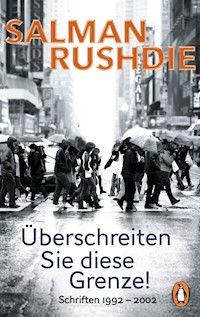2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bertelsmann, C.
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Salman Rushdie erhält den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2023 »für seine Unbeugsamkeit, seine Lebensbejahung und dafür, dass er mit seiner Erzählfreude die Welt bereichert.« (Aus der Begründung der Jury)
Salman Rushdie erzählt in seinem neuen Roman eine zeitlose Liebesgeschichte in einer Welt, in der die Unvernunft regiert.
Dunia, die Fürstin des Lichts, verliebt sich in den Philosophen Ibn Rush und zeugt mit ihm viele Kinder, die in die Welt hinaus ziehen. Ibn Rush gilt als Gottesfeind, sein Gegenspieler ist der tiefgläubige islamische Philosoph Ghazali. Die Geister der beiden geraten in Streit. Der Kampf des Glaubens gegen die Vernunft beginnt und entfacht einen so furchtbaren Sturm, dass sich im Weltall ein Spalt öffnet, durch den die zerstörerischen Dschinn zu uns kommen. Die Existenz der Welt steht auf dem Spiel. Dunia entschließt sich, den Menschen zu helfen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 479
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Salman Rushdie
Zwei Jahre, acht Monate und achtundzwanzig Nächte
Roman
Aus dem Englischen von Sigrid Ruschmeier
C. Bertelsmann
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel »Two Years Eight Months and Twenty-Eight Nights« bei Random House, New York.
Zwei Jahre, acht Monate und achtundzwanzig Nächte ist eine erfundene
Geschichte. Namen, Orte und Handlung sind entweder der Phantasie des Autors entsprungen oder werden fiktiv gebraucht. Jegliche Ähnlichkeit mit tatsächlichen Ereignissen, Örtlichkeiten, lebenden oder toten Personen ist reiner Zufall.
Die Arbeit der Übersetzerin wurde freundlicherweise
vom Deutschen Übersetzerfonds gefördert. Die Übersetzerin dankt Mark Baker für unermüdliche, kenntnisreiche Hilfe.
Mehr Informationen zum Werk des Autors
unter www.salman-rushdie.de
1. Auflage
Copyright © 2015 by Salman RushdieCopyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2015 beim C. Bertelsmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbHRedaktion: Afra MargarethaSatz: Uhl + Massopust, AalenISBN 978-3-641-17490-3
www.cbertelsmann.de
Für Caroline
El sueño de la razón produce monstruos
Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer
(Nr. 43 aus Los Caprichos von Francisco Goya. Der vollständige
Titel der Radierung im Prado lautet: »Die von der Vernunft verlassene Phantasie gebiert unfassbare Ungeheuer; mit ihr vereint ist sie die Mutter der Künste und der Ursprung der Wunder.«)
Man »glaubt« nicht an Märchen.Es gibt keine Theologie, keinen Dogmenkatalog, kein Ritual, keine Institution, keine Erwartung an ein bestimmtes Verhalten. Märchen handeln von dem Unerwarteten und der Wandelbarkeit der Welt.
GEORGE SZIRTES
Statt das Buch zu schreiben, das ich hätte schreiben sollen, den Roman, den man von mir erwartete, habe ich das Buch erdichtet, das ich selbst gern lesen wollte, das Buch eines anderen Autors, aus einer anderen Zeit, aus einem anderen Land, auf einem Dachboden entdeckt.
ITALO CALVINO
Hier bemerkte Scheherezade den Tagesanbruch und verstummte.
ERZÄHLUNGEN AUS TAUSENDUNDEINER NACHT
Die Kinder des Ibn Ruschd
h
Sehr wenig weiß man, doch viel wurde geschrieben über die wahre Natur der Dschinn, jener Wesen aus rauchlosem Feuer. Sind sie gut oder böse, teuflisch oder gütig? Diese Fragen werden heiß diskutiert. Weitgehend einig ist man sich über Folgendes: Sie sind launisch, unberechenbar und mutwillig, können sich mit hoher Geschwindigkeit fortbewegen, Größe und Gestalt wechseln, wenn es ihnen beliebt oder sie dazu genötigt werden, können Sterblichen Wünsche gewähren und haben ein grundsätzlich anderes Zeitgefühl als Menschen. Man verwechsle sie nicht mit Engeln, obgleich manche der alten Geschichten fälschlich meinen, der Teufel selbst, der gefallene Engel Luzifer, der Sohn der Morgenröte, sei der größte der Dschinn. Lange strittig waren auch ihre Wohnstätten. Einige, noch ältere Geschichten behaupten, in durchaus verleumderischer Absicht, dass die Dschinn hier unter uns auf Erden, in der sogenannten niederen Welt, in Ruinen und an vielerlei ungesunden Orten leben wie Müllhalden, Totenäckern, Abtrittsgruben, Kloaken und, wo immer möglich, Misthaufen. Diesen ehrenrührigen Äußerungen nach zu urteilen, täten wir gut daran, uns nach jedem Kontakt mit Dschinn gründlich zu waschen. Sie stinken und übertragen Krankheiten. Berühmte Kommentatoren behaupten freilich schon lange, was wir heute als gesichert ansehen: Die Dschinn leben in ihrer eigenen, von unserer durch einen Schleier getrennten Welt, und diese obere Welt, die manchmal Peristan oder Märchenland heißt, ist zwar ungeheuer groß und weit, ihre Beschaffenheit uns aber verborgen.
Die Dschinn als nicht menschlich zu bezeichnen, erübrigt sich fast, doch die Menschen haben zumindest einige Eigenschaften mit ihren sagenhaften Gegenspielern gemein. In Religionsdingen zum Beispiel gibt es unter den Dschinn Anhänger aller Glaubensrichtungen auf Erden, aber auch Ungläubige, denen die Vorstellung von Göttern und Engeln so fremd ist, wie sie selbst es den Menschen sind. Und obwohl viele Dschinn keinerlei Moral kennen, kennen zumindest einige sehr wohl den Unterschied zwischen Gut und Böse, zwischen dem Pfad zur rechten und dem zur linken Hand.
Manche Dschinn können fliegen, andere kriechen in Schlangengestalt über den Boden oder rennen bellend und die Reißzähne bleckend als riesige Hunde herum. Im Meer und bisweilen auch in der Luft nehmen sie gern das äußere Erscheinungsbild von Drachen an. Dschinn niederen Ranges können auf der Erde ihre Form häufig nicht lange bewahren. Diese amorphen Kreaturen schlüpfen gelegentlich durch Ohren, Nasen oder Augen in die Menschen, nehmen deren Körper eine Weile lang in Besitz und werfen ihn ab, wenn sie seiner überdrüssig sind. Leider überleben die Menschen eine solche Besetzung nicht.
Die weiblichen Dschinn, also die Dschinnya oder Dschinniri, sind noch rätselhafter, noch komplizierter und seltener zu fassen, weil sie Schattenfrauen aus feuerlosem Rauch sind. Es gibt grausame Dschinniri und Dschinniri der Liebe, vielleicht aber sind sie in Wirklichkeit identisch, und grausame Naturen werden von Liebe besänftigt, während liebende Geschöpfe durch schlechte Behandlung zu einer Brutalität angestachelt werden, die wir Sterblichen uns gar nicht vorstellen können.
Dies ist die Geschichte einer Dschinnya, einer hochrangigen Prinzessin, die Blitzprinzessin genannt wurde, weil sie über den Blitz gebot, und die einst, nach unserem Sprachgebrauch im zwölften Jahrhundert, einen sterblichen Mann liebte. Es ist auch die Geschichte ihrer vielen Nachkommen und wie sie nach langer Abwesenheit in die Welt zurückkehrt, sich noch einmal für kurze Zeit verliebt und dann in den Krieg zieht. Erzählt wird des Weiteren von anderen Dschinn, männlichen und weiblichen, fliegenden und kriechenden, guten, bösen und moralisch gleichgültigen, und von der Zeit der Krise, der aus den Fugen geratenen Zeit, welche wir die Zeit der Seltsamkeiten nennen und die zwei Jahre, acht Monate und achtundzwanzig Nächte währte, mit anderen Worten, tausendundeine Nacht. Und ja, wir leben seit damals schon wieder weitere tausend Jahre, sind aber alle für immer durch diese Zeit verändert. Ob zum Guten oder Bösen, darüber wird unsere Zukunft entscheiden.
Im Jahre 1195 geriet der große Philosoph Ibn Ruschd, einst der Kadi oder Richter von Sevilla und seit Kurzem der Leibarzt des Kalifen Abu Jusuf Jakub in seiner Heimatstadt Córdoba an höchster Stelle in Verruf und fiel in Ungnade, weil seine freisinnigen Ideen den zunehmend mächtigen und sich wie die Pest im maurischen Spanien verbreitenden fanatischen Berbern nicht passten. Er wurde in das kleine Dorf Lucena nicht weit von Córdoba, verbannt, in ein Dorf voller Juden, die nicht mehr sagen durften, dass sie Juden waren, weil die vorherige Herrscherdynastie von al-Andalus, die der Almoraviden, sie gezwungen hatte, zum Islam überzutreten. Ibn Ruschd, der Philosoph, der seine Weltanschauung nicht mehr darlegen durfte, dessen sämtliche Schriften verboten und dessen Bücher verbrannt worden waren, fühlte sich unter den Juden, die nicht sagen durften, dass sie Juden waren, gleich zu Hause. Er war der Günstling des Kalifen aus der herrschenden Dynastie, den Almohaden, gewesen, doch Günstlinge geraten aus der Mode, und Abu Jusuf Jakub gestattete den Dogmatikern, den großen Kommentator des Aristoteles aus der Stadt zu vertreiben.
Der Philosoph, der von seiner Philosophie schweigen musste, lebte in einer engen, ungepflasterten Gasse in einem ärmlichen Haus mit kleinen Fenstern, und der Mangel an Licht bedrückte ihn schrecklich. Er richtete sich eine Arztpraxis in Lucena ein, und wegen seines Ansehens als früherer Leibarzt des Kalifen kamen auch Patienten; zusätzlich benutzte er sein ihm verbliebenes Vermögen, um in den Pferdehandel einzusteigen, und investierte in die Herstellung der großen Tonkrüge, der tinajas, in denen die Juden, die keine Juden mehr waren, Olivenöl und Wein aufbewahrten und verkauften. Nicht lange nach dem Beginn seines Exils erschien eines Tages ein Mädchen von vielleicht sechzehn Lenzen vor seiner Haustür, lächelte, klopfte aber weder an noch störte sie in irgendeiner Weise seinen Gedankengang, sondern stand einfach nur da und wartete geduldig, bis er seine Anwesenheit bemerkte und sie hereinbat. Dann erzählte sie ihm, sie sei seit Kurzem elternlos, habe keinerlei Einkommen, wolle aber nicht in einem Hurenhaus arbeiten. Es heiße Dunia, was nicht wie ein jüdischer Name klang, aber den durfte sie ohnehin nicht sagen, und weil sie des Lesens und Schreibens unkundig war, konnte sie ihn auch nicht aufschreiben. Dunia berichtete weiter, ein Angehöriger des fahrenden Volkes habe ihr den Namen vorgeschlagen, gesagt, er komme aus dem Griechischen und bedeute »die Welt«, und diese Vorstellung habe ihr gefallen. Ibn Ruschd, auch Übersetzer von Aristoteles, wollte ihr gegenüber nicht wortklauberisch sein, denn er wusste, dass »Dunia« in so vielen Sprachen »die Welt« bedeutete, dass übertriebene Genauigkeit fehl am Platze war. »Warum hast du dich nach der Welt genannt?«, fragte er sie, und sie schaute ihm in die Augen und erwiderte: »Weil aus mir eine Welt strömen wird und die, welche aus mir strömen, sich in alle Welt zerstreuen werden.«
Da er ein Mann der Vernunft war, kam er gar nicht auf die Idee, dass sie ein übernatürliches Wesen sein könne, eine Dschinnya aus dem Stamm der weiblichen Dschinn, den Dschinniri: eine vornehme Prinzessin dieses Stammes, die, fasziniert von den Menschen im Allgemeinen und den geistvollen im Besonderen, auf irdischer Abenteuersuche war. Er nahm sie als Haushälterin und Geliebte in sein bescheidenes Heim, und bei einer ihrer nächtlichen Umarmungen flüsterte sie ihm ihren »wahren« – das heißt falschen – jüdischen Namen ins Ohr, und das wurde ihr Geheimnis. Dunia, die Dschinnya, war so atemberaubend fruchtbar, wie sie es prophezeit hatte. In den folgenden zwei Jahren, acht Monaten und achtundzwanzig Tagen und Nächten wurde sie drei Mal schwanger und gebar jedes Mal eine Vielzahl von Kindern, wenigstens sieben, hatte es den Anschein, und einmal elf oder möglicherweise sogar neunzehn; die Aufzeichnungen sind weder eindeutig noch auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfbar. Alle Kinder erbten ihr besonderes Kennzeichen: Sie hatten angewachsene Ohrläppchen.
Wäre Ibn Ruschd ein Kenner des geheimnisumwehten Wissens des Okkulten gewesen, hätte er damals begriffen, dass seine Nachkommen die Sprösslinge einer nichtmenschlichen Mutter waren, doch er war zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um groß darüber nachzudenken. (Manchmal glauben wir, dass es ein Glück für ihn und unsere ganze Geschichte war, dass Dunia ihn wegen seines brillanten Verstandes liebte, denn er war vielleicht zu eigensüchtig, als dass man ihn um seines Wesens willen hätte lieben können.) Der Philosoph, der nicht philosophieren durfte, befürchtete, dass seine Kinder von ihm die bedauerlichen Anlagen erben würden, die ihm Reichtum und Fluch zugleich waren. »Wer dünnhäutig, weitsichtig und redselig ist«, sagte er, »fühlt zu intensiv, sieht zu klar und spricht zu freimütig. Er ist der Welt gegenüber verwundbar, während die Welt sich selbst für unverwundbar hält, er versteht ihre Wandelbarkeit, während sie meint, sie sei unwandelbar, er ahnt vor allen anderen, was kommt, er weiß, dass die barbarische Zukunft die Tore zur Gegenwart einreißt, während sich andere an die abgelebte, hohle Vergangenheit klammern. Wenn unsere Kinder Glück haben, erben sie nur deine Ohren, da sie aber leider und unleugbar auch meine sind, denken sie vermutlich zu bald zu viel und hören zu früh zu viel, und darunter Dinge, die man nicht denken oder hören darf.«
»Erzähl mir eine Geschichte«, bat Dunia oft, wenn sie zu Beginn ihres Zusammenlebens beieinanderlagen. Er entdeckte rasch, dass sie ihrer scheinbaren Jugend zum Trotz im Bett und außerhalb anspruchsvoll und eigenwillig war. Er war ein großer Mann und sie wie ein Vögelchen oder eine Heuschrecke, doch er hatte oft den Eindruck, dass sie die Stärkere war. Sie war die Freude seiner alten Tage, verlangte ihm aber einen Aufwand an Energie ab, den er nur mit Mühe betreiben konnte. In seinem Alter wollte er im Bett bisweilen nur noch schlafen, doch Dunia betrachtete seine Versuche einzunicken als feindlichen Akt. »Wenn du die ganze Nacht Sex mit mir hast«, sagte sie, »bist du sogar ausgeruhter, als wenn du stundenlang schnarchst wie ein Ochse. Das weiß doch jeder.« Betagt, wie er war, fand er es nicht immer leicht, sich in den für den Geschlechtsakt erforderlichen Zustand zu bringen, besonders in mehreren aufeinanderfolgenden Nächten, aber sie betrachtete seine ältlichen Erregungsprobleme als Beweis für sein liebloses Wesen. »Wer eine Frau attraktiv findet, hat keine Probleme«, beschied sie ihn. »Ganz egal, wie viele Nächte hintereinander. Ich bin immer geil, ich kann ewig weitermachen, anhalten gibt’s für mich nicht.«
Seine Entdeckung, dass er ihre körperliche Inbrunst durch Erzählen dämpfen konnte, verschaffte ihm eine gewisse Erleichterung. Wenn sie »Erzähl mir eine Geschichte« sagte und sich unter seinen Arm schmiegte, sodass seine Hand auf ihrem Kopf lag, dachte er, ah, gut, für heute Abend bin ich aus dem Schneider, und erzählte ihr nach und nach die Geschichte seiner Gedanken. Dabei benutzte er Worte, die viele seiner Zeitgenossen unerhört fanden, wie zum Beispiel »Vernunft«, »Logik« und »Wissenschaften«, die drei Säulen seines Denkens, der Ideen, die dazu geführt hatten, dass seine Bücher verbrannt wurden. Dunia fürchtete diese Worte, aber ihre Furcht erregte sie, und sie schmiegte sich enger an ihn. »Halt mir den Kopf, während du ihn mit deinen Lügen vollstopfst«, sagte sie.
In seinem Inneren trug er eine tiefe, schmerzliche Wunde, ja, er war ein geschlagener Mann, weil er die große Schlacht seines Lebens gegen einen Perser, Ghazali von Tus, verloren hatte, einen Kontrahenten, der seit fünfundachtzig Jahren tot war. Vor hundert Jahren hatte dieser ein Buch mit dem Titel Die Inkohärenz der Philosophen geschrieben, in dem er Griechen wie Aristoteles, die Neuplatoniker und ihre Anhänger sowie Ibn Ruschds große Wegbereiter Ibn Sina und al-Farabi angriff. Einmal war er in eine Glaubenskrise geraten, doch nachdem er die überwunden hatte, zur schlimmsten Geißel in der Weltgeschichte der Philosophie geworden. Die Philosophie, höhnte er, sei unfähig, die Existenz Gottes, ja nicht einmal die Unmöglichkeit der Existenz eines zweiten Gottes zu beweisen. Die Philosophie glaube an die Zwangsläufigkeit von Ursache und Wirkung, womit sie die Macht Gottes schmälere, der, wenn es ihm beliebe, ohne Weiteres eingreifen könne, um Wirkungen zu modifizieren und Ursachen wirkungslos zu machen.
»Was geschieht«, fragte Ibn Ruschd Dunia, wenn die Nacht sie in Stille hüllte und sie von verbotenen Dingen reden konnten, »wenn man ein brennendes Stöckchen mit einem Baumwollbällchen in Kontakt bringt?«
»Natürlich fängt die Baumwolle an zu brennen«, antwortete sie.
»Und warum fängt sie an zu brennen?«
»Weil das so ist«, sagte sie, »die Flamme züngelt an der Baumwolle, und die Baumwolle wird Teil des Feuers, so ist das nun mal.«
»Das Gesetz der Natur«, sagte er. »Ursachen haben Wirkungen.« Und sie nickte, während seine Hand ihren Kopf liebkoste.
»Er war anderer Meinung«, sagte Ibn Ruschd, und sie wusste, dass er den Feind meinte, Ghazali, der ihn besiegt hatte. »Er sagte, die Baumwolle sei entflammt, weil Gott sie dazu gezwungen habe, denn in Gottes Universum ist Gottes Wille das alleinige Gesetz.«
»Wenn Gott also gewollt hätte, dass die Baumwolle das Feuer löscht, wenn er gewollt hätte, dass das Feuer Teil der Baumwolle würde, hätte er das geschafft?«
»Ja«, sagte Ibn Ruschd. »Ghazalis Buch zufolge wäre Gott dazu imstande.«
Einen Moment lang dachte sie nach. »Das ist dumm«, sagte sie schließlich. Selbst im Dunklen spürte sie sein resigniertes Lächeln, ein Lächeln voller Zynismus, aber auch Schmerz, das sich schief über seinem bärtigen Gesicht ausbreitete. »Er würde sagen, das sei der wahre Glaube«, erwiderte Ibn Ruschd, »und dem zu widersprechen sei … inkohärent.«
»Dann kann also alles geschehen, wenn Gott es in Ordnung findet«, sagte sie. »Dann könnten zum Beispiel die Füße eines Mannes den Kontakt zum Boden verlieren, und er könnte auf der Luft laufen.«
»Ein Wunder«, sagte er, »besteht schlicht darin, dass Gott die Regeln ändert, nach denen er spielen will, und wenn wir das nicht begreifen, dann deshalb nicht, weil Gott letztlich unbegreiflich ist, mit anderen Worten, jenseits unseres Begreifens.«
Wieder schwieg sie. »Angenommen, ich nehme an«, sagte sie nach einer Weile, »dass Gott nicht existiert. Angenommen, du bringst mich dazu, anzunehmen, dass ›Vernunft‹, ›Logik‹ und ›Wissenschaften‹ eine Magie besitzen, die Gott überflüssig macht. Kann man überhaupt annehmen, dass es möglich wäre, etwas Derartiges anzunehmen?« Sie spürte, wie sein Körper erstarrte. Jetzt hat er Angst vor meinen Worten, dachte sie, und merkwürdigerweise gefiel ihr das. »Nein«, sagte er viel zu barsch. »Das wäre tatsächlich eine dumme Annahme.«
Er hatte selbst ein Buch geschrieben, Die Inkohärenz der Inkohärenz, eine Erwiderung auf Ghazali über einen Abstand von einhundert Jahren und eintausend Meilen, doch trotz des flotten Titels hielt der Einfluss des toten Persers unvermindert an, und dann war es schließlich Ibn Ruschd, der in Ungnade fiel; sein Buch wurde angezündet, und die Flammen verzehrten die Seiten, weil Gott in dem Moment beschlossen hatte, den Flammen genau das zu erlauben. In allen seinen Schriften hatte der Philosoph versucht, die Worte »Vernunft«, »Logik« und »Wissenschaften« mit den Worten »Gott«, »Glauben« und »Koran« in Einklang zu bringen, und es war ihm nicht gelungen, obwohl er mit großem Feinsinn von der Güte Gottes her argumentierte und anhand eines Zitats aus dem Koran zeigte, dass Gott existieren müsse, weil er der Menschheit den Garten der irdischen Lüste gegeben habe. Und Wir senden aus den Regenwolken Wasser in Strömen hernieder, auf dass Wir damit Korn und Kraut hervorbringen mögen und üppige Gärten. Ibn Ruschd war ein begeisterter Gärtner, und das Argument von der Güte Gottes schien ihm sowohl Gottes Existenz als auch sein grundsätzlich gütiges, tolerantes Wesen zu beweisen, doch die Anhänger eines strengeren Gottes hatten ihn geschlagen. Jetzt lag er einer konvertierten Jüdin bei (glaubte es zumindest), die er vor dem Hurenhaus bewahrt hatte und die offenbar in seine Träume sehen konnte, in denen er sich mit Ghazali in der Sprache der Unversöhnlichkeit stritt, der Sprache der Aufrichtigkeit und Konsequenz, welche ihn dem Scharfrichter ausgeliefert hätte, hätte er sie bei Tage gebraucht.
Während Dunia sich mit Kindern füllte und sie in das kleine Haus ausleerte, gab es immer weniger Platz für Ibn Ruschds exkommunizierte »Lügen«. Die intimen Momente des Paars wurden weniger und allmählich das Geld zum Problem. »Ein wahrer Mann stellt sich den Folgen seiner Handlungen«, sagte sie zu ihm, »besonders einer, der an Ursache und Wirkung glaubt.« Aber Geld zu verdienen war nie seine Stärke gewesen. Im Pferdehandel herrschten Lug und Betrug, es wimmelte von Halsabschneidern, und die Gewinne waren gering. »Verlang mehr Geld von deinen Patienten«, riet sie ihm einigermaßen gereizt. »Du solltest aus deinem früheren Ruf Kapital schlagen, selbst wenn er angekratzt ist. Was hast du denn sonst noch? Nur ein Kinder machendes Monster zu sein reicht nicht. Du machst Kinder, die Kinder kommen, die Kinder müssen essen. Das ist ›logisch‹. Das ist ›vernünftig‹.« Sie wusste, welche Worte sie gegen ihn verwenden konnte. »Und das nicht zu tun«, rief sie auftrumpfend, »ist ›Inkohärenz‹.«
(Die Dschinn lieben Glitzerkram, Gold, Juwelen und dergleichen, und sie verstecken ihre Schätze oft in unterirdischen Höhlen. Warum rief die Dschinnya-Prinzessin nicht am Tor einer Schatzhöhle Öffne dich! und löste ihre finanziellen Probleme auf einen Schlag? Weil sie sich für ein menschliches Leben entschieden hatte, für eine menschliche Partnerschaft als »menschliche« Ehefrau eines Menschen, und an diese Entscheidung gebunden war. Wenn sie zu diesem späten Zeitpunkt ihrem Geliebten ihr wahres Wesen enthüllt hätte, hätte sie auch enthüllt, dass Falschheit und Lüge den Kern ihrer Beziehung bildeten. Aus Angst, er werde sie verlassen, schwieg sie. Zum Schluss verließ er sie trotzdem, aus seinen eigenen menschlichen Gründen.)
Ein persisches Buch mit dem Titel Hazar Afsaneh oder Tausend Erzählungen war ins Arabische übersetzt worden. In der arabischen Fassung enthielt es weniger als eintausend Geschichten, doch die Handlung erstreckte sich über eintausend Nächte, oder – weil runde Zahlen als hässlich galten – über tausend Nächte und eine dazu. Ibn Ruschd hatte das Buch nie gesehen, aber manche der Geschichten am Hofe gehört. Die vom Fischer und dem Dschinni gefiel ihm gut, weniger wegen ihrer phantastischen Elemente (dem Dschinni aus der Lampe, den sprechenden Zauberfischen, dem verzauberten Prinzen, halb Mann, halb Marmor) als vielmehr wegen ihrer handwerklichen Schönheit, ihm gefiel es, wie Geschichten in andere Geschichten eingepackt waren und selbst wiederum neue einhüllten, sodass die Geschichte insgesamt, fand er, ein wahrer Spiegel des Lebens wurde, in dem alle unsere Geschichten die Geschichten anderer enthalten und ihrerseits in größeren, bedeutenderen Erzählungen enthalten sind, den Geschichten unserer Familien, unserer Heimatländer oder Glaubensvorstellungen. Schöner sogar noch als die Geschichten in den Geschichten war die Geschichte der Erzählerin, einer Prinzessin Schahrazad oder Scheherezade, die ihre Märchen ihrem mörderischen Ehemann erzählte, damit er sie nicht hinrichten ließ, die also Geschichten gegen den Tod erzählte und einen Barbaren damit zivilisieren wollte. Am Fußende des Ehebetts saß Scheherezades Schwester, die perfekte Zuhörerin, die stets um noch eine Geschichte bat, dann noch eine und noch eine. Dem Namen dieser Schwester entlehnte Ibn Ruschd den Namen für die Kinderscharen, die dem Schoß seiner Geliebten Dunia entsprangen, denn zufällig hieß die Schwester Duniazad, »und, bitte schön, was mir hier das düstere Haus füllt und mich zwingt, von meinen Patienten, den Kranken und Siechen von Lucena, Wucherhonorare zu verlangen, ist die Existenz der Dunia-zát, das heißt, des Stammes der Dunia, der Rasse der Dunianer, des Dunia-Volkes, was, wenn man es übersetzt, ›Volk der Welt‹ heißt.«
Dunia war zutiefst beleidigt. »Du meinst«, sagte sie, »weil wir nicht verheiratet sind, dürfen deine Kinder nicht den Namen ihres Vaters tragen?« Er verzog das Gesicht zu seinem traurigen Lächeln. »Es ist besser, wenn sie die Duniazat sind«, erwiderte er. »In dem Namen steckt die Welt, und er ist nicht von ihr gerichtet worden. Wenn sie Ruschdi hießen, würden sie mit einem Mal auf der Stirn in die Geschichte eingehen.« Dunia begann nun, von sich als Schwester Scheherezades zu sprechen, und bat auch immer um Geschichten, aber ihre Scheherezade war ein Mann, ihr Geliebter, nicht ihr Bruder, und manche seiner Geschichten hätten für sie beide den Tod bedeutet, wenn die Worte durch ein Versehen der Dunkelheit des Schlafzimmers entschlüpft wären. Er sei so was wie eine Anti-Scheherezade, sagte Dunia zu Ibn-Ruschd, das genaue Gegenteil der Erzählerin aus Tausendundeiner Nacht. Deren Geschichten hätten ihr das Leben gerettet, während seine sein Leben in Gefahr brächten. Doch dann gewann Kalif Abu Jusuf Jakub einen Krieg; bei Alarcos am Fluss Guardiana errang er seinen größten militärischen Erfolg gegen den christlichen König von Kastilien, Alfonso VIII. Nach der Schlacht bei Alarcos, in der seine Streitkräfte 150 000 kastilische Soldaten, die Hälfte des christlichen Heeres, erschlugen, nannte er sich al-Mansur, der Siegreiche, und mit dem Selbstbewusstsein des siegreichen Helden setzte er der Vorherrschaft der fanatischen Berber ein Ende und berief Ibn Ruschd zurück an den Hof.
Das Schandmal auf der Stirn des alten Philosophen wurde getilgt, sein Exil hatte ein Ende, er wurde rehabilitiert, fiel wieder in Gnade und wurde mit allen Ehren in seine alte Stellung als Leibarzt in Córdoba eingesetzt, zwei Jahre, acht Monate und achtundzwanzig Tage und Nächte nach Beginn seiner Verbannung, mit anderen Worten, eintausend Tage und Nächte und noch einen Tag und eine Nacht; und natürlich war Dunia wieder schwanger, und natürlich heiratete er sie nicht, natürlich gab er seinen Kindern niemals seinen Namen und nahm Dunia natürlich auch nicht mit zum Hof der Almohaden. Sie glitt aus der Historie, die er bei seinem Weggehen mitnahm, zusammen mit seinen Gewändern, seinen geistsprühenden Gegenreden und Manuskripten, manche gebunden, manche in Rollen, sowie den Abschriften der Bücher anderer Männer. Seine eigenen Schriften waren zwar verbrannt worden, doch viele Kopien, hatte er ihr einmal erzählt, überlebten in anderen Städten, in den Bibliotheken von Freunden und in Verstecken, wo er sie für den Fall, dass er eines Tages die Gunst seines Herrschers verlieren würde, deponiert hatte, denn ein weiser Mann bereitet sich stets auf Ungemach vor. Wenn er allerdings angemessen bescheiden bleibt, kann das Glück ihn auch überraschen. Ibn Ruschd ging, ohne zu Ende zu frühstücken oder sich zu verabschieden, und weder drohte sie ihm noch entdeckte sie ihm ihr wahres Wesen und die in ihr verborgene Macht, noch rief sie ihm hinterher: Ich weiß, was du in deinen Träumen sprichst, wenn du annimmst, was anzunehmen dumm wäre, wenn du nicht mehr versuchst, das Unversöhnliche zu versöhnen, sondern die schreckliche, fatale Wahrheit sagst. Nein, Dunia ertrug, dass die Historie sie zurückließ, und bemühte sich nicht, sie festzuhalten, so wie Kinder eine prächtige Prozession an sich vorbeiziehen lassen, sie jedoch in Erinnerung behalten und zu etwas Unvergesslichem machen, sie sich zu eigen machen. Dunia hörte auch nicht auf, ihn zu lieben, obgleich er sie so schnöde verlassen hatte. Du warst mein ein und alles, wollte sie ihm sagen, du warst meine Sonne und mein Mond, und wer hält mir jetzt den Kopf, wer küsst meine Lippen, wer wird unseren Kindern ein Vater sein? Doch er war ein großer Mann, bestimmt für unsterblichen Ruhm, und die schreienden Bälger waren nur Ballast, den er abwarf.
Eines Tages, flüsterte sie dem abwesenden Philosophen zu, eines Tages, wenn du längst tot bist, wirst du an den Punkt kommen, an dem du deine Familie um dich haben möchtest, und dann werde ich, deine Geistfrau, dir deinen Wunsch erfüllen, obwohl du mir das Herz gebrochen hast.
Man geht davon aus, dass Dunia noch eine Zeit lang unter den Menschen weilte, weil sie vielleicht wider besseres Wissen auf seine Rückkehr hoffte, und dass er ihr regelmäßig Geld schickte, sie vielleicht von Zeit zu Zeit besuchte, dass sie den Pferdehandel aufgab und nur mit den tinajas weitermachte, doch da Sonne und Mond der Historie für immer über ihrem Haus untergegangen waren, verwandelte sich ihre Geschichte in etwas Schattenhaftes, Mysteriöses, und es mochte sogar stimmen, was die Leute sagten, dass Ibn Ruschds Geist sie nach seinem Tod aufsuchte und noch mehr Kinder zeugte. Die Leute behaupteten auch, Ibn Ruschd habe ihr eine Lampe mit einem Dschinni mitgebracht, und der Dschinni sei der Vater der Kinder, die nach dem Weggang des Philosophen geboren wurden – wir sehen also, wie leicht Gerüchte die Dinge vollkommen verkehrt herum darstellen können! Weniger freundlich wurde auch kolportiert, dass die verlassene Frau jeden Mann, der ihr die Miete bezahlte, ins Haus nahm, und dass jeder Mann, den sie ins Haus nahm, ihr noch mehr Bälger hinterließ, sodass die Duniazat, die Bälger der Dunia, keine Ruschdi-Bankerte mehr waren, jedenfalls einige von ihnen nicht, oder viele oder die Mehrzahl nicht. In den Augen der meisten Leute war die Geschichte ihres Lebens eine zerfledderte Zeile geworden, deren Lettern zu nichtssagenden Formen zerfielen und keine Auskunft mehr darüber geben konnten, wie lange sie wie oder wo oder mit wem lebte und wann und wie – oder ob – sie starb.
Niemand bemerkte es oder interessierte sich dafür, dass sie sich eines Tages zur Seite drehte, durch einen Schlitz in der Welt glitt und nach Peristan zurückkehrte, in die andere Realität, die Welt der Träume, die die Dschinn in regelmäßigen Abständen verlassen, um die Menschheit zu plagen oder zu beglücken. Die Dorfbewohner von Lucena meinten, sie habe sich aufgelöst, vielleicht in feuerlosen Rauch. Nachdem Dunia unsere Welt verlassen hatte, nahm die Zahl der Reisenden aus der Welt der Dschinn in unsere Welt ab, und dann kam sogar lange überhaupt niemand mehr, und das phantasielose Unkraut der Konvention und die langweiligen Dornbüsche alles Irdischen überwucherten die Schlitze in der Welt, bis diese schließlich vollkommen zugewachsen waren und unsere Vorfahren sich, so gut sie konnten, ohne die Hilfe von Flüchen oder Magie behelfen mussten.
Aber Dunias Kinder wuchsen und gediehen. So viel kann man sagen. Und als die Juden fast dreihundert Jahre später aus Spanien vertrieben wurden, sogar die Juden, die nicht sagen durften, dass sie Juden waren, gingen Dunias Kindeskinder in Cádiz und Palos de Moguer auf Schiffe, zu Fuß über die Pyrenäen oder flogen auf fliegenden Teppichen oder gigantischen Amphoren wie die Dschinn davon, mit denen sie ja verwandt waren. Sie durchquerten Kontinente, segelten über die sieben Meere, erklommen hohe Berge, schwammen durch mächtige Ströme, glitten in tiefe Täler, suchten Zuflucht und Obdach, wo immer sie sich ihnen boten, und vergaßen einander rasch beziehungsweise erinnerten sich so lange wie möglich und vergaßen sich dann oder aber vergaßen sich nie und wurden eine Familie, die eigentlich keine Familie mehr war, ein Stamm, der eigentlich kein Stamm mehr war. Sie nahmen jeden Glauben an oder keinen, und viele von ihnen wussten nach Jahrhunderten der Konvertierung nichts mehr von ihren übernatürlichen Ursprüngen oder auch der erzwungenen Konvertierung der Juden, und so wurden manche krankhaft religiös, andere verächtliche Nichtgläubige. Sie waren eine Familie ohne Ort, aber mit Angehörigen allerorts, ein Dorf ohne Ort, das sich bald hier, bald dort auf diesem Globus befinden konnte, wie Pflanzen ohne Wurzeln, Moose, Flechten oder Kletterorchideen, die sich an andere anlehnen müssen, weil sie nicht allein stehen können.
Die Historie ist nicht freundlich zu denen, die sie fallen lässt, kann aber ebenso unfreundlich zu denen sein, die sie machen. Ibn Ruschd starb (normal am Alter, glauben wir zumindest), als er kaum ein Jahr nach seiner Rehabilitierung durch Marrakesch reiste, und erlebte weder, wie sein Ruhm wuchs, noch, wie er sich über die Grenzen seiner Welt in die Welt der Ungläubigen dahinter ausbreitete, wo seine Kommentare zu Aristoteles die Popularität seines mächtigen Vorgängers begründeten und zu Eckpfeilern der gottlosen Philosophie der Ungläubigen wurden, die saecularis genannt wurde, also eine Idee bedeutete, die nur einmal in einem saeculum entsteht, einer Zeitspanne der Welt, oder eine Idee für alle Zeiten, die das genaue Ebenbild und Echo jener Ideen war, von denen er nur in seinen Träumen gesprochen hatte. Als frommer Mann wäre er vielleicht von dem Platz, den die Geschichte ihm zuwies, weniger erbaut gewesen, denn für einen Gläubigen ist es schon ein seltsames Schicksal, wenn er zu Ideen inspiriert, die Glauben nicht nötig haben, und ein noch seltsameres Schicksal ist es für die Philosophie eines Mannes, über die Grenzen seiner Welt hinaus zu obsiegen, aber innerhalb dieser Grenzen in Vergessenheit zu geraten, denn in der Welt, die Ibn Ruschd kannte, mehrten sich die Kinder seines toten Widersachers Ghazali und erbten das Königreich, während seine eigene uneheliche Brut sich ausbreitete, seinen, ihr verbotenen Namen hinter sich ließ und die Erde bevölkerte. Ein beträchtlicher Teil der Überlebenden gelangte dank des Phänomens der Clusterbildung, das zu der rätselhaften Unlogik der zufälligen Verteilung gehört, auf den großen nordamerikanischen Kontinent, während viele andere auf dem großen indischen Subkontinent landeten, von denen sich später wiederum viele gen Westen und Süden über den amerikanischen Doppelkontinent und von der großen Raute am Fuße Asiens aus sich nördlich und westlich in aller Herren Länder verbreiteten, denn eins kann man sagen: Außer den eigentümlichen Ohren hatten die Duniazat Fernweh. Ibn Ruschd war tot, doch wir werden sehen, dass er und sein Kontrahent sich sogar noch jenseits des Grabes stritten, denn großen Denkern gehen die Argumente nie aus. Argumente selbst sind ja ein Werkzeug, mit dem man den Geist schärfen kann, das schärfste aller Werkzeuge, geboren aus der Liebe zur Weisheit, mit anderen Worten: zur Philosophie.
Mr. Geronimo
h
Achthundert und mehr Jahre später, mehr als dreieinhalbtausend Meilen entfernt und vor jetzt mehr als eintausend Jahren fegte ein Sturm über die Stadt unserer Vorfahren, der einschlug wie eine Bombe. Ihre Kindheiten, die Anlegestellen aus Erinnerungen, auf denen sie einst Bonbons und Pizza gegessen hatten, die Promenaden der Sehnsüchte, unter denen sie sich vor der Sommersonne geschützt und zum ersten Mal Lippen geküsst hatten, glitten ins Wasser und gingen verloren. Durch den Nachthimmel flogen Hausdächer wie orientierungslose Fledermäuse, und die Dachböden, wo Vergangenheit aufbewahrt wurde, waren den Elementen preisgegeben, bis offenbar alles, was unsere Ahnen einmal gewesen waren, von dem räuberischen Himmel verschlungen worden war. Geheimnisse gingen in überfluteten Kellern unter, und ihre Hüter vergaßen sie. Sie hatten keine Kraft mehr. Dunkelheit senkte sich herab.
Bevor der Strom ausfiel, sah man auf den Fernsehbildschirmen eine gewaltige weiße Spirale wie ein eindringendes außerirdisches Raumschiff am Himmel kreisen. Dann ergoss sich der Fluss in die Kraftwerke, Bäume fielen auf die Stromleitungen, zerdrückten die Schuppen mit den Notstromaggregaten, und die Apokalypse begann. Das Tau, mit dem unsere Vorfahren in der Realität verankert waren, riss, und als die Naturgewalten ihnen in die Ohren brüllten, lag der Gedanke natürlich nahe, dass sich die Schlitze in der Welt wieder geöffnet hatten, die Verschlüsse herausgebrochen waren und am Himmel Hexenmeister lachten, satanische Reiter, die auf den galoppierenden Wolken ritten.
Drei Tage und Nächte sprach niemand, denn es ertönte nur die Sprache des Sturms, und dieses schreckliche Idiom beherrschten unsere Vorfahren nicht. Dann ließ der Sturm endlich nach, und wie die Kinder, die sich weigern zu glauben, dass die Kindheit zu Ende ist, wollten sie, dass alles wieder so sei wie zuvor. Doch als das Licht zurückkehrte, fühlte es sich anders an. Ein solch weißes Licht hatten sie noch nie gesehen, es war grell und gnadenlos wie aus der Lampe eines Verhörers, und nirgendwo gab es mehr Schatten oder Stellen, an denen man sich hätte verstecken können. Hütet euch, schien das Licht zu sagen, ich komme, um zu verbrennen und zu richten.
Dann begannen die Seltsamkeiten. Sie sollten zwei Jahre, acht Monate und achtundzwanzig Tage dauern.
So ist es, ein Jahrtausend später, auf uns gekommen, als Historie, von Sagenhaftem durchtränkt, vielleicht sogar darunter verschüttet. Und so betrachten wir es heute: als trügerische Erinnerung oder Traum aus uralter Vergangenheit. Wenn alles unwahr ist oder teilweise unwahr, wenn erfundene Geschichten in die Überlieferung eingegangen sind, dann ist es jetzt zu spät, daran etwas zu ändern. Dies ist die Geschichte unserer Vorfahren, wie wir sie erzählen wollen, und deshalb ist es natürlich auch unsere Geschichte.
Am Mittwoch nach dem großen Sturm bemerkte Mr. Geronimo zum ersten Mal, dass seine Füße den Boden nicht mehr berührten. Wie üblich war er eine Stunde vor Morgengrauen erwacht und erinnerte sich nun dumpf an einen seltsamen Traum, in dem sich die Lippen einer Frau an seine Brust gepresst und lautlos etwas gemurmelt hatten. Seine Nase war verstopft, sein Mund trocken, weil er im Schlaf durch den Mund geatmet hatte, sein Hals war steif, weil er immer zu viele Kissen darunterlegte, und das Ekzem an seinem linken Knöchel wollte gekratzt werden. Ganz allgemein bereitete ihm sein Körper das vertraute Maß an morgendlichen Beschwerden, in einem Satz: nichts zu klagen. Die Füße fühlten sich sogar gut an. Er hatte den größten Teil seines Lebens Probleme mit den Füßen gehabt, aber heute machten sie keine Zicken. Er hatte Senkfüße, und obwohl er stets abends als Letztes vor dem Einschlafen und morgens als Erstes nach dem Aufwachen gewissenhaft seine Zehenübungen machte, Einlagen trug und auf Zehenspitzen die Treppen hoch- und hinunterging, taten sie ab und zu weh. Er kämpfte darüber hinaus auch mit der Gicht und den Medikamenten dagegen, die Durchfall verursachten. Mit den in regelmäßigen Abständen auftretenden Schmerzen fand er sich ab und tröstete sich außerdem damit, was er als junger Mann erfahren hatte: Mit Plattfüßen wurde man nicht zum Militär eingezogen. Doch obwohl er längst aus dem Alter für das Kriegshandwerk heraus war, fand er in diesem kleinen bisschen Wissen immer noch Trost. Und die Gicht war schließlich die Krankheit der Könige.
In letzter Zeit hatte sich auf seinen Hacken dicke, rissige Hornhaut gebildet, um die er sich kümmern musste, aber er hatte zu viel zu tun gehabt, um eine Fußpflegerin aufzusuchen. Er war den ganzen Tag auf den Füßen, er brauchte sie. Da sie nun ein paar Tage Ruhe gehabt hatten, denn Gärtnern war bei einem solchen Sturm nicht in Frage gekommen, belohnten sie ihn vielleicht heute Morgen damit, dass sie sich nicht weiter bemerkbar machen. Er schwang die Beine aus dem Bett und stand auf. Da aber fühlte sich etwas anders an. Die Struktur der abgeschliffenen Holzdielen seines Schlafzimmerbodens war ihm vertraut, doch aus irgendeinem Grund spürte er sie an diesem Mittwochmorgen nicht. Stattdessen spürte er eine neue Glätte, ein wohltuendes Nichts. Vielleicht waren seine Füße taub, wegen der dickeren Hornhaut unempfindlich geworden. Aber ein Mann wie er, wenn auch nicht mehr der Jüngste, dem ein Tag mit schwerer körperlicher Arbeit bevorstand, scherte sich nicht um solche Kleinigkeiten. Ein Mann wie er, groß, fit, stark, tat solche minderen Unpässlichkeiten mit einem Schulterzucken ab und ging seinem Tagewerk nach.
Es gab immer noch keinen Strom und sehr wenig Wasser, wenn auch beides für den nächsten Tag versprochen worden war. Mr. Geronimo war eigen, und es war ihm höchst unangenehm, dass er sich weder gründlich die Zähne putzen noch duschen konnte. Mit ein wenig Wasser aus der Badewanne spülte er die Toilette. (Vorsichtshalber hatte er vor Beginn des Sturms die Wanne volllaufen lassen.) Er zog Arbeitsoverall und Schnürschuhe an, ließ den stecken gebliebenen Aufzug links liegen und lief hinunter auf die zerstörten Straßen. Mit über sechzig, sagte er sich, hatte er ein Alter erreicht, in dem die meisten Männer die Beine hochlegten, doch er war so gut in Form und aktiv wie eh und je. Dafür hatte das Leben gesorgt, für das er sich vor langer Zeit entschieden hatte. Es hatte ihn weggeführt aus der Kirche der Wunderheilungen seines Vaters, von den Weibern, die sich, von der Kraft Jesu Christi besessen, kreischend aus Rollstühlen erhoben, und aus dem Architekturbüro seines Onkels, wo er unsichtbar lange Jahre in sitzender Tätigkeit hätte verbringen und die verkannten Visionen dieses netten Herrn zeichnen müssen, dessen Grundrisse der Enttäuschungen, des Scheiterns und all der verpassten Gelegenheiten. Mr. Geronimo hatte Jesus und die Zeichentische hinter sich gelassen und sich ins Freie begeben.
In dem grünen Pritschenwagen, auf dessen Seitenwänden die Worte Mr. Geronimo Gardener sowie die Telefonnummer plus Website-Adresse in Gelb mit scharlachroten Schlagschatten prangten, spürte er den Sitz nicht unter sich. Das rissige grüne Leder, das sich normalerweise angenehm in seine rechte Pobacke drückte, tat genau das heute nicht. Er war eindeutig nicht er selbst. Seine allgemeine Empfindungsfähigkeit hatte nachgelassen. Das war beunruhigend. In seinem Alter und in dem Metier, das er sich ausgesucht hatte, musste er auf die kleinen Verrätereien seines Körpers achten und sich schon aus dem Grund darum kümmern, weil er die unvermeidlichen größeren Verrätereien hinauszögern wollte. Er musste sich durchchecken lassen, doch nicht jetzt; wegen der Nachwirkungen des Sturms hatten Ärzte und Krankenhäuser andere Probleme. Unter seinen Sohlen fühlten sich das Gaspedal und die Bremse eigenartig abgepolstert an, als brauchten sie heute Morgen ein wenig mehr Druck. Augenscheinlich hatte der Sturm die Psyche der Kraftfahrzeuge ebenso durcheinandergebracht wie die der Menschen. Merkwürdig verquer und mutlos lagen verlassene Autos unter kaputten Fenstern, ein melancholischer gelber Bus auf eine Seite gekippt. Aber die Hauptstraßen waren frei geräumt, und die George Washington Bridge war für den Verkehr wieder offen. Benzin war knapp, doch er hatte einen Vorrat gebunkert und ging davon aus, dass er zurechtkommen würde. Mr. Geronimo hamsterte alles, von Benzin über Gasmasken, Taschenlampen, Decken, Medikamenten und Essenskonserven bis zu Wasser in Leichtverpackungen; er war ein Mann, der Notfälle erwartete, der damit rechnete, dass das Gefüge der Gesellschaft Risse bekam und auseinanderbrach, der wusste, dass man mit Sekundenkleber Schnittwunden schließen kann, der der Fähigkeit des Menschen, solide oder gut zu bauen, nicht traute. Also ein Mann, der auf das Schlimmste gefasst war. Auch ein abergläubischer Mann, ein Daumendrücker, der zum Beispiel wusste, dass in Amerika böse Geister auf Bäumen leben und man auf Holz klopfen muss, um sie zu vertreiben, während britische Baumgeister (Mr. Geronimo war ein Liebhaber der englischen Landschaft) freundliche Wesen waren und man auf Holz klopfte, um sich ihres Wohlwollens zu versichern. Dergleichen Wissen war wichtig. Man konnte gar nicht vorsichtig genug sein. Wenn man sich von Gott abwendet, sollte man eventuell versuchen, das Glück auf seine Seite zu bringen.
Schließlich schaffte er es, den Motor anzuwerfen; dann fuhr er die Ostseite der Insel hoch und über die wiedereröffnete George Washington Bridge. Natürlich hatte er den Oldies-Sender eingeschaltet. Yesterday’s gone, yesterday’s gone, sangen die Oldies. Guter Tipp. Recht habt ihr. Und morgen wird es nicht geben. Womit heute übrig bleibt. Der Fluss folgte wieder seinem natürlichen Lauf, aber an beiden Ufern sah Mr. Geronimo Zerstörungen und schwarzen Schlamm, aus dem die vor langer Zeit ertrunkene Vergangenheit der Stadt exhumiert worden war. Die Schornsteine gesunkener Flussschiffe ragten heraus wie Periskope, gespenstische Oldsmobiles lagen schlammverkrustet am Ufer, dunklere Geheimnisse, das Skelett des legendären Flussungeheuers Kipsy und die Schädel ermordeter irischer Schauerleute, schwammen in dem schwarzen Modder, und im Radio kam die seltsame Nachricht, dass das Bollwerk des indianischen Forts Nipinichsen aus der Tiefe hochgeschoben worden war. Außerdem waren angeblich die schmuddeligen Pelze der alten holländischen Händler und wahrhaftig die Originalschatulle mit dem Sechzig-Gulden-Flitterkram, mit dem ein gewisser Peter Minuit eine hügelige Insel von den Lenape-Indianern erworben hatte, an der südlichen Spitze von Manna-hata gestrandet, als sage der Sturm unseren Ahnen: Leckt mich, ich kaufe die Insel zurück.
Mr. Geronimo fuhr durch kaputte, vom Sturm zugemüllte Straßen nach La Incoerenza hinaus, dem Bliss’schen Anwesen. Hier, außerhalb der Stadt, hatte das Unwetter sogar noch heftiger gewütet. Blitze wie riesige schräge Säulen verbanden La Incoerenza mit dem Himmel, und die Ordnung, von der Henry James mahnend gesagt hat, sie sei nur der Traum des Menschen vom Universum, löste sich, das war das Gesetz der Natur, unter der Gewalt des Chaos auf. Über dem Tor des Anwesens schwang ein unter Strom stehendes Kabel, den Tod an der Spitze, gefährlich hin und her. Wenn es das Tor berührte, knisterten blaue Blitze an den Stäben entlang. Das alte Haus stand noch, doch der Fluss war über die Ufer getreten, hatte sich wie eine gigantische Seeschlange, nur Schlamm und Zähne, emporgereckt und die Gartenanlagen mit einem einzigen Happs verschlungen. Dann hatte er sich zwar zurückgezogen, aber ein Trümmerfeld hinterlassen. Als Mr. Geronimo die Verheerungen sah, war ihm, als sei er Zeuge des Todes seiner eigenen Phantasie, hier war er am Tatort, wo sie von dem dicken schwarzen Matsch und dem unzerstörbaren Plunder der Vergangenheit ermordet worden war. Vielleicht weinte er. Auf den einstmals sanft geschwungenen Rasenflächen, die nun unter dem schwarzen Modder aus dem übergelaufenen Hudson begraben lagen, betrachtete er unter Tränen die Zerstörung von mehr als einem Jahrzehnt seiner besten landschaftsgärtnerischen Arbeit, der Steinspiralen, wie sie uns von den Kelten der Eisenzeit bekannt sind, des Senkgartens, der sein Pendant in St. Petersburg in Florida in den Schatten stellte, der analemmatischen Sonnenuhr, einer Kopie derjenigen auf dem Nullmeridian in Greenwich, des Rhododendronhains, des minoischen Labyrinths mit dem dicken steinernen Minotaurus in der Mitte sowie all der geheimen, hinter Hecken verborgenen Nischen. Alles war verschwunden, vom schwarzen Müll der Geschichte zerquetscht, und Baumwurzeln ragten wie Arme Ertrinkender heraus. Und hier begriff Mr. Geronimo, dass das Problem mit seinen Füßen keineswegs belanglos war. Als er nämlich auf den Schlamm trat, schmatzten seine Schuhe nicht und blieben auch nicht stecken. Verwirrt machte er zwei, drei Schritte, blickte hinter sich und sah, dass er keine Fußabdrücke hinterlassen hatte.
»Verdammt!«, schrie er fassungslos. In was für eine Welt hatte ihn der Sturm geworfen? Er hielt sich nicht für jemanden, der leicht ins Bockshorn zu jagen war, doch angesichts der fehlenden Fußabdrücke gruselte ihn. Er trat fest auf, linker Fuß, rechter Fuß, linker Fuß. Dann sprang er hoch und versuchte, sich beim Landen so schwer wie möglich zu machen. Die schwarze Pampe zeigte sich ungerührt. Hatte er getrunken? Nein. Er trank zwar gelegentlich einen über den Durst, wie es, warum auch nicht, für einen älteren, allein lebenden Mann nicht unüblich ist, doch dieses Mal spielte Alkohol keine Rolle. Schlief er noch und träumte, dass das Anwesen La Incoerenza unter einem Meer von Schlamm begraben war? Vielleicht, aber es fühlte sich eigentlich nicht wie ein Traum an. Handelte es sich hier um einen den Schlammforschern bisher nicht bekannten übernatürlichen Schlamm vom Grund des Flusses, einen flussungeheuren Schlamm, dessen Tiefseegeheimnis ihm die Kraft gab, dem Gewicht eines hüpfenden Mannes zu widerstehen? Oder – und das schien Mr. Geronimo die plausibelste, obgleich beunruhigendste Erklärung – hatte sich in ihm selbst etwas verändert? Seine eigene Schwerkraft aus unerfindlichen Gründen nachgelassen? Herr im Himmel, dachte er und gleich danach, dass sein Vater angesichts dieser Gotteslästerung die Stirn gerunzelt hätte, denn er hatte ihn schon als Kind aus einem halben Meter Entfernung gescholten, wenn er allwöchentlich seiner Gemeinde von der Kanzel mit Feuer und Schwefel drohte. Herr im Himmel! Er musste seine Füße wirklich sofort untersuchen lassen.
Mr. Geronimo war ein bodenständiger Mann und kam deshalb gar nicht auf die Idee, dass ein neues Zeitalter des Irrationalen begonnen hatte, in dem die Schwerkraftanomalie, deren Opfer er war, nur eine von vielen bizarren Erscheinungsformen darstellte. Weitere groteske Anmutungen in seiner eigenen Geschichte lagen erst recht jenseits seiner Vorstellungskraft. Nie wäre ihm zum Beispiel in den Sinn gekommen, dass er in naher Zukunft mit einer Märchenprinzessin schlafen würde. Die gegenwärtige Veränderung der weltweiten Verhältnisse beschäftigte ihn auch nicht. Aus seiner eigenen misslichen Lage zog er keine weitergehenden Schlüsse. Er vermochte sich weder das unmittelbar bevorstehende Auftauchen von Seeungeheuern im Meer vorzustellen, die so groß waren, dass sie ganze Schiffe mit einem Mal hinunterschlangen, noch das Auftauchen von Männern, die so stark waren, dass sie ausgewachsene Elefanten hochstemmen konnten, noch das Erscheinen von Zauberern am Himmel über der Erde, die auf offenbar durch Magie angetriebenen fliegenden Amphoren mit Höchstgeschwindigkeit durch die Luft sausten. Und schon gar nicht hätte er vermutet, dass er unter dem Zauberbann eines mächtigen, bösartigen Dschinni stand.
Aber Mr. Geronimo ging von Natur aus systematisch vor und langte nun, eindeutig besorgt ob seines veränderten Zustands, erst einmal in eine Tasche seiner abgewetzten Gärtnerjacke und fand ein gefaltetes Blatt Papier, eine Rechnung von seinem Energieversorger. Strom gab es nicht, doch die Rechnungen sollten pünktlich bezahlt werden. Das war die natürliche Ordnung der Dinge. Er faltete das Blatt auseinander und breitete es auf dem Schlamm aus. Dann stellte er sich darauf, sprang und trampelte ein bisschen darauf herum und versuchte, das Schriftstück mit den Füßen zu verknittern. Es blieb unversehrt. Und als er nach unten griff und daran zog, kam es sofort unter seinen Füßen hervor. Von Abdrücken keine Spur. Beim nächsten Versuch konnte er die Stromrechnung glatt unter seinen Schuhen durchziehen. Der Spalt zwischen ihm und der Erde war winzig, aber nicht zu leugnen. Mr. Geronimo war nun dauerhaft zumindest eine Papierblattdicke über der Oberfläche des Planeten verortet. Das Papier in der Hand, richtete er sich auf. Um ihn herum lagen tote Bäume und versanken im Modder. Die Philosophin, seine Arbeitgeberin, die Futtermittelerbin Miss Alexandra Bliss Fariña, beobachtete ihn durch die Terrassentür im Erdgeschoss, die Tränen rannen ihr über das wunderschöne junge Gesicht, und aus den Augen strömte noch etwas, das er nicht erkennen konnte. Es mochte Furcht sein, oder Schock. Vielleicht sogar Begehren.
ENDE DER LESEPROBE