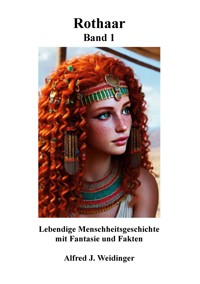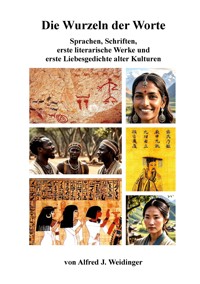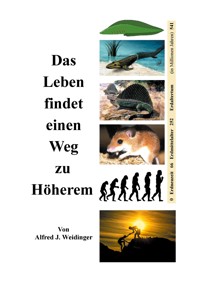
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Leben, so wie wir es kennen, ist ein faszinierendes Phänomen. Es findet immer einen Weg, selbst in den widrigsten Umständen. Es überwindet scheinbar unüberwindbare Grenzen und zeigt sich in einer erstaunlichen Vielfalt. Das Leben ist zweifellos ein Wunder, das uns immer wieder staunen lässt. In diesem Buch möchte ich Sie mitnehmen auf den faszinierenden Weg der Entstehung des Lebens, angefangen beim Urknall und der Entstehung der Elemente, bis hin zur erstaunlichen Vielfalt des Lebens auf unserer Erde. Während dieser langen Entwicklungsgeschichte sind unglaublich viele Lebensformen entstanden. Ich habe mich bemüht, die Entstehung und Entwicklung so klar wie möglich mit Bildern und Texten zu erklären. Möge dieses Buch Ihre Neugier wecken und Ihr Verständnis für das Leben auf unserer Erde vertiefen. Ich empfehle Ihnen, dieses Buch nicht von vorne nach hinten zu lesen. Statt dessen, blättern Sie darin und wählen Sie eine Abbildung aus, die Ihr Interesse weckt. Lassen Sie sich von dieser Abbildung inspirieren und erkunden Sie den Text, der sie umgibt. Ihre Neugier wird Sie ganz von selbst durch das Buch führen. Probieren Sie es aus!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bildnachweise für die Titelseite:
Erstes Wirbeltier, mögliches Lebensbild: Myllokunmingia,https://de.wikipedia.org/wiki/Myllokunmingia#/media/Datei:Myllokunmingia.jpg, von Giant Blue Anteater (talk) - Eigenes Werk (Originaltext: I created this work entirely by myself.), Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7194138
Landgang: Lebensbild von Tiktaalik roseae,https://de.wikipedia.org/wiki/Tiktaalik#/media/Datei:Tiktaalik_roseae_life_restor.jpg, von Zina Deretsky, National Science Foundation - National Science Foundation Multimedia Gallery http://nsf.gov/news/mmg/mmg_disp.cfm?med_id=58310http://nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=106807https://flickr.com/photos/nsf_beta/3705198718, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2542188
Vorfahre der Säugetiere im Erdaltertum: Dimetrodon,https://en.wikipedia.org/wiki/Dimetrodon#/media/File:DimetrodonKnight.jpg, by Charles R. Knight - http://www.charlesrknight.com/AMNH.htm and http://donglutsdinosaurs.com/charles-r-knight-artwork-2/, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3786357
Säugetier im Erdmittelalter: Zwergmaus,https://de.wikipedia.org/wiki/Afrikanische_Zwergmaus#/media/Datei:Mus_musculoides_hirse_fressend.jpg,Von AleXXw - Eigenes Werk, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6001789
Die Evolution des aufrechten Ganges, (angelehnt an den „March of Progress“ von Rudolph Zallinger), https://de.wikipedia.org/wiki/Hominisation#/media/Datei:Darwin-chart.jpg, von A very similar image is used here [1] on page →., Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=822874, vom Autor bearbeitet
Helfen verbindet: Sonnenuntergang,https://pixabay.com/de/photos/sonnenuntergang-m%C3%A4nner-silhouetten-1807524/, Bild von Sasin Tipchai
Autor:
Alfred Johann Weidinger, geboren 1955 Ausbildung zum Metall-Modellbauer Ingenieurstudium für Maschinenbau 33 Jahre Ingenieur in einem Großbetrieb Seit 2015 im Ruhestand Nun auf der Suche nach Antworten
Abb. 1: Autor
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
I. Kapitel - Vom Urknall zur Entstehung des Sonnensystems
1. Die Entstehung und Verteilung der Elemente
1.1 Der Urknall
1.2 Entstehung der Elemente bis zum Eisen
1.3 Entstehung der Elemente, schwerer als Eisen
1.4 Die Verteilung der Elemente im Weltall
1.4.1 Supernova
1.4.2 Sternwinde
1.4.3 Kosmische Strahlung
II. Kapitel - Vom Sonnensystem zur Entfaltung des Lebens
2. Die Entstehung unseres Sonnensystems
3. Unser Mond
3.1 Die Entstehung unseres Mondes
3.2 Der Einfluss des Mondes auf die Evolution des Lebens
4. Wasser, Grundlage des Lebens
5. Erstes Leben
5.1 Die Ursuppe
5.2 Leben von anderen Himmelskörpern
5.3 Es brodelte in den Tiefen des Ur-Ozeans
5.4 Entstehung des Lebens in der Uratmosphäre
6. Die Entstehung organischer Verbindungen
6.1 Organische Elemente
6.2 Erste Biomoleküle
6.2.1 Aminosäuren
6.2.2 Einfache Zuckermoleküle
6.2.3 Nukleotide
6.2.4 Lipide
7. Nukleinsäuren
7.1 Ribonukleinsäure (RNA)
7.2 Desoxynukleinsäure (DNA)
8. Vergleich: RNA und DNA
9. Leben mit Viren
9.1 Viren, Ursprung des Lebens?
9.2 Genomische Koevolution
9.3 Viren als Krankheitserreger
10. Das Genom
11. Das Gen
12. Die ersten Einzeller
12.1 Der Aufbau erster Einzeller
12.2 Erste Lebensformen
12.2.1 Archaeen
12.2.2 Bakterien
13. Die Photosynthese und ihre Auswirkungen
14. Die Entwicklung der Erdatmosphäre
14.1 Uratmosphäre
14.2 Erste Atmosphäre
14.3 Zweite Atmosphäre
14.4 Dritte Atmosphäre
15. Die Entstehung der ersten Landmassen
15.1 Kenorland
15.2 Rodinia
16. Eiszeitalter, Warmzeiten und Eiszeiten
16.1 Warmzeiten
16.2 Eiszeiten
16.2.1 Pongola-Eiszeit
16.2.2 Huronische Eiszeit
16.2.3 Die Schneeball-Erde-Hypothese
16.2.4 Ordovizisches Eiszeitalter
16.2.5 Karoo-Eiszeit
16.2.6 Känozoisches Eiszeitalter und quartäres Eiszeitalter
17. Die Zeit der Bakterien
17.1 Vermehrung durch Zellteilung
17.2. Einzeller ohne Zellkerne
17.3 Von den Bakterien zu Tieren, Pilzen und Pflanzen
18. Die “Langweilige Milliarde“
18.1 Die Entstehung der Eukaryoten
18.2 Vergleich von Tierzelle und Pflanzenzelle
18.3 Die frühe Bildung von Mehrzellern
18.4 Die Entwicklung der Algen
18.4.1 Die einzelligen Algen
18.4.2 Die vielzelligen Algen
19. Die jüngste Zeit der frühen Lebewesen
19.1 Die Ediacara-Fauna
19.2 Die Ediacara-Flora
19.3 Die Entstehung der Ozonschicht
19.4 Plattentektonische Situation vor 550 Millionen Jahren
III. Kapitel - Erdaltertum
20. Die Kambrische Explosion
20.1 Schwämme
20.2 Nesseltiere
20.3 Röhrenwürmer
20.4 Weichtiere
20.5 Gliederfüßer
20.5.1 Die Trilobiten
20.5.2 Krebstiere
20.5.3 Tausendfüßer
20.5.4 Insekten
20.5.5 Spinnentiere
20.6 Armfüßer
20.7 Stachelhäuter
20.7.1 Seelilien und Haarsterne
20.7.2 Seegurken
20.7.3 Seesterne
20.7.4 Schlangensterne
20.7.5 Seeigel
20.8 Chordatiere
20.8.1 Das erste Wirbeltier
21. Lebensentwicklung trotz Katastrophen
22. Die Entwicklung der Fische
22.1 Frühe Wirbeltiere
22.2 Kieferlose Fische
22.3 Plattenhäuter
22.4 Knorpelfische
22.5 Knochenfische
23. Übergangsformen vom Wasser zum Land
23.1 Lungenfische
23.2 Amphibien
23.3 Tiktaalik
24. Die Pflanzen erobern das Land
24.1 Landpflanzen und Pilze
24.2 Bärlapp-Gewächse
24.3 Schachtelhalme und Farne
24.4 Nacktsamer
25. Die Evolution der Nabeltiere
26. Die Abstammungslinie der Säugetiere
26.1 Synapside
26.2 Pelycosaurier
26.2.1 Dimetrodon
26.2.2 Sphenacodon
26.2.3 Edaphosaurus
26.3 Therapside
26.3.1 Biarmosuchia
26.3.2 Dinocephalia
26.3.3 Anomodontia
26.3.4 Theriodontia
27. Auswirkungen des größten Massensterbens
27.1 Auswirkungen auf die Tierwelt
27.2 Auswirkungen auf die Pflanzenwelt
28. Der Superkontinent Pangaea
29. Fauna und Flora im Erdaltertum
IV. Kapitel - Erdmittelalter
30. Die Entwicklung der Säugetiere
30.1 Die Vorläufer und Vorfahren der Säugetiere
30.2 Säugetierartige Tiere und Kloakentiere
30.3 Höhere Säugetiere
30.4 Entwicklung der Säugetiere im Erdmittelalter
31. Entwicklung der Meeres-, Dino-, und Flugsaurier
31.1 Die Vorläufer und Vorfahren der Dinosaurier
31.2 Die Meeressaurier
31.2.1 Ichthyosaurier
31.2.2 Plesiosaurier
31.2.3 Mosasaurier
31.2.4 Pliosaurier
31.3 Die Dinosaurier
31.3.1 Klassifierzierung der Dinosaurier
31.3.1.1 Vogelbeckensaurier (Ornithischia)
31.3.1.2 Echsenbeckensaurier (Saurischia)
31.3.2 Die ersten Dionsaurier
31.3.2.1 Eoraptor
31.3.2.2 Herrerasaurus
31.3.3 Die Vielfalt der Dinosaurier
31.4 Die Flugsaurier
31.4.1 Langschwanz-Flugsaurier
31.4.1.1 Eudimorphodon
31.4.1.2 Dimorphodon
31.4.1.3 Rhamphorhynchus
31.4.2 Kurzschwanz-Flugsaurier
31.4.3.1 Pterodactylus
31.4.3.2 Pteranodon
31.4.3.3 Quetzalcoatlus
32. Die Entwicklung der Vögel
32.1 Urvögel
32.1.1 Archaeopteryx
32.1.2 Confuciusfornis
32.1.3 Iberomesornis
32.2 Moderne Vögel
32.2.1 Urkiefervögel
32.2.2 Neukiefervögel
33. Die Entwicklung der Schlangen
34. Temperaturen im Erdmittelalter
34.1 Trias
34.2 Jura
34.3 Kreide
35. Die Entwicklung der Flora
35.1 Trias
35.2 Jura
35.3 Kreide
35.3.1 Abstammung der Bedecktsamer
35.3.2 Die Entwicklung der Bedecktsamer
35.3.2.1 Monokotyledonen (Einkeimblättrige)
35.3.2.3 Eudikotyledonen (Zweikeimblättrige)
36. Das Ende des Erdmittelalters
V. Kapitel - Erdneuzeit
37. Die Erdneuzeit
37.1 Entwicklung der Säugetiere in der Erdneuzeit
38. Die Entwicklung der heutigen Säugetiere
38.1 Euarchochontoglires
38.1.1 Primaten
38.1.1.1 Neuweltaffen
38.1.1.2 Altweltaffen und ihre Nachfahren
38.1.2 Hasenartige und Nagetiere
38.1.2.1 Hasenartige
38.1.2.2 Nagetiere
38.2 Laurasiatheria
38.2.1 Insektenfresser
38.2.2 Fledertiere
38.2.3 Paarhufer und Wale
38.2.3.1 Paarhufer
38.2.3.2 Wale
38.2.4 Unpaarhufer
38.2.5 Schuppentiere
38.2.6 Raubtiere
38.2.6.1 Katzenartige
38.2.6.2 Hundeartige
38.3 Afrotheria-Paenungulata
38.3.1 Rüsseltiere
38.3.2 Seekühe
38.3.3 Schliefer
39. Die Kontinente in der Erdneuzeit
VI. Kapitel - Der Mensch
40. Die Evolution des Menschen
40.1 Die Entwicklung zum Homo sapiens
40.1.1 Australopithecus afarensis
40.1.2 Australopithecus bahrelghazali
40.1.3 Australopithecus africanus
40.1.4 Homo rudolfensis
40.1.5 Homo habilis
40.1.6 Homo ergaster
40.1.7 Homo erectus
40.1.8 Homo erectus heidelbergensis
40.2 Evolution des Menschen in verschiedenen Regionen
40.3 Die Evolution des aufrechten Ganges
40.4 Die Ausbreitung des Homo sapiens
40.5 Die Vermischung der Homo-Arten
40.6 Das Bewusstsein
40.6.1 Das menschliche Bewusstsein
40.6.2 Bewusstsein der Tiere
40.7 Die Entstehung der Religionen
40.7.1 Die Anfänge der Religionen
40.7.2 Zunahme der Religiosität mit der Sesshaftwerdung
40.7.3 Religion aus Sicht der Wissenschaftler
40.7.4 Religionen der Griechen und Ägypter
40.7.5 Bekannte Religionen heute
41. Prägung des Menschen
41.1 Die Biogenetische Grundregel
41.2 Die Angst
41.3 Die Epigenetik
41.4 Aggression und Gewalt
41.5 Der Mensch ist ein soziales Wesen
VII. Kapitel - Anthropozän und Zukunft
42. Wie viele Menschen lebten bisher?
43. Die Menschheit heute
43.1 Wohlstandsindikator (HDI)
43.2 Ungleichheit weltweit
43. Die Menschheit und ihre Zukunft
43.1 Die Bevölkerungsentwicklung
43.2 Die Geburtenraten
43.3 Verteilungsgerechtigkeit und Würde für alle
43.4 Nachhaltige Entwicklungsziele (SDGs)
43.5 Zukunft der Menschheit im Anthropozän
Schlusswort
Danksagung
Anmerkung zum Quellenverzeichnis
Quellenverzeichnis
Nachweise für Abbildungen
Veröffentlichungen des Autors
Vorwort
Das Leben, so wie wir es kennen, ist ein faszinierendes Phänomen. Es findet immer einen Weg, selbst unter den widrigsten Umständen. Es überwindet scheinbar unüberwindbare Grenzen und zeigt sich in einer erstaunlichen Vielfalt. Das Leben ist zweifellos ein Wunder, das uns immer wieder staunen lässt.
In diesem Buch suche ich nach Antworten auf Fragen, die von fundamentaler Bedeutung sind: Wie ist das Leben überhaupt in Gang gekommen? Gibt es ein organisierendes Prinzip, das dem vielfältigen Reichtum der Natur zugrunde liegt? Sind wir Menschen tatsächlich aus Sternenstaub entstanden? Diese Fragen zeugen von unserem tiefen Verlangen, die Geheimnisse des Lebens und seiner Entwicklung zu ergründen.
Die Zusammenstellung dieses Buches war keine leichte Aufgabe und erforderte etwa zwei Jahre intensiver Arbeit. Während dieser Zeit habe ich den Inhalt kontinuierlich überarbeitet, um sicherzustellen, dass er so verständlich wie möglich ist. Meine Recherchen stützten sich auf Informationen und Fakten aus verschiedenen Quellen, die im Anhang dieses Buches aufgelistet sind. Die Zahlen in eckigen Klammern, die Sie am Ende von Absätzen oder Seiten finden, dienen als Verweise auf Quellen, die Ihnen auch eine Vertiefung mit den behandelten Themen ermöglichen.
Anfang 2023 erfuhr ich, dass Bücher auch mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt werden können. Dieser technologische Fortschritt weckte mein Interesse, und so entschloss ich mich, dieses Buch erneut zu überarbeiten und die Unterstützung von ChatGPT in Anspruch zu nehmen. [1]
Eine KI-gestützte Software ist nicht in der Lage, alle Aspekte eines Buches eigenständig zu entwickeln oder zu bearbeiten. Als Autor war es meine Aufgabe, eine menschliche Perspektive und mein Urteilsvermögen einzubringen, die von ChatGPT vorgeschlagenen Texte sorgfältig zu prüfen und anzupassen.
In diesem Buch möchte ich Sie mitnehmen auf den faszinierenden Weg der Entstehung des Lebens, angefangen beim Urknall und der Entstehung der Elemente, bis hin zur erstaunlichen Vielfalt des Lebens auf unserer Erde. Während dieser langen Entwicklungsgeschichte sind unglaublich viele Lebensformen entstanden.
Ich habe mich bemüht, die Entstehung und Entwicklung so klar wie möglich mit Bildern und Texten zu erklären. Möge dieses Buch Ihre Neugier wecken und Ihr Verständnis für das Leben auf unserer Erde vertiefen.
Ich empfehle Ihnen, dieses Buch nicht von vorne nach hinten zu lesen. Blättern Sie darin und wählen Sie eine Abbildung aus, die Ihr Interesse weckt.
Lassen Sie sich von dieser Abbildung inspirieren und erkunden Sie den Text, der sie umgibt. Ihre Neugier wird Sie ganz von selbst durch das Buch führen.
Probieren Sie es aus!
Alfred J. Weidinger, 2023
Millionen Jahre vor heute
Wichtigste Ereignisse vom Urknall bis heute
13 800
Urknall, Entstehung von Materie
13 420
Ende des Dunklen Zeitalters
9 000
Formung unserer Galaxie (Milchstraße)
4 600
Entstehung unseres Sonnensystems
3 800
Erstes Leben auf der Erde, Zellen ohne Zellkern
2 100
Erste Entwicklung von Mehrzellern
1 500
Eukaryoten, Zellen mit Kern
1 200
Entwicklung der mehrzelligen Algen
600
Entwicklung von tierischen Mehrzellern
540
Kambrische Explosion im Wasser
460
Landgang der Pflanzen
375
Landgang der Tiere
240
Erste Dinosaurier
66
Meteoriten-Einschlag, Aussterben der Dinosaurier
2
Homo-Arten
Abb. 2: Urknall
I. Kapitel - Vom Urknall zur Entstehung des Sonnensystems
Millionen Jahre vor heute
Wichtigste Ereignisse
13 800
Urknall, Entstehung von Materie
13 420
Ende des Dunklen Zeitalters
9 000
Bildung unserer galaktischen Scheibe (Milchstraße)
4 600
Entstehung unseres Sonnensystems
1. Die Entstehung und Verteilung der Elemente
1.1 Der Urknall
Am Anfang war der Urknall, darin sind sich fast alle Wissenschaftler einig. Das ganze Universum soll aus einem winzigen Punkt (Anfangssingularität) entstanden sein. Das ist unvorstellbar! Georges Lemaitre, ein belgischer Theologe, katholischer Priester, Mathematiker und Astrophysiker, schrieb 1931 die Idee des Urknalls (als quantenphysikalischen Beginn) nieder.
Bei mehreren Billionen Grad Celsius bildeten sich nach dem Urknall in etwa 10 Mikrosekunden die ersten Protonen und Neutronen. Mit der Ausdehnung kühlte alles rasch ab.
In die Quantentheorien wollen wir in diesem Buch nicht einsteigen. Wir beginnen mit den Bausteinen der Elemente:
den Protonen,
den Neutronen
und den Elektronen.
Die Protonen haben etwa dieselbe Masse wie die Neutronen.
Die Neutronen sind elektrisch neutral. Die Protonen sind elektrisch positiv geladen, die Elektronen negativ. Die Masse des Elektrons hingegen ist ca. 1 836-mal kleiner als die Masse des Protons.
Die Protonen und Neutronen bilden den Atomkern, die Elektronen schwirren um den Atomkern herum. In den folgenden Minuten nach dem Urknall entstanden:
Wasserstoff (etwa 75 %), Helium (etwa 25 %) und in geringen Mengen Lithium und Beryllium.
Atom bzw. Isotop
*
Anzahl Protonen
Anzahl Neutronen
Anzahl Elektronen
Wasserstoff
1
0
1
Helium
2
2
2
Lithium
3
4
3
Beryllium
4
5
4
Abb. 3: Leichte Elemente
* Ein Isotop hat mehr Neutronen als Protonen
Abb 4: Helium (oben) und Lithium (Bohrsche Atommodelle)
Gaswolken, hauptsächlich aus Wasserstoff, bildeten sich. Dieses Gas strömte durch Gravitation auf eine Massenanhäufung zu, dabei setzte eine Drehung ein.
1.2 Entstehung der Elemente bis zum Eisen
Nach einigen hundert Millionen Jahren entstanden die ersten Sterne. Bei sehr massereichen Sternen verschmelzen die Kerne (wie auch heute noch bei der Sternen-Entstehung) durch den Gravitationsdruck zu immer größeren Atomen.
Aus Wasserstoff entsteht zunächst Helium. Dieser Prozess setzt sich fort, bis sich im Sternenkern Eisen bildet. Dieser Vorgang wird auch Schalenbrennen genannt. [2]
Bei diesem Fusionsprozess wird Energie abgegeben wie bei unserer Sonne. Die Energieabgabe wird immer geringer, je größer die Ordnungszahl (Anzahl der Protonen) der Atome wird.
Abb. 5: Schalenmodell eines Eisenatoms
1.3 Entstehung der Elemente, schwerer als Eisen
Wenn ein massereicher Stern all seinen nuklearen Brennstoff verbraucht hat, hört die Kernfusion auf. Der Kern des Sterns kollabiert aufgrund seiner eigenen Schwerkraft, da der Strahlungsdruck durch die Fusion nicht mehr vorhanden ist. Die äußeren Hüllen werden ins All abgesprengt (siehe Abb. 6).
Durch den extremen Druck bei der gewaltigen Explosion (Supernova) werden die schwereren Elemente (mit Ordnungszahlen größer als Eisen) bis hin zu Uran und Plutonium zusammengebacken. Je größer die Sternenmasse, desto stärker die Supernova. [3]
Ein weitere Möglichkeit ist u. a. die Kollision von Neutronensternen. Die Kollision der extrem dichten Objekte erzeugt eine Schockwelle, die eine Supernova auslöst, bei der schwerere Elemente, wie z. B. Gold, Platin und Uran, produziert werden. Diese Elemente sind im Universum seltener als leichtere Elemente wie Kohlenstoff und Sauerstoff (siehe auch Abb. 7).
Abb. 6: Supernova
Die Entstehung schwererer Elemente findet heute noch beim Kollabieren Roter Riesen und bei Kollisionen von dichten Objekten statt.
Atom bzw.
Anzahl
Anzahl
Anzahl Elektronen in den Schalen
Isotop
Protonen
Neutronen
K
L
M
N
O
Summe
Kohlenstoff
6
6
2
4
6
Stickstoff
7
7
2
5
7
Sauerstoff
8
10
2
6
8
Silizium
14
14
2
8
4
14
Eisen
26
30
2
8
16
26
Silber
47
61
2
8
18
19
47
Gold
79
118
2
8
18
32
19
79
Uran-235
92
143
2
8
18
32
32
92
Abb. 7: Schwere und schwerere Elemente
1.4 Die Verteilung der Elemente im Weltall
Die Verteilung der Atome im Weltall wurde durch verschiedene Ereignisse beeinflusst, die seit dem Urknall stattgefunden haben.
Die wichtigsten Vorgänge zur Verteilung der Elemente sind Supernovae, Sternwinde und kosmische Strahlungen.
1.4.1 Supernova
Wenn ein Stern am Ende seines Lebens als Supernova explodiert, werden große Mengen an schwereren Elementen ins Weltall ausgestoßen und verteilt.
1.4.2 Sternwinde
Es gibt unterschiedliche Arten von Sternwinden.
Zwei Beispiele:
1.4.3 Kosmische Strahlung
Sie besteht aus energiereichen Teilchen und kann zur Entstehung neuer Elemente beitragen.
Der genaue Anteil von Elementen schwerer als Eisen und Nickel in der galaktischen kosmischen Strahlung ist noch nicht präzise bekannt, da die Messungen und Untersuchungen in diesem Bereich komplex sind. Dennoch wurden Spuren von Elementen wie Bismut in der kosmischen Strahlung nachgewiesen, was auf die Existenz von schwereren Elementen hinweist, die in den Weiten des Universums entstanden und in die kosmische Strahlung eingebunden sind. [4]
2. Die Entstehung unseres Sonnensystems
Unser Sonnensystem entstand vor etwa 4,6 Milliarden Jahren aus einer Wolke aus Gas und Staub. Es ist ein jüngeres Sternensystem, in dem schon viele Elemente verteilt sind. Durch die Schwerkraft wurde die Wolke komprimiert und begann sich zu drehen, wodurch eine rotierende Scheibe entstand. In der Mitte dieser Scheibe bildete sich eine Materieanhäufung. Durch die enorme Dichte und sehr hohe Temperatur zündete die erste Kernfusion, unser Protostern „Sonne“ war geboren. Um den Protostern herum formte sich eine Akkretionsscheibe, in der sich Staub- und Gasteilchen zu immer größeren Objekten zusammenballten. [5]
Dieser Prozess dauerte viele Millionen Jahre, bis schließlich die heutigen acht Planeten unseres Sonnensystems entstanden.
Abb. 8: Sonnensystem, nicht maßstäblich
Die inneren Planeten unseres Sonnensystems (Merkur, Venus, Erde und Mars) sind relativ klein und felsig und haben einen hohen Anteil an schweren Elementen wie Eisen und Nickel.
Die äußeren Planeten (Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun) sind dagegen viel größer und haben einen höheren Anteil an leichteren Elementen wie Wasserstoff und Helium.
Dies lag daran, dass in den äußeren Regionen der Scheibe mehr Gas vorhanden war, das von den Planeten aufgenommen werden konnte. [6]
3. Unser Mond
3.1 Die Entstehung unseres Mondes
Es gibt verschiedene Theorien über die Entstehung unseres Mondes, die am meisten akzeptierte ist die Kollisionstheorie. Vor etwa 4,5 Milliarden Jahren raste ein marsgroßer Himmelskörper namens Theia in die glühende Erde. Theia wurde dabei völlig zerstört. Das versprengte Material beider Körper umkreist die Erde und ballte sich schließlich zu unserem Mond zusammen.
Diese Theorie wird durch verschiedene Beobachtungen und Modelle gestützt. Zum Beispiel stimmt die Zusammensetzung des Mondes mit der Erde überein, was darauf hinweist, dass der Mond aus Material der Erde entstanden sein muss.
Simulationen haben gezeigt, dass eine Kollision mit Theia in der Lage wäre, genügend Material aus der Erde herauszuschleudern, um einen Mond zu bilden.
Abb. 9: Planeten-Kollision, siehe auch mond-entstehung-simulation-videoerde-kollision-theia
Eine alternative Theorie besagt, dass der Mond zusammen mit der Erde aus der gleichen Wolke von Gas und Staub entstanden ist. Diese Theorie ist jedoch nicht so favorisiert wie die Kollisionstheorie. [7]
3.2 Der Einfluss des Mondes auf die Evolution des Lebens
Der Mond spielte eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des Lebens auf der Erde. Hier sind einige der bedeutenden Auswirkungen des Mondes:
Gezeitenkräfte: Der Mond übt eine gravitative Anziehungskraft auf die Erde aus, die Gezeitenkräfte erzeugt. Durch die Gezeitenkräfte wird das Wasser in den Ozeanen bewegt, was zu Ebbe und Flut führt. Dies hat erheblichen Einfluss auf die Küstenregionen, die Ökosysteme der Meere und die Entwicklung vieler Lebewesen.
Stabilisierung der Erdachse: Der Mond spielt eine Rolle bei der Stabilisierung der Erdachse. Durch die gravitative Wechselwirkung des Mondes mit der Erde bleibt die Neigung der Erdachse relativ konstant, was zu stabilen Jahreszeiten führt. Stabile Jahreszeiten sind wichtig für das Wachstum von Pflanzen und die Anpassung von Lebewesen an periodische Veränderungen in den Umweltbedingungen.
Mondlicht: Einige nachtaktive Tiere nutzen das Mondlicht zur Orientierung oder für Jagdzwecke. Die Mondphasen können auch das Brutverhalten vieler Arten beeinflussen, einschließlich der Fortpflanzungszyklen von Meeresorganismen.
Evolutionäre Selektion: Es wird spekuliert, dass die Mondphasen und die periodischen Veränderungen des Lichts einen evolutionären Druck auf bestimmte Arten ausüben könnten. Diese periodischen Veränderungen könnten zur Entwicklung von internen biologischen Uhren geführt haben, die die Regulierung von Verhaltensweisen und physiologischen Prozessen steuern. [
8
]
Abb. 10: Rückseite des Mondes
4. Wasser, Grundlage des Lebens
Die genaue Entstehungsgeschichte des Wassers auf der Erde ist Gegenstand wissenschaftlicher Forschungen. Es gibt mehrere Theorien, hier die Favoriten:
1. Das Wasser war in den Gesteinen der Erde gebunden, es war also Teil der Staubwolke bei der Erdentstehung. Wasserdampf wurde beim Schmelzen des Gesteins freigesetzt.
2. Asteroiden und Kometen aus Eis haben auf der Erde eingeschlagen. Vor etwa vier Milliarden Jahren fand ein großes Bombardement durch Kometen und Asteroiden statt.
Möglicherweise haben beide Szenarien zu unserem hohen Wassergehalt auf der Erde beigetragen. Auf der heißen Erde konnte sich das Wasser nur dampfförmig in der Ur-Atmosphäre verteilen. Durch die allmähliche Abkühlung entstanden gewaltige Wolkenbrüche. Das Wasser verdampfte zunächst auf der heißen Erdoberfläche.
Wir wissen heute nicht, wie lange es gedauert hat, bis die Erde so weit abgekühlt war, dass das Wasser nicht mehr sofort verdampfte und den Ur-Ozean bilden konnte. Schließlich bildete sich der Ur-Ozean, aus dem einige hohe Vulkane ragten. [9]
Abb. 11: Heute bedeckt Wasser ca. 71 % der Erdoberfläche
5. Erstes Leben
Die ersten Lebensformen auf der Erde entstanden vor etwa 4 bis 3,8 Milliarden Jahren, kurz nachdem die Erde durch Abkühlung und Stabilisierung der Oberfläche lebensfreundliche Bedingungen entwickelt hatte. Diese ersten Lebensformen waren wahrscheinlich Einzeller, die keine Zellkerne oder komplexe Organellen besaßen.
Die genaue Entstehung dieser ersten Lebensformen ist noch Gegenstand aktiver Forschung und Diskussion, aber es gibt mehrere Theorien und Hypothesen darüber, wie das Leben auf der Erde entstanden ist. [10]
5.1 Die Ursuppe
Das Leben auf der Erde soll in einer heißen, mineralreichen Suppe entstanden sein, die sich vor etwa 3,8 Milliarden Jahren auf der Erde befunden haben soll. Diese Suppe soll alle notwendigen Zutaten für das Leben enthalten haben.
Diese Theorie ist umstritten.
5.2 Leben von anderen Himmelskörpern
Das Leben auf der Erde könnte möglicherweise von außerhalb unseres Planeten stammen. Dies könnte zum Beispiel durch Meteoriten oder andere kosmische Objekte geschehen sein, die Bakterien oder andere einfache Organismen auf die Erde gebracht haben. Diese Theorie verschiebt die Entstehung von Leben nur irgendwo ins Weltall. Die Frage nach der Entstehung des Lebens wir damit nicht beantwortet.
5.3 Es brodelte in den Tiefen des Ur-Ozeans
Auslöser für den Beginn des Lebens könnten thermische, chemische und stoffliche Unterschiede in heißen Quellen und Schloten auf dem Meeresboden gewesen sein.
Abb. 12: Weißer Raucher
Aus Schloten (z. B. Schwarze oder Weiße Raucher), aus heißen Quellen, aus Vulkanen, aus Spalten in der Erdkruste in der Tiefe des Ur-Ozeans kommen aus dem Erdinneren heiße Gase, Mineralien und Eisenpartikel. Sie reagieren unter hohem Druck und hohen Temperaturen mit dem Wasser. Das Leben könnte an der Oberfläche von Eisen-Schwefel-Mineralen entstanden sein, also Sulfiden, wie sie sich heute noch durch besondere Prozesse an Tiefsee-Vulkanen bilden. Bakterien, die zu ihrem Stoffwechsel Eisen und Schwefel nutzen, existieren heute noch in der Tiefsee.
Im Ur-Ozean entwickelten sich methanbildende Archaeen (Ur-Bakterien) und andere anaerobe Prokaryoten, die ohne Sauerstoff einen Stoffwechsel ermöglichten. [11]
Sie erzeugten Energie aus anorganischen Verbindungen und schieden Methan aus. Die Atmosphäre reicherte sich dadurch mit Methan an. Anorganische Stoffe wie Schwefelwasserstoff, Schwefel, Eisen und Nitrite wurden als Energielieferanten gebraucht.
5.4 Entstehung des Lebens in der Uratmosphäre
Eine gängige Hypothese ist die Annahme, dass die Uratmosphäre eine Mischung aus Wasserstoff (H2), Methan (CH4), Ammoniak (NH3) und Wasserdampf (H2O) enthielt. Diese Gase könnten aus vulkanischen Aktivitäten und der Ausgasung des Erdinneren in die Atmosphäre gelangt sein.
In einer solchen Atmosphäre könnten verschiedene chemische Reaktionen stattgefunden haben, die zur Bildung komplexer organischer Moleküle führten, die für die Entstehung des Lebens von Bedeutung sind.
In dem berühmten Miller-Urey-Experiment wurde versucht, die Bedingungen der Uratmosphäre nachzustellen. Dieses Experiment wurde 1953 von Stanley Miller unter der Aufsicht von Harold Urey durchgeführt.
Eine Mischung aus Methan, Ammoniak, Wasserstoff und Wasserdampf wurde in einen Fünf-Liter-Kolben gefüllt und von einem elektrischen Entladungsapparat mit Energie versorgt, um die ultraviolette Strahlung der Sonne nachzustellen. Man ließ die Produkte kondensieren und sie sammelten sich in einem unteren Kolben. Die diesem Kolben zugeführte Wärme recycelte den Wasserdampf so, wie Wasser aus Seen und Meeren verdunstet, bevor er in die Atmosphäre gelangt und wieder als Regen kondensiert.
Nach einem Tag Dauerbetrieb fanden Miller und Urey eine dünne Schicht Kohlenwasserstoffe auf der Wasseroberfläche.
Nach etwa einer Woche Betrieb hatte sich im unteren Kolben ein dunkelbrauner Schaum angesammelt, der verschiedene Arten von Aminosäuren, darunter Glycin und Alanin, sowie Zucker, Teer und verschiedene andere nicht identifizierte organische Chemikalien enthielt. [12]
6. Die Entstehung organischer Verbindungen
6.1 Organische Elemente
Einige wenige Elemente genügten, um erste organische Verbindungen für das Leben zu schaffen:
Atom bzw.
Anzahl
Anzahl
Anzahl Elektronen in den Schalen
Isotop
Protonen
Neutronen
K
L
M
N
O
Summe
Wasserstoff
H
1
0
1
1
Kohlenstoff
C
6
6
2
4
6
Stickstoff
N
7
7
2
5
7
Sauerstoff
O
8
10
2
6
8
Phosphor
P
15
16
2
8
5
15
Schwefel
S
16
16
2
8
6
16
Eisen
Fe
26
30
2
8
16
26
Abb. 13: Organische Elemente
Der Kohlenstoff hat vier Bindungselektronen. Er kann durch Bindung mit ein bis vier weiteren Kohlenstoffatomen ein Molekül bilden. Lineare oder verzweigte Kohlenstoffketten und Kohlenstoffringe konnten entstehen.