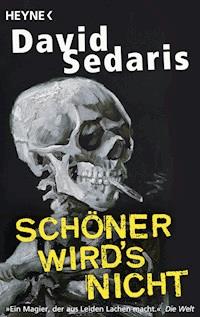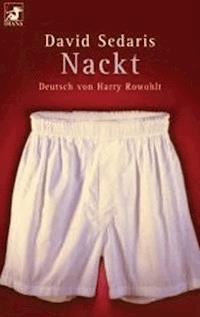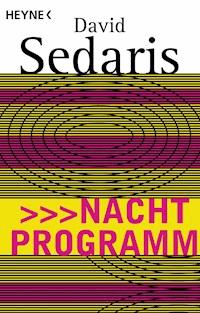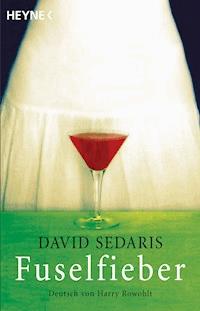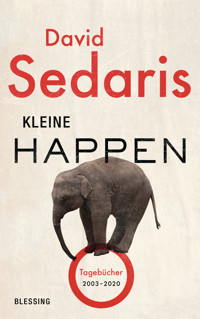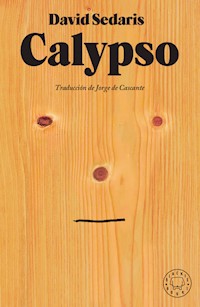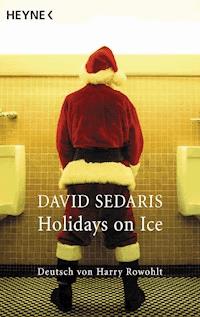7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blessing
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Als die Tiere den Wald aufmischten: Fabelhaftes von David Sedaris
Er hat „einen Sinn für die schrägen, einsturzgefährdeten Seiten des Daseins“ (SPIEGEL ONLINE). Die Bücher über sein Leben hat Bestsellerautor David Sedaris längst als eigenes literarisches Genre etabliert. Aber er kann auch anders. Das Leben ist kein Streichelzoo: Davon können die Tiere, die Sedaris in seinen sechzehn subtil fiesen und wahrhaft komischen Fabeln auftreten lässt, ein Lied singen.
Bleischwer senkt sich peinlich berührtes Schweigen über den Friseursalon des Pavians, der seine Kundin, eine Katze, gerade leichtfertig durch eine Bemerkung über Körperpflege mit der Zunge verstört hat. Guten Mutes folgt das Schaf auf der Weide den Meditationsübungen einer Krähe, nicht ahnend, dass die Sache für sein kleines Lämmchen nicht gut enden wird. Ungläubig lauscht die Laborratte im Käfig den Theorien eines Neuzugangs, wonach körperliche Gesundheit lediglich eine Frage der positiven Einstellung ist.
In diesen virtuosen Fabeln leuchtet Sedaris zielsicher und haarsträubend witzig die kleinen Peinlichkeiten und großen Katastrophen des Lebens aus, denen kein Tier – und kein Mensch – entrinnen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 123
Ähnliche
Für meine Schwester Gretchen
Inhaltsverzeichnis
Die Katze und die Pavianin
Die Katze war zu einer Party eingeladen und ging zur Pavianin, um sich schick machen zu lassen.
»Was für eine Party ist es denn?«, fragte die Pavianin, während sie der Katze zur Entspannung den Nacken massierte, wie sie es bei allen ihren Kundinnen machte. »Hoffentlich nicht das Erntedankfest unten am Fluss. Meine Schwester ist letztes Jahr dort gewesen und hat gesagt, sie hätte noch nie ein so rüdes Volk erlebt. Zwei Opossums hätten eine Schlägerei angezettelt, und dabei sei die Frau eines der beiden gegen einen Baumstumpf geschubst worden und habe sich vier Zähne ausgeschlagen. Noch dazu recht hübsche, nicht so gelbe Dinger wie bei den meisten Tieren, die sich von Abfällen ernähren. «
Die Katze erschauerte. »Nein«, sagte sie. »Nur ein Treffen unter Freunden. Die Sorte Feier.«
»Gibt’s was zu essen?«, fragte die Pavianin.
»Irgendwas«, seufzte die Katze. »Keine Ahnung, was genau. «
»Ist auch eine schwierige Angelegenheit«, sagte die Pavianin. » Jeder hat seinen eigenen Geschmack. Der eine mag Blätter, und der andere kann sie nicht ausstehen. Die Gäste sind heutzutage so wählerisch, dass ich einfach nur noch eine Schale mit Erdnüssen hinstelle, soll die essen, wer mag. «
»Also, Erdnüsse wären nichts für mich«, sagte die Katze. »Ganz und gar nicht.«
»Na, dann hält man sich eben an die Getränke. Der Trick ist nur, zu wissen, wann man genug hat. «
»Damit habe ich kein Problem«, prahlte die Katze. »Ich trinke, bis ich abgefüllt bin, und dann stehe ich auf und gehe. Das habe ich schon immer so gemacht. «
»Eine sehr vernünftige Einstellung. Nicht so wie bei einigen hier in der Nachbarschaft. « Die Pavianin zupfte einen Floh vom Kopf der Katze und steckte ihn sich behutsam in den Mund. »Letzte Woche zum Beispiel war ich auf einer Hochzeitsfeier, letzten Samstag war’s, glaube ich. Zwei Kaninchen unten vom Sumpf haben geheiratet, Sie haben bestimmt davon gehört. «
Die Katze nickte.
»Also, ich mag ja kirchliche Trauungen, aber das war eine, bei der die Brautleute sich selbst ihre Treueschwüre schreiben. Die hatten beide noch nie einen Stift in der Hand gehabt, aber mit einem Mal halten sie sich für die größten Dichter, als bräuchte man dazu nicht mehr als verliebt zu sein. «
»Mein Mann und ich haben auch unsere eigenen Treueschwüre geschrieben«, wandte die Katze ein.
»Natürlich«, erwiderte die Pavianin, »nur hatten Sie einander vermutlich auch was zu sagen, nicht so wie diese Sumpfkaninchen, die haben ihre Liebe mit einem zarten Schössling oder was weiß ich verglichen. Und während der ganzen Feier hat daneben ein Eichhörnchen auf einer Harfe oder so was geklimpert.«
»Bei meiner Hochzeit hat auch jemand Harfe gespielt«, sagte die Katze, »und es war wunderschön. «
»Das glaube ich gerne, aber Sie hatten bestimmt einen richtigen Musiker engagiert, der auch spielen konnte. Dieses Eichhörnchen hatte garantiert nie eine Unterrichtsstunde gehabt. Hat die Saiten mit seinen Krallen beharkt, als hätte es eine Mordswut auf das Instrument. «
»Es hat bestimmt sein Bestes gegeben«, sagte die Katze.
Die Pavianin nickte und lächelte, wie man es im Dienstleistungsgewerbe erwartet. Sie hatte mit der Geschichte über ein betrunkenes Sumpfkaninchen fortfahren wollen, einen Bruder des Bräutigams in der letzten Woche, aber das hatte jetzt keinen Zweck, zumindest nicht bei dieser Kundin. Die Katze widersprach ihr ständig, und wenn sie nichts fand, worüber sie einer Meinung waren, konnte sie ihr Trinkgeld vergessen. »Wissen Sie«, sagte sie und kratzte etwas Schorf aus dem Nacken der Katze, »ich hasse Hunde. Ich kann sie einfach nicht ausstehen.«
»Wie kommen Sie jetzt darauf?«, fragte die Katze.
»Ich musste nur gerade daran denken«, sagte die Pavianin. » Gestern ist so eine Spanielmischung hier reinspaziert und wollte eine Haarwäsche. Die habe ich gleich vor die Tür geschickt und gesagt: ›Interessiert mich nicht, wie viel Geld Sie haben, ich unterhalte mich nicht mit jemandem, der sich am Arsch leckt.‹« Im gleichen Moment bemerkte sie ihren Patzer.
»Und was, bitte schön, ist daran auszusetzen?«, protestierte die Katze. »Es ist gut, einen sauberen Anus zu haben. Ich lecke meinen mindestens fünf Mal am Tag. «
»Bewundernswert«, sagte die Pavianin, »aber Sie sind auch kein Hund.« »Und das heißt?«
»Bei einer Katze… hat das Stil«, sagte die Pavianin. »Das sieht elegant aus, aber bei einem Hund, Sie wissen ja, was für Verrenkungen die machen, die Beine wild von sich gestreckt. «
»Nun ja«, sagte die Katze, »da haben Sie schon recht.«
»Und dann geifern und sabbern sie alles voll, und was von ihrem Glibber verschont bleibt, beißen sie in Fetzen. «
»So sind sie.« Die Katze kicherte leise, und die Pavianin entspannte sich und kramte in ihrem Gedächtnis nach einer verleumderischen Hundegeschichte. Die Colliehündin, die Schäferhündin und die Spanielmischung, die sie angeblich hinausgeworfen hatte: Sie alle waren gute Freundinnen und treue Kundinnen, aber was machte es schon, das Gegenteil zu behaupten und einen schmalen Grat zu überschreiten, den zwischen Arschlecken und Arschkriechen?
Die Wandergrasmücken
Die gelbe Grasmücke behauptete meistens, alles liefe gut, bis sie nach Brownsville käme. »Und dann – wrumms! «, erzählte sie ihren Freunden. » Ich weiß nicht, ob es an der Luft oder sonst was liegt, aber sobald wir auf unserem Flug da durchkommen, muss ich eine Pause machen und mir die Seele aus dem Leib kotzen. «
»Das kann man wohl sagen«, gluckste ihr Gatte.
»Ein oder zwei Stunden Pause, mehr brauche ich nicht, aber ist das nicht merkwürdig? Nicht Olmito oder Bayview oder Indian Lake, sondern Brownsville. Immer wieder Brownsville. «
Ihre Zuhörer versuchten, mitfühlend oder zumindest interessiert zu klingen. »Hm«, sagten sie, oder: »Brownsville, ich glaube, dort wohnt ein Cousin von mir. «
Von der Südspitze Texas’ aus flog das Paar über Mexiko und dann weiter nach Mittelamerika. »Meine Familie überwintert in Guatemala, seit ich denken kann«, erklärte die Grasmücke. »Jedes Jahr, exakt zur gleichen Zeit, fallen wir zu Zehntausenden dort ein. Aber glaubt ihr, irgendeiner der Spanisch sprechenden Vögel würde sich die Mühe machen, Englisch zu lernen? Um nichts in der Welt!«
»Es ist schrecklich«, sagte ihr Mann.
»Na, aber auch lustig«, ergänzte seine Frau. »Schrecklich und lustig. Also einmal zum Beispiel fragte ich einen kleinen guatemaltekischen Vogel: ›Don day est tass las gran days mose cass de cab eyza?‹«
Ihre Zuhörer legten den Kopf zur Seite, verwirrt und mehr als nur ein bisschen beeindruckt. »Moment mal, du sprichst dieses Kauderwelsch?«
»Oh, ich habe hier und da was aufgeschnappt«, sagte die Grasmücke in ihrer beiläufigen Art. »Ich meine, was bleibt mir übrig? Ich glaube, ich habe ein gutes Ohr für Sprachen. Hat man mir jedenfalls gesagt. «
»Sie ist ein echtes Sprachgenie«, prahlte ihr Mann, worauf seine Frau nur abwehrend einen Flügel hob. »Na ja, nicht immer. In dem Fall, zum Beispiel, hatte ich fragen wollen, wo die großen Pferdebremsen seien. Das leuchtet ja auch ein, nur hatte ich statt cob ayo, was ›Pferd‹ heißt, cab eyza gesagt. So aber lautete meine Frage: ›Wo sind die großen Kopffliegen?‹«
Ihre Zuhörer kicherten höflich, weil sie glaubten, dies sei das Ende der Geschichte. »Kopffliegen, wie komisch. «
»Moment, es geht noch weiter«, sagte die Grasmücke. »Der guatemaltekische Vogel gab mir einen Wink, ihm durchs Gebüsch zu folgen. Dahinter war ein Feld, auf dem etwa dreihundert Köpfe in der Nachmittagssonne verwesten. Auf jedem saßen ungefähr fünfzig Fliegen. Alles riesige Biester, so groß wie Walnüsse. «
»Mein Gott«, sagten die Zuhörer. »Verwesende Köpfe mit lauter Fliegen?«
»Oh, keine Vogelköpfe«, versicherte die Grasmücke. »Die Köpfe gehörten Menschen, zumindest früher einmal. Das Fleisch warf Blasen, und die Haare waren zu Klumpen verklebt. Ich weiß nicht, was mit den Körpern passiert war, vielleicht hatte man die verbrannt. Und dann hatten sie die Köpfe zu einer Mauer aufgetürmt.«
»Eigentlich sah es mehr aus wie eine Theke«, sagte ihr Mann.
Es war ganz eindeutig eine Mauer gewesen, aber sollte man die ganze Zuhörerschaft bitten, sich die Ohren zuzuhalten, damit man sich eine Stunde lang mit seinem lächerlichen Mann, der eine Theke nur von Bildern her kannte, zoffen konnte? Nein. Das Beste war, einfach darüber hinwegzusehen.
»Also, wir sehen da diese Mauer, meinetwegen auch Theke aus menschlichen Köpfen, und ich will sagen: ›Hier stinkt’s wie der Teufel‹, aber stattdessen sage ich …« An dieser Stelle prustete sie laut los und gab das Wort an ihren Gatten weiter.
»Tatsächlich sagt sie zu dem kleinen guatemaltekischen Vogel: ›Der Teufel schnüffelt bei mir da unten.‹ Unglaublich, oder? Meine Gattin, meine Damen und Herren, oder wie sie südlich der Grenze auch genannt wird, Satans sexy Stinkerchen!«
Die Zuhörer schüttelten sich vor Lachen, und die Grasmücken, Mann und Frau, genossen das Gefühl, ihr Publikum genau dorthin gebracht zu haben, wo sie es haben wollten. Das war die Belohnung dafür, drei Monate im Jahr in einem unterentwickelten Land zu verbringen. Und wenn im milden Abendlicht das Gelächter in Gesang überging, entschädigte das beinahe für die erduldete Mühsal – die Magenverstimmungen, zum Beispiel, oder die Momente, wenn die Fremdheit einer anderen Kultur, statt die beiden Partner enger aneinanderzuschweißen, sie nur weiter voneinander trennte und sie sich einsam und verletzt vorkamen.
Daheim in ihrem Element, funktionierten die beiden Grasmücken wie eine gut geölte Maschine. »Wenn ihr mal richtig lachen wollt, dann versucht da unten mal irgendeinen Handwerker zu bekommen«, sagte der Grasmückenmann als Auftakt zu einer Reihe unglaublich komischer Erzählungen über faule Eingeborene, ihre stümperhafte und rückständige Art und ihren Aberglauben. Das warf die Frage auf: »Warum überhaupt dorthin gehen? Warum nicht in Florida überwintern, wie alle anderen?« Die Grasmücken erklärten dann, dass Mittelamerika, ungeachtet der abgetrennten Köpfe, auf seine ganz eigene Weise schön sei.
»Und so billig«, fügten sie hinzu. »Cheap, cheap, cheap.«
Das Eichhornchen und das Streifenhörnchen
Das Eichhörnchen und das Streifenhörnchen waren seit zwei Wochen ein Paar, als ihnen der Gesprächsstoff ausging. Eicheln, Parasiten, der unvermeidlich nahende Herbst: Alle diese Themen hatten sie bereits nach einer Stunde durch, ganz außer Atem und mit hochroten Köpfen. Zweimal hatten sie ein ausgiebiges Gespräch über Hunde geführt, in dem sie beide ihren grundsätzlichen Hass auf sie erklärt und darüber spekuliert hatten, was für ein Leben das wäre, wenn ihnen jemand zweimal am Tag eine Schale Futter vorsetzen würde. »Die sind durch und durch verzogen«, hatte das Streifenhörnchen gesagt, und das Eichhörnchen hatte seine Pfote auf die seiner Partnerin gelegt und gesagt: »Genau. Endlich einmal jemand, der es begriffen hat. «
Freunde hatten sie gewarnt, es könne mit ihnen nicht gut gehen, und solche Augenblicke schienen ihnen der Beweis, dass die Skeptiker nicht nur im Unrecht, sondern obendrein neidisch waren. »Sie werden nie das haben, was zwischen uns existiert«, sagte das Eichhörnchen, und dann saßen beide ganz still da und hofften auf eine plötzliche Flut oder einen Gewehrschuss, irgendetwas, über das sie miteinander reden konnten.
Eines Abends waren sie in einer kleinen Bar, die von einem Eulenpaar betrieben wurde. Nach langem Schweigen schlug das Eichhörnchen mit der flachen Hand auf die Tischplatte. »Weißt du, worauf ich stehe? «, fragte es. »Ich stehe auf Jazz.«
»Das wusste ich gar nicht«, sagte das Streifenhörnchen. »Herr im Himmel, Jazz!« Sie hatte keine Ahnung, was Jazz war, wagte aber nicht, danach zu fragen, um sich nicht zu blamieren. »Welche Art denn? «, fragte sie, darauf hoffend, seine Antwort werde die Dinge etwas eingrenzen.
»Na ja, eigentlich alles«, sagte er. »Vor allem die frühen Sachen.«
»Ich auch«, sagte sie, und als er wissen wollte, warum, sagte sie, die späteren Sachen seien zu spät für ihren Geschmack. »So als wären sie überreif oder so was. Verstehst du?«
Da streckte das Eichhörnchen zum dritten Mal, seit sie sich kannten, seine Hand über den Tisch und nahm ihre Pfote.
Als sie abends nach Haus kam, weckte das Streifenhörnchen ihre ältere Schwester, mit der sie ein Zimmer teilte: »Hör zu«, flüsterte sie, »du musst mir etwas erklären. Was ist Jazz?«
»Warum fragst du mich das? «, sagte die Schwester.
»Du weißt es also auch nicht?«, fragte das Streifenhörnchen.
»Ich habe nicht gesagt, dass ich es nicht weiß«, sagte die Schwester. »Ich habe nur gefragt, warum du es von mir wissen willst. Hat das was mit diesem Eichhörnchen zu tun?«
»Vielleicht«, sagte das Streifenhörnchen.
»So, ich sag’s den Eltern«, verkündete die Schwester. »Gleich morgen früh, das geht jetzt schon viel zu lange so.« Sie klopfte auf ihr Mooskissen und legte es zurück unter ihren Kopf. »Ich habe dich schon vor Wochen gewarnt, dass das nicht gut gehen würde, und jetzt bringst du das ganze Haus durcheinander. Kommst mitten in der Nacht nach Hause und weckst mich auf, um mir deine kleinen schmutzigen Geheimnisse zu erzählen. Jazz also. Warte nur, bis deine Mutter davon erfährt.«
Das Streifenhörnchen lag die ganze Nacht wach und dachte an das Donnerwetter, das sie am kommenden Morgen erwartete. Was, wenn Jazz Eichhörnchen-Slang für etwas ganz Schlimmes war, zum Beispiel Analverkehr? »Oh, ich stehe auch drauf«, hatte sie gesagt, noch dazu voller Begeisterung! Andererseits konnte es sich auch um etwas nicht ganz so Schreckliches wie Kommunismus oder Wahrsagen handeln, Dinge, über die man redete, aber nur selten praktizierte. Immer wenn sie sich wieder etwas beruhigt hatte, tauchte eine neue Schreckensvision vor ihr auf, eine furchtbarer als die andere. Jazz war mit Maden gespicktes Aas, die Kruste auf einem entzündeten Auge, ein anderes Wort für rituellen Selbstmord. Und sie hatte behauptet, darauf zu stehen!
Jahre später, als sie über alles in Ruhe nachdenken konnte, erkannte sie, dass sie dem Eichhörnchen nie wirklich vertraut hatte. Wie sonst hätte sie sich so furchtbare Gedanken machen können? Wäre er wie sie ein Streifenhörnchen gewesen, und sei es ein noch so draufgängerisches, hätte sie angenommen, Jazz wäre etwas Alltägliches, eine Wurzelsorte vielleicht, oder ein bestimmter Haarschnitt. Natürlich war ihre Schwester keine Hilfe gewesen. Genau wie der Rest der Familie. »Ich habe ja nicht grundsätzlich etwas gegen Eichhörnchen«, hatte ihre Mutter gesagt. »Nur dieses, das gefällt mir einfach nicht.« Als sie nachfragte, was ihr an ihm nicht gefalle, erwähnte sie seine Fingernägel, die für ihren Geschmack etwas zu lang wären. »Ein sicheres Zeichen für Eitelkeit«, warnte sie. »Und jetzt auch noch die Geschichte mit dem Jazz.«
Das hatte letztlich den Ausschlag gegeben. Im Anschluss an die schlaflose Nacht hatte die Mutter das Streifenhörnchen gezwungen, die Beziehung zu beenden.
»Nun«, seufzte das Eichhörnchen, »ich denke, das war’s dann wohl. «
»Das denke ich auch«, sagte das Streifenhörnchen.
Ein paar Tage später hatte er sich auf den Weg flussabwärts gemacht, und sie hatte nie wieder etwas von ihm gesehen oder gehört.
»Das ist kein großer Verlust«, sagte ihre Schwester. »Kein Mädchen sollte mit solchen Ausdrücken konfrontiert werden, erst recht nicht aus dem Mund eines Eichhörnchens.«
»Amen«, fügte ihre Mutter hinzu.
Schließlich begegnete das Streifenhörnchen einem anderen, und nachdem sie sicher verheiratet waren, spekulierte ihre Mutter, bei Jazz handle es sich vielleicht um einen nicht voll anerkannten Zweig der Medizin, so etwas wie Chiropraktik. Ihre Schwester widersprach und sagte, es sei vermutlich ein Tanz, und dann stand sie vom Tisch auf und warf ihre stämmigen Beine in die Luft. »Ach, du«, sagte ihre Mutter, »das ist ein Cancan.« Dann sprang sie ebenfalls auf und tat es ihrer Tochter nach.
Das Bild blieb dem Streifenhörnchen im Gedächtnis, denn sie hätte nie gedacht, dass ihre Mutter etwas vom Tanzen oder sonst einer Beschäftigung verstand, die mit Vergnügen zu tun hatte. Genau so sahen sie später auch ihre eigenen Kinder : als trübsinnig, streng und ewig gestrig. Sie hatte mehrere Jungen, alle kerngesund, und nur einer bereitete ihr Sorgen. Er hatte die Angewohnheit, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein, aber er hatte ein gutes Herz, und das Streifenhörnchen wusste, er würde zuletzt den rechten Weg finden. Ihr Mann dachte genauso und starb in dieser Gewissheit.
Ein oder zwei Monate nach seinem Tod fragte sie ihren Sohn, was Jazz sei, und als er antwortete, eine Musikrichtung, wusste sie instinktiv, dass er die Wahrheit sagte. »Ist es schlechte Musik? «, fragte sie.
»Nur wenn sie schlecht gespielt wird«, sagte er. »Sonst ist sie ganz angenehm.«
»Haben Eichhörnchen sie erfunden?«
»Du lieber Himmel, nein«, sagte er. »Wer hat dir denn das erzählt?«
Das Streifenhörnchen strich sich über die braunweiße Schnauze. »Niemand«, sagte sie. »War nur so ein Einfall. «
Als ihre Schnauze mehr weiß als braun geworden war, vergaß das Streifenhörnchen, dass sie und das Eichhörnchen sich damals nichts zu erzählen hatten. Sie vergaß auch, was Jazz bedeutete, und verband damit alles Schöne, das sie in ihrem Leben nie genügend schätzen gelernt hatte: den Geschmack warmen Regens; den Geruch eines Babys; das Rauschen eines angeschwollenen Flusses, der an ihrem Baum vorbei der Ewigkeit entgegenfloss.
Die Kröte, die Schildkrote und der Enterich
Die Beschwerdeschlange begann am Rand des Sumpfes, zog sich von dort westwärts und endete an einem verkohlten Kiefernstumpf, an dem die Schildkröte sich endlich einfand. Sie stellte sich hinter einer Kröte mit glasigen Augen an und gähnte breit, als ein Enterich den Platz hinter ihr einnahm und leise brummte: »Was für ein Haufen Idioten.«
Die Schildkröte nickte mit weit aufgerissenem Maul.
»Ich stehe schon zum zweiten Mal an, ob Sie’s glauben oder nicht«, meckerte der Enterich. »Beim ersten Mal haben sie mir gesagt, ich bräuchte keinen Ausweis, und dann, nachdem ich fast drei Stun-den angestanden hatte, erklärt mir diese aufgeblasene Flussratte: ›Tut mir leid, Sir, aber wenn Sie sich nicht ausweisen können, kann ich nichts für Sie tun.‹ Ich sag ihr: ›Warum zum Teufel haben Sie mir das nicht früher gesagt?‹, worauf sie mich nur anblafft : ›Wenn Sie sich nicht benehmen können, muss ich Sie bitten zu gehen.‹«
Die Schildkröte stöhnte mitfühlend, als sei ihr schon einmal Ähnliches widerfahren. »Der älteste Trick überhaupt«, sagte sie. »Die vermasseln alles, aber irgendwie bist du das Problem. «
»Ich hab ihr gesagt: ›Wenn Sie auf gutes Benehmen Wert legen, sorgen Sie dafür, dass Ihre Kunden nicht an der Nase herumgeführt werden!‹, fuhr der Enterich fort. »›Sie können sich schlecht über die Beschwerden anderer Leute aufregen, wenn Sie selbst der Grund dafür sind.‹«
»Sehr gut ausgedrückt«, sagte die Schildkröte, die später zugab, tatsächlich beeindruckt gewesen zu sein. »Von einer Ente oder überhaupt einem Vogel erwartet man keine gestochenen Formulierungen«, erklärte sie abends ihrer Familie, »aber der Enterich hat den Nagel auf den Kopf getroffen.«
Genau an der Stelle hatte sich die Kröte in die Unterhaltung eingeschaltet: »Wollen Sie mal was über Benehmen hören? Als ich endlich an der Reihe war und meinen Ausweis vorlegte, hat man mir gesagt, ich bräuchte zwei Ausweise. Nicht zu glauben, oder? Ich sagte: ›Ich habe nicht gesehen, dass der breitärschige Luchs vor mir zwei Ausweise vorgelegt hat‹, worauf die Angestellte hinterm Schalter, eine Schwarznatter, bloß sagt, es handle sich um eine Sonderregelung für Reptilien.
›Na prima‹, sage ich. ›Ich bin nämlich eine Amphibie. ‹ Und darauf sagt sie allen Ernstes: ›Das ist doch das Gleiche.‹
Ich sage: ›Das ist verdammt noch mal überhaupt nicht das Gleiche. Erstens paare ich mich nicht im Wasser. Und zweitens habe ich immer noch die gleiche Haut wie bei meiner Geburt. Erzählen Sie mir also keinen Müll von wegen das Gleiche. Gerade Sie sollten es besser wissen!‹ Und dann kommt sie mir mit dem gleichen Dreck, den die Wasserratte dem Enterich erzählt hat, von wegen: ›Tut mir leid, Sir, aber wenn Sie in dem Ton mit mir reden …‹«
Die Schildkröte verdrehte die Augen. »Typisch.«
»Ich hätte ihr eine reinhauen sollen«, sagte die Kröte. »Mitten ins Gesicht – paff.«
»Ganz meine Meinung!«, sagte der Enterich.
»Oder nein«, fuhr die Kröte fort. »Ich hätte ihr die Augen ausstechen sollen, dann hätte sie den Rest ihres Lebens im Dunkeln verbringen können.«
Die Schildkröte hatte einen blinden Cousin, den sie nicht leiden konnte, und lachte umso lauter.
»Und dann hätte ich ihr die Zunge herausgerissen«, sagte die Kröte. »Mal sehen, wie ihr das gefallen hätte. «
»Nicht so leicht, andere zu schikanieren, wenn man keine Zunge mehr hat«, sagte der Enterich.
»Und zuletzt hätte ich sie abgefackelt«, ergänzte die Kröte. »Nein, ich hätte sie erst mit Säure übergossen und sie dann abgefackelt, das dumme Miststück.«
Die Schildkröte wollte etwas sagen, aber die Kröte, ganz aufgeregt über einen neuen Einfall, unterbrach sie: »Oder halt, nein, zuerst würde ich ihr die Zunge abschneiden und dann einen Apfel mit Scheiße beschmieren, ihr das fette Maul aufreißen und ihr ihn in den Rachen stopfen. Danach würde ich sie mit Säure übergießen und sie abfackeln. «
Die drei lachten.
»Eine Cantaloupe wäre noch besser«, sagte die Schildkröte. »Die mit Scheiße beschmieren und ihr in den Rachen schieben, ha!«
»Oder nein«, sagte der Enterich. »Statt der Cantaloupe könnte man eine Wassermelone nehmen und dann …«
In dem Moment kühlte die ausgelassene Stimmung ab. »Eine Wassermelone für eine Schwarznatter«, sagte die Kröte. »Das ist einfach nur rassistisch. «
»Aber nein«, sagte der Enterich, »ich meinte doch nur …«
»Ich weiß, was Sie meinten«, sagte die Kröte. »Und ich finde, es stinkt zum Himmel.«
»Sehr richtig«, stimmte die Schildkröte zu.
»Ach, ihr könnt mich alle mal«, sagte der Enterich und watschelte leise fluchend davon.
»Mein Gott, wie ich solche Typen hasse«, sagte die Kröte. »Eine Wassermelone. Bei einer Königsnatter hätte er das bestimmt nicht gesagt, und bei einem Python erst recht nicht. «
Die beiden schauten dem abziehenden Enterich hinterher und schüttelten angewidert die Köpfe. Einen Moment war es still, dann sagte die Kröte: »Ich hätte eine Honigmelone mit Scheiße eingeschmiert – oder nein, eine Honigmelone und eine Cantaloupe. Ich hätte zwei Melonen mit Scheiße beschmiert und ihr in den Rachen gestopft. Dann hätte ich sie mit Säure übergossen, und dann hätte ich sie abgefackelt.«
»Na ja«, sagte die Schildkröte, »es gibt immer ein nächstes Mal. «
Die mutterlose Bärin
Drei Stunden, bevor sie starb, grub die Bärenmutter ein paar Eicheln aus, die ein Eichhörnchen Monate zuvor verscharrt hatte. Sie waren feucht und von Würmern zerfressen, so unappetitlich wie Hundehaufen, und sie schob sie, seufzend über ihr elendes Los, zurück in die Erde. Gegen zehn gab sie es auf, sich eine Klette aus dem Fell der linken Hüfte zu zupfen, und dann, so erzählte ihre Tochter : »Dann war sie plötzlich … tot.«
Die ersten zehn Male wiederholte die junge Bärin den Satz, ohne ihn recht zu glauben. Ihre Mutter nicht mehr da – unmöglich! Nach einem Tag aber ließ der Schock nach, und sie versuchte ihn mit einer kunstvollen Pause und einer Reihe amateurhafter theatralischer Gesten wiederzuerwecken. Ein abwesender Blick half dabei, und zuletzt hatte sie den Satz perfekt einstudiert. »Und dann«, sagte sie, den Blick auf den fernen Horizont gerichtet, »dann war sie plötzlich … tot.«
Sieben Mal konnte sie weinen, doch nach einigen Wochen wurde das schwieriger, und sie ging dazu über, ihr Gesicht mit den Tatzen zu bedecken und ruckartig die Schultern hochzuziehen. »Gut so, gut so«, sagten ihre Freunde, und sie stellte sich vor, wie sie zu ihren Familien zurückkehrten und sagten: »Ich habe heute diese arme mutterlose Bärin gesehen, also wenn einem das nicht das Herz bricht, weiß ich es auch nicht.«
Ihre Nachbarn brachten ihr zu essen, mehr als genug, um damit über den Winter zu kommen, sodass sie auf den Winterschlaf verzichtete und furchtbar fett wurde. Im Frühjahr kamen die anderen aus ihren Höhlen gekrochen und sahen, wie sie die letzten frühen Traubenkirschen verspeiste. »Essen lindert den Schmerz «, erklärte sie, während ihr der leuchtende Saft vom Kinn tropfte. Als die Bären sich abwandten, folgte sie ihnen. »Habe ich schon erzählt, dass meine Mutter gestorben ist? Wir hatten einen wunderbaren Morgen verbracht, und ganz plötzlich …«
»Das ist keine Entschuldigung dafür, uns alles wegzufressen«, schimpften die anderen.
Ein paar Bären hörten ihr geduldig zu, aber in ihren Augen sah sie, dass ihr Mitleid sich in etwas anderes verwandelt hatte, das im besten Fall Langeweile, im schlimmsten Fall peinliche Verlegenheit war, nicht über sich selbst, sondern über sie.
Die Freundin, die ursprünglich am meisten Mitgefühl gezeigt und bittere Tränen vergossen hatte, als sie die Geschichte zum ersten Mal hörte, versuchte ihr zu helfen: »Such dir eine Aufgabe«, sagte sie. »Das habe ich auch gemacht, als mein Großvater einen Herzanfall bekam, und es hat Wunder gewirkt.«
»Eine Aufgabe?«, fragte die Bärin.
»Du weißt schon«, sagte ihre Freundin, »grab dir eine neue Höhle oder so was.«
»Aber ich bin mit meiner Höhle ganz zufrieden.«
»Dann hilf jemand anderem beim Graben. Die Tante meines Exmanns zum Beispiel hat letztes Jahr eine Pranke in einer Falle verloren und den Winter in einem Graben verbracht. Warum hilfst du ihr nicht?«
»Ich habe mir auch einmal die Tatze verletzt«, sagte die Bärin. »Da ist mir eine Kralle glatt abgebrochen, und als sie endlich nachgewachsen war, sah sie aus wie eine Paranuss.« Sie versuchte, das Gespräch wieder auf sich zu lenken, in der Hoffnung, die Freundin werde ihren Vorschlag fallen lassen, aber das funktionierte nicht.
»Ich sag der Guten, du kämst heute Nachmittag vorbei«, sagte sie. »Da wird sie glücklich sein, und du kannst ein paar Pfunde abspecken. «
Die Freundin trottete davon, und die Bärin starrte auf ihr entschwindendes Hinterteil. »Da kannst du ein paar Pfunde abspecken«, äffte sie ihr hinterher.
Dann rollte sie einen Baumstamm zur Seite und fraß ein paar Ameisen, die mit dem Streifen auf dem Hintern, die weniger Kalorien hatten. Danach legte sie sich in die Sonne und schlief tief und fest, bis ihre Freundin zurückkehrte und sie wach rüttelte: »Was ist los mit dir?«
»Hä? «
»Es ist fast dunkel, und die Tante meines Exmanns hat den ganzen Tag auf dich gewartet. «
»Ach, richtig«, sagte die Bärin und stieg den Berg hinauf, beschloss aber schon nach wenigen Metern, dass nichts daraus werden würde. Einem Ratschlag folgen, um den sie nicht einmal gebeten hatte, das fehlte noch. Anstatt eine Höhle für eine Fremde zu graben, die alt war und ohnehin sterben würde, wollte sie lieber fortgehen und sich auf der anderen Seite des Berges niederlassen. Dort würde sie neuen Bären begegnen, Fremden, denen sie ihre Geschichte erzählen und sich wieder tragisch fühlen konnte.
Am folgenden Morgen brach sie auf, sich vorsichtig an der verstümmelten alten Bärin vorbeischleichend, die immer noch neben ihrem kümmerlichen Graben hockte und auf sie wartete. Hinter einem abgebrannten Birkenhain stieß sie auf einen Fluss, dessen Lauf sie folgte, bis sie auf ein Bärenjunges traf, das hüfttief im rauschenden Wasser saß und mit täppischen Tatzenschlägen versuchte, einen Fisch zu fangen.
»So habe ich das auch gemacht, als ich klein war«, rief die Bärin. Das Junge blickte auf und tat einen erstaunten Schrei.
»Ich muss den ganzen Vormittag über im Wasser gesessen haben, bis meine Mutter kam und mir zeigte, wie man Fische fängt.« Sie machte eine kurze Pause und fuhr dann fort: »Natürlich könnte das jetzt nicht mehr passieren, und weißt du, warum?«
Das Bärenjunge sagte nichts.
»Es könnte jetzt nicht mehr passieren, weil meine Mutter gestorben ist«, verkündete die Bärin. »Ganz plötzlich, als ich überhaupt nicht damit gerechnet hatte. Einen Moment war sie noch da, und im nächsten war sie … nicht mehr.«
Das Bärenjunge begann zu wimmern.
»Da wachst du als Waise auf, der Leichnam deiner Mutter verwest langsam neben dir, und was bleibt dir anderes übrig, als dich ganz allein durchzuschlagen, ohne dass jemand dich umsorgt oder beschützt?«
Als das Junge laut zu heulen begann, brach die Mutter aus dem Dickicht. »Bist du krank?«, brüllte sie. »Ziehst dich daran hoch, unschuldige Kinder zu verschrecken, wie? Sieh zu, dass du verschwindest. «
Die Bärin rannte zum gegenüberliegenden Ufer und weiter in den Wald, wobei sie sich immer wieder umsah und über im Weg liegende Baumstämme stolperte. Übergewichtig, wie sie war, geriet sie bald außer Atem, verfiel schon nach den ersten hundert Metern in einen Trott und wurde im Laufe des Nachmittags immer langsamer. Kurz vor Anbruch der Dämmerung roch sie Kaminfeuer und gelangte an den Rand eines Dorfes. Durch eine Lücke in einer dichten Hecke sah sie eine Ansammlung von Menschen, die mit dem Rücken zu ihr standen. Sie schienen etwas zu betrachten, das vor ihnen auf einer Lichtung stand, und als jemand ein Stück zur Seite rückte, sah sie, dass es ein männlicher Bär war, obwohl sie zweimal hinschauen musste, weil er ein Kleid und einen kegelförmigen Hut mit einem Seidentuch an der Spitze trug. Die Schnauze steckte in einem Maulkorb aus Lederriemen, und daran war eine Leine befestigt, an der ein
Titel der Originalausgabe: Squirrel Seeks ChipmunkOriginalverlag: Little, Brown and Company, New York
1. Auflage
Copyright © der Originalausgabe 2010 by David Sedaris Illustrations copyright © 2010 by Ian Falconer Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2011 by Karl Blessing Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Layout und Herstellung: Ursula Maenner Satz: Leingärtner, Nabburg
eISBN 978-3-641-06456-3
www.blessing-verlag.de
www.randomhouse.de
Leseprobe