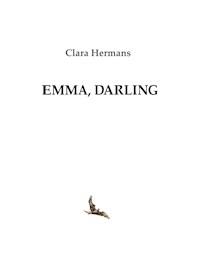Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von Anfang an gab er sich bedingungslos der mächtigen Präsenz Onkel Ferdinands anheim -- einem Mann von Statur, groß, breit, gutherzig -- aber, wie so oft bei dergleichen Volk, in prekären Situationen hilflos. Da sprang das Luiserl dann ein, nahm ihn bei der Hand und zog den Onkel jedes Mal sachte heraus aus der Bredouille. Dies schmale Luiserl! Er stand die frühen Hungerjahre mit ihm durch, begleitete seine ersten literarischen Versuche, teilte mit ihm die Schmach gnadenloser Verrisse, rettete ihn vor dem Tod auf dem feuilletonistischen Schlachtfeld, half dem blutig Zerfetzten, wieder und wieder aufzuerstehn. Nach weiteren, beschwerlichen Jahren wurde dann aus dem Onkel Ferdi doch noch, wozu er bestimmt war und wovon das Luiserl immer geträumt hatte: ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 317
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Herzlichen Dank an Raymund, ohne den dieses Buch nicht zustandegekommen wäre.
Das Luiserl!
Von Anfang an gab er sich bedingungslos der mächtigen Präsenz Onkel Ferdinands anheim – einem Mann von Statur, groß, breit, gutherzig – aber, wie so oft bei dergleichen Volk, in prekären Situationen hilflos. Da sprang das Luiserl dann ein, nahm ihn bei der Hand und zog den Onkel jedes Mal sachte heraus aus der Bredouille.
Dies schmale Luiserl! Er stand die frühen Hungerjahre mit ihm durch, begleitete seine ersten literarischen Versuche, teilte mit ihm die Schmach gnadenloser Verrisse, rettete ihn vor dem Tod auf dem feuilletonistischen Schlachtfeld, half dem blutig Zerfetzten, wieder und wieder aufzuerstehn. Nach weiteren, beschwerlichen Jahren wurde dann aus dem Onkel Ferdi doch noch, wozu er bestimmt war und wovon das Luiserl immer geträumt hatte: der strahlende Autor reißend verkaufter Unterhaltungs-Romane.
Auch das vater- und mutterlose Luiserl machte auf seine Art Karriere. Anfangs hatte er dem Onkel nur als Schreibkraft gedient. Dann, langsam zum absoluten Faktotum heranreifend, bearbeitete er seinen gesamten, umfangreichen, immer komplizierteren Schriftverkehr. Führte nach und nach die Verhandlungen mit dem Verlag, verabredete die Termine seiner Lesereisen und Vortragsabende, buchte seine Hotelunterkünfte, behielt seine Vermögensanlagen und die Vermehrung seiner Einkünfte im Auge und stand alljährlich die Hölle der Steuererklärung durch. Nebenbei erledigte er auch die Anfragen mehr oder weniger seriöser Journalisten, übernahm sowohl den Empfang überschwänglicher Fans wie die Auseinandersetzung mit giftigen Kritikern. Hielt die lösbaren, besonders jedoch die unlösbaren Probleme von ihm fern, die seine Arbeit behindern konnten.
Aber Literatur?
Nein, bloß nicht!
Oder doch?
Ohne dass das Luiserl es sich vornahm, flößte es nach und nach – wie nebenbei – in mitfühlender Anteilnahme dem Text einen blühenderen Wortschatz ein, schmeidigte seine Satzkunst, festigte mit einer kleinen, unauffällig hinzugefügten Sequenz die Glaubwürdigkeit seiner vielleicht ein wenig zu flüchtig gefassten Figuren, verdeutlichte ihre Umrisse, gab ihnen durch bedachtsame Zutaten Substanz. Verpasste da und dort einem Satz Hintergründigkeit, Doppelsinn, Tiefe. Zauberte kleine stilistische Feinheiten, Preziosen! in seine mageren Sätze. Stellte sie behutsam um und verwob sie miteinander. Gab ihnen fließende Eleganz.
Ehe das Luiserl ein Manuskript dem Verlag zuschickte, las er Korrektur, prüfte es auf Grammatik, Satzzeichen, Groß- und Kleinschreibung – und streute an manchen Stellen noch einmal Goldstaub darüber. Da der Onkel kein Manuskript, sobald er es beendet hatte, jemals wieder zur Hand nahm, konnte ihm nie auffallen, dass nicht jedes treffende Wort, nicht jeder geschliffene Satz, nicht jede kleine, feine Pointe aus seiner eigenen Feder stammte.
Kurz, der Onkel hatte nicht die mindeste Ahnung, dass längst seinen Texten mit Gottes und Luiserls Hilfe etwas zuteil wurde, was man eine “literarische” Anmutung hätte nennen können.
Da starb er. Er hatte immer zu viel und zu gut gespeist.
Dem Luiserl hinterließ er all seine Besitztümer und Rechte. Das Luiserl jedoch dachte voll Sorge: Wer gibt mir jetzt Arbeit? Wer schreibt Romane für mich, lässt mich korrigieren, Wörter hinzuerfinden, wegtun, austauschen – dass die Sätze klingen, das Profil der Personen sich deutlicher abhebt, ihre Konflikte den Leser so sehr schmerzen und ihre Lösung am Schluss ihn so rührt und beglückt, als habe er alles selber erlebt? Das ist ja ganz allein das Geheimnis der Sprache! Gerne hätte ich den Onkel einmal gefragt: was war das Wichtigste für ihn: das Sujet? oder, wie für mich, die Fassung, das Gefäß, die Sprache. Schade, zu spät!
Ach, der Onkel hat immer so viel schreiben müssen, eigentlich viel zu viel. Da war es meine Aufgabe, noch einmal drüberzugehen. Überhaupt das Korrekturlesen, was Schöneres gibt’s gar nicht. Höchstens das Selber-Schreiben. Aber wer traut sich das zu? Keiner, der ein so großes Vorbild hat wie den Onkel Ferdi, der einen Roman nach dem anderen schrieb. Nein, ich nicht! Ich kann halt nur ein bisschen rumredigieren.
Alleinerbe!
Das Luiserl versank in Trauer. In Tränen verabschiedete er sich von ihm:
“Ach, Onkel Ferdi, obgleich du, von außen betrachtet, so schwer und massiv warst, fast ein Koloss, wusste ich immer, eine zarte Seele wohnte in dir, auch wenn man sie dir nicht ansah. Hoffentlich blüht sie im Jenseits weiter, wo alles leicht ist und duftet, befreit von seiner irdischen Hülle.”
Festen Halt hatte der Onkel zeitlebens seinem Neffen gegeben, wie eine Säule dem Efeu. Viel, alles war ihm der Onkel gewesen: Übervater – Ernährer – Arbeitgeber.
Was also sollte das Luiserl jetzt mit sich anfangen? Knapp fünfunddrei-ßigjährig, hatte seine Arbeit für den Onkel dem Luiserl keine Ausbildung “nebenher” erlaubt; er hatte nichts gelernt, kein Handwerk, keinen Beruf. Immer nur war er “der Neffe vom Onkel Ferdi” gewesen. Und woraus bestand also nun seine Biographie?
Er hatte lesen gelernt!
Gelernt, insgeheim die Manuskripte des Onkels so zu verbessern, dass seinen Texten durch Zutat von Wörtern, Sätzen, Ideen mehr Glanz, mehr Anziehungskraft, mehr Glaubwürdigkeit widerfuhr.
Auch in vielerlei Dingen des praktischen Lebens, selbst in hochkomplizierten, wusste er Bescheid. Er hatte sich alles aus Büchern und aus dem Internet beigebracht. Nur – einen Abschluss, ein Zeugnis, ein Diplom besaß er nicht. Zuerst die Hungerjahre, später die Großschriftstellerei: das hatte dem Luiserl lange Zeit vollkommen genügt.
Aber jetzt, wo es den Onkel Ferdi nicht mehr gab?
“Was bleibt denn noch übrig von mir, wo ich nichts als die Hinterlassenschaft meines Onkels bin? Ein Niemand?”
Natürlich ist niemand ein Niemand. Es ist jeder ein Irgendwer und meistens ein Irgendwas noch dazu. Sprich: er besitzt eine Profession, einen Stand und einen passenden Titel dazu. Selbst ein Bettler ist noch ein – nun ja, halt ein Bettler! Nur: was für ein Wer und ein Was war das Luiserl?
Jetzt, mit dem Ableben des Onkels, hatte alles, auch seine ihm so liebwerte, freiwillige Sklaverei, ein Ende. Alleinerbe! Geld und ein paar Immobilien – bestand daraus jetzt seine Identität? Sein ICH? Er beschloss, für den Fall, dass er überhaupt ein solches besaß, sein verborgenes, sein wahres SELBST aus sich heraus zu erfragen. Auch wollte er nicht mehr das Luiserl sein – das ES, das der Onkel aus ihm gemacht hatte – sondern der ER, der Luis!
Vorläufig allerdings verschob er seine Analyse auf über- oder auf überübermorgen. Er hatte genug mit dem Nachlass des Onkels zu tun: mit der Steuer, dem Verlag, den Mietsachen und dazu mit einer besonders delikaten, mit rechnerischer Mühseligkeit verknüpften, testamentarischen Bestimmung.
Ferdis übriggebliebene, jüngere Schwester Dorothea nämlich hatte nie ein Hehl daraus gemacht, wie sehr sie ein gut gefülltes Bankkonto verachtete. So hinterließ ihr der Bruder fürs erste nur eine unerhebliche Summe, überzeugt, sie lasse sich sowieso alles als Spende für diese oder jene Bagatelle abschwatzen und binnen kurzem wäre ihr Konto geräumt. Daher sollte sie ihr wirkliches Erbe vom Luiserl in hübschen Portionen nach und nach überwiesen bekommen. Allmonatlich musste er ihr von dem, was der Bücherverkauf einbrachte, ihren Anteil auszahlen – jedes Mal für das Luiserl ein Rechenkunststück. Für die Schwester ein allerletzter, winziger Seitenhieb. Aber sie sagte nur: “Das sieht dem Ferdi ähnlich!” – böse konnte sie ihm nicht mehr sein. Der Tod ist ein mächtiger Versöhner.
Tante Dorothea war eine hochgewachsene, schlanke, noch recht jugendlich gebliebene Dame, ausgestattet mit einem erheblichen Potential an Wissen und anspruchsvoller Attitüde. Das einzige verbindende Element zwischen Bruder und Schwester war das Luiserl gewesen, der als Vollwaise – nach dem schweren Unfall einer vor langen Jahren mitsamt ihrem Gatten ums Leben gekommenen Schwester – vom Onkel Ferdinand aufgenommen und großgezogen worden war.
Das Luiserl stand von jeher in ehrfürchtiger Distanz zu dieser Tante, die familiär Doro abgekürzt wurde. Sie war jahrzehntelang an einer Mädchenschule Handarbeitslehrerin gewesen, ein wenig angesehener, dabei ehrlicher und zuletzt so gut wie ausgestorbener Beruf. Sie lebte im Appartement einer bescheidenen Giesinger Pension. Die Geschwister hatten sich zu Onkel Ferdis Lebzeiten höchstens zweimal im Jahr, an ihrem jeweiligen Geburtstag, gesehen.
Einer demonstrierte dem anderen dann mit Hingabe seine Geringschätzung. Ferdi zum Beispiel trug seiner Schwester jedes Mal ungefragt, aber mit Genuss, den Inhalt seines jüngsten Romans vor, was sie mit verächtlich versteinerter Miene über sich ergehen ließ. Der Onkel bedankte sich hernach mit zynischer Lust für „ihr glühendes Interesse und ihren Beifall”.
Wahrhaftig nicht zu Luiserls Vergnügen spielten sich diese seltenen alljährlichen Zusammenkünfte von Bruder und Schwester ab, die er an einem möglichst noblen Ort zu inszenieren hatte. Das Luiserl besaß nicht die eisernen Nerven der beiden Geschwister. Er zitterte diesen Terminen jedes Mal schon lange vorher entgegen und stand ihren Verlauf nur mit Mühe durch. Das Beisammensein war im Grunde nichts anderes als ein erbitterter Zweikampf. Wer behielt das letzte Wort? Wer brachte dem andern die schmerzhaftere Wunde bei? Jeder der beiden hielt hernach seinen Auftritt für einen Triumph seines Ego. Es gab indessen kein einziges Jahr, wo man auf diese siegesgewissen Zusammenkünfte verzichtet hätte.
Die Tante, hochgebildet, was das Neueste an moderner Kunst und Literatur betraf, sah alles und las alles, was auf den Markt kam – und verfügte über ein unbeirrbares Urteil. Nach dem allerfrühesten Roman ihres Bruders hatte sie niemals mehr eins seiner Bücher zur Hand genommen. Demzufolge war ihr natürlich auch die mit den Jahren zunehmende, zuerst kaum, dann deutlicher bemerbare Literarisierung der brüderlichen Texte entgangen.
“Ich liebe sie halt”, erklärte der Onkel Ferdi. “Die Dorothea, die alte Schachtel – und, weiß Gott, sie liebt mich auch!”
Das bestätigte sich bei Ferdis Beisetzung.
Auf dem Heimweg von seiner frischen Grabstätte führte das Luiserl die Tante Doro fürsorglich am Arm. Sie konnten zu Fuß gehen, es war nicht weit vom Ostfriedhof bis zu ihrer Pension. Die Tante weinte den ganzen Weg still vor sich hin. Wie viel ihr der Bruder, diese kraftstrotzende Natur, bedeutete – sie, seine Schwester, hatte es nicht im entferntesten geahnt. Jetzt, wo er tot war, wusste sie es. (Umgekehrt wäre es sicher nicht anders gewesen).
“Für immer ist er nun weg – und lässt mich allein!”
“Du bist nicht allein, Tante Doro, ich bin auch noch da und habe dich lieb!”
“Ist das wahr? Wirst du mich manchmal besuchen, Luiserl?
So wurden die beiden, der schüchterne Neffe und seine Tante, auf dem kurzen Stück Heimweg vom Friedhof zu ihrer Pension, Freunde.
Und wenn der Onkel Ferdinand dem Luiserl viele Jahre lang als väterlicher Ersatz gedient hatte, so erfuhr die Vollwaise jetzt von der Tante mehr als einen Hauch mütterlicher Zuneigung. Sie war, verglichen mit ihrer gewohnten Kühle und Distanz, von unerwartet liebevoller Wärme. Sogar fast so, als habe die immer unverheiratet gebliebene Tante in ihm einen Sohn, oder jedenfalls ein liebenswertes männliches Mitglied in der seither von ihrem Bruder so frauenfeindlich dominierten Familie gefunden. Und was wurde als Gegenleistung erwartet? Eigentlich fast nichts. Nur dass er sie ab und zu besuchte und sich ehrlich für ihre Lebensumstände und, woran ihr am meisten lag, für ihre Leidenschaften – die neueste Literatur, die neueste Kunst – interessierte.
Von keinem weiblichen Mund je geküsst, besaß das Luiserl nur eine einzige Freundin, die benachbart, in der gleichen seelenlosen Straße wohnte wie er – das zwölfjährige Evchen.
Der Onkel hatte ihn – als es ihm an der Zeit schien – wissen lassen, dass seine Abneigung unverhohlen den Frauen galt, seine Vorliebe den Männern. “Hüte dich vor den Frauen!” war sein Leitspruch, den er dem Luiserl ohne weitere Erklärung einprägte. Das Luiserl fand Frauen attraktiv und das gleiche widerfuhr ihm von ihrer Seite. Doch das Luiserl war gewohnt, dem Onkel blind zu vertrauen. Sein Lehrmeister hatte ihm nur äußerst wenige Lebensregeln gepredigt. An die aber hielt er sich. So, wie er auch die seltsame Namensänderung des Onkels hinnahm, der eines Tages aus ihm, dem Luis, einfach ein Luiserl machte.
Seine Schwester hatte ihm, Ferdinand, kurz vor ihrem schweren Unfall lächelnd erklärt, sie habe sich eigentlich immer ein kleines Luiserl statt eines kleinen Luis gewünscht.
“Aber beim nächsten Mal klappt es bestimmt.”
Es würde ja nun kein zweites Mal geben, die liebe Theodora und ihr Ehemann waren beide tot.
“Machen wir ihr doch – zum Himmel hinauf – die Freude!” sagte der Onkel Ferdinand. “Natürlich nur für eine gewisse Zeit.”
So wurde über Nacht aus dem vierjährigen Luis ein Luiserl. Welch eine spinnöse Idee! sie blieb an dem bedauernswerten Luis hängen, er wurde sie nie mehr los, er war und er blieb das Luiserl. Der Onkel Ferdi gewöhnte sich so sehr daran, dass er sich nicht mehr davon trennen mochte. So war er eben, der Romanschreiber, der selber gern in der Welt seiner Romane gelebt hätte – immer ein kleines bisschen neben der Wirklichkeit.
Was Frauen betraf: das Evchen war für das Luiserl eine Ausnahme.
Er mochte das Evchen.
Und er hielt das Evchen – einfach so – für eine verirrte Seele, genau wie inzwischen sich selbst. “Gleich zu gleich gesellt sich gern”, zitierte er sein Verhältnis zu ihr. Außerdem meinte er befürchten zu müssen, mit dem Evchen nehme es einmal ein böses Ende, auf jeden Fall eher als mit ihm. Man müsse jedenfalls gut auf sie achtgeben.
“Aber bis dahin hat es noch Zeit”. Was ihn selber betraf, er wäre dem Schicksal, anders als das Evchen, für ein dramatisches Ende einfach nicht wichtig genug. Er würde irgendwie “so” davonkommen und eines Tages still und ohne Aufhebens seinen Weg ins Jenseits nehmen.
Des außerordentlich produktiven Onkels Nachlass – an dem der Neffe auf seine Weise nicht unbeteiligt gewesen war – seine Romane, die sich nach seinem Ableben weiterhin prächtig verkauften, ermöglichten dem Neffen ein auskömmliches, aber auch ein durch sein einsames Nichtstun völlig unbefriedigendes Dasein. Wenigstens hatte er in den vielen freien Stunden schon mehrmals versucht, ins Innerste seines Wesens, gewissermaßen in seine Kern-Substanz einzudringen.
Das Ich! Sobald er herausgefunden hätte, woraus es bestand, wollte er es für immer auf sich beruhen lassen. Fast schon routiniert legte er sich eine immer wieder veränderte Auswahl eindringlicher Fragen zurecht. Etwa, wie er es mit den bürgerlichen Tugenden hielt. Gewissenhaftigkeit? Wahrheitsliebe? Fleiß? Großzügigkeit? Humanität? Fragen, die ein einigermaßen skrupulöser Mensch sich kaum uneingeschränkt positiv beantworten konnte. Was ihm das Allerwichtigste war auf dieser Welt, fragte er sich schon gar nicht. Und ließ es dann auch wieder gut sein mit seinem Forschen.
Eines allerdings hatte das Luiserl bei seinen erfolglos zelebrierten Selbst-Wahrnehmungen inzwischen herausgefunden. In diesem Punkt stand sein Urteil ein für allemal fest:
“Ich bin ein Versager! Eine Schmetterlingslarve, der keine Metamorphose gelingt, die nie aus dem Raupen-Dasein herausfindet. Mir wachsen keine Flügel. Ich werde nie fliegen von Blüte zu Blüte. Ich krieche nur immer so vor mich hin.”
Dem Evchen offenbarte er sich:
“Weißt du, manche Menschen sind praktisch unsichtbar, die sind einfach nur Luft, wenn man ihnen auf der Straße begegnet. Ich zum Beispiel! Vielleicht liegt das aber auch daran, dass ich das Luiserl bin? Jawohl, Evchen! Ich will in Zukunft kein Luiserl mehr sein. Sondern, wie ich getauft bin, ein Luis!”
“Aber Luiserl!” Das Evchen war hell entsetzt. “Du bist doch was Besondres! Ich war immer stolz auf dich. Und jetzt willst du auf einmal bloß noch ein ganz gewöhnlicher Mann sein? Nein! Bitte nicht! Ich will, dass du das Luiserl bleibst! Ein Luiserl wie dich gibt’s auf der ganzen Welt nur ein einziges Mal!”
Das Evchen regte sich so auf, dass ihm die Tränen kamen.
“Und überhaupt – wenn du kein Luiserl mehr bist, dann will ich nichts mehr mit dir zu tun haben, dann besuche ich dich auch nicht mehr!”
Das Luiserl war tief gerührt.
“Wenn dir so viel daran liegt, Evchen, dann will ich dir zuliebe in Gottes Namen das Luiserl bleiben.”
In aller Unschuld sagte das Evchen zum Abschied:
“Grad weil du kein richtiger Mann bist, hab ich dich ja so lieb! Weißt du, die meisten richtigen Männer sind einfach saugrob. Wie der Papa. Der schubst die Mama, schreit rum und schmeißt Sachen.”
“Und was machst dann du?”
“Ich lauf weg. Aber richtig schlimm ist es mit dem Papa erst, seit er arbeitslos ist, sagt die Mama. Jetzt hockt er nur noch vorm Fernseher und trinkt Bier.”
“Siehst du, Evchen, ihm fehlt einfach die Arbeit – und mir fehlt sie auch.
Aber was kann ich, was hab’ ich gelernt? Nichts, gar nichts. Ja, dem Onkel hab’ ich die Buchführung gemacht, Manuskripte abgetippt, Rechtschreibund Kommafehler korrigiert und ein bisschen geraten, wenn’s bei einem Roman mit dem Schreiben mal nicht weiterging. Wir beide, der Onkel und ich, haben da manchmal ganz schön rumgeknobelt, bis uns was einfiel. Der Onkel hat mich auch immer gelobt, wenn ich ihm einen Vorschlag machte. “Brav, Luiserl”, hat er dann gesagt. “Ausgezeichnet!”
Das Evchen machte große Augen: “Dann hast du also deinem Onkel, dem berühmten Dichter, sogar manchmal beim Dichten geholfen?”
“Na ja, erstens war der Onkel Ferdi kein Dichter wie der Goethe oder der Grass. Das ist mir doch allzu hoch gegriffen. Und zweitens: ich habe ihm auch nicht beim Dichten geholfen, nicht wirklich, nur dann, wenn er sagte: “Luiserl, jetzt hab’ ich den Faden verloren und weiß nicht mehr weiter. Schau mal, ob du ihn wiederfindest, ich trink derweil eine Tasse Tee.” Dann habe ich so lange drin rumgelesen, bis ich für den Anschluss das Ende vom Faden wiedergefunden hatte und wusste, so muss es jetzt weitergehen. Das Stichwort, verstehst du! Ich kannte ja übrigens immer im Voraus den Schluss. Den durfte man nie aus den Augen verlieren. Insgeheim musste man stets darauf zusteuern, raffiniert, über viele Irr- und Umwege und mehrere Katastrophen hinweg, damit die Spannung gute vier-, fünfhundert Seiten durchhielt. Und mit meinem Vorschlag war es dann ja auch gut. Aber gedichtet hab’ ich im Leben nie irgendwas.”
‘‘Du, wenn man mit dem Schreiben so viel Geld verdienen kann, Luiserl – und man muss nicht mal ein richtiger Dichter sein wie dein Onkel – ja. Luiserl, dann überleg’ ich, ob ich’s mit dem Bücherschreiben später auch einmal probiere. Was meinst du?”
“Gott behüte, Evchen! Heutzutage wird ja geschrieben, geschrieben, geschrieben. Der Computer macht das anscheinend so einfach. So viel Autoren wie derzeit gab’s noch niemals zuvor. Bei einer solchen Konkurrenz – da verhungerst du schlicht! Lass bloß die Finger davon!”
Inzwischen verging die Zeit. Auch das Evchen wurde immer wieder ein Jahr älter und kam seltener das Luiserl besuchen. Er machte ihr keinen Vorwurf daraus. Sie steckte schon mitten in der Pubertät. Warf ihre Blicke während der großen Pause im Schulhof auf diesen und jenen Jungen und wollte so bald wie möglich – eine derart altmodische Institution keineswegs verachtend – einen Tanzstundenkurs absolvieren. Wer aber sollte das bezahlen? Fast mit Erleichterung sprang das Luiserl dafür ein: endlich konnte er mit seinem Geld etwas bewirken – obgleich er gerade den Tanzkurs für möglicherweise sittlich gefährdend hielt, der das Evchen ins Verderben führte? Am Ende des Kurses wäre sie vielleicht sogar schwanger? Dem Evchen traute er ja sowieso schon von jeher alles Mögliche zu. Was das Evchen betraf, schreckte das Luiserl in seinen besorgten Visionen vor nichts zurück. Aber trotzdem verschaffte auch ihm die Tanzkurs-Idee, bei allen Befürchtungen, einen herzhaften Auftrieb.
“Wie lang bin ich eigentlich nicht mehr bei unsrem “Ersten Dienstag im Monat” gewesen? Eine Ewigkeit! Schäme dich, Luiserl, dass du deine Freunde so lange im Stich ließest!”
Als besagter “Erster Dienstag im Monat” wieder einmal herankam – diesmal hatte das Luiserl ihn kaum erwarten können! – suchte er sich schon lange vorher sein schönstes Abendkleid heraus, probierte die Langhaarperücke, ob sie noch richtig saß, machte sich sogar schon am Vorabend ein wenig zurecht. Für all das wurde zu Zeiten des Onkels, unter seiner strengen Aufsicht, viel Geld ausgegeben. Der Neffe war damals unter des Onkels Regie mit allem Pomp “in die Gesellschaft” seiner Gesinnungsgenossen eingeführt worden.
Kritisch prüfte das Luiserl sein Aussehen. Konnte er sich, in seinem Alter – fünfunddreißig! – überhaupt noch sehen lassen?
Was er dann abends im deckenhohen Spiegel erblickte, war eine wunderschöne Frau, eine Diva, fertig zum Ausgang! Schmales Gesicht, kunstvoll geschminkte Wangen, von Echthaar umrahmt – und die Figur! Entzücken durchrieselte ihn. Umwerfend sah er aus! Sein Kostüm stammte sowieso aus dem teuersten Atelier der Stadt, darunter kamen ein Paar hochhackige Pumps zum Vorschein.
Und so ereignete sich, wie schon an früheren Dienstagen, ein Wunder! Noch vor wenigen Stunden unvorstellbar: aus einem trübseligen Nichts, aus einer Null war das Luiserl zu einer Prinzessin, einer Königin, nein, zu einer Göttin geworden.
Ein Jubel ohnegleichen durchströmte ihn: er war kein Niemand, nicht mehr bloß Luft! Er war eine wunderschöne Frau! Nicht etwa nur durch die kostbare Robe! Nein, er/sie hatte sich verwandelt, ihre Haltung, wie sie den Kopf hielt, wie sie schaute, den Kopf zurücklegte und mit einem einzigen Blick die ganze Welt distanzierte, die sich vor ihr verneigte, die vor diesem strahlenden, von sich selber entzückten Ich einfach niederkniete.
Man traf sich nicht etwa in einer Spelunke, sondern im Separée eines erstklassigen Hotels mit einer eigens engagierten, speziellen Band, von der laut Absprache nichts anderes erwartet wurde als ein Abend voll Blues, Blues, nachtblauem Blues, zu dem sich die Herren Damen eng umschlungen in seliger Vergessenheit wiegen, träumen, für ein paar wundervolle Stunden verlieren und die Verachtung vergessen konnten, die ihnen ansonsten im Alltag widerfuhr. Die zwölf, fünfzehn Beteiligten, die sich da, wie immer seit Jahren, getroffen hatten, waren allesamt bluesverrückt: nicht mehr jugendliche, schon eher etwas fettgewordene Männer in kostspieligen, farbfrohen, wallenden, spitzenbesetzten, seidenen, bodenlangen Gewändern, die auch mit Schminke im Gesicht und viel falschem Schmuck um den Hals ihr Alter nicht mehr unsichtbar machen konnten. Und die gerade deshalb von ihrer Umwelt weit weniger toleriert wurden als “normale” Schwule, welche die Gesellschaft inzwischen so gut wie hinnahm. Sie jedoch – Tunten! – sie waren wenigstens an diesem besonderen Abend einfach glücklich. Sie wussten ja, das hielt nicht an, das ging vorbei.
Ihr Jüngster, das Luiserl, wurde mit Jubel begrüßt, umarmt, gestreichelt, geküsst.
Und dann kam ER / SIE.
Trat ein und war da:
Eine Erscheinung!
Jung, blühend, die Jugend selbst.
Gertenschlank, im weißen Brautkleid.
Mit weißem Brautkranz über blondlockigem Haar.
Eine schwarze Braut!
Den Anwesenden stockte der Atem. So etwas hatten sie noch nie gesehen, das hatte es unter ihresgleichen noch niemals gegeben. Spontan, einmütig, ohne Absprache, waren sie dagegen. Gegen ein solches Ausmaß von Schönheit, gegen diesen Triumph von Jugend, von Körper, von Eleganz. Und gegen diesen ungeheuerlichen Widerspruch, diese Provokation von Schwarz gegen Weiß. Trotzdem hielten sie sich erst einmal vor diesem strahlenden Monstrum, das da ihre Bühne betreten hatte, hilflos zurück.
“Guten Abend!” lächelte die Braut, knickste und drehte sich einmal um sich selbst.
“Noch einmal, Guten Abend allerseits!” Sie machte wiederum einen tiefen Knicks, kreiste und kreiste. Das hochzeitlich aufgebauschte Gewand umwehte ihre Gestalt wie eine silbrige Wolke. Sie konnte sich nicht genug damit tun: sie schwebte in dieser Wolke – und beinah flog sie mit ihr davon.
Niemand hatte ihn/sie hergebeten, niemand wollte sie/ihn dahaben. Der Ekel, die Wut, der Hass schüttelte sie: Ein Neger! Nur das Luiserl schaute verzückt. Einer nach dem anderen jedoch ermannte sich – verwandelte sich zurück, wurde von der Tunte wieder zum Mann. Der Hau-Drauf- und Beißtrieb brach durch: wie wilde Tiere fielen sie über die Braut her. Das Luiserl kämpfte sich zu ihr durch, packte sie, riss sie an sich, durchbrach das wilde Rudel und schleppte sie in seinen Armen hinaus, vor die Tür – und weiter durch die weite Eingangshalle des Hotels bis draußen, wo sie in Sicherheit waren.
Eine Schlange von Taxis und die kühle Nachtluft erwartete sie: zwei Elendsgestalten, eine so zerrauft wie die andere.
“Ich wohne ja hier!” sagte die Braut verzweifelt. “Vielleicht wirft man mich jetzt raus?”
“Egal!” sagte das Luiserl. “Lass uns einsteigen – nur weg!”
Der Fahrer ihres Taxis verzog keine Miene, als das Luiserl die Türe zum Rücksitz öffnete, der schwarzweißen Braut hineinhalf – inzwischen mit blankschwarzer Glatze statt blonder Perücke – und dann vorne neben ihm Platz nahm. Auch die bescheidene Giesinger Adresse ließ den Fahrer nicht die Fassung verlieren, nicht einmal die Tatsache, dass das Luiserl beim Kampfgewühl seine Handtasche samt Geldbeutel eingebüßt hatte, (während er Haus- und Wohnungsschlüssel gottseidank verborgen um den Hals trug). Zuhause angekommen, ließ er die zerhaute Braut im Auto zurück und besorgte sich in seiner Wohnung einen ziemlich großen Geldschein, den er dem überaus diskreten Taxler in die Hand drückte:
“Vielen Dank und alles Gute!”
In der Wohnung angekommen, konnten sich beide ihre Hüllen nicht schnell genug vom Leib reißen..
“Bimbo “, sagte das Luiserl, als sie halbnackt nebeneinander standen.
“Bimbo, ich bin das Luiserl – und wer bist du?”
Anderntags, als das Luiserl sich längst seiner kostbaren Echthaarperücke, seiner eigens für ihn angefertigten Ball-Garderobe, sowie der filmreifen Ge-sichtsbemalung entledigt hatte, wurde er wieder zu dem, was er von jeher war: ein ganz normaler, in keiner Weise irgendwie auffallender Mensch.
Aber eben ein Mensch: denkend, fühlend, mit Herz. So, wie er auf das Evchen schon immer ein wach- und achtsames Auge gehalten hatte, so wandte er sich jetzt dem Bimbo zu, der seinem Leben (vielleicht?) das geben würde, was er so sehr vermisste: einen Inhalt, einen Sinn.
Denn, ohne dass er über das geringste Fachwissen verfügte – er hatte ja nie etwas gelernt! – ahnte, ja, begriff er: es war ihm da ein hochartifizielles Geschöpf begegnet – eine zwischen euphorischen Hochgefühlen und tiefsten neurotischen Ängsten hin- und hergejagte, armselige Kreatur. Aber warum, weshalb ihr das widerfuhr, das zu enträtseln reichte Luiserls analytisches Ahnungsvermögen nun doch nicht aus.
“Das Größeste aber ist die Liebe”, hieß es in seiner alten Lutherbibel. “Jawohl, das gilt auch für mich!”, sagte das Luiserl. Aber vielleicht meinte das Buch der Bücher etwas anderes mit der Liebe als er? Schon beim allerersten Anblick hatte er sich in die schwarzweiße Braut verliebt. Fühlte der Bimbo das gleiche für ihn? Armes Luiserl – er würde leiden.
Es schien übrigens, Bimbo, der Afrikaner, war dem Luiserl an Bildung weit überlegen – woher er sie auch haben mochte. Er zitierte Gedichte, die dem Luiserl total fremd waren, er zitierte Celan. Von diesem Halbgott der Poesie hatte das Luiserl noch nie gehört.
Einen Schmetterling wie Bimbo kann man nicht im Wohnzimmer halten. Der flattert hin und flattert her, sucht die Freiheit – und wird nur kurz einmal das Fenster geöffnet, husch, ist er draußen! Am Morgen des dritten Tages war der Bimbo weg, spurlos verschwunden. Nein, nicht ohne Spur! Das Hochzeitskleid ließ er da.
Das Luiserl trug es in sein bewährtes Schneideratelier, wo es sowohl an seinem Etikett, seinem Entwurf, seinem Material wie an seiner allerfeinsten Handarbeit als sublimes Meisterwerk aus einem der berühmtesten Pariser Modeateliers identifiziert wurde. Man konnte sich an Bewunderung für dies Höchstmaß an Schneiderkunst nicht genugtun und bot ihm tausend Euro für seine Überlassung. Lächerlich! Als ob das Luiserl jemals die ihm so kostbare, einzigartige Hinterlassenschaft Bimbos verkaufen würde! Für kein Geld der Welt!
Der Schaden, den dies Gewand aus reinster, kostbarster Seide bei der Schlacht im Hotel erlitten hatte, wurde alsbald hingebungsvoll beseitigt. Anschließend besorgte sich das Luiserl mit großer Mühe eine lebensgroße farbige Schaufenster-Puppe und brachte die Braut in Onkel Ferdis pompös dekoriertem, ehemaligem Salon unter. Mit den Jahren hatte der Onkel diesen Salon immer theatralischer ausstaffiert und darin friedlich so manche geruhsame Stunde verbracht, ungestört von seinem Neffen, den des Onkels geschmackliche Todsünden nicht im geringsten zu irritieren vermochten. Der Onkel hatte ganz bewusst sein Ambiente als wohnliche Entsprechung zu dem von ihm selbst erschaffenen, absolut zeitfernen, literarischen Universum inszeniert.
Unter der Auflage, sie müsse für immer so bleiben wie zu des Onkels Lebzeiten, und nichts, auch nicht das Allergeringste, dürfe darin verändert werde, hatte das Luiserl die Wohnung geerbt. Im Grunde war da schon die Aufstellung dieser gesichtslos abstrakten, modernen, schwarzen Schaufenster-Figur ein Sakrileg.
Dem Luiserl würde die Braut von jetzt an Tage, Wochen, Monate – vielleicht sogar für immer? – Trost spenden müssen: diese bezaubernde Braut, die ihm den Bimbo so vertrat, als säße er leibhaftig vor dem Luiserl, nicht weiß und weiblich, sondern farbig und männlich wie er. Manchmal hielt es das Luiserl dann nicht mehr im Anblick des/der Schönen, er sprang auf, umarmte, küsste ihn/sie auf den imaginären Mund, sagte ihm/ihr Zärtlichkeiten, Koseworte in ein nicht vorhandenes Ohr.
Jeden Tag erwachte Bimbo aufs Neue für das Luiserl zum Leben – und jeden Tag wurden sie ein wenig vertrauter miteinander, obwohl er noch nicht einmal Bimbos richtigen Namen kannte. Manchmal, wenn er die Braut umarmte, rührte sich etwas in ihm, was sich kaum jemals zuvor gerührt hatte – und er merkte beseligt: ja, er, der Bräutigam, wäre mit allen Sinnen bereit für eine weitere, wundervolle, einmalige, romantische Hochzeitsnacht. Nur: würde es diese Nacht noch ein zweites Mal geben? Es sah nicht danach aus. Kein Zeichen von Bimbo – nichts!
Da ging ihm denn eines Tages das Herz, der Mund über – er erzählte dem Evchen, was an jenem Ersten Dienstag im Monat passiert war – nur nicht mit all seinen Folgen. Das Evchen war sprachlos. Einerseits. Andererseits sagte es, zögernd zwar, aber tapfer:
“Wir haben dich beobachtet, auf dem Balkon, mit deinem Bimbo. Weißt du, was Mama und Papa gesagt haben? Sie hätten’s schon immer gewusst, dass du eine Tunte bist, weil man das ja schon an deinem Namen merkt. Ja, wenn du bloß schwul wärst – aber gleich eine Tunte. Das ist ja wie ein normaler Homo hoch zwei! Hab ich im Biologieunterricht gelernt. Schämst du dich jetzt?”
“Evchen, wie alt bist du inzwischen?”
“Bald sechzehn.”
“Sowas lernt man also heutzutag in der Schule? Na ja ... Aber schämen tu ich mich nur, wenn du mich verachtest. Alle anderen Menschen sind mir egal, der Rest der Welt ist mir wurscht!”
“Luiserl, ich kann dich natürlich jetzt nicht mehr heiraten, das hatte ich nämlich vor. Aber das geht ja nicht mehr. Du kannst natürlich nichts dafür, dass du so bist, wie du bist. Dich verachten – nie! Du bleibst immer, immer, immer mein allerbester Freund!”
“Versprichst du mir das?”
“Versprochen!”
Darauf öffnete er dem Evchen sein Heiligtum, Onkel Ferdis Salon.
“Ach, Evchen”. sagte er, jedes Mal wieder hingerissen vom Anblick der Braut, “das hatte der Bimbo damals an – und sah darin aus wie ein Engel. Ein schwarzer Engel. Ich fürchte nur, ich werde ihn niemals wiedersehen. Wo ich ihn auch suche, ich werde ihn niemals finden.”
“Aber Luiserl, das ist doch ganz einfach! Du bräuchtest ihn nur im Internet um Antwort bitten – irgendjemand kennt ihn oder er antwortet dir selbst.”
“Was schreibt man denn da?”
“Na: Bimbo, wo bist du? Verzweifelt sucht dich das Luiserl, melde dich bitte!
Im Nu hättest du ein paar Follower, die sofort mitmachen, weil es so spannend ist. Schon über Nacht vermehren sie sich, gehen in die Dutzend, dann in die Hundert – du wärst ihnen sympathisch, sie würden Sprüche auf Bimbo dichten, sich vielleicht auch lustig über dich machen. Das ist halt so, Luiserl, solche Leute gibt’s immer. Bald würde das halbe Netz nach deinem Bimbo suchen, es könnte zum Volkssport werden. Da wäre es doch ein Wunder, wenn du deinen Bimbo nicht fändest!”
Das Luiserl bekam es mit der Angst. Wo führte das hin?
“Das ist ja ein Phänomen, Evchen! Ein ganz furchtbares, entsetzliches, grauenhaftes Phänomen! Nein, das will ich nicht, auf gar keinen Fall will ich sowas!”
Argwöhnisch hatte die Doro es jahrelang vermutet, nur nicht beweisen können – aber, nicht wahr? wenn ihr Bruder kein weibliches Wesen je in sein Haus einlud, niemals mit einer Dame ausging, in seinem Schlafzimmer kein Porträt einer schönen Frau, einer heimlich Geliebten verbarg – dann lag der Verdacht doch nahe: der Ferdi sei homophil? Letzlich gab es gar keinen anderen Schluss. Eine Katastrophe!
Einmal fasste sie sich ein Herz: “Ferdi, hast du denn keine Freundin? Willst du keine Familie? Kinder?” Er antwortete nur: “Mir reicht schon das Luiserl!”
Genau! Warum hieß zum Beispiel das Luiserl Luiserl und nicht etwa Luis, wie er getauft war? Das war doch verrückt! Und in welche Richtung ging das überhaupt?
Hartnäckig versuchte die Doro, dem Ferdi auf die Schliche zu kommen. Immer wieder legte sie den Finger in die heimliche Wunde, bis der Ferdi eines Tages seelenruhig antwortete: “Hör’ auf mit der Fragerei! Du weißt es ja eh’ ! Also gib eine Ruh’ !”
Mit Schweigen überging die Doro fortan das heikle Thema.
Denn wenn sie die familiären Bande zu diesem einzigen Bruder, zu diesem einzigen Neffen bewahren wollte, anstatt sich ihrer philiströsen Entrüstung hinzugeben, dann blieb ihr keine Wahl, dann musste sie ihre Abscheu bekämpfen, Frieden schließen – und das wollte sie auch: die Bande festhalten, bewahren, um jeden Preis!
Natürlich ließ das Desaster ihr auch weiterhin keine Ruhe. Immerzu musste sie darüber nachdenken. Nachforschungen anstellen. Und erfuhr: so weitverbreitet war diese Veranlagung zum Homo, dass man sie beinahe schon als normal ansehen konnte. Und sie war nicht nur unter Menschen verbreitet, auch Viecher machten von dieser Art Sex Gebrauch. Die Natur kennt keine Moral! Ein Mensch jedoch wie die Doro, konnte die leben ohne Moral?
Sie wollte dem Ferdi halt doch dahinter kommen, wie, wann und wo lebte er seine sündhafte Lust aus? Und so erforschte sie weiterhin diskret: wie war der augenblickliche Stand seines vielleicht doch vorhandenen Liebeslebens? Auf welchen Abseitspfaden irrte der Ferdi umher? Erlitt er gerade eine schmerzhafte Trennung? Gab’s eine Wiedervereinigung? Eine neue Liebe? Oder wurde er verlassen, gekränkt, verstoßen? Aber nie bot Ferdi der Phantasie seiner Schwester zufriedenstellenden Stoff. Rauszufinden, ob und wie weit er sich insgeheim schadlos hielt, gelang der Doro bei all ihrem weiblichen Spürsinn nicht. So ließ sie ihn in ihrer Phantasie lebenslang der angeblichen Katastrophe einer verlorenen Liebe nachtrauern. Und daraus ergab sich eine Folgerung, die ihr als Ausrede für alle Zukunft Genüge tat: Wäre womöglich genau dieser männliche, dieser womöglich auch nur fiktive Irrweg, auf dem er sich sowieso nie ertappen ließ, die Quelle seiner Inspiration?
Dann machte das seine eventuelle Homosexualität ja gradezu akzeptabel!
Das Geschlecht – es war eben nicht nur Sex, es war viel viel mehr!
Sie selbst hatte lange Jahre Wohnung und Leben mit ihrer inzwischen verstorbenen Besten Freundin geteilt. Ihr brauchte man von diesem Mit-, Aus- und Gegeneinander einer solchen Liaison nichts erzählen, sie hatte alle Nuancen erlebt, erlitten und begrub ihre Erinnerungen an den ewigen Streit um ihre unüberwindbare Frigidität mit Schweigen.
Immer hatte sie sich gegen Sex gesträubt. Warum aber musste gerade sie, die doch nie etwas damit zu tun haben wollte, ständig daran denken? Warum war das Problem Sex immer für sie präsent? Und zugleich ihr Leben, mit diesem ewigen Hin und Her ihrer Beziehung, so fad, so unendlich leer? Verglichen mit Ferdis Leben, der den Sex, wenn er ihn schon nicht de facto auslebte, dann mit seiner Schreiberei sozusagen auf dem Papier ausschwitzte?
Sex! Abstoßend? Schmutzig? Verachtet und doch von der ganzen Menschheit leidenschaftlich begehrt? Für die Doro ein immerwährendes, unbegreifliches Faszinosum.
Sie war noch mit vierzig Jungfrau. Hatte immer nur mit dem Kopf gelebt, sich kastriert und nur ein einziges Mal hingegeben. Im Fernzug nach Paris hatte ihr eine Frau gegenüber gesessen, sie unentwegt angeblickt mit kohlschwarzen, brennenden Augen. Irgendwann, kurz vor Paris, stand sie plötzlich auf, ergriff Doros Hände, zog sie hoch: ”Viens!”
Als kurz darauf der Zug in Paris einfuhr, verließen sie die Toilette, rannten ins Abteil, rissen ihr Gepäck an sich – der Zug hielt. Der Bahnsteig war überfüllt mit Aussteigenden, sie drängten sich durch – noch in der Halle hielten sie sich bei der Hand. Und dann war die Fremde plötzlich verschwunden. Die Doro suchte und suchte. Zuletzt begriff sie, die Fremde wollte gar nicht gefunden werden.
Beim ersten Besuch, den ihr das Luiserl abstattete, tastete die Doro seine Seele ab. Im Nu kannte sie seine ganze, traurige Bimbo-Geschichte. Also auch das Luiserl ein Homo! Wie schade! Inzwischen wusste sie aber: Homo bleibt Homo – daran könnte auch sie nichts ändern. So fügte sie sich. Aber ihre weibliche Intuition – ihr halb mütterlicher, halb anderweitiger Hilfstrieb – gab ihr, trotz kaum wahrgenommener Eifersucht, ein Hilfsmittel ein.
“Schreib’ es auf, Luiserl, schreib’s auf!”
Und, als er sie verständnislos anstarrte: “Warum? Wozu?”
“Schau nicht so! Wozu hast du jahrzehntelang mit einem ausgefuchsten Schriftsteller zusammengelebt, für ihn, mit ihm gearbeitet, seine Tricks kennengelernt, nicht nur seine Grammatikfehler verbessert, sondern manchmal auch seine Ideen. Du weißt doch inzwischen genau, wie so ein Geschäft läuft, worauf es bei einem Roman ankommt. Hast genug mit den Lektoren rumgestritten, wenn ihnen mal wieder was nicht gepasst hat. Und da kannst du wirklich nicht auch selber schreiben? – Das Handwerk, Junge, das bisschen Erzählen, das kannst du doch längst! Versuch’s wenigstens. Für deinen Liebeskummer jedenfalls gibt es keine bessere Medizin!”
Als die Tante merkte, das Luiserl war nach einigem Nachdenken tatsächlich bereit, es mit dem Schreiben zu versuchen, beschloss sie, sich der Sache anzunehmen, sie richtig in Schwung zu bringen. Sie hatte unendlich viele Bücher gelesen, gute Bücher, Literatur! Davon verstand sie etwas – mit ihrem Zutun könnte vielleicht mehr als eine Liebesgeschichte à la Onkel Ferdinand entstehen, nämlich ein kleines, feines Stück Literatur nach Tante Doros Geschmack?
Sie begab sich also zum Luiserl.
“Wie wär’s? Wir beide fliegen oder fahren mit dem TGV nach Paris, um uns dort eine Woche lang einen Schauplatz zusammenzubasteln? Paris, das mögen die Menschen, das werden sie mit Begeisterung lesen. Und ich wüsste schon, wo überall ich dich herumschicken würde. Dann müsstest du dir nämlich keinen Schauplatz mehr aus den Fingern saugen. Paris, das wäre das non plus ultra für deine Geschichte. Denn woher stammt schließlich die Hochzeitstoilette deiner Braut? Aus Paris!
Ich, mein Lieber, als gelernte Schneiderin – Schneidermeisterin! – habe mich in Paris natürlich immer besonders für Mode interessiert, habe versucht, in Modeschauen reinzukommen, mir einen Einblick in die allerhöchste Schneiderkunst eines berühmten Ateliers zu verschaffen. Wo solche Meisterwerke wie dein Brautkleid entstehen. In vielen Wochen mühsamer Handarbeit. Die niemals auch nur den einzigen Nadelstich einer Nähmaschine erdulden. Ich habe Kontakte, vielleicht kann ich dich irgendwo reinmogeln? Woher sonst sollte dein Bimbo dieses wundervolle Kleid haben?