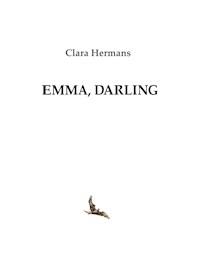Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wer glaubt, dass er ein Monster sei - schämt und verachtet der sich? Hasst er Gott und die Welt? Oder bettelt er nur um Mitleid? Liebe unbekannte Cousine Kathi, vielleicht hast Du schon einmal von mir gehört? Seit ich denken kann, werde ich, schwer behindert, in diesem Heim als Vollwaise verwahrt. Nun teilte man mir mit, dass ich - inzwischen achtzehn, erwachsen geworden - nicht länger hier bleiben kann. Aber wo sonst? Ich habe ja keine Familie, die mich aufnehmen könnte. Einen Krüppel, ein Monster wie mich. Ich bin ziemlich verzweifelt. Weißt Du mir einen Rat? In der Hoffnung, von dir zu hören, grüße ich dich! Dein Cousin Arne. Nein, er fragte nur nach einem Unterschlupf, einem Obdach, einer bescheidenen Bleibe. Er wäre, nach so vielen Jahren in einem städtischen Behindertenheim, mit allem zufrieden. Und vielleicht wüsste sie ihm auch einen Rat für die Zukunft? Ein Foto lag bei, es zeigte, nun ja, das Antlitz des Briefschreibers, mit einem ganz in ein fernes Jenseits versunkenen, kaum wahrnehmbaren Lächeln.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Herzlichen Dank an Raymund, ohne den dieses Buch nicht zustandegekommen wäre.
Klavier – schöön!
Wer glaubt, dass er ein Monster sei – schämt und verachtet der sich?
Hasst er Gott und die Welt?
Oder bettelt er nur um Mitleid?
Liebe unbekannte Cousine Kathi,
vielleicht hast Du schon einmal von mir gehört? Seit ich denken kann, werde ich, schwer behindert, in diesem Heim als Vollwaise verwahrt. Nun teilte man mir mit, dass ich – inzwischen achtzehn, erwachsen geworden – nicht länger hier bleiben kann. Aber wo sonst? Ich habe ja keine Familie, die mich aufnehmen könnte. Einen Krüppel, ein Monster wie mich. Ich bin ziemlich verzweifelt. Weißt Du mir einen Rat?
In der Hoffnung, von dir zu hören, grüße ich dich!
Dein Cousin Arne.
Nein, er fragte nur nach einem Unterschlupf, einem Obdach, einer bescheidenen Bleibe. Er wäre, nach so vielen Jahren in einem städtischen Behindertenheim, mit allem zufrieden. Und vielleicht wüsste sie ihm auch einen Rat für die Zukunft? Ein Foto lag bei, es zeigte, nun ja, das Antlitz des Briefschreibers, mit einem ganz in ein fernes Jenseits versunkenen, kaum wahrnehmbaren Lächeln.
Es war fast ebensowenig erkennbar wie das weithin berühmte Lächeln einer Dame des frühen 16. Jahrhunderts – der Mona Lisa im Louvre. Alle Betrachter verunsicherte ihr Porträt. Auch Kathi. Auf einer Postkarte reproduziert, hing es an ihrer Küchenwand. Jedes Mal, wenn sie einen Blick darauf warf, fragte sie sich:
„Lächelt sie wirklich? Wenn ja, dann kaum mit den Lippen, eher vielleicht mit den Augen. Aber wem lächelt sie zu? Mir? Kerzengerade sitzt sie auf ihrem Armstuhl. Ihre rechte Schulter wendet der Maler leicht von uns ab. Ihre linke dagegen, von einem Lichtstreif gesäumt, schiebt er voluminös nach vorn in unsern Blick. Aus dem dunklen Obergewand treten goldschimmernd die Ärmelfalten hervor.
Ihre Hände legt der Maler übereinander. Eine Barriere?”
Oft schon hatte Kathi versucht, dieser Person – ein gutes halbes Jahrtausend älter als sie – eine geheime Botschaft abzugewinnen. Vergeblich.
La Gioconda – Lisa del Giocondo, Ehefrau eines Florentiner Kaufmanns. Deren Rätsel Leonardo da Vinci uns zeigt – und zugleich vorenthält? Nicht nur ihr Lächeln bleibt sein Geheimnis.”
Genauer wollte Kathi es gar nicht wissen. Ihr Fazit war und blieb immer gleich:
“Sie wendet sich uns nicht zu, sie schenkt uns nur diesen einzigen Blick, schräg aus den Augenwinkeln – ihr angebliches, mysteriöses Lächeln.“
Zuletzt wurde sogar die sanfte Kathi störrisch:
“Sie lächelt doch gar nicht! Nicht richtig. Das redet man uns nur ein! Und am Ende glauben wir’s auch noch?“
Ähnlich ging es ihr jetzt mit der Fotografie ihres unbekannten Cousins.
“Genau so wenig wie das der Mona Lisa kann ich sein Lächeln deuten. Ob er ihr Bild wohl kennt?“
Was für eine Art Vetter war eigentlich dieser Arne? Wievielten Grades?
”Es gibt keine Familie, wir haben keine, wir brauchen keine und wollen auch keine. Basta!”
Sie konnte sich also nicht kundig machen, dafür hatte ihre verstorbene Mutter gesorgt.
Damit war sie aber auch diesem unbekannten Familienmitglied nichts weiter schuldig. Sie stellte sich keine Fragen mehr. Er mochte ja ganz nett sein, Aber was sagt einem so ein Foto? Und was sollte sie ihm antworten?
In Gedanken schrieb sie ein paar Zeilen, stellte sich vor:
“Seit einem halben Jahr arbeite ich, eben erst staatlich geprüft, als Erzieherin in einem Heim für schwerbehinderte Kinder und Jugendliche, betreue fünf, sechs, manchmal auch sieben, acht kleine Monster, wie du sie wohl nennen würdest, im Vorschulalter. Spiele mit ihnen, füttere sie, wechsle ihre Windeln, wische ihnen die Tränen, die Spucke ab, putze ihnen den Po. Ganz Liebe gibt es unter ihnen – aber natürlich auch ihr Gegenteil. Über die könnte ich manchmal verzweifeln, verwünsche sie, würde am liebsten davonlaufen.
Wer weiß, vielleicht bist du von der gleichen Sorte und tust nur so nett?“
Ihren Brief wollte sie sich noch ein paar Tage überlegen. Was erwartete sich denn der angebliche Vetter von ihr? Sie wohnte noch immer in einer Wohngemeinschaft. Wollte er sich da etwa einnisten?
Die Arbeit mit den behinderten Kindern war nicht leicht, sie forderte ihre ganze Kraft, anfangs fast bis zur Erschöpfung. Aus Tagen wurden so Wochen. Dann entfiel er ihr einfach, ihr sogenannter Cousin.
Kathi war ein sanftes Geschöpf mit einem Madonnengesicht und einem fast ebensolchen Herzen.
“Ich mag Kinder. Es gibt auch Menschen, die hassen Kinder, können sie nicht ausstehen. Meine Mutter zum Beispiel! Die hätte mich – ihr einziges Kind! – am liebsten ausgesetzt. So lästig war ich ihr. Eine Fessel! Als ich eines Tages auch noch gefragt habe: “Wo ist denn mein Papa? Alle Kinder haben doch einen Papa! Wo wohnt er? Warum nicht bei uns?“ – da wurde die Mama ganz böse.
“Wozu brauchst du einen Papa? Er bringt nichts als Unglück..” Und dann deklamierte sie, langsam, mit erhobenem Zeigefinger, diesen furchtbaren Spruch:
”Des Vaters Segen baut den Kindern Häuser,
aber der Mutter Fluch reißt sie wieder ein!”
Sie wiederholte ihn, wohl wissend, dass ich ihn gar nicht verstehen konnte. Ich war ja noch so klein.
Zum Schluss warnte sie mich:
”Hüte dich vor deiner Mutter Fluch!“
Kathi hatte nicht zu fragen gewagt, was das sei – ’Fluch’.
“Jetzt aber wünschte ich mir erst recht einen Papa, der Häuser baute für seine Kinder. Auch wenn die böse Mama sie dann wieder einriss! Für wen hätte ich mich damals entschieden? Für den unbekannten Papa natürlich, nach dem ich eine so tiefe Sehnsucht empfand – und nicht für diese Mama, die mir so viel Angst einjagte? Aber ich hatte ja keine Wahl! Heute, wenn sie noch lebte, würde ich von ihr wissen wollen: Warum hast du mich so gehasst? Dass ich auf der Welt bin – daran bist doch du selbst schuld? Was kann ich denn dafür?”
Ohne mütterliche Wärme war Kathi aufgewachsen, es hatte auch kein freundliches Umfeld von Tanten, Onkeln, Vettern und Basen zum Einkuscheln gegeben. Da machte ihr jetzt das Schicksal mit diesem so plötzlich aus dem Nichts aufgetauchten Cousin ein wundersames Angebot: könnten sie beide sich nicht zusammentun – zu einer Familie en miniature?
Aber das fiel Kathi im Traum nicht ein!
Erst einmal musste sie sich aus jener Vereinsamung lösen, die sie seit ihrer Kindheit gefangen hielt. Nicht einmal eine beste Freundin hatte sie haben dürfen. Nicht, dass es ihr gradezu verboten war. Doch jagte Kathis Mutter wortlos, allein mit ihrer finsteren Miene, jedem Kind so viel Angst ein, dass sich bald niemand mehr zu Kathi ins Haus traute.
Wie aber kam sie, inzwischen erwachsen, mit der Erinnerung an diese schwierige Mutter zurecht?
Da war die Geschichte mit dem Kätzchen, das ihnen eines Tages zu Kathis Entzücken zulief.
”Eine Katze? Gibt’s nicht! Hör auf mit dem Getue – sie muss weg!”
Gnadenlos verscheuchte Kathis Mama das kleine Tier, das erst vor kurzem seiner Obhut entlaufen schien. Schon am nächsten Tag miaute es wieder kläglich vor ihrer Haustür. Jetzt packte die Mama das hilflose Wesen in eine große Plastiktüte und machte sich, Kathi an der Hand, auf den nahe gelegenen Weg hinunter zur Isar. Unten angekommen, trat sie ganz nah ans Ufer. Während Kathi weinte: ”Bitte nicht! Bitte nicht!” – schleuderte sie ohne Erbarmen die Tüte mit weitem Schwung in die Fluten.
Die Isar ist keine Sanfte, die Isar ist wild. Sie riss ihre Beute an sich, verschlang sie.
Am Ende ihrer Kindergartenzeit sollte Kathi zum Abschied eine Märchenprinzessin spielen. Welche Fünf-, Sechsjährige wollte das nicht? Wie ging das? Nun, man bekam ein Krönchen aufgesetzt. Aber natürlich machte das Krönchen nicht gleich eine richtige Prinzessin aus ihr. Es hätte keiner mütterlichen Ermahnung bedurft.
”Führ’ dich nur ja nicht wie eine Prinzessin auf! Du bist bloß von irgendwo hergelaufen, merke dir das!” Und die Mama veranlasste, dass der kleinen Kathi unter einem Vorwand die Rolle entzogen wurde und ein anderes Kind sie bekam.
Und doch hütete Kathi auch eine versöhnliche Erinnerung an die Mutter.
In Giesing, unweit von Kathis Wohnung, gab es die öffentlich zugängliche Orthopädie. Auch sie war einmal als kleines Mädchen von der Mutter dorthin gebracht worden, um eine böse Wunde verarzten zu lassen. Zusätzlich wurde die Klinik damals als städtische Unterkunft für jugendliche Behinderte genutzt, eine Heimstatt, die ihren jungen Bewohnern eine für jene Zeit wahrhaft generöse Bewegungsfreiheit gewährte.
Jeden Tag nämlich zu einer bestimmten Zeit tobten die Jugendlichen auf ihren Rollstühlen los, eine fröhliche Bande, die sich lauthals in ihr nicht ungefährliches, wenn auch nur vorübergehendes Unternehmen stürzte. Sie eroberten sich die Welt – oder eigentlich nur die Straße, die vor dem Gelände der Orthopädie mit einem sehr breiten Gehweg verlief: das war ihre Rennbahn. Unter Anfeuern und Jauchzen fand hier der tägliche Wettkampf statt. Jeder konkurrierte mit jedem. Untereinander wurde dabei gerempelt, ausgebremst und hinterrücks festgehalten, dass es nur so schepperte. Aber nie kam es zu einem Unfall. Allesamt waren sie Rollstuhl-Artisten. Überdies wollte keiner dem anderen wirklich Böses.
So wurde eine gewöhnliche Straße für sie zum Inbegriff von Freiheit. Stets ohne begleitende Aufsicht, fuhren sie jeden Tag wieder drauflos. Jeder in Giesing kannte das Schauspiel. Es gehörte einfach zum Viertel. Manche nannten die Orthopädie noch, wie vor keineswegs unvordenklichen Zeiten, ganz selbstverständlich ”das Krüppelheim”. Doch niemand, der den ”Krüppeln” gelegentlich ausweichen musste, fühlte sich von ihnen belästigt. Jeder gönnte den Rollstuhlfahrern ihr Vergnügen, das sie sich täglich, ihren Gebrechen zum Trotz, mit ihren nicht ungefährlichen Wettkämpfen verschafften Als die erwachsene Kathi sich später auf den Erzieherinnen-Beruf vorbereitete, kehrte ihr die Erinnerung an jene tumultuarischen Schauspiele zurück. Welch wunderbare Freiheit hatte man den Behinderten damals gegönnt! Eine Freiheit, die sie später wohl einbüßten, als sie in die Innenstadt oder wohin auch immer verlegt wurden.
Die Straße vorbei an der Orthopädie führte noch ein gutes Stück weiter, von großen Tennisplätzen gesäumt, der Grenze des Viertels entgegen.
Es bedurfte nur eines leichten, hügeligen Anstiegs, eines kleinen geologischen Akzents, um die beiden benachbarten und doch so gegensätzlichen Münchener Viertel – Giesing und Harlaching – voneinander zu trennen. Unmittelbar, urban ging hier das leicht erhöhte, noble Harlaching mit seinen Villen, weiß ummauerten Gärten und hohen Bäumen aus dem tiefer gelegenen, noch fast dörflichen Glasscherbenviertel Giesing hervor. Unzugänglich für Rollstuhlfahrer – oder, wie Arne gesagt hätte, für Monster. Ihnen hatte selbst Kathis hartherzige Mutter damals zugebilligt:
”Für die wird’s später im Leben noch schwer genug. Wenigstens haben sie jetzt ihren Spaß!”
Bis zuletzt besaß ihre Mama in Kathis Augen ein so beherrschendes, außergewöhnliches, fast majestätisches Format, dass sie sich noch lange – auch in ihrem Erwachsenenleben – dieser monströsen Mutterfigur unterwarf.
”Mach’s gut, Kathi!” hatte sie sich kurz vor ihrem Tod von ihrer Tochter verabschiedet.
”Deine Mutter wird dich immer begleiten.”
Für Kathi eine furchterregende Ankündigung!
”Wo sie mir so schon all ihre unseligen Gene hinterließ! Muss ich mich eines Tages sogar vor mir selber fürchten?” Würde irgendwann einmal jenes rätselhaft böse Etwas aus ihrem Ich hervortreten, das ihr von ihrer Mutter eingepflanzt worden sein könnte? Sie musste gut auf sich aufpassen, um diesem unliebsamen Erbe mit aller Kraft entgegen zu wirken, falls es jemals Gewalt über sie bekam,
Was hingegen diesen unbekannten Cousin Arne betraf: noch immer wusste die Kathi nicht, wie ihm zu helfen wäre. Hoffentlich fiele ihr mit der Zeit ein Ratschlag ein, den sie ihm dann in seiner Notlage zukommen ließe. In den Wochen und Monaten nach seinem Brief hatte sie allerdings genug damit zu tun, versöhnlich umzugehen mit der kleinen Schar, die zu hüten ihr aufgegeben war. Darunter befand sich auch der eine oder andere schlimme Geist, der nach Herzenslust pöbelte, mit Schimpfworten um sich warf und mit höchster Lust ein Getümmel veranstaltete, bei dem selbst Kathi kaum ihren Gleichmut bewahren konnte. Die Aufsässigkeiten gewisser Patienten hielt sie dann einfach für das eine oder andre Symptom ihrer Behinderung. Damit wurden sie verzeihbar und mit einem „Aber! Aber!“ oder mit einem leisen ”Pfui, wer sagt denn sowas!” beschwichtigt. Egal – mit der Zeit gewöhnte man sich daran.
Nach einer bewegten Phase des Einlebens kannte Kathi alle Eigenheiten ihrer kleinen “Familie“: die Haupteigenschaften jedes Kindes, seine spezielle Behinderung, sein Herkommen, den familiären Horizont, der sich jeden Spätnachmittag und über das lange Wochenende für ihn auftat. Sie besaß auch längst ein Gespür dafür, wie viel Liebe, Verständnis, Geduld ihm dort zuteil wurde, wie viel Zeit man ihm gönnte – oder auch nicht. So hatte ihr Berufsleben seinen Anfang genommen, voraussichtlich würde es auch so weitergehen zu ihrer Zufriedenheit.
Da heiratete eine Kollegin nach Hamburg hinauf und kündigte. Kathi musste die ihr liebgewordene Gruppe verlassen, sie wurde auf die verwaiste Stelle versetzt. Anstatt mit Vorschulkindern bekam sie es jetzt mit Burschen von zehn, zwölf, vierzehn Jahren zu tun. Das waren andere Kaliber! Wobei einer in dieser neuen Gruppe, der sich anfangs völlig im Hintergrund hielt, ihr bald besondere Sorgen bereitete. Erik, ein blondlockiger, recht ansehnlicher Knabe. Als einziger stimmte Erik gegen einen demnächst geplanten Ausflug. Auf den Boden stampfend, schrie er wütend: “Nein! Nein! Nein!“ Diese drei Neins waren eine Kriegserklärung, und falls Kathi das nicht begriff, würde Erik es ihr schon noch beibringen, keine Sorge!
Inwiefern war dieser Erik überhaupt behindert? Dem Anschein nach gar nicht Vielleicht psychisch? So las es sich wenigstens bei Durchsicht seiner Papiere.
Befindet sich gastweise im Heim. Keine körperliche Behinderung. Neigt jedoch zu krassen Wutausbrüchen, totaler Widersetzlichkeit und fast krankhafter Aggression. Für unser Entgegenkommen revanchiert sich Eriks Mutter mit äußerst großzügigen Spenden. Es ist Vorsicht geboten.
Irgendwie würde Kathi sich mit diesem Erik arrangieren müssen. Er war ein Sonderfall. Das wusste sie jetzt. Sich bei der Heimleitung über ihn zu beklagen, wäre sinnlos. Als “Neue“ würde sie sowieso, wie ihr die Kolleginnen ankündigten, in allernächster Zeit von Eriks Mutter, der sogenannten Donna Elvira, inspiziert werden, die regelmäßig im Heim auftauchte, um, wie sie sagte, ein Auge auf ihren Sohn zu werfen. Man erlaubte es ihr im Hinblick auf ihre finanzielle Großzügigkeit. Auch gab sie sich keineswegs als unangenehme oder arrogante Person, sondern höchstens ein wenig sonderbar, “verrückt“, wie man sich zuflüsterte, sie gleichwohl bemitleidend. Erik lebte nämlich nicht bei ihr, sondern, weil angeblich kein Auskommen mit ihm war, tagsüber im Heim, nachts und übers Wochenende bei Pflegeeltern. Aber auch sie mussten unentwegt beschwichtigt und Jahr für Jahr durch finanzielles Hinzutun neu motiviert werden.
Nach und nach erfuhr Kathi Näheres: Eriks Mutter, ein berühmter Sopran, war in ihren späteren Jahren, nachdem sie letztmals an der New Yorker Met als Mozarts Königin der Nacht triumphiert hatte, endgültig nach Europa zurückgekehrt – einerseits zum dritten Mal geschieden, andererseits als Mutter eines soeben in aller Eile noch schnell adoptierten Sohnes, der, wenn auch schon zweijährig, noch fast in den Windeln lag.
Wie aber war sie zu ihrem Namen gekommen?
Aus der scherzhaften Frage eines Besuchers: ”Wie heißt du denn, kleine Donna?” – hatte sie als kleines Mädchen ”Ich heiße Donna Elvira!” gemacht. Ihr etwas spinöser Vater heftete ihr den selbsterfundenen Doppelnamen als familiäres Attribut an. Sie wurde ihn nie mehr los. Ganz nach Bedarf wandte man ihn mit respektvollem oder respektlosem Unterton an – in der Familie, in ihrem Bekanntenkreis und natürlich erst recht hier im Heim.
Sie ließ nie erkennen, was ihr dies legendäre Anhängsel bedeutete. Fest aber stand, sie war eine Dame.
Vom ersten Augenblick an glaubte Kathi, den Widerstand Eriks zu spüren.
So versuchte sie gar nicht erst, sein Zutrauen zu gewinnen. Schon ein paar freundliche Gesten hatten Eriks Feindseligkeit noch befeuert. Also verhielt sie sich neutral, war aber im Grunde jede Sekunde angespannt, auf eine Attacke gefasst. Das kostete Nerven! Doch was blieb ihr übrig? Sie beobachtete dieses Ungeheuer aus den Augenwinkeln, um nicht überrascht oder gar angefallen zu werden. Ein einziges Mitglied ihrer neuen Gruppe war imstande, sie zu verunsichern. Unbegreiflich!
”Was sieht denn dieser Erik in mir?” fragte sie sich.
”Was reizt ihn zum Widerstand? Besitzt er vielleicht einen besonderen Spürsinn? Ahnt er meine böse Mutter, die in mir steckt? Werden das bald auch die anderen merken? Wird er sie drauf hinweisen? Und was geschieht dann mit mir?”
Der körperlich völlig gesunde Erik hörte nicht auf, sein Spiel mit ihr zu treiben.
Im Verlauf einiger Jahre – seit seinem elften Lebensjahr hier untergebracht – hatte sich der jetzt Vierzehnjährige eine Mischung angeblicher Behinderungen zugelegt, die er abwechselnd zur Schau stellte. Manchmal gab er sich als taubstumm, manchmal imitierte er das Petit Mal, das epileptische Zittern. Und einmal simulierte er, nach dem Vorbild eines vor seinen Augen stattgehabten Grand Mal, einen richtigen epileptischen Anfall – und diesen so täuschend echt, dass Kathi wirklich erschrak. Mit Häme quittierte er hinterher ihre Besorgnis, nachdem der herbeigerufene Arzt Eriks dramatisches Schauspiel mit einem Machtwort beendet hatte. Wenn’s ihm gerade Spaß machte, quälte er die einen, belustigte die andern mit Augenverdrehen. Gelegentlich gab er auch den von allen dauernd herumgeschubsten, aufgrund eines Herzschadens eigentlich schonungsbedürftigen, wehrlosen Down-Syndrom-Willy. Jedoch grotesk überdreht: mit blödem Gesichtsausdruck, zugekniffenen Schlitzaugen, sinnlos lächelnd, zum Mongo entstellt.
Und dies, obgleich sich doch Erik gerade zu diesem Willy mit aller Kraft, einfühlsam, liebevoll hingezogen fühlte!
Der Down-Syndrom-Willy war, mit Erik verglichen, die reine Unschuld. Und daher das ideale Schwarze Schaf. Kathi bekam schnell heraus, dass man diesem Unschuldsengel alles in die Schuhe schob, was irgendwann kaputt-, verlorengegangen oder mit Absicht zerstört worden war, kurz, alles, wofür man einen Sündenbock brauchte. Sobald jedoch ein paar Gelangweilte eine Schubserei mit Willy anfingen, mischte sich, noch ehe Kathi eingreifen konnte, Erik ein, postierte sich vor Willy, verteidigte ihn mit Händen und Füßen und spuckte dem letzten Schubser noch schnell ins Gesicht.
Natürlich war Eriks Sonder-Status bekannt: Sohn eines Weltstars! Alle in Kathis Gruppe waren mit Rauswurf bedroht, die ihn nicht respektierten. Man wollte die großzügige Gönnerin nur ja nicht abschrecken! So bildete die Mutter indirekt einen Schutzschild für ihren Sohn. Dankbar wäre er ihr gewiss nicht dafür gewesen! Er hasste seine Mutter. Unverblümt zeigte er ihr das auch. Jeder konnte es sehen, wenn Donna Elvira wieder einmal zu Besuch kam und mit freundlichem Gruß nach allen Seiten den Aufenthaltsraum betrat. Demonstrativ drehte sich Erik dann von ihr weg. Sie dagegen, sich amutig in die Mitte bewegend, ihren Sohn mit den Augen suchend, winkte behandschuht dem Abgewandten einen Gruß zu, sprach ein paar Worte und verabschiedete sich, liebenswürdig lächelnd, auch schon wieder. Eine immer noch schöne, schlanke, alterslos scheinende Frau. Allen soeben in die Pubertät gelangenden Knaben hinterließ sie einen tiefen Eindruck von strahlender Eleganz.
Vom ersten Tag an, nachdem sie seine Gruppe übernommen hatte, mochte Kathi den Down-Syndrom-Willy. Ein kleines Wunder war er für sie. Mit unglaublichem Eifer, geradezu ekstatisch, versuchte er, alles, was man ihm beibringen wollte, sich anzueignen. Zum Beispiel bei Tisch manierlich mit Messer und Gabel zu hantieren, sich immer nur kleine Bissen von Fleisch oder Wurst einzuverleiben. Als ein noch größeres Wunder jedoch erschien es Kathi, wie ausgerechnet Erik dem Willy beim Lernen behilflich war, es ihm immer wieder vormachte und mit unendlicher Geduld Willys Ungeschicklichkeit hinnahm. Wenn Kathi beobachtete, mit welcher Fürsorge Erik den hilflosen Willy umgab, dann kam ihr schon manchmal der Gedanke: Nicht nur für mich, auch für Erik ist Willy nicht blöd. Erik und ich, wir beide teilen uns ein Geheimnis: für uns ist der Willy ein Prinz!
Sie statuierte das einfach so, und dabei blieb es. Erik zu fragen, wagte sie nicht. Vielleicht hätte er ihr sogar zugestimmt? Was ihre Mutter damals verhindert hatte: dass aus ihr eine kleine Prinzessin wurde, das vollzog Kathi jetzt am Down-Syndrom-Willy, sie verlieh ihm eine Aura.
Als eines Tages Donna Elvira, Eriks Mutter, wieder einmal auftauchte – diesmal von der Heimleitung begleitet – hielt sie sogar eine kleine Ansprache an Kathis Gruppe.
“Ihr kennt mich ja, ich bin Eriks Mama und von Beruf Sängerin. Und was braucht ein Sänger? Nicht nur eine schöne Stimme, er braucht auch ein Klavier!
Was haltet ihr davon, wenn bald in eurer Turnhalle ein Klavier steht und ihr könnt, wenn ihr wollt, darauf spielen? Es gibt überall Menschen, die gerne klavierspielen würden, wenn sie eins hätten. Vielleicht ist so einer unter euch? Dem widme ich das Klavier und wünsche mir, dass der Geist der Musik in ihm erwacht! Ansonsten könnt ihr an allen Fest- und Feiertagen zum Klavier singen und tanzen!”
Ein allgemeines Murmeln hob an – und dazwischen dröhnte Eriks “Kein Klavier! Kein Klavier!“ Aber, oh Wunder! ihm folgte, laut und deutlich, Willys Stimme. Wie immer, wenn er sich aufregte, stotterte er:
“K’ K’ Kla’ Klavier – sch’ sch’ schöööön!“
Und alle, bis auf Erik, klatschten in die Hände und riefen ”Klavier – schööön!”
Schon seit Jahren bekam dieser Erik, Sohn, wenn auch nur Adoptiv-Sohn einer einzigartig musik-begnadeten Mutter, privaten Klavierunterricht, der eine eventuell verborgene musikalische Veranlagung zum Vorschein bringen sollte. Bei seinen Pflegeeltern stand für ihn ein Klavier. An den Wochenenden, die Erik nicht im Heim, sondern bei ihnen verbrachte, sollte er gerade in dieser Hinsicht besonders gefördert werden. Klavierlehrer kamen und gingen. Der letzte allerdings kündigte schon nach der ersten Unterrichtsstunde. Erik besitze nicht die geringste Begabung und er, akademisch gebildeter Musikpädagoge, werde sich keinesfalls dafür missbrauchen lassen, einem derart unerzogenen Burschen, der ihn schon beim ersten Kennenlernen mit dem Satz begrüßt habe: “Klavierspielen ist Scheiße! Scheiße! Scheiße!“, auch nur eine einzige, weitere Unterrichtsstunde zu gewähren.
Worauf Erik dann an den folgenden Wochenenden das Klavier stundenlang so malträtierte, dass die völlig entnervten Pflegeeltern die Mutter anriefen: sie würden jetzt die Polizei einschalten, wenn Erik mit seinem Terror nicht aufhöre. Erik hörte nicht auf, er ließ es kaltblütig darauf ankommen. Als die Polizei anrückte, stahl er sich durch den Hinterausgang davon – und die Pflegeeltern sahen sich blamiert.
Das von Erik veranstaltete häusliche Klavier-Desaster sprach sich bis zu Kathi herum. Sie hätte eher erwartet, Erik werde seine Wut, wenn schon, dann an ihrem Turnhallen-Klavier austoben. Das aber hätte Erik niemals getan, denn er sah doch: für seinen Freund Willy war dieses Klavier ein Wunder, einzigartig, das er fortan wie einen Schatz behütete, jeden Tag aufsuchte, seine Tasten streichelte, sie hin und wieder auch einmal ganz sachte anklingen ließ und seine Töne vernahm, als kämen sie aus einer anderen Welt.
Während seiner von Kathi genehmigten täglichen Ausgehzeit saß der Willy also nur einfach träumend vor dem Klavier. Aber nicht lange blieb er mit seiner stillen Andacht allein. Schon bald gesellte sich Erik zu ihm, stellte einen Stuhl neben Willy, und sie schwiegen gemeinsam. Auch das hielt Erik dann nicht mehr aus; mit einem rauschenden C-Dur-Akkord griff er in die Tasten. Rein und strahlend ging es, nach seinen Umkehrungen zurück in die Tonika. Willy war sprachlos. Das waren keine einzelnen Töne. Nein – Akkorde! Zusammenklänge! Harmonien! Sie gingen weit über seine Träume hinaus! Er versuchte sogleich, es Erik gleichzutun. Natürlich misslang es. Aber dann brachte Erik dem Willy mit unendlicher Geduld jenen Dreiklang bei, der Willy aufjubeln ließ. Nach und nach prägte er ihm auch noch seine Umkehrungen ein, das Höchste an Harmonie für den beseligten Willy.
Außer den beiden fand sich niemand, der am Klavier interessiert war. Anfangs spielte Erik dem Willy kleine, dann mit der Zeit größere Stücke von Mozart vor. Es war nur ein Versuch: langweilte sich der Willy damit? Nein, andächtig hörte er zu, konnte das Gleiche nicht oft genug hören. Immer und immer wieder verlangte er eine Wiederholung. Mit der Zeit mogelte Erik dann ein Stückchen Schubert, eines von Beethoven darunter, aber der Willy hörte es heraus und begriff: Es gibt vielerlei wunderbare Musik. Sie hat keine Grenzen, hört nicht bei Mozart auf. Der Willy besaß also ein Ohr! Er konnte unterscheiden, hatte Lieblingsstücke. Stellte Fragen. Erik freute sich.
Natürlich erfuhr auch Donna Elvira davon. Plötzlich stand sie eines Tages überraschend in der Turnhalle hinter den beiden am Klavier. Sie erschraken zutiefst, als sie in die Hände klatschte und ”Bravo! Bravo!“ rief. Sie hatten sie nicht kommen gehört. Erik stand sofort auf und rannte weg. Auch Willy erhob sich, machte eine kleine Verbeugung, wie man es ihm zum Spaß beigebracht hatte. Elvira setzte sich auf Eriks Stuhl und präludierte beidhändig auf dem Klavier. Andächtig hörte Willy zu.
Nach einem kleinen Vorspiel begann sie mit ihrer Glockenstimme zu singen:
Sah ein Knab’ ein Röslein stehn,
Röslein auf der Heiden.
War so jung und morgenschön,
Lief er schnell, es nah zu sehn,
Sah’s mit vielen Freuden.
Röslein, Röslein, Röslein rot,
Röslein auf der Heiden.
Willy hielt es vor Begeisterung nicht auf seinem Stuhl. Im Stehen begann er schon nach der ersten Strophe leidenschaftlich zu klatschen, konnte gar nicht mehr damit aufhören. Donna Elvira ließ es daher mit Singen genug sein. Sie stand auf und bedankte sich für den Beifall mit einem kleinen, frivolen Knicks.
“Ist gut, Willy, ist gut! Wenn du willst, komm ich mal wieder und sing’ dir die beiden nächsten Strophen vor. Ja?“
Willy konnte, wie immer, wenn er aufgeregt war, nur noch stottern.
“Ja, bi- bi- bi- bitte! Bi-bitte!“
“Dann Grüß Gott und Leb’ wohl bis zum nächsten Mal!“
Damit entschwand sie.
Was sie ihrem Sohn Erik soeben angetan hatte – seine Tastenkünste mit ihrem verführerischen Gesang weit in den Schatten stellend – darüber machte sie sich keine Gedanken: In solchen Augenblicken war sie noch immer die Diva, der Weltstar, dem soeben noch einmal ein Triumph widerfahren war, wenn auch nur vom leidenschaftlich applaudierenden Down-Syndrom-Willy.
Die ganze Zeit stand Erik hinter der Tür, war Zeuge von Willys Jubel und wusste, gegen seine Mutter käme er niemals an. Sie hatte ihn übertrumpft, seinen einzigen Freund die wahre Herrlichkeit, das Wunder ”Musik” hören lassen. Und wie der Willy zugehört hatte! Was war Eriks Klavierspiel gegen Donna Elviras Zauberstimme?
Er wartete, bis sie verschwunden war, dann ging Erik in die Halle zurück.Willy stand immer noch da, selig lächelnd, die Augen geschlossen. Weit ausholend schlug Erik dem Willy mit aller Gewalt die geballte Faust ins Gesicht. Willy stürzte rücklings zu Boden, mit dem Hinterkopf schlug er auf. Besinnungslos lag er da. Tot?
Erik flüchtete. Rannte, rannte. Hörte gar nicht mehr auf. Aus dem Haus, die Straße entlang, die nächste Straße. Ohne anzuhalten, durchs ganze Viertel. Fand eine S-Bahn-Haltestelle, stieg ein, blieb sitzen, bis es irgendwo nicht mehr weiterging. Rannte weiter. Führ irgendwann ein Stück mit einem Omnibus. Wollte weiterrennen. Konnte nicht mehr. Konnte kaum mehr gehen. Ließ die letzten Häuser und Gärten hinter sich. Schleppte sich nur immer weiter. War erschöpft. Es wurde Nacht. Wo bleiben? Wo etwas zu trinken bekommen? Wo ein warmes Plätzchen finden? Wo schlafen?
In der Ferne sah er die Lichter der S-Bahn. Wo kam sie her? Wo fuhr sie hin? Da – da – ganz in der Nähe verliefen ihre Schienen! Wenn er sich jetzt darauflegte, wäre alles vorbei. Die S-Bahn kam näher. Die Schienen vibrierten unter seinem Körper. Im allerletzten Moment wälzte er sich zur Seite. Die S-Bahn donnerte vorüber. Er zitterte, krümmte sich, blieb einfach liegen. Gab es nirgendwo einen Unterschlupf? In der Ferne sah er ein niedriges Dach, vielleicht eine Hütte? Er kam nicht mehr hoch. Mit unendlicher Mühe kroch er auf allen Vieren in jene Richtung, wo er das Dach zu sehen glaubte. Er wusste später nicht mehr, wo und wie er die Nacht überstanden hatte. Am anderen Morgen gelang es ihm, wieder auf die Beine zu kommen, sich mühsam, Schritt für Schritt, zurück in die bewohnte Welt der Häuser, Gärten und Menschen zu bewegen. Dort fand er zwar keine S-Bahn-Haltestelle, aber wenigstens einen wartenden Omnibus. Egal, er stieg ein. Der Fahrer sah auf den ersten Blick, da brauchte einer Hilfe. Ein Junge, halb noch ein Kind! – ausgebüxt? Er gab der Polizei einen Wink. In kürzester Zeit wurde Erik von zwei freundlichen Polizisten abgeholt; er war bereits als vermisst gemeldet.
Kathi war es, die den besinnungslosen Willy fand.
Mit schwerer Herzattacke lag er dann – in ständiger Gefahr des Herzversagens – wochenlang auf einer kardiologischen Intensivstation. Er überlebte und kam anschließend in eine mehrwöchige Kur.
Im Heim wurde über den schrecklichen Unfall betont geschwiegen. Man hegte zwar einen starken Verdacht gegen Erik, doch einem Verhör unterzog man ihn nicht. Man wusste einfach nicht, was mit Willy passiert war. Vielleicht wollte man es so genau auch gar nicht wissen? Es gab ja keine Zeugen. Und Willy konnte nicht reden, er war lange bewusstlos.
Auch als er nach vielen Wochen zurückkehrte ins Heim, redete Willy nicht. Er hatte sich verändert, war schmal, still und ernst geworden, wo er doch früher jedermann freundlich zugelächelt hatte. Nie mehr suchte er Eriks Nähe, offensichtlich ging er ihm aus dem Weg. Ängstigte er sich vor ihm? Es entging Kathi nicht, dass umgekehrt auch Erik seinem Freund auswich. Das bestätigte ihren Verdacht, Erik habe mit Willys lebensbedrohlichem Sturz zu tun.
Nur – wie, was, weshalb?
Auch Erik konnte seine Gefühle nicht verbergen. Allzu schwer lastete auf seiner Seele der furchtbare Hieb, den er Willy versetzt hatte. Erik litt. Eines Tages ertrug er seine Schuld nicht mehr. Vor dem Mittagessen schlüpfte er ins Esszimmer und schob dort unter Willys Teller einen Zettel: Verzeih mir, Willy! Bitte verzeih mir! Erik hatte am Tisch einen festen Platz unweit von Willy, ihm gegenüber.
Gespannt beobachtete Kathi, ob Willy den Zettel bemerkte, der ein klein wenig unter dem Teller hervorlugte. Ja, Willy nahm ihn – las ihn – schaute Erik an und – nickte ihm zu. Ganz langsam, mit großem Ernst, immer noch einmal nickte er. Ja, er verzieh! Erik nickte zurück, dankbar – und ebenso ernst. Es war, als sprächen sie sich feierlich ein gegenseitiges Gelübde zu. Kathi atmete auf. Die beiden waren versöhnt. Obgleich eifersüchtig, gönnte sie Erik den Frieden.
Ein paar Tage danach, während sie einander wieder nah und näher kamen, riss Erik plötzlich im Vorübergehen den Willy an sich, hielt ihn fest in seinen Armen, küsste ihn leidenschaftlich – rechts, links auf die Backe, auf den Mund. Es war ein Augenblick unaussprechlicher Seligkeit!
Das aber war der Kathi dann doch zu viel. Sie hatte die Szene von fern beobachtet – mit Abneigung.
”Der Down-Syndrom-Willy gehört erst einmal mir. Er ist mein Willy, meiner! Glaubt denn der Erik, dass er den Willy jetzt ganz für sich haben kann? Aber ich gebe ihn nicht her! Schon gar nicht dem Erik! Was hat er denn neulich noch mit ihm gemacht? Und heute umarmt und küsst er ihn!”
”Recht so! Wehr’ dich!” empörte sich ihre innere Stimme. ”Dieser Erik ist böse! Lass dir nur nichts von ihm gefallen! Zeig ihn an! Jawohl, er hat den Willy fast totgeprügelt! Warum sonst wäre er weggelaufen? Auch die Heimleitung verdächtigt ihn! Aber sie schweigen. Sie haben natürlich Angst, ihr guter Ruf könnte leiden.”
Musste also jetzt sie, die Kathi, dafür sorgen, dass Erik bestraft wurde?
”Erik, ein Beinahe-Mörder! Ins Gefängnis mit ihm!”
Nein, dahin käme er, als Jugendlicher, ja nicht. Aber im Heim könnte er keinesfalls bleiben. Von heute auf morgen müsste er es verlassen. Für immer wäre Kathi ihren Peiniger los. Willy jedoch? Willy, der gerade Frieden geschlossen hatte mit Erik, seinem besten, nein, seinem einzigen Freund? Willy würde verzweifeln.
”Nichts da! Dieser Erik muss angeklagt werden. Wenn von niemand sonst, dann von mir!”
Aber Kathi klagte den Erik nicht an. Kathi lieferte den Schuldigen nicht aus. Sie ging auch nicht zur Heimleitung.
Verzweifelt versuchte sie, sich dafür zu rechtfertigen: dem Willy zulieb unterließe sie es – wem sonst?
Aber zuletzt stritt sie es auch vor sich selbst nicht mehr ab: ”Das bin nicht ich! Da spricht meine Mutter aus mir? Der Erik ist doch fast noch ein Kind! Ihn ausliefern, verurteilen, kaputtmachen?”
Nein! Ihre innere, hartherzige Mutter mochte es noch so sehr von der Tochter verlangen – sie brachte es nicht übers Herz! Sie hatte grade zum ersten Mal mit ihrer schrecklichen Mutter gekämpft und sie besiegt!
Monate vergingen. Der Brief ihres unbekannten Cousins, in dem er Kathi um Rat gebeten hatte, war längst vergessen. Da bekam sie eines Tages von Arnes Wohnheim die Nachricht, Arne habe sich umzubringen versucht. Er liege im Harlachinger Krankenhaus, und man wisse nicht, ob er den hohen Blutverlust überleben werde. Sie sei vermutlich seine einzige Verwandte. Ob sie ihn nicht besuchen und ihm Mut zusprechen wolle? Alle im Heim mochten Arne und seien sehr traurig, dass er sich das angetan habe.
Das Krankenhaus war nicht allzu weit von ihrer Giesinger Wohnung entfernt. Zur Not hätte sie auch zu Fuß hingekonnt, aber mit dem Taxi ging’s natürlich schneller. Und es konnte Kathi gar nicht schnell genug gehen. Unendlich schwer lag ihr ihre Versäumnis auf dem Gewissen! Der Brief war doch ein Hilferuf gewesen! Allzu lange vergeblich auf ihre Antwort wartend, war Arne verzweifelt.
“Ist er ansprechbar?” fragte sie die Schwester, die ihr die Tür von Arnes Zimmer wies.
“Und wie