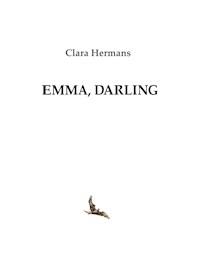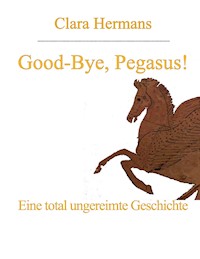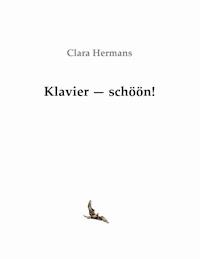Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
>>Denn wirklich verkörpert dieser Diskurs über Kunst geradezu paradigmatisch die Ideen, ja, die Ideologie des Klassizismus: jenes Bildungsideals, das in dieser Epoche nicht nur Goethe leidenschaftlich bewegte. Wobei er sie im Werk und als Person verinnerlicht hat... Dass man die Ideale des Klassizismus auch leben kann, beweisen Goethes mittlere und späte 1790er Jahre. Ein Zeugnis dieser "klassizistischen" Lebensart liefert die Reise in die Schweiz des Jahres 1797, die damit hinter die phantastischen italienischen Träume einen definitiven Schlusspunkt setzt. Davon handelt dieses Buch. << Dies ist die überarbeitete Fassung der Dissertation, mit der die Autorin 1954 bei Walther Rehm in Freiburg mit Auszeichnung promoviert wurde. Sie gibt Zeugnis ab, wie damals geistig gearbeitet wurde und wie geistig damals gedacht wurde. Von der formalen und intellektuellen Ungebundenheit, und von der gedanklichen Strenge, die Doktorvater und Doktorandin verband.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 520
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Raymund meinen herzlichen Dank
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
“... lerne ich, freylich etwas spät, noch reisen”
Der Kontinent Goethe
“Die Idee geht aller Erfahrung voraus”
Italien! Italien!
Ein Weltbürger entpuppt sich
“Ein wundersames Werk ...”
Die gesetzgebende Gewalt des guten Geschmacks
Diese “ganze empirische Breite”: Frankfurt
“Der symbolische Fall”
Frankfurt: die STADT
Der “ächte, mäßige Zustand des Nachsommers”
Heidelberg
Am Neckar und in Heilbronn
Stuttgart: Klassizismus in der Provinz
Selbstbildnis
Schaffhausen: der Rheinfall
Die Elegie “Amyntas”
Die Schweiz
Von Stäfa auf den St.Gotthard
Der “Übergang von dem Formlosesten ...”
Nachwort
Einleitung
Von jeher ist Goethes “Reise in die Schweiz 1797” ein Stiefkind der Literatur. Auch Goethe selber hat, was er dem mitreisenden Schreiber Geist damals an Ort und Stelle ins Tagebuch diktierte, jahrzehntelang in seinem Archiv vergraben - und vielleicht seit 1797 niemals wieder auch nur eines Blickes gewürdigt - bis er 26 Jahre später, 1823, seinem neuen Gehilfen Eckermann die Hinterlassenschaft seiner Schweizerreise1 zum Redigieren der Texte für die Aufnahme in seine Gesammelten Werke übergab: “Sie werden sehen, es ist alles nur so hingeschrieben, wie es der Augenblick gab; an einen Plan und eine künstlerische Ründung ist dabei gar nicht gedacht, es ist, als wenn man einen Eimer Wasser ausgießt.”2 Für Eckermann war eine solche Aufgabe, seine allererste, eine hohe Auszeichnung, möglicherweise auch eine Talentprobe? Außer drei Heften mit Niederschriften enthielt das Konvolut auch alles, was Goethe 1797 auf der Reise gesammelt und nach Weimar mitgebracht hatte; nach seinen Worten
“alle Arten von öffentlichen Papieren: Zeitungen, Wochenblätter,
Predigtauszüge, Verordnungen, Komödienzettel, Preiskuraten”,
die jetzt allerdings keine Verwendung mehr finden würden. Denn ursprünglich war durchaus an eine spätere “künstlerische Ründung” gedacht und hatte Goethe Tagebuch, Reisebriefe und das Informationsmaterial zu einem Buch verarbeiten wollen. Schade, dass er nach seiner Rückkehr die Flinte so schnell ins Korn warf und damit das ganze Sammelsurium von Zeitungen und “fliegenden Blättern” Makulatur werden ließ - anstatt ein Stück Literatur daraus zu machen. Auf die von Eckermann besorgte Redaktion hat mit Gewißheit der alte Goethe ein Auge gehabt. Das Tagebuch wurde aufgefüllt durch dazwischengestreute Briefe: Goethe von unterwegs an Schiller, an den Herzog Karl August, an andere Freunde; so bekommt auch derjenige Leser, der sich keine Ausgabe von Goethe-Briefen leisten kann, einen Eindruck von des Dichters exzellenter brieflicher Schreibe. Und gerade weil Tagebuch und Briefe später nicht geglättet, nicht poliert und nicht vereinheitlichend durcheinander und ineinander verarbeitet wurden, behielt das Material seine originale Frische und Unmittelbarkeit, und wer sich wirklich für Goethe interessiert, wird die “Schweizerreise” gewiß nicht gelangweilt aus der Hand legen. Allerdings: dass Goethe die Redaktion seiner Reiseaufzeichnungen für die Veröffentlichung nicht eigenhändig besorgt hat, kostete seine “Reise in die Schweiz 1797” in den Augen der Goethe-Philologie einen Teil ihrer Authentizität - obgleich sämtliche Texte von Goethe legitimierte Originale sind.
Es liegt also die Beschreibung einer dem Anschein nach wohlgelungenen Reise vor.
Der bedeutende Goethe-Kenner und -Forscher B. Suphan hat innerhalb der Großen Weimarer Sophienausgabe einen Ergänzungsband zur Schweizer Reise 1797 herausgegeben und ihr, die immer noch mit dem Ruch der Illegitimität behaftet war, kraft seines hohen Ansehens als Gelehrter einen ganz besonderen Rang als Gesinnungs-Dokument zugesprochen. lässt sich das verifizieren?
Man muss wissen: Goethe unternahm 1797 seine nunmehr dritte Reise in die Schweiz keineswegs, um wieder einmal das schöne Land zu besuchen. Die Reise musste gewissermaßen herhalten als psychologischer Schlusspunkt eines Dramas, das - von der Goethe-Biographik so gut wie nie beachtet -soeben zu Ende gegangen war. Es handelt sich um eine seit mehreren Jahren mit großem Einsatz vorbereitete, mit den höchsten Hoffnungen verbundene - geplante - zweite große Reise Goethes nach Italien, die der wissenschaftlichen Dokumentation seiner unvergleichlichen Idealvorstellung von Italien hätte dienen sollen. Sie musste abgesagt werden - und zwar für immer. Sämtliche Unterlagen der jahrelangen Vor-Arbeiten blieben jedoch in Goethes Archiv erhalten: der umfangreiche Briefwechsel zwischen Goethe und dem Maler Heinrich Meyer, der sich in Goethes Auftrag bereits seit 1795 in Italien aufhielt, sowie Goethes Aufzeichnungen über seine eigenen Studien - die eindrucksvollen Bruchstücke eines monumentalen Ideengebäudes: Goethes Traum - Italiens Apotheose.
Entstehen sollte die umfassende Darstellung, das Panorama der einzigartigen Idealität Italiens, in dem alles mit allem durch das Medium seiner Kunst zu klassischer Einheit verbunden war - Natur, Kunst, Geschichte. Wenn es so gelungen wäre, wie Goethes Vision es vorsah - zumindest der Goethe‘sche Teil - besäße Italien heute womöglich ein Nationaldenkmal aus deutscher Hand, vorausgesetzt, Goethe hätte seine rund zwei Jahre lang theoretisch vorbereiteten Pläne verwirklichen und zur Vollendung bringen können. Da Goethes Briefpartner Meyer nicht nur Maler, sondern auch Kunstgeschichtler war, dreht sich in seinen wie in Goethes Briefen naturgemäß alles um Malerei, Bildhauerei, Architektur - und zwar ausschließlich unter dem Patronat der damaligen Zeitströmung “Klassizismus”. Man darf annehmen, dass Kunst und Kunstwerke das alles verbindende Herzstück von Goethes Italienprojekt gewesen sind.
So ist - durch diesen Briefwechsel dokumentiert - Vokabular und Geist des Klassizismus die Haupt-Erbschaft, vielmehr die Haupt-Erblast des Italien-Projekts mit seinen Stichworten: Ordnung, Regelhaftigkeit, Gesetzmäßigkeit, Ebenmaß, Harmonie, Proportion, das makellos Schöne in der Kunst -und die Beurteilbarkeit, ja, Herstellbarkeit von Kunst mittels Lehren und Erlernen eindeutiger Regeln. Diese Regeln sind gleichsam das Arkanum, nach dem Goethe in seiner klassizistischen Lebensphase auf der Suche war und das er nirgendwo anders als in Italien zu finden hoffte. Die Kunst “der Alten” ist ihm inzwischen zu einer Art Kunst-Religion geworden - und er selbst zum Missionar, ja, zu ihrem Apostel. Unter dieser Prämisse befand sich Goethes Mitarbeiter, der Maler und Kunstgelehrte Heinrich Meyer, schon seit Herbst 1795 in Italien. Sein Ressort: Kunst und ihre Geschichte.
Ein Jahr lang bearbeitete er in Rom und ein weiteres Jahr in Florenz herausragende Kunstwerke stichwortartig beschreibend nach der von Goethe vorgedachten, tabellarischen Methode - indessen er je länger desto schmerzlicher darauf wartete, dass der durch die Kriegsereignisse immer wieder verhinderte Goethe endlich höchstselbst in Italien erscheinen würde, um vor Ort sein eigenes, weitaus umfassenderes Programm abzuwickeln. Goethe indes wurde ein Opfer der Folgen der Französischen Revolution, respektive des derzeitigen Hauptdarstellers auf der politischen Bühne: Napoleon eroberte erst Oberitalien, später Rom, ließ eine Menge bedeutender Kunstschätze nach Paris abschleppen - und machte Goethe auch in dieser Hinsicht einen Strich durch die Rechnung. Das Projekt Italien - ein Projekt ganz im Geiste des Klassizismus - immer wieder in Frage gestellt, aber bis zum letzten Moment am Tropf der Hoffnung hangend, wurde endlich im Sommer 1797 endgültig aufgegeben und landete im Papierkorb der Literaturgeschichte unter dem Titel
“Vorbereitung zur zweiten Reise nach Italien.1795. 1796”,
Material, das - in der gelehrten Diktion Suphans
“ALS EIGENARTIGES PARALIPOMENON3 MEHR DER GANZEN EPOCHE ALS EINES EINZELNEN WERKES HIER AN DIE ÖFFENTLICHKEIT GELANGT”.
Denn wirklich verkörpert dieser zwischen Goethe und Meyer brieflich hin- und hergehende Diskurs über Kunst, in den auch immer wieder Schiller einbezogen wird, geradezu paradigmatisch die Ideen, ja, die Ideologie des Klassizismus: jenes Bildungsideals, das in dieser Epoche nicht nur Goethe leidenschaftlich bewegte. Wobei er sie im Werk und als Person verinnerlicht hat und sich in einer Rolle gefiel, die alles Ungeordnete, Aggressive, Chaotische, Pathologische in Kunst und Leben kategorisch ablehnte. dass man die Ideale des Klassizismus auch leben kann, beweisen Goethes mittlere und späte 1790er Jahre. Ein Zeugnis dieser “klassizistischen” Lebensart liefert die Reise in die Schweiz des Jahres 1797, die damit hinter die phantastischen italienischen Träume einen definitiven Schlusspunkt setzt. Davon handelt dieses Buch.
Meyer hatte sich Mitte 1797 krank und depressiv nach der Schweiz in seinen Heimatort Stäfa am Züricher See abgesetzt. Jetzt kannte Goethe nur noch ein Ziel: seinen Meyer in die Arme zu schließen, sich mit ihm endlich in persona über ihrer beider Vorstellungen von Kunst auszutauschen.
So also kam es zu Goethes Reise in die Schweiz. Fortan obsiegte notgedrungen die Kunst-Theorie über die Kunst-Anschauung - sprich: die Theorie über die Kunst.
1 Am 25.Oktober 1823 schreibt Eckermann: “Wir sprachen darauf dies und jenes über vorhabende Arbeiten. Es war die Rede von seiner Reise über Frankfurt und Stuttgart nach der Schweiz, die er in drei Heften liegen hat und die er mir zusenden will, damit ich die Einzelheiten lese und Vorschläge tue, wie daraus ein Ganzes zu machen.”
Vom 23.Dezember 1823 berichtet Eckermann: “Abends mit Goethe allein in allerlei Gesprächen. Er sagte mir, dass er die Absicht habe, seine Reise in die Schweiz 1797 in seine Werke aufzunehmen.”
2 Eckermann kommentiert: “Ich freute mich dieses Gleichnisses, welches mir sehr geeignet schien, um etwas durchaus Planloses zu bezeichnen.” Als “planlos” kann man gerade die Schweizerreise 1797 nun keineswegs bezeichnen. Vielleicht ist sie ganz im Gegenteil an ihrer Planhaftigkeit - ihrer Über-Planung - gescheitert, d.h. nicht umgesetzt worden in einen künstlerisch umgearbeiteten Reisebericht.
3 Paralipomenon: Randbemerkung, Ergänzung, Nachtrag
“... lerne ich, freylich etwas spät, noch reisen”
Der Kontinent Goethe
Genau genommen gab es objektiv weder Grund noch Veranlassung für Goethes Reise in die Schweiz. Meyer war in der heimatlichen Luft gut aufgehoben und sogar unerwartet rasch genesen, er hatte auch keinen Hilferuf an Goethe gerichtet ihn abzuholen, wohl aber spürbar aufgeatmet, als Goethe das italienische Unternehmen endgültig und, wörtlich zu verstehen, zu den Akten legte. Zwar flackerten Goethes Hoffnungen immer wieder einmal auf - und möglichweise spielte bei der Reise nach Stäfa auch eine Rolle, dass sie dem Italien-Vorhaben zu einer heimlichen Gnadenfrist verhalf, schließlich kam Goethe seinem Sehnsuchtsland auf dem Umweg über die Schweiz in nächste Nähe und konnte von da aus die politische Lage Italiens viel besser beurteilen als von Weimar aus. Eventuell würde man sich ja vielleicht doch noch spontan zum Schritt und nicht nur zum Blick über die Alpen entschließen, je nach Lage der Dinge. Auch wenn dieser Glücksfall einer Wende vom Krieg zum Frieden ziemlich unwahrscheinlich war: die spezifische Denkweise, den Blick, den er für Italiens Kunst, Kultur und Geschichte, seine geographische Struktur, seine Geologie, die Physiognomie, die Lebensart seiner Menschen, den Charakter ihrer Städte entwickelt hatte, - für die Urbanität Italiens im Ganzen, - das alles hat Goethe sich natürlich nicht von heute auf morgen aus dem Kopf schlagen können und schon gar nicht wollen. Das sich wohl niemals mehr konkretisierende Programm wird ihn auf die Ersatz-Reise begleiten: Goethe wird mindestens einen wenn auch geringen Teil des sorgfältig erarbeiteten Fragenkatalogs, dieses auf Anwendung drängenden Instrumentariums, jetzt endlich einmal ausprobieren können. Allein: wie vergleichbar sind “Reise in die Schweiz” und “Unternehmen Italien”? Goethe wird auf dem Weg nach der Schweiz durch Länder und Städte kommen, ohne irgendwo Kunstwerke und Architektur zu finden wie in Italien, und nirgendwo werden ihm - mit einer Ausname - Kunstkenner und Künstler -Maler, Bildhauer, Architekten - wie in Rom begegnen. Aber suchen wird er sie!
Er macht es sich jedoch nicht leicht. Er gibt dem Notbehelf eine eigene Würde: die Ersatz-Reise, er zelebriert sie! Denn nie zuvor ist der wahrlich nicht wenig gereiste Goethe so auf Reisen gegangen4: lange Wochen bevor die Reise beginnt, beginnt das Nachdenken über sie. Da ihm die Schweiz, das Ziel der Reise, wohl kein genügend attraktiver Gegenstand der Reflexion sein kann, denkt er sich zunächst einmal - wie es seinem ersten Impuls entspricht - die Reise selbst als Experiment, im Grunde nichts anderes als: eine Reise in den “Kontinent Goethe”. Gegenüber Schiller spricht er einmal scherzhaft von einer “sentimentalen” Reise5 - worunter er nicht, wie unser heutiger Sprachgebrauch, einen gefühlsbetonten und eher feuilletonistischen Text versteht, - auch gerade nicht so wie 1789, wo er “so viel als möglich von sich zu verleugnen” versucht hat, - sondern im Sinne von Schillers 1795 erschienenem Aufsatz “Über naive und sentimentalische Dichtung”: “sentimentalisch” gleich “modern”, “von Reflexion dominiert” - und zwar eindeutig einer Reflexion über sich selbst. Er ist inzwischen annähernd zehn Jahre älter geworden und längst dabei, sich eine Facon zu geben, die dem Inbegriff seines humanistisch-klassizistischen Menschenbildes entspricht: dem eines umfassend gebildeten, allem Katastrophischen, Chaotischen, Tragischen, Leidenschaftlichen abgeneigten homo humanus.
Das Jahr 1794 ist das Entscheidungsjahr, das ihm eine Sternstunde beschert hatte: die Begegnung und die endlich herbeigeführte Verständigung mit Schiller, die ihn von einer jahrelangen Vereinsamung - einer schweren Kränkung - erlöst, wie er sie, ihr ganzes Ausmaß keineswegs beschönigend, später in seinen Annalen für 1794 beschreibt:
“Nach meiner Rückkunft aus Italien, wo ich mich zu größerer Bestimmtheit und Reinheit in allen Kunstfächern auszubilden gesucht hatte ... fand ich neuere und ältere Dichterwerke in großem Ansehen, von ausgebreiteter Wirkung. leider solche, die mich äußerst anwiderten; ich nenne nur Heinses Ardinghello und Schillers Räuber. Jener war mir verhaßt, weil er Sinnlichkeit und abstruse Denkweisen durch bildende Kunst zu veredeln und aufzustutzen unternahm; dieser, weil ein kraftvolles, aber unreifes Talent gerade die ethischen und theatralischen Paradoxen, von denen ich mich zu reinigen gestrebt, recht im vollen hinreißenden Strome über das Vaterland ausgegossen hatte. Beiden Männern verargte ich nicht, was sie unternommen und geleistet ... Das Rumoren aber, das im Vaterland dadurch erregt, der Beifall, der jenen wunderlichen Ausgeburten allgemein, so von wilden Studenten als der gebildeten Hofdame, gezollt ward, der erschreckte mich; denn ich glaubte, all mein Bemühen völlig verloren zu sehen, die Gegenstände, zu welchen, die Art und Weise, wie ich mich gebildet hatte, schien mir beseitigt und gelähmt. Und was mich am meisten schmerzte, alle mir verbundenen Freunde, Heinrich Meyer und Moritz, so wie die im gleichen Sinne fortwaltenden Künstler Tischbein und Bury schienen mir gleichfalls gefährdet; ich war sehr betroffen. Die Betrachtung der bildenden Kunst, die Ausübung der Dichtkunst hätte ich gerne völlig aufgegeben, wenn es möglich gewesen wäre; denn wo war eine Aussicht, jene Produktionen von genialem Wert und wilder Form zu überbieten? Man denke sich meinen Zustand! die reinsten Anschauungen suchte ich zu nähren und mitzuteilen; und nun fand ich mich zwischen Ardinghello und Franz Moor eingeklemmt. . . ich vermied Schillern, der, sich in Weimar aufhaltend, in meiner Nachbarschaft wohnte. Die Erscheinung des Don Carlos war nicht geeignet, mich ihm näher zu führen; alle Versuche von Personen, die ihm und mir gleich nahe standen, lehnte ich ab, und so lebten wir eine Zeit lang neben einander fort. Sein Aufsatz über Anmut und Würde war eben so wenig ein Mittel, mich zu versöhnen. Die Kantische Philosophie, welche das Subjekt so hoch erhebt, indem sie es einzuengen scheint, hatte er mit Freuden in sich aufgenommen; sie entwickelte das Außerordentliche, was die Natur in sein Wesen gelegt, und er, im höchsten Gefühl der Freiheit und Selbstbestimmung, war undankbar gegen die große Mutter, die ihn gewiß nicht stiefmütterlich behandelte ...“
Gerade in diesem neuen, 1794 dann endlich doch begonnenen Lebensabschnitt der Freundschaft mit Schiller befindet der dem Klassizismus ergebene Goethe sich im Diskurs mit ihm einerseits auf einem wahren Höhepunkt der Spekulation: das Nachdenken über die Dinge ist ihm mindestens so wichtig wie die Gegenstände seiner Reflexion selbst - andererseits gehören zum Kanon der klassizistischen Begrifflichkeit wenige Begriffe so innig wie der der “Reflexion” und fast zwangsläufig auch der der Selbstreflexion. Folgerichtig sollen ihm die Materialien seiner Schweizerreise nachträglich, wie er es unterwegs formuliert, zu einer “Geschichte des Äußern und Innern” verhelfen. Genau genommen ist Selbstbeobachtung und Weiterentwicklung der eigenen Person in jenem Sinn, den er schon in seinen italienischen Jahren sich zu eigen gemacht hatte, das innerste Ziel seines Reiseprogramms - immer mit dem Vorbehalt, seine klassizistische Statuarik beizubehalten und sie nirgends und durch nichts erschüttern zu lassen. Die Versuchung dazu wird ihm zwar begegnen - sowohl angesichts des Rheinfalls bei Schaffhausen wie angesichts der vorwinterlichen Gebirgswelt beim Aufstieg zum St.Gotthard - aber Goethe besitzt längst jene Mentalität, die ihm alles Wertherische Leiden und Mitleiden in und mit der Natur, die er “die große Mutter” nennt, vermeiden hilft.
Seine literarischen und wissenschaftlichen Probleme und Projekte - so auch die Weiterarbeit am Faust - durchdenkt Goethe seit Jahren, indem er sie mittels eines Schemas inhaltlich formalisiert. Das Schema als Hilfsmittel hat für ihn eine lange Tradition. Schon zu Beginn seines Weimarer Schaffens ist die Rede davon: Goethe hat den Versuch einer Lebensbeschreibung Herzog Bernhards - eines Vorfahren der Fürstenfamilie im 17.Jh. - unternommen und schließlich aufgeben müssen, denn “nach vielfachem Sammeln und mehrmaligem Schematisieren ward zuletzt nur allzu klar, dass die Ereignisse des Helden kein Bild machen”. Auch jetzt versucht er, dem Gehalt der Schweizerreise, vor allem dem, was er an Wissen und Erkennen über sich selbst aus ihr herauszuholen hofft, einen geeigneten Rahmen in Form eines Schemas zu geben, das heißt, die Gegenstände der Erfahrung so zu sortieren, dass sie seinem klassizistischen Pathos Genugtuung verschaffen. Schon im frühesten Hinweis auf die geplante Reise taucht der Begriff “Reiseschema” in Goethes Tagebuch auf. Wie über alles, was ihn wirklich bewegt, eröffnet Goethe sofort ein Gespräch darüber mit Schiller. Innerhalb weniger Tage spinnt er das Nachdenken über die Reise weiter. Allein der Gedankenaustausch mit Schiller - Wochen vor Reisebeginn - ist ein Beweis, wie wichtig gerade das Konzeptionelle an dieser Reise für Goethe gewesen ist.
Am 8.Juni 1797:
”Ideen zu einem Reiseschema. Abends zu Schiller, mit ihm darüber conferiert.”
Am 11. Juni:
“Früh Character des Lord Bristol und einiger andern. Vorsatz auf der Reise sich das unbedeutende und unangenehme des Umgangs durch solche Schilderungen einigermaßen zu ersetzen.”6
Am 12.Juni:
“Abends bey Schiller. Verschiednes über die Reise.”
Erst sieben Wochen nach dem ersten Eintrag, am 3o.Juli nachmittags, verlässt Goethe Weimar in Richtung Frankfurt. Unterwegs:
“Über die Characteristik der Städte.”
Während der Reise präzisieren sich die “Ideen zu einem Reiseschema”, - eine Anleihe beim italienischen Programm. Allerdings: Für diese Reise, wenn sie denn einer Theorie entsprechen, wenn sie mehr sein soll als ein von Hier nach Dort, gibt es kein Konzept, das an Faszination dem klassischen Entwurf seines Italien-Programms gleichkäme. Es bleibt nun einmal vom Anfang bis zum Ende der prosaische Zweck dieser Schweiz-Reise, sich unterwegs und überall, wo Goethe Station macht - in Frankfurt, Stuttgart, Tübingen - bei Kunstverständigen und anderen Fachleuten kundig zu machen, sich schließlich in Stäfa mit Heinrich Meyer zu treffen und zusammen mit ihm die Heimreise anzutreten. Es mag diese Reise unterwegs mit noch so vielen Kunstbetrachtungen und Kunstgesprächen garniert sein, ihr wird immer jene Aura fehlen, die das Projekt Italien umglänzte. Dennoch: eingebettet in ein zeitlich weiterreichendes Vorfeld von Goethes damaliger Lebenssituation - und sogar unabhängig von der italienischen Enttäuschung - erhält die Schweizerreise eine Bedeutung über sich hinaus, als Dokument einer besonderen, persönlichen Problematik. “Planlos”, ohne Konzeption kann er nicht reisen: das eine, doch nicht das einzige Denk-Motiv ist das Reisen als Selbstversuch. Zum andern gibt es ein zweites, möglicherweise kaum lösbares Problem: Goethe wehrt sich gegen alles Erfahrungswissen, die Empirie - “die ganze Breite der Empirie” sagt er verächtlich. Ihr steht definitionsgemäß die Theorie, Goethes derzeitiges intellektuelles Lieblingsinstrument, entgegen. Er lehnt - explizit in diesem Lebensaugenblick - die pure Erfahrung der Wirklichkeit und ihrer Gegenstände als Lehrmeister ab, er will sich Tatsachen und Erscheinungen durch Erforschung und Begründung ihrer Ursachen, Gesetzmäßigkeiten, Prinzipien erklären, um sie begrifflich einer ihnen zubestimmten abstrakten Ordnung einzuverleiben. Genau dies Prinzip Ordnung vermisst er in der puren Wirklichkeitserfahrung. Deshalb fordert er den Abstand der Dinge, die seinem Theoriebedürfnis aus Zeitmangel, aber auch aufgrund ihrer Zufälligkeit nicht genügen können, - ein Anspruch, den er der Reise gleichsam wie eine Leerformel einprogrammiert hat. Der sodann kunstvoll an allen psychologischen Klippen vorbeigesteuerte Reiseverlauf - und vermutlich auch der Zuwachs an Selbsterfahrung - wird am Ende Goethes unbestechliche Intellektualität dann doch nicht zufriedenstellen können. Erst hinterher, nach seiner Rückkehr, wird Goethe sich dieser Bilanz bewusst werden. Gerade die Traumata auf Goethes Lebensweg sind es jedoch, die Goethe von seinem schrecklichen Image eines “Olympiers” erlösen. Und die Nachwirkung der Schweizerreise ist eine solche Verletzung, - eben das macht sie interessant: eine Schwäche, die uns jenen Goethe in klassizistischer Garderobe und mit der feierlichen Attitüde, - zu der auch seine Theorieversessenheit gehört - die er sich in diesem Lebensabschnitt zugelegt hat, menschlich erscheinen lässt.
Über Erfurt, Eisenach, Fürth, Gelnhausen und Hanau trifft Goethe am 3.August 1797 vormittags um acht Uhr, am vierten Tag seiner Reise, in Frankfurt zu längerem Aufenthalt ein. Das Thema Reise wird er hartnäckig weiterverfolgen bis zu ihrem Schluss. “Reisen”: mehr als eine sinnliche und rationale Erfahrung, ein transitorischer Vorgang, der den Reisenden vorübergehend in einen elementar verändertenen seelischen Aggregatzustand versetzt - wie Wasser, das zu Eis wird. Im übrigen erfährt jeder Reisende, wenn er nur sensibel genug ist, jene seltsame Erregung, in der er das Reisen intensiv als Ausnahmezustand erlebt. Goethe registriert ihn als Irritation, die ihm das Medium “Reise” im Umgang mit den “Gegenständen der Erfahrung” verursacht.
An Meyer in Stäfa schreibt er:
“Auf der kurzen Reise von Weimar hierher und diese wenigen Tage hier habe ich über die Methode der Beobachtung auf Reisen, über Bemerken und Aufzeichnen manches gedacht. Die Gegenstände der Erfahrung sind so vielfach, dass sie uns immer zerstreuen, indem sie uns einzeln in jedem Augenblick anziehen; die Zeit ist kurz, und man ist nicht immer aufzumerken fähig. Ich will die Zeit, die ich hier bleibe, ein Schema und eine bequemere Form eines Tagebuchs auszudenken suchen, und die zweyte Hälfte meiner Reise durch Deutschland bis zu Ihnen durch diese Hülfsmittel zu benutzen suchen; das übrige wird eine gemeinsame Bemühung vollenden.”
Worüber er schon seit den vorhergegangenen sechs Wochen nachgedacht hat, nämlich über die Methodik des Reisens, der Beobachtung, des Wahrnehmens und Aufzeichnens beim Reisen - das beschäftigt ihn noch immer während “der wenigen Tage” - es sind immerhin vier! - von Weimar bis Frankfurt. Goethe liefert da ein anschauliches Beispiel, wie hartnäckig und ausdauernd er Problemen auf den Leib zu rücken pflegt, die sich ihm als wichtig und zugleich als schwierig darstellen - auch, dass für ihn im Grunde das Faszinosum dieser Reise erst einmal im Erfinden einer Methode als “Hülfsmittel” zum “Beobachten, Bemerken und Aufzeichnen” besteht.
Aus diesem Brief erfährt man nebenbei auch, dass Goethe zusammen mit Meyer gesprächsweise diese Reise aufzuarbeiten plant, vermutlich mit der Absicht, den Stoff für eine Publikation vorzubereiten - ähnlich wie er vorher mit Schiller die Reise “vorbesprochen” hat. Man kann daran sehen, wie sehr Goethe der Kommunikation mit einem Geistesverwandten bedarf. Jahrelang, nach seiner Rückkehr aus Italien 1788, hat er das schmerzlich vermisst, erst seit 1794, durch das Gespräch mit Schiller über Literatur und Philosophie - und durch das Gespräch mit dem seit 1792 in Weimar ansässigen Meyer über Kunst, das ihn bis zum Lebensende begleiten wird, ist ihm dies Geschenk inzwischen - gleich doppelt - zuteil geworden
Mittels eines höchst einfachen Prinzips wird er mit dem überwältigenden Andrang von Eindrücken fertig - den er einerseits fürchtet, andererseits zu sich heranzieht: er registriert einfach alles, was ihm über den Weg läuft, ihm zu Ohren, unter die Augen, in die Hände kommt. Das Resultat dieser Entscheidung ist, neben den Tagebucheintragungen, jenes Bündel verschiedenartigster Papiere, die bedauerlichweise den Weg in die “Schweizer Reise” nicht gefunden haben. Heutzutage werden Ansichtspostkarten und Fremdenverkehrsprospekte gesammelt - schwer zu sagen, um wie viel interessanter das Goethe‘sche Sammelsurium gewesen wäre.
“Ich gewöhne mich nun, alles, wie mir die Gegenstände vorkommen und was ich über sie denke, aufzuschreiben, ohne die genaueste Beobachtung und das reifste Urteil von mir zu fordern oder auch an einen künftigen Gebrauch zu denken. Wenn man den Weg einmal ganz zurückgelegt hat, so kann man das Vorräthige immer wieder als Stoff gebrauchen.
So gibt es Materialien, die mir künftig als Geschichte des Äußern und Innern interessant genug bleiben müssen.”
Entschlossen greift Goethe damit zum einzigen Verfahren, das ihn von möglichen Skrupeln mit einem Schlag befreit. Wann hat er sich je so wie hier um Beliebiges, Zufälliges gekümmert? Aber in diesem Fall hat er mit der ihm sonst ganz fremden Art von Stoffsammlung eine gute Wahl getroffen. Denn intuitiv lässt Goethe damit den Zufall für sich arbeiten wie einen - mathematisch legitimierte Resultate liefernden - Zufallsgenerator. Faszinierend ist es schon, sich das Goethe´sche Auswahlprinzip “alles” durch moderne Rechenmethoden halbwegs sanktioniert zu denken, sich zu vergegenwärtigen, dass der Willkür seiner Reiseeindrücke, insofern sie von großer Menge und also von statistischer Beweiskraft sind, durchaus eine rational begründbare Evidenz - und noch dazu von besonderem Reiz - zugrunde liegt, die letztlich genau das Gewünschte erbracht hätte: eine umfassende, gerade durch ihr inhaltlich nicht vorausbestimmbares Zustandekommen faszinierende Reise-Dokumentation. Als subjektives Element verleiht Goethes Reaktion auf Gehörtes und Geschautes, das ihn anmutet, seinen Reisebildern an bestimmten Stellen des Tagebuchs eine eigene literarische - und zuweilen sogar eine wahrhaft poetische Grundierung. Wenn er sich obendrein “Materialien” für seine “Geschichte des Äußern und Innern” verspricht, - also eine Geschichte, des Was und Wie seiner Reise, dann gesteht er dem Zufall tatsächlich eine Art Vernunft zu, ein fatales, schicksalhaftes Walten. Es bleibt zu bedauern, dass Goethe sich nicht die Mühe gemacht hat, die Zusammenhänge seiner Biographie mit seiner Sammlung von Theaterzetteln, Predigtauszügen, Verordnungen etcetera, sowie seine Reflexionen darüber, der Nachwelt zu hinterlassen: wir könnten heute in der Außen-Welt von damals wie in einem Spiegel seine Innenwelt erblicken.
Tag für Tag signalisiert Goethe im übrigen, wie wohl ihm unterwegs auf der Reise ums Herz ist: ohne den geringsten Skrupel verwendet er zeitsparend die immergleichen Epitheta, mit denen er Land und Leute im Vorüberfahren charakterisiert. Und es fällt ihm auch später, im Alter, offensichtlich nicht im Traum ein, daran herumzuverbessern, was nur Goethes ungeheuren Seelenabstand beweist. Aber: seine Wortwahl, das Streben nach Begrifflichkeit akzentuiert immer wieder seine Selbst-Beschreibungen, ohne den früh angeschlagenen Grundton, das Wohlgefallen an seiner Reise je in Frage zu stellen:
“Vom 25.August an, da ich von Frankfurt abreiste, habe ich langsam meinen Weg hierher genommen. Ich bin nur bey Tage gereist und habe nun, vom schönen Wetter begünstigt, einen deutlichen Begriff von den Gegenden, die ich durchwandert, ihren Lagen, Verhältnissen, Ansichten und Fruchtbarkeiten.”
Goethes Landschaftsschilderungen - auch wenn sie anfangs so abstrakt erscheinen wie oben - werden, im weiteren Verlauf der Reise, mehr und mehr zu Musterbeispielen der Anschaulichkeit - er schüttelt gleichsam eine Prosa aus dem Ärmel, so natürlich wie die Natur selbst, wie sie nur einem wahren Liebhaber und vielleicht auch ihm nur in einem vom Reifen und Ernten glücklich geprägten Augenblick wie dem Übergang vom späten Sommer zum frühen Herbst gelingt. Das Tagebuch beschreibt von Mal zu Mal detailreicher die Landschaften Süddeutschlands, durch die Goethe seines Wegs zieht - und bis zum gartengleichen Übergang in die Schweiz werden viele Landschaften einander gleichen - jede eine Kulturlandschaft, eine Idylle, von menschlicher Hand geschaffen und eher von ihr gestreichelt als je von ihr vergewaltigt oder ausgepowert. Goethe liebt sie, aber noch viel mehr liebt er ihr Abbild in der Kunst: es ist die Landschaftsmalerei Poussins und Claude Lorrains, deren Pendant er auch in der wirklichen Landschaft sucht - nicht umgekehrt, - reale Landschaften beschreibt er mit Maleraugen wie ein Gemälde. Der Klassizist in Goethe liebt eben noch mehr die Vollkommenheit der gemalten Natur - und damit möglicherweise auch das Künstliche in der Kunst - mehr als das Natürliche in der Natur. Und er steigt niemals unterwegs aus, auf dem Land schon gar nicht, nie äußert er auch nur in Gedanken einen solchen Wunsch - sein Ziel ist immer die Stadt.
Schon den Auftakt, die viertägige Fahrt von Weimar her und wie er sich in Frankfurt fühlt, schildert er in Briefen an verschiedene Adressaten mit Genuss:
“Zum ersten Male habe ich die Reise aus Thüringen nach dem Mainstrome durchaus bei Tage, mit Ruhe und bewusstseyn gemacht ... So bin ich denn vergnügt und gesund am 3. in Frankfurt angekommen und überlege nun in einer ruhigen und heitern Wohnung, was es heiße, in meinen Jahren in die Welt zu gehen.”
Andererseits: schon auf dieser ersten Station seiner Reise erwägt er, was es für ihn bedeute, “in die Welt zu gehen.” Die Bemerkung “in meinen Jahren . . .” steckt wie ein kleiner Widerhaken im Text. Goethe wird am 28.August 1797 achtundvierzig Jahre alt. 1792 hat er als Begleiter Carl Augusts, der den Rang eines Generals der Preußischen Armee innehatte, die Kampagne in Frankreich, die schicksalhafte Kanonade von Valmy und den anschließenden Rückzug absolviert - und nebenbei der Weltgeschichte ein unvergessliches Bonmot geschenkt. Fühlt er sich, nur fünf Jahre später, um so viel gealtert?
Und ist es Koketterie, wenn er schreibt:
“Durch die Gelassenheit, womit ich meinen Weg mache, lerne ich, freylich etwas spät, noch reisen”.
Damit unterscheidet Goethe seine Schweizerreise 1797 von früheren wie zukünftigen Reisen. Nur diese und keine andere Reise wird für ihn bis zum Schluss zum Experiment, wo er Reisenlernen sich geradezu schulmäßig auferlegt, - gerade weil diese Reise nur ein Ersatz für die große italienische Tour, auf der alles Erfahrung und Lernen gewesen wäre, nur gerade das Reisen nicht. “Lernen” steht auf der klassizistischen Werte-Skala weit oben. “Reisenlernen” war demnach für Goethe - trotz so vieler vorausgegangener Reisen - in eben diesem Augenblick ein willkommenes, sozusagen speziell kreiertes Übungsprogramm: eine Technik, sich zu “versammeln”, alles Vorübergehende rasch aufzufassen und im Gedächtnis zu speichern - die Überfülle der Farben und Formen von Wiesen, Wäldern, Gärten, Weinbergen, Gewässern und Naturerscheinungen wie Nebel oder Sonnenuntergang in höchster Konzentration wahrzunehmen - und gerade dadurch dies alles, auch die eigene Virtuosität, aufs Höchste zu genießen. Mit gutem Recht hätte Goethe sich der perfekt erlernten Kunst des Reisens rühmen können, die er durch seine täglichen Diktate unter Beweis stellt, - wie er überhaupt bei allem, was er sich lernend aneignet, auf einem sehr hohen Niveau seine Fertigkeiten trainiert und aus vielen Fertigkeiten eine Kunst macht:
“Es gibt eine Methode, durch die man überhaupt in einer gewissen Zeit die Verhältnisse eines Ortes und einer Gegend und die Existenz einzelner vorzüglicher Menschen gewahr werden kann. Ich sage gewahr werden, weil der Reisende kaum mehr von sich fordern darf; es ist schon genug, wenn er einen saubern Umriß nach der Natur machen lernt und allenfalls die großen Parthien von Licht und Schatten anzulegen weiß; an das Ausführen muss er nicht denken.”
Man könnte sich fragen: warum diese bohrende Suche nach einer “Methode”, die es ermöglicht, auf Reisen in kürzester Zeit “die Verhältnisse eines Ortes ... und die Existenz einzelner vorzüglicher Menschen gewahr zu werden”. Und man könnte versuchen, sich dieses Experimentieren und Erfragen mit einem für diese Reise gültigen Grundprinzip Goethes zu erklären: sich über alles und alle, Dinge wie Menschen, im Licht äußerster rationaler Klarheit und Erklärbarkeit “einen Begriff” zu verschaffen - eben jene Begrifflichkeit herzustellen, die ihm sein klassizistischer Impetus in diesem Lebensaugenblick als Pflichtübung vorschreibt. Daher ein weiterer Leitsatz seiner “Reise-Methode”: Skizzieren, ein “sauberer Umriß nach der Natur” genügt. Es bedeutet verzichten auf liebgewohnte Gepflogenheiten des Ausführens - kein Verweilen, kein Hinterfragen, kein Differenzieren wie in seiner Beschreibung des Lord Bristol, keine Farben, keine Psychologie, und schon gar keine Floskeln, keine Füllsel. Auch heute noch, nach über zweihundert Jahren, fesselt Goethes klares, knappes Deutsch, das an wenn auch nur wenigen, bewunderungswürdigen Stellen seine volle Sprachkunst spontan durchbrechen lässt. Andererseits kommt auch immer wieder der klassizistische Goethe zum Vorschein. Er hat um eine Methode gerungen - und er hat sie gefunden, nämlich: alles - und das sind nicht nur Stoffe, Projekte, Unternehmungen, sondern ganz besonders ist es auch jede Art von Problematik - mit der Gelenkigkeit seines Geistes methodisch zu bewältigen, Irrationales zu meiden, Krisenhaftes zu neglegieren. Ein Rezept, das Goethe gerade in diesem Schicksalsaugenblick instinktiv auch für sich selber nutzbringend anwendet: mit dem italienischen Fehlschlag wird er am einfachsten dadurch fertig, dass er, anstatt zuhause in Weimar die Trümmer seiner Hoffnungen im Doppelsinn “aufzuheben”, sich auf eine Reise begibt. Es ist also, diesbezüglich, eine überaus “vernünftige” Reise - sie lässt Schmerz und Enttäuschung nicht ein einziges Mal unterwegs offen zur Sprache kommen. In den Tagebucheintragungen existieren die italienischen Pläne überhaupt nicht, nur beispielsweise über die Preise in Italien denkt Goethe gelegentlich einmal nach. Die Tragödie - und das war sie für Goethe - ist scheinbar schon unter der Erde. Außerdem bieten sich, in Stuttgart besonders, auf passablem Niveau allerlei Gespräche an über Kunst und Kunstwerke, Themen, die ihm natürlich am allermeisten am Herzen liegen - und die ihm auch dadurch Genugtuung verschaffen, dass ihm von den verschiedenen Gesprächspartnern Resonanz und Beifall für seine inzwischen zu Dogmen gewordene Kunst-Meinung zuteil wird: hier ist er Lehrmeister - überall sonst auf der Reise ein ungewöhnlich intelligenter Schüler.
“Über den eigentlichen Zustand eines aufmerksam Reisenden habe ich eigene Erfahrungen gemacht und eingesehen, worin sehr oft der Fehler der Reisebeschreibungen liegt. Man mag sich stellen, wie man will, so sieht man auf der Reise die Sache nur von einer Seite und übereilt sich im Urteil; dagegen sieht man aber auch die Sache von dieser Seite lebhaft, und das Urteil ist in gewissem Sinne richtig. Ich habe mir daher Akten gemacht, worin ich alle Arten von öffentlichen Papieren, die mir jetzt begegnen: Zeitungen, Wochenblätter, Predigtauszüge, Verordnungen, Komödienzettel, Preiskourante, einheften lasse und sodann auch wohl das, was ich sehe und bemerke, als auch mein augenblickliches Urteil einschalte. Ich spreche nachher von diesen Dingen in Gesellschaft und bringe meine Meinung vor, da ich denn bald sehe, in wiefern ich gut unterrichtet bin, und in wiefern mein Urteil mit dem Urteil wohlunterrichteter Menschen übereintrifft. Sodann nehme ich die neue Erfahrung und Belehrung auch wieder zu den Akten . . . Wenn ich bei meinen Vorkenntnissen und meiner Geistesgeübtheit Lust behalte, dieses Handwerk eine Weile fortzusetzen, so kann ich eine große Masse zusammenbringen.”
Dies ein Glanzbeispiel der Sorgfalt und Eindringlichkeit Goethes. Er scheut keine Mühe, sich Wissen und Einblick zu verschaffen, dann, was er erfahren und wozu er eine eigene Meinung hat, einer vielfachen Kontrolle zu unterziehen - und die Systematik seines Vorgehens Schritt für Schritt zu dokumentieren. Das ist er sich und seinem Selbstbild schuldig. Es ist im übrigen typisch für Goethe, dass er das Gespräch sucht mit informierten Personen als seinen Informanten - sichtlich entschädigt ihn das für den Verzicht auf eine systematische Vertiefung und theoriebildende Auseinandersetzung. Das Gespräch macht ihm die “Empirie” erträglich, vielleicht sogar attraktiv. Mit Lust demonstriert er jedoch fast buchhalterisch genau seine inzwischen wohlerprobte Methode, ihre Vorteile und Erfolge. Sein Wortschatz hat etwas verblüffend Schulmäßiges: “aufmerksam” - “Fehler” - “richtig” - “wohlunterrichtet” - “gut unterrichtet” - “Erfahrung und Belehrung” - “Vorkenntnisse” - “Geistesgeübtheit”. Und vermutlich nicht zufällig taucht in diesem Passus der Begriff “Reisebeschreibungen” auf- und lässt vermuten, dass auch er auf dies Genre hinarbeitet, mit dem Bemühen, selbige in Schatten zu stellen, was ihm zweifellos triumphal gelungen wäre.
Gegen Ende seiner Reise ändert sich Goethes Einstellung bemerkenswert. Denn zuguterletzt glaubt er, das Reisen so souverän zu beherrschen, dass es ihm zum “Spiel”, wenn nicht gar zur Lotterie wird. Im klassizistischer Repertoir fehlt nicht der Begriff “Spiel”, “spielerisch”: als eine der Möglichkeiten vollkommen müheloser Perfektion, und genau diese Stufe glaubt Goethe jetzt erreicht zu haben:
“Überhaupt aber bin ich auf einer Idee, zu deren Ausführung mir nur noch ein wenig Gewohnheit mangelt; es würde nämlich nicht schwer werden, sich so einzurichten, dass man auf der Reise selbst mit Sammlung und Zufriedenheit arbeiten könnte; denn wenn sie zu gewissen Zeiten zerstreut, so führt sie uns zu andern desto schneller auf uns selbst zurück: der Mangel an äußern Verhältnissen und Verbindungen, ja die Langeweile ist demjenigen günatig, der manches zu verarbeiten hat. Die Reise gleicht einem Spiel: es ist immer Gewinn und Verlust dabey; man empfängt mehr oder weniger als man hofft, man kann ungestraft eine Weile hinschlendern, und dann ist man wieder genötigt, sich einen Augenblick zusammenzunehmen. Für Naturen wie die meine ist eine Reise unschätzbar: sie belebt, berichtigt, belehrt und bildet.”
Dies Zitat stammt aus einem Brief kurz vor der Rückreise. Sein Resümee muss man sich auf der Zunge zergehen lassen: für Naturen wie die seine sei eine Reise “unschätzbar”: “sie belebt, berichtigt” und - das ist nun wirklich das Credo des Klassizismus: sie “ belehrt und bildet “ - womit er dem Reisen das überhaupt höchste Prädikat zuspricht, das der Klassizismus zu vergeben hat: ihr Geschenk für den Reisenden ist “ Bildung “, “ Belehrung” - und das fast ohne Mühen für ihn; die Reise allein ist es, die “wenn sie zu gewissen Zeiten zerstreut, so führt sie uns zu andern desto schneller auf uns selbst zurück.” Jede moderne sogenannte “Bildungsreise” kann sich das Goethezitat in ihren Werbe-Prospekt setzen. Die Reise: seine Lehrmeisterin, mit deren Hilfe er während der Reise leben gelernt hat; vor allem aber hat er gelernt, nicht mehr unter ihr zu leiden. Dies aber, leiden vermeiden, ist auf allen Gebieten, im Leben wie in der Kunst, ein Hauptanliegen des Klassizismus - weshalb in der Kunst z.B. das Zeigen von Leiden zum Problem wird, sofern es ein Gesicht verzerrt, einen Körper entstellt. Die Schönheit darf nicht preisgegeben werden - um der Sinnhaftigkeit unsres Daseins willen, die sich in der Sinnhaftigkeit und Harmonie der schönen Künste spiegelt und keine Entstellung, kein Infragestellen, keine Deformation verträgt: ein Grundgesetz des Klassizismus. Das gilt auch für die Seele und ihren Ausdruck in Malerei und Bildhauerkunst. Und es gilt letztlich auch für die Vermeidbarkeit des Tragischen im menschlichen Schicksal. Deshalb muss auch diese Reise - was das Reisen als solches und was ihn selbst als Reisenden angeht - zuletzt mit einem erfolgreichen Abschluss enden. Wie anders ist sie zu Beginn in Frankfurt von Goethe gesehen worden:
“Hier möchte ich mich nun an ein großes Stadtleben wieder gewöhnen, mich gewöhnen, nicht mehr zu reisen, sondern auch auf der Reise zu leben. Wenn mir nur dieses vom Schicksal nicht ganz versagt ist! denn ich fühle recht gut, dass meine Natur nur nach Sammlung und Stimmung strebt und an allem keinen Genuss hat, was diese hindert. Hätte ich nicht an meinem Hermann und Dorothea ein Beyspiel, dass die modernen Gegenstände, in einem gewissen Sinne genommen, sich zum Epischen bequemten, so möchte ich von aller dieser empirischen Breite nichts mehr wissen.”
Sich wieder an ein großes Stadtleben gewöhnen - nicht mehr nur reisen -auch auf der Reise leben; das klingt alles eher nach dem Gegenteil von reisen, nach verweilen. Was er wirklich braucht, ist “Sammlung und Stimmung”, er kennt seine Natur, sie wird ihm nicht beides erlauben: sich sammeln und sich zerstreuen. Was also wäre dann letztlich für ihn der Sinn dieser Reise? Sein vor kurzem vollendetes und veröffentlichtes Epos “Hermann und Dorothea” hat er mitgenommen, einem ausgewählten Zuhörerkreis wird er es gelegentlich vorlesen. “Epos”, “Heldengedicht” - Homers Odyssee ist ein solches, ist das Urmodell aller Epen. “Hermanns” Vorgängerin, die “Luise” von Voss, ein bürgerliches Epos, ist also eigentlich eine contradictio in adjecto. Auch Goethes “Hermann” ist ein bürgerliches Epos, mit einem hochaktuellen, einem modernen Sujet: eine Gruppe von Flüchtlingen unterwegs in kriegserfüllter Jetzt-Zeit, nicht Helden, sondern Menschen wie du und ich, die sich jedoch in das aus der Antike überkommene heroische Schnittmuster eines epischen Gedichtes fügten, “in einem gewissen Sinne genommen sich zum Epischen bequemten.” Immerhin fühlte Goethe sich mit den “modernen Gegenständen” mindestens in diesem Augenblick ausgesöhnt, die er sonst grundsätzlich mit “aller dieser empirischen Breite” assoziiert, von der er “nichts mehr wissen möchte”. Nicht auszuschließen war immerhin, dass ihm auf der Reise nochmals ein moderner Stoff wie sein “Hermann” glücklich entgegen käme, oder auch nur ein einzelnes, genügend markantes, später vielleicht brauchbares Konterfei eines Charakters, den Goethe mit spürbarer Skepsis registriert:
“Unter anderem skizzierten sie einen Character, der wohl irgendwie zu brauchen wäre; ein schweigender allenfalls trocken humoristischer Mensch, der aber, wenn er erzählt und schwört, gewiß eine Lüge sagt, sie aber ohne Zweifel selbst glaubt.”
Mit dem sehr ausführlichen, mit seinen “englischen” Widersprüchen sehr eindrucksvollen Porträt des “Lord Bristol, Bischofs zu Derby”, im Tagebuch vom 8.Juni 1797 lässt sich der obige, nur hingestrichelte “saubere Umriß nach der Natur” freilich nicht vergleichen. Das praktisch am Vorabend seiner Reisevorbereitungen als Impression weniger Stunden entstandene Charakterbild des Lord Bristol hat Goethe später in seine Gesammelten Werke aufgenommen - vermutlich war es wohl ursprünglich unmittelbar im Hinblick auf seine bevorstehende Reise angefertigt worden, um auf der Reise als Modell für weitere Charakterskizzen zu dienen, die “das Unbedeutende und Unangenehme des Umgangs durch solche Schilderungen einigermaßen ersetzen” sollten - sprich: die ihm die Widrigkeiten der Begegnung mit anderen Reisenden durch ihre literarische Verwertbarkeit erträglicher gemacht hätten. Die Skizze hat sich später nicht nachweisbar verdichtet zu einem ausgeführten Porträt. Es gab überhaupt keine nennenswerte Ausbeute an derartigen Studien auf der Schweizerreise - was für die Überzahl angenehmer Begegnungen spricht. Weiterhin jedoch ist Goethe bemüht, das feine Sensorium seiner dichterischen Existenz zur “rohen Wirklichkeit” in Distanz zu halten. Ungefiltert, unveredelt bleibt sie für ihn unverwendbar - auch das eine Maxime, die Goethe seinem Klassizismus verdankt. Festzustehen scheint ihm: auf der Reise wird es kein Tun, keine Aktion, kein Arbeiten in seinem ureigenen Metier geben können.
Es wundert nicht, dass Goethe sich vornimmt, auf der ganzen Reise alles Poetische von vornherein zu meiden - womit er das Herzstück seiner Veranlagung, die Lyrik, versteht - und es klingt fast so, als wolle er sich ”das Poetische” durch die “rohe” Erfahrung der Wirklichkeit nicht entweihen lassen. Er drückt das mit einer Metapher in der Art jener poetischen Sprachgebilde aus, von denen sich noch einige weitere in der Schweizerreise finden - die dem Sprachzauberer Goethe sozusagen “herausgerutscht” sind.
“Für einen Reisenden geziemt sich ein skeptischer Realism; was noch idealistisch in mir ist, wird in einem Schatullchen, wohlverschlossen, mitgeführt, wie jenes Undenische Pygmäenweibchen”.
Fundstücke hütet er sorgfältig -:
“Ein paar poetische Stoffe bin ich schon gewahr geworden, die ich in einem feinen Herzen aufbewahren werde; und dann kann man niemals wissen, was sich aus der rohen Erfahrung in der Folgezeit noch als wahreres Gehalt aussondert.”
“Wenn man den Weg einmal ganz zurückgelegt hat, so kann man mit besserer Übersicht das Vorräthige immer wieder als Stoff gebrauchen.”
“Da in der Empirie fast alles einzeln unangenehm auf mich wirkt, so tut doch das Ganze sehr wohl, wenn man endlich zum Bewusstsein seiner eigenen Besonnenheit kommt.”
Goethe hat - so wie oben - Freunden wie Schiller oder Meyer und anderen - unzählige Male Einblick in seine Werkstatt, in seine Gedanken- und seine Gefühlswelt, in seine Stimmungen, in seine Philosophie gegeben. Auch verbirgt er Freunden nicht, wenn er einmal leidet an Welt und Menschen. Und offensichtlich erwartet er keine Resonanz - weder Beschwichtigung noch Aufmunterung. Es sind immer lapidare Sätze der Selbstbeschreibung, an denen es auch vonseiten eines Freundes nichts zu deuteln und zu beschönigen gibt. Manchmal könnte man denken, er führe gar keine Unterhaltung, sondern ein Selbstgespräch, währenddessen er mit sich selbst oder auch mit einem Problem ins Reine zu kommen versucht. Ist er ein Egomane? Oder braucht er einfach das Darüber-Sprechen, also das Gespräch, um kraft der Formulierung des Problems das Problem selber zu erfassen? Hält er es ähnlich wie Kleist mit seinem “Über das allmähliche Verfertigen der Gedanken beim Reden”? - nur ist es bei Goethe nicht bloß das Reden an sich, sondern er braucht die Wechselrede, den vertraulichen Dialog, das befreundete Gegenüber, die eingeübte Kommunikation, ganz besonders den Briefpartner, der schweigt. Vielleicht ist für ihn gerade deshalb der Briefwechsel mit Freunden und Vertrauten so wichtig: der Zuhörer existiert nur in der Vorstellung, kann den Gang der Gedanken nicht unterbrechen, dann aber lässt er in seiner Antwort das Gespräch wie eine Girlande weiterschwingen. Weniger aus den Tagebuch-Eintragungen, mehr aus Goethes Briefen erfährt man, wie ihm während der Reise zumute ist, wie sehr ihn “das Reisen” als solches beschäftigt, wie er sich zuweilen dagegen wehrt, wie er - gelegentlich ein Misanthrop - seiner Abneigung gegen die Menschheit freien Lauf lässt. Der Reiz dieser Reise liegt auch und manchmal besonders in den Briefen, weil sie zeigen, wie Goethe mit sich als ein Reisender herumexperimentiert, der auch im weiteren Verlauf der Reise lange nicht herausbekommt, ob er wirklich Befriedigung daran findet, ein solcher zu sein.
Zu Beginn seiner Reise, die so unbeschwert begann, schreibt er aus Frankfurt an Meyer in Stäfa:
“In der Lage, in der ich mich befinde, habe ich mir zugeschworen, an nichts mehr teilzunehmen als an dem, was ich so in der Gewalt habe wie ein Gedicht; wo man weiß, dass man zuletzt nur sich selbst zu tadeln oder zu loben hat; an einem Werk, an dem man, wenn der Plan einmal gut ist, nicht das Schicksal des Penelopeischen Schleiers erlebt. Denn leider in allen übrigen irdischen Dingen lösen Einem die Menschen gewöhnlich wieder auf, was man mir großer Sorgfalt gewoben hat, und das Leben gleicht jener beschwerlichen Art zu wallfahrten, wo man drei Schritte vor und zwei zurück tun muss.”
Sein Menschenbild, seine Lebenserfahrung: illusionslos. Schon als Meyer sich noch in Italien aufhielt, hat Goethe seiner Resignation und melancholischen Distanzierung zu Welt und Menschen hin und wieder freien Lauf gelassen. Wenn er in Frankfurt schreibt, er “überlege nun in einer ruhigen und heitern Wohnung, was es heißt, in meinen Jahren in die Welt zu gehen” stellt er nun auch sich selbst - desillusioniert - in Frage. Ist das derselbe Goethe, der noch vor wenigen Wochen nach Italien aufbrechen wollte, um dort ein weit strapaziöseres Unternehmen als die Schweizerreise in Gang zu bringen? Wandelt ihn in solchen Momenten eine Ahnung vom Verlust jener ihm sehr lange erhalten gebliebenen jugendlichen Schaffenskraft an, deren Schwung ihn noch hinüber nach Italien tragen sollte, und für die der Abschied von Italien etwas endgültig und unwiederbringlich Verlorenes bedeutet, eine Zäsur, die eine nur schwer heilbare Verlustangst hinterließ? Fühlt er sich im Stich gelassen von jener Zukunftsfähigkeit, die ihn über Jahre hinweg ein zeitlich fast nicht einzugrenzendes Unternehmen projektieren ließ, ohne dass er den ungeheuren, zu seiner Ausführung benötigten Kraftaufwand auch nur ein einziges Mal überdachte? und womit lässt das Vakuum seines zerstörten Plans - der ja seinem Umfang nach ein Stück Lebensplan war - sich schließlich auffüllen? Wenn Goethe sich auf dieser Reise in die Schweiz gewissermaßen “ausprobiert”, so schwankt er dabei wohl immer wieder zwischen der Alternative: ist “das Reisen” für ihn wirklich eine prinzipielle Erfahrung, ein existentielles Problem, - als ein geistiges Experiment überhaupt des Nachdenkens wert -oder würde er besser daran tun, zu resignieren: sich mit der “Illiberalität” abfinden, dass er fortan jene Freiheit nicht mehr besitzt, sich einen Plan wie den italienischen auch nur auszudenken - geschweige seine Realisierung zu betreiben. Es wird ihm wohl auch jetzt erst bewusst, dass er die Grenzen seines Handwerks weit überschritten hat, dass er jetzt klein beigeben muss - worüber er “einen um den andern Tag rasend werden” könnte. Bei einer solchen Gelegenheit lässt Goethe doch einmal spüren, dass im Kern seines Wesens, wenn auch eingehüllt von einer glänzenden klassizistischen Ummantelung, Melancholie wohnt, und manchmal auch Verzweiflung. Hilflosigkeit ist die Konsequenz aus ihrer beider - seiner wie Meyers - Erfahrung, dem Schicksal sei nichts abzuringen, was es nicht freiwillig herzugeben bereit ist. Meyer kann sich damit abfinden, er ist Lehrer an der Weimarer Akademie, kein Universalist, er bedarf der Mahnung Goethes nicht. Den Appell an Meyer richtet Goethe an sich selbst.
“Kommen Sie zurück, so wünschte ich, Sie könnten sich auf jede Weise zuschwören, dass Sie nur innerhalb einer bestimmten Fläche, ja ich möchte wohl sagen, innerhalb eines Rahmens, wo Sie ganz Herr und Meister sind, Ihre Kunst ausüben wollen. Zwar ist, ich gestehe es, ein solcher EntSchluss sehr illiberal, und nur Verzweiflung kann einen dazu bringen; aber es ist doch immer besser, ein- für allemal zu entsagen, als immer einmal einen um den andern Tag rasend zu werden. Was mich betrifft, so sehe ich immer mehr ein, dass jeder nur sein Handwerk ernsthaft treiben und das übrige alles lustig nehmen soll. Ein paar Verse, die ich zu machen habe, interessieren mich jetzt viel mehr als wichtigere Dinge, auf die mir kein EinFluss gestattet ist, und wenn ein Jeder das Gleiche tut, so wird es in der Stadt und im Hause wohl stehen.”
Für solche Stichworte seines Ausbruchs: “illiberal” - “Verzweiflung” - “ein für allemal zu entsagen” - “rasend werden” - gibt es zu diesem Zeitpunkt von Tag und Stunde dem Anschein nach noch keinen konkreten Anlaß. Und doch: “Verzweiflung” allein hat ihn zu seinem “illiberalen”, seinem erzwungenen Entschluss bringen können, sich nur auf das zu beschränken, worüber er “ganz Herr und Meister” ist wie über ein paar Verse. Vielleicht steckt in seiner Verzweiflung auch Enttäuschung, dass - außer Meyer- niemand aus seinem Freundeskreis wirklich den Kummer über die gescheiterte Italien-Mission mit ihm teilt. Und er wäre doch wirklich der Sendbote einer großen, einer fast säkularen Idee gewesen! Er mag auch wohl ahnen, dass es gerade seine Freunde waren, die seine Italien-Ideen für eine Grenzüberschreitung hielten, ja, dass sie eher für seine eigentliche Berufung fürchteten, als für seine hochfliegenden Pläne hofften. Für einen Kopf von der unglaublichen Vielseitigkeit Goethes, der - während er die Italienische Reise vorbereitete - unter anderem “nebenher” Cellinis Lebensbeschreibung aus dem Italienischen übersetzte, zusammen mit Schiller die frechen “Xenien” verfasste, eine Anzahl wunderbarer Balladen und außerdem fast in Windeseile das Epos “Hermann und Dorothea” schrieb - und der gleichzeitig eine mirakulöse Menge von Literatur über Kunst und Künstler, Architektur, Botanik, Geografie, Geologie, Geschichte Italiens rezipierte - für den muss das peinliche Desinteresse seiner Umwelt, ihr unausgesprochenes “Schuster, bleib bei deinem Leisten” enttäuschend, demütigend gewesen sein. Vielleicht hat ihm das Vorgefühl des in Bälde langsam sich einschleichenden Alters und der ihm damit zuwachsenden Würde geholfen, “ein- für allemal” dem zu entsagen., was ihm vom Schicksal ver-sagt worden ist. Auch eine Genugtuung ist ihm ohne Zweifel die im Verlauf der Reise gewonnene Perfektion seiner Methode, ohne die er sich “gar übel befinden” würde. Seine Methode: ein technisches Hilfsmittel, das schon beinahe zur Lebenshilfe mutiert, das Schema - in seiner reifsten Form ein Beinahe-Kunstwerk.
“In früherer Zeit imponieren und verwirren uns die Gegenstände mehr, weil wir sie nicht beurteilen noch zusammenfassen können, aber wir werden doch mit ihnen leichter fertig, weil wir nur aufnehmen, was in unserem Wege liegt, und rechts und links wenig achten. Später kennen wir die Dinge mehr, es interessiert uns deren eine größere Anzahl, und wir würden uns gar übel befinden, wenn uns nicht Gemütsruhe und Methode zuhilfe kämen.”
“Bey dem allem leugne ich nicht, dass mich mehrmals eine Sehnsucht nach dem Saalgrunde wieder angewandelt und würde ich heute dahin versetzt, so würde ich gleich, ohne irgendeinen Rückblick, etwa meinen Faust oder sonst ein poetisches Werk anfangen können.”
Die Reise - er würde ihr nicht nachweinen, “ohne irgendeinen Rückblick” daheim “ein poetisches Werk anfangen”, sich in Weimar an irgendeine Arbeit machen; es würde sich jedoch so leicht wohl gar nichts finden, auch der Faust bleibt nach der tatsächlichen Rückkehr - obgleich Schiller ständig mahnte -vorerst liegen. Wie sich zeigen wird, hat sich das vom Ialien-Plan hinterlassene Vakuum so rasch nicht aufgefüllt. Vielleicht ist das einzige, was ihm im Augenblick über einen gewissen Tiefpunkt hinweghilft, sein hohes, exklusives Bildungsideal. Vermutlich wurde Goethe eher von einem vorübergehenden Fluchtrefiex heimgesucht, der sich in einem Gedankenspiel Luft machte - und nichts weiter. Aber ganz so unwichtig sind solche kleinen Splitter nun doch nicht, denn sie beweisen, dass bei allem Bildungsoptimismus, ja, aller Bildungseuphorie die Seele hungern kann und dass das wehtut, auch wenn Goethe immer aufs neue den Höhenweg der Bildung einschlägt und von den Wissenschaften zur Weisheit seinen “lieben Landsleuten” voranschreitet:
“Wer in dem immer fortdauernden Streben begriffen ist, die Sachen in sich und nicht, wie unsere lieben Landsleute, sich nur in den Sachen zu sehen, der muss immer vorwärts kommen, indem er seine Kenntnisfähigkeit vermehrt und mehrere und bessere Dinge in sich aufnehmen kann.”
Der schulbuchmäßige Lehrsatz zeigt nur, wie steif der Klassizismus daherkommt, wenn ihm einmal für eine Weile das Feuer der Begeisterung verglüht; ein vertrockneter Moralismus sucht ihn heim, ein “immer fortdauerndes Streben” treibt ihn an, seine “Kenntnisfähigkeit” zu vermehren, “mehrere und bessere Dinge in sich aufzunehmen”, “immer vorwärts” zu kommen. Dazu noch ein Seitenhieb gegen seine “lieben Landsleute”. Vielleicht weiß Goethe sich in diesem Moment nicht anders gegen seinen Fluchtreflex zu helfen, als mit dieser dürren und pedantischen Aufzählung. Nicht immer sind seine Methode, sein Schema die Zaubermittel, die ihm diese Reise und die ungeliebte “ganze Breite der Empirie” schmackhaft machen. Noch hat Goethe dies so sorgfältig ausgearbeitete Schema nicht an großen Objekten ausprobiert, an Landschaft und Städten.
Woraus besteht Goethes Schema nun also? Es ist eine Tabelle und es ist mehr als eine Tabelle. Es ist eine Gedächtnishilfe, um zum Beispiel eine Naturlandschaft oder eine Stadtlandschaft systematisch abzufragen. Wenn ein solches Schema zur Kunst tendiert, ist es mehr als eine Gedächtnishilfe. Seine Kunst-Ähnlichkeit besteht aus der Auswahl der einzelnen Komponenten und ihrer Zuordnung zueinander - ein Bauplan, der einen lebendigen Organismus erkennen lässt, der sich aus den einzelnen Gliedern als harmonische Ordnung eines übereinstimmenden Ganzen darstellt - ein Konzept, das Ordnung als solche zum Idealzustand macht. Das Schema einer Landschaft ist das tabellarische Muster einer abstrakten idealtypischen Landschaft, zerlegt in sämtliche für eine Landschaft typischen Einzelteile, in die naturgegebenen Bauteile ihrer Architektur: geordnet nach ihren Waagrechten, Senkrechten, Diagonalen, ihren Strukturen, ihrem Rhythmus, nach Unbeweglichem, Beweglichem, nach Himmelsrichtungen, Einflüssen der Jahreszeiten etc. Nach den jeweiligen genormten Spalten werden die Variablen ermittelt, so hat jede reale in der idealen Landschaft eines Schemas ihre individuelle Entsprechung. Das Landschafts-Schema, die tabellarische Darstellung einer abstrakten, idealtypischen Landschaft, ist also ein allgemeingültiges graphisches Muster, welches versucht, der Gliederung, der individuellen Architektur, der Singularität einer realen Landschaft mithilfe der Normen einer idealen Landschaft zum Ausdruck zu verhelfen, - wie sie gerade noch zu jenem Zeitpunkt, kurz vor Anbruch des Industriezeitalters in Europa möglich gewesen ist.
Die Einengung, die jede Verstofflichung und Kategorisierung eines Objektes mit sich bringt, wird durch die innere Freiheit, die Ordnung durch Gliederung, die das ideale Schema verleiht, kompensiert. Die Denk-Arbeit, die zur Herstellung eines solchen Schemas aufgewendet wurde, drückt das Schema unmittelbar aus - die mechanische Funktion der Gedächtnishilfe wird von der ideellen Funktion, von der Evidenz der Idealität seiner graphischen Figur, weit übertroffen.
4 Im Jahzehnt zwischen 1790 und 18oo unternahm Goethe folgende größere Reisen: 179o: G. erwartet die Herzoginmutter Anna Amalia am Ende ihrer Italienreise in Venedig und begleitet sie zurück nach Weimar. 179o, Reise nach Schlesien, Krakau, Riesengebirge 1792, Campagne in Frankreich. 1793, Belagerung von Mainz.
5 In seinen Annalen oder Tag und Jahresheften schreibt Goethe für 1789: “Gleich nach meiner Rückkehr aus Italien machte mir eine andere Arbeit viel Vergnügen. Seit Sterne’s unnachahmliche sentimentale Reise den Ton gegeben und Nachahmer geweckt, waren Reisebeschreibungen fast durchgängig den Gefühlen und Ansichten des Reisenden gewidmet. Ich dagegen hatte die Maxime ergriffen, mich so viel als möglich zu verleugnen und das Objekt so rein, als nur zu tun wäre, in mich aufzunehmen. Diesen Grundsatz befolgte ich getreulich, als ich dem Römischen Karneval beiwohnte ...“
6 Unter “Biographische Einzelheiten” veröffentlichte Goethe später in seinen Gesammelten Werken folgenden Abschnitt: “LORD BRISTOL, BISCHOF ZU DERBY. Etwa dreiundsechzig Jahre alt, mittlerer, eher kleiner Statur, von feiner Körper- und Gesichtsbildung, lebhaft in Bewegungen und Betragen, im Gespräch schnell, rauh, eher mitunter grob; in mehr als einem Sinne einseitig beschränkt; als Brite starr, als Individuum eigensinnig, als Geistlicher streng, als Gelehrter pedantisch. Rechtschaffenheit, Eifer für das Gute und dessen unmittelbares Wirken sieht überall durch das Unangenehme jener Eigenschaften, wird auch balanciert durch große Welt-, Menschen- und Bücherkenntnis, durch Liberalität eines vornehmen, durch Aisance eines reichen Mannes. So heftig er auch spricht und weder allgemeine noch besondere Verhältnisse schont, so hört er doch sehr genau auf Alles, was gesprochen wird, sei es für oder gegen ihn; gibt bald nach, wenn man ihm widerspricht; widerspricht, wenn ihm ein Argument nicht gefällt, das man ihm zu Gunsten aufstellt; lässt bald einen Satz fallen, bald fasst er einen andern an, indem er ein paar Hauptideen gerade durchsetzt ... Er will nur gelten lassen, was das klare Bewusstsein des Verstandes anerkennen mag, und doch lässt sich im Streite bemerken, dass er viel zarterer Ansichten fähig ist, als er sich selbst gesteht. Übrigens scheint sein Betragen nachlässig, aber angenehm, höflich und zuvorkommend. So ist’s ungefähr, wie ich diesen merkwürdigen Mann, für und gegen den ich so viel gehört, in einer Abendstunde gesehen habe . Jena, den 10.Juni 1797.”
“Die Idee geht aller Erfahrung voraus”
Das Schema, - eine Denk-Übung, die nicht wörtlich zu nehmen, sondern stets anzupassen ist an das jeweilige Objekt, in der Ausführung variabel, und immer zu Abweichungen vom Idealfall gezwungen. Als Gedankenbild hat es im Auge Goethes weitergewirkt, ihm den Überblick erleichtert. Sein Modell einer Ideal-Stadt hat jedes Städtebild dieser Reise mitgeprägt - mit seiner jedem anderen Gesichtspunkt übergeordneten Idee der Urbanität, der Grundidee der Stadt schlechthin. Sie allein drückt das absolute Primat der Stadt aus, ja, berechtigt überhaupt erst dazu - kraft ihrer Wesenhaftigkeit, ihrer Persönlichkeit, ihrer vielfachen Potentiale, ihrer architektonischen Hervorbringungen, ihrer Bedeutung in der Geschichte, ihrer seit Jahrhunderten entwickelten Rechte und Pflichten, ihrer bürgerschaftlichen Selbstverwaltung, ihrer stolzen Stadtregierung, ihrer Organe und Organisationen, ihrer Steuerhoheit, ihrer niedern und hohen Gerichtsbarkeit, ihrer Produktivität - und nicht zuletzt kraft ihrer Wurzeln in der Antike: der Vielzahl all jener Eigenschaften, die die Stadt abheben von allen anderen denkbaren, ihr nachgeordneten Wohnstätten und Siedlungen, - und die Stadt wiederum gleichsetzen nur mit ihresgleichen. Obwohl das Schema im Text der Schweizerreise nicht als Muster “zitiert” wird, nicht als “Gebrauchsanweisung” in Erscheinung tritt, sondern unsichtbares Hilfsmittel bleibt, lassen Goethes Städtebilder seine Struktur, sein durchdachtes Raster ahnen, seine Wertordnung, - und den zentralen Bezugspunkt, der diese Wertordnung legitimiert. Denn erst eine übergeordnete Idee kann die Priorität der Stadt rechtfertigen, dem Schema einen Sinn wie einen Stempel aufdrücken, der sich dann auch dem späteren Städtebild deutlich erkennbar vermittelt. Damit wird im Idealfall ein Schema generiert nach einem dem jeweiligen Gegenstand - der Stadt - immanenten Ordnungsprinzip, das scheinbar diesem Objekt selber entstammt und ihm nicht etwa aufgepfropft wurde: nach Maßgabe menschlicher Denkformen hebt sich die Idee des Gegenstandes aus dem Gegenstand selbst heraus. Dass dies allerdings ein Irrtum ist, macht Goethe sich am sinnfälligen Beispiel der Kunst deutlich7.
Was der Bildhauer vollzieht, wenn er eine von ihm erdachte Form auf den Stein überträgt, bzw. “aus ihm herausholt”, das führt der Betrachtende und Denkende auf seine Weise aus, wenn er mit seiner spezifischen Art des Denkens die Beschaffenheit, das Wesen einer Sache, einer Gegebenheit, einer Gegenstandes - von Personen oder Dingen - ableitet.
Goethe beruft sich dabei auf zwei aristotelische Grundgedanken.8
Einmal: Die Idee geht aller Erfahrung voraus - somit auch jeder Deutung und Wesensbestimmung. Das bedeutet aber nichts anderes, als dass Goethe weiß, wissen muss: die Idee wächst nicht aus der Sache heraus, sondern sie wird in die Sache hinein gelegt - von ihm selbst. Sein Bild der Stadt ist demzufolge mehr ein Dokument seiner Gesinnung, als ein Produkt seiner Erfahrung. Zum zweiten: die Idee in ihrer Reinheit ist weder darstell- noch fassbar, eine für Goethe bittere Einsicht: Auch das Schema selber - so rein in seiner Struktur es die Idee der Stadt darzustellen vorgibt - kann sie nicht vollständig verkörpern und erst recht wird sich diese Idee nicht im Erscheinungsbild einer realen Stadt manifestieren.
Die allmählich sich ausprägende, verbindliche Ideal-Struktur des Schemas ist also ein Abbild Goethe´schen Bemühens, sinnliche Erscheinung in eine “gereinigte” Begrifflichkeit umzuformen, die Individualität der einzelnen Erscheinungen einer schematisierten Typologie unterzuordnen, die Idee eines Gegenstandes seiner konkreten Gestalt vorauszubilden. Immer wird ihn hernach der reale Gegenstand in der Unvollkommenheit seiner Erscheinung zur Resignation zwingen.9
Die höchste Form der Resignation, die sich an den Grenzen der Erkenntnisfähigkeit angelangt sieht, wird den Gegenstand ganz zu vergeistigen suchen - sich also aus den Schranken der Empirie einen Ausweg ersinnen. Dem entspricht eine Maxime Goethes:
“Es gibt eine zarte Empirie, die sich mit dem Gegenstand innigst identisch macht und dadurch zur eigentlichen Theorie wird. Diese Steigerung des geistigen Vermögens aber gehört einer hochgebildeten Zeit an.”
Wieder die beiden Stichworte des Goethe‘schen Klassizismus: “Theorie” und “hochgebildet”, die hier als Geistesverwandte auftreten. Entsprechendes formuliert Goethe gegen Ende der Schweizerreise - wobei er letztendlich in der Übereinstimmung von Empirie und Theorie auch den Zusammenfall von Idee und Wirklichkeit so gut wie postuliert:
“Man erfährt wieder bei dieser Gelegenheit, dass eine vollständige Erfahrung die Theorie in sich enthalten muss.”
Das Schema verkörpert auf vollkommene Weise jenen Ort, wo eine “zarte Empirie” in sich selbst zur “eigentlichen Theorie” wird. Ja, innerhalb dieses Begriffsraumes ist es seinem Wesen und seiner Bedeutung nach überhaupt erst richtig zu bestimmen. Deutlich strebt es zur Idealität, ist sublimierte Form Goethe´scher Erkenntnis: es gliedert, ordnet, reiht und klassifiziert die Ergebnisse einer schöpferischen Anschauungskraft.
In seiner nur scheinbaren additiven Beschaffenheit leistet es als vorgeformtes Strukturbild sowohl analytische wie synthetische Vorarbeit.
Über diese hohe geistige, aber immer noch zweckgebundene Funktion hinaus stellt das Schema als selbständige Gestalt einen idealen, formal völlig ausgereiften Gegenstand dar und erreicht damit den höchsten erreichbaren Grad der schöpferischen Genugtuung für Goethe.
Demnach wird das Schema allen Forderungen genügen müssen, die an ein Kunstwerk gestellt werden: Inhalt, Gehalt und Form sollen untereinander im Einklang stehen - d.h. es muss ein stoffliches Interesse und einen idellen wie formalen Anspruch in seiner wenn auch chiffrenartigen Sprache voll befriedigen können.