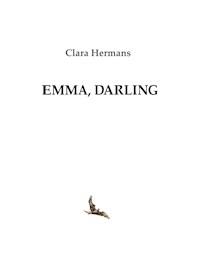
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Makel haftete Emma an. Vaterlos, mutterlos wuchs sie bei der Großmutter auf. Eine Schein-Waise. Beim vornehmen Stuttgarter Damen-Zirkel – vorwiegend Gattinnen verblichener Honoratioren, ehemals namhafter Vorstände aus Industrie, Wirtschaft und Handel – hatte die Oma, herbe Witwe eines Schulrats, eines vergleichsweise armen Schluckers, nur mehr geduldeten Zutritt. Von Mal zu Mal musste sie ihren Ausschluss befürchten, ihrer desolaten Familienverhältnisse wegen. Es wurde natürlich gemunkelt über die uneheliche kleine Enkelin. Wie gewissenlos musste eine Mutter sein, die ihr eigenes Kind im Stich ließ? Diese Person – mit wem und wo lebte sie? In der Pariser Halbwelt? So gern man mehr über sie gewusst hätte, es war nichts weiter über sie zu erfahren, außer: ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 271
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Raymund meinen herzlichen Dank
Ein Makel haftete Emma an.
Vaterlos, mutterlos wuchs sie bei der Großmutter auf. Eine Schein-Waise.
Beim vornehmen Stuttgarter Damen-Zirkel – vorwiegend Gattinnen verblichener Honoratioren, ehemals namhafter Vorstände aus Industrie, Wirtschaft und Handel – hatte die Oma, herbe Witwe eines Schulrats, eines vergleichsweise armen Schluckers, nur mehr geduldeten Zutritt. Von Mal zu Mal musste sie ihren Ausschluss befürchten, ihrer desolaten Familienverhältnisse wegen. Es wurde natürlich gemunkelt über die uneheliche kleine Enkelin. Wie gewissenlos musste eine Mutter sein, die ihr eigenes Kind im Stich ließ? Diese Person – mit wem und wo lebte sie? In der Pariser Halbwelt? So gern man mehr über sie gewusst hätte, es war nichts weiter über sie zu erfahren, außer: sie war der Großmutter missratene einzige Tochter. Was war aus ihr geworden, dort in Paris? Eine Künstlerin? Ein Luder? Man befürchtete – (hoffte mit Genuss) – das Letztere. Paris eben!
Zum Auftakt der allmonatlichen Kaffeetafel erging sich jedes Mal ein Grüppenen da, ein Grüppchen dort wohlig in allerlei Mutmaßungen, solange die Großmama noch auf sich warten ließ. Sobald sie eintrat, verstummte man. Die Betroffene gab sich dann, als merke sie die peinliche Pause nicht.
Mehr, viel mehr litt im Verborgenen Emma. Aber wer wie sie am Rand stand, woher sollte das zehn-, elfjährige Kind die Kraft nehmen, dem Getuschel, der Häme diverser Mitschülerinnen, der bösartigen Nachrede zugehöriger Eltern die Stirn zu bieten, die Schandmäuler mit Verachtung zu strafen? Irgendwann suchte sie sich verzweifelt eine Zuflucht. Ein Etwas, das Emmas ferner Mutter – einem Strahlenkranz gleich – den Anschein einer ganz und gar außergewöhnlichen Mama verlieh?
Das Wunder ereignete sich in der Schule. Im gleichen Augenblick, wo im Kunstunterricht Abbildungen von Aphrodite und Nofretete miteinander verglichen wurden, hatte Emma, was sie suchte, gefunden! Was war den beiden gemeinsam, hob die von ihrem Makel Gezeichneten weit über alle makellos Schönen hinaus? Ihre Fehler! Der Armstumpf der griechischen Göttin, der ägyptischen Nofretete blickloses Auge! Litt ihre Schönheit darunter? Nein! Ein geheimnisvoller Zauber ließ ihre Schönheit noch schöner erscheinen – ihre Entstellung machte sie einzigartig. Verlieh ihnen eine Aura.
Emmas Mutter fehlte kein Arm und kein Auge, sie selbst fehlte. Kam dieser von ihrem Nichtvorhandensein entstellten Mutter nicht eine ähnliche, rätselhaftunerklärbare Ausstrahlung zu, kraft ihrer Beschädigung – ihrer Abwesenheit?
Von jetzt an fühlte sich das einsame Kind der imaginierten Mutter aufs Innigste verbunden. Obgleich Emma weder jetzt noch jemals später ein Lebenszeichen von ihr erhielt. Es wurde ihre nachhaltigste Kindheits-Erfahrung: sie hatte der schnöden Wirklichkeit eine Wunsch-Mutter abgetrotzt, ein tröstliches Phantom, das ihr aus weiter Ferne – allein mittels Emmas glühender Vorstellungskraft – einen wundersamen Abglanz verlieh.
Es rechtfertigte zugleich wohltuend die schmerzlich Vermisste, reinigte die Weitentfernte von allen Vorwürfen, die die Großmama unentwegt hasserfüllt gegen die eigene Tochter erhob. Sie konnten dieser schönen, sich – wer weiß? – vielleicht doch liebevoll-zärtlich nach ihrem Kind sehnenden, eingebildeten Mama niemals mehr etwas anhaben. Ein unendlich warmer Strom mütterlicher Zuneigung ging künftig von ihr aus.
Von klein auf war Emma eingebläut worden:
“Wenn du nach deiner Mama gefragt wirst, sag’, sie ist tot!”
“Ist sie wirklich tot, Oma?”
“Ich weiß es nicht – und ich will es auch gar nicht wissen. Für uns, für mich und für dich, ist sie gestorben, egal, ob sie noch lebt.”
“Ich will aber auch eine Mama, wie alle Kinder! Warum habe nur ich keine richtige Mutter?”
“Das frag’ ich mich auch, und das würde ich sie gern selber fragen – diese gewissenlose Person!”
“Warum bist du so böse auf sie?”
“Wenn du’s genau wissen willst, weil sie mir dich aufgehalst hat – und ich kann sehen, wie ich dich großziehe und dabei auf alles verzichte, was mir in meinem Alter zusteht. Mein Ansehen hat sie zerstört, zum Gespött hat sie mich gemacht.”
“Magst du mich gar nicht? Ich hab’ dich doch auch lieb, Oma!”
“Ach, hör auf mit dem Geschmuse.”
Die unbekannte Mutter – lange Zeit eine Katastrophe für Emma. Jetzt aber diese Magie, dieser Inbegriff von Zuwendung! Viele Jahre später würde Emma ihre unbekannte Mutter in den Tod begleiten. Nicht aus weiter Ferne – nur ein paar Schritte von ihr entfernt – noch immer nicht wirklich nah – und doch nah genug: kraft ihrer unbesiegbaren Vorstellungsgabe.
Dank dem Schutz und Schirm einer majestätischen Großtante namens Emma, die von ihrem Wohnsitz Bietigheim aus mit ständigen Anrufen, regelmäßigen Kontrollbesuchen und Anweisungen ihre Cousine, die Stuttgarter Großmutter, mit imperativen Geboten in Schach hielt, verbrachte ihre Großnichte Emma eine sorglose Schulzeit, überstand die Pubertät und wurde erwachsen. Kurz nach ihrem Abitur starb in hohem Alter die geliebte Großtante, wenig später, von Emma ein Gutteil weniger betrauert, auch die Oma; sie ließen Emma einsam und ratlos zurück.
Auf seltsame Weise missglückte ihr dann – unverschuldet – der ohnehin zögernde Studienbeginn. Außer sich vor Entsetzen, verstört, floh sie von ihrem Studienort Freiburg im Süden nach Hamburg im Norden. Dort zerbrach sie sich erst recht den Kopf:
“Was will ich hier? Wie komme ich ausgerechnet auf Jura? Wo ich doch weder dafür noch für sonst etwas Talent habe? Warum studiere ich überhaupt?” Sie begann, sich in Träumen zu verlieren. War nahe daran, sich von einem jungen Jura-Professor verführen zu lassen. Er bot Studienanfängern Beratung an unter dem Motto: “Studiert Jura nicht der Karriere wegen, sondern nur, weil ihr Lust dazu habt!” Lange warb er um sie, letztlich erfolglos. Sie war tief in den Gedanken verstrickt: ein jeder Mensch sollte unbedingt einen Lebensplan haben. Aber wo nahm man den her? Ja, wenn man eine wirkliche Begabung besaß, sich irgend einer Sache mit Leidenschaft hingab – dann war es einfach. Wer Schauspieler, Schriftsteller, Politiker, wer Künstler, Fußballspieler, Soldat, ja, wer Gärtner werden wollte, oder auch nur Millionär – das waren strikt vorgegebene Ziele. Diesen Glücklichen hatte eine gute Fee ihre Gaben verliehen und sie machten Gebrauch davon. Emma jedoch besaß nichts dergleichen. Sicher, sie hatte ein anständiges Abitur gemacht. Aber wofür eigentlich?
So überstand sie lustlos und wenig erfolgreich die Klausuren des Wintersemesters, nach wie vor von Ole, dem Jura-Professor vergeblich umworben, der immer wieder versuchte, ihr ein Interesse für sein Fach einzuflößen.
Zu Beginn des Sommersemesters gestand sie sich endlich ein: ich vergeude hier meine Zeit – ich vergeude mich selbst. Ich will nicht länger studieren, eh ich nicht weiß: Was aus mir werden soll.
In ein übriggebliebenes leeres Schulheft begann sie alsbald zu schreiben:
Also gut: wie stelle ich mir meine Zukunft vor? Ja, wenn ich das wüßte!
Einen Platz finden im Leben – wie geht das? Ich weiß ja nicht einmal genau: wer bin ich? Welche Gene stecken in mir? Was fehlt? Was kann ich mir zutrauen, was muss ich befürchten?
Schon stockte der Schreibfluss. Immer noch geisterte manchmal die Mutter durch ihre Gedanken. Ließ ihr keine Ruhe. So schön, wie sie sich einst ihr Bild ausgemalt hatte, ließ es sich nun doch nicht mehr an. Zweifel stellten sich ein: ihr Kind behalten, es großziehen – wäre das so schwierig, so unzumutbar für sie gewesen? Oder war ihr das Kind einfach nur lästig, unbequem, ein Klotz am Bein?
Wie bin ich entstanden? Beiläufig? anlässlich eines mehr oder weniger lustvollen? einmaligen? zufälligen? gewohnheitsmäßigen Beischlafs? hinter der Bühne? in einer Besenkammer? in einer Absteige? einem Stundenhotel? Bin ich ein Kind der Liebe – oder bloß ein Unfall? Vielleicht versäumte meine Mutter nur das gebotene Datum, während dem sie mich wegmachen durfte? Hat mich also ein kalendarisches Versehen, ein Rechenfehler gerettet? Oder wollte mich meine Mutter eben doch bei sich behalten?
Selbst nach der Geburt hätten sich immer noch Mittel und Wege gefunden, ein vaterloses Kind irgendwie, irgendwo in Paris loszuwerden. Vielleicht anonym, als Findelkind, in einem Pariser Waisenhaus? Vielleicht freigegeben zur Adoption? Stattdessen hatte sie es fortgebracht! Hunderte Kilometer weit weg! Von Paris nach Stuttgart! Gab es eine Gefahr für dieses Kind?
Angeblich war meine Mutter Tänzerin im Ballett des Pariser Kabaretts Moulin Rouge. Kein erstklassiges Etablissement! Für die Oma natürlich ein Skandal. Für mich, als ich es erfuhr, faszinierend, glamourös!
Hatte ein Bewunderer von Rang und Namen ihre Mutter verführt, der sich dann von diesem winzigen Menschlein gesellschaftlich bedroht sah? Oder kam der Kindsvater aus einem Milieu von ganz unten, wo man nicht zurückschreckt vor krimineller Selbsthilfe? Bot die Obhut einer weit entfernten schwäbischen Großmutter wenn auch kein liebevolles, so doch ein sicheres Asyl für ihr Kind?
Sie muss mich eben doch geliebt haben – warum sonst hätte sie mich in das ferne Stuttgart gebracht?
Ihre zu keinem Erbarmen fähige Mutter musste ihr als einzige Zuflucht erschienen sein.
Ihr legte die Tochter das winzige, neugeborene Bündel Mensch auf den Wohnzimmertisch, ertrug stumm den wütenden, mütterlichen Protest, drehte sich um und verschwand.
Nie schickte sie mir aus Paris auch nur das geringste Lebenszeichen. Unsagbar, verzweifelt habe ich mich nach dieser verschwundenen Mutter gesehnt. Ich war zwölf, als ich sie mir in meiner Sehnsucht erfunden, erdichtet habe. Von da an hatte auch ich eine Mama.
Aber niemals war diese Mama auch nur vage für sie sichtbar geworden. Es war dem Kind auch durchaus bewusst: das wäre bestenfalls Sinnestäuschung gewesen.
Aber was blieb Emma anderes übrig, als weiterhin auf ihre Erscheinung, ein Wunder! zu hoffen – wo es von der so innig Ersehnten kein einziges Foto gab? Alles hatte die Oma vernichtet, was sie an ihre mißratene Tochter erinnerte. Sogar ihren Vornamen – angeblich hatte sie ihn vergessen – gab sie der Enkelin nur auf Emmas flehentliche Bitten preis.
Immerzu hoffte ich, die Mama erscheine mir einmal – vielleicht nur als zarter Umriss, kaum wahrnehmbar und gleich wieder verlöschend, eine Schattengestalt – ein einziges Mal nur. Aber wie die Knospe einer überaus kostbaren Pflanze, die sich in ihren Deckblättern verbirgt und niemals zum Blühen entfaltet, so hüllte sich meine Mutter in ihre geheimnisvolle Unsicht- und Unnahbarkeit ein.
Enttäuscht spannte damals die Zwölfjährige eine imaginäre Leinwand auf, nein, behalf sich mit einem Schul-Zeichenblock und versuchte, ohne das geringste Mal- oder Zeichentalent, darauf ein vages Abbild der Mutter zu projizieren. War die Mama groß, klein, hatte sie blaue, hatte sie braune Augen? Emma bekam keine Antwort auf diese Fragen, aber auf rätselhafte Weise wurde die Unsichtbare auf einmal wenigstens hörbar.
Ein paar Tage lang hatte ich mich heimlich in ein altes Französisch-Lehrbuch der Oma vertieft, ein paar Wörter herausgelesen. Dann versuchte ich, nach Anweisung der Lautschrift ein französisches “bitte” korrekt auszusprechen – brachte ein zaghaftes “S’il vous plaît, Mama!” heraus. Vielleicht verstand die Mama inzwischen nur noch Französisch?
Mir stockte der Atem. Ganz nah (oder doch von weither?) vernahm ich ein sanftes “Emma, ma chère!” – oder glaubte ich nur, es zu vernehmen? Macht das einen Unterschied?
Von da an war ich nur noch Ohr, nichts als Ohr.
Und die Mama war Stimme, nichts als Stimme. Die aber blühte immer mehr in mir auf – klang oft wie Musik. Konnte jedoch auch streng sein. Mahnen.
Auf wunderbare Weise hat mir diese eingebildete Mutter dann jahrelang Beistand geleistet. Hat Tag für Tag mich begleitet. Wenn ich Kummer hatte, mir die Tränen weggeflüstert. Wenn ich frech zur Oma war, mich zur Rede gestellt. Und wenn die Oma schimpfte, gebot sie: “Schweig, Emma!” Sie sorgte tausend Sorgen, freute tausend Freuden mit mir. Mein Schutzengel – meine Mama.
Die Mama, die ich mir herbeigedacht und -gesehnt habe, ein Gaukelspiel soll das gewesen sein? Einbildung? Nichts als eine schöne Illusion?
Nein! Es war Nothilfe! Lebensrettend! Stärker als alle Wirklichkeit!
Ich hatte in meiner Verlassenheit wahrhaftig herausgefunden, wie ich eine Unsichtbare, die ich verzweifelt zum Überleben brauchte, festhalten konnte. Dass ich sie hereinnehmen musste in mein Aller-Innerstes, bis sie ganz tief in mir drin war. Dann wuchsen wir beide zusammen, und bald wusste ich nicht mehr: wer redet, wer schweigt? Wer frägt? Wer antwortet? Die Mama? Ich?
Ein paar Jahre ging das so hin, bis weit in die Pubertät. Nicht ich, wie vor der Geburt, war das Kind in ihrem Leib, sie hat in mir gewohnt. Ein gegenseitiges Ineinander - eine Umkehr der Natur.
Als nach einigen Jahren die Mama ganz sachte zu entschwinden begann, leiser und immer leiser wurde, fast unhörbar zuletzt, da habe ich nicht versucht, sie festzuhalten.
Ich ließ sie gehen – zurück, ins ferne Paris.
Als reale Schutzmacht wirkte von Anfang an die mächtige Großtante Emma von Bietigheim aus. Sie nahm das mutter- und vaterlose Kind sofort an ihr Herz. Nur leider: sie musste das Kind wohl oder übel dem ewigen Zetern der Oma, ihrer Cousine überlassen.
Nicht ihre, deine Ziehtochter, geliebte Tante Emma, bin ich gewesen. Hast für eine sorglose Kindheit und Schulzeit gesorgt. Mich die ganzen Jahre, über die Distanz Bietigheim-Stuttgart hinweg, aufs Liebevollste behütet. Mich zuletzt großzügig zu deiner Erbin gemacht. Wie kann ich dir jemals für alles danken?
Beide liegt ihr jetzt friedlich nebeneinander in unserm Stuttgarter Familiengrab, die ihr euch im Leben nicht ausstehen konntet. Du bist, anders als die Oma, eine starke, unabhängige, dafür aber einsame Frau gewesen, hast keine Kaffeekränzchen gebraucht. Ich hätte viel lieber bei dir als bei ihr gelebt. Heute weiß ich, warum du mich nicht zu dir nehmen konntest. Ach, Tante Emma, die Moral, die Moral! Ich hätte mich nicht um sie gekümmert! Du wärst mir eine wunderbare Ersatzmutter gewesen. Du wolltest so gerne ein Kind – und konntest keines bekommen.
Wenn du noch lebtest, Tante Emma, was wünschtest du dir von mir? Ich glaube, ich weiß: das, was du dir selbst so dringend, aber vergeblich gewünscht hast. Ich würde es dir gerne schenken – ein Kind! Zum Dank für alles, was du mir geschenkt hast. Ein Enkelkind, das bei dir aufwachsen dürfte. Wir drei zusammen: du, ich und unser Wunschkind. Ohne einen Papa natürlich, wie es sich für uns beide gehört. Für dich, die du jahrzehntelang mit deinen Damen gewerbsmäßig meinen Lebensunterhalt finanziert hast, für mich, die ich die Erfahrung gemacht habe: es geht auch ohne Vater, solange man eine Tante Emma hat. Im Ernstfall hast DU mir immer zur Seite gestanden.
Lange Jahre blieb Emma eine zufriedene “Mutter-Tochter”, vermisste nie einen Vater.
Wenn sie sich damals mit den Mädchen in ihrer Klasse verglich, stellte sie mit Erstaunen fest: Allesamt waren das “Vater-Töchter”. Für die unreifen, pickligen Jungs ihrer gleichaltrigen Jahrgänge hatten sie kaum einen Blick. Nein, ihre Idole waren die eigenen, mittels Diät und Disziplin jugendlich-sportlichschlank gebliebenen Väter, im besten Mannesalter, beruflich auf dem Zenith. Moderne Väter von weltmännischem Zuschnitt – angebetet von ihren Töchtern: ihre erste große Liebe. Im hohen kulturellen Milieu des wenn auch schwäbisch behäbigen Stuttgart, im geheiligten Äther von Wissenschaft, Kunst, Theater, Film und Fernsehen und ihren Festivitäten tummelten sich denn auch jene Väter: Nobilitäten aus Wirtschaft und Industrie – sich gegenseitig ihr kunstverständiges, oft auch mäzenatisches Niveau, ihre Weitläufigkeit bestätigend. Und bei solcherart Anlässen stellten sie denn auch, hinsichtlich eines gewissen Bäumchen-wechsel-dich-Spiels ihrer Begleiterinnen, ihre derzeitigen Amourositäten diskret zur Schau – was der Boulevard anderntags seinen Lesern nicht vorenthielt.
Emmas Mitschülerinnen nahmen das als selbstverständliche Reverenz der Presse für den jeweiligen Papa geschmeichelt zur Kenntnis.
Nur allzu gern ließen ebendiese Väter dann aber auch ihre aufblühenden Töchter voll Stolz teilhaben an ihren eigenen noblen, gesellschaftlichen Events. Und diese taufrischen, verführerischen Sechzehn-, Siebzehn-, Achtzehnjährigen, geschminkt, frisiert und im Decollecté, ließen sich dann von den ebenfalls recht ansehnlichen Kollegen ihrer Väter bewundern, umschwärmen, walzerselig umarmen. Unschuldig-übermütig kokettierten sie mit ihnen vor ihren Vätern – besser: für sie. Sie demonstrierten ganz offen: “Sind wir, eure Töchter, nicht weit attraktiver als eure Begleiterinnen?” Wobei sie am liebsten gewesen wären, was sie nun einmal nicht sein konnten: ihres Vaters Liebhaberin. Derlei Gedanken kamen Emma damals natürlich nicht. Diese Väter füllten ja auch nur vorübergehend, vorläufig eine Leerstelle aus – bis eines Tages der Schwiegersohn auftrat, für den der Vater den Platz freihielt.
Nie hatte Emma bisher ihre Schulfreundinnen um deren Chefärzte-, Professoren-, Industriellen- oder sonstige Super-Väter beneidet. Jetzt aber, wo sie erwachsen war und sich immer wieder fragte, was aus ihr werden, ob und was sie studieren sollte, hätte sie sich nun doch einen fürsorglich beratenden Vater gewünscht. Zum ersten Mal dachte sie über ihren Erzeuger nach, zum ersten Mal fehlte er ihr. Wie vernachlässigt war sie doch vom Schicksal! Es verweigerte ihr nicht nur die Mutter, noch weniger gab es einen Vater für sie. Warum geschah das gerade ihr? Ein unbeantwortbar schreckliches Warum!
“Ich könnte ja nach Paris fahren, ihn suchen. Aber wenn er sich dann als arbeitsloser Trinker ohne festen Wohnsitz herausstellt?”
Die Eingebung eines Augenblicks ließ ihr dann auf das “Warum?” ein keckes “Warum nicht?” einfallen.
Warum überhaupt ein Risiko mit einem unbekannten Vater eingehen? Warum kann ich mir nicht – hier und jetzt – anstelle eines ungebildeten, ungepflegten, unbehausten Pariser Arbeitslosen einen Ersatz- Vater erschaffen – so, wie ich mir damals meine Mutter erschaffen habe?
Das war’s: einen Vater imaginieren, ihn ausstatten mit all jenen wunderbaren Eigenschaften, worüber die Väter ihrer Mitschülerinnen verfügten: bella figura, Ansehen, Bildung, Manieren, Herkommen. Aber kein biederer Schwabe wie jene. Nein, ein Franzose! Ein echter Pariser natürlich!
Ein homo eruditissimus et elegantissimus also, wie er noch aus dem Lateinunterricht ciceronianisch in ihrem Gedächtnis herumspukte. Ein bisschen ein Snob. Und ja, vielleicht sogar ein klein wenig effeminiert – der totale Gegentyp zu den sportiven Vätern ihrer Mitschülerinnen! Mit leicht anglophiler Attitüde würde er sie “Darling” nennen. Weil sie eben für ihn etwas ganz Besonderes war.
“Emma Darling!” Ja, warum nicht?
Anstelle der entschwundenen Sehnsuchtsmutter würde es also von jetzt an einen starken, noblen, ritterlichen Sehnsuchsvater geben. Wenn er die unerwünschte Tochter auch als Baby verleugnet hatte – auf die erwachsene Emma war er stolz, sie war seine Prinzessin! Die Silhouette des Eiffelturms, die Champs Elysees tauchten vor ihren Augen auf - alles, was jeder kennt, auch wenn er noch nie in Paris war.
Ihre Selbstbetrachtung endete mit den stolzen Worten:
Durch ihn und nur durch ihn bin ich eine wirkliche, geborene Pariserin!
Auch die allerletzten Bedenken wischte sie weg:
Selbst wenn er niemals von mir erfahren hätte – nichts wüsste von meiner Existenz – für immer unauffindbar wäre – gerade dann dürfte ich mir doch erst recht einen erdachten Vater erschaffen!
Und wie leicht das ging! Er, der so viele Jahre niemals für sie existiert hatte, wurde innerhalb kürzester Zeit zur attraktiven Figur, – viel rascher als damals die Mama nahm er Gestalt an. Unentwegt erschien er in ihren Gedanken – ein Vater. Am Ende mehr als ein Vater?
Was einst die Mitschülerinnen möglichweise nur ganz im Geheimen und tief in einer schlaflosen Nacht ihrer ausschweifenden Phantasie erlaubten, darüber dachte Emma am hellichten Tag unverhohlen, sehnsüchtig nach: Wenn er mich suchen, mich finden, mich anschauen würde – würde ich ihm gefallen? Nicht ihm, als meinem Vater – nein, ihm, einem Mann! Würde er sich am Ende in mich verlieben? Ich mich in ihn? Würde er mich umarmen und…
Es war ein verwegener, ein verrückter, ein verbotener, ein sündhafter Gedanke, hinreißend und verführerisch! Emma hütete sich, ihn ihrem Tagebuch anzuvertrauen.
Zuerst musste sie sich allerdings entscheiden: Weiterstudieren – oder aufhören und, als Dank für Tante Emma, ein Kind?
Ein Kind? Wirklich? Einerseits eine verrückte Idee. Ja, aber sie gäbe ihrem Leben eine ganz unerwartete Wendung, einen wunderbaren Inhalt, einen Sinn. Denn dieses Kind bestünde aus Fleisch und Blut; sie würde es zur Welt bringen – nicht bloß erträumen, sich ausdenken. Ganz allein ihr würde dies Wesen gehören. All die Zärtlichkeit und Hingabe, die in ihrer Seele schlummerten, gäbe sie ihm: die unendliche Sehnsucht, Gefühle, an denen sie litt wie an einer riesigen Last: überschüssige, seit Jahren in ihr aufgespeicherte Liebe, – ein Gefäß, das den Überfluss einfach nicht mehr fassen, halten, bändigen konnte.
Und endlich: Ein Kind, das sie abfragen könnte: wer bin ich, ICH, deine Mutter? DU – ein Wesen, in dem ich mir selbst begegne – authentisch – wie in einem Spiegel – und von dem ich endlich erfahre: was in mir, in dieser vaterlosen, verstoßenen Pariser “Missgeburt” steckt?
Ein Kind? Aber von wem? Nie zuvor hatte Emma einen richtigen Freund gehabt, “eine Beziehung”. Jetzt zog sie zum ersten Mal eine Hingabe, “Liebe” genannt, in Betracht. ”Liebe” – nicht für den Hamburger Jura-Professor, der um sie warb, sondern für ein Phantom, für eine Traumgestalt – eine Ausgeburt ihrer Phantasie. Sie hätte dieses Gefühl als Vorleistung bezeichnen können, als Duftmittel, das ihn auf den Weg her locken sollte zu ihr.
Schluss also mit ihrem Studium, das im Grunde noch immer nicht richtig begonnen und sie bisher so gar nicht befriedigt hatte? Sie schob die Entscheidung noch einmal ein paar Tage vor sich her.
Sie bewohnte ein möbliertes Zimmer in einem Hamburger Hinterhaus. Als sie eines frühen Morgens, nach einigen letzten, zergrübelten Nächten, vor die Haustür trat, erblickte sie unter der einsamen Kastanie in der Mitte des begrünten Innenhofs eine Katze, die ihr Spiel mit einem Etwas trieb, dem sie immer wieder einen sachten Hieb versetzte – und das Etwas hüpfte und flatterte verzweifelt, konnte nicht davonfliegen, weil es noch gar nicht fliegen gelernt hatte. Und dann, nach einem letzten Tatzenstreich, hörte das Flattern auf.
Emma hatte viele Jahre Omas Kater Karl innig geliebt. Emma wusste: Katzen sind so, es ist ihr Wesen, sie töten – aber ehe sie töten, spielen sie noch – wie sagt man? – “Katz und Maus” mit ihrem Opfer. Hier war’s keine Maus. Doch Emma war zu spät gekommen, um das aus seinem Nest gefallene Amselküken vor dem unbarmherzigen Totschlagspiel noch zu retten.
Aber gerade das gab den Ausschlag. Abrupt, energisch, trotzig sagte sie vor sich hin: “Jawohl, jetzt erst recht, Tante Emma! Ein Kind! Du bekommst es.”
In diesem einzigen, absurden Augenblick entschied Emma endgültig über dies Abenteuer. Ohne noch einmal über die fragwürdige, verbotene, nein, sündhafte Mitwirkung, die sie ihrem Vater zugedacht hatte, nachzudenken – jedenfalls nicht mit dem Kopf, höchstens mit ihren Eingeweiden.
Ihr Leben damit umstülpend wie einen Handschuh.
Das beharrliche Werben des Jura-Professors machte es ihr leicht.
Der verliebte Ole konnte nicht ahnen, dass er von Emma nur benutzt, nein, missbraucht wurde, doppelt missbraucht: als realer Samenspender und als fiktiver Stellvertreter eines Anderen, heimlich Ersehnten. Der bloßen Notwendigkeit einer Zeugung hätte sich Emma mit gebotener Distanz unterworfen und ihrem Körper dabei jede Lustempfindung versagt. Doch im Beischlaf ging es jetzt für sie um weit mehr: um die geheime, gewollt lustvolle Vereinigung mit einem Abwesenden, um den Liebesakt mit einem von Emma Ersehnten, Unsichtbaren – um ein phantasmagorisches Ritual.
Der ahnungslose Ole ging mit der jungfräulichen Emma sehr zart und behutsam um. Emma jedoch befand sich in einem Zustand tiefster, suggestivster Selbstversunkenheit. Und im Augenblick, wo Ole in sie eindrang, ereignete sich ein hypnotisches Wunder:
Er war es, der Ersehnte – er, nicht Ole – er!
“Ja! er, er ist es!”
Was immer sie sich erwartet hatte von ihm: es war glutheiße Lust. Vom Strudel einer atemlos-wahnsinnigen, dem Schmerz nahen Empfindung erfasst, der durch sie hindurchging, sie auslöschte wie eine riesige Woge, unterwarf sich Emma dem Taumel, dem Rausch, der Lust, gab sich bedingungs-, besinnungslos hin – ihm!
In ihrer Liebeswut, ihrer Wutliebe verkeilte sich Emma in Ole, ging unter, erstarb.
Als sie endlich voneinander abließen und Emma, um Atem ringend, neben Ole lag, sagte er, selber erschöpft:
“So hat noch nie eine Frau mit mir geschlafen…”
Emma zitterte noch immer vor Glück. Sie war eins mit ihm gewesen.
Anderntags, nach einer durchwachten Nacht, erstarrt vor Scham, hielt sie sich vor:
“Ich habe Ole betrogen. Wie weiß ich, wessen Kind ich bekomme? Oles Kind – oder SEINES? Wirken nicht bei einer Empfängnis auch Herz, Geist und Seele mit – haben Macht über die Gene?
Und so ergriff sie wieder einmal die Flucht, im Gepäck ihr Schuldeingeständnis. Sie konnte es ja nicht einfach wegwerfen wie ein Bündel schmutziger Wäsche. Sie musste es mitschleppen. Keine Absolution eines Beichtvaters, kein Zuspruch eines Therapeuten hätte sie davon reinigen, befreien können. Auch wenn niemand je ihre Schuld verstehen würde: dass sie – mit der Absicht, ein Kind von ihm zu empfangen – nur vorgetäuscht, scheinbar mit Ole, in Wahrheit aber mit ihrem eigenen Erzeuger, ihrem abwesenden, ihrem fern in Paris weilenden, unbekannten, ihrem eingebildeten Vater geschlafen hatte.
“Was bin ich denn dann? Eine Hure? Eine Verrückte?”
Sie schrieb in ihr Tagebuch:
Wie komme ich je damit zurecht? Ich habe unendliche Lust empfunden. Ich wollte doch nur ein Kind. Von Ole. Aber war Ole Ole? Wer immer er war – von dem ist mein Kind. Und dabei bleibt’s!
Dafür werde ich büßen, mich bestrafen, nie wieder schlafen mit einem Mann. Aber meine Lust, meine Seligkeit vergessen werde ich nie. Niemals!
Und dann strich sie den letzten Eintrag aus.
Diesmal zog es Emma mit aller Gewalt vom Norden zurück in den Süden. In München wollte sie endlich zur Ruhe kommen.
Aber wenn nicht gleich der allererste Versuch mit Ole geglückt war? Würde sie sich überwinden können für eine Wiederholung? Oder würde sie ihren Plan scheitern lassen? Wie ernst war es ihr wirklich mit einem Kind? Sie dachte an die unfruchtbare Großtante Emma, die für ein heiß ersehntes Kind gewiss all die unendlich vielen Behandlungen, Eingriffe auf sich genommen hätte, die es damals, zu ihrer Zeit, noch nicht gab. Sie horchte lange in sich hinein. Überließ es der Zukunft, (oder dem Zufall?) – schob es vor sich her, wie sie sich im Ernstfall entscheiden würde. Als erstes suchte sie sich eine Bleibe in einem Münchener Vorort. Sie brauchte unbedingt eine Arbeit. Nicht des Geldes wegen, sondern um – wenigstens tagsüber – sich zu vergessen. In der Nähe befand sich ein privates Senioren-Wohnheim. Sie erkundete es unter einem Vorwand, fand es zwar – auf schwäbisch "ziemlich feudal” – bewarb sich aber nach einigem Überlegen dann doch für die einfachsten Hilfsdienste: Putzen, Küchendienst, Wäsche. Weil sie anstellig war, jeden Wunsch, jeden Auftrag annahm, als willige Arbeitskraft keinerlei Extras beanspruchte, alle Anweisungen strikt und intelligent ausführte, durfte sie schon nach kurzer Zeit beim Umgang mit den Hausbewohnern aushelfen – die raren Pflegekräfte entlasten. Die ungewohnte Arbeit tat ihr gut, lenkte sie wenigstens tagsüber von ihrem verworrenen Innenleben ab. Sie lernte zugleich eine ihr aus der Vergangenheit wohlvertraute Sorte von Menschen aufs Neue kennen: die Alten. Und den manchmal mühsamen Umgang mit ihnen.
In Kürze gewann sie mit ihren höflich-diskreten Manieren die Wohlwollenden, Taktvollen, Kultivierten unter den Senioren. Emma kannte sie aus langjähriger Erfahrung. Ihr Modell war die geliebte Bietigheimer Großtante Emma, die ihr mit ihrem großzügigen Erbe ihre Fluchten bisher ermöglicht hatte.
Nicht alle Senioren waren von Emmas täglichen Hilfeleistungen angetan. Es gab auch Abweisende, Verbitterte, Ungute. Sie kosteten Nerven. Sie schienen Emma der unlängst verstorbenen Oma zum Verwechseln ähnlich. Aber sie hatte ja gelernt, sich von streitsüchtigen alten Frauen nicht provozieren zu lassen, sie wusste, wie mit ihnen auszukommen war. Sie verrichtete ihre Arbeit in den Zimmern so geschwind und leise wie möglich – vor allem jedoch so, dass die Bewohnerin jeden Handgriff scharfäugig zu kontrollieren vermochte. Wenn sie fertig war, schwebte Emma lächelnd mit einem freundlichen Gruß hinaus. Falls sie die bissigen Bemerkungen der schwierigsten Alten, auch Hausgäste genannt, nicht mehr ertragen hätte, wäre sie, dank ihrer Erbtante, eine Weile auch ohne Arbeit ausgekommen. Aber sie dachte gar nicht daran. Friedfertig, nachsichtig nahm sie die oft schwierigen Launen einzelner Hausgäste hin. Sie souverän zu übersehen, zu überhören, zu belächeln war ihr inzwischen fast zum Spiel geworden.
“Ach, Oma”, dachte sie oft, “hier begegne ich dir jeden Tag, wiederverkörpert, sogar mehrfach – und ehrlich, die sind genau so schlimm wie du oder manchmal fast noch schlimmer. Seltsam, das macht sie mir eher sympathisch. Ich versuche, geduldig mit ihnen umzugehen, diesen Alten. Nie sind sie vom Leben verwöhnt worden, nie mit Liebe behandelt – und nun sind sie, wie du einst, garstig, bösartig, aggressiv. Umgekehrt kann ich heute dich, Oma, durch sie besser als zu deinen Lebzeiten verstehen. Überaus streng wurdest du wahrscheinlich erzogen, fest im Glauben – ein “bravs Mädle” halt, wie man im Schwäbischen sagt. Eine freudlose Kindheit und Jugend, das muss man sich wohl in deinem Fall vorstellen – und eine noch freudlosere Ehe. Dann ist dir auch noch deine Tochter missraten. Und ich Unglückswurm habe deine alten Tage mit Mühe und Arbeit, Schulsorgen und vielleicht auch mit den Demütigungen erfüllt, die du meinetwegen nicht nur von Tante Emma hinnehmen musstest. Du hast aber alles, womit sie dich verletzte, an mich weitergegeben. Ich verzeihe es dir, Oma. Jetzt, wo du tot bist, fällt es mir gar nicht mehr schwer.”
Noch im Nachhinein milderte ihre vielerprobte Vorstellungskraft die Erinnerung an ein bissiges, altes, unversöhnliches Oma-Gespenst.
Ein Arzt hatte ihre Hoffnung bestätigt: sie war schwanger, der Zeugungsakt bedurfte keiner Wiederholung. Deutlich und immer öfter spürte sie nach und nach das Leben in ihrem Körper. Ins Chaos ihrer Seele hätte endlich Ruhe einkehren können. Doch unentwegt sehnte sie sich zurück in diese unerlaubte Nacht, der keine je gleichen würde: die sie nur scheinbar mit Ole, in Wirklichkeit mit Oles geheimnisvollem, seinem herbeigesehnten Doppelgänger verbracht hatte – wünschte sich eine geheime Wiederbegegnung, oder wenigstens einen zärtlichen Abschied, ein erotisches Lebewohl.
Eines Nachts erfüllte sich ihr Wunsch.
Ohne Schlaf lag sie lange wach, fand keine Ruhe. Widerstandslos, mit geschlossenen Augen ließ sie sich treiben – als gleite sie in einem Boot auf dunklen Gewässern lautlos dahin, sich noch einmal mit ganzer Seele jenem Fernen entgegensehnend. Unversehens manifestierte er sich ihr zur Seite, schmiegte sich an sie, streichelte, umarmte, küsste sie. Er war zurückgekommen, auf wundersame Weise vereinigte er sich mit ihr.
Im gleichen Augenblick begann das ungeborene Wesen sich heftig in ihr zu bewegen. Sie spürte es mit Entsetzen, fühlte unbekannte Schmerzen, bekam wahnsinnige Angst. Machte sich das Kind von ihr los? Würde sie es verlieren?
Sie krümmte sich, legte die Arme beschützend um ihren Bauch, wagte nur noch ganz flach zu atmen, flehte: “Bleib da, bitte, bleib da!”
Und immer wieder: “Bleib bei mir, bitte, bitte, bitte…
Es ging so bis zum Morgen. Dann sank sie in einen erschöpften Schlaf.
Es war eine Warnung.
Jetzt wusste sie, wenn sie ihr Kind behalten wollte, durfte sie ihn niemals wieder herbeisehnen. Was immer sie mit ihm erlebt hatte – das Liebessspiel war zu Ende. Sie war aufs neue schuldig geworden! Noch immer angsterfüllt schwor sie: Nie wieder ihr ungeborenes Kind einer solchen Gefahr auszusetzen – nie wieder an Oles geheimnisvollen Stellvertreter auch nur zu denken!
Jetzt – nach dieser unheilvollen Nacht – musste sie vor allem in die Altersheim-Wirklichkeit, in den dortigen Alltag zurückfinden.
Immer wieder ließ sie die vorgesehenen Arzttermine verstreichen. So erfuhr sie erst einige Wochen vor der Geburt, sie würde Zwillinge bekommen. Zwillinge! Die Nachricht machte als Sensation die Runde im Heim. Die Senioren waren außer sich vor Freude: Wann sehen wir die Babys? Wann bringt sie sie her?
Vor allem Ole musste endlich erfahren, er wurde Vater! Wegnehmen würde er ihr die Früchte ihres einmaligen Beischlafs nicht können. Sie gehörten ihr, Emma, ihr ganz allein.
Auf ihre Nachricht antwortete Ole:
Du verbietest mir, zu Euch zu kommen und meine Kinder in die Arme zu nehmen. Du schenkst sie mir also nicht, – du willst sie ganz für dich allein? Hast mich hereingelegt, hast sie mir abgeluchst, bringst sie in München vor mir in Sicherheit? Du warst anfangs so zart, so scheu, und dann so wild – und dabei so raffiniert! Ich will aber Vater sein dürfen für meine Kinder. Gott, welch ein Glück: ZWEI! Ich erwarte, dass du mir Bericht über sie gibst, mindestens einmal im Monat, nein, jede Woche – am liebsten jeden Tag. Ich strenge einen Prozess gegen dich an, wenn du dich nicht daran hältst. Und, wie du weißt, ich bin Jurist und mit allen Wassern gewaschen. Ich nehme dir die Zwillinge weg, wenn du nicht auf meine Wünsche eingehst. Im übrigen möchte ich für alles einstehen, was sie brauchen, einschließlich Porto und Telefon. Mein Gott, Zwillinge, ein Pärchen! Ich könnte verrückt werden vor Freude.
Es grüßt und küsst dich der betrogene Kindsvater Ole.
Emma wich aus,:
“Du verstehst mich nicht. Ich habe nie einen Vater gehabt – und meine Mutter hat mich zeitlebens verleugnet, ich weiß nicht einmal, ob sie noch lebt. Und deshalb will ich mit allem, was ich bin und habe, für meine Kinder da sein. Allein. Aber nicht für immer, Ole, nur so lange sie klein sind. Und ich verspreche dir, dass du immer von ihnen hörst.
Unbedingt musste Emma den Besuch Oles vermeiden. Gequält von ihrer Schuld, schienen ihr auch die Zwillinge davon befleckt. Und das wäre vielleicht sogar Ole aufgefallen?
Auch Emma selbst hätte es so kurz nach der Geburt nur schwer ertragen, mit Ole als Vater ihrer Zwillinge jenem unsichtbaren Doppelgänger wiederzubegegnen, von dem sie ihre Kinder empfangen hatte – wenn auch bloß in Gedanken, nicht wirklich. Aber machte das einen Unterschied?
Ja, eben doch.
Sie legte wahrhaftig ein Bußgelübde ab: nie, nie wieder würde sie jenen fernen Geliebten imaginieren, um sich nochmals mit ihm zu vereinen – wie in jener einzigen Nacht, als sie beinahe ihre Kinder verlor. Sie würde sich überhaupt niemals mehr einem Mann hingeben, den Kindern zuliebe.
Aber es half nichts:





























