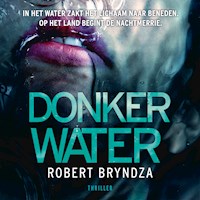8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Erika-Foster-Reihe
- Sprache: Deutsch
Ein bitterkalter Wintertag hüllt London in Schnee und Schweigen. Das Klingeln eines Handys durchbricht die gespenstische Stille eines zugefrorenen Sees. Doch niemand antwortet. Nur wenige Zentimeter daneben ragen Finger aus dem Eis …
Acht Monate sind vergangen seit Detective Erika Fosters letztem Einsatz, der in einer Katastrophe endete und ihrem Mann das Leben kostete. Doch es ist an der Zeit, nach vorn zu blicken. Die Tochter einer der mächtigsten Familien Londons wurde ermordet, und Erika setzt alles daran, den Schuldigen zu finden. Während sie noch gegen die Dämonen der Vergangenheit kämpft, rückt sie ins Visier eines gnadenlosen Killers.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 531
Veröffentlichungsjahr: 2017
Sammlungen
Ähnliche
ROBERT BRYNDZA wurde in England geboren und hat in den USA und Kanada gelebt, ehe er mit seinem slowakischen Mann in dessen Heimat zog. Er hat eine Schauspielausbildung absolviert und ist heute hauptberuflich als Autor tätig. Das Mädchen im Eis ist der Auftakt seiner Krimireihe um Detective Erika Foster, die in 22 Ländern erscheint.
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook.
Robert Bryndza
DAS MÄDCHEN IM EIS
Kriminalroman
Aus dem Englischen von
Charlotte Breuer, Marion Matheis und Norbert Möllemann
Für Ján, meinen Begleiter durch die Komödie und jetzt auch durch das Drama.
Prolog
Das Pflaster glitzerte im Mondlicht, als Andrea Douglas-Brown die menschenleere Hauptstraße entlanghastete. Der unregelmäßige Rhythmus, mit dem das Klackern ihrer hohen Absätze die Stille durchbrach, war all dem Wodka geschuldet, den sie getrunken hatte. Die Januarluft war eisig, und Andrea spürte die Kälte wie Messerstiche an ihren nackten Beinen. Weihnachten und Neujahr waren längst vorbei und hatten eine frostige, sterile Leere hinterlassen. Die Schaufenster lagen im Dunkeln, nur ein schäbiger Spirituosenladen wurde von einer flackernden Straßenlaterne beleuchtet. Drinnen saß im Schein seines Laptops ein Inder, der jedoch keine Notiz von ihr nahm, als sie vorbeistapfte.
Andrea war so wütend, so froh, dem Pub entronnen zu sein, dass sie sich erst fragte, wohin sie eigentlich wollte, als die Schaufenster von etwas zurückgesetzten großen Häusern abgelöst wurden. Über ihr ragte die kahle Krone einer Ulme in den sternenlosen Himmel. Sie blieb stehen und lehnte sich an eine Mauer, um Atem zu schöpfen. Das Blut dröhnte ihr in den Ohren, und die kalte Luft brannte ihr in der Lunge. Sie drehte sich um und sah, dass sie ein ganzes Stück Weg zurückgelegt hatte und schon auf halber Höhe des Hügels war. Die Straße hinter ihr glänzte im orangefarbenen Licht einer Gaslaterne, und ganz unten lag der in Dunkelheit gehüllte Bahnhof. Die Stille und die Kälte waren bedrückend. Die einzige Bewegung kam von den Dunstschwaden, die Andreas Atem erzeugte. Die pinkfarbene Clutch an den Körper gedrückt, vergewisserte sie sich, dass niemand in der Nähe war, dann schob sie ihr kurzes Kleid hoch und zog das iPhone aus ihrem Slip. Die Swarovski-Kristalle glitzerten schwach im Laternenlicht. Das Display zeigte keinen Empfang. Vor sich hin fluchend, schob sie das Handy zurück an seinen sicheren Ort und öffnete den Reißverschluss der Clutch, in der sie noch ein älteres iPhone hatte, ebenfalls mit Swarovski-Kristallen verziert, von denen allerdings schon einige fehlten. Es hatte auch keinen Empfang.
Panik erfasste sie, während sie sich umschaute. Die Häuser hier waren umgeben von hohen Hecken und schmiedeeisernen Gittern. Oben auf dem Hügel würde sie wahrscheinlich Empfang haben, wenn sie es bis dorthin schaffte. Und dann würde sie verflucht noch mal den Fahrer ihres Vaters anrufen, dachte sie. Ihr würde schon eine Erklärung dafür einfallen, warum sie sich südlich der Themse aufhielt. Sie knöpfte ihre kurze Lederjacke zu, verschränkte die Arme vor der Brust und ging weiter die Straße hoch, das alte iPhone in der Hand wie einen Talisman.
Hinter ihr näherte sich ein Auto. Sie drehte sich um, blinzelte in das Scheinwerferlicht, fühlte sich total exponiert, als der grelle Lichtkegel über ihre nackten Beine huschte. Ihre Hoffnung, dass es sich um ein Taxi handelte, zerstob, als sie sah, dass es ein normales Auto ohne Dachschild war. Sie wandte sich ab und lief weiter. Das Motorengeräusch wurde lauter, dann wurde sie ganz vom Licht der Scheinwerfer erfasst. Mehrere Sekunden vergingen, und die Scheinwerfer waren immer noch da. Sie konnte beinahe deren Wärme spüren. Sie drehte sich um. Das Auto fuhr im Schritttempo direkt hinter ihr her.
Wut packte sie, als sie erkannte, wessen Auto es war. Sie warf ihr langes Haar zurück und setzte ihren Weg fort. Das Auto beschleunigte ein wenig, fuhr jetzt neben ihr her. Die Scheiben waren dunkel getönt. Im Wageninneren dröhnte Musik aus der Lautsprecheranlage und verursachte bei ihr ein Kribbeln im Hals und ein Jucken in den Ohren. Sie blieb abrupt stehen. Das Auto hielt ebenfalls an und setzte zurück, bis sich das Fenster auf der Fahrerseite mit ihr auf einer Höhe befand. Die Musik wurde ausgeschaltet. Der Motor summte.
Andrea beugte sich vor und versuchte, durch das getönte Fenster etwas zu erkennen, sah jedoch nur ihr eigenes Spiegelbild. Sie probierte die Tür, aber die war verriegelt. Sie schlug mit ihrer Clutch gegen die Fensterscheibe und versuchte noch einmal, die Tür zu öffnen.
»Was ich gesagt habe, war kein Scherz, das war ernst gemeint!«, schrie sie. »Entweder du machst die Tür auf oder … oder …«
Nichts rührte sich, nur der Motor lief.
Oder was?, schien der Wagen zu spotten.
Andrea klemmte sich die Tasche unter den Arm, zeigte der getönten Scheibe den Stinkefinger und marschierte weiter den Hügel hoch. Der dicke Stamm eines riesigen Baums auf dem Gehweg schirmte sie kurz vor dem Scheinwerferlicht ab. Sie hielt ihr iPhone in der Hoffnung auf Empfang hoch über den Kopf. Der Himmel war sternenlos, und eine braun-orangefarbene Wolke hing so tief, dass Andrea das Gefühl hatte, sie mit der ausgestreckten Hand berühren zu können. Das Auto hielt neben dem Baum.
Langsam bekam Andrea es mit der Angst zu tun. Im Schatten des Baums schaute sie sich um. Dichte Hecken auf beiden Seiten der Straße, die weiter oben mit dem düsteren Vorstadthimmel verschmolz. Dann entdeckte sie auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine Gasse zwischen zwei großen Häusern. Sie konnte so gerade eben ein kleines Schild mit der Aufschrift DULWICH 1¼ ausmachen.
»Fang mich doch, wenn du mich kriegst«, murmelte sie. Sie holte tief Luft und wollte über die Straße rennen, blieb jedoch mit dem Fuß an einer der dicken Baumwurzeln hängen, die aus dem Asphalt ragten. Ein scharfer Schmerz durchfuhr ihr Fußgelenk, als sie umknickte, und sie verlor das Gleichgewicht. Ihre Tasche und das iPhone schlitterten auf die Straße, während sie zuerst mit der Hüfte auf der Bordsteinkante und dann mit dem Kopf auf dem Asphalt aufschlug. Benommen lag sie im grellen Scheinwerferlicht.
Die Scheinwerfer wurden ausgeschaltet, und Dunkelheit hüllte Andrea ein.
Sie hörte, wie eine Tür geöffnet wurde, und versuchte aufzustehen, doch um sie herum drehte sich alles. Zwei Beine in Jeans kamen in ihr Gesichtsfeld … Ein Paar teure Sportschuhe verschwamm vor ihren Augen, verdoppelte sich. Sie streckte den Arm aus in der Erwartung, dass die vertraute Gestalt ihr aufhelfen würde, aber stattdessen legte sich in einer schnellen Bewegung eine behandschuhte Hand über ihren Mund und ihre Nase, und im darauffolgenden Moment wurde sie hochgerissen, zum Auto gezerrt und auf die Rückbank geworfen. Die Kälte hinter ihr ließ nach, als die Tür zugeschlagen wurde. Andrea war starr vor Schreck und begriff überhaupt nicht, was gerade geschehen war.
Das Auto bewegte sich, als die Gestalt einstieg und die Fahrertür zuschlug. Die Zentralverriegelung klickte und surrte. Andrea hörte, wie das Handschuhfach geöffnet wurde, wie etwas raschelte, wie es wieder geschlossen wurde. Das Auto schaukelte, als die Gestalt zwischen den Vordersitzen hindurch nach hinten kletterte und sich so schwer auf Andreas Rücken setzte, dass es ihr die Luft aus der Lunge presste. Einen Augenblick später wurden ihr die Hände auf den Rücken gefesselt, wobei ein dünnes Plastikband ihr in die Haut schnitt. Die Gestalt bewegte sich an Andreas Körper entlang nach unten, schnell und behände, muskulöse Oberschenkel drückten auf ihre Handgelenke. Ein ratschendes Geräusch, dann wurden ihre Füße mit breitem Klebeband gefesselt, was die Schmerzen in ihrem verrenkten Knöchel noch verschlimmerte. Ein intensiver Geruch nach Kiefernadelraumspray vermischte sich mit etwas Metallischem, und sie merkte, dass ihre Nase blutete.
Ein Adrenalinstoß, ausgelöst von plötzlicher Wut, schärfte ihre Sinne.
»Was zum Teufel soll das?!«, fragte sie. »Ich schreie. Du weißt genau, wie laut ich schreien kann.«
Doch die Gestalt fuhr wortlos herum, drückte ihr die Knie in den Rücken und raubte ihr die Luft. Aus dem Augenwinkel sah sie, wie etwas sich schattenhaft bewegte, dann traf sie etwas Schweres, Hartes am Hinterkopf. Schmerz durchzuckte sie, und sie sah Sterne. Ein Arm hob sich, und wieder traf sie etwas am Hinterkopf, dann wurde alles schwarz.
Die Straße war still und leer, als die ersten Schneeflocken fielen und gemächlich zu Boden schwebten. Das Auto mit den getönten Scheiben fuhr fast lautlos an und verschwand in der Nacht.
1
Lee Kinney trat aus dem kleinen Reihenendhaus, in dem er immer noch mit seiner Mutter wohnte, und betrachtete die mit Schnee bedeckte Hauptstraße. Er zog eine Schachtel mit Zigaretten aus seiner Trainingshose und zündete sich eine an. Es hatte das ganze Wochenende geschneit, und jetzt fiel wieder Schnee und überdeckte alle Fuß- und Reifenspuren. Der Bahnhof Forest Hill lag still am Fuß des Hügels; die Pendler, die montagmorgens normalerweise auf dem Weg in ihre Büros im Zentrum Londons an ihm vorbeiströmten, waren wahrscheinlich noch im Warmen und genossen einen geschenkten Vormittag im Bett mit ihrer besseren Hälfte.
Glückspilze.
Lee war arbeitslos, seit er vor sechs Jahren die Schule abgeschlossen hatte, aber die guten alten Zeiten, in denen der Staat einem ein gemütliches Leben ermöglichte, waren vorbei. Die neue Tory-Regierung ging hart gegen die Langzeitarbeitslosen vor, und Lee musste jetzt für sein Geld Vollzeit arbeiten. Man hatte ihm jedoch einen ziemlich bequemen Job als Gemeindegärtner im Horniman Museum zugewiesen, nur zehn Fußminuten entfernt. Er wäre gern wie alle anderen an diesem Vormittag zu Hause geblieben, aber er hatte nicht vom Jobcenter gehört, dass die Arbeit heute ausfallen würde. Seine Mutter hatte sich tierisch aufgeregt und ihn angeschrien, wenn er nicht zur Arbeit erscheine, werde ihm das Arbeitslosengeld gestrichen, und dann könne er sich gleich eine andere Bleibe suchen.
Hinter ihm rumste es. Er drehte sich um und sah das verkniffene Gesicht seiner Mutter am Küchenfenster, die ihn mit einer Handbewegung losscheuchte. Er zeigte ihr den Stinkefinger und machte sich auf den Weg.
Vier hübsche junge Mädchen kamen ihm entgegen. Sie trugen die Uniform der Mädchenschule in Dulwich – rote Jacke, kurzer Rock, weiße Kniestrümpfe. Auf ihre affektierte Art schwatzten sie aufgeregt darüber, dass sie aus der Schule nach Hause geschickt worden waren, während sie gleichzeitig auf ihren iPhones herumwischten – um den Hals die typischen weißen Kopfhörerkabel, die sich von ihren roten Jacken abhoben. Sie gingen nebeneinanderher und machten Lee keinen Platz, sodass er gezwungen war, auf die Straße auszuweichen und durch den Schneematsch zu stapfen, den das Streufahrzeug hinterlassen hatte. Er spürte, wie eisiges Wasser in seine neuen Sportschuhe drang, und warf den Mädchen einen finsteren Blick zu, aber die waren in ihr Geschnatter vertieft und lachten gerade kreischend über irgendetwas.
Eingebildete reiche Zicken, dachte Lee. Als er die Hügelkuppe erreichte, sah er den Turm des Horniman Museums durch die kahlen Äste der Ulmen. Schneereste klebten an den gelben Sandsteinmauern wie nasse Klopapierfetzen.
Lee bog rechts in eine Wohnstraße, die entlang des schmiedeeisernen Zauns der Museumsgärten verlief. Die Straße stieg steil an, und die Häuser wurden immer vornehmer. Oben angekommen blieb er einen Augenblick stehen, um zu verschnaufen. Schnee flog ihm in die Augen, rau und kalt. An guten Tagen konnte man von hier aus über ganz London sehen, bis zum London Eye am Ufer der Themse, aber heute hatte sich eine dicke weiße Wolke über die Stadt gelegt, und Lee konnte nur die imposante Ansammlung von Villen in der Overhill Road am gegenüberliegenden Hügel ausmachen.
Das kleine Tor im Zaun war verriegelt. Der Wind fegte ihm ins Gesicht, und Lee bibberte in seinem Trainingsanzug. Ein bescheuerter alter Depp war für das Gärtnerteam verantwortlich. Eigentlich musste Lee warten, bis der kam und ihn einließ, aber es war weit und breit niemand zu sehen. Er sah sich kurz um, dann kletterte er über das niedrige Tor auf das Museumsgelände und folgte einem schmalen Pfad durch hohe immergrüne Hecken.
Hier, im Schutz vor dem heulenden Wind, war die Welt auf einmal auf geradezu unheimliche Weise still. Es schneite jetzt ziemlich heftig, und Lees Fußspuren wurden schnell überdeckt, als er durch die Heckenreihen ging. Das Gelände des Horniman Museums umfasste sieben Hektar, und die Geräteschuppen befanden sich im hinteren Teil vor einer hohen Mauer mit geschwungenem Rand. Um Lee herum war alles blendend weiß, sodass er die Orientierung verlor und tiefer in der Gartenanlage herauskam, als er erwartet hatte, gleich neben der Orangerie. Der Anblick des opulenten Gebäudes aus Schmiedeeisen und Glas brachte ihn so sehr aus dem Konzept, dass er kehrtmachte. Doch schon wenige Minuten später stand er erneut auf unvertrautem Terrain vor einer Weggabelung.
Wie oft bin ich schon durch diesen verfluchten Park gelaufen?, dachte er. Er nahm den Weg, der nach rechts in einen Senkgarten führte. Weiße marmorne Putten posierten auf verschneiten, aus Backsteinen gemauerten Sockeln. Der Wind heulte leise, und als Lee an den Putten vorbeiging, schien es, als würden sie ihn mit ihren milchigen Augen beobachten. Er blieb stehen, hielt sich gegen das Schneegestöber schützend die Hand über die Augen und überlegte, welcher der kürzeste Weg zum Besucherzentrum war. Den Gartenarbeitern war es normalerweise nicht erlaubt, sich im Museum aufzuhalten, aber es war eiskalt, und das Café war vielleicht schon geöffnet, und er würde sich dort aufwärmen wie jeder normale Mensch, verdammt noch mal.
Sein Handy vibrierte in seiner Hosentasche, und er nahm es heraus. Eine SMS vom Jobcenter: Wegen des »widrigen Wetters« brauche er nicht am Arbeitsplatz zu erscheinen. Er stopfte das Handy wieder in die Tasche. Die Putten schienen sich ihm alle zugewandt zu haben. Hatten die auch vorher schon so dagestanden? Konnte es sein, dass ihre perlmuttfarbenen kleinen Köpfe sich langsam bewegten und seinen Weg durch die Parkanlage verfolgten? Er schüttelte den Gedanken ab und eilte an den leeren Augen vorbei, den Blick auf den schneebedeckten Boden geheftet, bis er ans Ufer eines stillen, kleinen Sees gelangte, der früher einmal zum Bootfahren benutzt worden war.
Er blieb stehen und spähte mit zusammengekniffenen Augen durch die wirbelnden Schneeflocken. Ein Ruderboot, dessen blauer Anstrich verblasst war, lag in einem Oval aus Schnee, das sich auf dem zugefrorenen See gebildet hatte. Am gegenüberliegenden Ufer befand sich ein halb verfallener Bootsschuppen, unter dessen Dach Lee ein Ruderboot zu erkennen glaubte.
Seine Sportschuhe waren nass, und die Kälte drang durch seine Jacke. Er schämte sich dafür, dass er tatsächlich Angst verspürte. Aber er musste unbedingt hier raus. Wenn er jetzt kehrtmachte und durch den Senkgarten zurückging, konnte er den Weg am Zaun entlang finden und den Ausgang an der London Road nehmen. Die Tankstelle hatte bestimmt geöffnet, dort konnte er sich Zigaretten und ein paar Schokoriegel kaufen.
Er wollte sich gerade auf den Weg machen, als ein Geräusch die Stille durchschnitt, blechern und verzerrt, und es kam aus der Richtung des Bootsschuppens.
»Hallo? Wer ist da?«, rief er. Seine Stimme klang schrill und panisch. Erst als das Geräusch verstummte und Sekunden später wieder von Neuem zu hören war, begriff Lee, dass es sich um den Klingelton eines Handys handelte, das womöglich einem seiner Kollegen gehörte.
Wegen des Schnees konnte er nicht erkennen, wo der Weg endete und der See begann. Er hielt sich möglichst dicht an den Bäumen, die das Ufer säumten, während er vorsichtig auf den Klingelton zuging. Es war eine fürchterlich schnulzige Melodie, und beim Näherkommen hörte Lee, dass sie aus dem Bootsschuppen kam.
Er bückte sich unter das niedrige Dach und sah einen Lichtschimmer im Dunkel hinter dem kleinen Boot. Das Klingeln verstummte. Lee war erleichtert, dass es nichts weiter war als ein Handy. Junkies und Penner kletterten regelmäßig nachts über den Zaun, und Lee und seine Kollegen fanden oft leere Brieftaschen, benutzte Kondome und Spritzen. Wahrscheinlich hatte jemand das Handy weggeworfen. Aber warum? Man wirft doch nur ein richtig beschissenes Handy weg, oder?
Lee ging um den kleinen Bootsschuppen herum. Die Pfosten eines schmalen Anlegestegs ragten aus dem Schnee, und der Steg führte unter das Dach des Schuppens. Dort, wo kein Schnee hingelangt war, konnte Lee sehen, dass das Holz faul war. Vorsichtig bewegte er sich über den Steg und zog unter dem niedrigen Dach, dessen Holz ebenfalls verrottet und zersplittert war, den Kopf ein. Über ihm hingen Spinnweben und Staubfäden. Er war jetzt neben dem Boot und entdeckte auf einem kleinen hölzernen Vorsprung auf der anderen Seite des Schuppens ein iPhone.
Er bekam Herzklopfen. So ein Handy konnte er locker im Pub verkaufen. Er schubste das Ruderboot mit dem Fuß an, doch es rührte sich nicht, denn es saß im Eis fest. Er ging um den Bug des Boots herum und blieb am anderen Ende des Stegs stehen. Er kniete sich hin, beugte sich vor und wischte mit dem Ärmel die dünne Schneeschicht weg, unter der durchsichtiges Eis zum Vorschein kam. Das Wasser darunter war klar, und tief unten konnte er zwei rot-schwarz gescheckte Fische erkennen, die träge umherschwammen. Winzige Bläschen stiegen von den Fischen auf, stießen gegen das Eis und verteilten sich in entgegengesetzte Richtungen.
Als das Handy erneut klingelte, wäre Lee vor Schreck beinahe vom Steg gefallen. Die schnulzige Melodie hallte vom Dach des Schuppens wider. Er konnte das iPhone jetzt deutlich an der gegenüberliegenden Wand sehen, es lag auf der Seite auf dem schmalen Vorsprung direkt über dem Eis. Es steckte in einer Schutzhülle mit Glitzerschmuck. Lee schwang ein Bein über den Rand des Ruderboots. Er stellte einen Fuß auf die Sitzbank, um zu testen, ob es sein Gewicht aushielt, während er mit dem anderen Fuß noch auf dem Steg stand. Das Boot rührte sich nicht.
Er kletterte in das Boot, aber das Gerät war immer noch außer Reichweite. Angespornt von dem Gedanken an ein Bündel Geldscheine in seiner Hosentasche, schwang Lee ein Bein auf der anderen Seite aus dem Boot heraus und testete die Eisdecke. Auf die Gefahr hin, einen nassen Fuß zu bekommen, hielt er sich am Boot fest und belastete das Bein. Das Eis hielt. Er stieg aus dem Boot und lauschte auf verräterisches Quietschen und Ächzen. Nichts. Er machte einen kleinen Schritt, dann noch einen. Es fühlte sich an, als würde er auf Beton gehen.
Das Dach des Schuppens war ziemlich schräg. Um an das iPhone zu gelangen, würde Lee in die Knie gehen müssen.
Auf allen vieren arbeitete er sich vorwärts. Das Handydisplay erleuchtete das Innere des Bootsschuppens. Lee sah ein paar alte Plastikflaschen und anderen Abfall aus dem Eis ragen. Dann fiel sein Blick auf etwas, das ihn erstarren ließ … es sah aus wie eine Fingerspitze.
Mit pochendem Herzen streckte er eine Hand aus und drückte die Fingerspitze vorsichtig. Sie fühlte sich kalt und gummiartig an. Eiskristalle klebten am Fingernagel, der tiefviolett lackiert war. Er zog sich den Jackenärmel über die Hand und rieb das Eis um den Finger glatt. Das Licht des iPhones tauchte die gefrorene Oberfläche in ein schmuddeliges Grün, und unter der Stelle, an der der Finger aus dem Eis ragte, entdeckte Lee eine Hand. Den dazugehörigen Arm verschluckte die Dunkelheit.
Das Handy verstummte, und ohrenbetäubende Stille trat ein. Dann sah er es. Direkt unter ihm befand sich das Gesicht einer jungen Frau. Ihre milchigen, leeren Augen starrten ihn direkt an. Eine dicke Strähne ihres dunklen Haars war im Eis festgefroren. Ein Fisch schwamm vorbei, seine Schwanzflosse berührte den Mund der Frau, der geöffnet war, als wollte sie etwas sagen.
Mit einem Aufschrei wich Lee zurück, sprang auf und stieß sich dabei den Kopf am Dach des Bootsschuppens. Er verlor das Gleichgewicht und landete rücklings auf dem Eis.
Wie benommen blieb er einen Augenblick liegen. Dann hörte er ein leises Quietschen und Knistern. In Panik versuchte er aufzustehen, um so weit wie möglich von der Toten wegzukommen, doch er rutschte immer wieder aus. Plötzlich brach er durch die Eisdecke und glitt in das eiskalte Wasser. Er spürte die schlaffen Arme der Frau, spürte ihre kalte, schleimige Haut. Je mehr er strampelte, um sich zu befreien, desto mehr verhakten sich seine Arme mit ihren. Die Kälte war schneidend und grausam. Er schluckte fauliges Wasser und trat und schlug verzweifelt um sich. Irgendwie gelang es ihm, sich am Rand des Ruderboots festzuklammern. Er würgte und übergab sich und wünschte, er hätte das iPhone erwischt. Aber kein Gedanke mehr daran, es zu verkaufen.
Er wollte nur noch Hilfe rufen.
2
Erika Foster saß seit einer halben Stunde im schäbigen Empfangsbereich des Polizeireviers Lewisham Row. Sie verlagerte das Gewicht auf einem der unbequemen grünen Plastikstühle, die an der Wand entlang am Boden festgeschraubt waren. Die Sitzflächen waren verblasst, blank poliert von all den Ängstlichen und Schuldigen, die sich hier schon den Hintern platt gesessen hatten. Durch ein großes Fenster, das zum Parkplatz hin lag, konnte man im Schneegestöber mit Mühe die Ringstraße, einen grauen Büroturm und das weitläufige Einkaufszentrum ausmachen. Ein Trampelpfad aus Schneematsch verlief diagonal vom Eingang zum Empfangstresen, hinter dem ein Polizist saß, der mit geröteten Augen auf seinen Computerbildschirm stierte. Er hatte ein breites Gesicht mit Hängebacken und knibbelte gedankenverloren an seinen Zähnen herum. Hin und wieder betrachtete er etwas, das er entdeckt hatte, und steckte es sich dann wieder in den Mund.
»Der Chef müsste jeden Augenblick hier sein«, sagte er nach einer Weile.
Er musterte die zierliche Frau in Jeans, Wollpullover und violetter Bomberjacke von oben bis unten. Sein Blick blieb an dem kleinen Rollkoffer hängen, der neben ihr stand. Sie funkelte ihn böse an, und sie wandten sich beide ab. Die Wand neben den Besucherstühlen war gepflastert mit Informationspostern. WERDEN SIE NICHT ZUM OPFER EINES VERBRECHENS stand auf einem. Ziemlich bescheuert, dachte Erika, so ein Poster im Empfangsbereich eines Polizeireviers in einem Londoner Randbezirk aufzuhängen.
An der Tür neben dem Tresen ertönte der Summer, und Chief Superintendent Marsh trat heraus. Sein kurzes Haar war in den Jahren ergraut, seit Erika ihn zum letzten Mal gesehen hatte, aber trotz seines erschöpften Gesichtsausdrucks sah er immer noch gut aus. Erika stand auf und schüttelte ihm die Hand.
»Tut mir leid, dass ich Sie habe warten lassen, DCI Foster. Hatten Sie einen guten Flug?«, fragte er, während er ihre Kleidung registrierte.
»Ja, nur leider verspätet, Sir. Daher bin ich noch in Zivil«, fügte sie hinzu.
»Der verdammte Schnee hätte zu keinem ungünstigeren Zeitpunkt fallen können«, sagte Marsh. Dann wandte er sich dem Diensthabenden zu: »Sergeant Woolf, das ist unsere neue Kollegin DCI Foster aus Manchester. Sie braucht so schnell wie möglich ein Fahrzeug.«
»Ja, Sir«, sagte Woolf.
»Und ich brauche ein Handy«, sagte Erika. »Falls Sie ein älteres Modell hätten, am liebsten eins mit Tasten. Ich kann Touchscreens nicht ausstehen.«
»Machen wir uns an die Arbeit«, sagte Marsh. Er zog seinen Dienstausweis durch den Scanner, woraufhin der Summer ertönte und die Tür aufsprang.
»Eingebildete Zicke«, murmelte Woolf, nachdem die Tür sich hinter den beiden geschlossen hatte.
Erika folgte Marsh einen langen, niedrigen Korridor hinunter. Telefone klingelten, Polizisten in Uniform und zivile Angestellte eilten an ihnen vorbei, ihre teigigen Januargesichter angespannt und konzentriert. Auf einer Pinnwand war eine Fantasy-Fußball-Liga dargestellt, und gleich dahinter, auf einer identischen Pinnwand, hingen mehrere Reihen Fotos unter der Überschrift: IN AUSÜBUNG IHRER PFLICHT GETÖTET. Erika schloss die Augen und öffnete sie erst wieder, als sie sich ganz sicher war, dass sie die Fotos passiert hatte. Sie wäre beinahe gegen Marsh geprallt, der vor einer Tür mit der Aufschrift EINSATZZENTRALE stehen geblieben war. Durch die halb offenen Jalousien der Glaswand sah sie, dass der Raum voll war. Angst schnürte ihr die Kehle zu. Sie schwitzte in ihrer dicken Jacke. Marsh ergriff die Türklinke.
»Sir, Sie wollten mich kurz einweisen, bevor …«, setzte sie an.
»Keine Zeit«, unterbrach er sie, und ehe Erika reagieren konnte, öffnete er die Tür und ließ ihr den Vortritt.
Die zwei Dutzend Polizisten in dem großen, offenen Raum verstummten, ihre erwartungsvollen Gesichter wirkten bleich in dem kalten Neonlicht. Entlang der Glaswände zu beiden Seiten verliefen Flure, an einer Wand standen mehrere Kopierer und Drucker. Auf den Teppichfliesen waren vor den Maschinen sowie zwischen den Schreibtischen und den an der hinteren Wand befestigten Whiteboards Trampelpfade entstanden. Während Marsh nach vorn ging, verstaute Erika eilig ihren Koffer neben einem Kopierer, der unermüdlich Papier ausspuckte. Dann setzte sie sich auf eine Schreibtischkante.
»Morgen allerseits«, sagte Marsh. »Wie wir alle wissen, wurde die dreiundzwanzigjährige Andrea Douglas-Brown vor vier Tagen als vermisst gemeldet, was in den Medien für großes Aufsehen gesorgt hat. Um kurz nach neun heute Morgen wurde auf dem Gelände des Horniman Museums in Forest Hill die Leiche einer jungen Frau gefunden, auf die die Beschreibung von Andrea Douglas-Brown passt. Eine vorläufige Identifizierung stützt sich auf ein Handy, das auf Andrea Douglas-Brown registriert ist, die offizielle Identifizierung steht noch aus. Die Forensiker sind auf dem Weg zum Fundort, aber der verdammte Schnee hält natürlich alles auf …« Ein Telefon klingelte. Marsh unterbrach sich. Das Telefon klingelte weiter. »Verdammt noch mal, Leute, das hier ist eine Einsatzzentrale. Kann mal jemand rangehen?«
Ein junger Mann im hinteren Teil des Raums nahm den Hörer ab und begann, leise zu sprechen.
»Falls die Identität sich bestätigt, haben wir es mit dem Mord an einer jungen Frau zu tun, die einer sehr mächtigen und einflussreichen Familie entstammt, und das bedeutet, dass wir immer eine Nasenlänge voraus sein müssen. Der Presse natürlich. Sonst rollen Köpfe.«
Die aktuellen Tageszeitungen lagen auf dem Schreibtisch vor Erika. Die Schlagzeilen schrien: TOCHTER VON HOCHRANGIGEM LABOURFUNKTIONÄR VERSCHWUNDEN und ANDIE VON TERRORISTEN ENTFÜHRT? Die dritte Zeitung hatte das auffälligste Titelblatt. Sie brachte ein ganzseitiges Foto von Andrea Douglas-Brown unter der Balkenüberschrift: ENTFÜHRT?
»Das ist DCI Foster von der Manchester Metropolitan Police, sie ist hier, um uns zu unterstützen«, schloss Marsh. Erika spürte alle Blicke auf sich.
»Guten Morgen«, sagte sie. »Ich freue mich …«
Ein Polizist mit fettigen schwarzen Haaren fiel ihr ins Wort.
»Chef, ich bin an dem Fall Douglas-Brown dran, seit die junge Frau vermisst wurde und …«
»Und was, DCI Sparks?«, fragte Marsh.
»Und meine Leute und ich arbeiten rund um die Uhr. Im Moment gehen wir mehreren Spuren nach. Ich stehe in Kontakt mit der Familie …«
»DCI Foster hat sehr viel Erfahrung mit heiklen Mordfällen …«
»Aber …«
»Sparks, die Entscheidung steht nicht zur Diskussion. DCI Foster wird diesen Fall übernehmen … Sie wird sich sofort an die Arbeit machen, und ich weiß, dass Sie sie nach besten Kräften unterstützen werden«, sagte Marsh. Eine betretene Stille trat ein. Sparks lehnte sich in seinem Stuhl zurück und betrachtete Erika mit unverhohlener Abneigung. Sie hielt seinem Blick stand.
Marsh fuhr fort: »Und kein Wort nach draußen – ich meine es ernst. Kein Wort an die Presse oder an sonst irgendjemanden. Alles klar?« Zustimmendes Gemurmel ertönte.
»DCI Foster, in mein Büro.«
Erika stand in Marshs Büro im obersten Stock, während dieser einen Stapel Unterlagen auf seinem Schreibtisch durchging. Sie schaute aus dem Fenster, von wo aus man einen guten Blick auf Lewisham hatte. Hinter dem Einkaufszentrum und dem Bahnhof erstreckten sich unregelmäßige Zeilen niedriger Reihenhäuser aus Backstein bis nach Blackheath. Marshs Zimmer unterschied sich deutlich von den üblichen Chefzimmern bei der Polizei. Es gab keine Modellautos auf den Fensterbänken, keine Familienfotos in den Regalen. Auf dem Schreibtisch herrschte ein heilloses Durcheinander aus Papierstapeln, und ein Regal neben dem Fenster, das offenbar als Notablage diente, war gefüllt mit überquellenden Fallakten, ungeöffneter Post, alten Weihnachtskarten und eng beschrifteten Haftnotizen, die sich an den Ecken rollten. In einer Ecke hingen Marshs Ausgehuniform und die dazugehörige Mütze über einer Stuhllehne, während auf der zerknitterten Uniformhose sein Blackberry lag, das er zum Laden ans Kabel gehängt hatte. Es war eine seltsame Mischung aus Studentenbude und Chefzimmer.
Marsh hatte endlich einen kleinen, wattierten Umschlag in dem Stapel gefunden, den er Erika reichte. Sie riss den Umschlag auf und entnahm ihm die Brieftasche mit ihrer Polizeimarke und ihrem Dienstausweis.
»Hm, ich werde also vom Nobody zur Heldin befördert?«, fragte sie, während sie die Marke hin und her drehte.
»Es geht nicht um Sie, DCI Foster. Sie sollten sich freuen«, sagte Marsh, ging um seinen Schreibtisch herum und ließ sich in seinen Sessel fallen.
»Man hat mir unmissverständlich zu verstehen gegeben, Sir, dass ich nach meiner Rückkehr in den Dienst mindestens ein halbes Jahr Innendienst verrichten müsse.«
Marsh bedeutete ihr, ihm gegenüber Platz zu nehmen.
»Foster, als ich Sie angerufen habe, hatten wir es noch mit einem Vermisstenfall zu tun. Jetzt haben wir einen Mordfall. Muss ich Sie daran erinnern, wer der Vater des Opfers ist?«
»Lord Douglas-Brown. War der Mann nicht einer der wichtigsten Vertragspartner der Regierung während des Irakkriegs? Während er gleichzeitig als Abgeordneter im Kabinett saß?«
»Es geht hier nicht um Politik.«
»Seit wann interessiere ich mich für Politik, Sir?«
»Andrea Douglas-Brown ist in meinem Revier verschwunden. Lord Douglas-Brown übt großen Druck aus. Er ist ein einflussreicher Mann, der eine Karriere befördern oder sie ruinieren kann. Ich habe am späten Vormittag eine Besprechung mit dem Assistant Commissioner und jemandem aus dem verdammten Cabinet Office …«
»Es geht also um Ihre Karriere?«
Marsh funkelte sie an. »Ich brauche erstens die Identität der Leiche und zweitens einen Verdächtigen. Und zwar schnell.«
»Ja, Sir.« Erika zögerte. »Darf ich Sie fragen, warum ausgerechnet ich? Bin ich der Sündenbock, ist das der Plan? Und anschließend darf Sparks den Schlamassel beseitigen und den Helden spielen? Ich finde nämlich, ich habe es verdient zu wissen, ob …«
»Andreas Mutter ist Slowakin, ebenso wie Sie … Ich dachte, es könnte nicht schaden, einer Frau den Fall zu übertragen, mit der die Mutter des Opfers sich identifizieren kann.«
»Es ist also gute PR, mir den Fall zu geben?«
»Wenn Sie so wollen. Außerdem weiß ich, was für eine außergewöhnlich gute Polizistin Sie sind. Okay, Sie hatten in letzter Zeit einigen Ärger, aber Ihre Leistungen stellen alles andere in den Schatten.«
»Sie brauchen mir keinen Honig um den Bart zu schmieren, Sir.«
»Foster, eins haben Sie nie kapiert, und das ist die Funktionsweise des Polizeiapparats. Wenn Sie die verstanden hätten, dann säßen Sie jetzt auf dieser Seite des Schreibtischs.«
»Tja, ich habe eben meine Prinzipien«, sagte Erika und sah ihn durchdringend an. Einen Moment lang herrschte Schweigen.
»Erika … Ich habe Sie ins Spiel gebracht, weil ich glaube, dass Sie eine neue Chance verdient haben. Reden Sie sich nicht um Kopf und Kragen, bevor Sie überhaupt angefangen haben.«
»Ja, Sir«, sagte Erika.
»Und jetzt fahren Sie zum Tatort. Melden Sie sich bei mir, sobald Sie irgendwelche Informationen haben. Falls es sich um Andrea Douglas-Brown handelt, muss jemand von der Familie sie identifizieren.«
Erika stand auf und wandte sich zum Gehen. »Ich hatte bei der Beerdigung leider keine Gelegenheit«, fuhr Marsh etwas milder fort, »Ihnen zu sagen, wie leid mir das tut mit Mark … Er war ein hervorragender Polizist und ein guter Freund.«
»Danke, Sir.« Erika betrachtete den Teppich. Es machte ihr immer noch zu schaffen, seinen Namen ausgesprochen zu hören. Sie kämpfte mit den Tränen. Marsh räusperte sich, und sein professioneller Ton war wieder da.
»Ich weiß, ich kann mich darauf verlassen, dass Sie in diesem Fall bald einen Schuldigen präsentieren. Halten Sie mich über jeden Ihrer Schritte auf dem Laufenden.«
»Ja, Sir«, sagte Erika.
»Und DCI Foster?«
»Sir?«
»Raus aus der Zivilkleidung.«
3
Erika ging in die Damenumkleide und zog sich eilig die fast schon vergessene, aber immer noch vertraute Kombination aus schwarzer Hose, weißer Bluse, dunklem Pullover und langer Lederjacke an.
Sie war gerade dabei, ihre Zivilkleidung in einem Spind unterzubringen, als sie am Ende einer der langen Holzbänke eine zerknitterte Ausgabe der Daily Mail entdeckte. Sie zog die Zeitung näher und glättete sie. Unter der Schlagzeile TOCHTER VON HOCHRANGIGEM LABOURFUNKTIONÄR VERSCHWUNDEN war ein großes Foto von Andrea Douglas-Brown abgedruckt. Die hübsche junge Frau war eine gepflegte Erscheinung mit langem dunklem Haar, vollen Lippen und leuchtenden braunen Augen. Ihre Haut war sonnengebräunt, sie trug ein knappes Bikini-Top und hatte die Schultern gestrafft, um ihre üppigen Brüste zu betonen. Sie schaute direkt in die Kamera, ihr Blick war ernst und selbstbewusst. Das Foto war auf einer Jacht aufgenommen worden, der Himmel im Hintergrund war blau, Wellen glitzerten in der Sonne. Rechts und links von Andrea Douglas-Brown standen zwei Männer, einer größer, einer kleiner, von denen nur die muskulösen Schultern zu sehen waren.
Die Daily Mail beschrieb die junge Frau als »unbedeutendes Partygirl«, was Andrea garantiert nicht gefallen hätte, dachte Erika. Immerhin wurde darauf verzichtet, sie »Andie« zu nennen, wie die anderen Boulevardblätter es getan hatten. Die Zeitung hatte mit ihren Eltern gesprochen, Lord und Lady Douglas-Brown, ebenso mit ihrem Verlobten, und alle flehten Andrea an, sich bei ihnen zu melden.
Erika kramte in den Taschen ihrer Lederjacke; ihr Notizheft war tatsächlich nach all den Monaten noch da. Sie notierte sich den Namen des Verlobten, Giles Osborne, und schrieb: Ist Andrea abgehauen? Sie betrachtete den Satz, dann strich sie ihn so heftig durch, dass das Papier riss. Sie steckte das Notizheft in ihre linke Gesäßtasche und wollte ihren Dienstausweis in die rechte Tasche stecken, hielt jedoch inne und genoss es einen Augenblick lang, ihn in der Hand zu spüren: das vertraute Gewicht, das lederne Etui, das nach all den Jahren die Form ihrer Pobacke angenommen hatte.
Erika stellte sich vor den Spiegel über einem der Waschbecken, klappte das lederne Etui auf und hielt es vor sich. Das Foto im Dienstausweis zeigte eine selbstbewusste Frau mit aus der Stirn frisiertem blondem Haar, die herausfordernd in die Kamera blickte. Die Frau, die ihr aus dem Spiegel entgegenschaute und den Ausweis in der Hand hielt, war mager und blass. Ihr kurzes blondes Haar war struppig, die Ansätze waren grau. Einen Moment lang betrachtete Erika ihren zitternden Arm, dann klappte sie das Etui zu.
Sie würde ein neues Foto beantragen.
4
Sergeant Woolf wartete auf dem Korridor, als Erika aus der Damenumkleide kam. Während er neben ihr herwatschelte, stellte er fest, dass sie einen ganzen Kopf größer war als er.
»Hier ist Ihr Handy. Es ist frisch aufgeladen«, sagte er und überreichte ihr eine durchsichtige Plastiktüte mit einem Handy und einem Ladegerät. »Nach der Mittagspause steht ein Wagen für Sie bereit.«
»Haben Sie wirklich keins mit Tasten?«, fragte Erika grimmig und begutachtete das Smartphone durch das Plastik.
»Es hat eine Taste zum Ein- und Ausschalten«, sagte der Diensthabende.
»Wenn mein Wagen kommt, könnten Sie den dann bitte in den Kofferraum packen?«, fragte sie und zeigte auf ihren Rollkoffer. Dann ging sie an Woolf vorbei zur Einsatzzentrale. Alle Gespräche verstummten, als sie den Raum betrat. Eine kleine, mollige Frau trat auf sie zu.
»Ich bin Detective Moss. Wir sind gerade dabei, ein Büro für Sie zu organisieren.« Die Frau hatte drahtiges rotes Haar und ein von Sommersprossen übersätes Gesicht. »Alle Infos gehen an die Boards, sobald sie reinkommen, und ich bringe Ihnen Ausdrucke ins Büro, wenn …«
»Ein Schreibtisch reicht völlig«, sagte Erika. Sie ging zu den Whiteboards, an denen ein großer, detaillierter Plan des Museumsgeländes und darunter ein aus einer Überwachungskamera stammendes Foto von Andrea Douglas-Brown hingen.
»Das ist das letzte bekannte Foto von ihr, aufgenommen am Bahnhof London Bridge, wo sie um 20:47 Uhr den Zug nach Forest Hill genommen hat«, sagte Moss, die Erika gefolgt war. Auf dem Foto war die junge Frau zu sehen, wie sie gerade ein wohlgeformtes Bein in den Waggon setzte. Ihr Gesichtsausdruck wirkte zornig. Sie hatte sich in Schale geworfen und trug eine enge Lederjacke über einem kurzen schwarzen Kleid, pinkfarbene High Heels und dazu eine farblich passende Clutch.
»War sie allein, als sie in die Bahn gestiegen ist?«, fragte Erika.
»Ja. Ich habe das Video hier, aus dem wir das Standbild herauskopiert haben«, sagte Moss, nahm einen Laptop von einem der Schreibtische, stellte ihn auf einen Stapel Akten und klickte auf Vollbildmodus. Auf dem Video war im Zeitraffer zu sehen, wie Andrea Douglas-Brown den Bahnsteig überquerte und in die Bahn stieg. Moss ließ die nur wenige Sekunden dauernde Sequenz als Endlosschleife laufen.
»Sie wirkt richtig wütend«, bemerkte Erika.
»Ja. Als hätte sie sich vorgenommen, jemand die Meinung zu geigen«, sagte Moss.
»Wo war ihr Verlobter?«
»Der hat ein wasserdichtes Alibi, er war auf einer Veranstaltung im Stadtzentrum.«
Mehrmals hintereinander sahen sie die junge Frau den Bahnsteig überqueren und in den Zug steigen. Sie war die einzige Person auf dem ansonsten menschenleeren Bahnsteig.
»Das ist Sergeant Crane«, sagte Moss und zeigte auf einen jungen Mann mit sehr kurzem blondem Haar, der – den Telefonhörer ans Ohr geklemmt und einen Mars-Riegel zwischen den Zähnen – eine Akte durchblätterte. Aus dem Augenwinkel sah Erika, wie Sparks das Telefon ablegte. Dann zog er sich seine Jacke über und ging zur Tür.
»Wo gehen Sie hin?«, fragte sie. Sparks blieb stehen und drehte sich um.
»Die Spurensicherung hat den Tatort freigegeben. Wir brauchen die Identität des Opfers, falls Sie das vergessen haben sollten, Ma’am.«
»Ich möchte, dass Sie hierbleiben, Sparks. Detective Moss, Sie kommen heute mit mir – und Sie, wie heißen Sie?«, fragte sie einen großen, gut aussehenden schwarzen Detective, der an einem Schreibtisch in der Nähe gerade einen Anruf entgegennahm.
Der junge Mann bedeckte das Telefon mit der Hand. »Peterson«, sagte er.
»Okay, Detective Peterson, Sie kommen auch mit mir.«
»Und was soll ich in der Zwischenzeit tun? Hier rumsitzen und Däumchen drehen?«, wollte Sparks wissen.
»Nein. Ich brauche das Material aus sämtlichen Überwachungskameras im Horniman Museum und in den angrenzenden Straßen.«
»Das haben wir bereits durchgesehen«, erwiderte er gereizt.
»Ich möchte, dass Sie die Überprüfung bis auf achtundvierzig Stunden vor dem Verschwinden der jungen Frau ausdehnen und auf alles danach. Und ich möchte eine Tür-zu-Tür-Befragung rund um das Museum. Außerdem brauche ich alles, was Sie über Andrea Douglas-Brown in Erfahrung bringen können. Angehörige, Freunde, Kontoinformationen, Gesundheitsunterlagen, Telefonunterlagen, E-Mails, soziale Medien. Wer mochte sie? Wer konnte sie nicht leiden? Ich will alles wissen. Hatte sie einen Computer, einen Laptop? Hatte sie garantiert. Ich brauche beides.«
»Man hat mir gesagt, dass wir ihren Laptop nicht haben können, Lord Douglas-Brown hat sich sehr eindeutig …«
»Und ich sage Ihnen, Sie sollen ihn besorgen«, schnitt Erika ihm das Wort ab. In der Einsatzzentrale waren alle Gespräche verstummt, aber Erika ließ sich nicht beirren: »Und niemand, ich wiederhole: niemand redet mit der Presse oder sonst irgendwem, egal, in welcher Funktion. Haben Sie mich verstanden? Ich will nicht einmal hören, dass jemand sagt: ›Kein Kommentar.‹ Keinen Pieps … Reicht das, um Ihre Zeit sinnvoll zu füllen, DCI Sparks?«
»Ja«, sagte Sparks mit vor Wut funkelnden Augen.
»Und Crane, Sie halten den Betrieb in der Einsatzzentrale aufrecht?«
»Klar«, sagte er, während er den Rest seines Mars-Riegels herunterschluckte.
»Schön. Um vier treffen wir uns wieder hier.«
Erika verließ den Raum, gefolgt von Moss und Peterson. Sparks warf seine Jacke auf seinen Stuhl.
»Miststück«, murmelte er vor sich hin und setzte sich wieder an seinen Computer.
5
Moss schaute über das Lenkrad hinweg auf die schneebedeckte Straße. Erika saß neben ihr auf dem Beifahrersitz und Peterson hinten. Das unbehagliche Schweigen wurde regelmäßig von den Scheibenwischern unterbrochen, die über die Scheibe quietschten und aussahen, als wären sie mit Kokosraspeln beklebt.
Südlondon war eine Palette aus schmutzigen Grautönen, eine Ansammlung verfallender Reihenhäuser, deren Vorgärten zubetoniert worden waren und jetzt als Parkplätze dienten. Die einzigen Farbtupfer bildeten die schwarzen, grünen und blauen Mülltonnen an den Straßenecken.
Die Straße machte eine scharfe Linkskurve, dann kamen sie am Ende eines Staus an der Einfahrt zum Catford-Kreisverkehr zum Stehen. Moss schaltete die Sirene ein, und die Autos wichen auf den Gehweg aus, um sie vorbeizulassen. Die Heizung im Streifenwagen funktionierte nicht, was Erika einen guten Grund gab, ihre zitternden Hände in den Taschen ihrer Lederjacke zu vergraben. Sie hoffte, dass es der Hunger war, der ihre Hände zittern ließ, und nicht der Druck der vor ihr liegenden Aufgabe. Sie entdeckte eine Tüte roter Lakritzschlangen im Fach über dem Funkgerät.
»Darf ich?«, fragte sie.
»Klar«, sagte Moss, während sie Gas gab und durch die Lücke stieß, die sich gebildet hatte, wobei der Wagen auf der vereisten Straße hinten kurz ausbrach. Erika zog eine Lakritzschlange aus der Tüte, steckte sie sich in den Mund und kaute. Sie betrachtete Peterson im Rückspiegel. Er saß konzentriert über sein iPad gebeugt. Er war groß und schmal und hatte ein jungenhaftes Gesicht. Er erinnerte sie an einen hölzernen Spielzeugsoldaten. Er schaute auf, und ihre Blicke begegneten sich.
»Also. Was können Sie mir über Andrea Douglas-Brown erzählen?«, fragte Erika und nahm noch eine Lakritzschlange aus der Tüte.
»Hat man Sie nicht bereits informiert, Chefin?«, fragte Peterson.
»Doch. Aber tun wir einfach mal so, als wäre dem nicht so. Ich gehe an jeden Fall so heran, als wüsste ich gar nichts. Es ist erstaunlich, was für neue Erkenntnisse sich auf diese Weise ergeben.«
»Sie ist dreiundzwanzig«, sagte Peterson.
»Hat sie gearbeitet?«
»Keine Erwerbsbiografie.«
»Warum nicht?«
Peterson zuckte die Achseln. »Sie brauchte nicht zu arbeiten. Lord Douglas-Brown ist der Besitzer von SamTech, einem privaten Rüstungsunternehmen. Die entwickeln GPS-Programme und Softwaresysteme für die Regierung. Bei der letzten Berechnung war er dreißig Millionen schwer.«
»Geschwister?«, fragte Erika.
»Ja, sie hat einen jüngeren Bruder, David, und eine ältere Schwester, Linda.«
»Man könnte also sagen, Andrea und ihre Geschwister leben vom Familienvermögen?«
»Ja und nein. Die Schwester, Linda, arbeitet, wenn auch für ihre Mutter. Lady Douglas-Brown besitzt einen Laden für Edelfloristik. Und David studiert.«
Sie befanden sich inzwischen auf der Catford High Street, wo gestreut war, sodass der Verkehr normal floss. Sie fuhren an Ramschläden, Geldverleihern und Importläden vorbei, vor denen sich wacklige Stapel mit Waren aus aller Welt auftürmten, die in den Schneematsch auf dem Gehweg zu stürzen drohten.
»Was ist mit dem Verlobten, Giles Osborne?«
»Sie haben … sie hatten für diesen Sommer eine große Hochzeit geplant«, sagte Moss.
»Was macht er?«, fragte Erika.
»Er leitet eine Veranstaltungsagentur der gehobenen Preisklasse: die Henley Regatta, Produktplatzierungen, Society-Hochzeiten.«
»Haben die beiden zusammengelebt?«
»Nein. Sie wohnte noch bei ihren Eltern in Chiswick.«
»Das ist Westlondon, richtig?«, fragte Erika. Peterson schaute sie im Rückspiegel an und nickte.
Moss fuhr fort: »Sie müssten mal sehen, wie die wohnen. Die haben vier Häuser zusammengelegt, die Keller ausgebaut. Das ist Millionen wert.«
Sie fuhren an einem offenbar geschlossenen Fliesenmarkt vorbei, dessen leerer Parkplatz ein großes weißes Rechteck bildete, dann an einem Harvester Restaurant, vor dem gerade ein Mann mit Ohrenschützern einen riesigen Weihnachtsbaum in einen Schredder schob. Das Rattern der Maschine dröhnte durch den Streifenwagen und wurde wieder leiser, als eine Reihe heruntergekommener Pubs in Sichtweite kam. Vor einem Pub namens The Stag lehnte eine alte Frau mit eingefallenem Gesicht an der grünen Tür und rauchte. Neben ihr hatte ein Hund den Kopf in eine Mülltüte gesteckt und beförderte Essensreste in den Schnee.
»Was zum Teufel hatte Andrea Douglas-Brown hier zu suchen, noch dazu allein? Bisschen weit ab vom Schuss für die Tochter eines Millionärs aus Chiswick, oder?«, bemerkte Erika.
Dichtes Schneegestöber behinderte kurzfristig die Sicht, dann tauchte das Horniman Museum vor ihnen auf. Das Sandsteingebäude wurde von hohen Yuccas und Palmen flankiert, die, so eingeschneit wie sie waren, etwas deplatziert wirkten.
Moss näherte sich langsam dem schmiedeeisernen Tor und hielt neben einem jungen uniformierten Polizisten. Erika ließ das Fenster herunter, woraufhin der junge Kollege sich bückte und eine behandschuhte Hand in den Türrahmen legte. Schneeflocken wirbelten ins Auto und blieben an der gepolsterten Innenseite der Tür kleben. Erika zeigte ihren Dienstausweis.
»Die nächste links. Es geht steil hoch. Wir haben einen Streuwagen da raufgeschickt, aber fahren Sie trotzdem langsam«, sagte der Polizist. Erika nickte und ließ ihr Fenster wieder hoch. Moss bog links ab, und sie fuhren den Hügel hinauf. Kurz vor der Kuppe befand sich eine Straßensperre, bewacht von einem weiteren uniformierten Polizisten. Links vom Absperrband standen ein paar Journalisten in dicken Wintersachen beisammen. Sie interessierten sich sofort für den Streifenwagen und ließen ihre Blitzlichter zucken.
»Haut ab«, knurrte Moss, während sie versuchte herunterzuschalten. Das Getriebe krachte, der Streifenwagen machte einen Satz, dann war der Motor abgewürgt. »Verfluchter Mist!«, zischte Moss und umklammerte das Steuerrad. Sie trat auf die Bremse, doch der Wagen rutschte weiter. Im Rückspiegel sah Erika die steile Straße hinter ihnen. Die Journalisten fotografierten das Schauspiel voller Begeisterung.
»Scharf links einschlagen!«, schrie Peterson, kurbelte hastig sein Fenster herunter und streckte den Kopf hinaus. Erika klammerte sich ans Armaturenbrett, während Moss sich ins Zeug legte und es tatsächlich schaffte, die Rutschpartie zu beenden, indem sie den Wagen in eine Parklücke lenkte, die gerade erst frei geworden und daher schneefrei war. Die Reifen fanden Halt auf dem trockenen Asphalt, und der Wagen blieb stehen.
»Das war pures Glück«, sagte Peterson mit einem Grinsen. Schneeflocken taumelten durch sein Fenster und blieben in seinen kurzen Dreadlocks hängen.
»Das war pures Eis«, konterte Moss und holte tief Luft.
Erika löste den Sicherheitsgurt. Sie schämte sich dafür, dass ihre Beine zitterten. Sie stiegen aus und wurden von den hohnlachenden Journalisten empfangen, die ihnen Fragen zur Identität der Leiche zuriefen. Im dichten Schneegestöber wiesen sie sich aus und wurden durchgelassen. Es war ein gutes Gefühl, wieder zurück zu sein, dachte Erika, als sie den vertrauten Dienstausweis in der Hand spürte und das Absperrband für sie angehoben wurde. Ein uniformierter Kollege wies ihnen den Weg zu dem schmiedeeisernen Tor, das aufs Museumsgelände führte.
Die Spurensicherung hatte über dem Bootsschuppen ein riesiges weißes Zelt aufgespannt, dessen Konturen im Schneetreiben verschwammen. Ein Assistent reichte Erika, Moss und Peterson Tatort-Schutzanzüge, die sie überstreiften, bevor sie das Zelt betraten.
Grelles Scheinwerferlicht wurde vom Schnee reflektiert und beleuchtete das faule Holz des niedrigen Dachs. Darunter suchten vier Forensiker jeden Zentimeter des Schuppeninneren ab. Ein Ruderboot lag nass glänzend auf dem schmalen Steg, und ein Polizeitaucher in schwarzem Neoprenanzug kam gerade aus dem eisigen Wasser hoch und mit ihm ein warmer, widerlicher Gestank. Zwischen Eisstücken, die in der Hitze des Scheinwerferlichts schmolzen, dümpelten alte Plastikflaschen und anderer Müll.
»DCI Foster.«
Erika musste hochblicken, um den großen Mann zu begrüßen, zu dem die tiefe männliche Stimme gehörte und der hinter dem Bootsschuppen hervorgetreten war. Als er seine Schutzmaske herunterzog, kam ein stolzes, schönes Gesicht mit dunklen Augen zum Vorschein. Seine Augenbrauen waren zu zwei schmalen, perfekt geschwungenen Linien gezupft.
»Isaac Strong, Gerichtsmediziner«, stellte er sich vor. »Ich kenne Moss und Peterson«, fügte er hinzu. Die beiden nickten. Er ging voraus um den Bootsschuppen herum zu einer metallenen Bahre, die hinter dem Zelt stand. Die Tote, die darauf lag, war nackt bis auf die Reste eines zerrissenen, schlammverschmierten Kleids, das sich um ihre Taille gewickelt hatte. Darunter waren Reste eines schwarzen Stringtangas zu erkennen. Die vollen Lippen der Toten waren leicht geöffnet, und einer ihrer Schneidezähne war fast ganz abgebrochen. Ihre Augen waren weit offen, der Blick todesstarr und milchig, und in ihrem verfilzten Haar hingen Blätter und anderer Schmutz aus dem Wasser.
»Das ist sie, oder?«, sagte Erika leise. Moss und Peterson nickten.
»Okay«, sagte Strong. »Die Leiche war im Eis eingefroren, als man sie gefunden hat. Zu diesem frühen Zeitpunkt würde ich mal vorsichtig schätzen, ich wiederhole: vorsichtig schätzen, dass sie mindestens zweiundsiebzig Stunden im Wasser gelegen hat. Vor drei Tagen sind die Temperaturen unter null Grad gesunken. Ihr Handy funktionierte noch, als sie gefunden wurde. Ein junger Bursche, der hier arbeitet, hat es klingeln hören.« Er reichte Erika eine Plastiktüte mit einem iPhone, dessen Schutzhülle mit Swarovski-Kristallen verziert war.
»Wissen wir, wer angerufen hat?«, fragte Erika in der Hoffnung auf eine Spur.
»Nein. Kurz nachdem wir das Ding gesichert haben, hat die Batterie den Geist aufgegeben. Wir konnten auch keine Fingerabdrücke feststellen.«
»Wo ist der Mann, der sie gefunden hat?«
»In einem Notarztwagen vor dem Besucherzentrum. Er war total hysterisch, als die Polizei hier eintraf. Er war durch die Eisdecke gebrochen und auf die Tote gefallen, hatte sich übergeben und in die Hose gemacht. Wir versuchen also, seine DNS so schnell wie möglich zu eliminieren.« Strong trat näher an die Tote.
»Das aufgedunsene Gesicht und die Würgemale am Hals könnten auf Strangulation hindeuten, außerdem ist ihr rechtes Schlüsselbein gebrochen«, sagte er, während er mit der rechten Hand, die in einem Latexhandschuh steckte, den Kopf der Toten leicht zur Seite drehte. »Es fehlen zwei Haarbüschel, und zwar jeweils an den Schläfen.«
»Der Täter könnte sie von hinten gepackt und an den Haaren gerissen haben«, bemerkte Moss.
»Irgendwelche Hinweise auf sexuelle Gewalt?«, fragte Erika.
»Ich brauche Zeit, um sie mir genauer anzusehen. An den Innenseiten ihrer Schenkel, an Rippen und Brüsten finden sich Striemen und Kratzer.«
Er zeigte auf mehrere rote Linien unter beiden Brüsten und auf Fingerabdrücke an ihrem Brustkorb. »Einschnittwunden an den Handgelenken deuten darauf hin, dass sie gefesselt war, aber als sie ins Wasser fiel, waren ihre Arme frei. Sie hat Hämatome am Hinterkopf, und im vorderen Eckpfosten des Stegs haben wir Spuren von Zahnschmelz gefunden … Nach dem abgebrochenen Zahn suchen wir noch. Möglicherweise hat sie ihn verschluckt, dann finde ich ihn später.«
»Als sie verschwunden ist, trug sie pinkfarbene Stöckelschuhe und hatte eine dazu passende Handtasche bei sich. Haben Sie die gefunden?«, fragte Moss.
»Sie hatte nur das Kleid und den Tanga an, keinen BH … keine Schuhe.« Strong hob vorsichtig die Beine der Toten an. »Ihre Fersen weisen tiefe Schnittwunden auf.«
»Sie wurde barfuß über den Boden geschleift«, sagte Erika, entsetzt über den Anblick der tiefen Schürfwunden in den Füßen, die das rosafarbene Fleisch freigaben.
»Einer unserer Taucher hat das hier aus dem Wasser geholt.« Strong gab Erika einen kleinen, durchsichtigen Plastikbeutel, der einen Führerschein enthielt. Schweigend betrachteten sie das Foto.
»Ein sehr lebhaftes Foto«, sagte Peterson. »Als wäre sie hier und würde uns über den Tod hinaus ansehen.«
Peterson hatte recht, dachte Erika. Auf Passfotos wirkten Augen häufig trüb, oder die Person wirkte wie im Scheinwerferlicht erstarrt, aber Andrea blickte frei und selbstbewusst in die Kamera.
»Mein Gott«, sagte Erika, als sie sich von dem Foto abwandte und die Leiche betrachtete, die verdreckt und mit aufgerissenen Augen auf der Bahre lag. »Wann können Sie uns die genaue Todesursache nennen?«
»Was ich Ihnen gesagt habe, muss erst mal reichen. Alles Weitere nach der Autopsie«, antwortete Strong leicht gereizt.
»Die Sie heute noch durchführen werden«, sagte Erika mit durchdringendem Blick.
»Ja. Heute«, erwiderte Strong.
Außerhalb des Zelts der Spurensicherung war es still. Es hatte aufgehört zu schneien. Mehrere uniformierte Polizisten suchten schweigend das Seeufer ab und wühlten mit ihren Stiefeln den Schnee auf.
Erika nahm ihr Handy heraus und rief Marsh an. »Sir. Es ist Andrea Douglas-Brown«, sagte sie.
Einen Augenblick lang herrschte Stille. »Verdammter Mist.«
»Ich bin auf dem Weg zu dem jungen Mann, der sie gefunden hat, anschließend werde ich die Eltern aufsuchen und informieren«, sagte Erika.
»Was denken Sie, Foster?«
»Es war zweifellos Mord, möglicherweise Vergewaltigung mit Strangulation oder Ertränken. Alles, was ich habe, ist auf dem Weg zu den Kollegen im Revier.«
»Irgendwelche Verdächtigen?«
»Nein, Sir. Aber ich tue, was ich kann. Wir brauchen eine offizielle Identifizierung durch die Familie. Der Pathologe führt heute noch eine Autopsie durch. Ich halte Sie auf dem Laufenden.«
»Wenn ich den Medien sagen könnte, dass wir einen Verdächtigen haben …«
»Ich weiß, Sir«, fiel sie ihm ins Wort. »Als Erstes nehmen wir uns die Angehörigen vor. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sie ihren Mörder gekannt hat. Es gibt keine Zeugen für ihr Verschwinden, niemand hat beobachtet, dass sie entführt wurde. Möglicherweise ist sie ihrem Mörder hier begegnet.«
»Immer mit der Ruhe, Foster. Stürzen Sie sich nicht auf die Idee, dass sie da zu einem schrägen Stelldichein verabredet war.«
»Ich habe doch gar nichts von einem schrägen Stelldichein gesagt.«
»Vergessen Sie nicht, dass wir es mit einer sehr angesehenen Familie zu tun haben, die …«
»Ich mache das nicht zum ersten Mal, Sir.«
»Richtig. Aber berücksichtigen Sie, mit wem wir es zu tun haben.«
»Ja. Mit trauernden Angehörigen. Und ich werde ihnen die üblichen Fragen stellen müssen, Sir.«
»Selbstverständlich. Aber tun Sie es taktvoll. Das ist ein Befehl.«
Erika legte auf. Marshs Einstellung ärgerte sie. Wenn es eins gab, das sie an England verachtete, dann war es sein Klassensystem. Selbst bei einer Mordermittlung glaubte Marsh offenbar, dieser Familie eine Art VIP-Behandlung zukommen lassen zu müssen.
Moss und Peterson kamen mit einem uniformierten Kollegen aus dem Zelt, und zusammen gingen sie am See vorbei und weiter durch den Senkgarten. Erika fragte sich, ob die Putten mit den leeren Augen gesehen hatten, wie Andrea Douglas-Brown zu dem Bootsschuppen geschleift worden war und um ihr Leben geschrien hatte.
Ein Funkgerät am Kragen des Uniformierten knisterte. »Wir haben gerade eine kleine pinkfarbene Handtasche aus einer Hecke an der London Road gezogen«, sagte eine blecherne Stimme.
»Wo liegt die London Road?«, fragt Erika.
»Das ist die Hauptstraße hier«, sagte der Polizist und zeigte an einer Baumreihe vorbei.
Nach Monaten der Untätigkeit hatte Erika Mühe, ihr Gehirn wieder auf Touren zu bringen. Jedes Mal, wenn sie die Augen schloss, sah sie die Leiche der jungen Frau, die geschundene Haut, die leeren, weit aufgerissenen Augen. Bei einer Mordermittlung gab es so viele verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Schon ein normales Haus konnte die Spurensicherung tagelang beschäftigen. Aber das hier war ein Tatort, der sich womöglich über sieben Hektar erstreckte, die Beweismittel auf einem öffentlich zugänglichen Gelände verstreut, noch dazu unter einer dicken Schneedecke verborgen.
»Bringen Sie sie zum Besucherzentrum, wo der Krankenwagen steht«, wies Erika den Uniformierten an, der sofort loseilte. Kurz darauf hatten Erika, Moss und Peterson den Senkgarten mit seinen kunstvoll beschnittenen Hecken durchquert. Am Fuß eines sanft abfallenden, schneebedeckten Hügels stand das Besucherzentrum, ein futuristisch anmutender Glaskasten. Auf dem Vorplatz war der Schnee von den Reifen des Krankenwagens aufgewühlt, der mit offenen Hecktüren vor dem Eingang stand. Ein junger Mann von etwa Anfang zwanzig saß in mehrere Decken gehüllt auf einer Trage. Sein Gesicht war aschfahl, und er zitterte. Eine kleine Frau stand neben den Hecktüren des Krankenwagens und sah misstrauisch zu, wie einer der Forensiker die Kleidung des jungen Mannes untersuchte und mit behandschuhten Händen den verschmutzten Trainingsanzug, den Pullover und die Sportschuhe in Plastikbeuteln verstaute und diese sorgfältig beschriftete. Die Frau hatte die gleichen buschigen Augenbrauen wie der junge Mann, aber ein kleines, spitzes Gesicht.
»Ich will ’nen Beleg«, sagte sie gerade. »’ne schriftliche Liste von all den Sachen, die Sie mitnehmen. Die Trainingshose hat Lee sich erst im November gekauft, und die Schuhe sind auch neu – für die muss er noch dreizehn Raten bezahlen. Wie lange brauchen Sie das Zeug denn überhaupt?«
»Alle diese Gegenstände sind Beweisstücke in einem Mordfall«, sagte Erika, als sie bei dem Krankenwagen eintrafen. »Ich bin DCI Foster, das sind die Detectives Moss und Peterson.« Sie zeigten ihre Dienstausweise, und die Frau beäugte sie argwöhnisch.
»Wie heißen Sie?«, fragte Erika.
»Grace Kinney, und mein Lee hier hat nichts anderes getan, als pünktlich zur Arbeit zu erscheinen. Und weil er in der Kälte warten musste, wird er bestimmt krank, und dann streichen sie ihm das Arbeitslosengeld.«
»Lee, würden Sie uns bitte schildern, was genau passiert ist?«
Lee nickte mit gequältem Blick. Er berichtete, wie er zur Arbeit gekommen war, wie er ein Handy hatte klingeln hören und so die Tote unter dem Eis entdeckt hatte. Die Befragung wurde unterbrochen, als ein Uniformierter erschien und einen Plastikbeutel mit einer kleinen pinkfarbenen Clutch hochhielt. In einem weiteren Plastikbeutel befand sich der Inhalt der Tasche: sechs Fünfzigpfundscheine, zwei Tampons, Wimperntusche, ein Lippenstift und ein Parfümflakon.
»Haben die Sachen der Toten gehört?«, fragte Grace neugierig. Hastig verbarg der Polizist die Beutel hinter seinem Rücken.
»Sie hat’s bereits gesehen«, fauchte Erika den Mann an. Dann wandte sie sich wieder der Frau zu. »Miss Kinney, ich mache Sie darauf aufmerksam, dass es sich um Beweismittel in einer schwierigen Ermittlung …«
»Ich halte den Mund, keine Sorge«, sagte Grace. »Aber was ’ne junge Frau mit ’ner Designerhandtasche und ’nem Bündel Fünfziger hier in der Gegend zu suchen hatte, ist mir schleierhaft.«
»Was glauben Sie denn, was sie hier gewollt haben könnte?«, fragte Erika.
»Ich nehm Ihnen nicht die Arbeit ab, aber man muss kein Sherlock Holmes sein, um sich denken zu können, dass die auf den Strich gegangen ist. Wahrscheinlich hat sie ’n Freier mit hergebracht, und dann ist alles schiefgelaufen«, sagte Grace.
»Lee, haben Sie die Tote gekannt?«
»Woher soll Lee denn ’ne Nutte kennen?«
»Wir … wir glauben nicht, dass sie eine Prostituierte war.«
Grace schien von der Not ihres Sohnes gar nichts mitzubekommen. Lee wickelte sich fester in die Decke ein und zog die buschigen Augenbrauen zusammen. »Sie war sehr schön«, sagte er leise. »Sogar tot unterm Eis … Es war schrecklich, wie sie gestorben ist, oder?«
Erika nickte.
»Ich hab’s an ihrem Gesicht gesehen«, sagte Lee. »Entschuldigung, was hatten Sie mich gefragt?«
»Kannten Sie die junge Frau? Haben Sie sie schon einmal hier in der Gegend gesehen?«
»Nein, ich habe sie noch nie gesehen«, antwortete er.
»Wir denken, dass sie zuletzt in einem der Pubs auf der London Road gewesen sein könnte. In welche Pubs gehen denn die jüngeren Leute?«, fragte Peterson.
Lee zuckte die Achseln. »Im Wetherspoon’s ist am Wochenende immer viel los … Und im Pig & Whistle, das ist vom Bahnhof aus ein Stück die Straße hoch.«
»Gehen Sie oft aus, Lee?«, wollte Peterson wissen. Wieder zuckte Lee die Achseln. »Also das Wetherspoon’s und das Pig & Whistle«, sagte Peterson. »Sonst noch welche?«
»In solchen Pubs treibt er sich nicht rum, stimmt’s, Junge?«, sagte Grace Kinney und blickte ihren Sohn scharf an.
»Ja. Äh, ich meine, nein, da treib ich mich nicht rum.«
»Früher war das mal ’ne richtig nette Gegend hier«, sagte Grace. »Nicht schick, aber nett. Das alte Wetherspoon’s war mal ein ganz gemütliches Kino. Die schlimmsten sind The Glue Pot und The Stag. In die Kaschemmen kriegen mich keine zehn Pferde rein, und wenn’s die letzten Pubs auf der Welt wären. Außerdem wimmelt’s da nur so von Immigranten – nichts für ungut, junger Mann«, sagte sie zu Peterson. Erika sah, wie Moss ein Grinsen unterdrückte.
Ungeachtet dessen, wie peinlich Lee die Situation war, fuhr Grace Kinney fort: »Ich kann Ihnen sagen, wenn ich heutzutage die London Road runtergeh, komm ich mir vor wie ’ne Fremde im eigenen Land: Polen, Rumänen, Ukrainer, Russen, Inder, Afrikaner … Und Lee erzählt mir, die rennen alle zum Jobcenter und halten die Hand auf. Die nehmen, was sie kriegen können. Sie sollten sich diese ganzen Pubs mal vorknöpfen. Die Hälfte von den Ausländern arbeitet nämlich da hinterm Tresen, und in der Pause rennen sie dann rüber zum Jobcenter. Aber nein, da drücken wir ja ein Auge zu. Und mein Junge hier muss für sechzig Pfund Stütze im Monat bei Wind und Wetter raus und vierzig Stunden die Woche malochen. Ist doch zum Kotzen.«
»Seit wann arbeiten Sie schon auf dem Museumsgelände?«, fragte Erika. Lee hob die Schultern. »Ich hab vier Wochen vor Weihnachten da angefangen.«
»Und jetzt ist es natürlich seine eigene Schuld, dass er nicht arbeiten kann, weil so ’ne dämliche Nutte sich unbedingt …«
»Es reicht«, unterbrach Erika sie.
»Na ja«, sagte Grace kleinlaut. »Am Ende ist sie trotzdem jemandes Tochter. Wissen Sie denn schon, wer sie ist?«
»Dazu können wir noch nichts sagen.«
Das weckte die Neugier der Frau. »Das ist doch nicht etwa das reiche Mädchen, das verschwunden ist? Wie hieß die auch noch, Lee? Angela? Hat die Tote ausgesehen wie das Mädchen in der Zeitung?«
Lee starrte ins Leere, anscheinend durchlebte er noch einmal den Moment, als er Andreas Gesicht durch das Eis gesehen hatte.
»Wie gesagt, die Leiche muss noch identifiziert werden«, sagte Erika. »Wir werden das Jobcenter benachrichtigen, Lee, denen Bescheid geben, was hier los ist. Bleiben Sie bitte in der Stadt, wir werden uns womöglich noch einmal mit Ihnen unterhalten müssen.«
»Glauben Sie etwa, er würde das Land verlassen?«, fauchte Grace. »Wenn er’s könnte, wär’s ja nicht schlecht – obwohl, hier in der Gegend wären wir wahrscheinlich die Einzigen, die mal rauskommen.«
Erika, Moss und Peterson brachen auf, als die Sanitäter den Krankenwagen abfahrbereit machten.
»Gott, war die anstrengend«, bemerkte Moss.
»Aber sie hat uns mehr Informationen gegeben als Lee«, sagte Erika. »Diese Pubs sollten wir uns tatsächlich mal ansehen. The Glue Pot. The Stag. Wäre es denkbar, dass Andrea am Abend vor ihrem Verschwinden in einem der Pubs gewesen ist?«
6