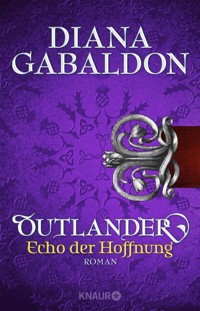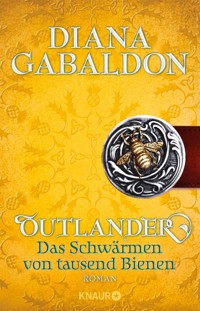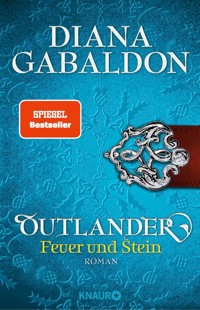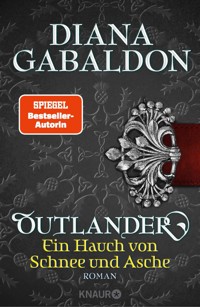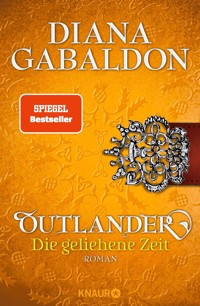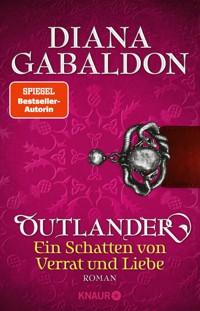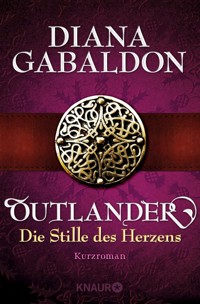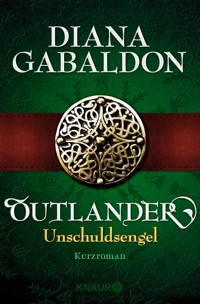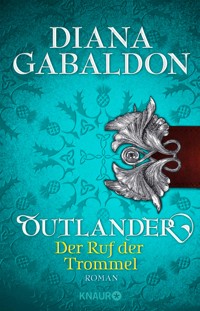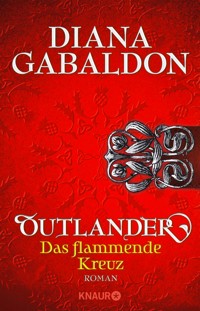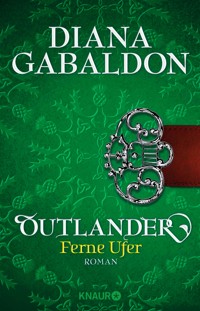12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Lord-John-Reihe
- Sprache: Deutsch
Dramatisch, abenteuerlich, hochspannend: der erste Roman aus Diana Gabaldons historischer Bestseller-Reiheum die beliebteste Nebenfigur der Outlander-Saga, Lord John Grey. Der britische Offizier Lord John Grey ist eben erst aus dem schottischen Exil nach Hause zurückgekehrt, als ihn im London des Jahres 1757 neues Ungemach erwartet: Er erhält den prekären Auftrag, vertrauliche Papiere aufzuspüren, die der britischen Armee gestohlen wurden – vermutlich von einem der eigenen Soldaten! Dazu kommt, dass der Ehrenwerte Joseph Trevelyan, der Verlobte von Lord Johns Cousine, ein Doppelleben zu führen scheint. Um seine Familie vor einem Skandal zu schützen, folgt Lord John so diskret wie möglich den rätselhaften Spuren Trevelyans – und gerät dabei nicht nur in Lebensgefahr, sondern muss auch sein eigenes Verständnis von Moral, Liebe und Loyalität in Frage stellen. Zum Mitfiebern spannend entführt Diana Gabaldon in »Das Meer der Lügen« ins ebenso quirlige wie brutale London des 18. Jahrhunderts, wo der queere Lord John Grey in ein Netz aus hemmungsloser Habgier, politischer Intrige und verzweifelter Liebe gerät. »So aufregend kann's nur Diana Gabaldon.« Meins über den 9. Bestseller der Otlander-Saga, »Das Schwärmen von tausend Bienen« Die historischen Romane der Lord-John-Reihe erscheinen in folgender Reihenfolge: - Das Meer der Lügen (Lord John 1) - Die Hand des Teufels (drei Kurzromane) - Die Sünde der Brüder (Lord John 2) - Die Fackeln der Freiheit (Lord John 3)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 458
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Diana Gabaldon
Das Meer der Lügen
Ein Lord-John-Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Barbara Schnell
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Der britische Offizier Lord John Grey ist eben erst aus dem schottischen Exil heimgekehrt, als ihn im London des Jahres 1757 neues Ungemach erwartet: Er erhält den hochgeheimen Auftrag, vertrauliche Papiere aufzuspüren, die der britischen Armee gestohlen wurden – vermutlich von einem der eigenen Soldaten! Dazu kommt, dass der Ehrenwerte Joseph Trevelyan, der Verlobte von Lord Johns Cousine, ein Doppelleben zu führen scheint. Um seine Familie vor einem Skandal zu schützen, folgt Lord John so diskret wie möglich den rätselhaften Spuren Trevelyans – und gerät dabei nicht nur in Lebensgefahr, sondern muss auch sein eigenes Verständnis von Moral, Liebe und Loyalität infrage stellen.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Vorwort
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
Epilog
Danksagung
Die Saga bei Knaur im Überblick
Liebe Leserinnen und Leser,
dieses Buch war ein Unfall, der irgendwann passieren musste, wie man so schön sagt (normalerweise über Dinge wie Straßen voller Schlaglöcher, herumliegenden Stacheldraht und Gewehre, die theoretisch nicht geladen sind).
Es ist Jahre her (26, um genau zu sein), dass ein Herr namens Maxim Jakubowski auf mich zukam. Er war unter anderem als Herausgeber von Anthologien bekannt und erzählte mir, dass er im Begriff war, zu Ehren der kürzlich verstorbenen Autorin Ellis Peters ein neues Buch mit Kurzkrimis zusammenzustellen. Das Buch sollte »Past Poisons« heißen, und er würde mich gern einladen, eine Geschichte beizusteuern.
Ich fühlte mich sehr geschmeichelt, weil viele der Mitwirkenden bekannte (historische) Krimiautoren waren: Anne Perry, Peter Lovesey, Steven Saylor und Susanna Gregory, um nur einige zu nennen. Dabei schrieb ich gar keine Krimis.
Der Haken war, wie ich ihm sagte, dass ich (abgesehen von Uni-Arbeiten) noch nie etwas geschrieben hatte, was kürzer war als 300000 Wörter. Doch ich fand sein Konzept spannend – und tatsächlich hatte ich (zu meiner persönlichen Freude) in jeden meiner großen historischen Romane einen kleinen Krimifall eingebaut. Was ich ihm nicht gesagt habe: Als ich darüber nachdachte, ein Buch zu schreiben – was ich schon lange tat, ehe ich dann ein Buch schrieb –, war ich immer davon ausgegangen, dass es ein Krimi sein würde, da Krimis meine bevorzugte Freizeitlektüre waren. (Dorothy Sayers und ihre aristokratische Spürnase Lord Peter Wimsey hatten einen Ehrenplatz in meinem Bücherregal, und ich kann nicht sagen, dass es nicht auch an ihnen lag …)
Was mich abgeschreckt hatte, war die Überlegung, dass Krimis einen roten Handlungsfaden hatten und ich mir absolut nicht sicher war, ob ich so etwas konstruieren konnte – andererseits hatte ich zu diesem Zeitpunkt vier ziemlich dicke Romane herausgebracht, und anscheinend reichte die Handlung darin aus, um die Menschen immer weiter umblättern zu lassen.
Außerdem tue ich gern Dinge, die ich noch nicht gemacht habe, also habe ich Maxims Herausforderung todesmutig angenommen und gesagt, ja, ich würde eine Geschichte für seine Anthologie schreiben.
Nun denn.
Und jetzt?
Ich wollte keine Kurzgeschichte schreiben, in der irgendeine der Hauptfiguren meiner Bücher vorkam, denn a) eine Kurzgeschichte muss genau wie eine längere Erzählung interessant sein. Das bedeutet, dass b) eine solche Geschichte eine Prämisse oder ein Ereignis von Belang behandeln muss. Und wenn ich c) eine Geschichte über meine Hauptfiguren schrieb, die ein solches Ereignis zum Inhalt hätte, müsste ich diese Ereignisse in den folgenden Romanen berücksichtigen, und ich wollte mir d) nicht selbst Hindernisse in den Weg legen. (Ich schreibe meine Bücher weder nach einem Plan noch chronologisch; was ich tue, ist, im Kopf – sehr langsam – so etwas wie Tetris zu spielen, aber die Blöcke brauchen Bewegungsfreiheit.)
Nun denn. Jamie Fraser oder Claire Randall konnte ich nicht nehmen … aber da war ja noch Lord John. Ich kannte ihn sehr gut, und er ist das, was ich einen »Pilz« nenne – eine Figur, die aus dem Nichts auftaucht und jede Szene stiehlt, die sie betritt. Das Schöne an ihm ist, dass er nicht in vielen Szenen der großen Bücher auftaucht, und niemand weiß, was er macht, wenn er nicht auf einer Seite erscheint. Er konnte also losziehen und ein kurzes Abenteuer erleben, ohne dass irgendwelcher Schaden entstand.
Und so kam es dazu, dass ich meine erste Kurzgeschichte schrieb, »Die Flammen der Hölle«, mit Lord John in der Hauptrolle und veröffentlicht in Maxims »Past Poisons: An Ellis Peters Memorial Anthology of Historical Crime«. Es funktionierte gut, und die Menschen mochten die Geschichte.
Und dann bat mich einige Zeit später noch einmal jemand um eine Kurzgeschichte, und ich sagte, mal sehen … und fing an zu schreiben, erneut mit Lord John als Protagonist. Ein paar Monate später habe ich in New York beim Mittagessen mit meinen beiden Agenten (einer für US-Rechte, einer für Auslandsrechte) erwähnt, dass ich die zweite Lord-John-Geschichte fast fertig hätte. Sie spitzten die Ohren, und sie fragten sofort: »Wie lang ist sie?«
»Ich wusste, dass ihr das fragen würdet«, sagte ich, »also habe ich gestern Abend gezählt. Bis jetzt sind es ungefähr 75000 Wörter, aber ich brauche vielleicht noch 20000, bis ich fertig bin.«
Die Agenten haben sich gegenseitig angesehen, dann mich, und dann im Chor gesagt: »Das ist keine Kurzgeschichte – das ist ein Buch!«
»Tatsächlich?«, sagte ich skeptisch. »Ich dachte, es wäre eine Kurzgeschichte.«
»Tja, es ist aber keine«, sagten sie und haben es prompt an sich genommen und es in siebenundvierzig Länder verkauft. In Deutschland hatte es damals seine Weltpremiere, und jetzt können Sie es im neuen Gewand endlich wieder lesen. Ich hoffe, es gefällt ihnen!
– Diana Gabaldon
Scottsdale, Arizona
3. Januar 2024
Für Margaret Scott Gabaldon und Kay Fears Watkins,
die wundervollen Großmütter meiner Kinder
1
… wenn wir nach Trug und Täuschung streben
Es war eines dieser Dinge, von denen man im ersten Moment hofft, man hätte falsch hingesehen – weil das Leben so viel angenehmer wäre, wenn man es nicht gesehen hätte.
Besagtes Ding an sich hatte kaum etwas Schockierendes; Lord John Grey hatte schon Schlimmeres gesehen, konnte jederzeit Schlimmeres sehen, wenn er einfach nur aus dem »Beefsteak« auf die Straße trat. Das Blumenmädchen, das ihm auf dem Weg zum Club einen Veilchenstrauß verkauft hatte, trug eine klaffende Wunde auf dem Handrücken, die halb verheilt war und eine nässende Kruste hatte. Der Türsteher, ein Veteran, der in Amerika gekämpft hatte, hatte eine wulstige Tomahawknarbe, die ihm vom Haaransatz bis zum Kinn lief und die Höhle seines erblindeten Auges in zwei Hälften spaltete. Im Vergleich dazu war die wunde Stelle auf dem besten Stück des Ehrenwerten Joseph Trevelyan ziemlich klein. Beinahe diskret.
»Nicht so tief wie ein Brunnen, noch so weit wie eine Kirchtür«, brummte Grey vor sich hin. »Aber es reicht hin. Verdammt.«
Er trat hinter dem chinesischen Paravent hervor und hielt sich die Veilchen an die Nase. Deren süßer Duft kam gegen den durchdringenden Geruch, der ihm von den Pissoiren her folgte, nicht an. Es war Anfang Juni, und wie jedes andere Etablissement in London roch auch das »Beefsteak« nach Bier und Spargelpisse.
Trevelyan hatte die Zurückgezogenheit der chinesischen Wand schon vor Grey verlassen und nichts von dessen Entdeckung mitbekommen. Der Ehrenwerte Joseph stand jetzt am anderen Ende des Speisezimmers und war in ein Gespräch mit Lord Hanley und dem jüngeren Mr Pitt vertieft – der Inbegriff des guten Geschmacks und der nüchternen Eleganz. Etwas schmalbrüstig, dachte Grey hartherzig – obwohl der Anzug aus feinem, rotbraunem Stoff darauf zugeschnitten war, der schlanken Figur des Mannes zu schmeicheln. Storchenbeine noch dazu; Trevelyan verlagerte das Gewicht, und auf seinem linken Bein erschien ein Schatten an der Stelle, wo sein Wadenpolster sich unter dem bestickten Seidenstrumpf verschob.
Lord John wendete das Sträußchen kritisch in der Hand, als suchte er nach welken Stellen, während er den Mann mit gesenkten Wimpern beobachtete. Er wusste sehr gut, wie man jemanden beobachtete, ohne dass es ihm anzusehen war. Er wünschte, diese Gabe der unauffälligen Betrachtung wäre ihm nicht so sehr zur Angewohnheit geworden – dann stünde er jetzt nicht vor diesem Dilemma.
Die Entdeckung, dass ein Bekannter an der Franzosenkrankheit litt, hätte normalerweise schlimmstenfalls eine angewiderte Reaktion hervorgerufen, bestenfalls neutrales Mitgefühl – gepaart mit tiefer Dankbarkeit, dass man nicht selbst von dergleichen betroffen war. Unglücklicherweise war der Ehrenwerte Joseph Trevelyan nicht einfach nur eine Clubbekanntschaft; er war mit Greys Cousine verlobt.
Der Steward murmelte ihm etwas zu; aus einem Reflex heraus reichte er dem Mann den Blumenstrauß und machte eine abwinkende Handbewegung.
»Nein, ich esse noch nicht. Ich warte noch auf Oberst Quarry.«
»Sehr wohl, Mylord.«
Trevelyan hatte sich wieder zu seinen Begleitern an einen Tisch am anderen Ende des Zimmers gesetzt, und sein schmales Gesicht errötete gerade vor Lachen über einen Witz, den Pitt gemacht hatte.
Grey konnte nicht einfach so dastehen und den Mann finsteren Blickes anstarren; er zögerte, unsicher, ob er sich ins Raucherzimmer begeben und dort auf Quarry warten sollte, oder vielleicht den Flur entlang in die Bibliothek gehen sollte. Schließlich kam ihm jedoch das plötzliche Eintreten von Malcolm Stubbs zuvor, eines Leutnants aus seinem Regiment, der ihn angenehm überrascht begrüßte.
»Major Grey! Was führt Euch denn hierher? Ich dachte, Ihr wärt Stammgast bei White’s. Habt wohl die Nase voll von den Politikern, was?«
Stubbs war nicht größer als Grey, aber doppelt so breit.
Er hatte ein pausbäckiges Engelsgesicht, große, blaue Augen und eine unverkrampfte Art, die ihn bei seinen Männern sehr beliebt machte, wenn auch nicht immer bei seinen vorgesetzten Offizieren.
»Hallo, Stubbs.« Grey lächelte trotz seiner inneren Unruhe. Stubbs war ein guter Bekannter, wenn sich ihre Pfade auch außerhalb des Regiments kaum kreuzten.
»Nein, Ihr verwechselt mich mit meinem Bruder Hal. Ich überlasse ihm das Räuberschach.«
Stubbs wurde rot im Gesicht und prustete leise.
»Räuberschach! Guter Witz, Grey, ehrlich. Den muss ich unbedingt dem Alten erzählen.« Der Alte war Stubbs’ Vater, ein unbedeutender Baronet, der mit Sicherheit sowohl mit dem White’s Club als auch mit Lord Johns Bruder vertraut war.
»Nun, Grey, seid Ihr hier Mitglied? Oder Gast, so wie ich?« Stubbs, der sich wieder von seinem Lachanfall erholt hatte, wies mit einer Handbewegung auf das geräumige, weiß eingedeckte Speisezimmer und warf einen bewundernden Blick auf die beeindruckende Sammlung von Dekantern, die der Steward auf einer Anrichte zurechtstellte.
»Mitglied.«
Trevelyan nickte gerade dem Herzog von Gloucester zu, der den freundschaftlichen Gruß erwiderte. Himmel, Trevelyan kannte auch wirklich jeden. Mit einem kleinen Ruck wandte Grey seine Aufmerksamkeit wieder Stubbs zu.
»Mein Patenonkel hat mich schon bei meiner Geburt im ›Beefsteak‹ angemeldet. Seit ich sieben bin, das Alter, in dem seiner Meinung nach die Vernunft einsetzt, hat er mich jeden Mittwoch zum Mittagessen mitgenommen. Auf diese Gewohnheit musste ich natürlich unterwegs verzichten, aber wenn ich in der Stadt bin, finde ich mich regelmäßig hier ein.«
Der Steward beugte sich zu Trevelyan hinab, um ihm einen Dekanter mit Portwein anzubieten; Grey erkannte das goldene Siegelrelief am Hals des Gefäßes – Vielle St. Moreau, hundert Guineen per Fass. Gut betucht, reich an Beziehungen … und mit der Syphilis infiziert. Verdammt, wie bekam er das nur in den Griff?
»Ist Euer Gastgeber noch nicht da?« Er berührte Stubbs am Ellbogen und wandte ihn zur Tür. »Dann kommt – trinken wir ein schnelles Glas in der Bibliothek.«
Sie spazierten den wohnlichen Teppich entlang, der über den Flur lief, und betrieben Konversation.
»Warum so herausgeputzt?«, fragte Grey beiläufig und versetzte die geflochtene Tresse an Stubbs’ Schulter in Bewegung. Das »Beefsteak« war keine Anlaufstelle für Soldaten; obwohl ein paar Offiziere des Regiments Mitglieder waren, trugen sie hier selten Uniform, es sei denn, sie waren auf dem Weg zu einem offiziellen Termin. Auch Grey war nur deshalb uniformiert, weil er mit Quarry verabredet war, der niemals etwas anderes in der Öffentlichkeit trug.
»Muss noch zu einem Witwenbesuch«, erwiderte Stubbs mit resignierter Miene. »Keine Zeit, mich vorher noch umzuziehen.«
»Oh? Wer ist denn gestorben?« Ein Witwenbesuch war ein offizieller Besuch, den man der Familie eines kürzlich verstorbenen Regimentsmitgliedes abstattete, um das Beileid der Truppe zu entbieten und sich nach dem Wohlergehen der Witwe zu erkundigen. War der Mann Berufssoldat, beinhaltete der Besuch möglicherweise auch die Aushändigung einer kleinen Summe in bar, die von den Kameraden und den direkten Vorgesetzten des Mannes gesammelt worden war – mit etwas Glück genug für eine anständige Beerdigung.
»Timothy O’Connell.«
»Tatsächlich? Wie ist das denn passiert?« O’Connell war ein Ire in den mittleren Jahren, mürrisch, aber fähig; er war sein Leben lang Soldat gewesen und hatte es aufgrund seiner Fähigkeit, seine Untergebenen einzuschüchtern, bis zum Sergeanten gebracht – eine Fähigkeit, um die ihn Grey als siebzehnjähriger Subalterner beneidet hatte und vor der er zehn Jahre später immer noch Respekt hatte.
»Ist bei einer Prügelei auf der Straße umgekommen, vorletzte Nacht.«
Bei diesen Worten fuhren Greys Augenbrauen in die Höhe.
»Da muss ihm aber eine ganze Bande nachgestellt haben«, sagte er, »oder ihn überrascht haben; ich hätte alles auf O’Connell gesetzt, wenn der Kampf auch nur halbwegs fair gewesen ist.«
»Ich weiß nichts Genaues; ich soll die Witwe danach fragen.«
Grey nahm auf einem der antiken, aber gemütlichen Sessel des »Beefsteaks« Platz und winkte einem Bediensteten.
»Brandy – für Euch auch, Stubbs? Ja, zwei Brandy, bitte. Und sorgt dafür, dass man mich holt, wenn Oberst Quarry eintrifft, ja?«
»Danke, Kumpel, nächstes Mal kommt Ihr zu Boodie’s, und dann gebe ich einen aus.« Stubbs schnallte sein Paradeschwert ab und reichte es dem wartenden Bediensteten, um es sich dann ebenfalls bequem zu machen.
»Habe übrigens neulich Eure Cousine getroffen«, merkte er an, während er seinen nicht unbeträchtlichen Hintern tief in den Sessel bohrte. »Ist im Row Park ausgeritten – hübsche junge Dame. Guter Sitz«, fügte er umsichtig hinzu.
»Ach, wirklich. Und welche Cousine war das?«, fragte Grey, während ihm das Herz in die Knie sank. Er hatte eine ganze Reihe von Cousinen, aber nur eine, von der er sich vorstellen konnte, dass Stubbs sie bewunderte, und so, wie dieser Tag sich anließ …
»Die Pearsall«, sagte Stubbs fröhlich und bestätigte Greys Vorahnung. »Olivia? War das der Name? Ist sie nicht mit diesem Trevelyan verlobt? Dachte, ich hätte ihn eben im Speisezimmer gesehen.«
»Das habt Ihr auch«, sagte Grey knapp. Er brannte im Augenblick nicht sehr darauf, sich über den Ehrenwerten Joseph zu unterhalten. Doch wenn Stubbs erst einmal einen Gesprächskurs eingeschlagen hatte, war er so schwer davon abzubringen wie ein bergab rollender Zwanzigpfünder, und Grey kam nicht umhin, sich alles Mögliche über Trevelyans Tun und seine herausragende gesellschaftliche Stellung anzuhören – Dinge, deren er sich nur allzu gut bewusst war.
»Irgendwelche Neuigkeiten aus Indien?«, fragte er schließlich verzweifelt.
Dieser Schachzug funktionierte; dem Großteil Londons war zwar bewusst, dass Robert Clive nach den Fersen des Nawabs von Bengalen schnappte, doch Stubbs hatte einen Bruder im 46sten Infanterieregiment, das derzeit mit Clive Kalkutta belagerte, und war daher in der Lage, einige grausige Details beizusteuern, die es noch nicht bis in die Zeitung geschafft hatten.
»… so viele britische Gefangene auf engstem Raum zusammengedrängt, sagt mein Bruder, dass es, wenn sie vor Hitze umgefallen sind, keinen Platz gab, wo sie die Leichen lassen konnten; die Überlebenden waren gezwungen, auf den Gestürzten herumzutrampeln. Er sagt –« Stubbs sah sich um und senkte ein wenig die Stimme. »Er sagt, ein paar der armen Kerle sind vor Durst wahnsinnig geworden. Haben das Blut getrunken. Wenn einer von ihnen gestorben ist, meine ich. Sie haben ihm die Kehle aufgeschlitzt, die Handgelenke, die Leiche ausbluten lassen und sie dann liegen gelassen. Bryce sagt, sie konnten der Hälfte der Toten keinen Namen mehr zuordnen, als sie sie dort herausgezogen haben, und –«
»Meint Ihr, sie schicken uns auch dorthin?«, unterbrach Grey. Er leerte sein Glas und bestellte mit einer Handbewegung zwei weitere Gläser Brandy, um sich vielleicht doch noch einen Rest seines Appetits auf das Mittagessen zu bewahren.
»Weiß nicht. Vielleicht – obwohl ich letzte Woche ein Gerücht gehört habe, das sehr danach klang, als könnte es Amerika werden.« Stubbs schüttelte stirnrunzelnd den Kopf. »Kann nicht sagen, dass ich einen großen Unterschied zwischen einem Hindu und einem Mohawk sehe – alles brüllende Barbaren –, aber wenn Ihr mich fragt, sind die Chancen, sich zu profilieren, in Indien sehr viel größer.«
»Wenn man die Hitze, die Insekten, die Giftschlangen und den Durchfall überlebt, ja«, sagte Grey. Er schloss für einen Moment der Glückseligkeit die Augen und genoss den sanften Hauch des englischen Junitages, der zum offenen Fenster hereinwehte.
Es wurde überall spekuliert, was den nächsten Posten des Regiments anging, und die Gerüchteküche florierte. Frankreich, Indien, die amerikanischen Kolonien … vielleicht Prag oder die russische Front, einer der deutschen Staaten oder gar die Westindischen Inseln. Indem es Österreichs strittige Thronfolge als Vorwand benutzte, kämpfte Großbritannien auf drei Kontinenten mit Frankreich um die Vorherrschaft, und kein Soldat konnte über Mangel an Beschäftigung klagen.
Sie verbrachten noch eine angenehme Viertelstunde mit ähnlich substanzlosen Vermutungen. Währenddessen konnte sich Greys Verstand ungehindert erneut den Schwierigkeiten zuwenden, die sich durch seine unpassende Entdeckung ergaben. Hätten die Dinge ihren normalen Lauf genommen, wäre Trevelyan das Problem seines älteren Bruders gewesen. Doch Hal war zurzeit auf Reisen in Frankreich und unerreichbar, was Grey zum Mann vor Ort machte. Die Hochzeit zwischen Trevelyan und Olivia Pearsall sollte in sechs Wochen stattfinden; es musste etwas unternommen werden, und zwar schnell.
Vielleicht zog er besser Paul oder Edgar zurate – aber keiner seiner Halbbrüder bewegte sich in gesellschaftlichen Kreisen; Paul führte ein gemütliches Landleben auf seinem Anwesen in Sussex und setzte kaum je einen Fuß in den nächsten Marktflecken. Was Edgar anging … nein, Edgar würde keine Hilfe sein. Seine Vorstellung von einer diskreten Erledigung der Angelegenheit würde es sein, Trevelyan auf den Stufen von Westminster auszupeitschen.
Ein Steward, der in der Tür erschien und Oberst Quarrys Eintreffen verkündete, setzte seinen abschweifenden Gedanken vorerst ein Ende.
Er erhob sich und berührte Stubbs an der Schulter.
»Holt mich nach dem Essen ab, ja?«, sagte er. »Wenn Ihr möchtet, begleite ich Euch bei Eurem Witwenbesuch. O’Connell war ein guter Soldat.«
»Oh, würdet Ihr das tun? Das ist wirklich anständig von Euch, Grey; danke.« Stubbs machte ein dankbares Gesicht; den Hinterbliebenen sein Beileid auszusprechen, war nicht seine Stärke.
Glücklicherweise hatte Trevelyan seine Mahlzeit beendet und war gegangen; die Stewards waren gerade dabei, die Krümel von dem frei gewordenen Tisch zu fegen, als Grey das Zimmer betrat. Auch gut; es hätte ihm den Magen umgedreht, wenn er den Mann beim Essen hätte sehen müssen.
Er begrüßte Harry Quarry herzlich und zwang sich dann, während der Suppe Konversation zu betreiben, obwohl er mit seinen Gedanken anderswo war. Er zögerte und tauchte seinen Löffel in die Suppe. Quarry benahm sich oft derb und unbeholfen, doch er besaß große Treffsicherheit, wenn es darum ging, den Charakter eines Menschen einzuschätzen, und er kannte sich mit unschönen Affären aus. Er stammte aus einer guten Familie und wusste, wie die bessere Gesellschaft funktionierte. Vor allem konnte man sich darauf verlassen, dass er ein Geheimnis für sich behalten würde.
Also dann. Über die Sache zu sprechen, würde die Situation möglicherweise zumindest für ihn selbst klarer machen. Er schluckte den letzten Rest Brühe hinunter und legte den Löffel hin.
»Kennt Ihr Mr Joseph Trevelyan?«
»Den Ehrenwerten Mr Trevelyan? Vater Baronet, Bruder im Parlament, ein Vermögen in Zinn aus Cornwall, bis über die Ohren an der Ostindischen Handelsgesellschaft beteiligt?« Harry zog ironisch die Augenbrauen hoch. »Nur vom Sehen. Wieso?«
»Er ist mit meiner Cousine Olivia Pearsall verlobt. Ich … ich hatte mich nur gefragt, ob Euch vielleicht irgendetwas in Bezug auf seinen Charakter zu Ohren gekommen ist.«
»Bisschen spät für derartige Erkundigungen – oder nicht, wenn sie schon verlobt sind?« Quarry löffelte ein Stück unidentifizierbaren Grünzeugs aus seiner Suppentasse, betrachtete es kritisch, dann zuckte er mit den Achseln und aß es. »Geht Euch doch sowieso nichts an, oder? Ihr Vater ist doch bestimmt zufrieden?«
»Sie hat keinen Vater mehr. Und keine Mutter. Sie ist verwaist und ist seit zehn Jahren das Mündel meines Bruders Hal. Sie lebt im Haushalt meiner Mutter.«
»Mm? Oh. Das wusste ich nicht.« Quarry kaute langsam auf seinem Brot herum und betrachtete seinen Freund mit nachdenklich gesenkten Augenbrauen. »Was hat er denn angestellt? Trevelyan, meine ich, nicht Euer Bruder.«
Lord John zog seinerseits die Augenbrauen hoch und spielte mit seinem Suppenlöffel.
»Nichts, soweit ich weiß. Warum sollte er denn etwas angestellt haben?«
»Sonst würdet Ihr Euch doch nicht nach seinem Charakter erkundigen«, führte Quarry in aller Logik an.
»Raus damit, John; was hat er getan?«
»Es ist nicht so sehr, was er getan hat, als vielmehr die Folgen.« Lord John lehnte sich zurück und wartete ab, bis der Steward das Suppengeschirr abgeräumt und sich außer Hörweite begeben hatte. Er beugte sich ein wenig vor, senkte die Stimme bis weit unter den Flüsterton, und dennoch spürte er, wie ihm das Blut in die Wangen stieg. Es war absurd, sagte er sich. Jeder Mann warf dann und wann einen beiläufigen Blick auf seinen Nebenmann – doch seine persönlichen Vorlieben machten ihn in einer solchen Situation mehr als angreifbar; er konnte die Vorstellung, dass ihn jemand einer vorsätzlichen Inspektion bezichtigen könnte, nicht ertragen. Nicht einmal Quarry – der in einer ähnlichen Situation Trevelyan wahrscheinlich am Glied des Anstoßes gepackt und lauthals eine Erklärung für das Ganze verlangt hätte.
»Ich – habe mich vorhin zurückgezogen –«, er nickte in Richtung des chinesischen Paravents, »– und bin unerwartet auf Trevelyan gestoßen. Mir … äh … fiel zufällig ins Auge –« Himmel, er wurde rot wie ein Mädchen; Quarry grinste über sein Unbehagen.
»… glaube, es ist die Syph«, schloss er, und seine Stimme war kaum noch ein Murmeln.
Das Grinsen verschwand abrupt aus Quarrys Gesicht, und er blickte auf die chinesische Trennwand, hinter der gerade Lord Dewhurst ins Gespräch mit einem Freund vertieft zum Vorschein kam. Als er Quarrys Blick auffing, sah Dewhurst automatisch nach unten, um sich zu versichern, dass seine Hose zugeknöpft war. Als er sie ordnungsgemäß vorfand, warf er Quarry einen finsteren Blick zu und kehrte an seinen Tisch zurück.
»Syph.« Quarry senkte ebenfalls die Stimme, sprach aber immer noch ein ganzes Stück lauter, als es Grey lieb war. »Syphilis meint Ihr?«
»Genau.«
»Sicher, dass Ihr Euch das nicht eingebildet habt? Ich meine, ein Blick aus dem Augenwinkel, ein kleiner Schatten … da kann man sich doch leicht irren, wie?«
»Das glaube ich nicht«, sagte Grey gereizt. Gleichzeitig klammerte sich sein Verstand voller Hoffnung an diese Möglichkeit. Es war nur ein kurzer Blick gewesen. Vielleicht war er ja im Irrtum … es war ein sehr verlockender Gedanke.
Quarry blickte erneut zu der chinesischen Wand hinüber; alle Fenster waren geöffnet, und der herrliche Junisonnenschein flutete herein. Die Luft war wie Kristall; Grey, der in seiner Aufregung das Salzgefäß umgestoßen hatte, konnte jedes einzelne Salzkorn auf dem Leinentuch sehen.
»Ah«, sagte Quarry. Er verstummte für einen Moment und malte mit dem Zeigefinger ein Muster in das verschüttete Salz.
Er fragte nicht, ob Grey einen Schankerfleck erkennen würde. Jeder junge Offizier im Dienst sah sich dann und wann gezwungen, den Stabsarzt bei der Truppeninspektion zu begleiten, um von Männern Notiz zu nehmen, die so krank waren, dass man sie entlassen musste. Die Vielfalt der Formen und Größen – von ihrem Zustand ganz zu schweigen –, die bei diesen Gelegenheiten zur Schau gestellt wurde, lieferte am Abend nach solchen Inspektionen in der Offiziersmesse viel Stoff für Gelächter.
»Nun, wohin geht er, wenn er eine Hure braucht?«, fragte Quarry. Er blickte auf und rieb sich das Salz vom Finger.
»Was?« Grey sah ihn ausdruckslos an. Quarry zog eine Augenbraue hoch.
»Trevelyan. Wenn er die Syph hat, muss er sich doch irgendwo angesteckt haben, oder nicht?«
»Sollte man meinen.«
»Na also.« Quarry lehnte sich selbstzufrieden auf seinem Stuhl zurück.
»Er muss es sich doch nicht in einem Bordell geholt haben«, argumentierte Grey. »Obwohl ich zugebe, dass es am wahrscheinlichsten ist. Aber was spielt das für eine Rolle?«
Quarry zog wieder die Augenbrauen hoch.
»Als Erstes müsst Ihr Euch wohl versichern, dass es stimmt, bevor Ihr ganz London mit einer öffentlichen Bezichtigung in Aufruhr bringt. Ich gehe schließlich nicht davon aus, dass Ihr einen Annäherungsversuch unternehmen wollt, um Euch genauer überzeugen zu können.«
Quarry grinste breit, und Grey spürte, wie ihm das Blut in der Brust aufstieg und ihm heiß den Hals heraufspülte.
»Nein«, sagte er knapp. Dann fasste er sich und lehnte sich ein wenig zurück. »Nichts für mich«, sagte er und schnippte sich imaginären Schnupftabak vom Rüschenkragen.
Quarry prustete los, das Gesicht seinerseits vom Rotwein und vor Belustigung errötet. Er schnappte nach Luft, prustete erneut und schlug mit beiden Händen auf den Tisch.
»Nun, so wählerisch sind Huren nicht. Und wenn so eine ihren Körper verkauft, verkauft sie auch alles, was sie sonst noch hat – Auskünfte über ihre Kunden eingeschlossen.«
Grey starrte den Oberst verständnislos an. Dann fiel der Groschen.
»Ihr meint, ich soll mich einer Prostituierten bedienen, um mir meinen Eindruck bestätigen zu lassen?«
»Ihr begreift schnell, Grey, wirklich schnell.« Quarry nickte beifällig und schnippte mit den Fingern, um noch mehr Wein zu bestellen. »Ich hatte eher daran gedacht, ein Mädchen ausfindig zu machen, das seinen Schwanz schon einmal gesehen hat, aber Eure Variante ist noch viel einfacher. Alles, was Ihr tun müsst, ist, Trevelyan in Euren Lieblingskonvent einzuladen, der Äbtissin etwas zuzuflüstern – und ihr etwas Kleingeld zuzustecken –, und das war’s!«
»Aber ich –« Grey hielt sich nur mit Mühe davon ab zuzugeben, dass er nicht nur kein Lieblingsbordell hatte – er hatte schon seit mehreren Jahren kein derartiges Etablissement mehr betreten. Er hatte die Erinnerung an sein letztes derartiges Erlebnis erfolgreich unterdrückt; er hätte inzwischen nicht einmal mehr sagen können, an welcher Straße das Gebäude gelegen hatte.
»Es wird wunderbar funktionieren«, versicherte ihm Quarry, ohne seine Verwirrung zu beachten. »Wird wahrscheinlich auch nicht allzu viel kosten; zwei Pfund dürften wohl reichen, höchstens drei.«
»Aber wenn ich dann weiß, ob sich mein Verdacht bestätigt hat –«
»Nun, wenn er nichts hat, seid Ihr aus dem Schneider, und wenn doch …« Quarry kniff nachdenklich die Augen zusammen. »Hm. Wie wär’s hiermit? Wenn Ihr es arrangieren könntet, dass die Hure etwas Geschrei und Theater macht, wenn sie einen genauen Blick auf ihn geworfen hat, kommt Ihr aus der Kammer Eures eigenen Mädchens gelaufen, um nachzusehen, was denn los ist. Es könnte ja sein, dass das Haus in Flammen steht.« Er prustete kurz, als er sich die Szene vorstellte, dann widmete er sich wieder seinem Plan.
»Nun, wenn Ihr ihn sozusagen kalt erwischt habt und die Lage ohne jeden Zweifel geklärt ist, glaube ich nicht, dass ihm viel anderes übrig bleibt, als einen Grund zu erfinden, um die Verlobung von sich aus zu lösen. Was sagt Ihr dazu?«
»Klingt, als könnte es funktionieren«, sagte Grey langsam, während er versuchte, sich das Bild vorzustellen, das Quarry entworfen hatte. Wenn man eine Hure mit hinreichend Talent zur Hysterie fand … und Grey musste ja schließlich die Dienste des Bordells nicht selbst in Anspruch nehmen.
Der Wein kam, und beide Männer verstummten einen Moment, während eingeschenkt wurde. Doch als der Steward ging, beugte sich Quarry mit leuchtenden Augen über den Tisch.
»Lasst mich wissen, wann Ihr gehen wollt; ich gönne mir den Spaß und komme mit!«
2
Ein Witwenbesuch
Frankreich«, sagte Stubbs angewidert, während er sich durch das Gedränge am Clove Market schob. »Schon wieder das verfluchte Frankreich, könnt Ihr das glauben? Ich habe mit DeVries gegessen, und er hat mir gesagt, er habe es direkt vom alten Willie Howard. Da dürfen wir dann wahrscheinlich in Calais den verdammten Hafen bewachen!«
»Wahrscheinlich«, sagte Grey und bahnte sich seinen Weg an einem Fischhändlerkarren vorbei. »Wann, wisst Ihr das?« Er tat so, als verärgere ihn der Gedanke an eine absehbar eintönige Stationierung in Frankreich genauso sehr wie Stubbs, doch in Wirklichkeit freute ihn diese Neuigkeit.
Er war gegenüber dem Lockruf des Abenteuers ebenso wenig immun wie jeder andere Soldat und hätte es genossen, die exotischen Sehenswürdigkeiten Indiens zu Gesicht zu bekommen. Doch er war sich auch sehr wohl bewusst, dass eine solche Stationierung in der Fremde ihn wahrscheinlich zwei Jahre oder länger von England fernhalten würde – von Helwater.
Ein Posten in Calais oder Rouen dagegen … er könnte problemlos alle paar Monate zurückkehren und das Versprechen erfüllen, das er seinem jakobitischen Gefangenen gegeben hatte – einem Mann, der zweifellos froh sein würde, wenn er ihn nie wieder zu sehen bekam.
Er schob diesen Gedanken entschlossen beiseite. Sie waren nicht in Freundschaft voneinander geschieden. Doch er hoffte auf die Macht der Zeit, den Bruch zu heilen. Wenigstens war Jamie Fraser in Sicherheit; er hatte ein anständiges Dach über dem Kopf, genug zu essen und genoss so viel Freiheit, wie seine Hafterleichterung eben zuließ. Grey tröstete sich mit dem Bild in seiner Vorstellung – ein langbeiniger Mann, der über die Hochmoore des Lake Districts schritt, das Gesicht der Sonne und den dahinziehenden Wolken zugewandt, das dichte rote Haar vom Wind verweht, der ihm Hemd und Kniehose eng an den sehnigen Körper klebte.
»Hoi! Hier entlang!« Stubbs’ Ausruf riss ihn gewaltsam aus seinen Gedanken, und er sah, wie der Leutnant hinter ihm ungeduldig auf eine Seitenstraße wies. »Wo seid Ihr nur heute mit Euren Gedanken, Major?«
»Ich hatte gerade an unseren neuen Posten gedacht.« Grey trat über eine schläfrige, verfilzte Hündin hinweg, die vor ihm ausgestreckt lag und sein Vorübergehen genauso wenig beachtete wie das Gewimmel der Welpen, die an ihren Zitzen saugten. »Wenn es Frankreich ist, gibt es wenigstens anständigen Wein.«
O’Connells Witwe bewohnte ein Zimmer über einer Apotheke in der Brewster’s Alley, wo sich die Gebäude auf derart engem Raum gegenüberstanden, dass es der Sommersonne nicht gelang, bis auf das Pflaster vorzudringen.
Stubbs und Grey durchwanderten den klammen Schatten und traten wiederholt Gerümpel beiseite, das wohl selbst den Anwohnern zu verkommen gewesen war.
Grey folgte Stubbs durch die enge Tür der Apotheke, über der ein Schild mit der verblassten Aufschrift »F. Scanlon, Apotheker« hing. Er blieb stehen, um mit dem Fuß aufzustampfen und einen verrotteten Pflanzenstrang abzuschütteln, der an seinem Stiefel klebte, blickte aber auf, als aus dem hinteren Teil der Apotheke eine Stimme erklang.
»Guten Tag, die Herren.« Die Stimme war leise und hatte einen starken irischen Akzent.
»Mr Scanlon?«
Grey sah blinzelnd in das Halbdunkel und machte den Besitzer aus, einen dunkelhaarigen, untersetzten Mann, der wie eine Spinne über seinem Tresen lauerte, die Arme ausgestreckt, als wartete er nur darauf, jederzeit jede gewünschte Ware zu packen.
»Ebendieser. Finbar Scanlon.« Der Mann neigte höflich den Kopf. »Darf ich fragen, was ich die Ehre habe, für die Herren tun zu können?«
»Mrs O’Connell«, sagte Stubbs knapp und wies mit einem Ruck seines Daumens nach oben, während er auf den hinteren Teil der Apotheke zutrat, ohne eine Einladung abzuwarten.
»Ah, die Dame ist gerade nicht da«, sagte der Apotheker und schlüpfte rasch hinter dem Tresen hervor, um Stubbs den Weg zu verstellen. Hinter ihm wehte ein verblichener Vorhang aus gestreiftem Leinen im Luftzug, der von der Tür herkam. Wahrscheinlich verdeckte er eine Treppe zu den oberen Räumen.
»Wo ist sie denn?«, fragte Grey scharf. »Kommt sie irgendwann zurück?«
»Oh, aye. Sie ist zum Priester gegangen, um mit ihm über das Begräbnis zu sprechen. Ich nehme an, Ihr wisst von ihrem Verlust?« Scanlons Blick huschte von einem Offizier zum anderen und forschte nach ihren Absichten.
»Natürlich«, sagte Stubbs kurz angebunden. Er ärgerte sich über Mrs O’Connells Abwesenheit. Er hatte kein Verlangen danach, ihren Ausflug zu verlängern. »Deswegen sind wir hier. Wird sie bald zurück sein?«
»Oh, das kann ich gar nicht sagen, Sir. Es könnte etwas dauern.« Der Mann trat ins Licht, das zur Tür hereinfiel. In den mittleren Jahren, sah Grey, mit silbernen Strähnen im ordentlich zusammengebundenen Haar, aber gut gebaut mit einem attraktiven, sauber rasierten Gesicht und dunklen Augen.
»Könnte ich Euch helfen, Sir? Wenn Ihr Beileidsgrüße für die Witwe habt, richte ich sie gerne aus.« Der Mann sah Stubbs unverhüllt und offen an – doch Grey sah den Hauch von Spekulation, der in seinem Blick lauerte.
»Nein«, kam er Stubbs’ Antwort zuvor. »Wir warten in ihren Räumen auf sie.« Er wandte sich dem gestreiften Vorhang zu, doch die Hand des Apothekers ergriff seinen Arm und brachte ihn zum Stehen.
»Möchten die Herren nicht etwas trinken, um sich das Warten zu versüßen? Das ist das Mindeste, was ich Euch anbieten kann, zu Ehren des Verschiedenen.« Der Ire wies einladend auf die vollgestopften Regale hinter seinem Tresen, auf denen zwischen den Töpfchen und Gläsern des Apothekerhandwerks auch mehrere Flaschen Alkohol standen.
»Hm.« Stubbs rieb sich mit dem Handrücken über den Mund und richtete die Augen auf die Flaschen. »Es ist ein ziemlich langer Weg gewesen.«
So war es, und Grey nahm die Einladung ebenfalls an, wenn auch etwas widerstrebend, als er sah, wie Scanlons lange Finger flink eine Ansammlung leerer Glasbehälter und Zinngefäße als Trinkgläser auswählte.
»Tim O’Connell«, sagte Scanlon und hob seine Dose, deren Etikett die Zeichnung einer Frau trug, die auf einer Chaiselongue in Ohnmacht sank. »Der beste Soldat, der je ein Gewehr erhoben und einen Franzosen erschossen hat. Möge er in Frieden ruhen.«
»Tim O’Connell«, murmelten Grey und Stubbs wie aus einem Munde und hoben zustimmend ihre Gläser.
Grey drehte sich ein wenig, als er das Glasgefäß an seine Lippen hob, sodass das Licht der Tür die darin befindliche Flüssigkeit erleuchtete. Der Alkoholdunst wurde von einem kräftigen Geruch nach dem ehemaligen Glasinhalt – Anis? Kampfer? – überlagert, doch immerhin schwammen keine verdächtigen Krümel darin.
»Wisst Ihr, wo Sergeant O’Connell umgekommen ist?«, fragte Grey. Nach einem kleinen Schluck senkte er seinen provisorischen Becher und räusperte sich. Die Flüssigkeit schien reiner Kornschnaps zu sein, klar und geschmacklos, aber stark. Sein Mund und seine Nasenhöhle fühlten sich an wie versengt.
Scanlon schluckte, hustete und blinzelte. Seine Augen tränten – wahrscheinlich eher vom Alkohol als vor Trauer –, und dann schüttelte er den Kopf.
»Ich habe nur gehört, dass es irgendwo am Fluss gewesen ist. Der Konstabler, der uns die Nachricht überbracht hat, sagte aber, man hätte ihn furchtbar zusammengeschlagen. Vielleicht bei einer Wirtshausrauferei eins auf den Schädel bekommen und dann im Gedränge zertrampelt. Der Konstabler hat etwas vom Abdruck eines Absatzes auf seiner Stirn erwähnt, möge Gott mit dem armen Mann Erbarmen haben.«
»Keine Festnahmen?«, keuchte Stubbs, dessen Gesicht rot anlief, so sehr strengte er sich an, nicht zu husten.
»Nein, Sir. So wie ich es verstanden habe, hat man die Leiche am Puddle Dock halb im Wasser auf den Stufen gefunden. Wahrscheinlich hat ihn der Wirt selbst da hingezerrt, um wegen der Leiche auf seinem Grund und Boden keinen Ärger zu bekommen.«
»Wahrscheinlich«, wiederholte Grey. »Es weiß also niemand genau, wo oder wie er zu Tode gekommen ist?« Der Apotheker schüttelte ernst den Kopf und ergriff die Flasche.
»Nein, Sir. Aber schließlich weiß keiner von uns, wo oder wann er sterben wird, nicht wahr? Unsere einzige Gewissheit ist, dass wir eines Tages diese Welt verlassen werden, und möge uns der Himmel gewähren, dass wir in der nächsten willkommen sind. Noch einen Tropfen, die Herren?«
Stubbs nahm dankend an, machte es sich auf dem Hocker bequem, der ihm angeboten wurde, und stützte einen Stiefel gegen den Tresen. Grey lehnte ab und schlenderte beiläufig durch die Apotheke. Den Becher in der Hand, inspizierte er das Angebot, während die beiden anderen in ein freundschaftliches Gespräch verfielen.
Die Apotheke schien ein Mordsgeschäft mit Potenzmitteln, Verhütungsmitteln und Arzneien gegen Gonorrhoe, Tripper und andere Risiken des Geschlechtsverkehrs zu machen. Grey schloss auf ein Bordell in der Nachbarschaft, und erneut bedrückte ihn der Gedanke an den Ehrenwerten Joseph Trevelyan, dessen Existenz zu vergessen ihm kurzfristig gelungen war.
»Die können auch mit Bändchen in Regimentsfarben geliefert werden!«, rief Scanlon, als er ihn vor einer bunten Ansammlung von »Kondomen für den feinen Herrn« anhalten sah. Ein Muster jeder Sorte war auf einer Glasform ausgestellt, die Bänder zum Verschluss zierlich um den Fuß der Form geringelt. »Schafsdarm oder Ziege, wie Ihr es vorzieht, Sir – parfümiert drei Farthings zusätzlich. Für die Herren wäre das natürlich gratis«, fügte er weltgewandt hinzu und verbeugte sich, während er den Flaschenhals erneut über Stubbs’ Becher neigte.
»Danke«, sagte Grey höflich. »Vielleicht später.« Er nahm kaum wahr, was er sagte, denn eine Reihe verkorkter Flaschen hatte seine Aufmerksamkeit erregt.
Quecksilbersulfid, stand auf mehreren Etiketten, Guiacum auf anderen. Der Inhalt der Flaschen schien sich im Aussehen zu unterscheiden, doch die Beschreibung war bei beiden Sorten gleich: Zur schnellen und wirksamen Behandlung bei Gonorrhoe, Weichem Schanker, Syphilis und allen anderen Formen der Geschlechtskrankheit.
Eine Sekunde lang kam ihm der wilde Gedanke, Trevelyan zum Essen einzuladen und ihm eine dieser vielversprechenden Substanzen unter das Essen zu mischen. Unglücklicherweise hatte er zu viel Erfahrung mit dieser Art von Medizin, um darauf zu vertrauen; Peter Tewkes, ein guter Freund, war im vergangenen Jahr gestorben, nachdem er sich im St. Bartholomew’s Hospital nach mehreren fehlgeschlagenen Versuchen mit frei käuflichen Arzneien einer »Quecksilbersalivation« zur Syphilisbehandlung unterzogen hatte.
Grey hatte es zwar nicht persönlich mit angesehen, da er zu diesem Zeitpunkt im Exil in Schottland gewesen war, hatte es jedoch von gemeinsamen Freunden gehört, die Tewkes besucht hatten und nachdrücklich von der furchtbaren Wirkung des Quecksilbers berichtet hatten, ganz gleich, ob innerlich oder äußerlich angewandt.
Er konnte nicht zulassen, dass Olivia Trevelyan heiratete, wenn er tatsächlich krank war, doch er hatte auch keinerlei Bedürfnis, verhaftet zu werden, weil er versucht hatte, den Mann zu vergiften.
Stubbs, der von der geselligen Sorte war, ließ sich gerade in ein Gespräch über den Feldzug in Indien verwickeln; die Zeitungen hatten von Clives Sturm auf Kalkutta berichtet, und ganz London vibrierte vor Aufregung.
»Aye, ich hab doch selbst einen Vetter, der unter Clive dient«, sagte der Apotheker und richtete sich sichtlich stolz auf. »Einundachtzigstes Artillerieregiment, bessere Soldaten findet man auf Gottes grüner Erde nicht –«, grinste er und zeigte seine ebenmäßigen Zähne, »– mit Ausnahme der anwesenden Herrschaften natürlich.«
»Einundachtzigstes?«, sagte Stubbs und machte ein verwirrtes Gesicht. »Ich dachte, Ihr hättet gesagt, Euer Vetter sei im Dreiundsechzigsten.«
»Beides, werter Sir. Ich habe mehrere Vettern, und das Soldatenleben liegt bei uns in der Familie.«
Jetzt, wo er seine Aufmerksamkeit wieder auf den Apotheker gerichtet hatte, wurde Grey allmählich bewusst, dass irgendetwas mit dem Mann nicht stimmte. Er kam näher und betrachtete Scanlon verstohlen über seinen Becherrand hinweg. Der Mann war nervös – warum? Seine Hände hatten nicht gezittert, als er den Alkohol eingeschenkt hatte, doch er hatte Falten der Anspannung um die Augen herum, und sein verkrampftes Kinn passte nicht zu seinem beiläufigen Redefluss. Der Tag war warm, doch in der Apotheke war es nicht warm genug, um den Schweißfilm auf den Schläfen des Apothekers zu erklären.
Grey schaute sich im Raum um, sah aber nichts Auffälliges. Verbarg Scanlon illegale Handelsware? Sie befanden sich hier nicht weit von der Themse entfernt; das Puddle Dock, wo man O’Connells Leiche gefunden hatte, lag am Zusammenfluss von Themse und Fleet, und Schmuggelei war wahrscheinlich ein ganz normaler Erwerb für jeden Bootsbesitzer in der Nachbarschaft. Eine Apotheke gab einen besonders guten Umschlagplatz für Schmuggelware ab.
Doch wenn das der Fall war, warum alarmierte ihn die Gegenwart zweier Armeeoffiziere so? Die Schmuggelei war eine Angelegenheit des Londoner Magistrats oder Zolls, vielleicht der Schiffereibehörden, aber –
Über ihren Köpfen erklang ein leises, aber deutliches Rumpeln.
»Was ist das?«, fragte er scharf und blickte nach oben.
»Oh – nichts, nur die Katze«, erwiderte der Apotheker sofort und machte eine abwinkende Handbewegung.
»Abscheuliche Kreaturen, Katzen, aber da Mäuse noch abscheulichere Kreaturen sind …«
»Das war keine Katze.« Greys Augen waren immer noch zur Decke gerichtet, an deren Balken getrocknete Kräuterbündel hingen. Während er hinsah, erzitterte eines der Bündel kurz, dann das daneben; ein feiner, goldener Staub rieselte nieder, und der Lichtstrahl, der zur Tür hereinfiel, ließ die einzelnen Körnchen aufleuchten.
»Da oben läuft jemand herum.« Ohne den Protest des Apothekers zu beachten, schritt er auf den Leinenvorhang zu, schob ihn zur Seite und hatte die Treppe schon zur Hälfte erklettert, die Hand am Schwertknauf, bevor Stubbs sich so weit gesammelt hatte, dass er ihm folgen konnte.
Das Zimmer im ersten Stock war eng und schäbig, doch durch zwei Fenster schien die Sonne auf einen mitgenommenen Tisch nebst Stuhl – und auf eine noch stärker mitgenommene Frau, deren Mund vor Überraschung offen stand, als sie jetzt beim Absetzen eines Tellers mit Brot und Käse erstarrte.
»Mrs O’Connell?« Sie wandte ihm den Kopf zu – und jetzt erstarrte Grey ebenfalls. Ihr offener Mund war geschwollen, die Lippen waren aufgeplatzt, und in ihrem Zahnfleisch klaffte ein dunkelrotes Loch, denn einer ihrer unteren Zähne war ausgeschlagen. Beide Augen waren bis auf Schlitze zugeschwollen, und sie blinzelte ihn durch eine Maske aus blau-gelblichen Flecken an. Wie durch ein Wunder war ihre Nase nicht gebrochen; ihr schmaler Nasenrücken und die zierlichen Nasenlöcher lugten überraschend blass aus der Verwüstung hervor.
Sie hob eine Hand an ihr Gesicht und wandte sich vom Licht ab, als schäme sie sich ihrer Erscheinung.
»Ich … ja. Ich bin Francine O’Connell«, murmelte sie durch den Fächer ihrer Finger.
»Mrs O’Connell!« Stubbs trat einen Schritt auf sie zu, dann blieb er stehen, unsicher, ob er sie berühren sollte.
»Wer – wer hat Euch das angetan?«
»Ihr Mann. Möge seine Seele in der Hölle schmoren.« Die Bemerkung erklang im Konversationston in ihrem Rücken. Als Grey sich umdrehte, sah er den Apotheker ins Zimmer treten. An der Oberfläche war sein Verhalten immer noch beiläufig, doch seine ganze Aufmerksamkeit war auf die Frau konzentriert.
»Ihr Mann, ja?« Stubbs, der bei all seiner Geselligkeit kein Dummkopf war, griff nach den Händen des Apothekers und drehte dessen Fingerknöchel zum Licht. Der Mann ließ diese Inspektion in aller Ruhe über sich ergehen, dann entzog er Stubbs seine unverletzten Hände. Als sei ihm damit eine Erlaubnis erteilt worden, durchquerte er das Zimmer und stellte sich neben die Frau. Er strahlte unterdrückten Trotz aus.
»Es ist die Wahrheit«, sagte er, äußerlich nach wie vor ruhig. »Tim O’Connell war ein guter Mann, solange er nüchtern war, aber wenn er getrunken hatte … ein Ungeheuer in Menschengestalt, nicht weniger.« Er schüttelte den Kopf, die Lippen aufeinandergepresst.
Grey wechselte einen Blick mit Stubbs. Es stimmte; sie konnten sich beide noch gut daran erinnern, wie sie O’Connell einmal am Ende eines freien, durchzechten Abends in Richmond aus dem Gefängnis geholt hatten. Der Konstabler und der Kerkermeister trugen beide die Spuren der Festnahme, wenn auch keiner von ihnen so übel ausgesehen hatte wie O’Connells Frau.
»Und in welcher Beziehung steht Ihr zu Mrs O’Connell, wenn ich fragen darf?«, erkundigte sich Grey höflich. Es war kaum notwendig zu fragen; er konnte sehen, wie sich der Körper der Frau dem Apotheker zuneigte wie eine Kletterranke, die ihres Spaliers beraubt ist.
»Ich bin natürlich ihr Vermieter«, erwiderte der Mann neutral und legte Mrs O’Connell die Hand auf den Ellbogen. »Und ein Freund der Familie.«
»Ein Freund der Familie«, wiederholte Stubbs. »Ah ja.« Seine weit geöffneten blauen Augen wanderten tiefer und verweilten gezielt auf der Taille der Frau, unter deren Schürze sich die Wölbung einer fünf oder sechs Monate alten Schwangerschaft zeigte. Das Regiment – und Sergeant O’Connell – waren gerade einmal vor sechs Wochen nach London zurückgekehrt.
Stubbs warf Grey einen Blick zu, in dem eine Frage lag. Grey zog sacht eine Schulter hoch, dann nickte er kaum merklich. Wer auch immer Sergeant O’Connell auf dem Gewissen hatte, es war eindeutig nicht seine Frau – und sie hatten sowieso kein Recht, ihr das Geld vorzuenthalten.
Stubbs grollte leise, griff jedoch in seinen Rock und zog eine Geldbörse hervor, die er auf den Tisch warf.
»Ein kleines Zeichen der Erinnerung und Wertschätzung«, sagte er, ohne die Feindseligkeit in seiner Stimme zu unterdrücken. »Von den Kameraden Eures Mannes.«
»Geld für ein Leichentuch, wie? Ich will es nicht.« Die Frau lehnte sich nicht länger an Scanlon, sondern richtete sich auf. Unter ihren Verletzungen war sie bleich, doch ihre Stimme war kräftig. »Nehmt es wieder mit. Ich begrab meinen Mann selbst.«
»Seltsam«, sagte Grey höflich. »Warum sollte die Frau eines Soldaten die Hilfe seiner Kameraden zurückweisen? Ob es ihr Gewissen ist?«
Bei diesen Worten verfinsterte sich das Gesicht des Apothekers, und die Hände an seinen Seiten ballten sich zu Fäusten.
»Was meint Ihr damit?«, fragte er herausfordernd.
»Dass sie ihn umgebracht hat und sie Euer Geld aus Schuldgefühl abweist? Zeig ihnen deine Hände, Francine!«
Er ergriff die Hände der Frau und riss sie hoch, sodass sie gut zu sehen waren. Der kleine Finger der einen Hand war mit einem Holzspan geschient; ansonsten trugen ihre Hände keine Spuren außer den Narben abgeheilter Verbrennungen und den rauen Fingerknöcheln täglicher Arbeit – die Hände einer Hausfrau, die zu arm war, um eine Hilfe zu bezahlen.
»Ich gehe nicht davon aus, dass Mrs O’Connell ihren Mann selbst zu Tode geprügelt hat, nein«, erwiderte Grey unverändert höflich. »Aber sie muss ja nicht ihrer eigenen Taten wegen ein schlechtes Gewissen haben, oder? Es könnte ja auch Taten gelten, die in ihrem Interesse geschehen sind – oder auf ihren Wunsch.«
»Kein schlechtes Gewissen.« Die Frau entriss Scanlon abrupt ihre Hände und stand auf. Ihr verwüstetes Gesicht zitterte. Die Gefühle wechselten wie Meeresströmungen unter ihrer fleckigen Gesichtshaut, als sie nun von einem Mann zum anderen blickte.
»Ich werde Euch sagen, warum ich Euer Geschenk zurückweise, meine Herren. Der Grund ist nicht mein Gewissen, sondern mein Stolz.« Ihre Schlitzaugen ruhten auf Grey, hart und leuchtend wie Diamanten. »Oder meint Ihr, eine arme Frau wie ich hat keinen Anspruch auf ihren Stolz?«
»Stolz auf was?«, wollte Stubbs wissen. Er warf erneut einen vielsagenden Blick auf ihren Bauch. »Ehebruch?«
Zu Stubbs’ peinlich berührter Überraschung lachte sie.
»Ehebruch, was? Nun, wenn es das ist, dann habe ich nicht damit angefangen. Tim O’Connell hat mich voriges Jahr im Frühling sitzen gelassen; hat was mit ’ner Bordellschlampe angefangen und sein ganzes Geld ausgegeben, um ihr Flitterkram zu kaufen. Vor zwei Tagen, als er hierhergekommen ist, habe ich ihn zum ersten Mal seit sechs Monaten gesehen. Hätte Mr Scanlon mir nicht Arbeit und ein Dach überm Kopf angeboten, wäre ich mit Sicherheit zu der Hure geworden, für die Ihr mich haltet.«
»Besser Hure für einen Mann als für viele, nehme ich an«, murmelte Grey und legte Stubbs die Hand auf den Arm, um weitere unbeherrschte Bemerkungen zu unterbinden.
»Dennoch, Madam«, fuhr er etwas lauter fort, »verstehe ich nicht ganz, was Ihr dagegen habt, ein Geschenk von den Kameraden Eures Mannes anzunehmen, um Euch bei der Beerdigung behilflich zu sein – wenn sein Tod Euch tatsächlich keine Schuldgefühle verursacht.«
Die Frau richtete sich auf und verschränkte die Arme unter ihrer Brust.
»Werde ich die Börse da annehmen und sie benutzen, um schöne Worte über seiner stinkenden Leiche sprechen zu lassen? Oder schlimmer noch, Kerzen anzünden und Messen für eine Seele sprechen zu lassen, die jetzt im Schlund der Hölle brennt, wenn der Herr Gerechtigkeit kennt? Nein, Sir, das werde ich nicht!«
Grey betrachtete sie mit Interesse – und einem gewissen Maß an Bewunderung –, dann richtete er den Blick auf den Apotheker, um zu sehen, wie er diese Rede aufnahm. Scanlon war einen Schritt zurückgetreten; seine Augen waren auf das verletzte Gesicht der Frau geheftet, seine Stirn hatte sich leicht gerunzelt.
Grey schob sich die silberne Halsberge zurecht, dann beugte er sich vor, nahm die Börse vom Tisch und ließ sie auf seiner Handfläche klimpern.
»Wie Ihr wünscht, Madam. Möchtet Ihr dann auch die Pension ablehnen, die Euch als Witwe eines Sergeanten zusteht?« Eine solche Pension war ohnehin gering, doch in Anbetracht der Lage, in der sich die Frau befand …
Einen Moment stand sie unentschlossen da, dann hob sich ihr Kopf wieder.
»Die nehme ich an«, sagte sie und schenkte ihm einen glitzernden Blick aus ihrem zugeschwollenen Auge. »Ich habe sie mir verdient.«
3
Oh, welch verworrenes Netz wir weben …
Es blieb ihnen nichts anderes übrig, als die Angelegenheit zu Protokoll zu geben. Jemanden zu finden, der sie zu Protokoll nahm, war schon schwieriger; da das Regiment für seinen neuen Posten aufgestockt und ausgestattet wurde, herrschte ein ständiges Kommen und Gehen. Die übliche Parade war vorerst ausgesetzt, und niemand war, wo er sein sollte. Es war kurz nach Sonnenuntergang am folgenden Tag, als Grey endlich auf Quarry stieß, und zwar im Rauchersalon des »Beefsteaks«.
»Meint Ihr, sie haben die Wahrheit gesagt?« Quarry spitzte die Lippen und blies nachdenklich einen Rauchkringel in die Luft. »Scanlon und die Frau?«
Grey, der sich darauf konzentrierte, seine frische Cheroot-Zigarre zum Ziehen zu bringen, schüttelte den Kopf. Als die Zigarre ordentlich zu brennen schien, entfernte er sie von seinen Lippen, um zu antworten.
»Sie ja – zum Großteil. Er nicht.«
Quarry zog die Augenbrauen hoch, dann runzelte er die Stirn.
»Seid Ihr sicher? Ihr habt gesagt, er war nervös; könnte das nicht einfach daran liegen, dass er nicht wollte, dass Ihr Mrs O’Connell entdeckt – und damit seine Beziehung zu ihr?«
»Doch«, sagte Grey. »Aber auch nachdem wir mit ihr gesprochen hatten … ich kann nicht genau sagen, worüber Scanlon gelogen hat – oder auch nur, dass er tatsächlich gelogen hat. Aber er wusste etwas über O’Connells Tod, das er nicht geradeheraus erzählt hat, oder ich fresse einen Besen.«
Quarry grunzte als Antwort und lehnte sich in seinem Sessel zurück. Er zog heftig an seiner Zigarre und starrte konzentriert zur Decke. Von Natur aus träge, hasste Quarry es zu denken, doch er konnte es, wenn er musste. Aus Respekt vor der Mühe, die ihm dies abforderte, sagte Grey nichts und zog nur dann und wann an der spanischen Zigarre, die Quarry, der eine Vorliebe für dieses exotische Kraut hegte, ihm aufgedrängt hatte. Er selbst rauchte normalerweise nur zu medizinischen Zwecken, wenn ihn ein schwerer Schnupfen plagte, doch der Rauchersalon des »Beefsteaks« bot ihnen um diese Tageszeit die beste Gelegenheit zu einer Unterredung unter vier Augen, da die meisten Mitglieder jetzt beim Abendessen waren.
Greys Magen knurrte bei dem Gedanken an Abendessen, doch er ignorierte das. Später war noch genug Zeit zum Essen.
Quarry nahm die Zigarre gerade so lange aus dem Mund, dass er »Zum Teufel mit Eurem Bruder« sagen konnte, dann steckte er sie wieder hinein und nahm seine Betrachtung der pastoralen Szene an der Stuckdecke über ihren Köpfen wieder auf.
Grey nickte, denn er stimmte mit dieser Aussage zutiefst überein. Hal war Oberst des Regiments und Oberhaupt der Greyschen Familie. Hal war in Frankreich – seit einem Monat. Seine vorübergehende Abwesenheit erwies sich jetzt als unangenehme Bürde für jene, deren Pflicht es war, die Verantwortung zu schultern, die normalerweise die seine war. Doch daran war nichts zu ändern; Pflicht war Pflicht.
In Hals Abwesenheit oblag das Kommando über das Regiment dessen beiden regulären Obersten, Harry Quarry und Bernard Sydell. Grey zögerte keine Sekunde bei seiner Entscheidung, wem er Bericht erstatten sollte. Sydell war ein älterer Herr, mürrisch und streng, der nur wenig über seine Soldaten wusste und sich noch weniger für sie interessierte.
Einer der ewig wachsamen Bediensteten, der das sich abzeichnende Inferno beobachtete, trat wortlos vor und setzte Quarry ein kleines Porzellanschälchen auf die Brust, bevor die qualmende Zigarrenasche seine Weste in Brand setzen konnte. Quarry ignorierte ihn und schmauchte weiter rhythmisch vor sich hin, wobei er ab und zu leise aufgrollte.
Greys Zigarre war ausgegangen, als Quarry schließlich das Porzellanschälchen von seiner Brust entfernte und die nassen Überreste seiner Zigarre aus dem Mund nahm. Er setzte sich gerade hin und seufzte tief.
»Es hilft alles nicht«, sagte er. »Ihr müsst es erfahren.«
»Was denn?«
»Wir glauben, dass O’Connell ein Spion war.« Erstaunen und Bestürzung wetteiferten mit einem gewissen Gefühl der Genugtuung um einen Platz in Greys Brust. Er hatte gewusst, dass an der Brewster’s Alley etwas nicht stimmte.
»Spion für wen?« Sie waren allein; der allgegenwärtige Bedienstete war momentan verschwunden, doch Grey sah sich dennoch um und senkte seine Stimme.
»Wir wissen es nicht.« Quarry drückte seinen Zigarrenstummel in das Schälchen und stellte es beiseite. »Das war der Grund, warum Euer Bruder sich entschieden hat, ihn erst einmal in Ruhe zu lassen, nachdem uns der Verdacht gekommen war – in der Hoffnung, seinen Auftraggeber zu entdecken, sobald das Regiment wieder in London war.«
Das leuchtete ein; zwar war es gut möglich, dass O’Connell unterwegs gut nützliche militärische Informationen gesammelt hatte, doch es musste ihm sehr viel einfacher gefallen sein, diese im wimmelnden Ameisenhaufen Londons weiterzugeben, wo sich tagaus, tagein Menschen aus aller Herren Länder in den Fluten des Handels tummelten, die die Themse entlanggeflossen kamen, als in der Beengtheit des Militärlagers.
»Oh, ich verstehe«, sagte Grey und warf Quarry einen scharfen Blick zu, als ihm ein Licht aufging. »Hal hat die Gerüchteküche über den neuen Standort des Regiments ausgenutzt, nicht wahr? Stubbs hat mir nach dem Essen erzählt, er habe von DeVries gehört, dass wir definitiv wieder nach Frankreich geschickt würden – wahrscheinlich nach Calais. Ich nehme an, das war eine Finte, die O’Connells wegen gelegt wurde?«
Quarry sah ihn ausdruckslos an.
»Gab keine offizielle Verlautbarung, oder?«
»Nein. Und wir können davon ausgehen, dass das Zusammenfallen einer solchen inoffiziellen Entscheidung mit Sergeant O’Connells plötzlichem Ableben hinreichend, äh … interessant ist?«
»Geschmackssache, würde ich sagen«, sagte Quarry mit einem erneuten tiefen Seufzer. »Ich würde es ein verflixtes Ärgernis nennen.«
Der Bedienstete kam lautlos wieder in das Zimmer und trug einen Humidor in der einen Hand, einen Pfeifenständer in der anderen. Die Zeit des Abendessens ging zu Ende, und jene Mitglieder, die gern ein Verdauungspfeifchen rauchten, würden in Kürze den Flur entlangkommen, um ihre Pfeifen an sich zu nehmen und sich auf ihrem Lieblingssessel niederzulassen.
Grey saß einen Augenblick stirnrunzelnd da.
»Warum ist der … fragliche Gentleman denn … unter Verdacht geraten?«
»Erratet Ihr das denn nicht selbst?« Quarry zog eine Schulter hoch und ließ es im Unklaren, ob seine Schweigsamkeit in seinem eigenen Unwissen oder in offizieller Diskretion begründet lag.
»Verstehe. Dann ist mein Bruder also vielleicht in Frankreich – und vielleicht auch nicht?«
Ein schwaches Lächeln ließ die weiße Narbe auf Quarrys Wange zucken.
»Das müsst Ihr doch besser wissen als ich, Grey.«
Der Bedienstete war wieder aus dem Zimmer gegangen, um die anderen Humidore zu holen; mehrere Clubmitglieder bewahrten ihre persönlichen Tabak- und Schnupftabakmischungen hier auf. Er konnte schon hören, wie im Speisezimmer die Nachtisch-Gespräche lauter wurden. Grey beugte sich vor, bereit, aufzustehen.
»Aber Ihr habt ihn natürlich beschatten lassen – O’Connell. Jemand muss ihn in London genau beobachtet haben.«
»Oh, ja.« Quarry schüttelte sich, um seine Kleider ansatzhaft zu ordnen, strich sich die Asche von den Knien seiner Hose und zog seine zerknitterte Weste glatt. »Hal hat einen Mann gefunden. Sehr diskret und in guter Position. Einen Dienstboten, der bei einem Freund der Familie angestellt ist – das heißt, Eurer Familie.«
»Und dieser Freund ist –?«
»Der Ehrenwerte Joseph Trevelyan.« Quarry stand umständlich auf und ging als Erster aus dem Raucherzimmer. Grey blieb es überlassen, ihm nach bestem Vermögen zu folgen, während ihm mehr als nur der Tabakqualm die Sinne betäubte.
Auf grauenhafte Weise war das Ganze einleuchtend, dachte er, während er Quarry zum Ausgang folgte. Trevelyans und Greys Familien standen seit zwei Jahrhunderten in enger Verbindung, und zum Teil war es Joseph Trevelyans Freundschaft mit Hal, die überhaupt zu seiner Verlobung mit Olivia geführt hatte.