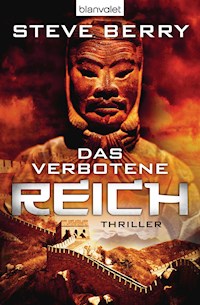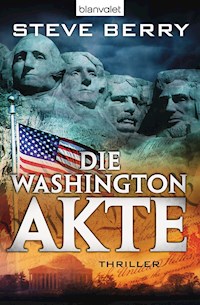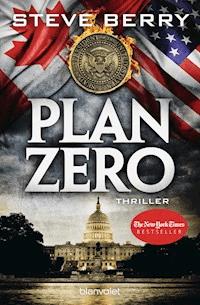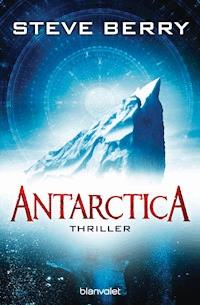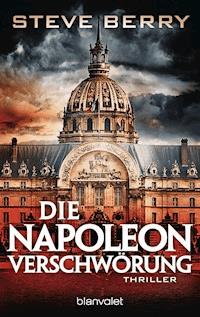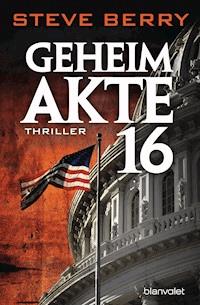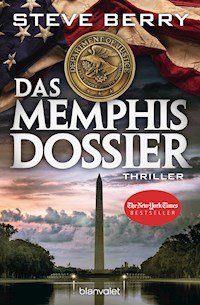
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Cotton Malone
- Sprache: Deutsch
Eine seltene Münze birgt die explosive Wahrheit über eines der brisantesten Kapitel der amerikanischen Geschichte …
In den Geschichtsbüchern steht, dass die Überwachung Martin Luther Kings durch das FBI am Tag seiner Ermordung endete. Doch nun, Jahrzehnte später, stößt Ex-Agent Cotton Malone auf geheime Dokumente, die den schicksalhaften 4. April 1968 in neuem Licht erscheinen lassen. Diese Informationen könnten Unschuldige das Leben kosten und das Erbe des größten Helden der Bürgerrechtsbewegung gefährden. Der Fall führt Malone von Mexiko bis Washington, D.C. – und zu einem Vorfall achtzehn Jahre zuvor, als ein junger Cotton Malone zwischen die Fronten des Justizministeriums und des FBIs geriet ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 523
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Buch
In den Geschichtsbüchern steht, dass die Überwachung Martin Luther Kings durch das FBI am Tag seiner Ermordung endete. Doch nun, Jahrzehnte später, stößt Ex-Agent Cotton Malone auf geheime Dokumente, die den schicksalhaften 4. April 1968 in neuem Licht erscheinen lassen. Diese Informationen könnten Unschuldige das Leben kosten und das Erbe des größten Helden der Bürgerrechtsbewegung gefährden. Der Fall führt Malone von Mexiko bis Washington, D.C. – und zu einem Vorfall achtzehn Jahre zuvor, als ein junger Cotton Malone zwischen die Fronten des Justizministeriums und des FBI geriet …
Der Autor
Steve Berry war viele Jahre als erfolgreicher Anwalt tätig, bevor er seine Leidenschaft für das Schreiben entdeckte. Mit jedem seiner hochspannenden Thriller stürmt er in den USA die Spitzenplätze der Bestsellerlisten und begeistert Leser in über 50 Ländern. Steve Berry lebt mit seiner Frau in St. Augustine, Florida.
Von Steve Berry bereits erschienen
Die Napoleon-Verschwörung, Das verbotene Reich, Die Washington-Akte, Die Kolumbus-Verschwörung, Das Königskomplott, Der Lincoln-Pakt, Antarctica, Geheimakte 16, Plan Zero, Der Goldene Zirkel, Das Memphis-Dossier
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und
www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Steve Berry
DAS
MEMPHIS-DOSSIER
Thriller
Aus dem Amerikanischen
von Wolfgang Thon
Die Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel
»The Bishop’s Pawn« bei Minotaur Books, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © der Originalausgabe 2018 by Steve Berry
Published by Arrangement with MAGELLAN BILLET INC.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die
Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, Hannover.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2019 by Blanvalet Verlag,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Werner Bauer
© Johannes Frick unter Verwendung von Motiven von
Claire Gentile/Moment/Getty Images und © Leigh Prather/Shutterstock.com
JB · Herstellung: sam
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-24094-3V002
www.blanvalet.de
Für Patricia June Goulding
Und ein langes Leben
Und sie sprachen zueinander:
Seht, da kommt der Träumer daher!
Und nun kommt und lasst uns ihn töten und in eine Zisterne
werfen und sagen, ein böses Tier habe ihn gefressen;
dann wollen wir sehen, was aus seinen Träumen wird!
Das erste Buch Mose (Genesis) 37,19-20
Prolog
Gegenwart
Es ist schon ironisch, dass alles mit einem Mord begann und jetzt mit einem neuen enden könnte.
Man hat mich zu einer berühmten Adresse bestellt: 501 Auburn Avenue, Atlanta, Georgia. Das Haus im Queen-Anne-Stil ist zweigeschossig, hat Bullaugenfenster, ein Giebeldach und eine große, überdachte Veranda mit Holzdekor. Es liegt in einem Wohnviertel mit einem klangvollen Namen: Sweet Auburn. Hier wohnten aufstrebende Mittelklassefamilien, die zum Arbeiten in die Stadt pendelten. Vor sechzig Jahren wurde die Gegend zum Epizentrum einer Bewegung, die schließlich das Land veränderte. Das afroamerikanische Paar, das hier lebte, wollte nicht, dass eines seiner Kinder in einem Krankenhaus mit Rassentrennung entbunden wurde, deshalb erblickten alle drei in diesem Haus das Licht der Welt. Das erste, ein Mädchen namens Christine, kam zu früh, noch bevor überhaupt eine Wiege gefunden war. So verbrachte es die ersten Nächte seines Lebens in einer Kommodenschublade. Das jüngste, Alfred Daniel, wurde an einem heißen Julitag geboren. Das mittlere Kind, ein Knabe, kam bezeichnenderweise im Mittelraum des Obergeschosses zur Welt – am 15. Januar 1929. Sie nannten ihn Michael, nach seinem Vater. Aber fünf Jahre später änderte der Vater nach einer Berlinreise seinen eigenen Namen und den seines Sohnes zu Martin Luther King, sen. der eine, jr. der andere.
Ich stehe im Erdgeschoss in einem stillen Vorraum. Die Einladung traf vor einer Woche mit normaler Post in meiner Kopenhagener Buchhandlung ein. Sie steckte in einem handschriftlich an mich – Cotton Malone – adressierten Umschlag und bestand aus einem Anschreiben, in dem nichts weiter stand als:
50 Jahre sind vergangen.
Bringen Sie das Zeug her.
Und weiter:
3. April, Kings Haus im MLK-Center, 23 Uhr
Eine Unterschrift fehlte.
Doch ich wusste, wer der Absender war.
In den abgedunkelten Erdgeschossräumen sind ein paar eingeschaltete Nachtlichter verteilt. Vor Jahren, als ich in Atlanta wohnte und für das Magellan Billet arbeitete, besuchte ich das Haus eines Sonntagnachmittags mit Pam und Gary – es war einer jener seltenen Familienausflüge von Mutter, Vater und Sohn. Wir schlossen uns einer Führung durch das Haus an, dann durchstreiften wir das gesamte King-Center und versuchten, Gary zu vermitteln, wie wichtig die Gleichberechtigung der Rassen ist. Pam und ich waren stolz darauf, absolut vorurteilsfrei zu sein, und wir wollten unseren Sohn im selben Geist erziehen.
Ich warf einen Blick in den Besuchersalon mit dem Grammophon und dem berühmten Klavier. Der Fremdenführer erzählte uns damals, dass King an diesem Instrument Musikunterricht hatte. Wenn ich mich recht entsinne, gehörte es nicht zu den Erfahrungen, an die sich das mittlere Kind besonders gern erinnerte.
Wir erfuhren auch ein paar andere Dinge über Martin Luther King jr.
Er besuchte die nahegelegene Elementary- und Highschool, danach das Morehouse College am anderen Ende der Stadt. Im Jahr 1954 erhielt er ein Pastorat in der Baptistenkirche in der Dexter Avenue, Montgomery, Alabama. Doch als es der Schwarzen Rosa Parks 1955 verboten wurde, sich in den Weißen vorbehaltenen vorderen Bereich eines Busses zu setzen, organisierte King den Busboykott in Montgomery, der sich über einen Zeitraum von 381 Tagen erstreckte. 1957 wurde er Präsident der erstarkenden Southern Christian Leadership Conference SCLC. Drei Jahre später zog er wieder nach Atlanta und teilte sich mit seinem Vater das Pastorat der Ebenezer-Baptistenkirche, die es hier, gleich die Straße hinunter, immer noch gibt.
Von dort aus wurde er zum Sprachrohr einer großen Bewegung.
So viele bemerkenswerte Reden. Zwei gewaltige gesetzgeberische Erfolge: der Civil Rights Act, der die Rassentrennung aufhob, und der Voting Rights Act, der die Benachteiligung von Schwarzen bei öffentlichen Wahlen erschweren sollte. Der Friedensnobelpreis. Dreißig Verhaftungen im Dienst der guten Sache. Und dann schließlich der 4. April 1968 in Memphis, als die Kugel eines Attentäters seinem Leben ein Ende machte.
Er war erst neununddreißig Jahre alt.
Ich starre den Mann an, der am gegenüberliegenden Ende der Erdgeschossdiele im Dunkeln steht. Er ist unübersehbar gealtert, aber sein Gesicht scheint im Laufe der Jahre nur noch ausdrucksstärker geworden zu sein. Sein Haar ist grauer, sein Körper schmaler geworden, geblieben sind die Ausstrahlung eines sanften Intellektuellen, der leicht gebeugte Gang und das Schlurfen bei jedem Schritt, mit dem er sich nähert.
»Morgen ist hier eine Menge los«, sagt er mit der leisen Stimme, die mir im Gedächtnis geblieben ist. »Fünfzig Jahre sind es her, seit King starb.« Er macht eine Pause. »Fast zwanzig Jahre, seit Sie und ich zum letzten Mal geredet haben. Ich spüre den Schmerz noch jeden Tag.«
Eine rätselhafte Bemerkung, doch etwas anderes habe ich auch nicht erwartet. »Nur aus Neugierde: Wie sind wir heute Abend hier hereingekommen? Das hier ist eine nationale Gedenkstätte.«
»Ich habe Beziehungen.«
Daran zweifle ich nicht. So war es schon, als vor vielen Jahren alles seinen Anfang nahm.
»Haben Sie sie mitgebracht?«, will er wissen.
Ich fasse in meine Gesäßtasche und zeige ihm, wonach er verlangt hat. »Alles dabei.«
»Sie haben sie all die Jahre sicher verwahrt. Und das Geheimnis auch. Reife Leistung.«
»Es war mein Beruf, Geheimnisse zu schützen.«
»Ich habe Sie im Auge behalten. Wie lange haben Sie für das Justizministerium gearbeitet? Zehn Jahre?«
»Zwölf.«
»Als Agent beim Magellan Billet. Und jetzt leben Sie in Dänemark und besitzen ein Antiquariat. Was für ein Kontrast.«
Er trägt eine Waffe im Hosenbund. Ich zeige darauf. »Ist die nötig?«
»Wir wussten beide, dass es irgendwann mal so weit ist.«
Kann sein.
»Sie sind darüber hinweg«, sagt er. »Alles, was geschah, hat Sie nur zu Größerem angespornt. Dieser Weg kam für mich nicht infrage. Für mich ist es schon ein Wunder, dass ich überhaupt so lange durchgehalten habe.«
Es stimmt. Mein Leben hat sich auf eine Weise verändert, die ich mir niemals erträumt hätte. Doch damals lernte ich auch eine wichtige Lektion.
»Heute Abend bin ich Ihretwegen hier«, sage ich.
»Legen Sie alles auf den kleinen Tisch, bitte.«
Es hat keinen Zweck zu diskutieren, deshalb tue ich, was er verlangt.
»Die Familie King lebte lange in diesem Haus«, sagt er. »Sie zogen unter diesem Dach drei Kinder groß, von denen eines in besonderer Weise heranreifte und die Welt veränderte.«
»Wir wissen beide, dass es ihm allein nicht gelungen wäre. Sie hatten großen Anteil daran.«
»Es ist nett, dass Sie das sagen. Aber das macht es nicht besser.«
Was damals wirklich geschehen ist, weiß bzw. wusste nur eine Handvoll Menschen, von denen die meisten inzwischen tot sind.
»Denken Sie manchmal noch an jene Tage?«, fragt er.
Während meiner Zeit beim Magellan Billet wurde ich mit einer ganzen Reihe erstaunlicher Dinge konfrontiert: mit Tempelrittern, mit einem skrupellosen zentralasiatischen Diktator, mit den Geheimnissen Karls des Großen, der verschollenen Bibliothek von Alexandria und Piraten der Neuzeit. Aber nichts ließ sich mit dem vergleichen, womit ich es bei meinem ersten Einsatz zu tun hatte.
Es passierte, bevor es das Magellan Billet überhaupt gab.
»Ständig«, antworte ich.
»Sollte die Wahrheit ans Licht kommen?«
Eine berechtigte Frage. Fünfzig Jahre sind seither vergangen, und die Welt hat sich verändert. Doch ich deute noch einmal auf die Waffe und kann mir eine Frage nicht verkneifen. »Ist die Waffe für mich oder Sie?«
Er antwortet nicht sofort.
Ich habe früh gelernt, dass die Handlungen von Menschen fast immer unkoordinierter als ihr Kopf sind. Deshalb lasse ich Vorsicht walten.
»Ich will darüber reden«, murmelt er schließlich.
»Und es gibt nicht viele, die für Sie als Zuhörer infrage kommen.«
Er nickt. »Es zerfrisst mich. Sie müssen mir alles erzählen, was passiert ist. Damals haben wir uns nie darüber unterhalten.«
Ich höre, was er nicht ausgesprochen hat. »Und dann?«
»Dann entscheide ich, für wen von uns beiden diese Waffe bestimmt ist.«
JUNI VOR 18 JAHREN
1
Zwei Gefälligkeiten änderten den Lauf meines Lebens.
Um die erste ging es an einem warmen Dienstagmorgen. Ich fuhr den Southside Boulevard in Jacksonville, Florida, hinunter und hörte Autoradio. Ein kurzer Druck auf den »SUCHEN«-Knopf, und schon kam aus den Lautsprechern: »Warum gibt es in New York viel Müll und in Los Angeles viele Anwälte?«
»New York durfte zuerst wählen.«
Laute Lacher. Dann ging es weiter. »Wie kriegt man einen Anwalt vom Baum?«
Niemand schien die Antwort zu wissen.
»Man schneidet das Seil durch.«
»Neulich haben Terroristen ein Flugzeug voller Anwälte entführt.«
»Wie schrecklich. Was ist passiert?«
»Sie drohten, wenn ihre Forderungen nicht erfüllt werden, lassen sie jede Stunde einen Anwalt frei.«
Noch mehr Gelächter.
»Was haben Anwälte und …«
Ich schaltete das Radio aus. Die Radiomoderatoren amüsierten sich offenbar prächtig, und es war nicht weiter riskant, sich über Anwälte lustig zu machen. Wer zum Teufel sollte sich auch beschweren? Es waren ja keine Schwulenwitze, Polenkalauer und nichts, was auch nur im Entferntesten sexistisch war. Alle Welt hasste Anwälte. Jeder machte Witze über sie. Und wenn es den Anwälten nicht passte, wen kümmerte das?
Mich. Mich kümmerte es.
Denn ich war Anwalt.
Und zwar ein guter, meiner Meinung nach.
Mein Name, Harold Earl »Cotton« Malone war einer unter Tausenden anderen, die auf Anwaltslizenzen für den Staat Georgia standen, wo ich sechs Jahre zuvor mein Juraexamen abgelegt hatte. Aber ich habe nie in einer Anwaltskanzlei gearbeitet. Stattdessen war ich als Lieutenant Commander bei der US-Navy der Obersten Militärjustizbehörde zugeteilt und zurzeit im Marinestützpunkt Mayport in Florida stationiert. Heute war ich allerdings nicht als Anwalt unterwegs, sondern für einen Freund, dem ich einen Gefallen erweisen wollte – ein verzweifelter Ehemann, der gerade eine Scheidung durchmachte.
Eine Gefälligkeit, die ich allmählich zu bereuen begann.
Sue Weiler, die Ehefrau, war gerissen wie ein Diktator und schamlos wie eine Stripperin. Gestern spazierte sie in Jacksonville quasi von Wohnung zu Wohnung. Vier insgesamt. Jedes Mal traf sie sich dort mit einem Kerl zu schnellem, unverbindlichem Sex. Während ich draußen vor dem Apartment Nummer 3 wartete, überlegte ich ernsthaft, ob sie vielleicht eine Nymphomanin war, denn den nötigen Appetit hatte sie ja auf jeden Fall.
Nach einem erstaunlich kurzen Besuch im Apartment Nummer 4 faltete sie kurz nach 17 Uhr ihre langen, schlanken Beine in einen nagelneuen Cadillac und fuhr auf einen geschäftigen Boulevard. Der Wagen war in einem Weißton lackiert, der ganz leicht ins Rötliche überging, sodass der Wagen schwach rosa wirkte. Ich wusste, was dahintersteckte. Sie hatte den Wagen extra bestellt, um ihren Noch-Ehemann wütend zu machen. Diese ganze Aktion entsprach genau ihrer provozierenden Persönlichkeit.
Letzte Nacht war sie geradewegs zu einem Apartmentkomplex im Südteil der Stadt zu Lover Nummer 5 gefahren. Das Gleiche hatte sie schon vor einem Monat gemacht, und weil ich so ein guter Kumpel war, war ich ihr auch da gefolgt. Jetzt wollte der Anwalt des zukünftigen Ex-Ehemannes Fotos haben, besser noch Videos, um sie beim Scheidungstermin vor Gericht zu verwenden. Mein Kumpel war bereits zu vorläufigen Unterhaltszahlungen verdonnert worden, die teilweise als Raten für den Cadillac draufgingen. Ein Beweis ihrer Untreue hätte den Unterhaltsverpflichtungen mit Sicherheit einen Riegel vorgeschoben. Insbesondere, weil Sue bereits zweimal zu Protokoll gegeben hatte, keine Liebhaber und überhaupt so gut wie keine männlichen Freunde zu haben. Sie log wie gedruckt, und wenn ich die Wahrheit nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, wäre ich ihr ebenfalls auf den Leim gegangen.
Gestern fiel den ganzen Nachmittag über leichter Regen und der Abend wurde so heiß und feucht, wie es für Florida im Juni typisch ist. Ich hatte die Nacht vor dem Apartment von Lover Nummer 5 Stellung bezogen und aufgepasst, dass Sue mir nicht durch die Lappen ging. Vor etwa fünfzehn Minuten ist sie herausgekommen und in ihrem Pink-Mobil davongebraust. Ich konnte mir denken, wohin sie unterwegs war. In einem Apartmentkomplex draußen am Strand wohnte Lover Nummer 6, ein Immobilienmakler, der zwanzig Kilo mehr an Muskelmasse und zwanzig Lebensjahre weniger als ihr Ehemann zu bieten hatte.
Der Morgen war klar und sonnig, die Straßen voller Leute, die zur Arbeit wollten, und der Verkehr in Jacksonville herausfordernd wie immer. Mein metallicblauer Buick Regal tauchte ins morgendliche Verkehrsgewühl, und einen pinkfarbenen Cadillac zu verfolgen erwies sich als ein Kinderspiel. Erwartungsgemäß fuhr sie dieselben Ecken und Abzweigungen quer durch die Stadt, bis sie links blinkte und der Cadillac in den nächsten Apartmentkomplex abbog.
Ich notierte die Uhrzeit.
07:58 Uhr
Lover Nummer 6 wohnte im Gebäude C, Wohnung 5, und verfügte über zwei eigene Parkplätze – einen für seinen fabrikneuen Mazda und den anderen für einen Gast. Diese Details hatte ich schon vor ein paar Wochen herausgefunden. Ich wollte noch eine halbe Stunde warten, damit ihnen reichlich Zeit blieb, in die Kiste zu steigen, und mir dann einen guten Platz suchen, um ein kleines Video aufzunehmen und ein paar Schnappschüsse ihres Cadillacs neben dem Mazda zu machen. Doch zunächst plante ich, vis-à-vis auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums auszuharren. Zum Zeittotschlagen hatte ich ein paar Taschenbücher dabei.
Ich wollte gerade abbiegen, als ein Ford-Pick-up auf der linken Spur an mir vorbeischoss. Er war kobaltblau lackiert und hatte einen Aufkleber auf der hinteren Stoßstange.
MEINE EX REITET JETZT AUF EINEM BESEN.
Ich wusste, wer drinsaß.
Mein Kumpel, der zukünftige Ex-Ehemann, wer sonst.
Das letzte Mal hatte ich gegen Mitternacht mit Bob Weiler gesprochen, um ihm die schlechten Nachrichten zu überbringen. Er nahm sie gar nicht gut auf. Und sein Auftauchen hier konnte nur eines bedeuten: Ärger. Ich hatte schon länger seinen wachsenden Groll gespürt. Seine Frau setzte sich sichtlich ungerührt über die Eifersucht ihres Mannes hinweg. Sie hatte Spaß daran, auf seinen Gefühlen herumzutrampeln und dann genussvoll zuzusehen, wie er vor ihren Augen zusammenbrach. Bei dieser Nummer ging es offensichtlich um Kontrolle. Er wollte ihre Liebe und sie das Vergnügen, ihn nach Belieben zappeln zu lassen. Doch solche Spielchen können riskant sein, die möglichen Konsequenzen sind den Beteiligten allerdings meistens völlig egal.
Bob in seinem Pick-up ignorierte den Gegenverkehr, kurvte mit quietschenden Reifen über die Gegenfahrbahn, verfehlte an der Einfahrt nur knapp das geschnitzte Zedernholz-Namensschild des Apartmentkomplexes The Legends und schoss dann die schmale Auffahrt hinauf. Ich wechselte sofort die Fahrspur, nahm ein paar Gaffern die Vorfahrt und machte mich an die Verfolgung. Der Gegenverkehr bremste mich kurzfristig aus, und als ich endlich in die Wohnanlage abbog, hatte Bob gute neunzig Sekunden Vorsprung.
Ich steuerte sofort auf das Gebäude C zu.
Da stand der Pick-up mit geöffneter Fahrertür, neben dem Mazda parkte der rosafarbene Cadillac, und Bob Weiler zielte mit der Waffe auf seine Frau, die zwar schon ausgestiegen, aber noch nicht ins Haus gegangen war. Ich riss das Lenkrad nach rechts und brachte den Kupplungshebel so abrupt in die Parkposition, dass es krachte. Als ich meinen .38er-Smith-&-Wesson aus dem Handschuhfach kramte, betete ich zu Gott, dass ich ihn nicht benutzen musste.
Danach stieß ich die Tür auf und rutschte hinaus. »Runter damit, Bob.«
»Vergiss es, Cotton. Ich habe es satt, mich von dieser Nutte zum Narren halten zu lassen.« Bob hielt die Waffe unverwandt auf Sue gerichtet. »Halt dich da raus. Das geht nur sie und mich was an.«
Ich blieb hinter meiner geöffneten Autotür in Deckung und warf einen kurzen Blick nach links. Mehrere Hausbewohner beobachteten die Szene von ihren Balkonen aus. Dann ein rascher Blick zu Bobs Frau, die fünfzehn Meter entfernt stand. Sie wirkte vor allem genervt, beobachtete ihren Mann allerdings sehr genau. Ihr Blick erinnerte an den einer Löwin, die ihre Beute anvisiert. Über ihrer Schulter baumelte eine stylische Chanel-Handtasche.
Jetzt richtete ich meine Aufmerksamkeit wieder auf Bob Weiler. »Leg die Waffe hin.«
»Diese Nutte nimmt mich aus und vögelt gleichzeitig jeden, den sie will.«
»Der Scheidungsrichter soll sich um sie kümmern. Wir haben jetzt genug Beweise.«
Er wandte sich zu mir. »Zum Teufel mit den Gerichten. Ich kann das gleich hier klären.«
»Was bringt dir das? Gefängnis? Sie ist es nicht wert.«
Zwei Schüsse hallten durch die Morgenluft, Bob Weiler stöhnte und sackte zu Boden. Aus zwei Löchern in seiner Brust strömte Blut. Ich sah schnell zu Sue hinüber. Sie hielt die Waffe noch in der Hand, nur dass sie sie jetzt auf mich richtete. Wieder knallte ein Schuss.
Ich hechtete in den Wagen.
Auf der Fahrerseite explodierte das Seitenfenster, wo ich gerade eben noch gehockt hatte, und mir spritzten Glassplitter entgegen.
Sie feuerte erneut.
Die Windschutzscheibe überzog sich nach dem Treffer spinnwebartig mit Bruchlinien, zersplitterte aber nicht. Ich entriegelte die Beifahrertür und ließ mich auf der anderen Seite aufs Pflaster gleiten. Jetzt war wenigstens ein ganzer Wagen zwischen uns. Ich sprang auf, legte an und schrie: »Waffe fallen lassen.«
Sie ignorierte mich und feuerte ein weiteres Mal.
Ich duckte mich, hörte, wie die Kugel von der Motorhaube abprallte, kam wieder hoch und gab einen Schuss auf sie ab, der Sues rechte Schulter durchschlug. Sie wurde vom Aufprall nach hinten gerissen und versuchte das Gleichgewicht zu halten, dann stürzte sie aufs Pflaster, wobei ihr die Waffe aus der Hand rutschte. Ich rannte hin und kickte die Pistole weg.
»Sie dreckiges Miststück!«, schrie sie. »Sie haben auf mich geschossen.«
»Seien Sie froh, dass ich Sie nicht umgebracht habe.«
»Sie werden sich noch wünschen, Sie hätten es getan.«
Ich schüttelte ungläubig den Kopf.
Sie war verletzt und blutete, war aber so giftig wie zuvor.
Drei Polizeiwagen von Duval County fuhren mit Blaulicht und kreischenden Sirenen aufs Gelände und rasten auf uns zu. Uniformierte sprangen heraus und befahlen mir, den Revolver fallen zu lassen. Sie hatten alle ihre Waffen auf mich gerichtet, deshalb beschloss ich, das Schicksal nicht herauszufordern und tat, was sie verlangten.
»Dieser Mistkerl hat auf mich geschossen«, schrie Sue.
»Auf den Boden«, befahl mir einer der Polizisten. »Sofort.«
Langsam ging ich auf die Knie runter, bis ich bäuchlings auf dem feuchten Parkplatz lag. Sofort drehte man mir die Arme nach hinten, ein Knie presste sich auf meine Wirbelsäule, und um meine Handgelenke schlossen sich Handschellen.
So viel zur Gefälligkeit Nummer eins.
2
Ich saß in einer weißen fensterlosen Zelle, die aus Beton gegossen war. Interessanterweise wurde mir kein einziges meiner verfassungsmäßigen Rechte vorgelesen, es wurden keine Fingerabdrücke genommen, ich wurde nicht für die Verbrecherkartei fotografiert, und ich brauchte auch keinen orangefarbenen Overall anzuziehen. Stattdessen brachte man mich ins Bezirksgefängnis von Duval County und sperrte mich allein in eine Arrestzelle. Ich starrte die Wände und die Decke an und überlegte, wo die Mikrofone und Kameras versteckt sein mochten. Die Fahrt im Polizeiwagen vom Apartmentkomplex bis in die Stadt dauerte fast eine halbe Stunde und meine Hände waren nach wie vor mit Handschellen auf dem Rücken gefesselt. Ich hielt mich an die Regel, die jeder Festgenommene beherzigen sollte, und machte über den Namen und die Telefonnummer meines Kommandierenden Offiziers hinaus keine Aussage.
Sue Weiler wurde in einem Rettungswagen abtransportiert und war, sofern die Lautstärke ihrer Schreie als Maßstab dafür taugte, nicht lebensbedrohlich verletzt. Bob Weiler war bereits tot, als sein Körper auf den Boden schlug. Es gab eine Menge Augenzeugen, was die Ermittlung des genauen Tathergangs erschweren konnte. Wie lautet der alte russische Spruch? Er lügt wie ein Augenzeuge? Die Ortspolizisten schätzten es nicht, dass ich entschieden auf mein verfassungsmäßiges Aussageverweigerungsrecht verwies und stumm blieb. Wirklich schade. Aber ich musste das alles noch verarbeiten. In meinem ganzen Leben hatte ich selbst im Zorn nie jemanden geschlagen. Und jetzt ließ ich sämtliche geringfügigen Vergehen und Ordnungswidrigkeiten links liegen und stieg gleich mit einem Offizialdelikt, schwerer Körperverletzung und einem Schuss auf einen Menschen ein.
Reue verspürte ich nicht.
Außerdem war ich Zeuge geworden, wie ein Mensch starb.
Auch dies war ein erstes Mal – und es zerriss mir schier das Herz.
Bob Weiler war ein Freund gewesen.
Die Stille ringsum wurde nur gelegentlich von körperlosen Stimmen, dem hallenden Echo von Schritten und dem leisen Jaulen einer Maschine unterbrochen. Das Gefängnis unterschied sich nicht von all den anderen, die ich zuvor besucht hatte, jedes war auf seine Art trist und deprimierend. Meine Zelle maß etwa 1,80 Meter auf 2,40 Meter, es gab eine Metallpritsche und eine Toilette ohne Sitz. Das einzige Fenster, aus Milchglas und auf Schulterhöhe in die Zellenwand eingelassen, war durch ein Stahlgitter gesichert. Gefängnisse kannte ich bisher nicht als Insasse, sondern nur als Gast. Eingesperrt hinter Gittern zu sitzen war definitiv etwas anderes. Keine Freiheit. Keine Wahlmöglichkeit. Fremde sagten einem, was man zu tun und zu lassen hatte. Die Architektur des Gebäudes war eindeutig darauf ausgelegt, dieses Gefühl der Bevormundung mit all den kleinen Erniedrigungen noch zu fördern, damit sich die Insassen mut- und machtlos fühlten und alles Positive durch unterwürfige Hilflosigkeit ersetzt wurde.
Mir war klar, dass ich Pam anrufen sollte, aber ich war nicht scharf darauf, mir ihre Moralpredigt anzuhören. Sie hatte mehr als einmal von mir verlangt, mich aus den Familienangelegenheiten der Weilers herauszuhalten – doch wenn ein Freund in Schwierigkeiten steckt, dann lässt man ihn nicht hängen.
Ich zumindest nicht.
Meine eigene Ehe stand auf der Kippe, und es gab zahlreiche Warnsignale. Unbeherrschtheit, vorschnelle Urteile, Ungeduld und Desinteresse. In letzter Zeit kamen mir öfters die Worte von Clark Gable in den Sinn: Liebe ist, wenn du nach Hause kommst und weißt, dass auf der anderen Seite der Haustür eine Frau auf deine Schritte lauscht. Pam hörte vor zwei Jahren auf hinzuhören, weil ich eine Dummheit begangen und vergessen hatte, dass eine Ehe monogam sein sollte. Ich hatte ihr Vertrauen missbraucht und sie zutiefst verletzt. Später tat ich alles, um mich zu entschuldigen, und offiziell verzieh sie mir auch. In Wahrheit aber nicht. Und das wussten wir beide.
Ich hatte es vermasselt.
Und zwar richtig.
So wurde aus einer Ehefrau eine Mitbewohnerin.
Ein metallischer Klang riss mich aus den Gedanken; eine Gefängnisaufseherin schloss die Zellentür auf. Ich verstand es als Aufforderung, stand auf und folgte der Frau durch einen sterilen, gefliesten Korridor. Ihr ruhiger rhythmischer Gang hätte jedem Drillsergeant Freude bereitet. Über jeder Tür funkelten Kameras als Waffenersatz. Ein starker Chlorgeruch stach mir in die Nase.
Ich wurde in einen anderen, hell erleuchteten und fensterlosen Raum gebracht, nur dass es diesmal keine Arrestzelle war, sondern ein Verhörraum mit einem langen Metalltisch und sechs Stühlen. Vermutlich für Anwälte und Mandanten. Eine Frau erwartete mich. Sie war mittleren Alters, dünn und attraktiv, kurzes, hell gefärbtes Haar und eine selbstbewusste Ausstrahlung. Sie trug ein elegantes Wollkostüm. Im Laufe der Zeit sollte sie eine meiner engsten Vertrauten werden, doch heute begegneten wir uns noch als Fremde.
Meinen ersten Eindruck von ihr musste ich jedoch nie revidieren.
Sie gehörte zur Strafverfolgung.
Und zwar nicht auf lokaler Ebene.
»Ich bin Stephanie Nelle«, sagte sie.
Die Gefängnisaufseherin ging und zog die Tür hinter sich zu.
»Und Sie arbeiten wo? FBI?«
Sie lächelte und schüttelte den Kopf. »Ich habe schon gehört, dass Sie ein gutes Gespür haben. Versuchen Sie es noch einmal.«
Ich versuchte, mir auf die Schnelle eine schlaue Antwort zurechtzulegen, aber mir fiel nichts ein. »Justizministerium«, spekulierte ich.
Sie nickte. »Ich bin aus Washington hergekommen, um Sie zu treffen. Aber als ich vor einer Stunde im Marinestützpunkt war, teilte mir Ihr Kommandierender Offizier mit, dass Sie hier sind.«
Ich befand mich im zweiten Jahr meiner dreijährigen Dienstzeit in Mayport. Der Stützpunkt lag wenige Meilen östlich von Jacksonville neben einem geschützten Hafen, in dem Schiffe von Flugzeugträgerformat anlegten. Hinter den Zäunen arbeiteten Tausende von Marinesoldaten und noch mehr Versorgungspersonal.
»Der lässt bestimmt kein gutes Haar an mir.«
»Er meinte, Sie sollten hier verrotten. Anscheinend bereiten Sie ihm nur Probleme.«
Dabei gab ich mir wirklich Mühe, kein Problem zu sein. Auf drei Stützpunkten hatte ich gedient: in Schottland, in Connecticut und Virginia. Man sagte mir nach, ein Rebell zu sein, und stempelte mich als dickköpfig, arrogant, ja sogar skrupellos ab. Manchmal geriet ich auch mit Vorgesetzten aneinander. Aber im Großen und Ganzen hielt ich mich an die Vorschriften der Navy, und meine Dienstakte war vorbildlich. Nach der Stationierung auf dem Flottenstützpunkt stand mir eine Dienstzeit auf See bevor, worauf ich mich nicht gerade freute. Ich musste dort mindestens drei Jahre abreißen, falls ich jemals zum Kommandanten aufsteigen wollte. Pam – Gott segne sie dafür – hatte mich bei jeder Stationierung begleitet, sich einen Job gesucht und uns ein Zuhause geschaffen, was meinen idiotischen Fehltritt noch schlimmer machte. Wir redeten davon, dass sie ein Jurastudium aufnehmen wollte. Sie war interessiert, und mir gefiel die Idee. Oder sollten wir ein Baby ansetzen? Vielleicht konnten eines oder gleich zwei unsere Beziehung retten? Bob Weilers Tod hatte mir die Schrecken einer Scheidung klar vor Augen geführt.
Ich zog einen der Stühle vom Tisch weg und setzte mich. Die schlaflose Nacht forderte ihren Tribut. Meine Besucherin blieb stehen.
»Sie haben gut gezielt da draußen«, sagte sie. »Sie hätten sie töten können, aber das haben Sie nicht getan.«
Ich zuckte mit den Schultern. »Sie hat den Gefallen nicht zu schätzen gewusst.«
»Haben Sie zum ersten Mal auf jemanden geschossen?«
»Merkt man das?«
»Sie sehen etwas mitgenommen aus.«
»Ich habe einen Freund sterben sehen.«
»Das lässt wohl niemanden kalt. Sue Weiler will Sie vor Gericht bringen.«
»Ja. Viel Glück damit.«
Sie lachte. »Man hat mir gesagt, dass Sie unter Druck nicht die Nerven verlieren. Gut zu sehen, dass meine Informationen stimmen. Sie waren Kampfpilot, richtig?«
Das war ich gewesen. Wenigstens eine Zeit lang. Solange, bis mich Freunde meines verstorbenen Vaters zu einem Laufbahnwechsel überredeten. Zwei Admirale und ein Captain, die es anscheinend als ihre Lebensaufgabe ansahen, sich um mich zu kümmern. Auch mein Vater hätte inzwischen Anspruch auf einen Admiralsposten gehabt, wenn sein U-Boot nicht mitsamt der Besatzung gesunken wäre. Die Leichen wurden nie geborgen, und über die Mission drang nur wenig an die Öffentlichkeit. Die ganze Sache war als streng geheim klassifiziert gewesen. Das wusste ich, weil ich erfolglos versucht hatte, an den Bericht des Untersuchungsausschusses zu kommen. Ich war zehn, als die Kameraden in Ausgehuniform zu uns nach Hause kamen und meiner Mutter die schlimme Nachricht überbrachten. Nichts ergab damals einen Sinn, und es sollte noch viele Jahre dauern, bis ich die Wahrheit erfuhr.
»Ich habe Ihre Personalakte gelesen«, fuhr sie. »Sie haben sich ausdrücklich für eine Fliegerausbildung beworben, und Ihre Fähigkeiten waren ausgezeichnet. Können Sie mir vielleicht erzählen, weshalb Sie zur Justiz übergewechselt sind?«
Ich fasste sie ins Auge, als zielte ich durch ein Visier. »Die Antwort auf diese Frage kennen Sie bereits.«
Sie lächelte. »Verzeihen Sie. Ich werde Sie nicht noch einmal so beleidigen.«
»Wie wär’s, wenn Sie zur Sache kommen?«
»Ich habe einen Job für Sie.«
»Was ich tue und lasse, das entscheidet die Navy.«
»Das ist das Schöne, wenn man für den Justizminister der Vereinigten Staaten arbeitet, dessen Dienstherr wiederum der Präsident der Vereinigten Staaten ist, der Oberkommandierende der Streitkräfte. Man kann Ihnen neue Aufgaben zuweisen.«
Okay. Die Botschaft war angekommen. Die Sache war wichtig.
»Die Aufgabe, an die ich da denke, erfordert Geschick und Diskretion. Man berichtete mir, Sie würden über beide Qualitäten verfügen.«
Jetzt brannten mir selbst ein paar Fragen unter den Nägeln. »Haben Ihnen die beiden Admirale oder der Captain etwas über mich erzählt?«
»Eigentlich alle drei. Ich wurde von einem zum andern weitergereicht. Man hat Sie in den höchsten Tönen gelobt. Aber die Frage ist, ob Sie diesen Vorschusslorbeeren gerecht werden. Ihr Kommandierender Offizier glaubt es nicht.«
Der Idiot konnte mich mal. Er war ein katzbuckelnder Bürohengst und würde es immer bleiben. Ein Offizier auf der Karriereleiter, der darauf aus war, seine zwanzig Jahre abzureißen und mit einer Pension aus dem Dienst auszuscheiden, solange er noch jung genug war, um in der Privatwirtschaft das Doppelte zu verdienen.
Dieser Berufsweg interessierte mich nicht.
Doch in den letzten Jahren hatte ich angefangen, darüber nachzudenken, ob mir dieses Schicksal vielleicht selbst bevorstand. Jene Freunde meines Vaters erzählten immer gern von ihrem Plan für mich. Geh einfach zur juristischen Fakultät, mach deinen Abschluss und bewirb dich bei der Justizbehörde der amerikanischen Streitkräfte. Das tat ich. Aber ich fragte mich allmählich, ob sie mich vergessen hatten.
Hier bot sich eine Gelegenheit.
Die ich ihnen zu verdanken hatte.
Was gab es da zu verlieren?
Mein Kommandierender Offizier würde mich wahrscheinlich mindestens den ganzen kommenden Monat lang zur Strafe an den Schreibtisch ketten, weil ich sein Kommando ins Gerede brachte. Dabei spielte es keine Rolle, dass ein Freund gestorben war und zuerst auf mich geschossen worden war.
»Die Sache mit Sue Weiler ist für mich erledigt?«
Sie nickte. »Ich hatte eine Unterredung mit dem Sheriff. Es wird keine Anklage erhoben.«
Ich war beeindruckt. »Mit dem Sheriff persönlich?«
»Warum hätte ich weiter unten anfangen sollen?«
Dies war der erste von vielen Momenten, die noch folgen sollten, bei denen ich Stephanie Nelle zu schätzen lernte. Sie war ein Mensch, der etwas bewegen konnte. An jenem Tag sah ich in ihr nur die Chance, dem Dreckskerl ein Schnippchen zu schlagen, der in Mayport auf mich wartete.
»Okay«, sagte ich. »Sie haben mir einen Gefallen getan, und jetzt tue ich Ihnen einen Gefallen.«
Das war mein zweiter Gefallen im Laufe von vierundzwanzig Stunden.
Danach war nichts wieder wie zuvor.
3
Ich rutschte gegenüber von Stephanie Nelle in eine Sitznische. Wir hatten das Gefängnis verlassen und waren in einem Mietwagen dem Atlantic Boulevard ostwärts in Richtung Marinestützpunkt gefolgt, fuhren aber an der Abfahrt zum Stützpunkt vorbei und landeten schließlich in Neptune Beach. Pam und ich wohnten ganz in der Nähe, und weil ich nun einmal ein neugieriger Mensch bin, hatte ich herausgefunden, dass der Name aus dem Jahr 1922 datierte, als ein tatkräftiger Anwohner in der Nähe seines Hauses eine Bahnstation errichtete und sie »Neptune« taufte. Ihm war gesagt worden, der Zug sei zum Halten verpflichtet, wenn er eine Haltestelle baute. Er ersparte sich so den täglichen Zwei-Meilen-Marsch nach Mayport, wo der Zug abfuhr, der ihn zu seiner Arbeitsstelle nach Jacksonville brachte.
Schlaues Kerlchen.
Die Sache funktionierte.
Jetzt war Neptune Beach ein hübsches Küstenstädtchen mit gepflasterten Straßen, vielen Kunsthandwerkern, gut besuchten Bars und Restaurants. Hier war das ganze Jahr etwas los, besonders aber in der Sommersaison vom Memorial Day bis zum Tag der Arbeit.
Das Sun Dog Diner gehörte zu meinen Lieblingsrestaurants. Es hatte den Chromblech-Look altmodischer Raststätten und war mit den obligatorischen, glänzenden Vinylbezügen und Linoleum ausgestattet. Und man war freundlich dort. Sie behandelten einen wie einen Nachbarn. Wer sich länger nicht hatte blicken lassen, wurde beim Reinkommen auf ein Getränk eingeladen, man bot einem einen Sitzplatz an und setzte sich auf einen kleinen Plausch dazu. So eine Art Laden war das. Er lag an der Durchgangsstraße, und nicht weit davon entfernt, auf der gegenüberliegenden Straßenseite, befand sich ein weiterer Lieblingsort von mir: The Bookmark, ein anderer lokaler Treffpunkt. Die Inhaber Rona und Buford Brinlee waren meine Freunde geworden. Bücher hatte ich schon immer geliebt. Irgendwann sollte ich damit meinen Lebensunterhalt bestreiten, doch damals stand ich erst am Beginn meiner Sammlung.
»Haben Sie schon mal von dem 1933er Double Eagle gehört?«, fragte Stephanie.
Ich schüttelte den Kopf.
»Das ist die seltenste Münze der Welt. Neunzig Prozent Gold, zehn Prozent Kupfer. Von 1850 bis 1932 hat man Millionen Double Eagle geprägt – amerikanische Goldmünzen, die auf dem Münzmarkt nach wie vor weit verbreitet sind. Doch 1933 geschah etwas Unerwartetes. In jenem Jahr wurden 445.500 Double Eagle geschlagen, doch keine einzige dieser Münzen wurde jemals offiziell in Umlauf gebracht. Im April 1933 untersagte Franklin D. Roosevelt privaten Goldbesitz. Weil die Münzen zu diesem Zeitpunkt bereits produziert waren, hielt man sie einfach in der Prägestätte in Philadelphia zurück und schmolz sie schließlich wieder ein.«
Eine Kellnerin schlenderte heran.
»Was kann man hier Gutes essen?«, fragte mich Stephanie.
»Der Hackbraten ist spitze.«
»Dann nehmen wir zwei«, sagte sie zur Kellnerin. »Für mich Wasser.«
»Und Eistee für mich.«
Ich merkte, dass sie gern die Führung übernahm, und ließ ihr das Vergnügen.
Das junge Mädchen verschwand.
Durch die Frontscheibe sah ich Leute ins The Bookmark gehen und wieder herauskommen. Ich wusste bereits, was Stephanie Nelles Problem war. »Wie viele der 1933er-Münzen entgingen dem Schmelzofen?«, erkundigte ich mich.
»Das blieb lange Zeit ein Rätsel.«
Sie erklärte mir, wie sich die 1933er Double Eagle zum heiligen Gral der Münzsammler entwickelten. Nur zwei Münzen waren bewusst in der Münzprägestätte zurückbehalten und der Smithsonian Institution übergeben worden. Diese beiden Münzen hätten die einzigen Exemplare weltweit sein sollen.
»Doch es tauchten weitere Münzen auf«, sagte sie. »Von zwanzig wissen wir. Vermutlich wurden sie von einem Angestellten der Münzprägestätte Philadelphia gestohlen, der sie bei einem örtlichen Goldschmied zu Geld machte, welcher sie aber an Münzsammler weiterverkaufte, bis schließlich der Secret Service 1944 Wind davon bekam. Nach und nach wurden neunzehn dieser Münzen zurückgeholt.«
»Und die letzte?«
»An dieser Stelle kommen Sie ins Spiel.«
Für mich klang das gut.
»Der Secret Service ist dieser Münze seit Jahrzehnten auf der Spur. Sie steht ganz oben auf der Fahndungsliste. Ich weiß, ich weiß. Es klingt albern. Eine Goldmünze, die nicht viel älter als sechzig Jahre ist. Doch der Secret Service nimmt seine Aufgabe als Währungshüter verdammt ernst. Den anderen Münzen war er jahrzehntelang auf der Spur.«
»Wie viel ist sie wert?«
»Schwer zu sagen. Vermutlich um die zehn Millionen Dollar. Aber Sie dürfen nicht vergessen, dass ihr Besitz nach wie vor illegal wäre, weil es sich um gestohlenes Regierungseigentum handelt. So beschränkt sich der Käuferkreis auf reiche Sammler, die sich damit abfinden, sie keinem zeigen zu können. Momentan befindet sich der letzte 1933er Double Eagle, von dem wir wissen, in Südflorida.«
Sie erzählte, dass die Münze vor zwei Tagen mit einem Boot aus der Karibik in den Norden gebracht worden war. Doch das Boot hatte sich vom Anker losgerissen, war auf ein Riff gelaufen und danach etwa zwölf Meter tief gesunken. Der Besitzer der Münze habe davon erfahren und sei bereits unterwegs, um sein Eigentum zu bergen.
»Mir liegt sehr viel daran, dass Sie als Erster die Münze erreichen.«
Ich wusste nicht recht, ob sie mich für dumm, leichtgläubig oder einfach nur ehrgeizig hielt. Ersteres schloss ich gleich aus, denn wer will schon für einen Idioten gehalten werden. Leichtgläubig? Das hatte mir noch niemand vorgeworfen. Ich neigte eher zu großem Misstrauen bis hin zur Paranoia. Ehrgeizig? Das konnte passen. Ich war jung, tatendurstig und brannte auf Veränderung. Oft zerbrach ich mir den Kopf darüber, was das Leben noch für mich zu bieten hatte, und flehte zu Gott, dass es keine Militärgerichtsprozesse waren und dass ich niemals vorgesetzten Offizieren in den Hintern kriechen musste. Um ehrlich zu sein – von der Navy war ich inzwischen mehr als bedient, und die Aussicht, für eine private Anwaltskanzlei zu arbeiten, lockte mich nicht. Diese Frau, die extra aus Washington gekommen war, um sich mit mir zu treffen, schätzte mich offenbar richtig ein. Ich wollte raus. Und das bedeutete für den Moment, dass ich ihr den Luxus gönnte, sich einzubilden, ich würde nicht merken, wie sie mich auf den Arm nahm. Wie hieß es doch in einem Song von Kenny Rogers? Wenn die Karten auf dem Tisch liegen, ist noch genug Zeit zum Zählen (There’ll be time enough for counting, when the dealin’s done).
So hörte ich einfach zu, während sie die Karten austeilte.
»In Ihrer Personalakte steht, dass Sie einen Tauchschein haben. Das hier ist einfach. Zwölf Meter klares, warmes Wasser bis runter zum Wrack.«
»Und wonach suche ich?«
»Nach einem schwarzen, wasserdichten Kasten, quadratisch, circa fünfundvierzig Zentimeter breit. Er muss unbedingt intakt geborgen werden.«
Die Kellnerin kam mit dem Essen. Es sah köstlich aus. Ich hatte seit gestern Nachmittag nichts mehr gegessen und griff zu.
»Wir sind überzeugt, dass der Double Eagle darin liegt, aber ich will mich persönlich davon überzeugen. Der Kasten darf nicht geöffnet werden. Diese Freunde Ihres Vaters sagten mir, ich könnte mich darauf verlassen, dass Sie Befehle befolgen.«
Ich ließ mir den Hackbraten schmecken und registrierte, dass sie ihren ignorierte. »Warum ich? Ihnen müssten doch jede Menge andere Agenten zur Verfügung stehen.«
»Dieser Job erfordert ein gewisses Maß an Selbstständigkeit außerhalb der normalen Dienstwege. Es ist eine sensible innere Angelegenheit des Justizministeriums, und ich bin dafür zuständig. Deshalb brauche ich ein neues Gesicht. Jemanden, den keiner kennt.«
Jetzt wurde der Anwalt in mir hellwach. Drei Jahre auf der juristischen Fakultät und sechs Jahre beim Militärgericht hatten zwar nicht viel gebracht, aber wenigstens eine gesunde Skepsis in mich eingepflanzt. Mir schossen jede Menge Fragen durch den Kopf, aber es war klar, dass diese Frau keine einzige davon beantworten würde. Zumindest jetzt noch nicht. Deshalb behielt ich meine Fragen für mich. Außerdem wollte ich den Job. Weshalb sollte ich es mir mit meiner neuen Chefin verderben?
Aber ganz konnte ich nicht widerstehen. »Und wenn ich nein sage?«
»Wer unterschätzt jetzt wen?«
Ich grinste. »Bin ich so durchschaubar?«
»Sie warten doch schon lange auf eine solche Gelegenheit.«
Sie kannte mich. Das war unheimlich.
»Sie wussten nur nicht, wann es so weit ist. Aber wissen Sie was? Jetzt heißt es Koffer packen, Lieutenant Commander Harold Earl ›Cotton‹ Malone. Ihre Zeit ist endlich gekommen.«
»Und meine Stationierung in Mayport?«
»Ihr Kommandierender Offizier hat gesagt, ich kann Sie haben. Anscheinend ordnen Sie sich nicht gut unter und improvisieren für seinen Geschmack zu viel. Für ihn ist das ein Handicap. Aber Sie haben Glück. Denn genau das suche ich.«
4
Ich parkte morgens kurz vor sieben in der Nähe der Docks. Es war eine lange Fahrt in den Süden gewesen, über die I-95 von Jacksonville bis Key West, und ich hatte die Strecke schon gestern im Anschluss an das Gespräch mit Stephanie Nelle zurückgelegt. Meinen Wagen konnte ich mir auf dem Abschlepphof von Duval County abholen, und das sogar gebührenfrei. Es war gut, wenn man Freunde ganz oben hatte.
Den ersten Stopp legte ich bei mir zu Hause ein. Dort packte ich eine Tasche und berichtete Pam, dass ich zu einem Spezialauftrag abkommandiert sei. Ich konnte nicht sagen, wie lange ich fort sein würde, wollte aber anrufen, sobald ich mehr wusste. Sie war darüber, gelinde gesagt, nicht glücklich, was die Liste unserer Probleme wieder einmal verlängerte. Ich berichtete ihr von Bob Weiler, und dass ich auf Sue geschossen und im Gefängnis gesessen hatte, was sie mit ihrem unvermeidlichen Ich habe es dir doch gesagt kommentierte. Ich ließ mich von ihr abkanzeln, weil ich mich nicht streiten wollte, und gab zu, dass sie von Anfang an recht gehabt hätte.
Ich fand es furchtbar, was sich zwischen uns abspielte.
Eine Marinelaufbahn war guten ehelichen Beziehungen nicht förderlich, und die ständige Umzieherei sorgte für zusätzlichen Stress. Die Scheidungsraten waren astronomisch – und das nicht nur in den Mannschaftsdienstgraden. Das Elend reichte bis weit hinauf in die oberen Ränge. Je näher man der Pensionierung kam, desto wahrscheinlicher wurde eine Trennung. Und dass ich alles selbst vermasselt hatte, rieb nur Salz in diese schwärende Wunde. Ein Freund von mir sagte oft: Wer einmal aus dem Ehebett steigt, findet nie mehr den Weg dorthin zurück. Vielleicht hatte er recht, denn wenn man zurückkehrte, dann mit schwerem Gepäck. Die Wahrheit war keine Einbahnstraße, und wenn man etwas erreichen wollte, mussten beide an einem Strang ziehen. Pam und ich brauchten noch lange, bis wir uns das eingestanden, und viele Jahre sollten vergehen, bis wir diesen Punkt erreichten. So wurden wir am Ende unserer Ehe zunächst erbitterte Feinde und dann Freunde. Damals hoffte ich allerdings aufrichtig, dass zwischen mir und Pam noch nicht alles vorbei war.
Stephanie hatte mich angewiesen, gut auszuschlafen und morgens um sieben im Key West Bight anzutreten. Gestern Abend hatte ich mich in einem Motel in der Nähe einquartiert, in dem ich ein Jahr zuvor für ein verlängertes Wochenende mit Pam eingekehrt war. Dort hatten wir drei wirklich schöne Tage verbracht. Wir spielten, wir redeten und hatten sogar Sex.
Das waren gute Zeiten.
Key West war landschaftlich reizvoll, relaxt, freigeistig und skurril, es hatte einen Touch von Bohème und stand politisch links von der Mitte. Piraten machten es in einer Zeit, als Miami noch ein unbewohnter Sumpf war, zum reichsten Ort in Florida. Die Stadt lag am Ende einer Kette flacher Felsinseln. Das ganze Jahr über herrschte ein tropisches Klima, und es kam einem vor, als sei rund um die Uhr Happy Hour. Die Leute kamen zum Fischen, zum Feiern, um abzutauchen und um aufzutanken. Nonkonformismus schien hier Religion zu sein. Man hatte sich in den 1980er-Jahren sogar von den Vereinigten Staaten abgespalten, die Conch Republic proklamiert, den USA den Krieg erklärt, aber sofort danach kapituliert und eine Milliarde Dollar Wiederaufbauhilfe verlangt.
So viel Frechheit musste man einfach mögen.
Ich hatte Anweisung, ein bestimmtes Charterboot am historischen Hafen zu suchen. Heute schwirrten hier nicht allzu viele Menschen herum, was vermutlich auf die tief liegende graue Wolkendecke zurückzuführen war, die unschön und bedrohlich aussah. Vom Meer wehte eine stetige feuchtwarme Brise, und die Luft war zum Schneiden dick. Da braute sich mit Sicherheit ein Sturm zusammen. Kein Tag zum Hochseeangeln.
Das Boot mit dem Namen Isla Marie, am Ende eines Anlegers, war eine Zwölf-Meter-Yacht mit breitem Heck, doppelten Innenbordmotoren und Ruderhaus. Ein überdachtes Achterdeck diente beim Angeln als Sonnenschutz, und für Übernachtungen stand eine geräumige Vorderkabine zur Verfügung.
Ein Mann trat aufs Achterdeck.
Er war klein und stämmig, hatte breite Schultern und einen muskulösen Nacken. Seine gebräunte Haut kontrastierte mit seinem dünnen silbergrauen Haar. Er hatte einen ausladenden Bauch, trug Khakishorts, ein dunkles Key-West-T-Shirt und eine verblichene Schirmmütze. Um seinen Hals hing eine Kette mit einer Golddublone. Wie bei Stephanie Nelle durchschaute ich seinen Aufzug.
Justizbehörde.
»Versuchen Sie, nicht aufzufallen?«, fragte ich den Mann vom Anleger.
»Ich bin in Pension. Mir ist das völlig egal.«
Guter Punkt. »Sind Sie Captain Nemo?«
Der Kerl grinste. »Die blöde Geheimniskrämerei blieb mir nicht erspart.«
Stephanie hatte mich angewiesen, nach diesem Decknamen zu fragen.
»Und Sie sind?«, wollte er wissen.
»Cotton Malone.«
Das klang auch so schon wie ein Deckname.
»Wie sind Sie zu dem Namen Cotton gekommen?«
»Eine lange Geschichte.«
Er grinste freundlich und ließ die Zähne aufblitzen. »Das ist gut, denn wir haben einen langen Törn vor uns. Kommen Sie an Bord.«
»Wo geht’s hin?«
Er deutete mit einem Finger auf die offene See.
»Siebzig Meilen in diese Richtung.«
Wir standen im Steuerhaus, die Isla Marie kämpfte hart gegen steifen Wind von vorn, und unermüdlich vibrierte die Maschine unter meinen Füßen. Je weiter wir nach Westen kamen, desto schlimmer wurde der Regen. Der Wind trieb die Gischt vor sich her, und Schaumkronen spritzten über den Bug, während wir einen lebhaften Kurs durch das aufgewühlte Wasser pflügten.
»Heute dürfte keiner zum Fischen rausgefahren sein«, meinte mein Gastgeber.
»Haben Sie nicht was vergessen?«
Seinen Namen war er mir bisher schuldig geblieben. Am Anleger konnte ich es noch nachvollziehen. Feind hört mit. Aber Key West lag weit hinter uns.
»Jim Jansen, früher beim FBI.«
»Und jetzt sind Sie beim Justizministerium?«
»Zum Teufel, nein. Man hat mich gebeten, Stephanie zu helfen. Eine Gefälligkeit. Wie bei Ihnen, habe ich läuten hören.«
Das Boot schaukelte wie eine Spielzeugwippe. Zum Glück neigte ich nicht zur Seekrankheit, sonst hätte ich mein Frühstück wieder hervorgezaubert. Auch Jansen schien seefest zu sein.
»Stammen Sie aus der Gegend?«, fragte ich.
»Ich bin in den Keys geboren und dort aufgewachsen, dann war ich dreißig Jahre bei der Bundespolizei. Vor zwei Jahren wurde ich pensioniert und bin wieder nach Hause zurück.«
Ich wusste, wie das lief. Special Agents beim FBI mussten gehen, wenn sie 57 wurden oder zwanzig Dienstjahre hinter sich hatten, je nachdem, was später kam. Ausnahmen konnten bewilligt werden, aber das kam nicht oft vor.
»Dann sind Sie durch und durch ein Conch?«, fragte ich und achtete darauf, den Namen richtig auszusprechen, nämlich »Konck«.
»Absolut. Wir haben hier auch eine Menge Landratten, Zugereiste aus allen Ecken, aber wir Original-Salzwasserexemplare, die echten Einheimischen, werden immer seltener. Halten Sie mal das Steuer.«
Ich übernahm, und Jansen holte eine Karte hervor, faltete sie auseinander und legte sie über die Instrumententafel. Große Regentropfen wurden durch die heftigen Böen an die Windschutzscheibe geklatscht.
»Wird Zeit, Sie ins Bild zu setzen«, sagte er. »Wir haben Kurs auf die Dry Tortugas gesetzt. Mal davon gehört?«
»Hm. Billy Bones spricht davon in der Schatzinsel, oder?«
Er zeigte mit einem dicken Finger auf die Karte. »Es ist eine Gruppe von sieben winzigen Inseln inmitten von Korallenriffs, kaum größer als Sandbänke, mit ein paar Bäumen und Büschen. Sie markieren das äußerste Ende der Florida Keys und den letzten Zipfel der Vereinigten Staaten. Weniger als fünfzig Hektar trockenes, unbewohnbares Festland ohne besondere Eigenschaften am Rand der Hauptschiffsfahrtsroute vom Golf in den Atlantik. Sie wurden von Ponce de León entdeckt. Wegen der vielen Schildkröten dort nannte er sie Tortugas.«
»Und wie kam es zu dem ›Dry‹ im Namen?«
»Das kam später dazu, damit die Seeleute wussten, dass es auf den Inseln keinen Tropfen Trinkwasser gibt. Aber dort konnte man bei Unwetter hervorragend vor Anker gehen oder einen Reparaturstopp einlegen, falls nötig.«
»Und warum fahren wir da jetzt mitten im Sturm hin?«
»Hat Stephanie sich bedeckt gehalten?«
»Sie war stumm wie ein Fisch.«
Er lachte. »Nehmen Sie es nicht persönlich.«
»Wie lange kennen Sie sie schon?«
»Erst seit Kurzem.«
Das sagte mir nichts. »Erzählen Sie mir von dem gesunkenen Boot«, schlug ich vor.
»Das war ein Seelenverkäufer. Es sah aus wie die Orca aus Der weiße Hai, und zwar nachdem der Hai mit ihr fertig war. Ich habe keine Ahnung, wie es das Ding überhaupt von Kuba herübergeschafft hat.«
Ich hörte das magische Wort und bedachte Jansen mit einem prüfenden Blick. »Ist das Ihr Ernst?«
»Macht die Sache gleich viel interessanter, oder?«
Allerdings. Kuba lag nur neunzig Seemeilen entfernt, und soweit ich wusste, war kubanischen Booten der Aufenthalt in US-amerikanischen Gewässern verboten. Ausnahmen wurden nicht gemacht. Unter keinen Umständen. Über dieses Detail hatte Stephanie kein Wort verloren, sondern nur erwähnt, dass das Boot aus derKaribik nach Norden gekommen war.
»Zwei Tage ist es her, da ankerte das Boot vor Garden Cay in den Dry Tortugas. Ich war da und habe es mir angesehen. Der Wind heulte wie heute, und es goss in Strömen. Die Gezeitenströmungen sind dort ziemlich heftig und gegenläufig zu den vorherrschenden Winden. Der Hafen war lange Zeit ein sicherer Zufluchtsort, in den man sich vor Feinden und Unwettern retten konnte, aber man muss wissen, was man tut. Dieser Captain wusste es nicht. Das Boot riss sich vom Anker los, trieb in westliche Richtung und lief auf ein Riff. Weg war es.« Jansen schnippte mit den Fingern. »Einfach so.«
Ich kämpfte mit dem Steuerrad und hielt es fest in den Händen. »Ich bin kein Experte im Steuern von Booten. Wollen Sie wieder ran?«
»Ach was. Das machen Sie gut. Da ist das Boot gesunken.« Er pochte wieder auf die Karte, diesmal knapp westlich, neben eine kleine, schmale Insel. »Gleich bei Loggerhead Cay. Der Kerl, der es in den Norden gefahren hat, wurde hier bei den Campingplätzen von Garden Cay in Fort Jefferson aufgehalten. Das ist hier, ein paar Meilen weiter östlich.«
Das Fort war mir ein Begriff.
Es wurde in der Mitte des 19. Jahrhunderts zum Schutz der Handelsstraße errichtet, damals einer der meistbefahrenen Seewege der Welt. Während des Bürgerkriegs machte man ein Gefängnis für desertierte Unionssoldaten daraus. Danach wurde es weiter als Gefängnis genutzt. Sein berühmtester Insasse war Dr. Samuel Mudd, verurteilt als Mitverschwörer bei der Ermordung Abraham Lincolns. Das Gefängnis musste wegen Epidemien und Wirbelstürmen aufgegeben werden. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts machte man schließlich eine Bekohlungsanlage für Dampfschiffe der Marine daraus. Von hier aus lief die Maine nach Havanna aus und schrieb Geschichte. Jetzt war es ein Nationalpark, dessen Hauptattraktion das größte gemauerte Gebäude der westlichen Hemisphäre war. Ich hatte Fotos davon gesehen: ein riesiges Sechseck aus Ziegeln, der Umfang betrug mehrere hundert Meter, die Wände waren vierzehn Meter hoch und zweieinhalb Meter dick. Das Fort nahm fast die gesamte Fläche der flachen Insel ein, sodass es wirkte, als schwebte es auf dem türkisfarbenen Wasser, das es umgab. Es verfügte über mächtige Geschützbatterien, die in gemauerten, mehrgeschossigen Kasematten untergebracht und dafür konzipiert waren, es mit einer ganzen feindlichen Flotte aufzunehmen. Ein perfektes Beispiel für das alte Sprichwort, dass man Festungen nicht dort baut, wo es einfach ist, sondern dort, wo man sie braucht.
»Es muss da ungeheuer abgeschieden sein«, sagte ich zu Jansen.
»Na ja, ist halt kein Touristenmagnet. Aber ein paar Leute werden schon da sein, die uns in die Quere kommen könnten.«
»Sie haben gesagt, der Kerl, der das Boot hergebracht hat, war auf Garden Cay. Wo ist er jetzt?«
»In Untersuchungshaft. Wir haben Glück, dass hier keine Einreisen aus Kuba gestattet sind.«
Ja, gut für uns. »Werde ich bei diesem Sturm zum Wrack tauchen?«
»Uns bleibt keine Wahl. Der Bootseigner ist unterwegs, und wir müssen vor ihm an den wasserdichten Kasten herankommen.«
»Wo kommt er her?«
»Aus Kuba. Woher sonst?«
Natürlich. Was für eine alberne Frage.
Uns traf eine Welle von backbord und brachte das Boot ins Schlingern. Ich glich aus und richtete den Bug wieder auf den alten Kurs aus. Dabei tauschte ich einen Blick mit Jansen. Er hatte tief liegende Augen, blinzelte nervös, und ich fragte mich, was dieser Mann mir an Wissen wohl voraushatte.
Eine Böe klatschte einen neuen Regenschwall gegen die Windschutzscheibe.
»Das ist verrückt«, sagte ich.
»Es ist das Schlaueste, was wir machen können. Bei dem Wetter wird hier draußen keiner unterwegs sein. Die Aufseher vom Nationalpark schon gar nicht. Wir müssten freie Bahn haben.«
Über unseren Köpfen zogen schwarze Wolkentürme voller Donner und Blitzen am Himmel. Der ganze Ozean schien zu kochen.
»Wenn Sie vor Ort waren, als es sank, warum sind Sie dann nicht getaucht?«
»Sehe ich aus wie Lloyd Bridges? Dafür bin ich nicht ausgebildet. Deshalb ist Stephanie losmarschiert und hat sich einen Frischling besorgt.«
»Sind Sie damit nicht einverstanden?«
»Geht mich nichts an. Ich helfe nur aus.«
»Wie viel wissen Sie über sie?«, versuchte ich es noch einmal.
»Ich schätze, Sie verdienen ein paar Auskünfte.«
So sah ich das auch.
»Sie war beim Außenministerium und ist später zum Justizministerium übergewechselt. Ich erinnere mich, dass sie während meiner Zeit eng mit dem FBI zusammenarbeitete, und ich habe gehört, dass sie es immer noch tut. Eine Anwältin, aber durch und durch Behörde.«
Ich hörte das unausgesprochene Lob.
Eine Anklägerin. Gute Leute. Auf der richtigen Seite.
Da der Mann ins Reden gekommen war, versuchte ich, ihn weiter zu ermuntern. »Sie hat mir von dem 1933er Double Eagle erzählt. Scheint eine ganz besondere Münze zu sein.«
»Vielleicht die letzte ihrer Art.«
So wertvoll immerhin, dass wir hier mitten im Sturm unterwegs waren, um ihre Bergung zu riskieren. Aber die ganze Sache stimmte vorn und hinten nicht. Eine Münze, die es gar nicht geben sollte. Ein Boot aus Kuba, das plötzlich sank. Der Eigentümer aus Kuba auf dem Weg hierher. Das Justizministerium, das es einfach hinnahm. Und das alles für einen wasserdichten Kasten, der unversehrt geborgen werden musste.
Ungeöffnet.
Ich hatte genug Militärgerichtsprozesse bei der Navy mitgemacht und konnte mich in Geschworene und Zeugen hineinversetzen. Auch wenn ich hier vielleicht als Frischling geführt wurde – ein Idiot war ich deshalb noch lange nicht.
Die Sache stank.
Gewaltig.
5
Hinter den Regenschleiern machte ich Fort Jefferson aus.
Die Fahrt von Key West hatte fast drei Stunden gedauert, weil uns der Sturm immer wieder ausbremste. Jansen stand wie zuvor am Steuer, er brachte uns an Garden Cay und dem Fort vorbei und setzte Kurs auf Loggerhead, die größte der sieben Inseln, mit einem Leuchtturm, dessen Signal trotz des Sturms weithin zu sehen war.
»Das Boot hat sich gleich da hinten vom Anker losgerissen und ist zum südlichen Ende von Loggerhead abgetrieben«, erklärte Jansen. »Auf der anderen Seite haben es dann die Riffs erwischt.«
Die Sturmböen waren schwächer geworden, doch es regnete unvermindert. Ein paar Katamarane, Segelboote und einige wenige Motoryachten lagen etwa fünfhundert Meter links von uns vor Anker. Wir passierten gerade die Südspitze von Loggerhead, als ich in den Wellen etwas dümpeln sah. Es war ein Milchcontainer aus Plastik mit gelbem Klebeband am Hals.
»Ich habe das Ding unten an einer Koralle vertäut«, sagte Jansen. »Das Riff ist hier so flach, dass ich schnorcheln konnte. Das Wrack liegt fünfzig Meter westlich der Markierung in etwas tieferem Wasser.«
»Das hier ist doch ein Nationalpark? Wie haben Sie es geschafft, das Wrack zu markieren?«
»Wegen des schlechten Wetters haben die den Milchcontainer bisher übersehen. Aber es hätte keinen Tag länger gedauert, denke ich mal.«
Er drosselte den Vortrieb und hielt das Boot stabil. »Ich bleibe über Ihnen und lasse den Motor laufen. Also achten Sie auf die Propeller. Und jetzt los. Ziehen Sie sich um. Alles, was Sie brauchen, liegt hinten auf Deck.«
Mein letzter Tauchgang lag schon eine ganze Weile zurück. Die Navy hatte es mir beigebracht. Pam lernte es vor ein paar Jahren auf Cozumel, machte aber nur zwei Tauchgänge. Als sie beim zweiten Mal einem Ammenhai begegnete, wurde ihr klar, dass Tauchen nicht ihr Ding war. So verbrachte sie die folgenden drei Tage an Bord und wartete auf mich – ein Leitmotiv unseres gemeinsamen Lebens, wie mir schien.
Als ich von der Brücke gestiegen war, sah ich mir die Ausrüstung an. Standardzeug. Nichts Besonderes. Der Regulator musste an die Tauchflasche geschraubt werden, und ich ließ für den Drucktest etwas Sauerstoff herauszischen. Dann legte ich Schulter- und Bauchgurt an und schnallte mir einen Ballastgürtel um. Über mir zuckte ein Blitz; ich fuhr zusammen, als der nächste Donnerkeil herunterkam, wie für mich bestimmt. Es donnerte und regnete unentwegt. Gegen wie viele Sicherheitsregeln wollte ich gleich verstoßen? Dass man bei Gewitter nie ins Wasser geht, zum Beispiel. Auch nicht allein und in verbotenen Gewässern. Das Deck bebte von heftigen, unvorhersehbaren Stößen. Kein geeigneter Ort, um schwere Ausrüstung anzulegen. Ich streifte nur Maske und Flossen über, warf die Tauchflasche über Bord und rollte mich vom Schanzdeck ins Wasser.
Ich tauchte unter die Wogen und fand die Tauchflasche. Gebeugt streckte ich die Arme durch die umgedrehten Schulterbänder, hob das Teil, das im Wasser schwerelos war, über meinen Kopf, führte die Flasche an meinem Rücken entlang runter und breitete die Arme aus, bis die Schulterbänder bequem anlagen.
Dann suchte ich den Regulator und spülte das Wasser raus.
Es konnte losgehen.
Ich hielt mich am Grund, wo alles viel ruhiger war. Jansen hatte recht: Hier war das Riff flach. Maximal drei Meter tief, danach ging es einen steilen Hang bis auf etwa zehn Meter und weißen Sand hinunter. Etwas weiter draußen befand sich die eigentliche Absenkung ins offene Meer. Wegen des trüben Wetters ließ das Licht zu wünschen übrig, die Sicht war jedoch exzellent. Das Wasser wimmelte von Leben.
Ein Barracuda kam neugierig heran. Sein Maul stand offen, und man konnte seine beeindruckenden Fangzähne sehen. Plötzlich verschwand er mit unglaublicher Beschleunigung ins weite Meer. Es gab einen lebenden Korallenwald in allen Schattierungen von Sandbraun und Gelb bis Dunkelbraun – Lebensort unzähliger Meeresbewohner. Ich erkannte lavendelfarbene Drückerfische, gestreifte Falterfische, schwarz-gelbe Kaiserfische und rote Husarenfische. Dabei achtete ich immer auf Haie am Rand meines Blickfelds.
Und dann sah ich es.
Das Wrack lag, nach steuerbord abgewinkelt, mit dem weißen Kiel des Rumpfes auf dem Meeresboden. Der Bug zeigte nach oben. Die Farbe war erhalten geblieben, weil das Wrack noch nicht so lange unter Wasser lag, dass sich Algen daran hätten festsetzen können. Das gesunkene Boot war etwa neun Meter lang und sah gar nicht viel anders aus als die oben wartende Isla Marie. Über die ganze Länge der Backbordseite lief ein Riss, der groß genug war, um hindurchzuschwimmen. Wie Jansen gesagt hatte.
Auf Riff gelaufen.
Ich schwamm zum Heck und steckte den Kopf in die Hauptkabine. Kreuz und quer lagen Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände verstreut. Nichts zu entdecken. Auf dem hinteren Deck gab es auch nicht viel, nur Tauchgerät, das an den Schotten befestigt war. Kein schwarzer wasserfester Kasten in Sicht. Ich nahm mir einen Moment Zeit, um den Sandboden rings um das Wrack zu erkunden. Auch dort war nichts zu finden.
Dann hielt ich inne und überlegte.
Meine Atmung war inzwischen langsam und ruhig, das warme Wasser angenehm – definitiv um Klassen besser als ein Gerichtssaal.
Weiter ging es zur oberen Brücke, wo ich an der Tür haltmachte, die offen in ihren Angeln hing.
Und da war er.
Ein schwarzer wasserdichter Kasten, quadratisch, circa fünfundvierzig Zentimeter Kantenlänge – genau wie von Stephanie Nelle beschrieben. Ich packte ihn am Griff und staunte. Schwer. Etwas zu schwer, um ihn an die Oberfläche zu wuchten, zumal ich keine Tarierweste anhatte.
Eine Frage drängte sich auf.
Was war da außer der Münze noch drin?
Ich nahm mir einen Moment und analysierte die Lage. Am klügsten war, den Kasten auf dem Meeresboden abzulegen, dann aufzutauchen und ein Seil zu holen. Es hatte keinen Sinn, den Kasten hochzubringen und dann versuchen zu wollen, ihn im Sturm an Bord zu bringen. Also schaffte ich den Behälter von der Brücke weg. Es erforderte kräftigere Schwimmstöße und beschleunigte meine Atemfrequenz, aber schließlich glitt ich damit aus dem Wrack und legte den Kasten auf dem sandigen Meeresboden ab. Ein kurzer Blick nach oben – da dümpelte der Kiel der Isla Marie unter der Oberfläche, die Maschinen schoben das Schiff vorwärts und rückwärts, damit es seine Position hielt.
Ich schwamm ihm entgegen.
Nach dem Auftauchen spuckte ich den Atemregler aus und winkte, bis Jansen aufmerksam wurde. »Ich brauche ein Seil. Fünfzehn Meter oder mehr.«
»Wir bekommen Gesellschaft«, brüllte er durch ein offenes Fenster und deutete in Richtung Heck.
Ich versuchte, so gut es ging über die Wellenkronen zu sehen. Ein kleines Boot war in unsere Richtung unterwegs und näherte sich schnell. Es konnten die Aufseher des Nationalparks aus Fort Jefferson sein.
»Holen Sie das Seil«, rief ich noch einmal.
»Wir müssen weg.«
»Die Zeit reicht. Wir können es schaffen. Holen Sie das Seil.«
Ich fand es erwähnenswert, dass ich die Nerven behielt. Falls ich jemals aus dem Militärgerichtswesen herauskommen und Action erleben wollte, musste ich mich beweisen. In brenzligen Situationen die richtigen Entscheidungen zu treffen war meine Stärke. Jetzt war der Moment gekommen, es sinnvoll anzuwenden. Das andere Boot kam stetig näher, doch ich konnte es schaffen, abzutauchen und zurückzukommen – wenn mir nur Jansen endlich das verdammte Seil zuwarf.
Schließlich tat er es.
Eine Rolle gelben Nylonseils landete auf dem Wasser.
»Der Kasten ist schwer«, schrie ich. »Ich binde ihn an und reiße am Seil, wenn ich fertig bin. Dann ziehen Sie ihn hoch. Ich komme gleich hinterher.«
Ich griff das Seilende, setzte mir das Mundstück ein und tauchte wieder ab.
6
Ich arbeitete mich durchs Wasser zu dem schwarzen Kasten vor, der hinter dem Wrack lag. Auf dem Weg nach unten übte ich mein Klares Denken in Krisensituationen