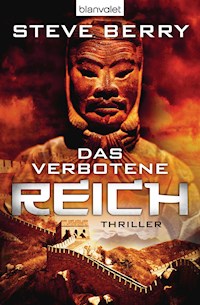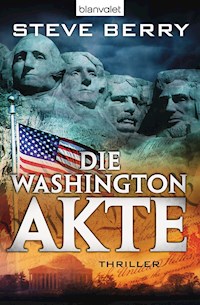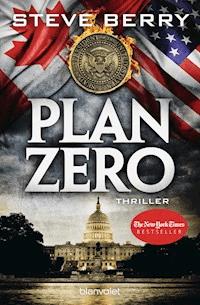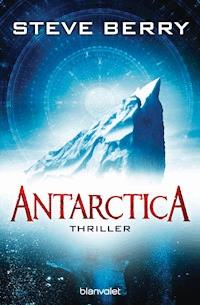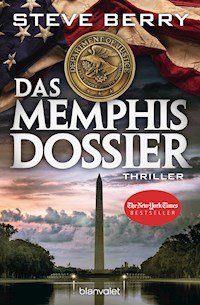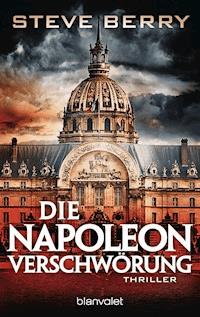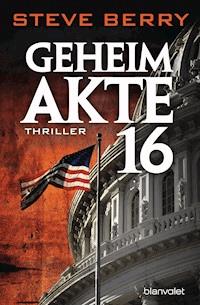9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Cotton Malone
- Sprache: Deutsch
Dieses Geheimnis könnte Europa zu Fall bringen! Der 15. Fall für Cotton Malone!
Die Arma Christi, die sieben Relikte, sind von unschätzbarem Wert für das Christentum – und sie werden überall auf der Welt aus Tresoren und Schatzkammern gestohlen. Nachdem der ehemalige Geheimagent Cotton Malone Zeuge eines solchen Diebstahls wird, erfährt er, dass bei einer Auktion hochsensible Informationen über das polnische Staatsoberhaupt verkauft werden sollen. Informationen, an denen sowohl Polen als auch die USA interessiert sind, allerdings aus völlig verschiedenen Gründen. Der Eintrittspreis zur Auktion: eines der sieben Relikte. Malone muss seine Prinzipien vergessen und die Heilige Lanze aus einem Schloss in Polen stehlen, um Zutritt zur Auktion zu erhalten. Dort will er das Schlimmste verhindern – aber er gerät mitten in einen blutigen Krieg zwischen drei Nationen um ein Geheimnis, dass ganz Europa aus den Angeln heben und ins Chaos stürzen könnte.
Alle Cotton-Malone-Romane können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Buch
Die Arma Christi, die sieben Relikte, sind von unschätzbarem Wert für das Christentum – und sie werden überall auf der Welt aus Tresoren und Schatzkammern gestohlen. Nachdem der ehemalige Geheimagent Cotton Malone Zeuge eines solchen Diebstahls wird, erfährt er, dass bei einer Auktion hochsensible Informationen über das polnische Staatsoberhaupt verkauft werden sollen. Informationen, an denen sowohl Polen als auch die USA interessiert sind, allerdings aus völlig verschiedenen Gründen. Der Eintrittspreis zur Auktion: eines der sieben Relikte. Malone muss seine Prinzipien vergessen und die Heilige Lanze aus einem Schloss in Polen stehlen, um Zutritt zur Auktion zu erhalten. Dort will er das Schlimmste verhindern – aber er gerät mitten in einen blutigen Krieg zwischen drei Nationen um ein Geheimnis, dass ganz Europa aus den Angeln heben und ins Chaos stürzen könnte.
Der Autor
Steve Berry war viele Jahre als erfolgreicher Anwalt tätig, bevor er seine Leidenschaft für das Schreiben entdeckte. Mit jedem seiner hoch spannenden Thriller stürmt er in den USA die Spitzenplätze der Bestsellerlisten und begeistert Leser weltweit. Steve Berry lebt mit seiner Frau in St. Augustine, Florida.
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und
www.instagram.com/blanvalet.verlag
Steve Berry
DIE
SIEBEN
RELIKTE
Thriller
Aus dem Amerikanischen
von Wolfgang Thon
Die Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel »The Warsaw Protocol (Cotton Malone 15)« bei Minotaur Books, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © der Originalausgabe 2020 by Steve Berry
Published by Arrangement with MAGELLAN BILLET INC.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die
Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, Hannover.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2021 by Blanvalet Verlag,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Werner Bauer
Umschlaggestaltung und -motiv: © Johannes Frick
unter Verwendung von Motiven von iStock.com
(titoslack; eb; Klubovy; sankai)
JB · Herstellung: sam
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-26631-8V001
www.blanvalet.de
Für Frank Green,
einen wahrhaft inspirierenden Mann
Noch ist Polen nicht verloren,
solange wir leben – zum Glück!
Was uns fremde Übermacht genommen,
holen wir uns mit dem Säbel zurück.
– Polnische Nationalhymne
(sinngemäße Übertragung)
Prolog
Montag, 9. August 1982
Warschau, Polen
15.45 Uhr
Janusz Czajkowski wollte sich von der grausamen Szene abwenden, doch er wusste, dass er es damit nur noch schlimmer machen würde.
Man hatte ihn extra zum Mokotów-Gefängnis gebracht, damit er zusah. Dieser Ort hatte eine lange und wechselhafte Geschichte. Die Russen ließen das Gebäude zu Beginn des 20. Jahrhunderts errichten. Es wurde ausgiebig von den Nazis genutzt, ebenso von den Kommunisten nach dem Krieg. Nach 1945 wurde hier der polnische politische Untergrund, die Intelligenzija, und auch jeder andere, den man als Bedrohung der von den Sowjets kontrollierten Regierung einstufte, eingekerkert, gefoltert und exekutiert. Das Gefängnis erlebte seinen Höhepunkt während der Stalin-Ära, als Tausende im Gefängnis Rakowiecka-Straße, wie es damals von den meisten Polen genannt wurde, gefangen gehalten wurden. Manchmal nannten sie es allerdings auch verächtlich bei seinem deutschen Namen: Nacht und Nebel. Ein Ort ohne Wiederkehr. In seinem Heizkeller wurden zahllose Menschen ermordet. Offiziell hatten solche Gräueltaten mit Stalin ein Ende gefunden – was jedoch nicht der Realität entsprach. Auch danach wurden jahrzehntelang Dissidenten verhaftet und für »Verhöre« dorthin gebracht.
Der Mann vor ihm war einer von ihnen.
Er war mittleren Alters, nackt, über einen hohen Hocker gebeugt, Handgelenke und Knöchel an die blutbefleckten Holzbeine gefesselt. Ein Wärter stand mit gespreizten Beinen vor dem Kopf des Gefangenen und schlug den Mann auf den Rücken und den nackten Hintern. Der Gefangene gab unglaublicherweise keinen Ton von sich. Der Wärter hörte auf, auf den Mann einzuschlagen, schob den Gefesselten vom Hocker und setzte seine Stiefelsohle auf die Schläfe des Mannes.
Dieser spuckte Rotz und Blut.
Trotzdem gab er keinen Laut von sich.
»Es ist leicht, Angst zu erzeugen«, sagte der große Mann, der neben Janusz stand. »Aber es ist noch leichter, sie vorzutäuschen.«
Der große Mann trug die Uniform eines Majors der polnischen Streitkräfte. Sein Haar war militärisch kurz geschoren, der schwarze Schnurrbart gestutzt und gepflegt. Er war älter, mittelgroß, aber muskulös, mit der arroganten und betont selbstbewussten Persönlichkeit, wie Janusz sie allzu oft bei der Roten Bourgeoisie wahrgenommen hatte. Die Augen waren dunkle, diamantförmige Punkte, und es war nichts aus ihnen herauszulesen. Augen wie diese versteckten immer mehr, als sie enthüllten, und er fragte sich, wie schwer es sein musste, eine solche Lüge zu leben. Auf einem Namensschild stand DILECKI. Er wusste von dem Major nur, dass er den Gefolterten verhaftet hatte.
»Um Angst zu erzeugen«, sagte Dilecki, »muss man einen Großteil der Bevölkerung dazu bringen, ihre Existenz zu akzeptieren. Das ist ein hartes Stück Arbeit. Man muss Situationen schaffen, die die Menschen sehen und spüren können. Es muss Blut vergossen werden. Terrorismus, wenn Sie so wollen. Aber Angst vortäuschen? Das ist viel einfacher. Man braucht nur alle zum Schweigen zu bringen, die sich der Angst nicht beugen wollen. So wie diesen armen Kerl.«
Der Wärter fuhr fort, mit einer Art Reitgerte auf den Mann einzuschlagen, an deren Spitze ein Metallteil befestigt war. Inzwischen hatten sich blutige Striemen gebildet. Drei weitere Wärter schlossen sich an und prügelten auf den Mann ein.
»Vielleicht bemerken Sie«, sagte Dilecki, »dass die Männer vorsichtig sind. Sie wenden nur so viel Kraft auf, wie nötig ist, um Schmerzen und Qualen zuzufügen, aber nicht genug, um zu töten. Wir wollen nicht, dass dieser Mann stirbt. Ganz im Gegenteil. Wir wollen, dass dieser Mann redet.«
Der Gefangene litt unübersehbar, doch er gönnte seinen Peinigern anscheinend nicht die Befriedigung, es zu zeigen.
»Ihr habt die Nieren vergessen«, rief Dilecki.
Einer der Wärter nickte und konzentrierte seine Schläge auf den entsprechenden Körperbereich.
»Diese Organe sind besonders empfindlich«, bemerkte Dilecki. »Wenn man richtig zuschlägt, braucht man die Leute nicht mal zu fesseln oder zu knebeln. Sie können sich weder bewegen noch einen Laut hervorbringen. Es verursacht extreme Schmerzen.«
Seine durchdringende Stimme war völlig gefühllos, und Janusz fragte sich, was geschehen musste, bevor jemand so unmenschlich wurde. Dilecki war Pole. Die Wärter waren Polen. Der Gefolterte ebenfalls.
Wahnsinn.
Das ganze Land war mittels Macht und Propaganda zusammengehalten worden. Aus dem Nichts heraus hatte sich die Solidarność-Bewegung erhoben und versucht, mit den Sowjets fertigzuwerden, doch vor acht Monaten hatte Moskau schließlich genug von Konzessionen und ihre Zerschlagung befohlen. Über Nacht waren Zehntausende ohne Anklage ins Gefängnis gesteckt worden, viele andere hatte man eingefangen und mit Bussen außer Landes geschafft. Menschen verschwanden einfach. Sämtliche Demokratiebewegungen wurden verboten und alle ihre führenden Köpfe inhaftiert, darunter auch der berühmte Lech Wałęsa. Die Machtübernahme des Militärs war schnell und koordiniert über die Bühne gegangen. Inzwischen patrouillierten in den Straßen aller größeren Städte Soldaten. Man hat eine Ausgangssperre verhängt, die Landesgrenzen dichtgemacht, Flughäfen geschlossen und Kontrollposten an Einfahrtsstraßen zu den größeren Städten aufgestellt. Telefonverbindungen wurden entweder unterbrochen oder abgehört, Post wurde zensiert und der Unterricht in Schulen und Universitäten ausgesetzt.
Es hatte auch Tote gegeben.
Niemand kannte die genauen Zahlen.
Eine Sechstagewoche wurde angeordnet. Die Medien, die Staatsbetriebe, die Gesundheitsfürsorge, die Versorgungsunternehmen, die Kohleminen, Häfen, das Schienennetz und die meisten wichtigen Industriebetriebe wurden der Aufsicht des Militärs unterstellt. Zur Zerschlagung gehörte auch ein Prozess, bei dem die Einstellung jedes Einzelnen zum herrschenden Regime überprüft wurde. Bestandteil des neuen Loyalitätsbeweises war ein Dokument, mit dem sich der Unterzeichner verpflichtete, alle Aktivitäten einzustellen, die in den Augen der Regierung eine Bedrohung hätten darstellen können. Dadurch waren viele ins Netz gegangen, darunter auch er selbst. Offenbar waren seine Antworten nicht zufriedenstellend gewesen, obwohl er gelogen hatte, so gut er konnte.
Die Schläge hörten einen Moment lang auf.
Er zwang sich nachzudenken und fragte: »Wer ist dieser Mann?«
»Ein Mathematikprofessor. Er wurde verhaftet, als er ein Solidarność-Treffen verließ. Dadurch gilt er definitionsgemäß nicht mehr als unschuldig.«
»Weiß er etwas?«
»Deshalb wird ja das Verhör durchgeführt«, sagte Dilecki. »Manchmal stochern wir nur im Nebel. Was er weiß, wird sich noch herausstellen.«
Sie schwiegen für einen Moment.
»Verhöre haben auch noch andere Nutzen. Sie schüchtern diejenigen ein, die nicht gefoltert wurden, wodurch wir ihren Widerstand brechen und sie … fügsamer machen.«
Jetzt begriff er, warum er hier war.
Dilecki sah ihn durch zusammengekniffene Lider scharf an. »Sie hassen mich, nicht wahr?«
Lügen war sinnlos. »Absolut.«
»Ist mir egal. Denn ich will, dass Sie mich fürchten.«
Janusz’ Beine begannen zu zittern.
Dilecki richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf den Gefangenen und machte ein Zeichen. Einer der Wärter trat den Hocker um, sodass der geschlagene Mann hart auf den Zementboden fiel. Seine Handgelenke und Knöchel wurden losgebunden, und der blutige Mann krümmte sich vor Schmerzen. Dennoch schrie er nicht und sagte auch kein Wort.
Das war beeindruckend.
Tatsächlich sogar noch stärker als Dileckis Furcht davor, betrogen zu werden.
Also nahm er sich diesen Mut zum Vorbild und fragte: »Was haben Sie mit mir vor?«
»Ich will, dass Sie die Augen und Ohren offen halten und mir sagen, was Sie sehen und hören. Ich will, dass Sie mir alles berichten, was Sie wissen. Ich will Informationen über unsere Freunde und unsere Feinde. Wir gehen einer großen Krise entgegen und brauchen die Hilfe von Menschen wie Ihnen.«
»Ich bin niemand.«
»Was Sie zum perfekten Spion macht.« Dilecki lachte. »Und wer weiß? Eines Tages werden Sie vielleicht eine große Nummer.«
Ihm war bewusst, was die Befürworter und Unterstützer des Kriegsrechts gerne sagten. Polen war von der UdSSR, der DDR, der Tschechoslowakei, der Ukraine und Weißrussland umgeben, alles Staaten, die von den Sowjets kontrolliert wurden. Man hatte in Polen das Kriegsrecht angeblich verhängt, um das Land vor einer möglichen Militärintervention durch jene Staaten des Warschauer Paktes zu bewahren – wie sie 1956 in Ungarn und 1968 in der Tschechoslowakei geschehen war, als die Sowjets jegliche Opposition niederschlugen. Doch niemand glaubte ernsthaft solchen Unsinn. Es ging den Mächtigen einzig und allein um ihren Machterhalt.
Der Kommunismus existierte nur durch Unterdrückung.
Der polnische Kommunismus wirkte wie eine seltsame Mischung von Sozialismus und Faschismus; eine kleine Gruppe kontrollierte alle anderen und die Ressourcen, während die überwältigende Mehrheit in Hunger und Armut lebte.
Der Gefangene auf dem Fußboden regte sich, sein geschundener Körper verdrehte sich, wie von einer furchtbaren Arthritis gepeinigt. Einer der Wärter trat ihn in den Leib, und aus dem Mund des Mannes spritzte Erbrochenes. Einerseits wollte Janusz dem Mann unbedingt helfen, andererseits wollte er einfach nur entkommen und alles tun und sagen, was dazu nötig war. Dilecki stellte wie ein fordernder Schulmeister jede Schlussfolgerung und jede Aussage infrage und ließ ihn nicht zur Besinnung kommen. Ihm blieb keine andere Wahl. »In Ordnung. Ich werde tun, was Sie verlangen.«
Dilecki stand auf, hielt die Hände leicht gefaltet; sein prüfender Blick haftete an ihm. »Vergessen Sie eines nie: Falls Sie mich anlügen oder versuchen, mich zu täuschen oder sich vor mir zu verstecken, wird man Sie schließlich auch an einen Hocker fesseln.« Seine schmalen Lippen verzogen sich zum Anflug eines Lächelns. »Aber genug der Drohungen. Sie haben sich richtig entschieden, Genosse. So wie es in der Hymne heißt. Polen wird bestehen, solange wir noch leben.«
»Und was … fremde Mächte … uns genommen … das werden wir … mit dem Säbel … zurückholen.«
Die Worte kamen von dem Gefangenen, der in seinem Erbrochenen auf dem Boden lag. Man hatte ihn geschlagen, und er blutete, doch er unternahm keinen Versuch, den Triumph in seiner Stimme zu verbergen, als er die zweite Zeile der Nationalhymne wiederholte.
Diese Worte waren jedem Polen heilig.
Janusz würde sie nie vergessen.
GEGENWART
1
Dienstag, 4. Juni
Brügge, Belgien
Cotton Malone hasste es, wenn zwei plus zwei fünf ergab. In seinem früheren Beruf als Offizier im amerikanischen Nachrichtendienst war es überaus häufig zu diesem beunruhigenden Ergebnis gekommen. Ob man es Berufsrisiko oder einfach nur Pech nannte, tat nichts zur Sache. Ungenaue Berechnungen brachten keine brauchbaren Resultate.
So wie jetzt.
Er stand in der Heilig-Blut-Basilika – die Belgier nannten sie Heilig Bloedbasiliek –, ein düsteres Gebäude aus dem 12. Jahrhundert, das eine der heiligsten Reliquien Europas beheimatete. Die alte Kirche schmiegte sich in eine Ecke des Burgplatzes, eingezwängt zwischen dem alten Rathaus und einer Reihe moderner Läden. Er war nach Brügge zur größten europäischen Messe für antiquarische Bücher gereist, die er bereits mehrfach besucht hatte. Er bevorzugte sie sogar vor allen anderen. Nicht nur, weil er die Stadt liebte, sondern auch, weil es dort den besten Nachtisch der Welt gab.
Dame blanche. White Lady.
Vanilleeis, getränkt in warmer belgischer Schokolade, mit einem Klacks Schlagsahne. Drüben in Amerika nannte man so etwas Sundaes. Nichts Besonderes. Aber hier war das anders. Die Einheimischen hatten das Dessert zu einer Kunstform erhoben. Jedes Café hatte seine eigene Version, und er war fest entschlossen, heute nach dem Abendessen eine neue Variante davon zu genießen.
Aber jetzt war er hier, um sich ein Spektakel anzusehen. Eines, von dem er zuvor schon gehört, das er aber noch nie mit eigenen Augen gesehen hatte. Früher fand es nur einmal pro Woche statt, jetzt täglich, entweder morgens zwischen 11 Uhr und Mittag oder zwischen 14 und 16 Uhr am Nachmittag, wie einem Aushang an der Tür zu entnehmen war.
Es gab sogar einen Namen dafür.
Die Verehrung des Heiligen Blutes.
Der Legende nach wurde der Leichnam Christi nach der Kreuzigung Joseph von Arimathäa übergeben. Er säuberte ihn mit ernster Hingabe und sammelte alles Blut, das aus den Wunden strömte, in einem heiligen Gefäß, das er angeblich seinen Nachkommen vererbte. Je nachdem, welcher Version man glaubte, fanden Tropfen dieses Blutes entweder im 12. Jahrhundert über Jerusalem oder im 13. Jahrhundert über Konstantinopel ihren Weg nach Brügge.
Niemand wusste, welche Legende der Wahrheit entsprach.
Jedenfalls war das Blut hiergeblieben, und manchmal wurde es vor den Calvinisten, vor Revolutionären und Eroberern versteckt. Seit Jahrhunderten kamen Pilger, um es zu sehen. Sie wurden durch eine päpstliche Bulle aus dem 14. Jahrhundert dazu ermutigt, in der allen, die vor der Reliquie beteten, ein Ablass zugesichert wurde. Die ganze Sache galt als überaus seltsam, zumal nirgendwo in der Bibel erwähnt wird, dass das Blut Christi erhalten geblieben sei.
Das hatte die Gläubigen aber nicht abgeschreckt.
Die Basilika bestand aus zwei Kapellen. Die untere war düster und romanisch, die obere hell und gotisch. Sie war zweimal zerstört und jedes Mal wieder aufgebaut worden. Er schaute sich in der oberen Kapelle um: Die drei hoch aufragenden, reich verzierten Kirchenschiffe lenkten die Blicke gen Himmel. Die goldenen Strahlen der Nachmittagssonne sickerten durch eindrucksvolle Buntglasfenster ins Kircheninnere. Über ihm erstreckte sich eine prachtvolle Decke, die wie ein umgedrehtes Boot aussah, und alles war mit atemberaubend schönen Holzintarsien versehen. Eine brünierte, kugelförmige Kanzel hing hoch oben an einer Wand. Vor einer Reihe weit hinaufreichender Wandmalereien, die in prächtigen Farben – dem Ort angemessen – den blutenden Jesus Christus darstellten, stand ein vergoldeter Altar. Auf den Holzbänken vor der Altarschiene saßen viele Touristen, während andere damit beschäftigt waren, Fotos zu schießen.
Doch zurück zu jener seltsamen Mathematik, bei der zwei plus zwei fünf ergab.
Es begann mit drei Männern.
Sie sahen anders als die übrigen Besucher aus. Jung, vorsichtig, seit Tagen unrasiert, mit glatten, ebenmäßigen Gesichtern. Auch ihre Minen unterschieden sich von denen der Menschen um sie herum, so als hätten sie einen wichtigeren Grund, hier zu sein, als eine bloße Besichtigung. Ihre Konzentration beunruhigte Cotton, er spürte jene Anspannung, die ihm verriet, dass es sich bei ihnen nicht um Touristen handelte. Seine Alarmglocken schrillten endgültig, weil sie sich strategisch in der Nähe der Außenmauern der Kapelle verteilten, mehr aufeinander als auf ihre unmittelbare Umgebung konzentriert.
Er sah auf seine Armbanduhr. 14 Uhr.
Eine Glocke ertönte.
Die Show begann.
Im seitlichen Kirchenschiff, hinter den Gewölbebögen, öffnete sich eine Tür und ein Priester trat heraus.
Die Zeremonie hatte begonnen.
Ein Prälat im Ornat trug ein rechteckiges Glaskästchen. Darin lag die Reliquie auf einem roten Seidenkissen. Die Phiole selbst, die etwas blutgetränkte Schafwolle enthielt, war ungefähr zehn Zentimeter hoch und drei Zentimeter im Durchmesser. Sie bestand vorwiegend aus klarem byzantinischem Bergkristall. Ihren Hals hatte man mit einem goldenen Faden umwickelt, dessen Enden mit Wachs versiegelt waren – eingebettet in einen größeren Glaszylinder, dessen goldene Krone mit Engelsdarstellungen verziert war. Cotton hatte ein wenig über den äußeren Zylinder gelesen und wusste, dass ein Datum mit römischen Ziffern in den Rahmen eingraviert war.
3. Mai 1388.
Der Priester schritt mit überaus frommer Miene durch die Kapelle auf einen Barockaltar aus weißem Marmor mit roter Samtdecke zu, der als Thron der Reliquie bezeichnet wurde. Vorsichtig stellte der Prälat das gläserne Kästchen auf den Altar, dann setzte er sich auf einen Stuhl, damit die Gläubigen vor der Reliquie beten konnten.
Doch zuerst mussten sie etwas spenden.
Links bildete sich eine Schlange, dort stand ein anderer Priester vor einer Kollektenschale. Die Menschen warfen dort Euros hinein, bevor sie die niedrige Treppe bestiegen und ein paar stille Momente mit der Reliquie verbrachten. Cotton fragte sich, was geschähe, wenn jemand keine Münze fallen ließe und die Reliquie dennoch verehren wollte. Würde man ihn abweisen?
Die drei Amigos hatten ihre Positionen verändert und waren mit allen anderen aus dem Hauptschiff zur Seitenkapelle gegangen. Mehrere Kirchendiener dirigierten die Menge und brachten jeden zum Verstummen, der seine Stimme zu laut werden ließ. Fotografieren, mit dem Finger darauf zeigen, filmen, glotzen und spenden war jedoch erlaubt.
Gespräche waren dagegen eher nicht erwünscht.
Einer der Amigos arbeitete sich zur Schlange der Betenden vor. Die beiden anderen hielten sich im Hintergrund in der Nähe der Gewölbebögen und betrachteten das Spektakel aus zehn Metern Entfernung. Eine Batterie von Votivkerzen trennte den Thron der Reliquie von den Gläubigen; es waren ein paar Hundert kleine Glassockel, in vielen davon flackerten Flammen. Einige der Besucher traten heran und entzündeten eigene Kerzen. Danach warfen sie selbstverständlich eine Münze in einen Metallkasten.
Immer wieder stiegen Menschen zur Reliquie hinauf, hielten dort für ein paar Augenblicke inne, beteten und bekreuzigten sich. Die beiden Amigos, die sich im Hintergrund gehalten hatten, trugen Rucksäcke. Obwohl auch viele andere Besucher Rucksäcke dabeihatten, schien mit denen der beiden etwas nicht zu stimmen.
Er hatte zwölf Jahre für das Justizministerium beim Magellan Billet gearbeitet, nachdem er zuvor bei der Navy gewesen war und einige Zeit als Anwalt beim Obersten Militärgerichtshof gearbeitet hatte. Jetzt lebte er im vorgezogenen Ruhestand und war Besitzer eines Antiquariats in Kopenhagen. Er nahm gelegentlich Aufträge von Regierungen und Geheimdiensten an, die ihm ein gutes Nebeneinkommen verschafften, aber heute war er nicht im Dienst. Er war nur Tourist. Und anscheinend zur falschen Zeit am richtigen Ort.
Hier war etwas im Gange.
Etwas, von dem ihm alle Instinkte in seinem fast fünfzig Jahre alten Nervensystem sagten, dass es nichts Gutes war. Es war wirklich schwer, alte Gewohnheiten abzulegen.
Der Amigo in der Warteschlange näherte sich der Opferschale, warf eine Münze hinein und stieg danach die wenigen Stufen zum Marmortisch hinauf, wo der stoische Priester Wache hielt. Die beiden anderen Amigos nahmen ihre Rucksäcke ab und öffneten die Reißverschlüsse. Das Klingeln der Alarmglocken in Cottons Kopf wurde einen Ton schriller, er konnte den Roboter aus LOST IN SPACE, der alten Science-Fiction-Serie, hören. GEFAHR, WILL ROBINSON.
Ein Amigo zückte eine Waffe, der andere hielt etwas, das wie ein Metallzylinder aussah. Er zog den Stift und warf die Dose in die Seitenkapelle.
Eine Granate?
Sofort stieg dichter Qualm auf.
Nein.
Ein Ablenkungsmanöver.
Cottons Überlegungen wurden durch den scharfen Knall der Waffe durcheinandergebracht, die zweimal in die Decke abgefeuert wurde. Es regnete Gips und Holzsplitter. Schnell breitete sich Panik aus, eine Frau kreischte. Man hörte laute Stimmen. Noch mehr Geschrei. Die Menschen bewegten sich wie eine Herde auf den einzigen Ausgang zu, eine reich verzierte Wendeltreppe, die nach unten führte. Es waren circa hundert Menschen, die alle nach draußen drängten und ein Chaos erzeugten.
Dann knallte ein weiterer Schuss.
Eine dichte graue Rauchwolke zog ins Hauptschiff hinein und verhinderte den Blick in die Seitenkapelle und zum Reliquiar. Cotton schob sich durch die Menge und steuerte auf den Qualm zu. Durch den Nebel sah er, wie der Amigo, der in der Schlange gestanden hatte, den Priester zur Seite stieß. Ein neuer Schwung aufgeregter Besucher stand wie eine Wand zwischen ihm und den drei Amigos, die sich gegen den Strom fortbewegten. Er drängelte weiter, die zwei anderen Amigos bogen zum dritten Mann ab, der das Glaskästchen mit der Reliquie zerstörte. Der Priester stürzte sich auf sie und versuchte den Diebstahl zu verhindern, aber einer der Amigos schlug dem alten Mann die Faust ins Gesicht, sodass er zu Boden ging.
Was war das hier?
Ein klassischer, schneller Raubüberfall?
Danach sah es jedenfalls aus.
Und es funktionierte.
Bestens.
Die drei Amigos steuerten auf die Seitentür zu, aus der der Priester herausgekommen war und die mit Sicherheit in die hinteren Räume der Basilika führte. Wahrscheinlich ging es von dort auch nach unten. Und das hieß, dass diese Kerle ihre Hausaufgaben gemacht hatten.
Cotton ließ die letzten panischen Touristen hinter sich und ging in die Seitenkapelle. Das Atmen fiel ihm schwer, er hustete Rauch aus und seine Augen tränten. Er sorgte sich um den Priester, deshalb lief er zum Altar, wo der alte Mann auf dem Boden lag.
»Alles in Ordnung?«, fragte er.
Der Mann war angeschlagen, sein rechtes Auge rot und geschwollen. Er umklammerte Cottons rechten Arm: »Sie müssen es … zurückholen.«
Die drei Amigos waren verschwunden.
Die Polizei war bestimmt schon unterwegs. Jemand musste sie angerufen haben. Doch sie würden nicht viel zur Ergreifung der Diebe tun können, denn die waren kurz davor, in die geschäftigen Straßen von Brügge abzutauchen.
Er schaltete in den Aktionsmodus.
Das Sightseeing war vorbei.
»Ich werde es zurückholen.«
2
Slowakei
Einschüchterung war ein Aspekt seines Geschäfts, den Jonty Olivier hasste. Er hielt sich für einen wohlerzogenen Gentleman, einen Mann mit exquisitem Geschmack, einen Connaisseur alter Weine und guten Essens. Einen gebildeten Menschen, der seine Freizeit überwiegend mit dem Studium der Klassiker verbrachte. Selbst sein Name beschwor Filmadel herauf. Oli-vi-je. Wie in Sir Laurence Olivier. Darüber hinaus war er ein Vollprofi. Seine Spezialität? Informationen. Sein Ruf? Der eines Mannes, der exakt das liefern konnte, was man wissen wollte. Interessierte man sich für das unbekannte Vermögen eines potenziellen Geschäftspartners oder möglichen Käufers? Kein Problem. Wie viele Automatikgewehre und wie viel Munition Boko Haram letzten Monat nach Nigeria importiert hatte? Ganz einfach. Was die kolumbianische Revolutionsarmee bei den nächsten bilateralen Gesprächen fordern wird? Etwas schwieriger, aber machbar. Welche Pläne die Hisbollah-Mudschaheddin in Kaschmir verfolgten, oder wie der Euro am Ende des heutigen Geschäftstages von den Devisenmärkten der EU bewertet wird? Beides nicht ganz leicht, doch seine Antworten kämen der jeweiligen Sache recht nahe. Außerdem gewährte er einen Preisnachlass, falls er sich nicht hundertprozentig sicher war, denn im Großen und Ganzen waren auch unvollständige Informationen weitaus besser als gar keine. Sein Motto? Scientia potentia est. Sir Francis Bacon hatte recht gehabt.
Wissen ist Macht.
Aber Wissen zu beschaffen war eine Herausforderung. Gier war und blieb eine universale Motivation, deshalb klappte es für gewöhnlich mit Geld. Tauschgeschäfte brachten ebenfalls Ergebnisse. Er hatte auch nichts gegen harte Verhandlungen, weil das nun einmal dazugehörte.
Aber Spitzel? Spitzel verachtete er.
Die Arme und Beine des Mannes, der vor ihm saß, waren mit Klebeband an einen Metallstuhl gefesselt. Ein Draht schlängelte sich durch den Mund in die Speiseröhre hinunter. Seine Stärke war sorgfältig bemessen: Er war fein genug, um keinen Würgereflex auszulösen, aber ausreichend dick, um seinen Zweck zu erfüllen. An seinem Ende hing ein stromleitender Haken aus Metall, während sich am anderen Ende ein Gleichstromtransformator befand. Ein Amateur hätte ihn von außen bearbeitet und die Informationen aus ihm herausgeschnitten, -gequetscht, -geschlagen oder -getreten. Er bevorzugte eine verfeinerte Herangehensweise. Diese Technik vermittelte ein viel tieferes und schmerzhafteres Unbehagen und hatte außerdem den Vorteil, keine Spuren zu hinterlassen.
Er zeigte mit dem Finger auf ihn. »Wer hat Sie geschickt?«
Keine Antwort. Er warf einen kurzen Seitenblick zu seinem Mitarbeiter. Vic DiGenti arbeitete schon lange mit ihm zusammen. Ihre Wege hatten sich zuerst in seinem früheren Geschäftsfeld gekreuzt, und bei jener Gelegenheit hatte er erlebt, dass Vic mit nahezu allem fertigwurde. Gott sei Dank. Jeder brauchte einen Helfer. Laurel hatte Hardy, Dean Martin hatte Jerry Lewis. Er hatte Vic. Einen dünnen, knorrigen Mann mit glattem schwarzem Haar und schmalen grauen Augen. Einen Mann von wenig Worten, der aber sehr diskret und absolut loyal und dabei frei von jeglicher Gier war.
Er machte ein Zeichen, und Vic betätigte den Regler des Transformators.
Der Mann, der an den Stuhl gefesselt war, riss die Augen weit auf, als elektrischer Strom durch das dünne Kabel seine Kehle hinunterfloss. Er verkrampfte sich und zerrte an den Fesseln. Er gab kein Geräusch von sich, weil ein Nebeneffekt dieser speziellen Überzeugungsmethode die Unfähigkeit zu schreien war. Vic wusste, wann er aufhören musste, und stellte nach fünf Sekunden den Strom ab.
Die Krämpfe lösten sich.
Aus den Mundwinkeln des Mannes tropfte Speichel.
Es war etwas unappetitlich, aber damit hatte er gerechnet.
»Sollen wir es Ihnen noch einmal demonstrieren?«, fragte er. »Das lässt sich auf jeden Fall einrichten. Aber ich bitte Sie, zwingen Sie mich nicht dazu.«
Der Mann schüttelte den Kopf hin und her; er atmete schwer und angestrengt.
Die gekalkten Wände, die ihn umgaben, rochen feucht und muffig, und er wäre jetzt am liebsten woanders gewesen. »Ich werde meine Frage noch einmal stellen. Es ist lebenswichtig, dass Sie antworten. Ist das klar?«
Der Mann nickte.
»Für … wen … arbeiten … Sie?«
Schweigen.
Er atmete lange und erschöpft aus.
Vic schickte erneut fünf Sekunden lang elektrischen Strom durch den Körper des Mannes. Sie mussten vorsichtig sein, denn Gleichstrom tötete, wenn man ihn nicht richtig dosierte.
Dieser Spion war gestern in Bratislava gefasst worden. Er und Vic waren da gewesen, um in letzter Minute noch ein paar Dinge glattzubügeln. Sie hatten beide bemerkt, dass sie beobachtet wurden, und sich Reflexionen auf Autos und gelegentliche Seitenblicke zunutze gemacht, um den Verfolger zu identifizieren. Dann hatten sie sich einem Tross von Schaufensterbummlern angeschlossen und bestätigt gefunden, dass sie verfolgt wurden. Vic, der stets wachsam war, hatte es geschafft, sich ihr Problem zu schnappen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen.
»Ihnen muss doch klar sein, dass Sie hier ganz auf sich allein gestellt sind«, betonte Jonty. »Niemand kommt, um Sie zu retten. Muss ich Ihnen eine weitere Demonstration geben?«
»Ich war da, um … Sie zu überprüfen. Und so viel herauszufinden … wie ich konnte.«
Er keuchte es mit dem Draht in seiner Kehle; sein Englisch hatte einen osteuropäischen Akzent.
»Das versteht sich von selbst. Was haben Sie herausgefunden?«
»Überhaupt … nichts.«
Das bezweifelte er. »Haben Sie gemeldet, dass Sie nichts herausgefunden haben?«
»Noch nicht.«
Bestimmt alles Lügen.
»Wem erstatten Sie Bericht?«
Keine Antwort.
Der Mann war zäh.
Er gab ein Zeichen, und Vic drehte wieder am Regler. Der Körper stemmte sich fest gegen die Fesseln, bäumte sich auf und verkrampfte. Diesmal ließ er die Quälerei ein paar Sekunden länger dauern, aber nicht so lange, dass das Herz dadurch paralysiert wurde. Er nickte, und Vic unterbrach den Stromkreis. Der Mann sackte bewusstlos im Stuhl zusammen. Vic brachte ihn mit zwei kräftigen Ohrfeigen wieder zur Besinnung.
Sie hatten so viel vor. Hatten sieben Einladungen verteilt. Fast alle Eingeladenen hatten Interesse gezeigt. Nur drei Bestätigungen standen noch aus. Und morgen um Mitternacht drohte die Deadline. Bis dahin waren es noch etwas mehr als vierundzwanzig Stunden.
»Ich mag keine Spitzel«, sagte er zu dem Mann. »Sie sammeln Informationen und geben sie dann einfach an ihre Arbeitgeber weiter. Sie sind meine Hauptkonkurrenten. Zum Glück sind Sie kein guter Spitzel. Ich habe dreimal gefragt. Wenn Sie mich zwingen, noch einmal zu fragen, für wen Sie arbeiten, werde ich den Strom fließen lassen, bis Sie tot sind.«
Er ließ seinen Bluff einen Moment lang wirken.
Eine Regel, an die er sich stets hielt – obwohl er nie davon sprach –, war es, niemanden zu töten. Aber er würde diesen Mann so weit bringen, dass er sich wünschte, tot zu sein.
Die bevorstehende Operation war die komplizierteste, die er jemals unternommen hatte. Eigentlich waren es sogar zwei in einer. Sie waren beide kompliziert, es gab viele Variablen, und die eine hing von der anderen ab. Aber für welchen Preis? Oh, die Belohnung. Das eine Geschäft konnte zwanzig Millionen Euro oder mehr einbringen. Und das andere? Das war schwer einzuschätzen, aber es konnten fast hundert Millionen Euro werden. Das reichte, damit er für den Rest seines Lebens tun konnte, was immer er wollte. Aber wegen dieses Spitzels könnte nun alles auf dem Spiel stehen.
Er wechselte einen Blick mit Vic.
»Nein. Bitte. Nicht«, bettelte der Mann.
Er sah wieder den Spitzel an. »Beantworten Sie meine Frage.«
»Reinhardt hat mich geschickt.«
Als er den Namen hörte, lief ihm ein Schauer den Rücken herunter.
Sein Erzfeind.
Er hätte nie damit gerechnet, von ihm beobachtet zu werden.
Dann sah er wieder zu Vic.
Der Regler wurde abermals gedreht.
3
Cotton floh durch eine Seitentür aus der verqualmten Kapelle und betrat einen kleinen Vorraum. Liturgische Gewänder hingen an einer Garderobe, woraus sich schließen ließ, dass die Priester hier vor der Messe ihre Talare anlegten. Er war selbst Messdiener gewesen – bis zu seinem dreizehnten Lebensjahr, als all seine Fragen aus ihm herausdrängten. Der Katholizismus war wirklich gut darin, das Was zu erklären, aber beim Weshalb haperte es. Teenager hatten jede Menge Fragen, und als die Antworten ausblieben, kam er zu dem Schluss, dass es nichts für ihn war, katholisch zu sein. Deshalb löste er sich davon. Wenn man ihn jetzt nach seiner Religion fragte, antwortete er immer, dass er ein geborener Katholik sei, den Glauben aber nicht praktiziere. Das erklärte vielleicht, weshalb er jetzt gleich die Ärmel hochkrempelte.
War er der Kirche etwas schuldig?
Nicht unbedingt, aber er fühlte sich trotzdem zuständig.
Er lief aus dem Vorraum in einen kleinen Flur, der an einer weiteren Treppe nach unten endete. Diese ließ sich nicht mit dem prachtvollen Haupteingang vergleichen, aus dem die Menge nach draußen geströmt war, als alles begonnen hatte. Hier gab es nur schmale Holzstufen. Er lief hinunter, gelangte an eine Tür, die ins Freie führte, und wurde vom Licht der Nachmittagssonne geblendet. Eine Menschenmenge füllte den Platz vor dem alten Rathaus. Verängstigte Touristen aus der oberen Kapelle drängten sich zu nervösen Haufen zusammen. Er ließ den Blick über die Menge schweifen und suchte nach Hinweisen auf die drei Amigos. Am gegenüberliegenden Ende des mit Kopfsteinen gepflasterten Platzes entdeckte er sie; sie waren drauf und dran, um eine Ecke zu biegen und zu verschwinden. Die Reliquie war nicht zu sehen; sie befand sich höchstwahrscheinlich in einem der Rucksäcke.
Brügge war ein architektonisches Kleinod der Gotik. In seinem oval geformten historischen Stadtkern gab es nur wenige Autos, aber dafür viele Menschen und Fahrräder. Eine Ringstraße hielt den Verkehr aus der Innenstadt heraus, aber sie war kreuz und quer von Kanälen durchzogen, denen sie ihren Beinamen verdankte: das Venedig des Nordens. Brügge war Belgiens wichtigste Touristenattraktion mit einem Gewirr gekrümmter Straßen, die von bunten Gildehäusern gesäumt wurden. Auf dem alten Marktplatz fanden einst Handelsmessen, mittelalterliche Turniere und sogar Hinrichtungen statt. Viele der mehrstöckigen, bunten Fassaden waren erhalten geblieben. Straße um Straße bildeten sie ein lebendiges Museum, was der Stadt den ehrenhaften Status eines Weltkulturerbes eingetragen hatte.
Mit solchen Städten hatte er schlechte Erfahrungen gemacht.
Dabei hatte er nie absichtlich Schaden verursacht.
Aber manche Dinge passierten einfach.
Er setzte den Amigos nach und folgte ihnen um die Straßenecke. Sie hatten fast hundert Meter Vorsprung und bewegten sich zwischen zwei Reihen von Giebelhäusern. Sie hielten ihre Flucht für gelungen, denn sie wirkten kaum nervös, sondern eher lässig. Er beschloss, den Abstand zu verringern, und fing an zu laufen. In dieser Nebenstraße waren nicht viele Menschen unterwegs, weil sie von den Hauptattraktionen weg und zur äußeren Ringstraße führte.
Er schaffte es, die Distanz bis auf fünfzig Meter zu verringern.
Einer der Amigos bemerkte plötzlich, dass sie verfolgt wurden. Er stieß die beiden anderen an, damit sie mitbekamen, dass sie bei ihrer Flucht beobachtet worden waren.
Sie fingen an zu laufen.
Großartig.
Cotton stürmte voran.
Die Straße endete an einer der gewölbten Brücken, was darauf schließen ließ, dass gleich ein Kanal folgte. Die Amigos liefen auf die andere Seite und verschwanden nach rechts. Cotton legte einen Zahn zu und sah, dass sie eine Steintreppe zu einem Anleger hinunterrannten, wo ein Boot wartete. Die drei Diebe sprangen hinein, starteten den Motor und fuhren schnell los, unter der Brücke hindurch, auf der er sich befand, und verschwanden auf der anderen Seite.
Zwei der Amigos winkten ihm lässig zu.
Auf seiner Seite des Kanals entdeckte er eines der vielen Boote mit offenem Verdeck und zwanzig freien Sitzplätzen, das auf den nächsten Schwung Touristen wartete, die gerade Tickets für eine Runde auf dem Wasser lösten. Am Schalter hatte sich eine Schlange gebildet, die Kasse war noch nicht geöffnet. Er drängte sich bis an den Anfang der Schlange und ging dann weiter. Der Angestellte am Ticketschalter rief laut. Er ignorierte den Befehl, stehen zu bleiben, und eilte die vermodert riechenden, feuchten Steinstufen hinunter. Unten wartete ein Mann, wahrscheinlich der Kapitän des Ausflugsbootes, der den illegalen Zutritt mit Gesten abzuwehren versuchte. Cotton rammte dem Mann sein Knie so fest in den Bauch, dass er sich krümmte.
»Tut mir leid«, murmelte er.
Er sprang ins Boot, dessen Motor im Leerlauf war, und löste die beiden Festmacherleinen. Dann nahm er den Gashebel und schob ihn nach vorn, sodass der Diesel mit einem gurgelnden Tschuck-tschuck zum Leben erwachte. Das Boot setzte sich in Bewegung; er kurbelte am Steuerrad und richtete den Bug auf die drei Amigos aus. Er war schon einmal auf einem dieser Boote gewesen und hatte damit ein paar Kanalfahrten durch Brügge unternommen. Sie tuckerten normalerweise im Schneckentempo voran, damit man sich alles ansehen konnte, und er hatte sich immer gefragt, ob vielleicht noch mehr Leistung unter der Haube war.
So war es.
Er gab Vollgas.
Der Propeller beschleunigte, und der Bug hob sich, er pflügte durch das braune Wasser des engen Kanals und zog dabei weiße Gischt hinter sich her. Cotton fuhr wieder unter der Fußgängerbrücke durch und kam auf der anderen Seite heraus, wo der Kanal nach links abknickte, vorbei an einem Ensemble von Sandsteingebäuden, deren Fassaden durch Kletterpflanzen aufgelockert wurden. Es ging noch einmal scharf nach rechts, dann wurde die Wasserstraße wieder gerade. Der Abschnitt vor ihm wurde von weiteren efeubewachsenen Häusern und Holzfassaden gesäumt.
Er fuhr unter den rostigen Trägern der nächsten Spannbrücke durch.
Die drei Amigos hatten einen soliden Vorsprung, aber sie fuhren offenbar nicht übermäßig schnell, weil sie sich bereits in Sicherheit wähnten.
Deshalb gelang es ihm, den Abstand zu verringern.
Der Kanal war ungefähr fünfzehn Meter breit und auf beiden Seiten von hohen Mauern eingefasst, hinter denen Bäume aufragten. An der nächsten Abzweigung kam plötzlich ein anderes Ausflugsboot von rechts. Er riss das Steuerrad nach links und passierte das andere Boot knapp vor dem Bug. Dabei wurden die meisten Fahrgäste des anderen Bootes von seinem Kielwasser nass gespritzt. Er machte eine entschuldigende Geste, fuhr aber weiter geradeaus und konzentrierte sich auf die Stelle, wo sich der Kanal an einer T-Kreuzung zu einer größeren Wasserfläche verbreiterte. Die drei Amigos warteten an dieser Stelle, ihr Boot dümpelte quer zu seiner Fahrtrichtung, und zwei der Männer zielten mit Waffen in seine Richtung.
Sie fingen an zu schießen.
Cotton war nahezu mit Höchstgeschwindigkeit in ihre Richtung unterwegs und kam ihnen immer näher. Er duckte sich unter die Windschutzscheibe, sodass die Kugeln an ihm vorbeiheulten. Das Boot der Amigos fuhr ein Stück nach vorn, sodass er nicht mehr nach links abbiegen konnte. Währenddessen wurde unablässig geschossen. Es war zu spät, um noch nach rechts abzubiegen. In dem langen, rechteckigen Wasserbecken war nicht genug Platz für eine Wende, ohne die Einfassungsmauer zu rammen.
Ihm blieb keine Wahl.
Er sprang ins Wasser.
Das Boot fuhr führerlos weiter, aber es schaffte nur noch zwanzig Meter, bevor es in die Steinmauer krachte und explodierte. Er tauchte unter die Oberfläche, vergaß dabei aber nicht, was er einmal gelesen hatte. Bis in die 1980er-Jahre hatte man ungeklärte Abwässer in die Kanäle eingeleitet. Hoffentlich waren nach vier Jahrzehnten der Reinigung alle Gefahren beseitigt.
Er streckte den Kopf aus dem Wasser.
Die drei Amigos waren verschwunden.
Aus dem Kanal herauszukommen konnte sich als Problem erweisen. Er sah weder Leitern noch Stufen an den Mauern, die die Wasserstraße einfassten.
Ein Polizeiboot mit Blaulicht raste in seine Richtung. Sein ausgeliehenes Boot war ein brennendes Wrack, das langsam im Kanal versank. Das Polizeiboot fuhr längsseits. Zwei Uniformierte hielten ihre Waffen in den Händen und zielten auf ihn. Sie wirken nicht besonders freundlich.
Aus dem Wasser herauszukommen war also kein Problem mehr.
Doch wo würde er schließlich landen?
Das konnte ein großes Problem werden.
4
Jonty goss sich einen großzügigen Schluck Krupnik ein. Das Getränk hatte ihm schon immer geschmeckt. Eine einzigartige Kombination aus Honig, Kräutern und Gewürzen wurde aufgekocht, gesiebt und dann mit Wodka vermischt. Der Legende nach stammte das Rezept von Benediktinermönchen aus Weißrussland und hatte sich bis nach Polen verbreitet. Normalerweise wurde es warm serviert, doch er bevorzugte Zimmertemperatur.
Er nippte an dem Gebräu; der starke Schnaps wirkte beruhigend und schien alle Ecken und Kanten auszubügeln. Die unschönen Dinge, die sich im Keller ereignet hatten, steckten ihm noch in den Knochen. Der neugierige Spitzel war gefesselt und sollte bis Donnerstag bleiben. Danach wollten sie ihn gehen lassen. Was er von ihm erfahren hatte, war in vielerlei Hinsicht beunruhigend, und Vic wollte sich mit der Angelegenheit befassen.
Reinhardt.
Ausgerechnet.
Gandhi hatte es am besten ausgedrückt: Die Bedürfnisse der Menschheit können gestillt werden, jedoch nicht ihre Habgier.
Das traf auf seinen Erzrivalen zu.
Er sah sich in der alten Bibliothek um.
Die Sturney-Burg schien perfekt zu sein. Es war eine gotische Festung aus dem 13. Jahrhundert, deren drei Flügel um einen fünfeckigen Innenhof herum angeordnet waren. Ein stattliches Haupttor nahm die vierte Seite ein. Die Burg lag strategisch günstig und war am Rand des Flusses Orava auf einem terrassenförmig ansteigenden Felshang errichtet worden – fünfzig Kilometer südlich der polnischen Grenze und weit im Inneren der Slowakei. Fünf Türme, die jeweils von einer Kuppel gekrönt waren, überragten die Ecken, ein Balkon beschwor eindringlich Bilder von einer Prinzessin in Not. Die Burg hatte jahrhundertelang regelmäßig Angriffen durch Türken, Kosaken und Hussiten getrotzt. Es sah aus, als hätte hier zu keiner Zeit Armut geherrscht, weil jeder Raum von Wandteppichen und Antiquitäten aus seiner glorreichen Vergangenheit strotzte. Die polnischen Kronjuwelen waren während der schwedischen Besatzungszeit im 17. Jahrhundert hier versteckt gewesen. Im 18. Jahrhundert hatte man den späteren König Madagaskars hier eingekerkert. Die Burg gehörte einst den ortsansässigen Adeligen und wurde in den 1950er-Jahren im Rahmen einer Landreform von den Kommunisten vereinnahmt. Glücklicherweise waren die offiziellen Grundbucheinträge nie geändert worden, weshalb das Gebäude nach der Wiederherstellung demokratischer Verhältnisse seinen früheren Besitzern zurückgegeben wurde, die jedoch nicht in der Lage gewesen waren, für den Unterhalt aufzukommen. Inzwischen konnte es samt Bediensteten und Küchenkräften von Firmen und Einzelpersonen, die sich den hohen Preis leisten konnten, samt Bediensteten und Küchenkräften angemietet werden.
Jonty ging zu den Flügeltüren und gelangte von dort auf eine obere Terrasse. Farbenprächtige Kübelpflanzen säumten die Außenmauern. So weit das Auge reichte, zogen sich Birken, Tannen, Kiefern und Fichten durch ein uraltes Juratal. Die Nordslowakei war spektakulär. Im Norden ragte die Tatra in den Himmel, das höchste Gebirge der Karpaten. In den höheren Lagen gab es Schnee – ein Mekka für Wanderer und Skifahrer.
Notgedrungen lebte er das Leben eines Einzelgängers. Sein Scheitern bei Frauen betrachtete er philosophisch – es schien ein wiederkehrendes Thema zu sein, und Männer interessierten ihn nicht. Aber aufzuspüren, was schwer zu finden war, und es dann zu verkaufen, das liebte er. Im Gegensatz zu Reinhardt zog er es vor, eigene Geschäfte anzubahnen, anstatt sie anderen abzujagen. Er hatte unzählige Geschäfte gemacht, und jedes war auf seine Art profitabel gewesen. Dabei umging er das Recht, ohne Frage, aber er war nie offiziell als Bedrohung angesehen worden. Er war sehr bemüht, sich aus der Politik herauszuhalten, er ergriff für niemanden Partei und hegte keine Ideale. Er verhielt sich wie die Schweiz und bewahrte sich in allen Dingen seine Neutralität – sofern es nicht um Profit ging.
Er genoss die schönen Dinge im Leben. Sich nie um Geld zu sorgen und jederzeit kaufen zu können, was er wollte. An jeden Ort reisen zu können. Francis Bacon hatte recht gehabt. Geld ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Und nun stand er kurz davor, das größte Geschäft seines Lebens abzuschließen.
Das leise Klingeln eines eingehenden Anrufs ließ ihn sein Telefon aus der Tasche ziehen. Das Handy des Tages. Er wechselte es alle drei Tage, was auf seine tief sitzende Paranoia und das Prinzip gegründet war, nach dem er schon lange lebte: Es brauchte ihn wirklich niemand zu finden, wenn er nicht gefunden werden wollte.
»Vorhin wurde das Heilige Blut gestohlen«, meldete Vic. »Und die Russen haben ihr Kommen bestätigt.«
Er lächelte.
Eine weitere Zusage. Somit waren es fünf. Nun waren nur noch die Amerikaner und die Deutschen übrig.
»Irgendwelche Probleme?«, fragte er.
»Der Diebstahl in Brügge ist anscheinend glatt über die Bühne gegangen.«
Gut zu wissen.
»Wir müssen uns vergewissern, dass nichts nach außen gedrungen ist«, sagte er zu Vic. »Ich mache mir Sorgen wegen unseres Kellergastes und dem, der ihn geschickt hat.«
Beim Verlassen Bratislavas waren sie besonders vorsichtig gewesen; der Spitzel hatte gefesselt und geknebelt auf der Rückbank gelegen. Sie hatten darauf geachtet, dass ihnen niemand folgte und dass ihr Wagen nicht mit einem Peilsender versehen worden war.
»Kümmere dich sofort darum, Vic«, sagte er. »Reinhardt ist für mein Gefühl viel zu dicht an uns dran.«
»Verstehe. Ich werde sehen, dass ich bald mehr Informationen habe.«
»Und was ist mit heute Abend?«
»Es ist alles vorbereitet. Ich fahre in wenigen Stunden in den Norden.«
Schön zu hören.
Er beendete das Telefongespräch, ging wieder hinein und stellte sein leeres Glas auf das Nussbaum-Sideboard. Es gab mehrere Gründe, weshalb er diesen Ort ausgewählt hatte. Erstens war er prachtvoll. Zweitens konnte man ihn von Krakau aus in zwei Stunden erreichen – und er lag dabei sicher auf der anderen Seite der Grenze in einem souveränen Staat. Drittens lebte im Umkreis von zehn Kilometern kein Mensch. Und viertens gab es hier viel Platz. Ein Ballsaal mit einer umlaufenden Galerie, ein Speisesaal, ein Dutzend Zimmer in der ersten Etage, eine großzügige Küche und – was am wichtigsten war – Dienstbotengänge, durch die man unbemerkt von einem Zimmer ins nächste kam.
Er liebte Geheimhaltung.
Es war so aufregend, mehr zu wissen als die anderen. Und hier wusste er etwas, von dem niemand sonst auf der Welt etwas ahnte. Alle, die über jene Information verfügt hatten, waren schon lange tot. Es war eine Information, die ihm ganz zufällig in den Schoß gefallen war, zunächst noch unwichtig, doch inzwischen unschätzbar wertvoll. Den eigenen Scharfsinn zu benutzen, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, hatte ihn schon immer fasziniert, ebenso die Gefahr und der Ruhm, die mit den Intrigen verbunden waren. Ganz zu schweigen von dem, was es einbrachte. Aber die nackte, kalte Angst, die sich manchmal wie eine Schlange um sein Herz legte, die hasste er.
Reinhardt.
Ein Problem.
Um das er sich, falls nötig, kümmern wollte.
Aber zuerst musste er den Staatspräsidenten Polens vernichten.
5
Warschau
18.30 Uhr
Präsident Janusz Czajkowski stürmte aus dem Palast zum wartenden Auto. Er hatte seinen Ausflug sorgfältig geplant und sich unter Vortäuschung eines jener seltenen Abende, an denen er sich nach dem Abendessen früh zurückziehen wollte, für den Rest des Tages nichts in den Kalender eingetragen. Folglich begleitete ihn auch keine Schar selbstgefälliger Berater. Keine Medienvertreter. Niemand außer seinen Leibwächtern, alles Agenten des Biuro Ochrony Rządu – BOR –, der Sicherheitsbehörde für die Regierung. Er hatte für seinen heimlichen Ausflug zwei Bewaffnete und einen unauffälligen Volvo angefordert.
Die jüngste Ausprägung der Republik Polen existierte seit 1989, weshalb das Land relativ jung war. Es hatte eine Vorgängerversion gegeben, aber der Zweite Weltkrieg und die sowjetische Besetzung hatten deren Fortbestehen unterbrochen. Seit der Wiederauferstehung hatte es neun Staatspräsidenten gegeben. Die Verfassung schrieb eine fünfjährige Amtszeit mit der Möglichkeit einer einmaligen Wiederwahl vor, doch nur einer seiner acht Vorgänger hatte es zu einer zweiten Amtszeit gebracht.
Die polnische Politik war jedenfalls in Bewegung.
Für den Großteil des Tagesgeschäfts war ein Premierminister verantwortlich, üblicherweise der Vorsitzende der größten Partei im Parlament – theoretisch konnte es jeder Parlamentarier sein. Die Verfassung stattete den Präsidenten mit einem Vetorecht aus, das von einer Dreifünftelmehrheit im Parlament überstimmt werden konnte. Der Präsident fungierte als Oberbefehlshaber der Streitkräfte und konnte eine Generalmobilmachung befehlen. Er ernannte und entließ Botschafter, begnadigte Kriminelle und konnte gewisse Gerichtsentscheidungen außer Kraft setzen. Aufgrund der gegenwärtigen Zwangslage war der Präsident auch der hochrangigste Vertreter des polnischen Staates und dazu befugt, internationale Verträge zu unterzeichnen oder zu kündigen.
Wie gut für ihn.
Er stieg in den Wagen, sie entfernten sich vom Palast und verließen das Gelände durch eine Nebenausfahrt.
Seine erste Amtszeit näherte sich dem Ende.
Die Anforderungen an einen Präsidenten waren einfach. Er musste polnischer Staatsbürger und am Tag der ersten Wahlrunde mindestens fünfunddreißig Jahre alt sein und die Unterschriften von hunderttausend eingetragenen Wählern eingesammelt haben. Wer eine absolute Stimmenmehrheit erhielt, war der Sieger. Falls dies keinem Kandidaten gelang, kam es zu einer Stichwahl der beiden Bestplatzierten. Er hatte seine erste Amtszeit durch eine knappe Stichwahl gewonnen, und am Horizont zeichnete sich die nächste Wahlschlacht ab, weil eine ganze Reihe von Widersachern antrat. Ein ehemaliger Premierminister. Ein populärer Anwalt. Drei Parlamentsabgeordnete. Ein Punkrockmusiker, der eine der eher lautstarken Minderheitenparteien anführte. Ein ehemaliger Minister, der verkündet hatte, dass er nur antreten wolle, falls ihn Czajkowski verärgerte. Anscheinend war es jetzt so weit, denn der Schreihals war dabei, die erforderlichen hunderttausend Unterschriften zu sammeln.
Die kommende Regierungsperiode versprach, lebhaft zu werden.
Zum Glück war er nicht unpopulär. Die jüngsten Meinungsumfragen zeigten eine 55-prozentige Zustimmungsrate. Nicht schlecht, aber auch nicht überwältigend. Auch das war ein Grund dafür, weshalb er jetzt im Auto saß und die Kilometer vorbeiziehen ließ, während er sich in westlicher Richtung zum Städtchen Józefa fahren ließ. Nach dreiwöchiger Suche war die Wurzel des Problems gefunden worden: ein treuer Gefolgsmann der kommunistischen Ära, der schon über zehn Jahre tot war. Man hatte sehr darauf gehofft, dass er sein Wissen mit ins Grab genommen hatte. Aber dann waren alte Informationen nach außen gedrungen. Und nicht nur irgendwelche Fakten und Zahlen, sondern etwas, das ihn direkt betraf. Es konnte ihn sogar ruinieren. Vor allem angesichts der bevorstehenden, heiß umkämpften Wahl am Horizont.
Es war dumm von ihm gewesen, die Vergangenheit als tot und erledigt zu betrachten.
Jetzt schien sie alles zu gefährden.
Es war an der Zeit, dass er sich von Angesicht zu Angesicht damit auseinandersetzte.
Der Wagen fuhr durch Józefa, das auf einem Felshang am Ufer der Weichsel errichtet worden war. Das Städtchen hatte eine lange Geschichte und einen hübschen alten Stadtkern, dazu kamen eine Burgruine und eine Kathedrale. Am bekanntesten war es aber wegen der nahe gelegenen Raffinerie, in der Hunderte von Menschen beschäftigt waren. Das Haus, das er suchte, lag im Süden der Stadt in einer Nebenstraße, die vom Fluss wegführte. Sein Fahrer parkte abseits zwischen den Bäumen, wo der Wagen keine Aufmerksamkeit auf sich ziehen würde. Er stieg aus und ging zur Haustür. Es war ein warmer Abend. Auf ihn wartete ein Mann in einem schwarzen Anzug mit schwarzem Schlips und einem undurchschaubaren Gesichtsausdruck, der angemessen, aber kalt war. Michał Zima. Der Chef des BOR.
Er betrat das Haus.
Es war einfach eingerichtet und sah aus wie das Haus in Südpolen bei Rzeszów, in dem er aufgewachsen war. Seine Eltern waren Bauern und keine Revolutionäre gewesen. Aber in den 1980er-Jahren hatte sich alles verändert. Zu keiner Zeit war privater Grundbesitz erlaubt gewesen. Um die wachsenden Unruhen zu besänftigen, waren der Bevölkerung Besitzrechte durch Kauf oder Erbschaft versprochen worden. Doch das waren alles Lügen gewesen. Schließlich waren seine Eltern und die meisten der anderen Bauern auf die Barrikaden gegangen und hatten sich geweigert, Lebensmittel zu den amtlich festgesetzten, viel zu niedrigen Preisen zu verkaufen. Stattdessen hatten sie ihre Ernte an die Streikenden gestiftet.
Eine mutige Aktion mit großen Auswirkungen.
»Wo ist sie?«
»Draußen.«
»Und die andere?«
Zima machte eine Kopfbewegung. »Da drin.«
»Wie haben Sie das hier gefunden?«
»Mit etwas Glück, genau genommen. Aber das ist manchmal auch alles, was es braucht.«
Es war klar, was der andere ihm sagen wollte. Stellen Sie nicht zu viele Fragen.
Er ließ den Blick durch den Raum schweifen und bemerkte ein paar gerahmte Bilder auf einem Tisch. Ein Foto fiel ihm ins Auge. Er ging hinüber und betrachtete die Fotografie eines Uniformierten, Major der polnischen Armee mit den Abzeichen des SB, des Sicherheitsdienstes, auf seinem Hemd. Er erkannte das unauffällige Gesicht mit dem Bürstenhaarschnitt und dem sorgfältig gestutzten Schnurrbart – es war der Mann aus dem Mokotów-Gefängnis.
Aleksy Dilecki.
Seit Jahrzehnten hatte er von dem Mann nichts gehört und nichts gesehen.
Der Zweite Weltkrieg hatte Polen zerstört, alles war zerbombt gewesen, das Land war völlig ausgeweidet worden, verfügte über keinerlei Mittel und nur wenige übrig gebliebene Arbeitskräfte für den Wiederaufbau. Die Sowjets versprachen eine Wiedergeburt, und viele glaubten ihnen. Aber in den späten 1970er-Jahren waren die Lügen offensichtlich geworden, und die Nation hatte ihre Geduld verloren. Damals war die Wochenarbeitszeit sehr lang gewesen, in den Läden waren nur wenige Lebensmittel zu finden, und es war stets kalt gewesen, weil es an Kohle und Bekleidung einschließlich Mänteln gefehlt hatte. Die Bevölkerung war permanent bespitzelt und mit Propaganda abgespeist worden, man hatte die Kinder einer Gehirnwäsche unterzogen. Das alles unter ständiger Gewaltandrohung. Der Hunger hatte kein Ende genommen, und die Regierung hatte mithilfe von Bezugsscheinen sogar festgelegt, wie viel jeder essen konnte. Wir haben alle die gleichen Mägen. Das hatten viele wiedergekäut. Und wenn die Menschen Hunger hatten und ihre Kinder hungrig waren, dann taten sie alles, um ihre Not zu lindern.
Und so kam es.
Ihm gefiel, was Orwell geschrieben hatte.
Alle Tiere sind gleich, aber manche sind gleicher als die anderen.
Das traf auf Aleksy Dilecki zu.
Politiker und Polizeikräfte waren stets bevorzugt worden. Sie hatten größere Rationen erhalten. Sie hatten in speziellen Läden eingekauft. Ihre Wohnungen waren besser gewesen, und sie hatten Privilegien besessen. Es gab sogar einen Namen für sie: Nomenklatura – ein sowjetischer Begriff für die Posten in der Regierung, die stets für Neuzugänge offen waren. Die Menschen waren nicht aufgrund ihrer Verdienste auserwählt worden, sondern ausschließlich aufgrund ihrer Loyalität zum Regime. So waren sie zu einer – wenn auch nicht erklärten – herrschenden Klasse geworden. Die Rote Bourgeoisie. Korruption und Gewalt hatten dauerhaft zu den Instrumenten ihrer Macht gezählt.
Und er blickte jetzt auf einen ihrer Angehörigen.
Ihm fiel wieder ein, was man vor vielen Jahren im Mokotów-Gefängnis gesagt hatte:
Wer weiß? Vielleicht wird eines Tages noch eine große Nummer aus Ihnen.
Er schüttelte den Kopf über diese Ironie. Gut, dass Dilecki tot war.
»Kannten Sie ihn?«, fragte Zima.
Er hatte nur eine einzige Person in die relevanten Details der Geschichte eingeweiht, und Zima war es nicht gewesen. »Zeigen Sie mir, was Sie gefunden haben.«
Er stellte das Foto wieder auf den Tisch und folgte Zima in einen kleinen Lagerraum, der mit Überbleibseln der Familiengeschichte vollgestellt war. Sein Blick fiel auf zwei verrostete Aktenschränke.
»Die sind voller Dokumente«, sagte Zima. »Berichte, Korrespondenzen, Memoranden. Alles aus den späten 1970er-Jahren bis 1990. Unzusammenhängende Daten und Vorfälle. Dahinter steckte kein richtiges Muster. Dilecki arbeitete lange für den Sicherheitsdienst. Er muss Zugang zu vielen Geheimnissen gehabt haben. Anscheinend hat er einiges davon verschwinden lassen, als es mit den Kommunisten zu Ende ging.«
In der chaotischen Zeit nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der Wiederauferstehung der polnischen Republik war sehr viel verloren gegangen. Heute interessierten sich nur wenige für die Vergangenheit. Alle waren einfach froh, dass es vorbei war. Die Zukunft schien das Einzige zu sein, was zählte. Doch solche Kurzsichtigkeit war ein Fehler.
Denn Geschichte spielte eine Rolle.
»Hat jemand diese Akten durchgesehen?«, fragte er.
»Nur ich. Und ich habe es mir nur schnell und oberflächlich angesehen. Nur so weit, bis ich sah, dass es das sein könnte, wonach Sie suchen.«
Er war neugierig. »Woher wissen Sie, dass ich nach etwas suche?«
»Das tue ich nicht. Ich vermute es nur, nach allem, was ich bisher weiß.«
Er sollte nachforschen, wie viel dieser Mann wusste. Aber nicht jetzt. »Lassen Sie den gesamten Inhalt dieser beiden Aktenschränke in den Kofferraum des Autos laden, mit dem ich gekommen bin.«
Zima nickte bestätigend.
»Hat Dileckis Witwe irgendwelche von diesen Dokumenten verkauft?«, wollte er wissen.
»Nein. Ihr Sohn hat das getan. Wir haben ihn in Untersuchungshaft.«
Das war eine neue Information.
»Wir haben ihn vor ein paar Stunden verhaftet.« Zima machte ihm ein Zeichen, und er folgte ihm ins Wohnzimmer. Auf dem Sofa lag eine blaue Nylonreisetasche. Zima öffnete den Reißverschluss, und man sah bündelweise Zlotys. »Eine halbe Million. Das haben wir in der Wohnung des Sohnes sichergestellt.«
Jetzt bekam alles einen Sinn. Die Eltern waren gute, loyale Kommunisten gewesen und der Sohn eher nicht. Es waren Jahrzehnte vergangen. Den Vater gab es nicht mehr, und die Mutter wurde immer älter. In den beiden Aktenschränken lag möglicherweise der Schlüssel, der alles änderte, insbesondere wenn in einigen der Dokumente der Name Janusz Czajkowski auftauchen würde. Man musste nur einen Käufer dafür finden.
»Hat der Sohn etwas ausgesagt?«
Zima nickte. »Er hat einen Handel mit einem Mann namens Vic DiGenti gemacht, der als Kompagnon von Jonty Olivier bekannt ist.«
»Sie sprechen seinen Namen aus, als würden Sie ihn kennen.«
»Das tun wir. Er geht mit Informationen hausieren. Gar nicht so unzuverlässig. Unsere Nachrichtendienste haben gelegentlich auf ihn zurückgegriffen. Die Mutter hatte keine Ahnung, was ihr Sohn trieb. Sie fand es erst gestern Abend heraus, als er ihr etwas von dem Geld anbot. Sie war alles andere als davon erbaut. Es gab eine ziemlich heftige Auseinandersetzung. Das war, wenige Stunden bevor wir ihn festgenommen haben.«
»Zeigen Sie mir den Rest«, sagte er.
Zima führte ihn durch die Hintertür zu einer kleinen Scheune mit einem verrosteten Wellblechdach. Bäume und Buschwerk schirmten das Gebäude von der nahen Schnellstraße ab. Das Scheunentor hing geöffnet in den Angeln, und er ging hinein. Eine schwache elektrische Funzel durchdrang die Dunkelheit. Hier gab es nicht viel zu sehen. Ein paar Werkzeuge, eine Schubkarre, ein altes, verrostetes Auto und eine Frau, die an einem der Balken hing. Ihre Arme hingen schlaff herunter, und ihr Hals hatte sich verdreht, als sie starb.
»Sie hat es in der Nacht getan«, sagte Zima, eigentümlich berührt. »Vielleicht, nachdem sie von der Verhaftung ihres Sohnes erfuhr. Oder vielleicht aus einer Art Loyalität gegenüber ihrem Ehemann. Das werden wir nie erfahren.«
Sie war anscheinend auf das alte Auto geklettert, hatte ein kurzes Stück Seil verknotet und war dann in die Ewigkeit abgetreten.
Er schüttelte den Kopf.
Jetzt hing alles von Belgien ab.
6
Cotton saß in der Zelle, noch nass von seiner Schwimmeinlage im Kanal. Er sollte wirklich duschen, auch wenn das hier nicht das Vierjahreszeiten war. Aber für eine Zelle war es gar nicht so schlecht. Geräumig. Sauber. Mit einer funktionierenden Toilette. Er war schon viel schlimmer eingesperrt gewesen.
Das kam also dabei heraus, wenn man der katholischen Kirche etwas schuldig war. Oder zu sein glaubte?
Es war fast 19 Uhr. Er war hier schon stundenlang allein. Die Brügger Polizisten waren nicht in Bestlaune gewesen, als sie ihn aus dem Kanal gefischt hatten. Sie hatten ihm gleich die Hände mit Handschellen hinter dem Rücken gefesselt und versucht, ihn zu verhören. Aber er wusste, wann es besser war, den Mund zu halten. Selbstverständlich würde er früher oder später Erklärungen abgeben müssen. Hoffentlich erzählte ihnen der Priester aus der Basilika, dass er ihn gebeten hatte, die Verfolgung der Diebe aufzunehmen. Bis jetzt wussten sie von ihm nur, dass er ein Boot gestohlen und damit im Kanal einen Unfall hatte, denn beim Eintreffen der Polizei hatte niemand mehr geschossen, und die drei Amigos waren weg gewesen.
Er war das einzige Problem.
Die Polizei hatte ihm die Brieftasche abgenommen. Sein Pass befand sich im Hotel. Aber sie wussten zumindest seinen vollen Namen, Harold Earl Malone. Der Spitzname Cotton stand nirgendwo in seiner dänischen Fahrerlaubnis und auf keinem anderen offiziellen Dokument. Er wurde oft gefragt, woher der Spitzname kam, und er antwortet jedes Mal dasselbe: Das ist eine lange Geschichte. Und das war es auch. Sein Vater spielte darin eine Rolle. Er erinnerte sich noch an den Tag, als er zehn Jahre alt gewesen war und die beiden Marineoffiziere zu ihrem Haus gekommen waren und ihm und seiner Mutter mitgeteilt hatten, dass das U-Boot seines Vaters mit Mann und Maus untergegangen war. Es hatte keine Leichen und keine Beerdigung gegeben. Alles hatte der Geheimhaltung unterlegen. Er hatte fast vier Jahrzehnte gebraucht, bis er die Wahrheit herausgefunden hatte, und diese Erfahrung hatte ihn äußerst misstrauisch gegen die Behörden auf allen Ebenen gemacht.
Was etwas besser erklärte, weshalb er sich bisher nicht geäußert hatte.
Er hoffte, dass er mit der Wahrheit am weitesten kommen würde, wenn es so weit war – und mehr hatte er schließlich nicht, mit dem er arbeiten konnte. Inzwischen wusste die Polizei von Brügge mit Sicherheit von dem Diebstahl. Das Heilige Blut war das wichtigste Objekt in der Stadt. Jährlich kamen Hunderttausende, um es zu sehen. Seit dem 14. Jahrhundert wurde es alljährlich in einer großen Prozession durch die Stadt getragen. Doch wenn sie wussten, dass es weg war, wieso waren sie dann nicht für eine kleine Unterhaltung zu ihm gekommen? Denn sie interessierten sich doch bestimmt dafür, was er wusste.
Vielleicht aber auch nicht.
Ein Scheppern riss ihn aus seinen Gedanken.
Eine der Metalltüren weiter unten im Flur ging auf und wieder zu.
Schritte kamen hallend näher. Ein langsames, gleichmäßiges Klacken.
Er blickte auf und sah eine Frau.
Sie war zierlich, hatte eine selbstbewusste Miene; ihr dunkles Haar war von einzelnen silbernen Strähnen durchzogen. Sie war Mitte sechzig, auch wenn er wusste, dass in ihrer Personalakte im Justizministerium, die er einmal gesehen hatte, an der Stelle, wo das Geburtsdatum stehen sollte, nur N/A stand. Jeder hatte einen wunden Punkt. Bei ihr war es das Alter. Zwei Präsidenten hatten versucht, sie zur Justizministerin zu machen, aber sie hatte beide Angebote abgelehnt. Warum? Wer konnte das sagen? Sie hatte ihren eigenen Kopf. Und das machte sie richtig gut in dem, was sie tat.
Er stand auf und ging zu den Gitterstäben. »Haben wir uns nicht so kennengelernt?«
Stephanie Nelle lächelte und nickte. »Ich erinnere mich. Es war im Stadtgefängnis von Duval.«
Er grinste. »Ich war ein ambitionierter Marineanwalt.«
»Der gerade eine Frau erschossen hatte.«
»Kommen Sie! Sie hatte zuerst geschossen und wollte mich umbringen.«
»Und jetzt stehen wir hier, so viele Jahre später, und Sie haben ein gestohlenes Boot in die Kanalmauer gefahren. Sie scheinen den Ärger förmlich anzuziehen.«
»Was ist mit den drei Dieben und dem Reliquiar, das sie gestohlen haben?«
»Das ist der springende Punkt, Cotton. Es gibt keinen Diebstahl.«
Diese Eröffnung überraschte ihn. Dann begriff er: »Haben Sie die Sache gedeckelt?«
Sie nickte. »Ich war in unserer Botschaft in Brüssel, als der Anruf der Polizei hereinkam. Sie hatten herausgefunden, dass Sie einer von uns sind, und stellten über Atlanta Nachforschungen an. Das Büro setzte sich daraufhin mit mir in Verbindung. Ich hatte natürlich keine Ahnung, dass Sie hier sind, aber ich habe mich trotzdem für Sie eingesetzt.«
Er zuckte mit den Schultern. »Zur rechten Zeit am falschen Platz. Ich war nur zufällig da. Aber die Diebe wussten genau, was sie taten. Die ganze Sache war durchgeplant.«
»Und weiter?«
Er erzählte, was sich in der Basilika und danach zugetragen hatte. Sie auf einer Seite der Gitterstäbe, er auf der anderen. Als er zum Ende gekommen war, fragte er: »Was tun Sie eigentlich in Brüssel?«
»Die Antwort auf diese Frage hat einen Preis.«