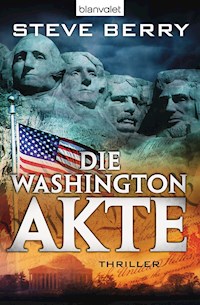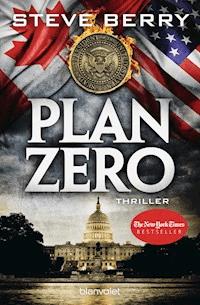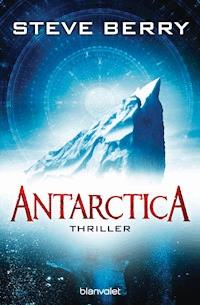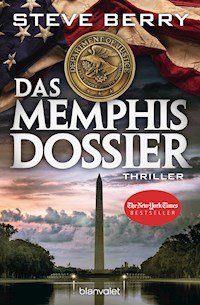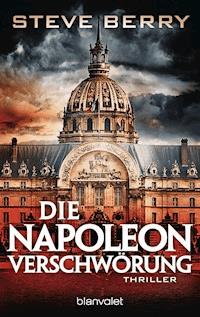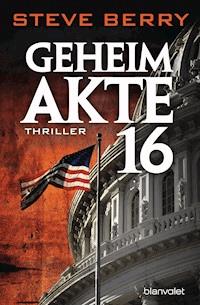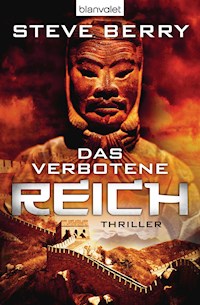
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Cotton Malone
- Sprache: Deutsch
Ein Geheimnis, das die Welt für immer verändert!
Ex-Geheimagent Cotton Malone wird jäh aus seinem friedlichen Leben gerissen, als ihn ein Video erreicht, auf dem seine Bekannte Cassiopeia Vitt gefoltert wird. Als Lösegeld fordern die Entführer eine antike Öllampe. Sie beweist die gefährliche Theorie eines russischen Wissenschaftlers über die Ölreserven der Erde – und liegt tief verborgen in den Grabkammern des ersten chinesischen Kaisers. Die Suche danach wird für Malone zum tödlichen Wettlauf gegen die Entsandten der Mächtigsten der Welt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 619
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Buch
Cotton Malone, ehemaliger Geheimagent der USA und derzeit Buchhändler in Kopenhagen, erhält per E-Mail einen Link zu einem Livestream. Darauf ist zu sehen, wie seine gute Bekannte Cassiopeia Vitt gefoltert wird. Sie verbindet eine gemeinsame Vergangenheit, und Cotton Malone ist klar, dass er sie retten muss.
Auf der Suche nach Cassiopeia stößt er auf ein Geheimnis, das im Zusammenhang mit einer antiken Öllampe steht – und mit den ehrgeizigen Plänen der Mächtigsten der Welt. Auch der russische Geheimdienst ist hinter dem legendären Objekt her, ebenso wie die Schergen der beiden machthungrigen Männer, die im Wettkampf um die Macht über China stehen – und die dafür zu allem bereit wären.
Autor
Steve Berry war viele Jahre erfolgreich als Anwalt tätig, bevor er seine Leidenschaft für das Schreiben entdeckte. Mit jedem seiner spannenden Thriller stürmt er in den USA die Spitzenplätze der Bestsellerlisten. Steve Berry lebt mit seiner Frau und seiner Tochter in Camden County, Georgia.
Bei Blanvalet von Steve Berry lieferbar:
Das verbotene Reich (37864)
Der Korse (37676)
Antarctica (37335)
Alpha et Omega (36781)
Die Romanow-Prophezeiung (37295)
Urbi et Orbi (37452)
Steve Berry
Das verbotene Reich
Thriller
Aus dem Amerikanischen
von Barbara Ostrop
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2010 unter dem Titel
»The Emperor’s Tomb« bei Ballantine Books, New York.
Deutsche Erstveröffentlichung August 2012 bei Blanvalet,
einem Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, München.
Copyright © der Originalausgabe 2010 by Steve Berry
This translation published by arrangement with Ballantine Books,
an imprint of The Random House Publishing Group,
a division of Random House, Inc.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2012 by Blanvalet,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
Copyright © der Landkarte 2010 by David Lindroth, Inc.
Umschlaggestaltung: Johannes Frick
Umschlagmotiv: Corbis/Yi Lu; Getty Images/Stone/Ed Freeman;
Getty Images/Vetta/Ilya Terentyev
Redaktion: Werner Bauer
ES · Herstellung: sam
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-07593-4V002
www.blanvalet.de
Für Fran Downing, Frank Green, Lenore Hart,
David Poyer, Nancy Pridgen,
Clyde Rogers und Daiva Woodworth
Allesamt außerordentliche Lehrer
Studiere die Vergangenheit, wenn du die Zukunft gestalten willst.
– Konfuzius
Geschichte hat etwas Jungfräuliches. Du kannst sie kleiden, wie es dir gefällt.
– Chinesisches Sprichwort
Alle Länder, große wie kleine, haben einen Fehler gemein: Der Herrscher ist von unwürdigen Leuten umgeben. Wer Herrscher lenken will, sollte zuerst deren geheime Ängste und Wünsche erkunden.
– Han Fei Tzu, 3. Jahrhundert v. Chr.
Zeittafel relevanter Ereignisse der chinesischen Geschichte
1765 – 1027 v. Chr.:
Shang-Dynastie (früheste bekannte Dynastie)
770 – 481 v. Chr.
Zeit der Frühlings- und Herbstannalen
551 – 479 v. Chr.
Lebenszeit des Konfuzius
535 v. Chr.
Ursprung des Eunuchensystems
481 – 221 v. Chr.
Zeit der Streitenden Reiche und Entstehung des Legalismus
221 v. Chr.
Qin Shi vereinigt die Streitenden Reiche zu China und wird Erster Kaiser
210 v. Chr.
Tod Qin Shis; die Terrakotta-Armee wird fertiggestellt und mit dem Ersten Kaiser im kaiserlichen Grabhügel bestattet
200 v. Chr. Erste chinesische Ölbohrung
146 v. Chr. – 67 n. Chr.
Das Eunuchensystem weitet sich zu einer politischen Kraft aus
89 v. Chr.
Sima Qian vollendet dieAufzeichnungen des Historikers (Shiji)
202 n. Chr. – 1912 n. Chr.
Verschiedene chinesische Dynastien
1912 n. Chr.
Letzter Kaiser wird zur Abdankung gezwungen; das Kaiserreich endet; das Eunuchensystem wird abgeschafft; die Republik China wird gegründet
1949 n. Chr.
Kommunistische Revolution; die Volksrepublik China wird gegründet
1974 n. Chr.
Die Terrakotta-Armee wird wiederentdeckt
1976 n. Chr.
Tod Mao Zedongs
Prolog
Nordgebiete, Pakistan
Freitag, 18. Mai
08.10 Uhr
Eine Kugel zischte an Cotton Malone vorbei. Er warf sich auf den steinigen Boden und suchte so gut wie es ging hinter den spärlich stehenden Pappeln Deckung. Cassiopeia Vitt tat das Gleiche; auf dem Bauch krochen sie über das scharfkantige Geröll zu einem Felsbrocken, der groß genug war, um ihnen beiden Schutz zu bieten.
Weitere Schüsse peitschten vorbei.
»Das wird allmählich ernst«, sagte Cassiopeia.
»Meinst du?«
Er wollte es noch nicht so recht glauben, denn bisher war nicht viel passiert. Sie waren hier von der größten Ansammlung hoch aufragender Berggipfel der Erde umgeben. Hier war das Dach der Welt, zweitausend Meilen von Peking entfernt in der äußersten südwestlichen Ecke von Chinas autonomem Gebiet Xinjiang – oder den Nordgebieten Pakistans, je nachdem, wen man fragte. Denn genau hier lag eine heiß umstrittene Grenze.
Was die Soldaten erklärte.
»Das sind keine Chinesen«, sagte sie. »Eindeutig Pakistani.«
Zerklüftete, schneebedeckte Gipfel, sechstausend Meter hoch, beschirmten Gletscher, grünschwarze Waldgebiete und fruchtbare Täler. Himalaya, Karakorum, Hindukusch und Pamir – diese vier Gebirgszüge trafen hier zusammen. Dies war das Land der schwarzen Wölfe und des blauen Mohns, der Steinböcke und der Schneeleoparden. Wo Feen sich trafen, so erinnerte Malone die Beschreibung eines längst verstorbenen Beobachters. Vielleicht lag hier sogar die Anregung für James Hiltons Shangri-la: ein Paradies für Trekking, Bergsteigen, Rafting und Skifahren. Unglückseligerweise beanspruchten sowohl Indien als auch Pakistan dieses Gebiet für sich, doch China hielt es in Besitz, und alle drei Regierungen stritten sich seit Jahrzehnten um die einsame Region.
»Sie scheinen zu wissen, wohin wir wollen«, sagte sie.
»Der Gedanke ist mir auch schon gekommen.« Er konnte es sich nicht verkneifen hinzuzufügen: »Ich hab dir ja gesagt, dass er ein Problem ist.«
Sie trugen Lederjacken, Jeans und Stiefel. Obwohl sie sich fast dreitausend Meter über dem Meeresspiegel befanden, war die Luft überraschend mild. Vielleicht fünfzehn Grad, schätzte er. Glücklicherweise hatten sie beide chinesische halbautomatische Pistolen und ein paar Ersatzmagazine dabei.
»Wir müssen da entlang.« Er zeigte nach hinten. »Und diese Soldaten sind uns nah genug, um zu treffen.«
Er durchforstete sein eidetisches Gedächtnis nach dem, was sie brauchten. Gestern hatte er sich mit dem geografischen Material über die Umgebung vertraut gemacht und festgestellt, dass dieses Fleckchen Erde, das nicht viel größer war als der Bundesstaat New Jersey, einmal den Namen Hunza getragen hatte. Es war neunhundert Jahre lang ein Fürstentum gewesen, hatte seine Unabhängigkeit aber in den 1970ern verloren. Die hellhäutigen und helläugigen Einheimischen behaupteten, die Nachfahren der Soldaten Alexanders des Großen zu sein, der das Gebiet zweitausend Jahre zuvor mit seinem griechischen Heer erobert hatte. Wer konnte das schon wissen? Das Land war über Jahrhunderte isoliert gewesen, bis in den 1980er Jahren der Karakorum Highway gebaut worden war, der China mit Pakistan verband.
»Wir müssen darauf vertrauen, dass er es hinkriegt«, sagte sie schließlich.
»Du hast zuletzt mit ihm geredet, nicht ich. Geh du voran, ich gebe dir Deckung.«
Er griff nach der chinesischen Double-Action-Pistole. Keine schlechte Waffe: fünfzehn Schuss und recht treffgenau. Cassiopeia machte sich ebenfalls bereit. Das mochte er an ihr – sie stellte sich jeder Situation. Sie waren ein gutes Team, und diese bemerkenswerte Hispano-Araberin faszinierte ihn wirklich.
Sie hastete los, auf ein Wacholdergebüsch zu.
Er zielte mit der Pistole über den Felsbrocken hinweg und machte sich bereit, auf die winzigste Bewegung zu reagieren. Rechts von ihm, in dem grabähnlichen Licht, das jetzt, im Frühjahr, durch die Baumblätter hindurchsickerte, erhaschte er einen Blick auf einen Gewehrlauf, der um einen Baumstamm herum zielte.
Schuss!
Der Gewehrlauf verschwand.
Malone beschloss, die Gelegenheit zu nutzen, und folgte Cassiopeia. Dabei achtete er darauf, dass der Felsbrocken zwischen ihm und ihren Verfolgern blieb.
Als er bei ihr war, rannten sie im Schutz der Bäume gemeinsam weiter.
Das scharfe Knallen von Gewehrschüssen ertönte. Kugeln zischten an ihnen vorbei.
Der Pfad wand sich aus dem Wald hinaus aufwärts, steil, aber doch so, dass man ihn noch erklimmen konnte. Er führte auf einem Abhang von losen Felsbrocken an einer Felswand entlang. Hier gab es nicht viel Deckung, aber ihnen blieb keine Wahl. Hinter dem Pfad erblickte er Schluchten, die so tief und steil waren, dass das Licht hier nur mittags eindringen konnte. Rechts von ihnen stürzten die Felswände einer Klamm hinab. Sie rannten an ihrem Rand entlang. Dreißig Meter weiter unten rauschte und strudelte das Wasser, grau von Sand, und warf schaumige Gischt hoch in die Luft.
Sie kletterten die steile Böschung hinauf.
Dann erblickte Malone die Brücke.
Sie befand sich genau dort, wo man es ihnen gesagt hatte.
Von einem Brückenbogen konnte keine Rede sein. Die Brücke bestand einfach nur aus ein paar wackeligen Pfählen, die auf beiden Seiten senkrecht zwischen Felsbrocken eingekeilt worden waren. Waagerecht verlaufende Planken waren mit dicken Hanfseilen daran befestigt. Ein Pfad aus Brettern, der über dem Fluss hing.
Cassiopeia kam oben bei der Brücke an. »Wir müssen hinüber.«
Diese Aussicht gefiel ihm nicht, aber sie hatte recht. Ihr Ziel lag auf der anderen Seite.
Aus der Ferne waren Schüsse zu hören, doch Soldaten waren nicht zu sehen.
Das bereitete ihm Sorgen.
»Vielleicht führt er sie ja weg«, mutmaßte sie.
Er war immer noch misstrauisch und abwehrend, aber sie hatten jetzt keine Zeit für lange Diskussionen. Er steckte die Waffe in die Tasche. Cassiopeia tat dasselbe und trat dann auf die Brücke hinaus.
Er folgte ihr.
Die Bretter vibrierten von der Gewalt des unten vorbeirauschenden Wassers. Er schätzte, dass es keine dreißig Meter bis zur anderen Seite waren, aber sie würden ohne jede Deckung über dem Abgrund hängen und zudem noch aus dem Schatten ins Sonnenlicht treten. Auf der anderen Seite war die Fortsetzung des Pfades zu sehen, der über Geröll wieder in einen Wald hineinführte. Er erblickte eine Figur, vielleicht fünf Meter hoch, die hinter dem Pfad in die Felswand gehauen war – eine Buddhastatue, genau wie man es ihnen beschrieben hatte.
Cassiopeia drehte sich zu ihm um. Aus ihrem europäischen Gesicht sahen ihn orientalische Augen an. »Diese Brücke hat schon bessere Tage gesehen.«
»Ich hoffe, dass ihr noch wenigstens ein weiterer davon bleibt.«
Sie griff nach den gedrehten Seilen, die die Hängebrücke hielten.
Er schloss ebenfalls die Finger um die groben Fasern und entschied dann: »Ich gehe voraus.«
»Und warum?«
»Ich bin schwerer. Wenn die Brücke mich trägt, trägt sie dich auch.«
»Da ich dieser Logik nicht widersprechen kann«, sie trat zur Seite, »nur zu.«
Er übernahm die Führung, seine Füße gewöhnten sich an die stetige Vibration.
Von Verfolgern war nichts zu sehen.
Er beschloss, dass er besser rasch ausschritt, da die Planken so keine Zeit hatten, in Schwingung zu geraten. Cassiopeia folgte ihm.
Unbekannte Töne überlagerten das Rauschen des dahinbrausenden Wassers.
Tiefe Basstöne. Weit entfernt, aber sie wurden lauter.
Wumm. Wumm. Wumm.
Er riss den Kopf nach rechts und erhaschte einen ersten Blick auf einen Schatten, der auf eine Felswand fiel. Dort, etwa eine Meile entfernt, stieß die Klamm, die sie überquerten, auf eine weitere Schlucht, die senkrecht dazu verlief.
Sie hatten nun die Hälfte geschafft, und es sah so aus, als würde die Brücke halten, auch wenn die modrigen Planken nachgaben wie ein Schwamm. Mit der Hand hielt er das grobe Hanfseil locker umfasst, doch er war bereit, es auf Leben und Tod zu umklammern, sollten die Planken unter ihm wegbrechen.
Der ferne Schatten wuchs zum unverkennbaren Umriss eines AH-1-Cobra-Kampfhubschraubers heran.
Eine amerikanische Maschine, aber das musste noch nicht unbedingt Rettung bedeuten.
Auch Pakistan verfügte über diese Hubschrauber. Washington lieferte sie als Militärhilfe an das Land, das es als Verbündeten im Kampf gegen den Terrorismus betrachtete.
Der Cobra flog direkt auf sie zu. Er verfügte über einen Zweiblattrotor und Doppelturbinen und war mit 20-mm-Kanonen, Panzerabwehrraketen und Luft-Luft-Lenkwaffen ausgestattet. Schnell wie eine Hummel und ebenso wendig.
»Der ist nicht hier, um uns zu helfen«, hörte er Cassiopeia sagen.
Er war derselben Meinung, aber es war nicht nötig, laut auszusprechen, dass er die ganze Zeit recht gehabt hatte. Sie waren genau aus diesem Grund hierhergetrieben worden.
Der verdammte Drecksack …
Der Cobra eröffnete das Feuer.
Lautes Knallen, dann flogen 20-mm-Geschosse auf sie zu.
Malone warf sich bäuchlings auf die Brückenplanken, rollte sich ab und sah zwischen den Beinen hindurch, dass Cassiopeia dasselbe tat. Der Cobra kam donnernd näher, seine Wellenturbinen saugten sich durch die trockene, klare Luft. Einige Geschosse trafen die Brücke und zerfetzten Holz und Seil mit großer Wucht.
Ein weiterer Feuerstoß peitschte heran.
Er war auf die drei Meter große Lücke zwischen Malone und Casssiopeia gerichtet.
Er erblickte Jähzorn in ihren Augen und sah, wie sie nach ihrer Waffe griff, sich auf die Knie aufrichtete und auf die Cockpitverglasung des Helikopters schoss. Aber er wusste, dass die Panzerung und die Geschwindigkeit des Hubschraubers – mehr als 270 km/h – ihre Chance, irgendeinen Schaden anzurichten, auf null reduzierte.
»Verdammt, runter mit dir!«, schrie er.
Der Feuerstoß vernichtete das Brückenstück zwischen ihm und Cassiopeia. Von einem Moment auf den anderen war von der Holz-Seil-Konstruktion nur noch eine Trümmerwolke übrig.
Im Bruchteil einer Sekunde begriff Malone, dass die ganze Brücke in die Tiefe krachen würde. Er konnte nicht zurück, also rannte er die letzten sechs Meter vor und klammerte sich an den Seilen fest, während die Brücke unter ihm wegstürzte.
Der Cobra flog, der Klamm folgend, vorbei.
Malone klammerte sich an den Seilen fest, und als die Brücke in zwei Teile zerriss und jede Hälfte zu ihrer Seite der Klamm hinüberschwang, flog er durch die Luft.
Er krachte gegen den Felsen, prallte zurück und hing dann einfach nach unten. Doch er ließ sich gar nicht erst Zeit, Angst zu kriegen. Langsam zog er sich nach oben und kletterte die letzten wenigen Meter zum Rand der Klamm hinauf. Das Rauschen des Wassers und das Wummern der Hubschrauberrotoren füllten seine Ohren. Er spähte zur anderen Seite der Klamm, suchte sie nach Cassiopeia ab und hoffte, dass sie es den Felsen hinauf schaffen würde.
Der Mut verließ ihn, als er sah, dass sie sich mit beiden Händen an der anderen Hälfte der Brücke festklammerte, die an der Steilwand herunterbaumelte. Er hätte ihr gerne geholfen, doch gab es nichts, was er hätte tun können. Sie war gut dreißig Meter entfernt. Zwischen ihnen war nichts als Luft.
Der Cobra flog eine enge Wende in der Klamm, zog nach oben und kam wieder auf sie zu.
»Kannst du hochklettern?«, schrie er über den Lärm hinweg.
Sie schüttelte den Kopf.
»Tu es!«, brüllte er.
Sie reckte den Hals zu ihm herum. »Verschwinde hier.«
»Nicht ohne dich.«
Der Cobra war nicht mehr weit entfernt. Gleich würden seine Kanonen wieder losfeuern.
»Klettern!«, schrie er.
Sie streckte eine Hand nach oben aus.
Dann stürzte sie fünfzehn Meter in den tosenden Fluss hinunter.
Wie tief er war, wusste Malone nicht, aber die Felsbrocken, die immer wieder aus dem Flusslauf herausragten, trösteten ihn nicht gerade.
Sie verschwand im schäumenden Wasser, das eiskalt sein musste, da es von Gebirgsschnee gespeist wurde.
Er wartete darauf, dass sie irgendwo auftauchte.
Doch das geschah nicht.
Malone starrte auf das brüllende graue Wildwasser hinunter, das Sand und Geröll inmitten brodelnder Gischt in einem reißenden Strom dahinschwemmte. Er wäre ihr am liebsten nachgesprungen, begriff aber, dass das unmöglich war. Er würde den Sturz ebenso wenig überleben.
Er stand einfach nur da und sah ungläubig hin.
Nach allem, was sie in den vergangenen drei Tagen durchgemacht hatten!
Doch Cassiopeia Vitt war verschwunden.
ERSTER TEIL
Drei Tage zuvor
1
Kopenhagen, Dänemark
Dienstag, 15. Mai
12.40 Uhr
Cotton Malones Finger zitterten, als er die Web-Adresse eingab. Mit einer anonymen Botschaft war es wie mit einem Telefon, das mitten in der Nacht klingelte: Sie bedeutete niemals etwas Gutes.
Die Nachricht war zwei Stunden zuvor eingetroffen, als er sein Buchantiquariat verlassen hatte und mit einer Besorgung unterwegs gewesen war. Die Angestellte, die den unbeschrifteten Umschlag entgegengenommen hatte, hatte vergessen, ihn Malone zu geben, und erst vor ein paar Minuten wieder daran gedacht.
»Die Frau hat nicht gesagt, dass es dringend wäre«, hatte sie zu ihrer Verteidigung gesagt.
»Was für eine Frau?«
»Eine Chinesin. Hat einen tollen Burberry-Rock getragen. Sagte, ich dürfe den Umschlag nur Ihnen geben.«
»Sie hat meinen Namen verwendet?«
»Zwei Mal.«
Im Inneren des Umschlags hatte ein gefaltetes Blatt graues Velinpapier gelegen, auf das eine Web-Adresse mit der Endung .org gedruckt gewesen war. Er war sofort die vier Treppen zu seiner Wohnung über dem Buchladen hinaufgestiegen und hatte sich sein Notebook gegriffen.
Jetzt tippte er die letzten Buchstaben ein und wartete ab, während der Bildschirm schwarz wurde. Dann erschien ein neues Bild. Ein Videofenster zeigte, dass gleich ein Livestream laufen würde.
Die Verbindung wurde hergestellt.
Jemand war zu sehen, der mit über dem Kopf ausgestreckten Armen auf dem Rücken lag, Hand- und Fußgelenke straff an etwas gefesselt, das wie ein Sperrholzbrett aussah. Die Person lag schräg, so dass der Kopf sich etwas tiefer befand als die Füße. Ein Handtuch verhüllte das Gesicht, aber es war unverkennbar, dass die gefesselte Gestalt eine Frau war.
»Mr. Malone.« Die Stimme war elektronisch verändert und ließ weder Tonfall noch Stimmhöhe erkennen. »Wir haben auf Sie gewartet. Eilig hatten Sie es ja nicht gerade, oder? Ich habe etwas, das Sie sehen sollten.«
Eine mit einer Kapuze verhüllte Gestalt tauchte auf dem Bildschirm auf, einen Plastikeimer in der Hand. Malone sah zu, wie Wasser über das Tuch geleert wurde, das auf dem Gesicht der Gefesselten lag. Ihr Körper bäumte sich auf und sie kämpfte mit ihren Fesseln.
Er wusste, was da geschah.
Das Wasser durchtränkte das Handtuch und floss ungehindert in Mund und Nase. Anfangs konnte man noch ein wenig nach Luft schnappen – mit verengter Kehle inhalierte man nur wenig Wasser –, aber das ließ sich nur ein paar Sekunden aufrechterhalten. Dann setzte der natürliche Würgereflex ein, und die Kontrolle ging vollständig verloren. Der Kopf war abgesenkt, so dass die Schwerkraft die Qual verlängerte. Es war wie Ertrinken, obwohl man gar nicht unter Wasser getaucht wurde.
Der Mann hörte auf zu gießen.
Die Frau bäumte sich immer noch gegen ihre Fesseln auf.
Die Technik reichte bis zur Inquisition zurück. Sie war sehr beliebt, da sie keine Spuren hinterließ, doch ihr Hauptnachteil war ihre Härte – die Qualen waren so intensiv, dass das Opfer sofort alles und jedes gestand. Malone hatte die Methode tatsächlich einmal vor Jahren während seiner Ausbildung zum Agenten des Magellan Billet am eigenen Leib erfahren. Im Rahmen eines Überlebenstrainings waren alle Rekruten nacheinander an die Reihe gekommen. Seine Abneigung gegen die Beschränkung seiner Bewegungsfreiheit hatte seine Qualen noch verstärkt. Die Fesseln in Verbindung mit dem durchtränkten Tuch hatten einen unerträglichen Anfall von Klaustrophobie ausgelöst. Er erinnerte sich an die öffentliche Debatte, die vor ein paar Jahren stattgefunden hatte, ob Waterboarding Folter sei.
Verdammt, das war es!
»Der Zweck meiner Kontaktaufnahme ist folgender«, sagte die Stimme.
Die Kamera zoomte dicht an das Tuch heran, das das Gesicht der Frau bedeckte. Eine Hand erschien im Bild und zerrte den durchnässten Stoff weg. Cassiopeia Vitt kam zum Vorschein.
»O nein«, murmelte Malone.
Angst bohrte sich wie mit Pfeilen in sein Herz. Ihn überkam Schwindel.
Das kann nicht wahr sein.
Nein.
Sie blinzelte das Wasser aus ihren Augen, spuckte Wasser aus und schöpfte Atem. »Gib ihnen verdammt nochmal gar nichts, Cotton. Nichts.«
Das durchnässte Handtuch wurde ihr wieder aufs Gesicht geklatscht.
»Das wäre nicht klug«, sagte die elektronische Stimme. »Gewiss nicht für Ihre Freundin.«
»Können Sie mich hören?«, fragte Malone ins Mikrofon des Notebooks.
»Natürlich.«
»Muss das wirklich sein?«
»Für Sie? Ich glaube schon. Sie sind ein respekteinflößender Mann. Ein ehemaliger Agent des Justizministeriums. Top ausgebildet.«
»Ich bin ein Buchhändler.«
Die Stimme lachte. »Verkaufen Sie mich nicht für dumm und gefährden Sie das Leben dieser Lady nicht länger. Ich möchte, dass Sie glasklar verstehen, was auf dem Spiel steht.«
»Und Sie müssen verstehen, dass ich Sie umbringen kann.«
»Bis dahin ist Ms. Vitt tot. Also, Schluss mit der gespielten Tapferkeit. Ich will das, was sie Ihnen gegeben hat.«
Er sah, dass Cassiopeia ihren Kampf gegen die Fesseln wieder aufnahm. Ihr Kopf unter dem Tuch fegte hin und her.
»Gib ihm nichts, Cotton. Das meine ich ernst. Ich habe es dir gegeben, damit du es sicher aufbewahrst. Gib es nicht her.«
Wiederholt wurde Wasser über das Tuch gegossen. Ihr Protest verstummte, da sie um Atem kämpfte.
»Bringen Sie den Gegenstand um vierzehn Uhr in den Tivoli. Der Treffpunkt ist vor der chinesischen Pagode. Man wird Sie ansprechen. Sollten Sie nicht auftauchen …« Die Stimme verstummte kurz. »Ich denke, Sie können sich die Folgen denken.«
Die Verbindung wurde unterbrochen.
Nachdenklich lehnte er sich auf seinem Stuhl zurück.
Er hatte Cassiopeia seit über einem Monat nicht mehr gesehen. Seit zwei Wochen hatte er nicht mehr mit ihr gesprochen. Sie hatte gesagt, sie werde eine Reise unternehmen, hatte aber, typisch für sie, nichts Näheres erzählt. Ihre Beziehung konnte man kaum so nennen. Es war nur eine wechselseitige Anziehung, die sie beide stillschweigend anerkannten. Sonderbarerweise hatte Henrik Thorvaldsens Tod sie einander näher gebracht, und in den Wochen nach der Beerdigung ihres gemeinsamen Freundes hatten sie viel Zeit miteinander verbracht.
Sie war zäh, intelligent und mutig.
Aber Waterboarding?
Er bezweifelte, dass sie jemals etwas Vergleichbares erlebt hatte.
Sie so auf dem Bildschirm zu sehen hatte ihn tief aufgewühlt. Er begriff plötzlich, dass sein Leben nie wieder dasselbe sein würde, falls dieser Frau etwas zustieß.
Er musste sie finden.
Aber es gab ein Problem.
Der Wunsch zu überleben hatte sie offensichtlich zum Handeln gezwungen. Aber diesmal hatte sie vielleicht mehr abgebissen, als sie kauen konnte.
Sie hatte ihm nichts zum Aufbewahren übergeben.
Er hatte keine Ahnung, wovon sie oder ihr Folterer sprachen.
2
Chongqing, China
20.00 Uhr
Karl Tang setzte eine Miene auf, die nicht im Entferntesten erkennen ließ, was er dachte. Nach beinahe drei Jahrzehnten Übung beherrschte er diese Kunst vollkommen.
»Und warum sind Sie diesmal gekommen?«, fragte ihn die Ärztin. Sie war eine wenig geschmeidige Frau mit eiserner Mimik. Das glatte, schwarze Haar trug sie im proletarischen Stil kurz geschnitten.
»Ihre Wut auf mich hat sich nicht gelegt?«
»Ich empfinde keine Feindseligkeit gegen Sie, Herr Minister. Sie haben bei Ihrem letzten Besuch recht deutlich gemacht, dass Sie hier das Sagen haben, obgleich dies mein Krankenhaus ist.«
Er überging ihren beleidigenden Tonfall. »Und wie geht es unserem Patienten?«
Die Klinik für ansteckende Krankheiten, die am Stadtrand von Chongqing lag, versorgte annähernd zweitausend Patienten, die entweder an Tuberkulose oder an Hepatitis litten. Sie war eines von acht Instituten, die im ganzen Land verstreut lagen, jedes ein abschreckender Komplex aus grauem Backstein, der von grünen Zäunen umschlossen war. Hier konnten die Menschen mit ansteckenden Krankheiten sicher in Quarantäne gebracht werden. Aber die Sicherheitsmaßnahmen, die diese Kliniken umgaben, machten sie auch zum idealen Ort für die Unterbringung kranker Strafgefangener.
Wie Jin Zhao, der vor zehn Monaten eine Gehirnblutung erlitten hatte.
»Er liegt im Bett, genau wie vom Tag seiner Einlieferung an«, sagte die Ärztin. »Er klammert sich an sein Leben. Der Schaden ist riesig. Aber er wurde – wieder gemäß Ihrem Befehl – keiner Behandlung unterzogen.«
Er wusste, dass sie ihm seine Eingriffe in ihre Autorität verübelte. Verschwunden waren Maos gehorsame »Barfußärzte«, die, dem offiziellen Mythos zufolge, bereitwillig unter dem Volk gelebt und sich pflichtbewusst um die Kranken gekümmert hatten. Diese Frau war zwar die Klinikchefin, aber Tang war Nationaler Minister für Wissenschaft und Technik, Mitglied des Zentralkomitees, Vize-Parteigeneralsekretär und Vizepräsident der Volksrepublik China – er kam direkt nach dem Präsidenten und Parteigeneralsekretär.
»Wie ich letztes Mal deutlich gemacht habe, war das nicht mein eigener Befehl, sondern die Direktive des Zentralkomitees«, sagte er, »und dem schulden wir beide absoluten Gehorsam.«
Diese Worte sprach er nicht nur für die törichte Frau aus, sondern auch für die drei Mitglieder seines Stabs und die beiden Offiziere der Volksbefreiungsarmee, die hinter ihm standen. Beide Militärs trugen eine frische grüne Uniform, und auf den Mützen prangte der Rote Stern des Vaterlands. Einer von ihnen war mit Sicherheit ein Informant – der seine Erkenntnisse wahrscheinlich mehr als einem Wohltäter zutrug –, und so wollte Tang, dass jeder etwaige Bericht ihn im positivsten Licht erscheinen ließ.
»Bringen Sie uns zum Patienten«, befahl er ruhig.
Sie gingen durch Korridore, die salatgrün verputzt waren. Die rissigen Wände wurden von schwachen Neonleuchten erhellt. Der Boden war sauber, aber vom endlosen Aufwischen vergilbt. Krankenschwestern mit einem Mundschutz vor dem Gesicht kümmerten sich um Patienten in blauweiß gestreiften Schlafanzügen. Manche trugen auch braune Bademäntel, und alle sahen praktisch wie Gefangene aus.
Durch die Flügel einer metallenen Schwingtür betraten sie eine weitere Abteilung. Der Raum war ziemlich groß, er bot Platz für mindestens ein Dutzend Kranke, doch dort stand jetzt nur ein einziges Bett. Darin lag ein Patient zwischen schmuddeligen, weißen Laken.
Es stank.
»Wie ich sehe, haben Sie die Bettwäsche in Ruhe gelassen«, sagte er.
»Das hatten Sie angeordnet.«
Noch etwas, was der Informant zu seinen Gunsten berichten konnte. Jin Zhao war vor zehn Monaten verhaftet worden, erlitt während seiner Befragung aber eine Gehirnblutung. In der Folge wurde er des Verrats und der Spionage angeklagt. Der Fall wurde vor einem Gericht in Peking verhandelt, und Zhao wurde verurteilt, alles in Abwesenheit, da er hier in der Klinik lag, im Koma.
»Er liegt genauso da wie neulich, als Sie ihn zuletzt gesehen haben«, sagte die Ärztin.
Peking lag mindestens tausend Kilometer im Osten, und er nahm an, dass diese Entfernung der Frau den Rücken stärkte. Man kanndie Drei Armeen ihres Oberbefehlshabers berauben, aber selbst dem geringsten der Bauern kann man nicht seine Meinung nehmen. Noch so ein Unsinn von Konfuzius. Tatsächlich konnte die Regierung das nämlich, und diese unverschämte Schlampe sollte das besser bedenken.
Er gab einem der Uniformierten einen Wink, und dieser führte die Ärztin zur anderen Seite des Raums.
Er trat ans Bett.
Der Mann, der dort lag, war Mitte sechzig. Sein schmutziges Haar war lang und zerzaust, der ausgemergelte Körper und die eingesunkenen Wangen erinnerten an einen Toten. Im Gesicht und auf der Brust hatte er blaue Flecken. Beide Arme hingen an einem Tropf. Ein Beatmungsgerät versorgte seine Lungen mit Luft.
»Jin Zhao, Sie sind des Verrats gegen die Volksrepublik China für schuldig befunden worden. Es wurde ein Urteil verkündet, gegen das Sie Berufung einlegten. Zu meinem Bedauern muss ich Ihnen mitteilen, dass der Oberste Volksgerichtshof Ihrer Hinrichtung zugestimmt und die Berufung verworfen hat.«
»Er hört kein Wort von dem, was Sie sagen«, erklärte die Ärztin von der anderen Seite des Raums.
Er hielt die Augen auf das Bett gerichtet. »Vielleicht nicht, aber die Worte müssen gesprochen werden.« Er wandte sich ihr zu. »So lautet das Gesetz, und er hat ein Recht auf ein korrektes Verfahren.«
»Sie haben ihm den Prozess gemacht, obwohl er gar nicht da war«, platzte sie heraus. »Sie haben nie gehört, was er zu sagen hatte.«
»Sein juristischer Vertreter hat Gelegenheit erhalten, Entlastungsmaterial vorzulegen.«
Die Ärztin schüttelte voll Abscheu den Kopf, das Gesicht bleich vor Hass. »Hören Sie, was Sie da sagen? Der Vertreter hatte nie Gelegenheit, auch nur mit Zhao zu sprechen. Was hätte er da wohl an Entlastendem vorbringen können?«
Tang konnte nicht entscheiden, ob einer seiner Mitarbeiter oder einer der Armeeoffiziere der Informant war, der nun gewiss aufmerksam hinsah und hinhörte. Inzwischen konnte man sich eigentlich bei gar nichts mehr sicher sein. Alles, was er wusste, war, dass sein eigener Bericht an das Zentralkomitee nicht die einzige Darstellung dieses Ereignisses sein würde. Daher stellte er klar: »Sind Sie sich sicher? Zhao hat niemals irgendetwas geäußert?«
»Er ist bewusstlos geschlagen worden. Sein Gehirn ist zerstört. Er wird nie mehr aus dem Koma erwachen. Wir halten ihn nur deshalb am Leben, weil Sie … nein, verzeihen Sie, weil das Zentralkomitee es befohlen hat.«
Er bemerkte den Abscheu in den Augen der Frau, etwas, was er in letzter Zeit immer öfter gesehen hatte. Insbesondere bei Frauen. Beinahe das gesamte Klinikpersonal – Ärztinnen wie Schwestern – war weiblich. Seit Maos Revolution hatten die Frauen große Fortschritte gemacht, doch Tang hielt sich immer noch an den Spruch, den sein Vater ihn gelehrt hatte. Ein Mann äußert sich nicht zu den Angelegenheiten im Haus und eine Frau nicht zu den Angelegenheiten außerhalb des Hauses.
Diese unbedeutende Ärztin, die in einer unwichtigen staatseigenen Klinik arbeitete, begriff nicht, vor welcher Herausforderung er stand. Peking regierte ein Land, das sich von Ost nach West über fünftausend Kilometer erstreckte, und von Nord nach Süd über dreitausend. Ein bedeutender Teil des Landes bestand aus unbewohnbaren Gebirgen und Wüsten, einigen der trostlosesten Regionen der Welt. Nur zehn Prozent der Landfläche waren kultivierbar. Die Bevölkerung umfasste beinahe anderthalb Milliarden Menschen – mehr Einwohner, als Amerika, Russland und Europa zusammengenommen hatten. Aber nur sechzig Millionen Chinesen waren Mitglieder der Kommunistischen Partei – weniger als drei Prozent der Gesamtbevölkerung. Die Ärztin war Parteimitglied, und zwar schon seit mehr als einem Jahrzehnt. Das hatte er überprüft. Sonst hätte sie auch nie in eine so hohe Stellung aufsteigen können. Nur Han-Chinesen, die Parteimitglieder waren, erreichten einen solchen Status. Die Han-Chinesen stellten die große Mehrheit der Bevölkerung dar, und der verbleibende kleine Prozentsatz verteilte sich auf sechsundfünfzig Minderheiten. Der Vater der Ärztin war ein bedeutender Angehöriger der lokalen Provinzregierung, ein loyales Parteimitglied, das an der Revolution von 1949 teilgenommen und sowohl Mao als auch Deng Xiaoping persönlich gekannt hatte.
Dennoch musste Tang etwas klarstellen. »Jin Zhao war der Volksregierung zur Loyalität verpflichtet. Er hat beschlossen, unseren Feinden zu helfen …«
»Womit hätte denn ein dreiundsechzigjähriger Geochemiker der Volksregierung Schaden zufügen können? Sagen Sie mir das, Herr Minister. Ich möchte es wissen. Und was könnte er uns jetzt wohl noch anhaben?«
Er sah auf die Uhr. Ein Hubschrauber wartete darauf, ihn nach Norden zu fliegen.
»Er war kein Spion«, sagte sie. »Kein Verräter. Was hat er wirklich getan, Herr Minister? Was rechtfertigt es, einen Mann zu schlagen, bis sein Gehirn blutet?«
Er hatte keine Zeit, über etwas zu diskutieren, was bereits beschlossene Sache war. Der Informant würde das Schicksal dieser Frau besiegeln. In einem Monat würde sie einen Versetzungsbescheid erhalten – trotz der Privilegien ihres Vaters – und wahrscheinlich tausende von Kilometern westwärts an den Rand der Republik geschickt werden, wo man solche Probleme versteckte.
Er gab dem anderen Uniformierten ein Zeichen.
Der Offizier nahm seine Waffe aus dem Holster, trat zum Bett und versetzte Jin Zhao einen Schuss in die Stirn.
Ein Ruck fuhr durch den Körper, dann lag er still.
Das Beatmungsgerät schickte weiter Luft in die tote Lunge.
»Das Urteil wurde vollstreckt«, erklärte Tang. »Vorschriftsgemäß bezeugt durch Vertreter der Volksregierung, das Militär … und die hiesige Klinikchefin.«
Er gab seinen Leuten einen Wink, dass es Zeit zum Aufbruch war. Den blutigen Schlamassel würde die Ärztin beseitigen müssen.
Er ging zur Tür.
»Sie haben gerade einen hilflosen Mann erschossen!«, schrie die Ärztin. »Das also ist aus unserer Regierung geworden?«
»Sie sollten dankbar sein«, erwiderte er.
»Für was?«
»Dass die Regierung die Kosten für die Kugel nicht vom Budget dieser Einrichtung abzieht.«
Und damit ging er.
3
Kopenhagen
13.20 Uhr
Malone verließ seinen Buchladen und trat auf den Højbro Plads hinaus. Der Nachmittagshimmel war wolkenlos und die Luft mild. Der Strøget – eine aus mehreren Straßen bestehende Fußgängerzone voller Läden, Cafés und Restaurants – wimmelte von Menschen.
Das Problem, was er mitbringen sollte, hatte er dadurch gelöst, dass er einfach das erstbeste Buch von einem der Regale genommen und es in einen Umschlag gesteckt hatte. Cassiopeia hatte sich offensichtlich entschieden, sich Zeit zu erkaufen, indem sie ihn in die Sache hineinzog. Ein schlechter Schachzug war das nicht, nur kam man mit einer solchen List eben nicht unendlich weit. Er wünschte, er wüsste, worum es ging. Seit letztem Weihnachten hatten sie sich gelegentlich besucht, waren ab und zu zusammen essen gewesen, hatten manchmal telefoniert oder E-Mails gewechselt. Oft hatten sie über Thorvaldsens Tod gesprochen, der sie beide zu schmerzen schien. Er konnte noch immer nicht glauben, dass sein Freund nicht mehr da war. Jeden Tag erwartete er, den gerissenen alten Dänen in seinen Buchladen treten zu sehen, um angeregt mit ihm zu plaudern. Es erfüllte ihn noch immer mit tiefem Bedauern, dass sein Freund in dem Glauben gestorben war, von ihm betrogen worden zu sein.
»Du hast in Paris getan, was du tun musstest«, hatte Cassiopeia zu Malone gesagt. »Ich hätte es genauso gemacht.«
»Henrik hat das anders gesehen.«
»Er war nicht vollkommen, Cotton. Er hat sich in etwas hineingesteigert. Er hat nicht nachgedacht und wollte auf niemanden hören. Es stand mehr auf dem Spiel als nur seine Rache. Du hattest keine Wahl.«
»Ich habe ihn enttäuscht.«
Sie langte über den Tisch und drückte ihm die Hand. »Ich sag dir was. Sollte ich jemals richtig tief in der Tinte sitzen, dann enttäusche mich bitte auf dieselbe Weise.«
Er ging weiter, ihre Stimme im Ohr.
Jetzt ging es also wieder von Neuem los.
Er verließ den Strøget und überquerte eine breite Straße, auf der sich metallisch glänzende Autos, Busse und Fahrräder stauten. Er hastete über den Rådhuspladsen, einen weiteren von Kopenhagens vielen öffentlichen Plätzen. Dieser hier lag vor dem Rathaus. Malone erblickte die bronzenen Trompeter über dem Eingangstor, die lautlos in ihre uralten Luren bliesen. Über ihnen erhob sich die vergoldete Statue von Bischof Absalom, der im Jahr 1167 ein winziges Fischerdorf zu einer ummauerten Festung ausgebaut hatte.
Auf der anderen Seite des Platzes, hinter einem weiteren verkehrsreichen Boulevard, lag der Tivoli.
In der linken Hand hielt er den Umschlag; seine Beretta, die er noch vom Magellan Billet erhalten hatte, steckte unter seiner Jacke. Er hatte die Waffe unter seinem Bett hervorgeholt, wo sie für gewöhnlich mit anderen Erinnerungsstücken seines früheren Lebens in einem Rucksack lag.
»Du kommst mir ein bisschen nervös vor«, hatte Cassiopeia zu ihm gesagt.
Sie standen in der kalten Märzluft vor seinem Buchladen. Sie hatte recht. Er war nervös. »Ich bin nicht besonders romantisch veranlagt.«
»Wirklich nicht? Das hätte ich nie erraten. Zum Glück für dich bin ich das aber.«
Sie sah großartig aus. Hochgewachsen und schlank, die Haut ein helles Mahagonibraun. Dickes, kastanienfarbenes Haar reichte ihr bis zu den Schultern und umrahmte ihr faszinierendes Gesicht mit den schmalen Brauen und den straffen Wangen.
»Mach dich nicht selber fertig, Cotton.«
Interessant. Sie hatte gewusst, dass er über Thorvaldsen nachgedacht hatte.
»Du bist ein guter Mann. Henrik hat das gewusst.«
»Ich bin zwei Minuten zu spät gekommen.«
»Und daran kannst du verdammt nochmal nichts mehr ändern.«
Sie hatte schon wieder recht.
Aber trotzdem konnte er das schlechte Gefühl nicht abschütteln.
Er hatte Cassiopeia sowohl in Bestform erlebt, als auch in einer Zeit, als die Umstände sie all ihres Selbstvertrauens beraubt hatten – da war sie verletzlich gewesen, fehlbar und emotional. Zum Glück war er vor Ort gewesen und hatte das ausgleichen können. Umgekehrt war sie später für ihn da gewesen, als die Rollen sich vertauscht hatten. Sie strahlte eine erstaunliche Mischung aus Weiblichkeit und Kraft aus, aber jeder – selbst sie – übernahm sich manchmal.
Plötzlich hatte er wieder vor Augen, wie sie mit dem Tuch über dem Gesicht auf das Brett gefesselt dagelegen hatte.
Warum sie?
Warum nicht er?
Karl Tang stieg in den Hubschrauber und setzte sich ins hintere Abteil. In Chongqing war er fertig.
Er hasste diesen Ort.
Dreißig Millionen Menschen besiedelten jeden Quadratmeter der Berge um den Zusammenfluss von Jialing und Jangtsekiang. Unter der Herrschaft der Mongolen, der Han und der Mandschu war hier das Zentrum des Imperiums gewesen. Während der Invasion der Japaner im Zweiten Weltkrieg wurde die Metropole zur provisorischen Hauptstadt. Inzwischen war die Stadt eine Mischung aus Alt und Neu – Moscheen, daoistische Tempel, christliche Kirchen, kommunistische Monumente –, ein erbärmlicher Ort, heiß und schwül, wo Wolkenkratzer den Horizont verstellten.
Der Hubschrauber erhob sich in den kohlendioxydgeschwängerten Nebel und schlug eine nordwestliche Flugrichtung ein.
Tang hatte seine Mitarbeiter und die Offiziere weggeschickt.
Auf diesen Teil der Reise würden keine Spione mitkommen.
Dies hier musste er selbst erledigen.
Malone löste seine Eintrittskarte und betrat den Tivoli. Halb Freizeitpark, halb kulturelles Wahrzeichen, sorgte das baumbestandene und mit Blumen bepflanzte Wunderland seit 1843 für die Unterhaltung der Dänen. Es war ein Nationaldenkmal, wo altmodische Riesenräder, Pantomimentheater und Piratenschiffe sich mit moderneren, der Schwerkraft spottenden Fahrgeschäften mischten. Selbst die Deutschen hatten den Park während des Zweiten Weltkriegs verschont. Malone kam gerne zu Besuch – man konnte mühelos verstehen, dass sowohl Walt Disney als auch Hans Christian Andersen sich hier hatten inspirieren lassen.
Er verließ den Haupteingang und folgte einer von Pflanzen gesäumten Zentralallee. Tulpenbeete, Rosen, Lilien und Hunderte von Linden-, Kastanien, Kirsch- und immergrünen Bäumen bildeten eine einfallsreiche Komposition, die das Gelände in seinen Augen immer größer wirken ließ als nur einen halben Hektar. Der Duft von Popcorn und Zuckerwatte lag in der Luft und vereinigte sich mit den Klängen eines Wiener Walzers und einer Bigband. Er wusste, dass der Gründer des Tivoli den Vergnügungspark gegenüber Dänemarks Christian VIII. mit den Worten gerechtfertigt hatte: Wenn das Volk sich amüsiert, denkt es nicht an Politik.
Malone kannte die chinesische Pagode. Von Bäumen umstanden erhob sie sich vier Stockwerke hoch an einem See. Sie war mehr als hundert Jahre alt, und ihr asiatisch wirkendes Foto schmückte nahezu jede Broschüre, die für den Tivoli warb.
Eine Truppe Jungen, fesch gekleidet mit roten Jacken, Patronengurten und Bärenfellmützen, marschierte den Nachbarweg hinunter. Die Tivoligarde, eine Marschkapelle. Das Publikum säumte ihren Pfad und verfolgte die Parade. Vor allen Attraktionen drängten sich ungewöhnlich dichte Menschenmengen, denn es war ein Dienstag im Mai, und die Sommersaison hatte gerade erst die Woche zuvor begonnen.
Er erblickte die Pagode. Drei turmartig angeordnete Dachgeschosse mit vorspringenden Gesimsen und hochgezogenen Dachrändern ragten, nach oben kleiner werdend, übereinander auf. Unten lag ein Restaurant, und Besucher strömten ein und aus. Weitere Gäste saßen auf Bänken unter den Bäumen.
Kurz vor vierzehn Uhr.
Er war rechtzeitig gekommen.
Enten aus dem See watschelten zwischen den Parkbesuchern herum. Sie zeigten wenig Furcht. Von sich selbst konnte Malone das nicht behaupten. Seine Nerven waren angespannt, und sein Denken verlief wieder in den Bahnen des Agenten des Justizministeriums, der er zwölf gefährliche Jahre lang gewesen war. Eigentlich war er früher aus dem Dienst ausgeschieden, um sich der Gefahr zu entziehen und stattdessen ein dänischer Buchhändler zu werden. Doch die letzten zwei Jahre waren alles andere als ruhig verlaufen.
Denk nach. Pass auf.
Die elektronische Stimme hatte gesagt, jemand werde ihn hier kontaktieren. Offensichtlich wussten Cassiopeias Häscher genau, wie er aussah.
»Mr. Malone.«
Er drehte sich um.
Neben ihm stand eine Frau, das hagere Gesicht eher länglich als rund. Ihr schwarzes Haar hing glatt herunter, und braune Augen mit langen Wimpern gaben ihr etwas Geheimnisvolles. Offen gestanden hatte er eine Schwäche für fernöstliche Schönheit. Sie trug schicke Kleidung, die ihrer Figur schmeichelte. Ein Burberry-Rock umspielte ihre schmale Taille.
»Ich bin hier, um das Päckchen abzuholen«, sagte sie.
Er wedelte mit dem Umschlag in seiner Hand. »Das hier?«
Sie nickte.
Sie war Ende zwanzig, bewegte sich lässig und gab sich in dieser Situation völlig unbesorgt. Sein Verdacht bestätigte sich rasch.
»Haben Sie Lust auf ein spätes Mittagessen mit mir?«, fragte er.
Sie lächelte. »Ein andermal.«
»Das klingt vielversprechend. Wie kann ich Sie finden?«
»Ich weiß, wo Ihr Buchladen ist.«
Er lächelte. »Wie dumm von mir.«
Sie zeigte auf den Umschlag. »Ich muss jetzt los.«
Er reichte ihr das Päckchen.
»Vielleicht schaue ich mal wieder in Ihrem Laden vorbei«, sagte sie mit einem Lächeln.
»Gerne.«
Er sah ihr nach, wie sie lässig davonschlenderte und in der Menschenmenge verschwand.
Tang schloss die Augen und überließ sich dem beruhigenden Dröhnen der Hubschrauberturbine.
Er sah auf die Uhr.
21.05 Uhr hier bedeutete 14.05 Uhr in Antwerpen.
Es geschah so viel auf einmal. Seine ganze Zukunft wurde jetzt von einem Zusammenprall verschiedener Umstände bestimmt, die er alle unter Kontrolle behalten musste.
Wenigstens war das Problem Jin Zhao jetzt gelöst.
Alles fand nun seinen angemessenen Platz. Dreißig Jahre der Hingabe würden bald belohnt werden. Alle Bedrohungen waren entweder beseitigt oder befanden sich zumindest unter Kontrolle.
Jetzt blieb nur noch Ni Yong.
4
Antwerpen, Belgien
14.05 Uhr
Ni Yong setzte sich in den schwarz lackierten Stuhl, eine Reproduktion der Qing-Periode. Er kannte die eleganten Linien und schönen Schwünge, und dieses Stück hier war ein ausgezeichnetes Beispiel für die chinesische Handwerkskunst vor dem 18. Jahrhundert. Die Schreinerarbeit war in ihrer Exaktheit von so hoher Qualität, dass Nägel und Klebstoff sich als überflüssig erwiesen.
Sein ernst dreinblickender Gastgeber saß in einem Rohrsessel. Das Gesicht des Mannes war länger als bei den meisten Chinesen, die Augen runder, seine Stirn höher; das schüttere Haar war leicht gewellt. Pau Wen trug eine jadegrüne Seidenjacke und weiße Hosen.
»Ihr Heim ist elegant«, sagte Ni in ihrer Muttersprache.
Pau nickte und nahm das Kompliment mit der Demut entgegen, die man von einem Mann von fast siebzig Jahren erwarten konnte. Er war zu jung, um 1949, als die Volksrevolution Chiang Kai-shek und seine Nationalisten nach Taiwan spülte, an Maos Seite gestanden zu haben. Ni wusste, dass Pau während der 1960er Jahre eine wichtige Rolle zu spielen begonnen hatte und auch nach Maos Tod 1976 eine bedeutende Stellung behalten hatte.
Dann, zehn Jahre später, hatte Pau China verlassen.
Und war ausgerechnet hier in Belgien gelandet.
»Ich wollte, dass mein Haus mich an meine Heimat erinnert«, sagte Pau.
Das Haus, das ein paar Kilometer vor Antwerpen lag, erschien von außen wie ein schlichtes Gebäude mit hohen, grauen Wänden, chinesischem Doppeldach mit vorschwingenden Dachrändern und zwei Türmen. Es verkörperte die wesentlichen Elemente der traditionellen chinesischen Architektur – Geschlossenheit, Symmetrie und Hierarchie. Innen war es hell und luftig und im klassischen Stil eingerichtet. Allerdings verfügte es über alle modernen Annehmlichkeiten – Klimaanlage, Zentralheizung, Überwachungssystem und Satellitenfernsehen.
Ni kannte diesen Haustyp.
Es war ein Siheyuan.
Das ultimative Symbol chinesischen Reichtums – eine Wohnanlage für eine Großfamilie, deren zentraler Innenhof von vier Gebäuden umschlossen wurde. Normalerweise gehörten zur Verschönerung noch ein Garten und eine Terrasse dazu. Früher hatten die Adligen solche Häuser besessen, heute konnten sich nur noch chinesische Militärs, Parteibonzen und die Neureichen ein solches Gebäude leisten.
»Das hier erinnert mich an ein Haus, das ich kürzlich im Nordosten besucht habe. Es gehörte dem Bürgermeister des Ortes. Drinnen fanden wir zweihundertfünfzig Goldbarren versteckt. Eine ganz schöne Leistung für einen Mann, der nur ein paar tausend Yuan im Jahr verdiente. Aber als Bürgermeister kontrollierte er natürlich die Wirtschaft des Gebietes, was die lokalen Unternehmer und ausländische Investoren offensichtlich zu honorieren wussten. Ich habe ihn festgenommen.«
»Und dann haben Sie ihn hinrichten lassen. Rasch, nehme ich an.«
Ihm war klar, dass Pau gewiss über das chinesische Justizsystem Bescheid wusste.
»Sagen Sie mir, Herr Minister, was führt Sie nach Europa und zu mir?«
Ni war der Chef der Zentralkommission für Disziplinarinspektion der Kommunistischen Partei Chinas. Er unterstand direkt dem Nationalkongress, befand sich damit auf derselben Ebene wie das allmächtige Zentralkomitee und hatte den Auftrag, Korruption und Amtsvergehen zu bekämpfen.
»Sie sind kein Amtsträger, den ich gerne zum Feind hätte«, sagte Pau. »Wie ich hörte, sind Sie der gefürchtetste Mann Chinas.«
Diese Bezeichnung war Ni nicht neu.
»Anderen zufolge könnten Sie gleichzeitig der ehrlichste Mann Chinas sein.«
Auch diese Beschreibung hatte Ni bereits gehört. »Und Sie, Pau Wen, sind immer noch chinesischer Staatsbürger. Sie haben dieses Recht nie aufgegeben.«
»Ich bin stolz auf mein chinesisches Erbe.«
»Ich bin gekommen, um etwas von diesem Erbe zurückzufordern.«
Sie saßen in einem Salon, der sich zu einem Innenhof öffnete, in dem Bäume blühten. Bienen schwirrten von einer duftenden Blüte zur nächsten. Ihr Summen und das Plätschern eines Brunnens waren die einzigen Geräusche. Hinter Glastüren und Seidenvorhängen lag im Nachbarraum ein Arbeitszimmer.
»Als Sie unser Vaterland verlassen haben, haben Sie offensichtlich beschlossen, dass einige unserer Artefakte Sie begleiten würden.«
Pau lachte. »Haben Sie auch nur die geringste Ahnung, wie es war, als Mao noch lebte? Sagen Sie mir, Herr Minister, haben Sie in Ihrer herausragenden Position als Hüter des Parteigewissens die geringste Vorstellung von unserer Geschichte?«
»Im Moment interessiert mich nur Ihr Diebstahl.«
»Ich habe China vor beinahe drei Jahrzehnten verlassen. Warum ist mein Diebstahl erst jetzt plötzlich von Bedeutung?«
Man hatte ihn vor Pau Wen gewarnt, einem studierten Historiker und gewieften Redner, der ein Meister darin war, Widrigkeiten zu seinem Vorteil umzumünzen. Sowohl Mao als auch Deng Xiaoping hatten sich seiner Talente bedient.
»Ich bin erst vor kurzem auf Ihr Verbrechen aufmerksam geworden.«
»Ein anonymer Informant?«
Ni nickte. »Solche gibt es glücklicherweise.«
»Und Sie machen es ihnen ja auch so leicht. Sie haben sogar eine Webseite eingerichtet. Man muss nur eine E-Mail dort hinschicken, braucht weder Namen noch Adresse anzugeben und kann seine ganzen Anschuldigungen loswerden. Sagen Sie mir, muss man mit irgendwelchen Folgen rechnen, wenn man jemanden zu Unrecht anschwärzt?«
Ni würde nicht in diese Falle tappen. »Auf dem Weg vom Vordereingang hierher ist mir ein Keramikpferd aus der Han-Dynastie aufgefallen. Eine Bronzeglocke aus der Zhou-Periode. Und eine Statuette aus der Tan-Dynastie. Lauter Originale, die Sie gestohlen haben.«
»Woher wollen Sie das wissen?«
»Eine ganze Reihe von Museen und Sammlungen standen unter Ihrer Obhut; für Sie war es leicht, sich anzueignen, was immer Sie begehrten.«
Pau stand auf. »Darf ich Ihnen etwas zeigen, Herr Minister?«
Warum nicht? Er wollte mehr vom Haus sehen.
Er folgte dem älteren Mann auf den Hof hinaus. Dieser weckte in ihm Erinnerungen an das traditionelle Heim seiner Familie in Sichuan, einer Provinz mit jadegrünen Hügeln und gepflegten Feldern. Seit siebenhundert Jahren lebten die Nis dort, von Bambusgehölzen umgeben, die fruchtbare Reisfelder einfassten. Auch dieses Haus hatte einen Wohnhof besessen. Eines war allerdings anders gewesen. Der Boden hatte nicht aus Pflastersteinen, sondern aus gestampfter Erde bestanden.
»Wohnen Sie allein hier?«, fragte Ni.
Um ein derart großes Haus musste man sich ständig kümmern, und alles wirkte tadellos gepflegt. Dennoch hatte er niemanden gesehen oder gehört.
»Ist das wieder der Ermittler in Ihnen? Müssen Sie ständig Fragen stellen?«
»Es kommt mir wie eine recht schlichte Erkundigung vor.«
Pau lächelte. »Mein Leben ist eines der selbst auferlegten Einsamkeit.«
Das war genau genommen gar keine Antwort, aber Ni hatte auch keine erwartet.
Sie gingen zwischen in Töpfen wachsenden Büschen und Zwergeiben hindurch und näherten sich auf der gegenüberliegenden Seite des Hofs einer hohen, schwarzen Tür, auf der eine rote Scheibe prangte. Dahinter lag ein großer Saal, gestützt von massiven Pfeilern, über die sich eine Decke aus grünem Gitterwerk spannte. An einer Wand standen Bücherregale, an einer anderen hingen mit chinesischen Schriftzeichen bedeckte Schriftrollen. Sanftes Licht drang durch Papierfenster. Er bemerkte schöne Schnitzereien, Seidentücher an den Wänden und Schauvitrinen, in denen Objekte wie in einem Museum ausgestellt waren.
»Meine Sammlung«, sagte Pau.
Ni starrte auf den Hort.
»Es stimmt, Herr Minister. Sie haben beim Betreten meines Hauses wertvolle Kunstgegenstände gesehen. Sie sind kostbar. Aber das hier ist der wahre Schatz.« Pau winkte, und sie gingen tiefer in den Raum hinein. »Hier zum Beispiel. Eine glasierte Keramikfigurine. Han-Dynastie. 210 vor Christus.«
Er betrachtete die Skulptur, die aus einem kalkfarbenen Material hergestellt war. Sie stellte einen Mann dar, der die Kurbel eines Geräts bediente, das wie eine Drehmühle aussah.
»Das hier zeigt etwas recht Bemerkenswertes«, erklärte Pau. »Das Getreide wurde oben in einen offenen Behälter gegeben, und die Mühle worfelte den Inhalt und sonderte die Spreu von den Körnern. Diese Art Maschine wurde in Europa erst beinahe zweitausend Jahre später bekannt, als niederländische Seefahrer sie aus China einführten.«
Auf einem weiteren Sockel stand eine Reiterfigurine; neben ihr lag ein Steigbügel. Pau bemerkte Nis Interesse.
»Das ist ein Objekt aus der Tang-Dynastie. Sechstes bis siebtes Jahrhundert nach Christus. Beachten Sie, dass die Füße des Kriegers auf dem Pferd in Steigbügeln stehen. China hatte die Steigbügel schon Jahrhunderte vorher erfunden, aber erst im Mittelalter schafften diese den Weg nach Europa. Ohne den chinesischen Steigbügel wären die mittelalterlichen Ritter, die mit Lanze und Schild bewaffnet zu Pferd saßen, gar nicht denkbar gewesen.«
Ni blickte sich zwischen den Artefakten um. Hier lagen mindestens hundert Objekte, wenn nicht mehr.
»Ich habe diese Stücke in Dörfern gesammelt«, erzählte Pau, »und in Gräbern gefunden. Viele stammen aus Kaisergräbern, die in den 1970ern entdeckt wurden. Und Sie haben recht, ich habe auch Objekte aus Museen und Privatsammlungen ausgewählt.«
Pau zeigte auf eine Wasseruhr und sagte, sie stamme aus dem Jahr 113 v. Chr. Eine Sonnenuhr, Kanonenrohre, Porzellan, astronomische Radierungen, jedes Objekt zeigte Chinas Erfindungsreichtum. Ein sonderbares Artefakt fiel Ni ins Auge – ein kleiner Löffel, der auf einer glatten Bronzeplatte im Gleichgewicht ruhte. In die Platte waren Zeichen eingraviert.
»Der Kompass«, sagte Pau. »Er wurde vor zweitausendfünfhundert Jahren von den Chinesen erfunden. Der Löffel besteht aus Magneteisenstein und dreht sich immer nach Süden. Als die Menschen im Westen noch auf Subsistenzniveau lebten, lernten die Chinesen schon, mit diesem Gerät zu navigieren.«
»Das alles gehört der Volksrepublik«, sagte Ni.
»Im Gegenteil. Ich habe dies hier vor der Volksrepublik gerettet.«
Ni wurde des Spiels überdrüssig. »Sagen Sie, was Sie damit meinen, alter Mann.«
»Während unserer glorreichen Kulturrevolution habe ich einmal beobachtet, wie eine zweitausend Jahre alte Mumie, die in Changsha in perfektem Zustand entdeckt worden war, von Soldaten zum Verrotten in die Sonne geworfen wurde. Bauern bewarfen sie mit Steinen. So sah das Schicksal von Millionen unserer historischen Objekte aus. Stellen Sie sich nur vor, welche wissenschaftlichen und historischen Informationen durch solche Dummheiten verloren gegangen sind.«
Er hütete sich, Paus Gerede zu viel Beachtung zu schenken. Wie er seinen Mitarbeitern beigebracht hatte, ließ ein guter Ermittler sich niemals von einem Befragten aus dem Konzept bringen.
Sein Gastgeber zeigte auf einen Abakus aus Holz und Messing. »Dieses Instrument ist tausendfünfhundert Jahre alt und wurde in einer Bank oder einer Schreibstube als Rechenhilfsmittel verwendet. Im Westen benutzte man derartige Geräte erst Jahrhunderte später. Das Dezimalsystem, die Null, die negativen Zahlen, Bruchrechnen, der Wert von Pi: All diese Konzepte – und alles in diesem Raum hier – wurden zuerst von den Chinesen entwickelt.«
»Woher wissen Sie das?«, fragte Ni.
»Das ist unsere Geschichte. Unglückseligerweise haben aber unsere glorreichen Kaiser und Maos Volksrevolution die Geschichte nach ihren Bedürfnissen umgeschrieben. Wir Chinesen haben kaum eine Vorstellung davon, woher wir gekommen sind oder was wir geleistet haben.«
»Sie aber wissen es?«
»Schauen Sie dort hinüber, Herr Minister.«
Er sah etwas, das wie eine Druckplatte aussah, mit Schriftzeichen, die dazu bereitstanden, auf Papier vervielfältigt zu werden.
»Bewegliche Schriftzeichen wurden in China im Jahr 1045 nach Christus erfunden, lange bevor Gutenberg diese Großtat in Deutschland wiederholte. Auch Papier haben wir vor dem Westen entwickelt. Der Seismograf, der Fallschirm, das Steuerruder, Mast und Segel, all das kam zuerst aus China.« Pau umfasste den Raum mit einer weitausholenden Geste. »Dies hier ist unser Erbe.«
Ni klammerte sich an die Wahrheit. »Trotzdem sind Sie immer noch ein Dieb.«
Pau schüttelte den Kopf. »Herr Minister, nicht meine Diebstähle haben Sie hierhergeführt. Ich war ehrlich mit Ihnen. Sagen Sie mir also, warum sind Sie gekommen?«
Unvermittelte Themenwechsel gehörten ebenfalls zu Paus bekannten Eigenschaften. Er war es gewohnt, ein Gespräch zu lenken, indem er die Richtung bestimmte, in die es sich entwickelte. Da Ni das Geplänkel satt hatte, blickte er sich in der Hoffnung um, das gesuchte Artefakt zu entdecken. Die Maße kannte er ja und wusste, dass der gesuchte Gegenstand einen Tiger mit einem Drachenkopf und Phönixflügeln darstellte. Die Drachenlampe war aus Bronze gefertigt und in einem Grab aus dem dritten Jahrhundert vor Christus gefunden worden.
»Wo ist die Drachenlampe?«
Ein sonderbarer Ausdruck trat in Paus runzliges Gesicht. »Genau dasselbe hat auch sie mich gefragt.«
Das war nicht die Antwort, die Ni erwartet hatte. »Sie?«
»Eine Frau. Spanisch mit einem Schuss marokkanischem Blut, glaube ich. Eine richtige Schönheit. Aber ungeduldig, genau wie Sie.«
»Wer war das?«
»Cassiopeia Vitt.«
»Und was haben Sie ihr gesagt?«
»Ich habe ihr die Lampe gezeigt.« Pau zeigte auf einen Tisch im hinteren Bereich des Saals. »Dort hat sie gestanden. Ein kostbares Stück. Ich habe sie in einem Grab aus der Zeit des Ersten Kaisers gefunden. Sie wurde … 1978 entdeckt, glaube ich. Ich habe die Lampe und alle anderen Objekte mitgenommen, als ich China 1987 verließ.«
»Wo befindet sich die Lampe jetzt?«
»Miss Vitt wollte sie kaufen. Sie hat mir ein beeindruckend hohes Angebot gemacht, und ich war in Versuchung, habe aber abgelehnt.«
Er wartete noch immer auf eine Antwort.
»Sie hat eine Pistole gezogen und die Lampe geraubt. Mir blieb keine Wahl. Ich bin nur ein alter Mann und lebe hier ganz allein.«
Das bezweifelte er. »Ein reicher alter Mann.«
Pau lächelte. »Das Leben hat es gut mit mir gemeint. Mit Ihnen auch, Herr Minister?«
»Wann war sie hier?«, fragte er.
»Vor zwei Tagen.«
Er musste diese Frau finden. »Hat sie irgendetwas über sich selbst preisgegeben?«
Pau schüttelte den Kopf. »Sie hat einfach nur die Waffe gezogen, die Lampe genommen und ist verschwunden.«
Eine verstörende Entwicklung. Aber das bedeutete kein unüberwindbares Hindernis. Man würde die Frau finden können.
»Sie haben die ganze weite Reise wegen der Lampe gemacht?«, fragte Pau. »Sagen Sie mir, hat dies etwas mit dem politischen Krieg zu tun, der bald zwischen Ihnen und Minister Karl Tang ausbrechen wird?«
Die Frage überrumpelte ihn. Pau hatte China vor langer Zeit verlassen. Was intern vor sich ging, war kein Staatsgeheimnis, aber es war auch nicht allgemein bekannt – zumindest noch nicht. Daher fragte er: »Was wissen Sie darüber?«
»Ich weiß einiges«, antwortete Pau fast im Flüsterton. »Sie sind gekommen, weil Sie wussten, dass Tang die Lampe haben wollte.«
Diese Tatsache war nur in Nis Büro bekannt. Jetzt erfüllte ihn Sorge. Dieser alte Mann war weit besser informiert, als er je angenommen hatte. Aber ihm kam noch ein anderer Gedanke. »Die Frau hat die Lampe für Tang gestohlen?«
Pau schüttelte den Kopf. »Sie wollte sie für sich selbst haben.«
»Daher haben Sie zugelassen, dass sie sie mitnahm?«
»Das erschien mir besser, als sie Minister Tang auszuhändigen. Ich hatte damit gerechnet, dass er vielleicht kommen würde, und wusste ehrlich gesagt nicht recht, was ich tun sollte. Diese Frau hat das Problem gelöst.«
Ni war sehr verwirrt und versuchte, die veränderte Situation neu einzuschätzen. Pau Wen betrachtete ihn mit Augen, die gewiss schon Vieles gesehen hatten. Ni war in der Annahme gekommen, mit dem Überraschungsbesuch bei dem älteren Exchinesen hätte er leichtes Spiel. Aber die Überraschung lag offensichtlich nicht auf Paus Seite.
»Sie und Minister Tang sind die beiden Hauptkonkurrenten um das Amt des Präsidenten und Parteigeneralsekretärs«, sagte Pau. »Der gegenwärtige Amtsinhaber ist alt und nähert sich dem Ende seiner Lebenszeit. Tang oder Ni. Alle werden sich entscheiden müssen.«
»Auf welcher Seite stehen denn Sie?«
»Auf der Seite des Einzigen, was zählt, Herr Minister. Auf Chinas Seite.«
5
Kopenhagen
Malone folgte der chinesischen Botin. Sein Verdacht hatte sich bestätigt. Sie hatte kein bestimmtes Objekt erwartet, sondern einfach nur den Auftrag, das entgegenzunehmen, was er ihr gab. Zum Teufel, sie hatte sogar mit ihm geflirtet. Er fragte sich, wie viel man ihr für diesen gefährlichen Botengang zahlte. Außerdem machte er sich Gedanken darüber, wie viel Cassiopeias Entführer wusste. Die elektronische Stimme hatte es sich nicht nehmen lassen, ihm seine Erfahrung als Regierungsagent unter die Nase zu reiben – und doch hatte man ihm eine ahnungslose Amateurin geschickt.
Er behielt die Botin im Auge, während sie sich durch die Menge schob. Der Weg, den sie einschlug, würde sie zu einem zweiten Tor an der Nordgrenze des Tivoli führen. Er beobachtete sie, wie sie den Ausgang passierte, den Boulevard dahinter überquerte und in den Strøget zurückkehrte.
Mit einem Block Abstand folgte er der Dahinschlendernden.
Sie kamen an mehreren Secondhand-Buchhandlungen vorbei, deren Besitzer seine Konkurrenten und gleichzeitig seine Freunde waren, und passierten zahllose Restaurants mit Außentischen davor. Schließlich erreichten sie den Højbro Plads. Beim Café Norden, das die Ostseite des Platzes säumte, bog sie rechts ab und schlug die Richtung zum Kirchturm von Nikolaj ein, einer alten Kirche, die inzwischen als Ausstellungssaal diente. Über eine Seitenstraße entfernte sie sich wieder von Nikolaj und wandte sich zum Magasin du Nord, Skandinaviens exklusivstem Kaufhaus.
Die Straßen wimmelten von gut gelaunten Passanten.
Fünfzig Meter weiter endete der Strøget, und Autos und Busse glitten vorbei.
Sie bog erneut in eine Seitenstraße ein.
Nun entfernte sie sich vom Kaufhaus und der verkehrsreichen Straße und näherte sich dem Kanal und den verkohlten Trümmern des Museums für griechisch-römische Kultur. Letztes Jahr war es von einem Feuer zerstört und noch nicht wieder aufgebaut worden. In jener Brandnacht war Cassiopeia Vitt aufgetaucht und hatte ihm das Leben gerettet.
Nun war es an ihm, dasselbe für sie zu tun.
Hier waren weniger Passanten unterwegs.
Viele der aus dem 18. und 19. Jahrhundert stammenden Gebäude mit den renovierten Fassaden waren einmal Bordelle gewesen, die von Kopenhagens Matrosen besucht wurden. Heute prägten Künstler und junge Selbständige die Gegend.
Die Frau verschwand um eine weitere Ecke.
Er eilte dorthin, wo sie abgebogen war, doch eine große Mülltonne versperrte ihm den Weg. Er spähte an dem Kunststoffbehälter vorbei und erblickte eine schmale Gasse mit baufälligen Backsteinwänden zu beiden Seiten.
Die Frau trat auf einen Mann zu. Er war klein, mager und nervös. Sie blieb stehen und reichte ihm den Umschlag. Der Mann riss ihn auf und schrie dann etwas auf Chinesisch. Malone brauchte nicht zu verstehen, was er sagte, um zu wissen, worum es ging. Der Mann hatte offensichtlich etwas Bestimmtes erwartet, und das war verdammt nochmal kein Buch.
Er schlug die Botin ins Gesicht.
Sie wurde zurückgeschleudert und musste um ihr Gleichgewicht kämpfen. Ihre Hand fuhr zu der getroffenen Wange.
Der Mann griff unter seine Jacke.
Eine Pistole tauchte auf.
Malone kam ihm zuvor, griff nach seiner Beretta und rief: »He!«
Der Mann fuhr herum, erblickte Malone mit seiner Waffe, packte die Frau und setzte ihr die Pistole an den Hals.
»Werfen Sie Ihre Waffe in die Mülltonne!«, schrie der Mann auf Englisch.
Malone rang mit sich, ob er das Risiko eingehen sollte, doch der entsetzte Ausdruck im Gesicht der Frau mahnte ihn zu gehorchen.
Er warf seine Pistole in die Tonne, und das Poltern, mit dem sie dort landete, ließ erkennen, dass der Behälter ansonsten leer war.
»Bleiben Sie, wo Sie sind«, sagte der Mann und zog sich mit seiner Geisel die Straße entlang zurück.
Malone durfte nicht zulassen, dass die Spur hier endete. Dies war seine einzige Möglichkeit, Cassiopeia zu finden. Der Mann und seine Gefangene schoben sich weiter dem Ausgang der Gasse zu, die dort in eine belebte Straße mündete. An der Kreuzung schlenderten zahlreiche Fußgänger in beide Richtungen.
Malone stand fünfzig Schritte entfernt und sah den beiden nach.
Plötzlich ließ der Mann die Frau los, und sie rannten gemeinsam weg.
Ni musterte Pau Wen und begriff, dass er in die Falle getappt war, die dieser raffinierte Mann ihm gestellt hatte.
»Und was ist das Beste für China?«
»Kennen Sie die Geschichte vom listigen Fuchs und dem hungrigen Tiger?«, fragte Pau.
Ni beschloss mitzuspielen und schüttelte den Kopf.
»Der Fuchs war vom Tiger gefangen worden und wehrte sich mit den Worten: ›Wage es nicht, mich zu fressen, denn ich bin allen anderen Tieren überlegen. Wenn du mich frisst, verärgerst du die Götter. Falls du mir nicht glaubst, folge mir einfach und schau, was passiert.« Der Tiger folgte dem Fuchs in den Wald, und alle Tiere rannten weg, sobald sie die beiden sahen. Der Tiger war sehr beeindruckt, denn er begriff nicht, dass er selbst die Ursache für den Schreck der Tiere war. Daher ließ er den Fuchs laufen.« Pau hielt inne. »Wer sind Sie, Herr Minister, der listige Fuchs oder der ahnungslose Tiger?«
»Anscheinend ist der eine ein Dummkopf und der andere ein Trickser.«
»Leider gibt es keine anderen Bewerber um die Herrschaft über China«, sagte Pau. »Sie und Minister Tang haben ganze Arbeit geleistet und alle anderen Herausforderer beseitigt.«
»Bin ich dann Ihrer Meinung nach der Dummkopf oder der Trickser?«
»Diese Entscheidung liegt nicht bei mir.«
»Ich versichere Ihnen, dass ich kein Dummkopf bin«, sagte Ni. »In der gesamten Volksrepublik herrscht Korruption. Es ist meine Pflicht, uns von dieser Krankheit zu befreien.«
Das war keine kleine Aufgabe in einer Nation, in der ein einziges Prozent der Bevölkerung vierzig Prozent aller Vermögenswerte besaß, meistens aufgrund von Korruption. Bürgermeister, Provinzbeamte, hochrangige Parteifunktionäre – sie alle hatte er schon festgenommen. Bestechung, Veruntreuung, widerrechtliche Inbesitznahme, moralische Verworfenheit, Vorteilsnahme, Schmuggel, Verschwendung und offener Diebstahl, all das nahm überhand.
Pau nickte. »Das System, das Mao geschaffen hat, war von Anfang an von Korruption durchsetzt. Wie könnte es auch anders sein? Wenn eine Regierung sich nicht vor dem Volk verantworten muss, wird Unehrlichkeit zur schleichenden Krankheit.«
»Haben Sie deswegen das Land verlassen?«
»Nein, Herr Minister. Ich bin gegangen, weil mir schließlich alles, was geschehen war, verhasst geworden war. So viele Menschen sind niedergemetzelt worden. Es herrscht so viel Unterdrückung und Leid. China war schon damals ein Misserfolg, und das hat sich nicht geändert. Sechzehn der zwanzig Städte mit der größten Luftverschmutzung liegen in China, und wir stoßen weltweit das meiste Schwefeldioxid aus. Der saure Regen zerstört unser Land. Wir verschmutzen das Wasser, ohne an die Folgen zu denken. Achtlos vernichten wir unsere Kultur, unsere Geschichte und unsere Selbstachtung. Die Verantwortlichen vor Ort werden nur für Wirtschaftswachstum belohnt und nicht für öffentliche Initiativen. Das System zerstört sich selbst.«