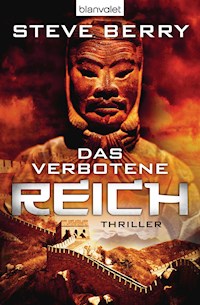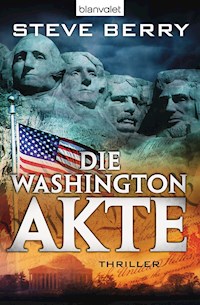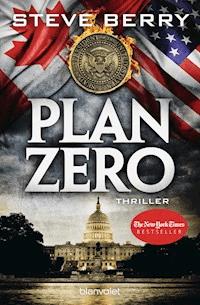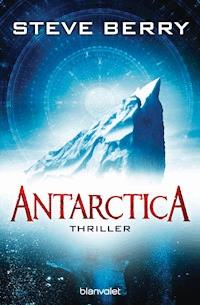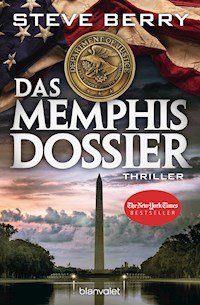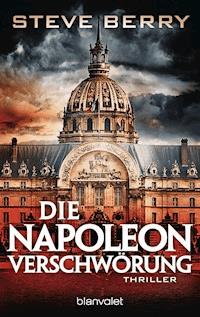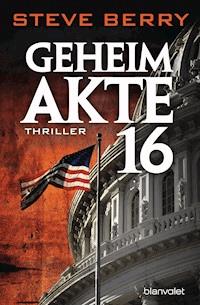9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Cotton Malone
- Sprache: Deutsch
Eine geheime Gesellschaft, ein wertvoller Schatz und ein Plan, der die USA an den Rand des Abgrundes bringen könnte ...
Sie waren einst die größte und gefährlichste Geheimorganisation der USA. Jetzt, 160 Jahre später, bleibt von den Rittern des Goldenen Zirkels nur noch die Legende über deren immensen Goldschatz, der nie gefunden wurde. Doch dann tauchen zwei Splittergruppen der ehemaligen Ritter auf, die den Reichtum in ihren Besitz bringen wollen – und bereit sind, dafür über Leichen zu gehen. Obwohl er sich aus dem Geheimdienst zurückgezogen hat, wird Cotton Malone in diesen Wettlauf hineingezogen. Denn für ihn steht nicht nur die Sicherheit der USA auf dem Spiel, sondern etwas viel persönlicheres ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 746
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Buch
»Die Ritter des Goldenen Zirkels« – einst waren sie die größte und gefährlichste Geheimorganisation der USA. Doch nun, 160 Jahre später, sind sie fast in Vergessenheit geraten. Aber noch immer sind Gold und Silber von unermesslichem Wert aus ihrem Besitz überall in den USA versteckt. Zwei Splittergruppen der ehemaligen Ritter werden nicht ruhen, bevor sie das Erbe an sich gerissen haben – und sie sind bereit, dafür alles aufs Spiel zu setzen.
Der ehemalige Geheimagent Cotton Malone gerät zwischen die Fronten des Wettlaufs um den Schatz, und er muss erkennen, dass seine Verbindung zu den Rittern enger ist, als er jemals geglaubt hätte …
Der Autor
Steve Berry war viele Jahre als erfolgreicher Anwalt tätig, bevor er seine Leidenschaft für das Schreiben entdeckte. Mit jedem seiner hochspannenden Thriller stürmt er in den USA die Spitzenplätze der Bestsellerlisten und begeistert Leser in über 50 Ländern. Steve Berry lebt mit seiner Frau in St. Augustine, Florida.
Von Steve Berry bereits erschienen
Die Napoleon-Verschwörung, Das verbotene Reich, Die Washington-Akte, Die Kolumbus-Verschwörung, Das Königskomplott, Der Lincoln-Pakt, Antarctica, Geheimakte 16, Plan Zero, Der Goldene Zirkel
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und
www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Steve Berry
DER
GOLDENE ZIRKEL
Thriller
Aus dem Amerikanischen
von Wolfgang Thon
Für die Mitarbeiter und die Geldgeber
der Smithsonian Libraries
Wären die Menschen Engel, brauchte es keine Regierung.
James Madison
[Doch] wenn wir uns zu Schafen machen,
werden die Wölfe uns fressen.
Benjamin Franklin
Prolog
Washington, D.C.
24. Januar 1865
14.45 Uhr
Er registrierte die plötzliche Unruhe in der Miene seines Gastgebers. Ein ungewöhnlicher Anblick, wenn man Joseph Henrys gefestigten Ruf als führender amerikanischer Wissenschaftler bedachte – von seinem prestigeträchtigen Titel ganz zu schweigen.
Sekretär der Smithsonian Institution.
Er saß in Henrys kühlem Büro auf einer bequemen Ledercouch, und ihr geplantes Geschäft stand kurz vor dem Abschluss. Das Treffen war schon vor Wochen vereinbart worden und hätte eigentlich gestern stattfinden sollen, doch er hatte sich verspätet. Was nicht verwunderlich war, weil in Virginia, gleich auf der anderen Flussseite, ein Bürgerkrieg wütete, dessen Wut allerdings täglich nachließ. Seit Gettysburg hatte sich alles geändert: Über 250.000 Konföderierte Soldaten waren gefallen, 250.000 vegetierten in Kriegsgefangenenlagern der Nordstaaten dahin, und weitere 125.000 waren verkrüppelt oder verwundet. War ein Sieg des Südens bisher noch denkbar gewesen, so hatte es nun den Anschein, als habe die Konföderation endgültig ihren Zenit überschritten.
»Haben Sie das gehört?«, fragte Henry.
Das hatte er tatsächlich.
Über ihren Köpfen war ein lautes Knirschen zu hören.
Das Büro befand sich in der ersten Etage hinter einem prachtvollen Buntglasfenster zwischen den beiden charakteristischen Türmen des Gebäudes.
»Es könnte auch einfach nur Eis vom Dach gerutscht sein«, sagte er zu Henry.
Es war ein bitterkalter Tag. Der Potomac floss kaum noch und war von einer dichten Eisschicht bedeckt, die die Flussschifffahrt zum Erliegen gebracht und seine Anreise verzögert hatte. Es war nicht leicht gewesen, in die nördliche Hauptstadt zu gelangen. Der Regierungsbezirk war von Forts umringt, und überall befanden sich Truppenlager. Es herrschte erhöhte Sicherheitsstufe. Man kam nur unter Auflagen und erst nach einer Befragung hinein oder hinaus. Glücklicherweise verfügte er über die erforderlichen Empfehlungsschreiben, weshalb man ihn auch mit dieser Mission betraut hatte.
Schon wieder ertönte dieses Geräusch.
Dann noch einmal.
»Es könnte Eis sein«, sagte Henry. »Ist es aber nicht.«
Sein Gastgeber stand auf und eilte zur Tür seines Büros. Er folgte ihm in einen höhlenartigen, zweigeschossigen Lesesaal, an dessen Decke sich dichter Rauch sammelte.
»Das Haus brennt«, schrie Henry. »Schlagt Alarm.«
Der Vorsitzende hastete die Treppe ins Erdgeschoss hinunter. Normalerweise fiel Tageslicht durch das runde Dachfenster und erhellte den Raum, doch jetzt war es draußen düster und geradezu unheimlich geworden. Qualm verhinderte den Blick auf die Außenwelt und drang nach und nach in die Innenräume. Er hörte schwere Schritte, Türen wurden geöffnet und geschlossen, aufgeregte Rufe ertönten. Männer strömten ins Auditorium und flüchteten dann hinunter ins Erdgeschoss. Er rannte durch einen der Korridore zur angeschlossenen Gemäldegalerie, wo Gipsbrocken aus der Decke herunterregneten und den Blick auf Flammen freigaben, die schon den Dachstuhl und das Dach erfasst hatten. Einige der Ölbilder hatten Feuer gefangen. Er war selbst Maler, deshalb erschütterte ihn der Anblick. Hier schien die Feuersbrunst besonders heftig zu wüten, was womöglich Rückschlüsse auf den Brandherd erlaubte. Doch eilig verscheuchte er den Künstler aus seinem Schädel, fing an, wie ein Aufklärer zu denken, analysierte seine Optionen und zog seine Schlüsse.
Schwarzer Qualm sammelte sich zu dichten Rauchwolken.
Man konnte kaum noch atmen.
Er war auf persönlichen, geheimen Befehl von Präsident Jefferson Davis aus Richmond angereist. Dass er Joseph Henry kannte und mit der Smithsonian Institution vertraut war, hatte ihn für die Aufgabe prädestiniert. Es gab bereits Pläne für eine geheime Friedenskonferenz, die in zwei Wochen in Hampton Roads stattfinden sollte. Lincoln beabsichtigte, daran teilzunehmen, ebenso der Vizepräsident der Konföderierten, Alexander Stephens, der bereits seit zwei Jahren den Krieg zu beenden versuchte. Jeff Davis hasste seinen stellvertretenden Oberbefehlshaber, weil er den verschwitzten Mann aus Georgia für schwach und hintertrieben hielt. Doch Stephens setzte große Hoffnungen darauf, dass ein ehrenvolles Ende des Kriegs ausgehandelt werden konnte.
Er hob den Arm und hielt sich den Ärmel seines Wollmantels schützend vor den Mund, um atmen zu können. Auf der gegenüberliegenden Seite des Lesesaals, am Ende eines weiteren Flures, verwüsteten Flammen den Instrumentensaal, dessen Sammlung seltener wissenschaftlicher Geräte schon bald vernichtet sein würde. Er wusste, dass die Innenwände sowohl auf dieser als auch auf der anderen Seite des Lesesaals nicht mit der Decke verbunden waren, damit man sie bei Bedarf zusammen mit dem Auditorium entfernen und auf diese Weise das gesamte Obergeschoss in einen zusätzlichen Ausstellungsraum verwandeln konnte. Diese zweckdienliche Einrichtung leistete dem Feuer jetzt jedoch Vorschub, das sich ungehindert an der Decke ausbreiten konnte.
»Das Gebäude ist nicht zu retten«, schrie ein Mann, der mit einem Kästchen unter dem Arm das Weite suchte. »Alle müssen raus.«
Mit dieser Einschätzung hatte dieser Mann womöglich recht, also sollte er sich beeilen. Der Zweck seines Besuches lag immer noch in Henrys Büro auf dem Schreibtisch und musste geschützt werden. Noch waren die Flammen nicht bis dorthin vorgedrungen, doch das konnte jeden Augenblick passieren. Menschen rannten herum, manche trugen Gemälde, andere Bücher und Akten, einige hielten Ausstellungsstücke in den Armen, die sie anscheinend für zu wertvoll hielten, um sie zurückzulassen. Das Gebäude war 1846 erbaut worden, nachdem der Kongress endlich darüber entschieden hatte, was mit den 500.000 Dollar geschehen sollte, die ein obskurer britischer Chemiker namens James Smithson testamentarisch gespendet hatte. Seine posthume Verfügung, wie das Geld auszugeben sei, hatte für einiges Kopfzerbrechen gesorgt.
In Washington soll eine Einrichtung mit dem Namen Smithsonian Institution gegründet werden, die der Vergrößerung und der Verbreitung des Wissens der Menschheit dienen soll.
Noch eigenartiger war der Umstand, dass Smithson, ohne im Leben auch nur einmal die Vereinigten Staaten besucht zu haben, deren Regierung sein gesamtes Vermögen vermachte.
Es hatte Jahre gedauert, bis der Kongress reagierte.
Manche waren der Auffassung, eine solche Einrichtung könne nur eine große Bibliothek sein, andere dachten an Museen, einige setzten sich für kostenlose Vortragsreihen ein, eine weitere Gruppe wollte lediglich anerkannte Fachbücher veröffentlichen. Kongressabgeordnete der Südstaaten waren grundsätzlich skeptisch, weil sie vermuteten, die angedachte Einrichtung könne so etwas wie ein Forum für jene werden, die die Abschaffung der Sklaverei befürworteten. Sie weigerten sich lange, überhaupt etwas zu unternehmen, und wollten das Geld einfach nur zurückgeben. Schließlich setzten sich die kühleren Köpfe durch, und man gründete eine Einrichtung, die eine Bibliothek, ein Museum, eine Kunstgalerie, einen Hörsaal und dazu ein großzügiges Gebäude benötigte, um alles darin unterzubringen. Das daraus resultierende Gebäude im romanischen Stil des 12. Jahrhunderts hatte lange Seitenflügel, hohe Türme, Rundbögen und ein Schieferdach, die es im Land einzigartig machten. Durch seine Form und die roten Sandsteinfassaden wirkte es wie ein Kloster. So wurde ganz bewusst ein verblüffender Kontrast zur antikisierenden Architekturmode geschaffen, die den Rest der Hauptstadt prägte. Joseph Henry hasste das fertige Produkt und nannte es ein abstruses und nahezu unbrauchbares Gebäude, einen traurigen Irrtum. Doch viele waren längst dazu übergegangen, es mit einem anderen Namen zu bezeichnen.
The Castle – die Burg.
Die jetzt brannte.
Er rannte zu Henrys Büro zurück und stellte fest, dass er dort nicht allein war. Jemand anders hatte sich bereits Einlass verschafft, und zuerst hielt er ihn für einen Mitarbeiter. Dann bemerkte er die dunkelblaue Uniform mit einem kurzen Übermantel und den Rangabzeichen eines Nordstaaten-Captains auf den Schultern. Der Mann drehte sich um und griff, ohne auch nur einen Augenblick zu zögern, nach seiner Waffe.
Er hatte zuvor bereits das Gefühl gehabt, dass ihm jemand folgte. Sein Plan war gewesen, unbemerkt in die Burg hinein- und wieder aus ihr rauszukommen. Doch nicht immer ging alles nach Plan.
Er hörte einen Schuss, und eine Kugel zersplitterte den Türrahmen, doch da war er bereits von der Tür weggesprungen. Er hatte auch bemerkt, dass es sich bei dem Revolver um eines der neuen Modelle handelte, die automatisch den Hahn spannten, auslösten und die Trommel weiterdrehten.
Teuer und selten.
Er landete im Korridor und griff nach seinem eigenen Selbstladerevolver, der in einem Holster unter seiner Jacke steckte. Er hatte gehofft, auf Gewalt verzichten zu können, doch nun schien er keine Wahl zu haben. Also stand er auf und bereitete sich darauf vor, den Mann in Henrys Büro auszuschalten. Acht Meter über ihm raste das Feuer über die Decke und schwärzte sie auf seinem Weg. Inzwischen war fast das gesamte Auditorium mit Rauch gefüllt. Brennende Holzteile regneten sowohl hier als auch in Henrys Büro von der Decke herunter. Der Captain rannte hinaus – die Waffe in der einen und das, was er für Joseph Henry mitgebracht hatte, in der anderen Hand.
»Geben Sie das dem Vorsitzenden«, hatte ihm Jefferson Davis aufgetragen und ihm einen Generalschlüssel in die Hand gedrückt. »Und bringen Sie Ihr Journal wieder mit.«
Er hatte den Band auf Henrys Schreibtisch liegen sehen, doch jetzt hatte ihn dieser Hauptmann, zusammen mit dem Schlüssel. Dass dieser Fremde ganz genau wusste, was er wollte, war beunruhigend.
Also stürzte er sich auf den Captain und warf ihn zu Boden.
Sie rollten zusammen über das Podium, vor dem sich die halbkreisförmig angeordneten Sitzreihen befanden. Der Captain machte sich los und sprang auf die Füße, doch ein Ruck an beiden Knöcheln brachte ihn aus dem Gleichgewicht, er ruderte mit den Armen durch die Luft, dann krachte der Uniformierte hart auf den Holzboden.
Der Mann ließ alles los, was er festgehalten hatte.
Er schnappte sich den Schlüssel und das Journal.
»Besten Dank«, sagte er zu dem benommenen Mann.
Er stand auf und trat die Waffe in den Qualm. Er wollte gerade veschwinden, als der Captain wieder das Bewusstsein erlangte, sich auf alle viere rollte und Anstalten machte, erneut anzugreifen.
»Muss das sein?«, murmelte er.
Er trat dem Mann mit der Stiefelspitze gegen das Kinn schickte ihn so erneut bewusstlos zu Boden.
»Das genügt hoffentlich.«
Er eilte zur Treppe und lief ins Erdgeschoss hinunter. Glücklicherweise schien sich das Feuer auf das obere Stockwerk zu beschränken, während es unten nur wenig Rauch gab. Er sah, dass das Wasser in den Kübeln, die überall im großen Saal verteilt standen – gewiss eine Vorsichtsmaßnahme für einen Fall wie diesen –, gefroren war. Die Kübel waren nutzlos, um damit die sich ausbreitende Feuersbrunst einzudämmen. Doch selbst wenn das Wasser nicht gefroren wäre, war das Feuer einfach zu groß, um es mit Eimern zu bekämpfen.
Er hörte es krachen und musste feststellen, dass große Teile des Dachs einbrachen.
Zeit zu verschwinden.
Was war mit dem Captain?
Vielleicht schaffte er es nicht, sich hinauszuretten.
Doch was ging ihn das an?
Ein Gewissen kann wirklich lästig sein.
Er schob die Waffe zurück in das Holster und steckte Schlüssel und Journal in eine Innentasche seines Mantels. Danach erklomm er – obwohl er es besser wusste – von Neuem die Treppe, fand den bewusstlosen Offizier und hievte ihn sich auf eine Schulter. Er trug den Mann hinunter und nach draußen, gerade als dampfbetriebene Feuerwehrwagen auf das Gelände rollten.
Inzwischen hatte sich eine größere Menschenmenge angesammelt.
Rauch und Flammen schlugen oben aus der Burg, sie schlängelten sich am Stein entlang und züngelten durch die Gewölbebögen und Zinnen. Aus den Fenstern regnete es Bücher, Freiwillige versuchten verzweifelt zu retten, was sich irgendwie retten ließ. Ein Turm brach zusammen und wirbelte Qualm und Funken auf. Er deponierte den Nordstaatensoldat in einiger Entfernung vom Gebäude in der Nähe anderer Leute, die infolge des Rauchs stark husteten und untersucht wurden.
Er starrte zurück zum Ort der Katastrophe.
Die Gemäldegalerie mit ihren hohen Bogenfenstern und den Wänden voller majestätischer Indianerporträts schien nicht mehr zu retten zu sein, ebenso wenig wie Henrys Büro. Die Fenster im Obergeschoss explodierten, und Glas regnete kaskadenartig herunter. Die Feuerspritzen begannen zu arbeiten, obwohl ihre Funktion durch die Kälte eingeschränkt wurde. Interessanterweise wirkte der Ostflügel des Gebäudes, wo Henry mit seiner Familie lebte, unversehrt, das Feuer konzentrierte sich auf das Obergeschoss des Westflügels.
Aber das alles war nicht sein Problem. Darum mussten sich andere kümmern, allen voran Sekretär Henry, der große Asket, der in einen unförmigen schwarzen Mantel gehüllt übers Gelände hastete und Befehle erteilte. Henry und er wechselten einen Blick, und er klopfte sich diskret auf eine Manteltasche, um anzudeuten, dass alles in Sicherheit war. Henry nickte und bestätigte, dass er verstanden hatte. Dann zuckte er leicht mit dem Kopf und neigte ihn nach einer Seite – ein Zeichen, dass er nun gehen solle.
Ein exzellenter Rat.
Joseph Henry spielte zweifellos ein gefährliches Spiel. Einerseits hatte er in der permanenten Abteilung der Kriegsmarine gedient und die Union in Fragen wie der Verwendung von Ballons im Krieg, neuer Waffen, ja sogar der Kohleförderung in Zentralamerika beraten. Andererseits war er zutiefst von seiner Verantwortung gegenüber dem Weltwissen und seinen Verpflichtungen als Vorsitzender der Smithsonian Institution überzeugt. Im Einklang mit diesen Idealen weigerte er sich, über der Burg die amerikanische Flagge zu hissen, er widersetzte sich dem Ansinnen, Unionstruppen einzuquartieren und betonte, dass es sich bei der Smithsonian Institution um eine neutrale, internationale wissenschaftliche Organisation handelte. Seine noch aus Vorkriegszeiten herrührende Freundschaft mit Jefferson Davis war kein Geheimnis, und das heutige Treffen war von Henry direkt mit Richmond vereinbart worden. Die chiffrierten Nachrichten waren mittels Brieftauben überbracht worden.
Ein Trupp von Unionssoldaten traf auf dem Gelände ein.
Es war definitiv Zeit zum Aufbruch.
Er mischte sich unter die Menge und entfernte sich langsam. Einige Gesichter der Umstehenden, die das Spektakel beobachteten, erkannte er. Offenbar hatten sich sogar Mitglieder des Kongresses eingefunden. Viele bekannte republikanische Politiker des Nordens standen in der Kälte. Das Journal ruhte sicher unter dem Mantel dicht an seiner Brust. Er war auf sich allein gestellt und auf einer Mission unterwegs.
Wie er es am liebsten hatte.
Die Soldaten hatten sich verteilt und kontrollierten jetzt die Menschenmenge. Seltsam, denn eigentlich sollten sie sich doch um das Feuer kümmern. Dann sah er den Captain von vorhin, der wieder auf den Beinen war und die Suche befehligte.
Eine Reihe von Kutschen stand in der Nähe geparkt, ihre Fahrgäste starrten auf das brennende Gebäude im trüben Nachmittagslicht. Er konzentrierte sich auf eine Kutsche, in deren Fenster er das hübsche ovale Gesicht einer Frau mittleren Alters sah, das von schulterlangem braunem Haar umrahmt wurde. Um den Hals trug sie eine Kette. Das goldene Medaillon bildete einen starken Kontrast zu ihrem schwarzen Mantel, der wegen der Kälte fest zugeknöpft war.
Er betrachtete das Symbol.
Ein Kreuz in einem Kreis.
Die Soldaten kamen immer näher, doch er bewegte sich weiter auf die Kutsche zu und hielt den Kopf gesenkt. Der Hals tat ihm weh von den tiefen Atemzügen in der eiskalten Luft.
Er erreichte sein Ziel. »Was wir sind, werdet ihr sein«, sagte er.
Sie lächelte. »Wie poetisch.«
»Vielleicht wissen Sie auch, wie der Spruch weitergeht?«
»Was ihr seid, waren wir einst.«
Es war der genaue Wortlaut in korrekter Betonung. Dabei handelte es sich um ein Epitaph, das er einmal auf einem alten Grabstein gesehen hatte; der Stein war ihm im Gedächtnis geblieben. Und genau so erging es ihm auch jetzt. Es fiel ihm schwer, etwas zu vergessen. Einzelheiten blieben ewig in seinem Gedächtnis, eine Begabung, die ihm in den letzten Jahren oft dienlich gewesen war. Ursprünglich hätte er diese attraktive Frau gleich nach dem Verlassen der Burg treffen sollen. Geplant war, dass sie um genau sechzehn Uhr hier auf der 10. Straße vorbeifahren sollte.
»Steigen Sie doch bitte ein«, sagte sie.
Er stieg ein, zog die Kutschentür hinter sich zu und setzte sich ihr gegenüber auf einen Platz, an dem er nicht gesehen werden konnte.
»Das war knapp. Man hätte Sie entdecken können«, flüsterte sie.
»Möglich.«
Er ließ sich seine Angst nur selten anmerken und schaffte es, sogar in großer Gefahr ruhig zu bleiben. Doch sobald die Gefährdung nachgelassen hatte, schien es immer einen kurzen Moment des Innehaltens zu geben, ein Entspannungsgefühl, das zugleich Erleichterung und Sicherheit bedeutete.
So wie jetzt.
Sie ließ die Kette wieder unter ihrer Jacke verschwinden. Dann befahl sie dem Kutscher loszufahren, und das Pferd setzte sich in Bewegung. Geplant war, dass er seine Geschäfte mit dem Vorsitzenden Henry zu Ende bringen und sich im Laufe des folgenden Abends mit dieser Frau für den zweiten Teil seiner Mission treffen sollte. In Washington hatte die Ballsaison bereits begonnen – es war die Zeit der Feste, der Gesellschaften und der Morgenempfänge. Die Zusammenkunft heute Abend im Haus des Marineministers Gideon Welles würde wie immer ein prachtvolles Ereignis mit nachhaltigen Auswirkungen sein. Nahezu 75.000 Menschen lebten in der Bundeshauptstadt, von denen ein Drittel den Südstaaten zugeneigt war. Es wäre seine Aufgabe gewesen, dort mit dieser Frau am Arm teilzunehmen und die Ohren offen zu halten. Das war schließlich die Hauptbeschäftigung eines Spions. Doch das war nun nicht mehr möglich.
Die Dinge hatten sich geändert.
Wenigstens hatte er noch den Schlüssel und das Journal in seinem Besitz.
Es war nicht nötig, die Begegnung mit dem Nordstaatenoffizier zu erwähnen. Das ging nur Jefferson Davis etwas an. Doch er war seiner Retterin zu Dank verpflichtet, deshalb nickte er ihr lächelnd zu.
»Angus Adams, Ma’am«, stellte er sich vor.
Sie erwiderte das Lächeln. »Marianne McLoughlin. Meine Freunde nennen mich Mary.«
»Sehr erfreut, Sie kennenzulernen, Mary. Meine Freunde nennen mich Cotton.«
GEGENWART
1
Westliches Arkansas
Dienstag, 25. Mai
13.06 Uhr
Cotton Malone konzentrierte sich auf den Schatz.
Die Suche hatte vor drei Stunden begonnen, als er die nahegelegene Berghütte verließ und zwanzig Meilen entfernt an den nördlichen Ausläufern des Ouachita-Nationalparks abgesetzt wurde – inmitten von 1,8 Millionen Hektar eines alten Baumbestandes aus Eichen, Birken, Kiefern und Ulmen. Diese Wildnis war ein Anziehungspunkt für Naturbegeisterte, doch vor 150 Jahren war sie auch ein Zufluchtsort für Gesetzlose gewesen, weil das hügelige Gelände hervorragende Verstecke für Diebesgut und Menschen bot.
Er unterstützte das Nationalmuseum für amerikanische Geschichte mit einem Forschungsauftrag, den er gerne angenommen hatte. Normalerweise war es seine alte Chefin Stephanie Nelle, die ihn entweder mit ins Boot holte oder geradewegs anheuerte, doch diesmal kam der Ruf vom Kanzler des Smithsonian persönlich, dem Vorsitzenden des Obersten Gerichts der Vereinigten Staaten, der ihm das Problem erläutert und genügend Informationen bereitgestellt hatte, um sein Interesse zu wecken. Das angebotene Honorar in Höhe von 25.000 Dollar war ebenfalls überaus großzügig gewesen. Allerdings hätte er den Auftrag auch gratis übernommen, weil er für das Smithsonian eine Menge übrighatte.
Und wem hätte es nicht gefallen, nach einem vergrabenen Schatz zu suchen.
Die Wälder, die ihn umgaben, erstreckten sich von den zerklüfteten Plateaus der Ozarks an der nördlichen Staatsgrenze bis zu den sanften Hügeln der Ouachitas im Süden. Dazwischen lagen Täler, Anhöhen, tiefe Schluchten, Höhlen und unzählige Flüsse und Bäche. Alles in allem war es ein Paradies, das er noch nie zuvor besucht hatte – ein weiterer Grund, warum er den Auftrag angenommen hatte.
Er war mit der Technologie des 21. Jahrhunderts angerückt und hatte ein Magnetometer, einen GPS-Tracker und die Startkoordinaten dabei. Mit dem GPS-Navigationsgerät stapfte er zwischen den Bäumen hindurch und näherte sich dem mit X gekennzeichneten Punkt, den ihm der Satellit hoffentlich weisen würde, der Hunderte von Meilen über ihm flog.
Das Ganze war ein spannendes Unternehmen.
Ein Referenzbibliothekar namens Martin Thomas, der im Museum für amerikanische Geschichte arbeitete, hatte eine Sammlung alter Karten, Aufzeichnungen und Tagebücher aus der riesigen Sammlung der Smithsonian Institution studiert. Die Unterlagen waren nicht für die Öffentlichkeit zugänglich und dokumentierten eine Untersuchung des Smithsonian, zu der auch eine bereits im Jahr 1909 durchgeführte Expedition ins westliche Arkansas gehörte. Die Reise war ergebnislos geblieben, wenn man davon absah, dass der leitende Wissenschaftler von ein paar Jägern getötet wurde, die ihn mit einem Hirsch verwechselten. Es konnte ein Unfall gewesen sein, doch Cotton war nicht so naiv zu glauben, dass ein lokal gewählter Sheriff nie die Interessen seiner Wählerschaft berücksichtigte – und das ländliche Arkansas war zu Beginn des 20. Jahrhunderts geradezu der Inbegriff des Lokalen.
Deshalb konnte man leicht Dinge unter den Teppich kehren.
Die GPS-Peilung zeigte ständig andere Zahlen.
Er passte seine Laufrichtung an, ging weiter und suchte zwischen den Bäumen. Die vergangenen drei Tage hatte er in Washington verbracht und sich durch dieselben Expeditionsaufzeichnungen, Bücher, Papiere, Karten und Dokumente gearbeitet, die bereits Martin Thomas’ Aufmerksamkeit gefesselt hatten. Er konnte jedoch mit dem Segen des Kanzlers darauf zugreifen und hatte ausführlich recherchiert, was ihn hier vor Ort in Arkansas womöglich erwartete. Aufzeichnungen jüngeren Datums von Thomas selbst beschrieben einen bestimmten Orientierungspunkt, der schon vor langer Zeit als Kartenbaum bezeichnet und mit den genauen Koordinaten eingetragen worden war. Die hilfsbereite Hüterin der Berghütte hatte ihn mit weiteren Informationen versorgt und ihm vage die Gegend beschrieben, in der die stattliche Buche zu finden war.
Der GPS-Sender piepte.
Ein X markierte die Stelle.
Da war er.
Der Baum war knapp zwanzig Meter hoch. In seinen Stamm waren fünfundsechzig Inschriften geschnitzt. Das wusste er, weil Thomas vor einem Monat hier gewesen war und sie gezählt hatte. Und dann war etwas passiert. Eine kopflose Puppe baumelte über dem Pfad, den Thomas am Tag zuvor gekreuzt hatte. Sie hing von einem Baum herunter, und Jeans und ihr Hemd waren von Kugeln durchlöchert. Ringsum waren Petruskreuze auf die Baumstämme gesprayt. Ein Häufchen verschossener Gewehrpatronenhülsen lag dabei, zu dem ein Faden führte, der an der Puppe seinen Anfang nahm. Die Botschaft war klar.
Verschwinde!
Es hatte funktioniert.
Thomas war geflüchtet.
Aber diesmal war ein Profi gekommen, der Ärger gewohnt war. Er ging zum Baum und sah die Schnitzereien in der Rinde. Ein Kreuz, eine Glocke, ein Pferd ohne Beine, ein Vogel, eine Gestalt, die wie ein Priester aussah, und viele Buchstaben, Symbole und Ziffern. Ein Botaniker im Naturkundemuseum hatte ihm erklärt, dass Buchenrinde in der äußersten Schicht nachwuchs und so eine glatte Oberfläche bildete, in der Einkerbungen erhalten blieben – anders als bei Eichen, deren Borke von innen nachwuchs und Oberflächenmarkierungen auslöschte. Viele der Einkerbungen waren mit Moos gefüllt, andere durch Jahrzehnte des Wachstums gestreckt oder verändert worden, doch die meisten ließen sich erkennen. Er hatte einen weichen Nylonpinsel im Rucksack, mit dem er vorsichtig die Flechten entfernte, wodurch weitere Details sichtbar wurden. Er hatte sich vorgenommen, mögliche Lesarten zu erkunden, momentan spielten sie jedoch keine Rolle. Vielmehr suchte er von diesem Baum als Ausgangspunkt nach einem anderen Baum.
Und er entdeckte ihn, etwa zehn Meter von ihm entfernt.
Es war eine große Roteiche, deren Äste vor langer Zeit zu einer unnatürlichen Form zurechtgeschnitten worden waren und jetzt wie Torpfosten emporragten. Hinter dem Baum sichtete er einen Pfad und richtete das GPS-Gerät darauf aus. Er musste eine gerade Linie gehen, bei der er den Ort, an dem er stand, als einen, die Torpfosten als anderen Referenzpunkt nahm. Nun musste er darauf achten, dass der Längengrad, der auf seinem GPS-Gerät angezeigt wurde, unverändert blieb, während er in nördlicher Richtung ging und lediglich den Breitengrad veränderte. Er staunte, wie dies bereits vor Jahrzehnten allein durch kühle Überlegung bewerkstelligt werden konnte.
Er ging weiter. Es gab kaum noch Unterholz und dafür mächtige Baumstämme. Sonnenlicht fiel durch die Blätter der frühlingshaften Baumwipfel und tanzte über den Boden. Auf seiner verschwitzten, klebrigen Haut spürte er die Hitze und die Feuchtigkeit, die sich wie ein Handtuch auf ihn legte und ihn an die Tage erinnerte, die er als Knabe im mittleren Georgia verbracht hatte. Nicht ganz zwanzig Meter von dem Kartenbaum entfernt, stieß er auf einen von Flechten überwucherten Steinhaufen. Man hatte ihm aufgetragen, explizit nach so etwas zu suchen. Er bückte sich und untersuchte den Haufen, nahm auch den Pinsel zu Hilfe, um die grüne Patina zu entfernen. Auf einem Stein, der fast auf Bodenniveau lag, entdeckte er die Ziffer Sieben, die in den Stein geschlagen war.
Sie war da, wenn auch kaum zu erkennen.
Er hob den softballgroßen Stein und drehte ihn um. Nach kurzem Bürsten entdeckte er zwei Buchstaben.
SE.
Er hatte herausgefunden, dass in diesem Wald absichtlich viele Wegmarken platziert wurden. Sie waren so raffiniert angebracht, teilweise auch so offensichtlich, dass niemand auf die Idee gekommen war, sie zu beachten. Dieser Steinhaufen war ein perfektes Beispiel dafür. Er blieb nichtssagend, bis man ihn tatsächlich genauer Betrachtung unterzog. Ihm kam etwas in den Sinn, was sein Großvater einst gesagt hatte.
»Was nützt es, Beute zu verstecken, wenn man sie dann nicht wiederfinden kann?«
Ganz genau.
Er ging davon aus, dass SE »südöstlich« bedeutete. Die 7? Wer weiß? Wahrscheinlich war es nur eine falsche Fährte. Niemand wäre auf die Idee gekommen, den Stein umzudrehen. Doch für jemanden, der Bescheid wusste und gekommen war, um das zu bergen, was immer hier auch versteckt sein mochte, zog diese 7 wie ein Großplakat die Aufmerksamkeit auf sich. Ihm war bekannt, dass die 7 für den Geheimbund, der jene Beute vermutlich versteckt hatte, eine symbolische Bedeutung hatte. Sie lautete: »Die Zugbrücke ist heruntergelassen, keine Hindernisse voraus.« Das gehörte zu ihrer kryptischen Geheimsprache.
Er schaltete das Magnetometer ein, auf dessen Einsatz er bisher verzichtet hatte, um die Batterien zu schonen. Dann wandte er sich nach Südosten, die Richtung, die ihn wieder zurück zum Kartenbaum führen würde, und konzentrierte sich. Die Expeditionsberichte von 1909 hatten von weiteren versteckten Wegweisern berichtet.
Ein geniales Sicherheitssystem.
Beweis menschlichen Erfindungsgeistes.
Er hielt das Magnetometer knapp über den Erdboden. In der anderen Hand hielt er das GPS-Gerät; so beschritt er eine gerade Linie in südöstlicher Richtung und schwenkte dabei den Metalldetektor hin und her. Nach zwanzig Metern summte das Instrument. Er legte alles beiseite und zog eine faltbare Schaufel aus dem Rucksack. Auf den Knien bearbeitete er vorsichtig die Fläche über der Fundstelle, der weiche, lehmige Boden löste sich in feuchten Klumpen. In fünfzehn Zentimetern Tiefe stieß er auf eine stark verrostete Pflugschar. Ihm war klar, dass er sie unangetastet lassen und ihre Botschaft entschlüsseln musste.
Er entfernte die Erde und sah, wohin der Pflug wies.
Südwestlich.
Eigentlich verwunderlich, dass der Gegenstand überhaupt da war. Aus den Expeditionsberichten von 1909 war hervorgegangen, dass auch Hufbeschläge für Pferde und Maultiere, Spitzhacken, Axtköpfe und natürlich auch Pflugscharen etwa zehn bis fünfzehn Zentimeter tief vergraben lagen. Tief genug, um unentdeckt zu bleiben, aber nicht so tief, dass eine Kompassnadel nicht darauf ansprach. Wenn man einen Kompass über ein vergrabenes Eisenteil bewegt, wird die Nadel darauf reagieren, ebenso wie eine Heftklammer in der Nähe eines Magneten selbst magnetische Eigenschaften anzunehmen beginnt. Als Martin Thomas vor einem Monat hier war, hatte er die Theorie bereits mit einer neuen Pflugschar ausprobiert und notiert, dass es funktionierte. Nicht annähernd so gut wie ein Magnetometer, aber definitiv wie dessen Ururgroßvater. Nur der Lauf der Zeit war nicht in die Gleichung einbezogen worden. Oxidation verringerte die magnetischen Eigenschaften, deshalb stand zu bezweifeln, dass ein Kompass heutzutage von großem Nutzen sein könnte. Gott sei Dank gab es die moderne Technologie.
Er spürte die Spannung in seiner Brust.
Das hier war wirklich aufregend.
Sein Großvater hätte es genossen.
Allerdings war es auch eine ernste Angelegenheit, weil hier vor langer Zeit ein Mann gestorben und Martin Thomas erst vor Kurzem von hier verschreckt worden war.
Also blieb er auf der Hut, nahm die Instrumente zur Hand und ging weiter in südwestlicher Richtung. Nach zwanzig Metern entdeckte er eine weitere vergrabene Markierung. Diesmal handelte es sich um einen Axtkopf. Auch dieser wies nach Südwesten. Er setzte seine Schritte vorsichtig und grub ebenso sorgfältig. In dieser Gegend gab es Klapperschlangen, und gerade jetzt können ein paar aus ihren Löchern gekrochen sein, um den heißen Nachmittag zu genießen. Ein weiterer Grund, weshalb sich die Beretta gut greifbar im Holster in seinem Rucksack befand.
Die Linie, der er gefolgt war, hatte ihn direkt zum Kartenbaum zurückgeführt, er war ein großes Dreieck gegangen. Nun wusste er, auf welchen Bereich er sich schwerpunktmäßig konzentrieren musste. Jetzt kam nicht mehr das gesamte unbebaute Land von Arkansas infrage, sondern es ging nur noch um den Raum, der von den Linien eingefasst wurde, die er gerade abgeschritten hatte.
Zielstrebig ging er ins Zentrum dieses Bereichs.
Die verspiegelten mattschwarzen Gläser seiner Sonnenbrille dämpften die blendend helle Sonne. Überall in den Ästen waren Vögel, Eichhörnchen und Insekten zu hören. Dieser Teil von Arkansas war ein wunderschönes und verborgenes Kleinod fast im Herzen des Landes. Die Gegend war vor eineinhalb Jahrhunderten noch schwer zugänglich gewesen, und viel hatte sich nicht verändert. Der größte Unterschied bestand darin, dass inzwischen der Nationalparkservice dafür sorgte, alles in unberührtem Zustand zu belassen. Er war sich nicht ganz sicher, ob er sich bereits im Nationalpark befand, musste jedoch verdammt nah dran sein.
Historisch betrachtet, hatte es niemals nennenswerte Goldfunde in Arkansas gegeben, auch wenn sich die Legenden darüber hartnäckig hielten. Dabei handelte es sich nicht um Gold, wie man es aus klaren Flüssen oder Adern gewinnt, sondern um Gold, das versteckt worden war. Den Ursprung der Geschichten bildeten die Spanier, die im 16. Jahrhundert Hunderte von Goldverstecken im mittleren Westen und im Westen angelegt haben sollen. Doch auch Gesetzlose hatten sich in diesen Wäldern versteckt. Und dann gab es eine weitere Gruppe. Aus dem 19. Jahrhundert.
Die Ritter vom Goldenen Zirkel.
Der hier seine Blütezeit gehabt hatte.
Vor sich, fast im Mittelpunkt des Dreiecks, gewahrte er jetzt einen großen Ahorn mit einer langen vertikalen Linie, die in seine Rinde eingewachsen war.
Man konnte sie kaum erkennen.
Doch sie war da.
Er schwenkte das Magnetometer über den Boden rings um den Baum, und es jaulte förmlich auf, um einen Fund anzuzeigen. Wieder auf den Knien, grub er vorsichtig. Zehn Zentimeter – nichts. Er grub weiter. Nach knapp einem halben Meter stieß er schließlich auf etwas Hartes. Ein Objekt, so tief vergraben, dass kein Kompass es hier entdecken konnte.
Und er wusste, was das bedeutete.
Es war ein Hauptgewinn, den nur bekam, wer die anderen Hinweise entschlüsseln konnte und genau wusste, wo er zu graben hatte.
Ja, so viel stand fest: Dies war das Eigentum der Ritter vom Goldenen Zirkel.
Er räumte die Erde beiseite, denn er hatte ein Glasgefäß mit einem Metalldeckel entdeckt, der schon vor langer Zeit durchgerostet war. Dieses Glas förderte er zutage; es hatte circa eine halbe Gallone Fassungsvermögen. Sobald es am Tageslicht war, entdeckte er, dass es ein Hort von eng gepackten Goldmünzen war, deren Glanz die Zeit fast nichts hatte anhaben können. Er versuchte abzuschätzen, wie viele davon in dem Glas sein mochten. Man hatte ihm aufgetragen, alles zu fotografieren, bevor er es berührte, deshalb legte er das Glas auf den Boden, zog sein Handy heraus und schaltete die Kamera ein.
Er wollte gerade ein paar Schnappschüsse machen, als er etwas hörte.
Da bewegte sich etwas.
Schnell.
Es kam näher.
Er griff in den Rucksack, zog die Beretta und wirbelte herum. Er nahm jedoch nur noch eine dunkle Gestalt und die charakteristische Kontur eines Gewehrs wahr.
Und beides kam rasend schnell in seine Richtung.
Dann war nichts mehr.
2
Östliches Tennessee
16.50 Uhr
Danny Daniels hasste Beerdigungen und mied sie so gut er konnte. Als Präsident der Vereinigten Staaten hatte er nur sehr wenige und ausgewählte besucht und diese düstere Aufgabe normalerweise an andere delegiert. Jetzt, als Ex-Präsident, konnte er niemanden mehr an seiner Stelle schicken. Doch das spielte keine Rolle. Bei dieser Beerdigung machte er eine Ausnahme von seiner Regel.
Er kannte den Verstorbenen schon seit seiner Zeit als Stadtverordneter in Maryville. Damals hatte Alex Sherwood im Repräsentantenhaus von Tennessee gesessen. Schließlich waren sie beide aufgestiegen – er in den Gouverneurspalast, den Kongress und schließlich ins Weiße Haus und Sherwood zum Senatspräsidenten von Tennessee und in den Senat der Vereinigen Staaten von Amerika. Zwei Jungs vom Land, von denen jeder seinen eigenen Weg zum Erfolg beschritt.
Während seiner zwei Amtszeiten im Weißen Haus hatte er sich immer auf Alex verlassen. Er wusste, dass sein alter Freund selbst gern Präsident geworden wäre, wozu es aber nicht gekommen war. Schnell mit Lob bei der Hand und sehr zurückhaltend mit Kritik – das war Alex. Kurz: einfach zu nett. Um das Präsidentenamt zu erfüllen, brauchte man eine Vielzahl von Qualitäten. Es ging nicht allein darum, Entscheidungen zu treffen, sondern man musste auch alle anderen davon überzeugen können, dass man sich seiner Sache ganz sicher war. Und manchmal war es nötig, anderen gehörig den Kopf zu waschen – eine Fähigkeit, auf die sich sein alter Freund nie verstanden hatte. Er versuchte es stets höflich, freundlich und mit Argumenten. Was in vielen Fällen einfach nicht funktionierte.
Es nieselte leicht vom grauen Frühlingshimmel. Die Trauergäste standen unter einem Meer von Regenschirmen. Bei seinem Aufbruch zu Hause hatte er nur einen Regenmantel übergezogen, damit sein Anzug nicht nass wurde. Seine Präsidentschaft hatte vor vier Monaten geendet, und er war nach Hause ins Blount County, Tennessee, zurückgekehrt.
Um ein neues Leben zu beginnen.
»Folgen Sie uns bitte«, sagte der Pfarrer und bat die Trauergemeinde, zur Grabstätte zu prozessieren.
In der Kirche hatten sich über 500 Personen eingefunden, der Trauergottesdienst war für die Öffentlichkeit zugänglich gewesen. Doch hier, auf dem alten, baumbestandenen Friedhof, mit dem Vorgebirge der Appalachen im Osten, gab es nur noch weniger als hundert geladene Gäste, bei denen es sich ausschließlich um Verwandte oder enge Freunde handelte. Keine Presse. Der US-Senat wurde durch den Mehrheitsführer und acht seiner Kollegen repräsentiert. Auch das Repräsentantenhaus hatte eine Abordnung geschickt, an deren Spitze der Senatspräsident, der Speaker, persönlich stand. Für den gegenwärtigen Speaker hatte er nie besonders viel übriggehabt; es handelte sich um einen überheblichen, aufgeblasenen Esel aus South Carolina namens Lucius Vance. Sie gehörten unterschiedlichen Parteien an, entstammten unterschiedlichen Bundesstaaten und hatten unterschiedliche Denkweisen. Vance verstand es jedoch meisterhaft, seine Kollegen zufriedenzustellen, sich Unterstützung zu verschaffen und die tausend Verpflichtungen zu jonglieren, die nötig waren, sein Amt zu behalten. Er war ein erfahrener Abgeordneter des Repräsentantenhauses und daran gewöhnt, sich alle zwei Jahre im Amt bestätigen zu lassen. Gleichzeitig war er sich der Tatsache wohl bewusst, wie schnell die öffentliche Anerkennung in Hass umschlagen konnte. Vor neun Jahren hatten ihn diese Erfahrung und über zwanzig Jahre in der Politik endlich mit genügend politischem Einfluss versehen, um ihn ins Amt des Speakers, des Senatspräsidenten, zu hieven. Vance wurde zum zweiundsechzigsten Amtsinhaber.
Früher hatte Danny die Opposition genau im Auge behalten und jeden ihrer Schritte gekannt. War das wirklich erst vier Monate her? Jetzt machte er das jedenfalls nicht mehr. Was spielte es auch für eine Rolle? Ex-Präsidenten hatten nur selten etwas zu melden. Ihre einzige Aufgabe bestand darin, allmählich in der Versenkung zu verschwinden. Vance hingegen stand noch unter Strom – er war pragmatisch, präzise und hielt die Zügel der Macht fest in der Hand. Acht Jahre lang hatte Vance wie ein Stachel im Fleisch des Daniels-Kabinetts auf jede nur erdenkliche Weise versucht, sämtliche Initiativen des Weißen Hauses zu Fall zu bringen.
Es war ihm viel zu häufig gelungen.
Aber das war jetzt nicht mehr Dannys Problem.
Diese Aufgabe fiel jetzt Präsident Warner Scott Fox zu, der den Vorteil hatte, zur selben Partei wie Vance zu gehören.
Auch wenn das womöglich gar nichts zu bedeuten hatte.
Der Kongress zerfleischte sich regelmäßig selbst.
Die Trauergäste drängten sich um ein großes Zelt, das in der Nähe der Grabstelle aufgestellt worden war. Alex’ Witwe Diane saß mit im Schoß gefalteten Händen darunter. Die Ehe der Sherwoods hatte lange gehalten – im Gegensatz zu seiner. Er und Pauline hatten bereits die Scheidungspapiere unterzeichnet. Sie hatten sich darauf geeinigt, sich am 1. Juli scheiden zu lassen und ihre Beziehung zu beenden. Bis dahin hatten die Menschen den ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten und seine First Lady längst vergessen.
Interessant, wie sich die Dinge verändert hatten.
Vor nicht allzu langer Zeit war er der wichtigste Mann der Welt gewesen. Tausende arbeiteten rund um die Uhr, um ihn zufriedenzustellen. Er war der Oberbefehlshaber der mächtigsten Armee der Welt. Seine Entscheidungen beeinflussten das Leben von Hunderten Millionen Menschen. Und jetzt war er wieder ein gewöhnlicher Bürger. Alex Sherwood war jedoch vor noch kürzerer Zeit noch am Leben gewesen. Deshalb durfte er sich nicht beklagen. Pauline schien mit ihrem neuen Leben und ihrer neuen Liebe glücklich zu sein. Und er war glücklich mit Stephanie Nelle. Manche Leute mochten die ganze Sache seltsam finden. Er nannte es den Lauf der Dinge. Er hatte seine Pflicht erfüllt und seinem Land gedient. Und Pauline hatte das auch getan. Jetzt war für sie beide die Zeit gekommen, an sich selbst zu denken.
Er ging über das feuchte Gras und blieb am Rand unter dem Zelt stehen, von wo er den Priester noch hören konnte, obwohl der Regen auf die Zeltleinwand über ihm prasselte. Der Gouverneur war anwesend, ein weiterer Freund und die Delegation der Abgeordneten. Diane hatte sich anscheinend genau ans Protokoll gehalten und keine Schlüsselfigur ausgelassen.
Der Pfarrer redete aus dem Stegreif über Tod und Auferstehung und dann über Alex, den er persönlich gekannt hatte. Auch dies gehörte zu den Dingen, die Danny an Beerdigungen hasste: Priester, die so taten, als ob. Dieser jedoch sprach von Herzen. Plötzlich fühlte er sich alt, obwohl dazu kein Grund bestand. Er würde bald das fünfundsechzigste Lebensjahr vollenden, womit ihm das Recht auf eine Pension zustand, was er jedoch ablehnen wollte, so wie er auch den Schutz durch den Secret Service ablehnte, der allen Ex-Präsidenten angeboten wurde. Noch mehr Babysitter war das Letzte, worauf er Lust hatte. Es war die Zeit gekommen, in jeglicher Hinsicht frei zu sein.
Ein kleines Kontingent vom Secret Service war anwesend, um den Sprecher des Repräsentantenhauses zu schützen. Vance stand mit einem Schirm in der Hand draußen vor dem Zelt – er war ein attraktiver Mann mit einem dichten schwarzen Haarschopf und kupferbraunen Augen. Keine Castingagentur hätte jemanden finden können, der rein äußerlich die Rolle des Sprechers das Repräsentantenhaus hätte besser darstellen können. Fünfzehn Jahre trennten die beiden, doch es fühlte sich eher wie 1.500 an. Macht stärkte und zehrte einen zugleich aus, insbesondere die Macht jener Art, wie zwei Amtszeiten im Weißen Haus sie mit sich brachten.
Dann kreuzten sich seine Blicke mit Vance, der ihn so unbeteiligt und kühl ansah wie eine Schaufensterpuppe – ein Blick, der nichts preisgeben sollte. Doch dann erwies der amtierende Vorsitzende des Repräsentantenhauses dem ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten mit einem leichten Kopfnicken seine Referenz. Danny war beeindruckt. Das war mehr Höflichkeit, als er in den gesamten vergangenen acht Jahren von ihm erfahren hatte. Es war allerdings leicht, jemanden mit Anstand zu behandeln, der einem keinen Schaden mehr zufügen konnte.
Jetzt fühlte er sich noch älter.
Er sollte so etwas wie eine Selbsthilfegruppe gründen. So etwas wie NIMEWI – nicht mehr wichtig –, für Leute, die sich gegenseitig durch die Entzugserscheinungen halfen, wenn sie süchtig nach der Macht gewesen waren. Manche, die aus öffentlichen Ämtern ausschieden, waren froh, endlich herauszukommen. Einige wenige schlugen Kapital aus ihren Erfahrungen und verdienten damit Geld. Dann gab es Akteure wie ihn, die nicht wussten, was sie sonst tun sollten. Für Danny war der Begriff Politiker kein Schimpfwort. Es bezeichnete einfach nur einen »Kompromissler«. Denn genau so lief der Hase. Das politische sine qua non war keine abstrakte Vision, sondern Konsens. Niemandem, weder ihm selbst noch Lucius Vance oder Warner Fox gelang es, seine Vorstellungen immer zu hundert Prozent durchzusetzen. Der Trick bestand darin, bei jeder sich bietenden Gelegenheit so viel wie möglich herauszuschlagen. Wenn der Deal, den du willst, unmöglich ist, dann mach den besten Deal, den du kriegen kannst. Das war stets sein Motto gewesen. Und seine legislativen Erfolge als Präsident waren respektabel, obwohl Männer wie Lucius Vance sich nach besten Kräften dagegengestellt hatten.
Der Priester kam zum Ende, die Trauergäste zogen mit ausdruckslosen Gesichtern am Sarg vorbei und erwiesen durch ein Kopfnicken, durch sanfte Berührungen oder durch ergriffene, mitfühlende Blicke ihren Respekt. Er beobachtete Vance, der, als er an die Reihe kam, sanft Dianes Hand schüttelte und danach einen Moment mit ihr redete.
Er wartete, dann stellte er sich in die Schlange.
Ein paar alte Bekannte grüßten ihn.
Blount County gab es seit 1795, es war nach dem damaligen örtlichen Gouverneur benannt. Maryville, die Bezirkshauptstadt, trug den Namen der Frau des Gouverneurs. So viel zum Thema Eitelkeiten. Das Land hatte einst den Tscherokesen gehört, dann wurde es ihnen von den Farmern gestohlen, die von Virginia und North Carolina aus westwärts zogen. Seine Vorfahren hatten zu jenen entschlossenen Siedlern gehört. Die Landschaften waren grün und üppig, die bewaldeten Hügel zogen sich wie Ozeanwellen bis in die Ferne. Die Blue-Ridge-Berge rahmten alles ein, und in mehreren Nationalparks war schon vor langer Zeit der Holzeinschlag eingestellt worden. Es gab 200 Kirchen im Bezirk, was wohl eine Art Rekord darstellte. Der berühmteste Einwohner war vermutlich er selbst, obwohl Alex Sherwood dicht hinter ihm folgte. Doch hier, unter Freunden, war er weder Präsident noch Ex-Präsident. Niemand nannte ihn bei seinem Taufnamen Robert Edward Daniels jr. Hier war er einfach Danny, der Typ, der mal in der Stadtverordnetenversammlung von Maryville gesessen hatte.
Und so gefiel es ihm.
Er kam an die Reihe und trat an Diane heran. Sie trug ein elegantes schwarzes Kleid mit einem Spitzenschleier und umklammerte ein Knäuel Papiertaschentücher in der unbehandschuhten Hand. Er verbeugte sich an ihrem Stuhl, und sie ließ sich von ihm kondolieren.
»Danke, dass Sie gekommen sind«, sagte sie.
Eigentlich war ihm an Diane nichts gelegen. Schon seit jeher. Sie mochte ihn auch nicht. Nun hätte er wohl ihre Hände umfassen oder dergleichen tun sollen, doch auf Tuchfühlung zu gehen war nicht sein Ding. »Ich werde ihn vermissen.« Das war alles, was er sagte.
»Bitte«, sagte sie. »Kommen Sie doch noch anschließend zum Empfang ins Haus.«
Er hatte nicht vorgehabt, nach der Beerdigung noch an einer Trauerfeier teilzunehmen, und gehofft, ihr und dem hohlen Geschwätz zu entgehen, das im östlichen Tennessee auf eine Beerdigung folgte. Allerdings wollte er auch keine Szene machen. »Die Zeit nehme ich mir auf jeden Fall.«
Was er ganz sicher nicht tun würde.
Er flüchtete aus dem Zelt und ging durch den Regen zu seinem Auto zurück. Viele Erinnerungen knüpften sich an diesen Friedhof. Seine Onkel, seine Großeltern und seine Eltern waren alle hier.
Und es gab noch ein anderes Grab.
Seine Tochter.
Sie war vor Jahrzehnten bei einem Brand umgekommen. In jener Nacht war auch ein Teil von ihm und von Pauline gestorben. Sie war ihr einziges Kind gewesen, und nach ihrem Tod gab es keine weiteren. Kein Tag verging, an dem er nicht an sie dachte. Es war schon Jahre her, seit er zum letzten Mal das Grab besucht hatte. Und seine Weigerung, sich mit ihrem tragischen Tod auseinanderzusetzen, hatte viel zu der Entfremdung zwischen ihm und Pauline beigetragen.
Er löste sich aus der Menge und bahnte sich einen Weg durch die Reihen mit Grabsteinen und Wegweisern; der regennasse Friedhof lag still und verschattet da. Er gelangte zur Südseite der Anhöhe und der Grabstelle seiner Tochter unter der alten Eiche. Der Rasen war dicht, kurz geschnitten und in einem guten Zustand. Auf dem Grabstein, der bündig in der Erde lag, stand nur ihr Name, der Geburts- und Todestag und dazu der einfache Satz: Unsere geliebte Tochter. Er stand mit den Händen in den Taschen da, der Regen klebte ihm das Haar an den Kopf, und er bat sie ein weiteres Mal um Vergebung.
So viel Zeit war vergangen.
Doch der Schmerz war noch so frisch, als wäre es erst gestern geschehen.
Ein allzu bekanntes Gefühl der Leere rumorte in seinen Eingeweiden. Er schloss die Augen und versuchte, nicht zu weinen. Sein Leben lang hatte er versucht, unerschütterlich zu wirken und nie etwas an sich herangelassen.
Das hier war die eine Ausnahme.
»Ich muss mit Ihnen reden«, sagte eine weibliche Stimme.
Er fasste sich rasch, denn er hatte nicht bemerkt, dass jemand so nah war. Als er sich umdrehte, sah er eine Frau, vielleicht Ende fünfzig, mit vollem, strähnigem Haar und weit geöffneten braunen Augen.
»Wer sind Sie?«, fragte er.
»Eine Freundin von Alex.«
»Davon sind heute eine Menge hier.«
»Mr. President …«
Er streckte eine Hand hoch und fiel ihr ins Wort. »Ich heiße Danny.«
Sie bedachte ihn mit einem müden Lächeln. »Na schön, Danny. Da gibt es etwas, das Sie wissen müssen.«
Er wartete.
»Alex wurde ermordet.«
Der jahrelange politische Nahkampf hatte ihn gelehrt, wie wertvoll es war, ein Pokerface aufzusetzen – insbesondere dann, wenn das Gegenüber auf eine Reaktion aus war. Deshalb setzte er eine starre Miene auf und ließ zu, dass der Regen ihm die Tränen aus den Augen wusch.
»Sie haben meine Frage nicht beantwortet«, sagte er. »Wer sind Sie?«
»Ich muss mit Ihnen reden. Unter vier Augen.«
Das war auch keine Antwort. »Wie kommen Sie auf die Idee, dass Alex ermordet wurde?«
»Es gibt keine andere vernünftige Erklärung dafür.«
3
Arkansas
Cotton inspizierte sein Gefängnis. Es war etwas Besonderes, das musste er zugeben. Er hockte in irgendeinem uralten gußeisernen Verbrennungsofen, einem Zylinder mit einem Durchmesser von etwa 2,5 Metern und einer Höhe von circa acht Metern. Mittlerweile hatte er jeden Zentimeter der rostigen Innenseite untersucht und keine Schwachstellen entdeckt. Vom Boden aus, auf dem er jetzt saß, konnte man nur durch eine jetzt verschlossene Eisenklappe flüchten, die sich nach außen öffnete. Wie sehr er sich auch anstrengte, sie bewegte sich keinen Millimeter. Die Luft war klamm und stank, hinzu kamen feine Rostpartikel. Er war in dem Ofen aufgewacht, nachdem er vermutlich etliche Stunden bewusstlos gewesen war. An seinem Haaransatz war eine Beule von der Größe eines halben Dollars gewachsen.
Jemand hatte ihm heftig eins übergezogen.
Die Nachmittagshitze der strahlenden Sonne hatte sein stählernes Gefängnis in eine Hölle verwandelt. Durch Schlitze im Dach, die ein Flechtwerk von Schatten an die rostigen Seitenwände warfen, waren Moskitos eingedrungen, und jetzt juckte es ihn überall. Er saß da und dachte darüber nach, dass er schon wieder seinen Buchladen in Kopenhagen im Stich gelassen hatte. Er schien mehr und mehr unterwegs zu sein, anstatt sich in seinem heimischen Ambiente aufzuhalten. Glücklicherweise konnte er sich auf die Leute, die für ihn arbeiteten, verlassen.
Und immerhin ging es diesmal wenigstens um einen vergrabenen Schatz.
Weder Goldmünzen noch Rucksack, Telefon, Sonnenbrille, Waffe oder eines seiner Werkzeuge waren mit ihm im Gefängnis gelandet. Was ihn nicht sonderlich überraschte. Wahrscheinlich erfreute sich dieser Dinge die Person, die ihn k.o. geschlagen hatte. Normalerweise bereiteten ihm abgeschlossene Räume Probleme, doch hier konnte er die Nachmittagssonne über sich sehen und sich einigermaßen frei bewegen, deshalb war es nicht ganz so schlimm. Wie in der Natur – wenn auch leicht eingeschränkt.
Wegen der Hitze prickelte es in seinen Fingerspitzen, und der Durst war zum Problem geworden. Über ihm brummte eine Fliege, durchflog die Streifen des Sonnenlichts und kam näher. Es konnte nicht mehr lange dauern, bis sichdieserOrtineinen unerträglichen Glutofen verwandelte – und er ging davon aus, dass gerade dies die Absicht war: ihn hier draußen einfach sich selbst zu überlassen. Er hätte sich die Lunge aus dem Hals schreien können, ohne dass ihn jemand hörte, denn ringsum gab es meilenweit nichts als menschenleere Wälder. Er vertrieb diesen verheißungsvollen Gedanken mit einem Handschlag nach der Fliege aus seinem Kopf. Das Insekt kehrte nicht mehr zurück. Seine Schläfen pochten, und ihm war schwindelig. Außerdem hatte er einen Krampf in der linken Schulter und fühlte sich steif.
Für solche Dinge wurde er wirklich allmählich zu alt.
Ein lauter Schlag auf die Außenseite erschreckte ihn, so sehr hatte er sich schon an die Stille gewöhnt. Er wartete auf das Knirschen von Metall auf Metall – dass das Schloss der Klappe aufgeschlossen wurde.
Doch nichts geschah.
Stattdessen schlug etwas auf das Gitter über ihm.
Er starrte nach oben und sah ein dickes Seil, das zwischen den Gitterstäben hindurchgeschoben und zu ihm herabgelassen wurde. Ans Ende war ein Stein gebunden, der das Seil herunterzog.
Es landete ein paar Schritte entfernt auf dem Boden.
Zwischen Seil und Stein klemmte eine handschriftliche Notiz.
Hast du mich vermisst?
Cotton schüttelte den Kopf und grinste, dann band er den Stein los und ruckte am Seil.
Fest.
Es konnte losgehen.
Er wusste, was er zu tun hatte, deshalb stemmte er die Stiefel an die Eisenwand und arbeitete sich nach oben. Seine Unterarme und Schultern schmerzten vom Aufstieg, doch er schaffte es bis nach oben, fasste einen der verrosteten Träger und hoffte, dass er noch stabil genug war, um ihn halten zu können. Dann schwenkte er sich aufwärts und trat das Gitter weg. Ihm war schon von unten aufgefallen, dass die Gitter in dem Rahmen nur lose auflagen und vom Rost schon ganz verzogen waren. Das Gitter, auf das er losging, widersetzte sich quietschend, flog dann aber himmelwärts.
Mühsam kletterte er durch die Öffnung und hielt sich an einem weiteren alten Träger fest, seine Blicke suchten links und rechts, er war zufrieden, es sah weiterhin sicher aus. Ein kleines Gebäude ragte einige Meter in die Höhe, Teil eines Schornsteins, der einst den Qualm nach oben gelenkt hatte. Er richtete sich auf, balancierte wie ein Akrobat über das warme Metall und suchte die Stelle, wo das Seil nach unten lief.
Cassiopeia Vitt stand unten im dichten Unterholz. Der Verbrennungsofen war ringsum von Bäumen umgeben.
»Hättest du nicht einfach die Tür aufmachen können?«, fragte er sie.
»Hängt ein Schloss davor.«
»Und warum hast du es nicht mit einem Dietrich probiert?«
Er wusste, dass sie immer die richtigen Werkzeuge dabeihatte.
»Es ist ein Zahlenschloss. Also musste ich mir ein Seil besorgen, was gar nicht so einfach war.«
»Du hättest dich wenigstens mal bemerkbar machen und mir sagen können, was du da treibst.«
Sie grinste ihn an. »Wo wäre denn da der Spaß geblieben?«
Erst heute Morgen hatten sie sich getrennt. Sie hatte ihn im Nationalpark abgesetzt und war dann weitergefahren, um die Park Ranger zu besuchen, denn sie wollte probieren, weitere Informationen von ihnen zu bekommen. Ihn zu finden konnte nicht schwer gewesen sein, weil er eine Uhr aus den Beständen des Magellan Billet trug, die mit einem GPS-Sender versehen war und ihr Smartphone in der Lage war, das Signal zu empfangen.
»Ich vermute, du hast auch etwas Gutes zu berichten?«, fragte sie.
»Wirklich zum Totlachen.«
Es ging über acht Meter in die Tiefe, deshalb holte er das Seil ein, das noch im Verbrennungsofen hing, warf den Stein weg und band das Seilende an einen der Träger. Sein Aussichtspunkt war so hoch, dass er ebenjenen Hügelrücken aus Sandstein ausmachen konnte, den er zuvor mit GPS-Koordinaten lokalisiert und zum Ausgangspunkt seiner Suche gemacht hatte.
Er war gar nicht weit davon entfernt.
Ein Schuss hallte, und nur wenige Schritte von ihm entfernt prallte eine Kugel vom Eisen ab.
Er ließ sich auf den Träger fallen, legte sich flach hin und ging hinter dem alten, aufgesetzten Schornstein in Deckung. Schweiß brannte ihm in den Augen. Er blinzelte die Feuchtigkeit weg und entdeckte den Schützen hinter den Bäumen in etwa fünfzig Metern Entfernung. Dieser hatte ein Gewehr dabei und hockte auf einem benachbarten Hügelkamm, wo er hinter einigen großen Felsblöcken in Deckung gegangen war. Der Schütze veränderte seine Position, wahrscheinlich weil er nach einer besseren Schusslinie suchte.
»Schatz.«
Er hörte ihren herablassenden Tonfall, mit dem sie zu ihm heraufrief.
»Zieh das Seil hoch.«
Er tat, was sie verlangte.
Ans Seilende war eine 9-Millimeter-Pistole gebunden. Es stand ihm nicht zu, das Geschenk zurückzuweisen, also befreite er die Waffe, legte an und wartete, bis sich der Gewehrschütze hinter einem anderen Felsspalt blicken ließ.
Er drückte zweimal ab.
Die Schüsse prallten von den fernen Felsen ab, als hätte er Steine geworfen.
Der Angreifer ging aus der Feuerlinie hinter einem Haufen Felsen in Deckung. Das gab ihm Gelegenheit, die Waffe in den Gürtel zu stecken, das Seil über den Rand zu werfen und sich nach unten abzulassen. Jetzt boten ihm der Verbrennungsofen und die Bäume Deckung.
»Du siehst furchtbar aus«, sagte sie, als seine Füße den Boden berührten.
Er war schweißüberströmt, unrasiert. Und er stank. Schmutz und Dreck bedeckten seine Kleidung, und seine Hände waren vom Rost rot gefärbt. Sie dagegen sah wirklich toll aus und bewegte sich mit der Geschmeidigkeit eines Menschen, der sich in bequemen Jeans recht wohlfühlt. Ihr rabenschwarzes Haar, das ihr normalerweise über die Schultern fiel, hatte sie zu einem festen Knoten zurückgebunden. Ihre kaffeebraune Haut schien an die Hitze gewöhnt zu sein, was zum Teil wohl ihrer spanischen Herkunft zuzuschreiben war, und ihr sinnliches Gesicht war schön und aufrichtig – sie war der Typ Frau, bei der ein kurzer erster Blick leicht in Starren übergehen konnte. Er kontrollierte seine Atmung und versuchte, trotz des Adrenalins einen kühlen Kopf zu bekommen.
»Tut die Beule auf deiner Stirn weh?«, fragte sie.
Er schüttelte vehement den Kopf, um seine Vitalität zu beweisen. Sein Verstand arbeitete langsam wieder auf Hochtouren, und er ging alle Möglichkeiten durch. Platz eins auf seiner To-do-Liste war jetzt herauszufinden, wer ihn angegriffen hatte, und sein gesunder Menschenverstand sagte ihm, dass die Antwort auf diese Frage auf der Anhöhe zu finden war.
»Du gehst weiter und versuchst, die Aufmerksamkeit des Schützen auf dich zu lenken«, sagte er ihr. »Das Unterholz ist zu dicht, als dass jemand auf dich anlegen könnte. Versuch, so viel Lärm wie möglich zu machen, damit er sich auf dich konzentriert. Ich werde versuchen, ihm in den Rücken zu fallen und herauszufinden, wer er ist.«
»Ich glaube, die Leute vom Smithsonian haben keine Ahnung, was hier vor sich geht.«
»Das ist eine Untertreibung«, sagte er. »Ich hätte beinahe Gary mitgenommen.«
Sein siebzehnjähriger Sohn hatte darum gebettelt, mitkommen zu dürfen, und er hätte fast nachgegeben, doch die Warnung vor möglichem Ärger, die Martin Thomas nach seiner gescheiterten Expedition ausgesprochen hatte, hatten ihn aus Sicherheitsgründen davon abgehalten.
Er fühlte sich immer noch etwas benommen, und jeder Atemzug schmerzte stechend in seiner Kehle. »Hast du einen Schluck Wasser?«
Sie kramte eine Plastikflasche aus ihrem Rucksack. Er drehte den Deckel ab, schüttete sich etwas von der lauwarmen Flüssigkeit in den Mund und versuchte, den metallischen Geschmack zu ignorieren. Jemand hatte ihn im Wald beobachtet, jemand, der genau wusste, wo er sich am besten aufstellte und der in der Lage war, unbemerkt in seine Nähe zu kommen. Dann hatte ihn dieser Jemand – oder waren es mehrere? – hierhergetragen und in diese Eisenbüchse geworfen.
Jemand hatte sich viel Mühe gegeben.
Doch weshalb?
Wurde Zeit, das herauszufinden.
4
Danny parkte den Wagen auf dem leeren Parkplatz vor der Missionskirche der Baptisten. Neben ihm auf dem Beifahrersitz saß die Frau vom Friedhof. Es war etwas verrückt für einen Ex-Präsidenten, ganz allein mit einer völlig Fremden unterwegs zu sein, aber sein Bauchgefühl sagte ihm, dass diese Lady keine Bedrohung darstellte. Noch immer prasselten Regentropfen auf Dach, Motorhaube und Windschutzscheibe. Sie hatten sich in aller Stille von der Beerdigung entfernt und waren unbemerkt entwischt.
»Nun, wollen Sie mir auch irgendwann Ihren Namen verraten?«, fragte er.
»Alex meinte, Sie und er seien die besten Freunde. Stimmt das?«
»Wie lange waren Sie und er befreundet?«, fragte er zurück.
Er wäre nie auf die Idee gekommen, dass Alex Sherwood ein Ehebrecher war.
»Wir kannten uns seit sechs Jahren«, antwortete sie.
Das schockte ihn noch mehr. »Wie konnten Sie das geheim halten?«
»Weil wir wirklich nur Freunde waren. Sonst nichts. Er hat nie etwas getan, das seine Ehe hätte gefährden können.«
»Und wie fand seine Frau diese Freundschaft?«
»Ich habe keine Ahnung. Sie kam nur ein paarmal im Jahr nach Washington. Ihr Ehemann schien sie bei diesen Besuchen am wenigsten zu interessieren.«
Ihr verächtlicher Unterton entging ihm nicht. Doch es war nichts Ungewöhnliches für die Ehegatten von Kongressabgeordneten, zu Hause zu bleiben. Die meisten hatten entweder Jobs oder Kinder, um die sie sich kümmern mussten, und das Leben in Washington, D.C., war nicht billig. Anders als in der Öffentlichkeit weithin vermutet, war die überwältigende Mehrheit der Menschen im Kongress nicht reich, und die Gehälter, die ihnen gezahlt wurden, reichten kaum aus, um die Kosten für ihren Dienst zu decken.
»Ich habe gegenüber von Alex gewohnt«, erwiderte sie. »Wir sind lange Zeit Nachbarn gewesen. Er war ein liebenswürdiger Mann. Ich sehe, dass Sie mir nicht glauben, aber Sex spielte bei dem, was wir einander bedeuteten, keine Rolle.«
Er konnte die Selbstkontrolle seines alten Freundes gut nachvollziehen. Er und Stephanie waren anfangs Feinde gewesen, dann Freunde, und jetzt noch viel mehr, doch all das ebenfalls, ohne dass er seine Ehe gebrochen hätte.
»Wir waren gern zusammen«, sagte sie, »haben zusammen gegessen, einen Film angeschaut oder gelesen. Er sprach davon, sich in zwei Jahren aus der Politik zurückzuziehen.«
Noch eine Überraschung. »Wie sollte es dann weitergehen?«
»Er sagte mir, dass er sich von seiner Frau scheiden lassen wollte.«
»Ihretwegen?«
»Das weiß ich nicht. Wir haben nicht oft über sie geredet. Aber in den letzten Wochen wurde er etwas gesprächiger. Und er war kein widerlicher Ehemann, der sich bei einer anderen Frau ausweint. Er wirkte einfach wie ein unglücklicher Mann, der sich mit seiner Frau auseinandergelebt hatte.«
»Und dass es Sie gab, hatte nichts damit zu tun?«
»Als er mir seine Scheidungsabsichten mitteilte, war ich total geschockt. Aber ich würde nicht sagen, dass mir die Aussicht nicht gefiel. Er meinte, er würde es tun, wenn er nicht mehr in der Öffentlichkeit stünde. Ich weiß, was Sie denken – das liegt auf der Hand. Doch er meinte, es sei auf diese Weise für alle Beteiligten am einfachsten.«
Er hatte für diese Philosophie das vollste Verständnis, denn er hatte ja genauso gehandelt. Der einzige Unterschied war, dass er und Pauline sich gemeinsam darauf geeinigt hatten, ihre Ehe zu beenden.
»Sie müssen wissen, dass ich nicht mit Alex zusammen war, damit er seine Ehe beendet, um mit mir zusammen zu sein. Es stand nie zur Debatte, dass wir beide zusammenkommen. Jedenfalls nicht bis vor Kurzem. Ich war mit Alex zusammen, weil ich ihn lieben lernte, und ich glaube, er liebte mich auch. Die Entscheidung, seine Ehe zu beenden, war jedoch ganz allein seine eigene. Ich habe keinen Druck ausgeübt.«
Sie hatte eine ängstliche, besorgte Miene und zog die Mundwinkel herunter. Nichts an dieser Frau wirkte flatterhaft oder gefühlsduselig. Er glaubte ihr jedes Wort.
»Gut, aber kommen Sie jetzt bitte zur Sache!«, forderte er sie auf.
»In den Wochen vor seinem Tod war Alex wirklich besorgt. Schuld daran war ein Notizbuch, in dem er immer wieder las.«
Sie besaß seine ungeteilte Aufmerksamkeit.
»Es war ungefähr so groß.« Sie formte mit den Händen ein Rechteck, das circa achtzehn Zentimeter hoch und dreizehn Zentimeter breit war. »Er hat in der letzten Zeit oft abends darin herumgeblättert.«
»Woher stammte es?«
»Von seinem Schwager.«
Von ihm wusste Danny nicht mehr als den Namen – Kenneth Layne –, und dass er ein politisches Aktionsbündnis leitete, das etwas mit Volksvertretern aus dem ganzen Land zu tun hatte.
»Sie wissen doch bestimmt, wie Alex sich in seine Themen hineinsteigern konnte«, sagte sie.