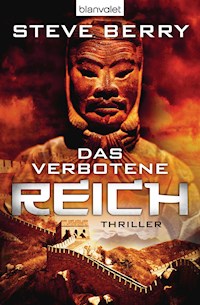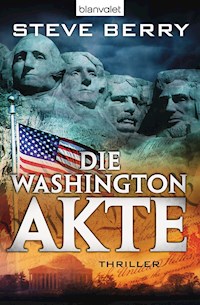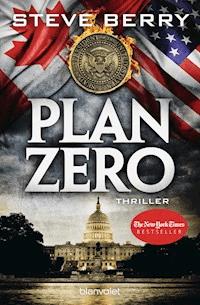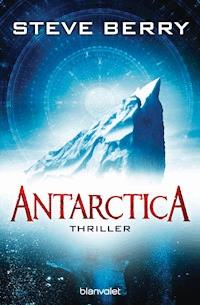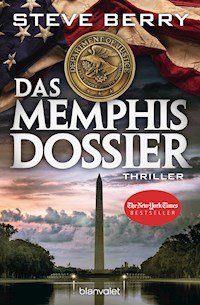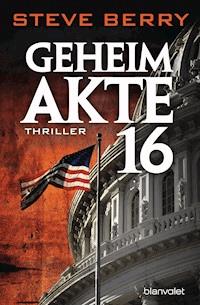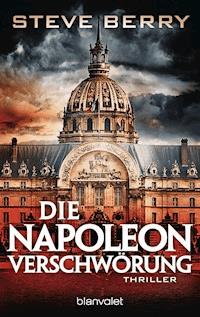
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Cotton Malone
- Sprache: Deutsch
Ein skrupelloser Killer, eine internationale Verschwörung und ein uraltes Geheimnis
Als Napoleon 1821 starb, nahm er sein größtes Geheimnis mit ins Grab: das Versteck seines Privatschatzes. Selbst in seinem Testament wird es nicht erwähnt. Oder vielleicht doch? Nach einer Schießerei wird Ex-Spezialagent Cotton Malone von seinem Freund Henrik Thorvaldsen kontaktiert, der die heimtückischen Pläne des elitären Paris Clubs aufgedeckt hat. Mit Hilfe von Napoleons legendärem Schatz wollen die Klubmitglieder die Weltwirtschaft zum Kollabieren bringen. Um diese Pläne zu vereiteln, muss Malone Napoleons Vermächtnis finden, doch ihm bleibt nicht viel Zeit: Ein international gesuchter Attentäter wurde damit beauftragt, Paris in die Luft zu jagen ...
Dieser Roman war zuvor unter dem Titel "Der Korse" bei Blanvalet erhältlich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 585
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Das Buch
Eine internationale Finanzverschwörung und die packende Suche nach dem verlorenen Privatschatz von Napoleon Bonaparte führen den ehemaligen Agenten Cotton Malone nach Paris. Gemeinsam mit Sam Collins, einem früheren Secret-Service-Mann, soll er dort im Auftrag des dänischen Multimillionärs Henrik Thorvaldsen der ominösen Verbindung »Paris Club« auf die Spur kommen.
Thorvaldsen will an den beiden Mördern seines Sohnes Cai endlich Rache nehmen. Cai, ein junger dänischer Diplomat, war zwei Jahre zuvor mit seiner Freundin, einer mexikanischen Staatsanwältin, auf offener Straße in Mexico City erschossen worden. Cais Freundin führte damals Ermittlungen gegen zwei international bekannte Kunsträuber durch, den Spanier Amando Cabral und den Briten Lord Graham Ashby. Alles deutet hin auf eine Verbindung zwischen den Kunsträubern und dem »Paris Club« …
Der Autor
Steve Berry war viele Jahre als erfolgreicher Anwalt tätig, bevor er seine Leidenschaft für das Schreiben entdeckte. Mit jedem seiner hochspannenden Thriller stürmt er in den USA die Spitzenplätze der Bestsellerliste. Steve Berry lebt mit Frau und Tochter in Camden County, Georgia.
Bei Blanvalet von Steve Berry erschienen:
Das verbotene Reich; Die Washington-Akte; Die Kolumbus-Verschwörung; Der Lincoln-Pakt; Antarctica; Geheimakte 16; Die Napoleon-Verschwörung
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und
www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Steve Berry
Die Napoleon-
Verschwörung
Thriller
Aus dem Amerikanischen
von Barbara Ostrop
Mit Dank und tiefer Wertschätzung
für Gina Centrello, Libby McGuire, Kim Hovey, Cindy Murray, Christine Cabello, Carole Lowenstein und Rachel Kind
Geld hat kein Vaterland;
Finanzleute kennen weder Patriotismus noch Anstand;
ihr einziges Ziel ist der Gewinn.
– Napoleon Bonaparte
Die Geschichte zeigt uns, dass Geldwechsler jede Form von Missbrauch, Intrige, Verrat und Gewalt benutzt haben, um ihre Kontrolle über Regierungen aufrechtzuerhalten.
– James Madison
Lasst mich das Geld einer Nation emittieren und kontrollieren, und mir ist es gleichgültig, wer die Gesetze schreibt.
– Mayer Amschel Rothschild
Prolog
Gizeh-Plateau, Ägypten
August 1799
General Napoleon Bonaparte stieg vom Pferd und ließ seinen Blick die Pyramide hinaufwandern. Daneben lagen noch zwei weitere Pyramiden, doch dies hier war die größte der drei.
Welchen gewaltigen Lohn seine Eroberung doch erbracht hatte!
Der gestrige Ritt von Kairo – erst durch Felder, die an schlammige Bewässerungskanäle grenzten, und dann rasch über eine Strecke windgefegten Sandes – war ereignislos verlaufen. Zweihundert Bewaffnete hatten ihn begleitet, da es tollkühn gewesen wäre, sich allein so weit nach Ägypten hineinzuwagen. Er hatte seine Truppe in einem Kilometer Entfernung zurückgelassen, wo sie für die Nacht lagerte. Der Tag war wieder heiß und trocken gewesen, und er hatte seinen Besuch absichtlich bis zum Sonnenuntergang aufgeschoben.
Vor fünfzehn Monaten war er mit 34.000 Mann, 1.000 Kanonen, 700 Pferden und 100.000 Schuss Munition in der Nähe von Alexandria gelandet. Er war rasch nach Süden marschiert und hatte die Hauptstadt Kairo eingenommen, wobei es sein Ziel gewesen war, jeden Widerstand durch Schnelligkeit und den Überraschungsmoment im Keim zu ersticken. Dann hatte er die Mamelucken nicht weit von hier in einem glorreichen Kampf besiegt, den er »Die Schlacht bei den Pyramiden« genannt hatte. Jene ehemaligen türkischen Sklaven hatten Ägypten fünfhundert Jahre lang regiert, und was für einen Anblick sie geboten hatten – Tausende von Kriegern in bunten Gewändern auf großartigen Hengsten. Noch meinte er, das Schießpulver zu riechen und das Donnern der Kanonen, die Schüsse der Musketen und die Schreie der Sterbenden zu hören. Seine Truppen, darunter viele Veteranen aus dem Feldzug in Italien, hatten tapfer gekämpft. Und während seine eigenen Verluste sich auf nicht mehr als zweihundert Gefallene belaufen hatten, hatte er praktisch die ganze feindliche Armee gefangen genommen und die vollständige Kontrolle über Unterägypten erlangt. Ein Reporter hatte geschrieben: Eine Handvoll Franzosen hat ein Viertel der Welt unterworfen.
Das war natürlich übertrieben, aber es klang wundervoll.
Die Ägypter hatten ihn Sultan ElKebir genannt – ein Ehrentitel, wie sie ihm versichert hatten. Während er diese Nation in den vergangenen vierzehn Monaten als Oberbefehlshaber regiert hatte, hatte er entdeckt, dass er die Wüste so liebte wie andere Menschen das Meer. Außerdem liebte er die ägyptische Lebensart, wo Besitz wenig zählte und Charakter viel.
Und genau wie er vertrauten die Ägypter der Vorsehung.
»Willkommen, Général. Was für ein wunderbarer Abend für einen Besuch«, rief Gaspard Monge auf seine übliche fröhliche Art. Napoleon mochte den kämpferischen Geodäten, einen älteren Franzosen, Sohn eines Hausierers, der mit einem breiten Gesicht, tief liegenden Augen und einer fleischigen Nase gesegnet war. Obwohl er ein Wissenschaftler war, trug Monge stets Gewehr und Pulverhorn mit sich herum, als wäre er allzeit bereit, in eine Revolution oder in eine Schlacht zu ziehen. Er war einer von hundertsechzig Gelehrten, Naturwissenschaftlern und Künstlern – Savants hatte die Presse sie genannt –, die mit Napoleon aus Frankreich hierher gereist waren, denn der General war nicht nur gekommen, um zu erobern, sondern auch, um zu lernen. Sein geistiges Vorbild, Alexander der Große, hatte es bei seinem Einmarsch in Persien genauso gehalten. Monge hatte Napoleon schon in Italien begleitet und dort schließlich die Plünderung des Landes überwacht, weshalb der General ihm vertraute.
Bis zu einem gewissen Grad.
»Wissen Sie, Gaspard, als Kind wollte ich Naturwissenschaften studieren. In Paris habe ich während der Revolution mehrere Vorlesungen in Chemie besucht. Aber leider haben die Umstände mich zum Armeeoffizier gemacht.«
Einer der ägyptischen Arbeiter führte Napoleons Pferd weg, aber vorher nahm der General noch eine Ledertasche herunter. Er und Monge standen jetzt allein da, im leuchtenden Staub, der im Schatten der großen Pyramide tanzte.
»Vor ein paar Tagen«, fuhr Napoleon fort, »habe ich eine Berechnung durchgeführt und festgestellt, dass diese drei Pyramiden genug Steine enthalten, um ganz Paris mit einer drei Meter hohen und ein Meter breiten Mauer zu umgeben.«
Monge schien über diese Behauptung nachzudenken. »Das könnte durchaus stimmen, Général.«
Napoleon lächelte über die ausweichende Antwort. »So spricht der zweifelnde Mathematiker.«
»Ganz und gar nicht. Ich finde es einfach nur interessant, wie Sie diese Bauwerke betrachten. Wichtig sind Ihnen nicht etwa die Pharaonen oder die in den Pyramiden angelegten Grabstätten oder zumindest die verblüffenden bautechnischen Leistungen, die zu ihrer Errichtung nötig waren. Nein, Sie sehen sie nur im Hinblick auf die Interessen Frankreichs.«
»So drängt es sich mir auf. Ich denke an kaum etwas anderes.«
Seit Napoleons Aufbruch war Frankreich tief erschüttert worden. Die einstmals große Flotte war von den Briten zerstört worden, so dass er nun hier in Ägypten abgeschnitten war. Das herrschende Direktorium schien fest entschlossen, mit jeder Monarchie in seiner Nachbarschaft Krieg zu führen, und machte sich Spanien, Preußen, Österreich und Holland zum Feind. Konflikte erschienen dem Direktorium als Möglichkeit, seine Herrschaft zu verlängern und den dahinschmelzenden Staatsschatz aufzufüllen.
Lächerlich.
Die Republik war gescheitert.
Eine der wenigen europäischen Zeitungen, die den Weg über das Mittelmeer gefunden hatten, sagte voraus, es sei nur eine Frage der Zeit, bis ein neuer Ludwig auf Frankreichs Thron sitzen werde.
Napoleon musste nach Hause zurückkehren.
Alles, was ihm teuer war, schien zusammenzubrechen.
»Frankreich braucht Sie«, sagte Monge.
»Jetzt sprechen Sie wie ein wahrer Revolutionär.«
Sein Freund lachte. »Was ich, wie Sie wissen, ja auch bin.«
Vor sieben Jahren hatte Napoleon zugesehen, wie andere Revolutionäre den Tuilerienpalast gestürmt und Ludwig XVI. entthront hatten. Danach hatte er der neuen Republik treu gedient und bei Toulon gekämpft. Im Anschluss war er zum Brigadegeneral, dann zum General der Ostarmee und schließlich zum Befehlshaber in Italien befördert worden. Von dort war er nach Norden marschiert, hatte Österreich eingenommen und war als Nationalheld nach Paris zurückgekehrt. Und jetzt hatte er mit kaum dreißig Jahren als General der Orientarmee Ägypten erobert.
Doch sein Schicksal war es, Frankreich zu regieren.
»Welch ein Überfluss an wundervollen Dingen«, sagte er, erneut die großen Pyramiden bewundernd.
Während seines Ritts vom Lager hierher hatte er Arbeitern dabei zugesehen, wie sie eine halb begrabene Sphinx vom Sand befreiten. Er hatte die Ausgrabung persönlich angeordnet und freute sich über die Fortschritte.
»Diese Pyramide hier liegt Kairo am nächsten, daher nennen wir sie die Erste«, sagte Monge. Er zeigte auf die nächste Pyramide. »Die Zweite. Die, die am weitesten weg liegt, ist die Dritte. Wenn wir die Hieroglyphen lesen könnten, würden wir vielleicht die wahren Namen der Bauwerke erfahren.«
Das sah Napoleon genauso. Keiner konnte die sonderbaren Zeichen verstehen, die auf beinahe jedem der alten Monumente auftauchten. Er hatte befohlen, sie zu kopieren, und es waren so viele Zeichnungen entstanden, dass seine Künstler alle aus Frankreich mitgebrachten Bleistifte verbraucht hatten. Monge war dann derjenige gewesen, der eine Methode ausgetüftelt hatte, geschmolzene Bleikugeln in Nilschilf zu gießen und so weitere Stifte herzustellen.
»Vielleicht gibt es da Hoffnung«, sagte Napoleon.
Er bemerkte Monges wissendes Nicken.
Beide wussten sie, dass ein unscheinbarer, bei Rosetta gefundener schwarzer Stein mit in drei Schriften eingemeißeltem Text – Hieroglyphen (die Sprache des alten Ägypten), Demotisch (das volkstümliche Ägyptisch) und Griechisch – vielleicht die Antwort bringen würde. Letzten Monat hatte er eine Sitzung seines Ägyptischen Instituts besucht, das er zur Ermutigung seiner Savants gegründet hatte, und da war diese Entdeckung verkündet worden.
Aber es waren noch viele weitere Studien nötig.
»Wir legen zum ersten Mal eine systematische Übersicht über diese Fundstellen an«, erklärte Monge. »Alle, die vor uns kamen, haben einfach nur geplündert. Wir werden dem, was wir finden, ein Denkmal setzen.«
Noch so eine revolutionäre Idee, dachte Napoleon. Aber sie passte zu Monge.
»Bringen Sie mich hinein«, befahl er.
Sein Freund stieg ihm voran an der Nordseite eine Leiter hinauf, die zu einer Plattform in zwanzig Meter Höhe führte. Schon vor einigen Monaten war Napoleon bei seiner ersten Besichtigung der Pyramiden mit einigen seiner Kommandanten bis hierher gekommen. Er hatte sich jedoch geweigert, das Bauwerk zu betreten, da er sonst vor seinen Untergebenen auf allen vieren hätte krabbeln müssen. Jetzt bückte er sich und kroch in einen Korridor, der nicht mehr als einen Meter hoch und ebenso breit war und mit einer sanften Abwärtsneigung durchs Herz der Pyramide führte. Die Ledertasche baumelte von seinem Hals herunter. Sie kamen zu einem weiteren Korridor, der aufwärts ging, und Monge trat gebückt hinein. Die Steigung führte auf ein erleuchtetes Quadrat am Ende des Ganges zu.
Sie verließen den Korridor und konnten sich aufrichten; der erstaunliche Ort erfüllte Napoleon mit Ehrfurcht. Im flackernden Schein von Öllampen erkannte er eine Decke, mindestens zehn Meter über ihnen. Eine Rampe führte durch weiteres Granitmauerwerk steil nach oben. Die Wände liefen zur Decke hin in übereinandergeschichteten Kragsteinen zu einem schmalen Gewölbe zusammen.
»Das ist großartig«, flüsterte er.
»Wir nennen es die Große Galerie.«
»Ein passender Name.«
Am Fuße jeder Seitenwand verlief ein einen halben Meter breiter, oben flacher Sockel die Galerie entlang. Dazwischen führte ein Gang von einem Meter Breite nach oben. Es gab keine Stufen, nur einen steilen Anstieg.
»Ist er da oben?«, fragte Napoleon.
»Oui, mon Général. Er ist vor einer Stunde eingetroffen, und ich habe ihn in die Königskammer geführt.«
Napoleon hielt noch immer die Tasche fest. »Warten Sie draußen, unten.«
Monge wandte sich zum Gehen, blieb aber noch einmal stehen. »Sind Sie sicher, dass Sie das allein machen wollen?«
Napoleon hielt die Augen weiter auf die Große Galerie gerichtet. Er hatte den Erzählungen der Ägypter gelauscht. Angeblich waren die Erleuchteten der Antike durch die mystischen Korridore dieser Pyramide gegangen, waren als Menschen eingetreten und als Götter herausgekommen. Dies hier war, so hieß es, ein Ort der »zweiten Geburt«, ein »Schoß der Mysterien«. Die Weisheit wohnte hier – so, wie Gott in den Herzen der Menschen wohnte. Napoleons Savants fragten sich staunend, welche Motivation diesen herkulischen Bauanstrengungen zugrunde gelegen hatte, aber für Napoleon gab es nur eine einzige Erklärung – und diese Obsession verstand er –, den Wunsch, die Enge der menschlichen Sterblichkeit gegen die Weite der Erleuchtung einzutauschen. Seine Wissenschaftler erklärten gerne, dies hier sei vielleicht das vollkommenste Bauwerk der Welt, die ursprüngliche Arche Noah, und habe möglicherweise den Ausgangspunkt für Sprachen, Alphabete, Maße und Gewichte dargestellt.
Doch er sah das anders.
Dies hier war das Tor zur Ewigkeit.
»Nur ich kann das hier tun«, murmelte er schließlich.
Monge ging.
Er wischte sich den Sand von seiner Uniform und ging los, die steile Rampe hinauf. Deren Länge schätzte er auf etwa hundertzwanzig Meter und war außer Atem, als er oben ankam. Eine hohe Stufe führte in eine Galerie mit niedriger Decke, von der eine Vorkammer mit Wänden aus behauenem Granit abging.
Dahinter öffnete sich die Königskammer, auch diese mit Wänden aus poliertem rotem Stein, dessen riesige Blöcke so eng verfugt waren, dass kaum ein Haar dazwischen passte. Die Kammer war rechteckig, etwa halb so breit wie lang, eine Höhlung im Herzen der Pyramide. Monge hatte ihm gesagt, dass es durchaus eine Beziehung zwischen den Maßen dieser Kammer und einigen uralten mathematischen Konstanten geben mochte.
Er hegte keinen Zweifel daran.
In zehn Meter Höhe bildeten flache Granitblöcke die Decke. Aus zwei Schächten, die die Pyramide von Norden und Süden durchzogen, sickerte Licht herein. Der Raum war leer, abgesehen von einem Mann und einem grob behauenen, unfertigen Granitsarkophag ohne Deckel. Monge hatte erwähnt, die runden Löcher von Bohrern und die Spuren von Sägen seien noch immer daran zu erkennen. Er hatte recht. Monge hatte ebenfalls berichtet, dass der Sarkophag einen knappen Zentimeter breiter war als der aufsteigende Korridor, was bedeutete, dass er vor dem Bau der restlichen Pyramide hierhergeschafft worden war.
Der Mann, der mit dem Gesicht zur hinteren Wand gestanden hatte, drehte sich um.
Sein formloser Körper war mit einem losen Überwurf bekleidet, sein Kopf mit einem Wollturban umwickelt; ein Stück Kattun hing ihm über die Schulter. Seine ägyptische Abstammung war unübersehbar, doch seine flache Stirn, die hohen Wangenknochen und die breite Nase zeigten auch Spuren anderer Kulturen.
Napoleon sah auf das tief zerfurchte Gesicht.
»Haben Sie das Orakel mitgebracht?«, fragte ihn der Mann.
Napoleon zeigte auf die Ledertasche. »Da ist es.«
Napoleon trat aus der Pyramide. Er war fast eine Stunde darin gewesen, und inzwischen hatte die Dunkelheit das Gizeh-Plateau verschluckt. Vor seinem Aufbruch hatte er den Ägypter aufgefordert, in dem Bauwerk zu warten.
Er wischte sich erneut den Staub von der Uniform und rückte die Ledertasche auf der Schulter zurecht. Er kam zur Leiter und bemühte sich, seine Gefühle in den Griff zu bekommen, aber die letzte Stunde war entsetzlich gewesen.
Monge wartete allein unten, die Zügel von Napoleons Pferd in der Hand.
»War Ihr Besuch zufriedenstellend, monGénéral?«
Er sah dem Savant in die Augen. »Hören Sie zu, Gaspard. Sprechen Sie nie wieder über diese Nacht. Haben Sie mich verstanden? Keiner darf wissen, dass ich hier war.«
Sein Freund schien von dem Tonfall bestürzt.
»Entschuldigung, ich …«
Napoleon hob die Hand. »Sprechen Sie nie wieder davon. Haben Sie mich verstanden?«
Der Mathematiker nickte, aber Napoleon bemerkte, wie er an ihm vorbei nach oben zur Leiter schaute, wo der Ägypter darauf wartete, dass der General aufbrach.
»Erschießen Sie ihn«, flüsterte Napoleon Monge zu.
Er bemerkte den Schreck im Gesicht seines Freundes, und so presste er den Mund an das Ohr des Wissenschaftlers. »Sie laufen gerne mit diesem Gewehr herum. Sie wollen ein Soldat sein. Dann ist es jetzt Zeit. Soldaten gehorchen ihrem Kommandanten. Ich möchte nicht, dass der Ägypter diesen Ort verlässt. Wenn Sie nicht den Schneid dazu haben, lassen Sie es erledigen. Aber eines sollten Sie wissen: Wenn dieser Mann morgen noch lebt, wird unsere glorreiche Mission zugunsten der erhabenen Republik den tragischen Verlust eines Mathematikers zu beklagen haben.«
Er sah die Angst in Monges Augen.
»Sie und ich, wir haben gemeinsam viel geleistet«, stellte Napoleon klar. »Wir sind in der Tat Freunde. Brüder der sogenannten Republik. Aber Sie wollen mir nicht den Gehorsam verweigern. Niemals.«
Er ließ los und bestieg das Pferd.
»Ich kehre heim, Gaspard. Nach Frankreich. Zu meinem Schicksal. Mögen Sie gleichfalls das Ihre finden, hier, an diesem gottverlassenen Ort.«
ERSTER TEIL
1
Kopenhagen
Sonntag, 23. Dezember, Gegenwart
00.40 Uhr
Die Kugel schlug in Cotton Malones linke Schulter ein.
Er bemühte sich, den Schmerz zu unterdrücken, und konzentrierte sich auf den Platz. Die Leute rannten in alle Richtungen davon. Hupen schrillten, Reifen quietschten. Marines, die die nahe gelegene amerikanische Botschaft bewachten, reagierten auf das Chaos, waren aber zu weit entfernt, um zu helfen. Tote und Verletzte lagen am Boden. Wie viele? Acht? Zehn? Nein. Mehr. Ein junger Mann und eine Frau lagen mit verdrehten Gliedmaßen in der Nähe auf einem Flecken öligem Asphalt; die Augen des Mannes waren starr geöffnet und voller Schreck – die Frau lag mit dem Gesicht nach unten und verlor Blut. Malone hatte zwei Bewaffnete entdeckt und sofort beide erschossen, aber den dritten nicht gesehen, der ihn mit einer Kugel erwischt hatte und nun zu fliehen versuchte, wobei er die in Panik geratenen Passanten als Deckung benutzte.
Verdammt, die Wunde tat weh. Angst schlug ihm ins Gesicht wie eine Feuerwoge. Seine Beine gaben nach, während er mit aller Kraft versuchte, den rechten Arm zu heben. Die Beretta schien Tonnen zu wiegen, nicht Gramm.
Der Schmerz vernebelte seine Sinne. Er sog in tiefen Atemzügen die nach Schwefel riechende Luft ein und zwang sich, endlich auf den Abzug zu drücken, der aber nur quietschte und nicht feuerte. Sonderbar.
Wieder quietschte es, als er erneut zu schießen versuchte.
Dann löste sich die Welt in Schwarz auf.
Malone wachte auf, machte sich von dem Traum frei – der in den letzten zwei Jahren viele Male wiedergekehrt war – und schaute auf seine Nachttischuhr.
00.43 Uhr.
Er lag in seiner Wohnung auf dem Bett; die Lampe auf dem Nachttisch war noch immer an, genau wie vor zwei Stunden, als er sich einfach hingeworfen hatte.
Etwas hatte ihn geweckt. Ein Geräusch. Es war Teil seines Traums aus Mexico City gewesen und doch anders.
Er hörte es erneut.
Drei Quietschlaute in schneller Folge.
Sein Haus stammte ursprünglich aus dem siebzehnten Jahrhundert und war vor wenigen Monaten nach altem Vorbild komplett wiedererrichtet worden. Die Holzstufen vom ersten zum zweiten Stock kündigten sich jetzt in einer strengen Reihenfolge an wie die Tasten eines Klaviers.
Was bedeutete, dass jemand da war.
Er griff unters Bett und fand den Rucksack, den er noch aus seinen Zeiten beim Magellan Billet stets fertig gepackt hatte. Mit der rechten Hand holte er die Beretta heraus, dieselbe Waffe, die er seinerzeit in Mexico City dabeigehabt hatte. Eine Patrone steckte bereits im Lauf.
Eine weitere Gewohnheit, die er zum Glück nicht abgelegt hatte.
Er schlich sich aus dem Schlafzimmer.
Seine Wohnung im dritten Stock maß weniger als hundert Quadratmeter. Außer dem Schlafzimmer gab es ein Wohnzimmer, Küche, Bad und mehrere kleinere Kammern. Im Wohnzimmer, von wo eine Tür zum Treppenhaus führte, brannte Licht. Sein Buchantiquariat nahm das Erdgeschoss ein, und der erste und zweite Stock wurden ausschließlich als Lager- und Arbeitsräume genutzt.
Jetzt war er zur Tür gelangt und drückte sich dicht an den Türpfosten – ohne sich durch ein Geräusch zu verraten.
Er trug noch immer die Kleider vom Vortag. Gestern, am letzten Samstag vor Weihnachten, hatte er nach einem lebhaften Verkaufstag bis spät abends gearbeitet. Es war gut, wieder ein Buchhändler zu sein. Das war doch angeblich jetzt sein Beruf. Warum aber hielt er dann mitten in der Nacht eine Pistole in der Hand, während jeder seiner Sinne ihm sagte, dass Gefahr im Verzug war? Er riskierte einen Blick durch die offene Tür. Die Treppe führte zu einem Treppenabsatz hinunter und von dort weiter nach unten. Er hatte die Lichter am Abend unten ausgeschaltet, bevor er zum Schlafengehen hinaufgegangen war, und es gab keine Dreiwegschalter. Er verfluchte sich dafür, dass er den Nachbau nicht damit ausgestattet hatte. Eines war allerdings hinzugefügt worden, nämlich ein Treppengeländer aus Metall, das außen an der Treppe entlanglief.
Leise verließ er die Wohnung und rutschte das glatte Messinggeländer zum nächsten Treppenabsatz hinunter. Es machte keinen Sinn, seine Anwesenheit mit dem Knarren weiterer Treppenstufen zu verkünden.
Vorsichtig spähte er ins leere Treppenhaus.
Es war dunkel und still.
Er rutschte zum nächsten Treppenabsatz und arbeitete sich zu einer Stelle vor, von wo er einen Blick auf den zweiten Stock hatte. Das bernsteingelbe Licht der Lampen auf dem Højbro Plads sickerte durch die vorderen Fenster des Hauses herein und erhellte den Raum hinter dem offenen Durchgang mit einem orangefarbenen Schein. Er bewahrte seine Lagerbestände dort auf – Bücher, die er den Leuten abkaufte, die sie jeden Tag kistenweise herschafften. »Kaufe für Cents, verkaufe für Euros.« So lief das Geschäft mit gebrauchten Büchern. Wenn der Durchsatz stimmte, verdiente man Geld. Besser noch, von Zeit zu Zeit kam in diesen Kisten ein echter Schatz in sein Geschäft. Diese Schätze bewahrte er im ersten Stock in einem abgeschlossenen Raum auf. Falls der Unbekannte also nicht diese Tür aufgebrochen hatte, musste er sich in den offenstehenden zweiten Stock geflüchtet haben.
Malone rutschte das letzte Geländer hinunter und stellte sich neben den Eingang des zweiten Stocks. Der Raum dahinter, der vielleicht vierzehn mal sieben Meter maß, war mit Kisten vollgestellt, die mannshoch gestapelt waren.
»Was wollen Sie?«, fragte er, den Rücken gegen die Außenwand gepresst.
Er fragte sich, ob es vielleicht nur der Traum war, der ihn in Alarmzustand versetzt hatte. Zwölf Jahre als Agent des amerikanischen Justizministeriums hatten seiner Persönlichkeit zweifellos einen paranoiden Touch verliehen, und die letzten zwei Wochen hatten ihren Zoll gefordert – einen Zoll, auf den er nicht scharf gewesen war, den er aber als Preis für die Wahrheit akzeptiert hatte.
»Ich sage Ihnen was«, erklärte er. »Ich gehe wieder hoch. Wer immer Sie sind, wenn Sie etwas wollen, kommen Sie nach. Falls nicht, sehen Sie zum Teufel noch mal zu, dass Sie aus meinem Laden verschwinden.«
Wieder Stille.
Er ging zur Treppe.
»Ich wollte zu Ihnen«, sagte ein Mann im Lagerraum.
Malone blieb stehen und registrierte die Nuancen der Stimme. Ein junger Mensch. Ende zwanzig, Anfang dreißig. Die Stimme klang amerikanisch, hatte aber eine Spur von Akzent. Und sie war ruhig. Sachlich und nüchtern.
»Und da brechen Sie in meinen Laden ein?«
»Das war nötig.«
Die Stimme war jetzt ganz nah, direkt auf der anderen Seite des Eingangs. Malone zog sich von der Wand zurück, zielte mit seiner Pistole und wartete darauf, dass der Sprecher sich zeigte.
Ein Schatten tauchte im Eingang auf.
Der Mann war mittelgroß und trug eine Jacke, die ihm bis zur Taille reichte. Kurzes Haar. Die Hände hingen herab und waren beide leer. Das Gesicht war in der Dunkelheit nicht zu erkennen.
Malone hielt die Waffe auf ihn gerichtet und sagte: »Ich brauche einen Namen.«
»Sam Collins.«
»Was wollen Sie?«
»Henrik Thorvaldsen steckt in Schwierigkeiten.«
»Gibt es sonst noch etwas Neues?«
»Es kommen Leute, um ihn zu töten.«
»Was für Leute?«
»Wir müssen zu Thorvaldsen fahren.«
Malone hielt die Pistole noch immer auf den Mann gerichtet und hatte den Finger am Abzug. Wenn Sam Collins auch nur zuckte, würde er ihn abknallen. Aber er hatte das Gefühl, die Art Gefühl, die ein Agent durch hart erkämpfte Erfahrung erwarb, dass der junge Mann ihn nicht belog.
»Was für Leute?«, fragte er erneut.
»Wir müssen zu ihm fahren.«
Malone hörte unten Glas zerbrechen.
»Da ist noch etwas«, sagte Sam Collins. »Diese Leute. Sie sind auch hinter mir her.«
2
Bastia, Korsika
01.05 Uhr
Graham Ashby stand oberhalb des ruhigen Hafens und sah sich bewundernd um. Rings um ihn her waren altersschiefe, pastellfarbene Häuser wie Kisten zwischen Kirchen aufgestapelt, überschattet von dem schlichten Steinturm, der zur Zeit sein Aussichtspunkt war. Seine Yacht, die Archimedes, lag einen halben Kilometer entfernt im Vieux Port vor Anker. Er bewunderte ihre schlanke, beleuchtete Silhouette vor dem silbrigen Wasser. Die zweite Nacht des Winters ließ einen kühlen, trockenen Wind aus Norden durch Bastia wehen. Eine feiertägliche Stille lag schwer in der Luft. Weihnachten war nur noch zwei Tage entfernt, aber das war ihm völlig gleichgültig.
Terra Nova, einst Bastias Militär- und Verwaltungszentrum, war inzwischen zu einem Viertel für Wohlhabende geworden. Schicke Wohnungen und trendige Läden säumten ein Labyrinth von Kopfsteinpflastergassen. Vor ein paar Jahren hätte er beinahe in den Boom investiert, hatte sich dann aber dagegen entschieden. Insbesondere in Küstennähe brachten Immobilien nicht mehr denselben Gewinn wie früher.
Er blickte Richtung Nordosten auf die Jetée du Dragon, einen künstlichen Kai, der noch vor ein paar Jahrzehnten nicht existiert hatte. Um den zu bauen, hatten die Ingenieure einen riesigen löwenförmigen Felsen, Leone genannt, wegsprengen müssen, der einmal den Hafen blockiert hatte und in vielen Stichen aus der Zeit vor dem zwanzigsten Jahrhundert zu sehen gewesen war. Als die Archimedes vor zwei Stunden in das geschützte Hafenbecken eingelaufen war, hatte er rasch den unbeleuchteten Bergfried entdeckt – im vierzehnten Jahrhundert von dem Genueser Statthalter der Insel erbaut – und jetzt stand er dort und fragte sich, ob heute die entscheidende Nacht sein würde.
Er hoffte es.
Korsika gehörte nicht zu seinen Lieblingsorten. Die Insel war einfach nur ein aus dem Meer aufragender Gebirgszug, hundertdreiundachtzig Kilometer lang und dreiundachtzig Kilometer breit, sie hatte eine Fläche von achttausendsiebenhundert Quadratkilometern und eine tausend Kilometer lange Küste. Geografisch fand man dort eine Vielfalt aus hochgebirgsartigen Gipfeln, tiefen Schluchten, Pinienwäldern, Gletscherseen, Weiden, fruchtbaren Tälern und sogar wüstenartigen Gebieten. Zu verschiedenen Zeiten war die Insel von Griechen, Karthagern, Römern, Aragonern, Italienern, Briten und den Franzosen erobert worden, aber ihren rebellischen Geist hatte keiner der Eroberer unterwerfen können.
Das war noch ein Grund, weshalb er hier nicht hatte investieren wollen. In diesem widerspenstigen französischen département gab es viel zu viele Unwägbarkeiten.
Die emsigen Genuesen hatten Bastia 1380 gegründet und es mit Festungen geschützt. Der Turm, auf dem er stand, war einer der letzten Überreste davon. Die Stadt war bis 1791 Hauptstadt der Insel gewesen, doch dann hatte Napoleon entschieden, dass sein Geburtsort, das südlicher gelegene Ajaccio, dazu besser geeignet wäre. Ashby wusste, dass die Einheimischen dem klein gewachsenen Kaiser diesen Übergriff noch immer nicht verziehen hatten.
Er knöpfte seinen Armani-Mantel zu und trat dicht an eine mittelalterliche Brustwehr. Mit seinen achtundfünfzig Jahren fühlte er sich in seiner maßgeschneiderten Kleidung, Hemd, Hose und Pullover, wohl. Er kaufte seine ganze Ausstattung im Kingston & Knight, genau wie vor ihm sein Vater und sein Großvater. Gestern hatte ein Londoner Friseur seine graue Mähne geschnitten und die weißen Strähnen weggenommen, die ihn älter wirken ließen. Er war stolz darauf, dass er noch das Aussehen und die Vitalität eines jüngeren Mannes besaß, und während er weiter über das dunkle Bastia aufs Tyrrhenische Meer schaute, genoss er die Befriedigung eines Mannes, der wirklich arriviert war.
Beiläufig sah er auf seine Uhr …
Ja, er war gekommen, um ein Geheimnis zu lüften, eines, das Schatzjäger seit mehr als sechzig Jahren in Atem gehalten hatte, und er hasste es, wenn jemand sich verspätete.
Endlich hörte er Schritte von der nahe gelegenen Treppe, die zwanzig Meter nach oben führte. Tagsüber stiegen hier Touristen herauf, um den Ausblick zu genießen und Fotos zu schießen. Zu dieser Stunde aber kamen keine Besucher.
Im schwachen Licht tauchte ein Mann auf.
Er war klein und hatte einen dichten Haarschopf. Zwei tiefe Furchen zogen sich von der Nase zu den Mundwinkeln. Seine Haut war so braun wie eine Walnussschale, und der dunkle Teint wurde durch den weißen Schnauzbart noch betont.
Und er war wie ein Priester gekleidet.
Seine schwarze Soutane rauschte, als er näher trat.
»Lord Ashby, bitte entschuldigen Sie die Verspätung, es ließ sich leider nicht ändern.«
»Ein Priester?«, fragte er, auf die Soutane zeigend.
»Ich dachte, dass ich mich heute Nacht am besten verkleide. Einem Priester stellt man selten Fragen.« Der Mann schnappte nach Luft, außer Atem von dem Aufstieg.
Ashby hatte diese Stunde mit großer Sorgfalt gewählt und mit englischer Präzision auf Pünktlichkeit geachtet. Doch das war jetzt durch die fast halbstündige Verspätung kaputtgemacht.
»Ich verabscheue Unhöflichkeit«, sagte er, »aber manchmal ist ein offenes Wort nötig.« Er zeigte auf den Neuankömmling. »Sie, mein Herr, sind ein Lügner.«
»Das stimmt. Das gebe ich offen zu.«
»Sie haben mich Zeit und Geld gekostet, und sowohl das eine als auch das andere ist mir teuer.«
»Unglückseligerweise, Lord Ashby, ist beides bei mir knapp.« Der Mann hielt inne. »Und ich wusste, dass Sie meine Hilfe brauchten.«
Beim letzten Mal hatte Ashby zugelassen, dass dieser Mann zu viel erfuhr.
Das war ein Fehler gewesen …
Etwas war am 15. September 1943 in Korsika geschehen. Sechs Kisten waren mit einem Boot aus Italien hergebracht worden. Manche behaupteten, sie seien vor Bastia ins Meer geworfen worden, aber andere waren überzeugt, dass sie an Land geschleppt worden waren. Alle Berichte stimmten darin überein, dass fünf Deutsche beteiligt gewesen waren. Vier von ihnen wurden vor ein Kriegsgericht gestellt, weil sie den Schatz an einem Ort zurückgelassen hatten, der bald in die Hände der Alliierten fallen würde. Sie wurden erschossen. Der fünfte wurde freigesprochen. Leider wusste er nicht, wo das endgültige Versteck lag, und so suchte er für den Rest seines Lebens vergebens.
So wie viele andere.
»Lügen sind die einzigen Waffen, die ich besitze«, stellte der Korse klar. »Damit hält man sich mächtige Männer wie Sie vom Leibe.«
»Alter Mann …«
»Ich bin nicht viel älter als Sie, wie ich zu behaupten wage. Auch wenn ich nicht so berüchtigt bin. Sie haben einen ziemlichen Ruf, Lord Ashby.«
Er stimmte der Feststellung mit einem Nicken zu. Er begriff, was das Image im Guten wie im Schlechten für einen Menschen bedeutete. Seine Familie hielt seit drei Jahrhunderten eine Mehrheit an einem von Englands ältesten Finanzinstituten. Dieser Anteil war inzwischen vollständig ihm zugefallen. Die britische Presse hatte seine leuchtend grauen Augen, seine römische Nase und sein aufzuckendes Lächeln einmal als das Gesicht eines Aristokraten beschrieben. Ein Reporter hatte ihn vor ein paar Jahren als beeindruckend bezeichnet, während ein anderer ihn als dunkelhäutig und düster geschildert hatte. Den Hinweis auf seinen dunklen Teint nahm er nicht unbedingt übel – den hatte er von seiner halb türkischen Mutter geerbt –, aber es störte ihn, dass jemand ihn als finster und verschlossen betrachtete.
»Ich versichere Ihnen, guter Mann«, sagte er, »ich bin niemand, den Sie fürchten müssen.«
Der Korse lachte. »Das hoffe ich doch. Mit Gewalt würden Sie nämlich gar nichts erreichen. Schließlich suchen Sie Rommels Gold. Einen gewaltigen Schatz. Und ich weiß vielleicht, wo er liegt.«
Dieser Mann war ebenso aufdringlich, wie er aufmerksam war. Aber außerdem war er zugegebenermaßen ein Lügner. »Sie haben mich in die Irre geführt.«
Die dunkle Gestalt lachte. »Sie haben kräftig Druck gemacht. Ich kann mir keine öffentliche Aufmerksamkeit leisten. Andere könnten etwas erfahren. Dies hier ist eine kleine Insel, und falls wir diesen Schatz finden, möchte ich meinen Anteil behalten können.«
Dieser Mann arbeitete für die Assemblée de Corse in Ajaccio. Er war ein kleiner Beamter in der Regionalregierung Korsikas, der praktischerweise Zugang zu sehr vielen Informationen hatte.
»Und wer sollte uns das wegnehmen, was wir finden?«, fragte Ashby.
»Die Leute hier in Bastia, die noch immer auf der Suche danach sind. Und andere, die in Frankreich und Italien leben. Nicht wenige Menschen sind für diesen Schatz gestorben.«
Dieser Dummkopf mochte es offensichtlich, wenn Gespräche langsam vom Fleck kamen. Er machte nur Andeutungen und Anspielungen, mit denen er sich seinem Ziel im Schneckentempo näherte.
Aber so viel Zeit hatte Ashby nicht.
Er machte ein Zeichen, und ein weiterer Mann trat aus dem Treppenhaus. Er trug einen schwarzen Mantel, der fast mit seinem stacheligen, grauen Haar verschmolz. Seine Augen waren durchdringend, das hagere Gesicht lief zum Kinn hin spitz zu. Er ging direkt auf den Korsen zu und blieb vor ihm stehen.
»Dies hier ist Mr. Guildhall«, sagte Ashby. »Vielleicht erinnern Sie sich von unserem letzten Besuch an ihn?«
Der Korse wollte ihm die Hand reichen, doch Guildhall ließ die Hände in seiner Manteltasche stecken.
»Ja«, antwortete der Korse. »Lächelt er eigentlich auch hin und wieder mal?«
Ashby schüttelte den Kopf. »Eine schlimme Sache. Vor ein paar Jahren wurde Mr. Guildhall in eine hässliche Auseinandersetzung verwickelt, in deren Verlauf er Schnittwunden in Gesicht und Hals erhielt. Wie Sie sehen, sind die Wunden verheilt, aber zurückgeblieben ist ein Nervenschaden, der seine Gesichtsmuskulatur teilweise lähmt. Daher kann er nicht lächeln.«
»Und was ist mit der Person, die ihn verwundet hat?«
»Ah, eine ausgezeichnete Frage. Die ist tot. Sie hat sich den Hals gebrochen.«
Ashby sah, dass seine Bemerkung ihre Wirkung erzielte, und so wandte er sich Guildhall zu und fragte: »Was haben Sie gefunden?«
Sein Angestellter zog ein kleines Buch aus der Manteltasche und reichte es Ashby. Im schwachen Licht erkannte er den verblassten französischen Titel. Napoleon, von den Tuilerien bis St. Helena. Eine der zahllosen Lebensbeschreibungen, die nach Napoleons Tod 1821 gedruckt worden waren.
»Wie … sind Sie da rangekommen?«, fragte der Korse.
Ashby lächelte. »Während Sie mich hier oben auf dem Turm haben warten lassen, hat Mr. Guildhall Ihr Haus durchsucht. Ich bin kein vollkommener Idiot.«
Der Korse zuckte die Schultern. »Das ist einfach nur eine langweilige Abhandlung. Ich lese viel über Napoleon.«
»Das hat Ihr Mitverschwörer ebenfalls gesagt.«
Ashby sah, dass er jetzt die ganze Aufmerksamkeit seines Zuhörers hatte. »Er, Mr. Guildhall und ich hatten eine großartige Unterhaltung.«
»Woher wussten Sie von Gustave?«
Ashby zuckte die Schultern. »Das war nicht schwer herauszubekommen. Sie beide suchen schon seit langem nach Rommels Gold. Sie sind vielleicht zusammen die beschlagensten Menschen auf diesem Gebiet.«
»Haben Sie ihm etwas angetan?«
Er bemerkte die Besorgnis in dieser Frage. »Himmel, nein, guter Mann. Halten Sie mich für einen Verbrecher? Ich bin aristokratischer Abstammung. Ein englischer Lord. Ein respektabler Finanzmann, kein Gangster. Natürlich hat Ihr Gustave mich ebenfalls belogen.«
Ein kurzer Wink, und Guildhall packte den Mann bei einer Schulter und einem Hosenbein, das unter der Soutane hervorschaute. Der kleine Korse wurde zwischen die Zinnen der Brustwehr gehoben und dann von Guildhall nach draußen bugsiert, wo er ihn an beiden Fußknöcheln festhielt, so dass er zwanzig Meter über dem Steinpflaster kopfüber von der Mauer herunterhing.
Die Soutane flatterte im Nachtwind.
Ashby schob den Kopf zwischen zwei Zinnen hindurch. »Leider hat Mr. Guildhall nicht dieselben Vorbehalte gegen Gewalt wie ich. Lassen Sie sich gesagt sein, dass Sie auf keinen Fall vor Schreck schreien dürfen, sonst lässt er Sie fallen. Haben Sie verstanden?«
Er sah einen Kopf nicken.
»Und jetzt wird es Zeit, dass Sie und ich uns einmal ernsthaft unterhalten.«
3
Kopenhagen
Malone starrte auf den gesichtslosen Umriss von Sam Collins, während unten noch mehr Glas zu Bruch ging.
»Ich glaube, die wollen mich umbringen«, sagte Collins.
»Falls Ihnen das noch nicht aufgefallen ist, ich richte ebenfalls eine Waffe auf Sie.«
»Mr. Malone, Henrik hat mich hergeschickt.«
Er musste eine Entscheidung treffen. Was war schlimmer, die Gefahr unmittelbar vor ihm oder die Gefahr zwei Stockwerke weiter unten?
Er senkte die Waffe. »Sie haben die Leute unten hierhergeführt?«
»Ich brauche Ihre Hilfe. Henrik hat gesagt, ich soll zu Ihnen gehen.«
Er hörte ein dreimaliges leises Knallen. Mit Schalldämpfer abgefeuerte Schüsse. Dann flog die Haustür krachend auf. Schritte stampften über den Holzboden.
Er schwenkte die Waffe. »Dort hinein.«
Sie zogen sich in den Lagerraum im zweiten Stock zurück und suchten hinter einem Stapel Kisten Zuflucht. Malone begriff, dass die Eindringlinge, vom Licht angezogen, sofort zum obersten Stockwerk hinaufgehen würden. Wenn sie dann bemerkten, dass keiner da war, würden sie zu suchen anfangen. Das Problem war nur, dass er nicht wusste, wie viele Leute zu Besuch gekommen waren.
Er riskierte einen Blick und sah einen Mann, der vom Treppenabsatz im zweiten Stock zum dritten hinaufging. Er bedeutete Collins, still zu sein und ihm zu folgen. Dann huschte er zum Eingang und glitt mit Hilfe des Messinggeländers zum nächsten Stockwerk hinunter. Collins machte es ihm nach. So ging es weiter, bis sie zur letzten Treppe kamen, die zum Buchladen im Erdgeschoss hinunterführte.
Collins trat zum letzten Geländer, doch Malone packte ihn beim Arm und schüttelte den Kopf. Die Tatsache, dass dieser junge Mann vorgehabt hatte, etwas so Dummes zu tun, zeigte entweder Unwissenheit oder eine trügerische Brillanz. Er war sich nicht sicher, welches von beidem, aber sie konnten hier nicht lange verweilen, da sich ja weiter oben ein Bewaffneter befand.
Er gab Collins einen Wink, seine Jacke auszuziehen.
In der Dunkelheit schienen sich in dem Gesicht Zweifel abzuzeichnen, ein Zögern, der Aufforderung nachzukommen, doch dann gab er nach und legte die Jacke geräuschlos ab. Malone packte das dicke Wollbündel, setzte sich aufs Geländer und glitt langsam und vorsichtig die Hälfte des Weges nach unten. Die Waffe fest mit der Rechten gepackt, schleuderte er die Jacke von sich.
Schüsse ertönten, und das Kleidungsstück wurde von Kugeln durchsiebt.
Eilig rutschte er den Rest des Weges hinunter, sprang vom Geländer und hechtete hinter die Ladentheke, während weitere Kugeln um ihn herum ins Holz einschlugen.
Jetzt erkannte er, wo die Schüsse herkamen.
Der Schütze befand sich rechts von ihm, in der Nähe des Frontfensters, wo die Regale mit den Kategorien Geschichte und Musik standen.
Malone kniete sich hin und schickte eine Kugel in diese Richtung.
»Jetzt«, schrie er Collins zu, der zu spüren schien, was von ihm erwartet wurde, von der Treppe flüchtete und hinter die Theke sprang.
Malone wusste, dass sie bald noch mehr Gesellschaft bekommen würden, daher krabbelte er nach links. Zum Glück gab es dort kein Hindernis. Während des jüngst erfolgten Nachbaus hatte er darauf bestanden, dass die Theke zu beiden Seiten offen blieb. Sein Schuss war nicht schallgedämpft gewesen, und so fragte er sich, ob draußen irgendjemand den lauten Knall gehört hatte. Unglückseligerweise lag der Højbro Plads von Mitternacht bis zum Tagesanbruch immer ziemlich verlassen da.
Er flitzte zum Ende der Theke, Collins an seiner Seite. Sein Blick war auf die Treppe geheftet, und er wartete auf das Unvermeidliche. Prompt erblickte er eine dunkle Gestalt, die größer wurde, während der Angreifer von oben langsam mit seiner Waffe um die Ecke zielte.
Malone schoss und erwischte den Mann am Unterarm.
Er hörte ein Stöhnen, und die Waffe verschwand.
Der erste Schütze gab dem Mann auf der Treppe Feuerschutz, so dass der in seine Richtung fliehen konnte. Malone spürte eine Pattsituation. Er war bewaffnet, so auch die Angreifer. Aber wahrscheinlich hatten sie mehr Munition dabei als er, da er es versäumt hatte, ein Ersatzmagazin für die Beretta mitzunehmen. Zum Glück wussten sie das nicht.
»Wir müssen sie reizen«, flüsterte Collins.
»Wie viele sind es denn?«
»Sieht aus wie zwei.«
»Hm, das wissen wir aber nicht genau.« Seine Gedanken kehrten zu seinem Traum zurück, in dem er schon einmal den Fehler gemacht hatte, nicht bis drei zu zählen.
»Wir können nicht einfach hier hocken.«
»Ich könnte Sie denen ausliefern und wieder schlafen gehen.«
»Das könnten Sie. Aber das werden Sie nicht tun.«
»Seien Sie da nicht so sicher.«
Er hatte nicht vergessen, was Collins gesagt hatte: Henrik Thorvaldsen steckt in Schwierigkeiten.
Collins schob sich an Malone vorbei und griff nach dem Feuerlöscher hinter der Theke. Malone beobachtete, wie der junge Mann den Sicherheitsstift herausriss und dann, bevor er noch etwas einwenden konnte, hinter der Theke hervorsprang und einen chemischen Nebel in den Bücherladen sprühte. Hinter einem Regal in Deckung gehend, besprühte er die Angreifer mit dem Flammschutzmittel.
Keine schlechte Aktion, nur dass …
Vier schallgedämpfte Schüsse ertönten als Antwort.
Kugeln zischten aus dem Nebel heraus, schlugen in Holz ein oder prallten von den Steinwänden ab.
Malone erwiderte das Feuer.
Er hörte Glas in einem klirrenden Crescendo zerbrechen und dann davoneilende Schritte.
Kalte Luft umfing ihn. Er begriff, dass die Angreifer durchs Schaufenster entkommen waren.
Collins senkte den Feuerlöscher. »Sie sind weg.«
Malone musste auf Nummer sicher gehen, und so huschte er gebückt, hinter den Regalen Deckung suchend, von der Theke weg und durch den sich auflösenden Nebel. Er kam zur letzten Regalreihe und riskierte einen raschen Blick. Nebelgeschwängerte Luft zog durch die zerschmetterte Fensterscheibe in die kalte Nacht ab.
Er schüttelte den Kopf. Schon wieder war alles versaut.
Collins trat hinter ihn. »Das waren Profis.«
»Woher wollen Sie das wissen?«
»Ich weiß, wer sie geschickt hat.« Collins stellte den Feuerlöscher auf den Boden.
»Wer denn?«
Collins schüttelte den Kopf. »Henrik hat gesagt, das wolle er Ihnen selber erklären.«
Malone trat zur Theke, griff nach dem Telefon und wählte die Nummer von Christiangade, Thorvaldsens ererbtem Landsitz neun Meilen nördlich von Kopenhagen. Das Freizeichen ertönte mehrmals. Normalerweise nahm Jesper, Thorvaldsens Diener, ab, zu welcher Uhrzeit auch immer.
Noch immer ertönte das Freizeichen.
Das war nicht gut.
Er legte auf und beschloss, vorbereitet zu sein.
»Gehen Sie bitte hoch«, forderte er Collins auf. »Auf meinem Bett liegt ein Rucksack. Bringen Sie mir den.«
Collins eilte die Holzstufen hinauf.
Malone nutzte die Gelegenheit, ein weiteres Mal in Christiangade anzurufen, und hörte zu, wie das Telefon läutete.
Collins stampfte die Treppe herunter.
Malones Wagen stand einige Straßen entfernt unmittelbar außerhalb der Altstadt in der Nähe des Christianburg Slot. Er holte sein Handy aus der Ablage unter der Theke.
»Gehen wir.«
4
Eliza Larocque spürte, dass sie dem Erfolg nahe war, wenn auch ihr Reisegenosse ihr ihre Aufgabe nicht leicht machte. Sie konnte nur hoffen, dass dieser hastig organisierte Überseeflug sich nicht als Zeitverschwendung erweisen würde.
»Er heißt Der Pariser Club«, sagte sie auf Französisch.
Sie hatte sich dafür entschieden, ihren letzten Überzeugungsversuch 15.000 Meter über dem Nordatlantik im Inneren der luxuriösen Kabine ihres neuen Gulfstream G 650 zu starten. Sie war stolz auf ihr neues Spielzeug, das ganz auf dem neuesten Stand der Technik war, eines der ersten Flugzeuge dieses Modells, das die Fabrik verlassen hatte. Die geräumige Kabine bot Platz für achtzehn Passagiere in feudalen Ledersesseln. Es gab Raum für eine Bordküche, eine geräumige Toilette, Mahagoniausstattung und extraschnelle Internet-Video-Module, die per Satellit mit der Welt verbunden waren. Der Jet flog hoch, schnell und zuverlässig. Er hatte siebenunddreißig Millionen gekostet und war jeden Euro wert.
»Diese Organisation ist mir bekannt«, erwiderte Robert Mastroianni, der bei ihrer Muttersprache blieb. »Eine informelle Gruppe von staatlichen Finanzleuten aus den reichsten Ländern der Welt. Umschuldungen, Schuldennachlässe und Schuldenerlasse. Sie vermitteln Kredite und helfen überschuldeten Nationen, ihre Verpflichtungen zu begleichen. Als ich beim Internationalen Währungsfond war, haben wir oft mit ihnen zusammengearbeitet.«
Eine Tatsache, die ihr bekannt war.
»Dieser Club«, sagte sie, »entstand aus Krisengesprächen, die 1956 zwischen dem bankrotten Argentinien und dessen Gläubigern stattfanden. Er trifft sich weiterhin alle sechs Wochen im französischen Ministerium für Wirtschaft, Finanzen und Industrie. Den Vorsitz hat ein Spitzenbeamter des französischen Finanzministeriums. Aber von dieser Organisation spreche ich hier nicht.«
»Wieder eines Ihrer Geheimnisse?«, fragte er, Kritik in der Stimme.
»Warum müssen Sie so schwierig sein?«
»Vielleicht weil ich weiß, dass es Sie ärgert.«
Gestern hatte sie Mastroianni in New York aufgesucht. Er hatte sich nicht gefreut, sie zu sehen, aber sie waren am Abend zusammen essen gegangen. Als sie ihm den Rückflug über den Atlantik angeboten hatte, hatte er angenommen.
Was sie überrascht hatte.
Dies hier würde entweder ihre letzte Unterhaltung sein – oder die erste von vielen weiteren.
»Fahren Sie fort, Eliza. Ich höre Ihnen zu. Natürlich kann ich hier auch gar nichts anderes machen, als Ihnen zuzuhören. Was vermutlich genau Ihr Plan war.«
»Wenn Sie das so sehen, warum haben Sie sich dann überhaupt einverstanden erklärt, mit mir zurückzufliegen?«
»Wenn ich abgelehnt hätte, hätten Sie mich einfach erneut aufgesucht. Auf diese Weise können wir die geschäftlichen Dinge erledigen, mit welchem Ergebnis auch immer, und ich bekomme zum Lohn für den Zeitaufwand einen bequemen Rückflug nach Hause. Also bitte, machen Sie weiter. Halten Sie Ihre Rede.«
Sie unterdrückte ihren Ärger und erklärte: »Es gibt eine Binsenweisheit, wie uns die Geschichte lehrt. ›Wenn eine Regierung sich der Herausforderung eines Krieges nicht stellen kann, findet sie ihr Ende.‹ Die Unangreifbarkeit des Gesetzes, der Wohlstand der Bürger, die Zahlungsfähigkeit – all diese Prinzipien werden bereitwillig von jedem Staat geopfert, wenn sein Überleben auf dem Spiel steht.«
Ihr Zuhörer nahm einen Schluck aus einer Champagnerflöte.
»Und hier ist noch ein Fakt«, sagte sie. »Kriege sind immer durch Schulden finanziert worden. Je größer die Bedrohung, desto größer die Schulden.«
Er winkte ab. »Und ich kenne auch den nächsten Teil, Eliza. Damit eine Nation sich auf einen Krieg einlässt, muss es einen glaubwürdigen Feind geben.«
»Natürlich. Und wenn es den schon gibt, magnifico?«
Er lächelte über ihre Verwendung seiner Muttersprache, das erste Aufbrechen seiner verschlossenen Miene.
»Wenn Feinde existieren«, sagte sie, »es ihnen aber an militärischer Macht gebricht, kann man Geld zur Verfügung stellen, um diese aufzubauen. Wenn es keine Feinde gibt …«, sie lächelte, »… kann man die jederzeit schaffen.«
Mastroianni lachte. »Sie sind ein solcher Teufel.«
»Und Sie nicht?«
Er sah sie finster an. »Nein, Eliza. Ich nicht.«
Er war vielleicht fünf Jahre älter als sie und ebenso reich; er konnte recht charmant sein, auch wenn er sie jetzt ärgerte. Sie hatten gerade zum Abendessen saftige Rinderlende, »Yukon-Gold«-Kartoffeln und knackige grüne Bohnen gespeist. Sie hatte in Erfahrung gebracht, dass er gerne schlicht aß: keine Gewürze, kein Knoblauch und nichts Scharfes. Ungewöhnlich für einen Italiener, doch vieles an diesem Milliardär war ungewöhnlich. Aber wer war sie, um da zu urteilen? Sie hatte selbst eine Menge Eigentümlichkeiten.
»Es gibt noch einen anderen Pariser Club«, erklärte sie. »Einen wesentlich älteren. Er geht auf die Zeit Napoleons zurück.«
»Das haben Sie bisher nie erwähnt.«
»Sie haben bisher keinerlei Interesse gezeigt.«
»Darf ich offen sein?«
»Unbedingt.«
»Ich mag Sie nicht. Oder genauer gesagt, ich mag Ihre Geschäftsinteressen und Ihre Geschäftspartner nicht. Deren Geschäftsgebaren ist skrupellos, und ihr Wort bedeutet nichts. Einige Ihrer Investitionen sind bestenfalls fragwürdig und schlimmstenfalls kriminell. Seit beinahe einem Jahr verfolgen Sie mich mit Geschichten von sagenhaften Gewinnen, bieten mir aber kaum Informationen an, um Ihre Behauptungen zu belegen. Vielleicht ist das Ihre korsische Hälfte, die Sie einfach nicht kontrollieren können.«
Ihre Mutter war Korsin gewesen und ihr Vater Franzose. Die beiden hatten jung geheiratet und waren mehr als fünfzig Jahre zusammengeblieben. Beide waren inzwischen tot, und sie war die einzige Erbin. Vorurteile bezüglich ihrer Herkunft waren nichts Neues – denen war sie schon viele Male begegnet –, aber das bedeutete nicht, dass sie sie fröhlich akzeptierte.
Sie stand auf und räumte die Teller ab.
Mastroianni packte sie am Arm. »Sie brauchen mich nicht zu bedienen.«
Sie hatte sowohl etwas gegen seinen Tonfall als auch gegen seinen Griff, doch sie wehrte sich nicht. Stattdessen lächelte sie, wechselte zum Italienischen über und sagte: »Sie sind mein Gast. Es gehört sich so.«
Er ließ sie los.
Sie hatte als Besatzung nur zwei Piloten mitgenommen, die beide vorne saßen, abgetrennt durch eine Cockpittür, und deshalb servierte sie das Essen selbst. In der Bordküche stellte sie die schmutzigen Teller ab und holte den Nachtisch aus einem kleinen Kühlschrank: zwei köstliche Schokoladentörtchen. Mastroiannis Lieblingsdessert, wie man ihr gesagt hatte. Sie hatte sie in dem Restaurant in Manhattan gekauft, das sie gestern Abend besucht hatten.
Seine Miene änderte sich, als sie die Leckerei vor ihn stellte.
Sie setzte sich ihm gegenüber.
»Ob Sie mich oder meine Firmen mögen, spielt für unser Gespräch keine Rolle, Robert. Dies hier ist ein geschäftliches Angebot. Eines, von dem ich dachte, dass es Sie interessieren würde. Ich habe meine Wahl mit großer Sorgfalt getroffen. Für fünf Leute habe ich mich bereits entschieden. Ich bin die sechste. Sie wären der siebte.«
Als hätte er nichts gehört, zeigte er auf das Törtchen. »Ich hatte mich schon gefragt, was Sie und der Kellner gestern Abend vor unserem Aufbruch besprochen haben.«
Er ignorierte sie und spielte sein eigenes Spielchen.
»Ich habe gesehen, wie gut Ihnen das Dessert geschmeckt hat.«
Er griff nach einer Gabel aus Sterlingsilber. Anscheinend erstreckte sich seine persönliche Abneigung ihr gegenüber nicht auf ihr Essen oder ihren Jet oder die Möglichkeit, Geld zu verdienen.
»Darf ich Ihnen eine Geschichte erzählen?«, fragte sie. »Über Ägypten. Als der damalige General Napoleon Bonaparte 1798 dort einmarschierte.«
Er nickte, während er sich die üppige Schokolade schmecken ließ. »Ich bezweifle, dass Sie ein Nein akzeptieren würden. Also, schießen Sie los.«
Napoleon führte die Kolonne französischer Soldaten am zweiten Tag des Marschs nach Süden persönlich an. Sie befanden sich in der Nähe von El Beydah und waren nur ein paar Stunden vom nächsten Dorf entfernt. Der Tag war heiß und sonnig, genau wie die Tage zuvor. Gestern hatten Araber seine Vorhut heftig angegriffen. Général Desaix wäre beinahe gefangen genommen worden. Das konnte verhindert werden, aber ein Hauptmann wurde getötet und ein Generaladjutant geriet in Gefangenschaft. Die Araber forderten ein Lösegeld, stritten sich aber um die Beute und schossen den Gefangenen schließlich in den Kopf. Ägypten erwies sich als trügerisches Land – leicht zu erobern, aber schwer zu halten –, und der Widerstand schien zu wachsen.
Vor sich am Straßenrand erblickte er eine Frau mit blutigem Gesicht. Im einen Arm hielt sie ein Neugeborenes, der andere war wie zur Selbstverteidigung ausgestreckt und tastete in die Luft. Was tat sie hier in der glühend heißen Wüste?
Er näherte sich ihr und brachte vermittels eines Dolmetschers in Erfahrung, dass ihr Mann ihr beide Augen ausgestochen hatte. Napoleon war entsetzt. Warum denn? Sie wagte nicht, sich zu beschweren, und flehte nur darum, dass jemand sich um ihr Kind kümmern möge, das dem Tod nahe schien. Napoleon befahl, dass man sowohl ihr als auch dem Kind Wasser und Brot gab.
Da kam plötzlich ein Mann hinter einer nahe gelegenen Düne hervor, wütend und hasserfüllt.
Die Soldaten wurden wachsam.
Der Mann rannte los und schnappte der Frau das Brot und das Wasser weg.
»Lassen Sie das«, schrie er. »Sie hat ihre Ehre verwirkt und die meine befleckt. Dieses Kind ist meine Schande. Es ist ein Kind ihrer Schuld.«
Napoleon stieg ab und sagte: »Sie sind verrückt, Monsieur. Wahnsinnig.«
»Ich bin ihr Mann und habe das Recht, zu tun, was mir gefällt.«
Bevor Napoleon noch antworten konnte, tauchte unter dem Umhang des Mannes ein Dolch auf, und im Handumdrehen hatte er seiner Frau eine tödliche Wunde beigebracht.
Es entstand Verwirrung, als der Mann das Kind ergriff, es hochhob und zu Boden schmetterte.
Ein Schuss peitschte durch die Luft und traf den Mann in die Brust. Er fiel auf die trockene Erde. Hauptmann le Mireur, der hinter Napoleon ritt, hatte das Spektakel beendet.
Jeder Soldat wirkte schockiert von dem, was er gesehen hatte.
Napoleon selbst hatte Mühe, seine Bestürzung zu verbergen. Nach ein paar angespannten Sekunden befahl er der Kolonne weiterzumarschieren, doch bevor er wieder auf sein Pferd stieg, bemerkte er, dass etwas unter dem Umhang des Toten herausgefallen war.
Eine mit einer Schnur zusammengebundene Papyrusrolle.
Er hob sie aus dem Sand auf.
Als Nachtlager requirierte Napoleon das Lusthaus eines seiner energischsten Gegner, eines Ägypters, der vor Monaten mit seiner Mameluckenarmee in die Wüste geflohen war und all seine Besitztümer zum Genuss der Franzosen zurückgelassen hatte. Der General, der auf flauschigen, mit Kissen übersäten Teppichen lag, war noch immer beunruhigt wegen der schrecklichen, unmenschlichen Szene, deren Zeuge er zuvor auf der Wüstenstraße geworden war.
Später hatte man ihm gesagt, der Ehemann habe Unrecht getan, als er seine Frau erstach, aber wenn Gott ihr für ihre Untreue Gnade gewährt hätte, wäre sie bereits von jemandem aus Barmherzigkeit aufgenommen worden. Da das nicht geschehen war, hätte das arabische Gesetz den Mann für die beiden Morde nicht bestraft.
»Dann ist es gut, dass wir es getan haben«, erklärte Napoleon.
Es war eine stille, langweilige Nacht, und so beschloss er, die Papyrusrolle zu untersuchen, die er bei der Leiche gefunden hatte. Seine Savants hatten ihm erzählt, die Einheimischen plünderten regelmäßig heilige Stätten und stählen dort, was sie könnten, um es entweder zu verkaufen oder wiederzuverwenden. Was für eine Verschwendung! Er war gekommen, um die Vergangenheit dieses Landes zu entdecken, nicht um sie zu zerstören.
Er zerriss die Schnur, entrollte das Bündel und entdeckte vier Blätter, die anscheinend auf Griechisch beschriftet waren. Er sprach fließend Korsisch und konnte inzwischen passables Französisch sprechen und lesen, aber darüber hinaus waren Fremdsprachen für ihn ein Buch mit sieben Siegeln.
Daher ließ er einen seiner Übersetzer zu sich kommen.
»Das ist Koptisch«, erklärte der Mann ihm.
»Können Sie es lesen?«
»Natürlich, mon Général.«
»Wie schrecklich«, sagte Mastroianni. »Dieses Baby zu töten.«
Sie nickte. »Das war die Realität des Ägyptenfeldzugs. Es war eine blutige, hart erkämpfte Eroberung. Aber ich versichere Ihnen, das, was damals geschah, ist der Grund dafür, dass wir jetzt diese Unterhaltung führen.«
5
Sam Collins saß auf dem Beifahrersitz und verfolgte, wie Malone rasch aus Kopenhagen hinausfuhr und dann auf der dänischen Küstenstraße nach Norden fegte.
Cotton Malone war genau so, wie er ihn sich vorgestellt hatte: Zäh, mutig und entschlossen akzeptierte er eine Situation so, wie sie sich ihm darbot, und tat, was zu tun war. Er entsprach sogar körperlich der Beschreibung, die Sam erhalten hatte. Hochgewachsen, glänzend braunes Haar und ein Lächeln, das kaum Emotionen verriet. Sam wusste Bescheid über Malones zwölfjährige Arbeit für das amerikanische Justizministerium, sein Jurastudium in Georgetown, sein eidetisches Gedächtnis und seine Bücherliebe. Aber jetzt hatte er aus erster Hand erlebt, wie mutig dieser Mann bei einem Schusswechsel war.
»Wer sind Sie?«, fragte Malone.
Sam begriff, dass er sich jetzt nicht schüchtern geben durfte. Er hatte Malones Misstrauen gespürt und nahm es ihm nicht übel. Ein Fremder bricht mitten in der Nacht in seinen Laden ein, verfolgt von Bewaffneten? »Secret Service. Oder zumindest war ich das bis vor ein paar Tagen. Ich glaube, ich bin gefeuert.«
»Warum denn das?«
»Weil keiner auf mich hören wollte. Ich habe versucht, ihnen die Sache zu erklären. Aber keiner wollte zuhören.«
»Und warum hat Henrik Ihnen zugehört?«
»Woher wussten Sie …« Er riss sich zusammen.
»Manche Leute nehmen streunende Tiere auf. Henrik rettet Menschen. Warum haben Sie seine Hilfe gebraucht?«
»Wer sagt denn, dass es so war?«
»Machen Sie sich nichts draus. Ich war selber einmal einer dieser Streuner.«
»Eigentlich würde ich sagen, dass Henrik derjenige war, der Hilfe brauchte. Er hat mich kontaktiert.«
Malone schaltete den Mazda in den fünften Gang und schoss die nächtliche Küstenstraße entlang, etwa hundert Meter vom dunklen Øresund entfernt.
Sam musste etwas klarstellen. »Ich habe beim Secret Service nicht zu den Leibwächtern fürs Weiße Haus gehört. Ich hatte mit Währungs- und Finanzbetrug zu tun.«
Er musste immer über das Hollywood-Stereotyp von Agenten mit dunklen Anzügen, Sonnenbrillen und hautfarbenen Ohrhörern lachen, die den Präsidenten umgaben. Die meisten Secret-Service-Leute arbeiteten wie er selbst im Verborgenen und schützten das amerikanische Finanzsystem. Das war tatsächlich die Hauptmission des Dienstes, der während des Bürgerkriegs gegründet worden war, um Falschmünzerei der Konföderierten zu verhindern. Erst nach der Ermordung von William McKinley fünfunddreißig Jahre später hatte man dem Dienst die Verantwortung für den Schutz des Präsidenten übertragen.
»Warum sind Sie in meinen Bücherladen gekommen?«, fragte Malone.
»Ich habe in der Stadt übernachtet. Henrik hat mich gestern in ein Hotel geschickt. Ich habe gemerkt, dass etwas faul war. Er wollte nicht, dass ich auf seinem Landsitz blieb.«
»Wie lange sind Sie schon in Dänemark?«
»Seit einer Woche. Sie waren weg. Sie sind erst vor ein paar Tagen wieder zurückgekommen.«
»Sie wissen eine Menge über mich.«
»Eigentlich nicht. Ich weiß, dass Sie Cotton Malone sind, ein ehemaliger Marineoffizier. Sie haben für das Magellan Billet gearbeitet. Inzwischen sind Sie im Ruhestand.«
Malone warf ihm einen Blick zu, der ausdrückte, wie wenig Geduld er damit hatte, dass Collins seiner ursprünglichen Frage auswich.
»Ich betreibe nebenher eine Website«, erklärte Sam. »So was sollen wir eigentlich nicht tun, aber ich habe es gemacht. Der Weltfinanzkollaps – eine kapitalistische Verschwörung. So habe ich es genannt. Sie finden sie unter Moneywash.net.«
»Ich kann verstehen, warum Ihre Vorgesetzten ein Problem mit Ihrem Hobby haben könnten.«
»Ich nicht. Ich lebe in Amerika. Ich habe das Recht, zu sagen, was ich denke.«
»Aber Sie haben nicht das Recht, gleichzeitig als Secret-Service-Mann zu arbeiten.«
»Genau das haben die auch gesagt.« Er konnte die Frustration in seiner Stimme nicht verbergen.
»Worum ging es auf Ihrer Webseite?«, fragte ihn Malone.
»Um die Wahrheit. Um Finanziers wie Mayer Amschel Rothschild.«
»Und da haben Sie Ihr Recht auf freie Meinungsäußerung wahrgenommen?«
»Was spielt das für eine Rolle? Der Mann war nicht mal Amerikaner. Einfach nur ein Meister im Umgang mit Geld. Seine fünf Söhne waren darin sogar noch besser. Sie lernten, wie man aus anderer Leute Schulden ein Vermögen macht. Sie waren Geldgeber für die Monarchien Europas, waren überall vor Ort. Mit der einen Hand gaben sie, mit der anderen nahmen sie sogar noch mehr zurück.«
»Ist das nicht der American Way?«
»Sie waren keine Bankiers. Banken arbeiten mit Kapital, das entweder von ihren Kunden angelegt oder von der Regierung geschaffen wurde. Die Rothschilds aber nahmen ihr persönliches Vermögen und verliehen es zu obszönen Zinsen.«
»Erneut, was ist daran eigentlich falsch?«
Sam rutschte auf seinem Sitz herum. »Genau diese Haltung hat den Rothschilds gestattet, mit ihrem Verhalten durchzukommen. Die Leute sagen: ›Na und? Es ist ihr Recht, Geld zu machen.‹ Nein, das ist es nicht.« Die Wut kochte in ihm hoch. »Die Rothschilds haben ihr Vermögen mit der Finanzierung von Kriegen verdient. Wussten Sie das?«
Malone antwortete nicht.
»Meistens haben sie beiden Seiten Geld geliehen. Und das verliehene Geld war ihnen scheißegal. Stattdessen wollten sie Privilegien, die sich zu Gewinn ummünzen ließen. Zum Beispiel Bergbaukonzessionen, Monopole oder Importverbote für bestimmte Güter. Manchmal erhielten sie als Garantie sogar das Anrecht auf bestimmte Steuern.«
»Das liegt Hunderte von Jahren zurück. Warum zum Teufel schert Sie das?«
»Es geschieht wieder.«
Malone bremste wegen einer scharfen Kurve. »Woher wissen Sie das?«
»Nicht jeder, der reich wird, ist so wohltätig wie Bill Gates.«
»Haben Sie Namen? Beweise?«
Collins verstummte.
Malone schien sein Dilemma zu spüren. »Nein, die haben Sie nicht. Da ist einfach nur ein Haufen verschwörungstheoretischer Mist, den Sie ins Internet gestellt haben, woraufhin Sie gefeuert worden sind.«
»Das ist nicht an den Haaren herbeigezogen«, entgegnete Sam rasch. »Diese Männer wollten mich töten.«
»Das scheint Sie ja fast zu freuen.«
»Es beweist, dass ich recht hatte.«
»Das ist eine ziemlich voreilige Schlussfolgerung. Erzählen Sie mir, was passiert ist.«
»Ich habe da in einem kleinen, muffigen Hotelzimmer gehockt, also beschloss ich, einen Spaziergang zu machen. Zwei Männer sind mir gefolgt. Ich habe Fersengeld gegeben, aber sie kamen mir weiter nach. Und so bin ich zu Ihnen gekommen. Henrik hatte mir gesagt, ich sollte im Hotel warten, bis ich von ihm hörte, und Sie dann kontaktieren. Aber als ich meine beiden Verfolger bemerkt habe, habe ich in Christiangade angerufen. Jesper hat mir gesagt, ich sollte Sie schleunigst aufsuchen, und so bin ich zu Ihrem Laden geeilt.«
»Wie sind Sie reingekommen?«
»Ich habe die Hintertür aufgebrochen. Das geht wirklich leicht. Sie brauchen eine Alarmanlage.«
»Ich schätze, wenn jemand alte Bücher stehlen will, dann kann er sie haben.«
»Was ist mit Leuten, die Sie umbringen wollen?«
»Eigentlich wollten diese Leute Sie umbringen. Und außerdem war dieser Einbruch töricht. Ich hätte Sie erschießen können.«
»Ich wusste, dass Sie das nicht tun würden.«
»Schön, dass Sie das gewusst haben. Ich wusste es nämlich nicht.«
Sie fuhren ein paar Meilen schweigend weiter und näherten sich Christiangade immer mehr. Sam hatte diese Fahrt im Verlauf des Jahres bereits mehrmals gemacht.
»Thorvaldsen hat einiges auf sich genommen«, sagte er schließlich. »Aber der Mann, hinter dem er her ist, hat angefangen.«
»Henrik ist kein Dummkopf.«
»Vielleicht nicht. Aber jeder findet einmal seinen Meister.«
»Wie alt sind Sie?«
Sam wunderte sich über den plötzlichen Themenwechsel. »Zweiunddreißig.«
»Und wie lange waren Sie beim Secret Service?«
»Vier Jahre.«
Er begriff, worauf Malone abzielte. Warum hatte Henrik es für nötig befunden, mit einem jungen, unerfahrenen Secret-Service-Agenten Kontakt aufzunehmen, der eine obskure Website betrieb? »Das ist eine lange Geschichte.«
»Ich habe Zeit«, sagte Malone.
»Eigentlich nicht. Thorvaldsen hat Öl ins Feuer gegossen, und das in einer Situation, in der Fingerspitzengefühl erforderlich gewesen wäre. Er braucht Hilfe.«
»Spricht hier der Verschwörungstheoretiker oder der Agent?«
Malone drückte aufs Gaspedal seines Mazdas und schoss eine gerade Strecke entlang. Rechts von ihnen erstreckte sich der schwarze Ozean und am Horizont schimmerten die Lichter des fernen Schweden.
»Es ist sein Freund, der spricht.«
»Offensichtlich wissen Sie überhaupt nichts über Henrik«, bemerkte Malone. »Der hat vor gar nichts Angst.«
»Jeder hat vor irgendwas Angst.«
»Was macht denn Ihnen Angst?«