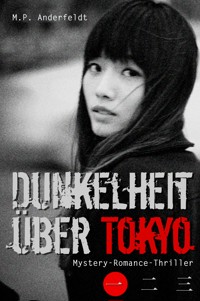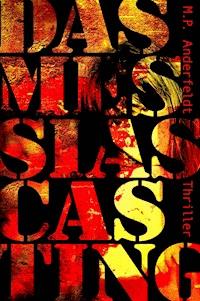
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Eine rätselhafte Serie von Selbstmorden erschüttert die Welt. Plötzlich und anscheinend ohne Grund bringen junge Menschen sich einfach um. Fieberhaft sucht die rasch gegründete, internationale Taskforce nach einer Lösung für das Problem. Da kommt ein Lösungsvorschlag aus einer ganz unwahrscheinlichen Ecke: Wir brauchen wieder einen Messias – es muss ja kein echter sein. Die Suche nach einem geeigneten Kandidaten führt die Gruppe um die ganze Welt. Sie bemerken nicht, dass sie längst selbst zu Gejagten geworden sind. Denn mit ihrer Idee haben sie sich mächtige Feinde gemacht …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 398
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
M.P. Anderfeldt
Das Messias Casting
Thriller
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Prolog
Das Foto
Hamburg
Milwaukee
Island
Milwaukee
Island
Austin
Unterwegs
Gainesville
Dhaka
Enugu
Dhaka
Hannover
Ipoh
Dhaka
Cusco
Naha
Fes
Saitama
Mandalay
Guadalajara
Fujishiro
Saitama
Tokyo
Saitama
Stefan
Elijah
Stefan
Elijah
Stefan
Elijah
Stefan
Cullen
Stefan
Sergej
Stefan
Stefan
Elijah
Stefan
Fujishiro
Zu Hause
Nachwort
Über den Autor
Weitere Werke
Leseprobe aus »Der kleine Vogel des Todes«
Leseprobe aus »Nur zehn Tage«
Leseprobe aus »Dunkelheit über Tokyo«
Impressum neobooks
Prolog
Das Bild war hell und klar und so scharf, dass man das Gefühl hatte, nur den Arm ausstrecken zu müssen, um das Ziel berühren zu können. Schmidt & Bender, das Feinste vom Feinen. Hatte ihm zumindest dieser Corporal erzählt. Elijah selbst kannte sich damit nicht aus, obwohl sein Vater ihn ein paar Mal mit auf den Schießstand genommen hatte. Mom hatte geschimpft, weil sie meinte, dafür sei er noch viel zu jung, aber Dad meinte, ein Junge könne so etwas gar nicht früh genug lernen. Naja, das war lange her …
Reiß dich zusammen, befahl er sich, jetzt ist keine Zeit für Erinnerungen an die Kindheit, du musst voll da sein. Es war wichtig, dass er sich konzentrierte. Er durfte jetzt keinen Fehler machen und alles vermasseln.
Madison stand hinter ihm und streichelte ihm über den Kopf. »Du tust das Richtige. Es ist wie damals in Milwaukee. Das Böse muss gestoppt werden.«
Auch wenn ich diesmal vielleicht keine Blumen bekomme, dachte Elijah.
»Nein, du bekommst vielleicht keine Blumen, aber ich verspreche dir, es gibt Menschen, die dir dankbar sein werden. Und ob du schon wandertest im finsteren Tal, dir wird nichts mangeln.«
Noch immer irritierte ihn Madisons Fähigkeit, seine Gedanken zu lesen. Oder erriet sie sie nur? Angeblich kam das unter Geschwistern ja vor. Aber diese ständigen Bibelzitate, die nervten wirklich. Nichts gegen die Heilige Schrift, aber das war eine irritierende Angewohnheit. Reverend Hornbine zitierte doch auch nicht in einem fort die Bibelsprüche.
Zum hundertsten Mal kontrollierte er den Stand des Gewehrs. Das Dreibein stand bombenfest, die Waffe selbst war gut schwenkbar. Nicht zu leicht und nicht zu schwer; wenn sich das Ziel bewegte, würde er leicht nachführen können, bei einem Schuss stünde es fest genug, um es nicht zu verfehlen. Und es würde nicht verreißen, wenn ein zweiter Schuss nötig war. Nötig werden sollte. Ein Kinderspiel, selbst auf diese Entfernung. Was sollte mit dieser Waffe schiefgehen?
»Es kann immer etwas passieren. Satan kann versuchen, uns aufzuhalten«, sagte Madison sanft aber bestimmt. Ihr komisches, gelbes Kleid raschelte bei jeder ihrer Bewegungen. Er glaubte, sich erinnern zu können, dass Mom so ein Kleid auf einem alten Foto trug. Sicher war es kein Zufall, dass Madison das jetzt anhatte. Zufälle gab es nicht, wenn es um sie ging.
Er überprüfte, ob das Gewehr gespannt war. Es war. Natürlich. Er vergewisserte sich, dass er den Sicherungshebel blind fand, und entsicherte mit einem schnellen Handgriff. Dann sicherte er die Waffe ebenso rasch wieder. Er hatte das Gefühl, er müsste sich den Schweiß von der Stirn wischen, doch er schwitzte nicht.
»Warum solltest du auch schwitzen? Du tust nichts Falsches.« Die Nacht war mild, eine sanfte Brise strich durch das Fenster, das er immerhin einen Spalt breit hatte öffnen können. Trotz der späten Stunde war es angenehm warm, nicht zu heiß. Die perfekte Temperatur, um zu Hause bei einem kühlen Bier auf der Veranda zu sitzen. Und nicht auf der anderen Seite der Welt in einem dunklen Hotelzimmer zu lauern. Wie ein heimtückischer Mörder.
»Gott hat dich in dieses Land gebracht, weil du sein Werkzeug bist, verstehst du? Du bist Elija, der Gesandte Gottes. Ihr habt die Gebote Jahwes nicht geachtet und seid dem Baal nachgefolgt.«
Elijah grunzte unwillig. Noch mehr Bibelzitate. Er fand, sie wirkten pompös und passten nicht zu Madison.
»Als das Volk das sah, warfen sich alle zu Boden, mit dem Gesicht in den Staub, und riefen: ›Jahwe allein ist Gott! Jahwe allein ist Gott!‹ Und Elija sagte zu ihnen: ›Packt die Propheten des Baal! Keiner darf entkommen!‹.« Am Ende hatte sie die Worte gerufen. Nun beruhigte sie sich wieder. Immerhin.
Leise wiederholte sie den letzten Satz und betonte dabei jedes einzelne Wort: »Keiner darf entkommen. Das ist Gottes Wille, Elijah.«
Er spürte das Gewicht ihrer Hand auf seiner Schulter, als sie fortfuhr: »Du magst es nicht, wenn ich so bin. Es tut mir leid. Es geht eben manchmal mit mir durch – der Auftrag ist so wichtig. Das ist das Wichtigste, was du je getan hast. Dein ganzes Leben kulminiert in diesem Moment.«
Sie biss sich auf die Unterlippe und blickte auf den Boden. »Ich weiß, du bist kein alter Prophet mit einem weißen Rauschebart. Du bist mein Bruder und ich liebe dich. Ich bin sehr stolz auf dich.« Sie beugte sich über ihn und gab ihm einen Kuss auf den Hinterkopf. Wieder raschelte das Kleid.
Schon vor einiger Zeit hatte er bemerkt, dass Madison nach gar nichts roch. Elijah achtete normalerweise nicht besonders auf Gerüche, aber Madisons Geruchlosigkeit war auffällig. Mom roch morgens nach Seife und Duschgel und abends nach Schweiß und Küche – und irgendwie immer nach Mom.
Elijah wandte sich zu Madison um. Sie strahlte ihn an. Sie hatte viel von ihrer Mutter, nur die Augen hatte sie von Dad. Sie sah jetzt aus wie die 15 Jahre, die sie tatsächlich war. Oder sein müsste. Warum wurde sie älter? Was hatte das zu bedeuten?
Er blickte wieder durch das Zielfernrohr. Wer würde dort kommen? Wen würde er töten müssen?
»Du wirst es wissen. Du wirst den falschen Messias erkennen.«
Er seufzte.
Du wirst es wissen … Immer diese Sicherheit in ihrer Stimme. Immerhin hatte sie bisher stets recht gehabt. Warum sollte es diesmal anders sein? Es war wie die anderen Male auch.
Elijah wandte sich wieder der Waffe zu. Um Gewicht einzusparen, bestand das M40A5 zum größten Teil aus matt olivgrünem Fieberglas, wodurch es ein wenig wie ein Spielzeug wirkte. Aus Plastik – das ist doch keine Waffe, hatte er gedacht, als er das Gewehr zum ersten Mal gesehen hatte.
Der Marine, der es ihm gegeben hatte, hatte ihm die Skepsis wohl angesehen. Es gibt nichts Besseres, hatte er ihm versprochen und Elijah in die Augen gesehen. Das war auf Okinawa gewesen. Elijah verstand immer noch nicht, wie es ihm gelungen war, eine Tennistasche mit einem Gewehr quer durchs Land zu schmuggeln. Jedes Mal, wenn er einen Polizisten sah, brach ihm der Schweiß aus, weil er befürchtete, dass einer sich mal zeigen lassen würde, was Elijah da mit sich herumtrug. Er musste wohl einen Schutzengel haben. Oder es war Gottes Wille, wie Madison sagen würde. Vielleicht lag es auch daran, dass den meisten Einheimischen seine Anwesenheit immer etwas peinlich zu sein schien; egal, wohin er ging, waren alle augenblicklich mit etwas anderem beschäftigt, sobald sie den Ausländer erkannten. Naja, am Ende war das auch Gottes Wille.
Das Magazin fasste zehn Schuss und war voll, viel mehr als ein Scharfschütze für diese Art Job brauchte. Das hatte ihm ebenfalls der Corporal erklärt. Wenn der erste Schuss nicht traf, müsste es der zweite tun. Es gab keinen dritten. Die Marines hatten irgendeinen Namen für einen Sniper, der beim ersten Schuss sein Ziel nicht traf, aber er fiel ihm nicht ein. Der Offizier hatte ihm gesagt, wie man einen Schützen nannte, der auch beim zweiten Schuss sein Ziel nicht traf und das hatte er sich gemerkt: Dead Man. Naja, er war ja nicht im Krieg und Elijah war froh, dass er ein paar Versuche mehr hatte. Aber was würde er tun, wenn er den Mann nur verletzte? Sollte er dann nochmals schießen und ihn töten? Einem Mann in den Kopf schießen, der sich vielleicht vor Schmerzen auf dem Boden wand? Er wusste, das würde er nicht tun können, er war doch kein Killer. Und was, wenn er nicht allein war? Wenn ihm jemand zu Hilfe eilte? Wenn ihn jemand zu schützen versuchte und sich vor ihn stellte? Müsste er dann erst den töten? Madison hatte recht, es konnte jede Menge Scheiße passieren.
Durch das Objektiv betrachtete er den Wirt, der gelangweilt die schäbigen Tische in seinem kleinen Restaurant abwischte. Trotz der Dunkelheit war er klar und scharf zu sehen, wie durch ein gutes Fernglas. Er bräuchte nur den Finger zu krümmen und der Mann würde von einer Kugel getroffen zusammenbrechen, da vorne, ein paar hundert Meter entfernt. Er besaß eine perfekte Tötungsmaschine, ein Höhepunkt Jahrtausende währender Versuche der Menschen, sich auf immer effektivere Art umzubringen. Tod auf Knopfdruck.
»Und wenn ich nicht schießen kann?«
»Glaubst du, Dad hätte gezögert?«
Nein, gewiss nicht. Elijahs Vater war Polizist gewesen. Aber hätte er es überhaupt so weit kommen lassen wie Elijah, der jetzt im vierten Stock eines Hotels saß und auf sein Opfer lauerte?
»Du lauerst nicht. Das ist kein Opfer. Du rettest die Welt vor einem falschen Messias. Vor dem Satan.«
Natürlich war es Sünde, wenn sich jemand als Messias ausgab. Aber hatten solche Verrückten nicht schon immer existiert? Musste man sie aus dem Weg schaffen?
»Sünde?« Madison winkte ab. »Darum geht es nicht. Das ist kein harmloser Spinner. Der und seine Freunde wollen die Welt verändern. Wenn du es nicht verhinderst, wird es passieren. Möchtest du, dass bald Kirchen brennen? Möchtest du, dass Christen bald wieder verfolgt werden? Möchtest du, dass Unschuldige gekreuzigt werden?«
»Nein … natürlich nicht.«
»Sollen noch mehr Menschen sterben? Denk an Matthew … Du hast schon einmal Hunderte gerettet. Jetzt musst du Millionen retten. Du hast es in der Hand. Du bist die Waffe Gottes. Das ist dein Schicksal, vor dem du nicht weglaufen kannst. Jona hat es versucht, Hiob haderte mit seinem Schicksal, aber man kann sich Gottes Willen nicht entziehen.«
Minutenlang sagte keiner etwas. Elijah setzte sich aufrecht hin und drehte seinen Kopf langsam in alle Richtungen, um die Verspannungen zu lösen. Bei jeder Bewegung knackte es.
»Es ist gleich so weit«, flüsterte Madison, obwohl es keinen Grund gab, zu flüstern. Und für sie erst recht nicht.
Elijah nickte. Er entsicherte die Waffe und blickte ruhig durch das Zielfernrohr. Nicht zögern und nicht die Luft anhalten, hatte der Corporal gesagt. Ruhig einatmen, dann ausatmen und abdrücken.
Bewegung kam ins Bild. Ein paar bange Sekunden fragte er sich, ob er sein Ziel auch erkennen würde. Was, wenn eine ganze Gruppe kam? Und was, wenn er keine freie Sicht zum Zielobjekt hätte?
Doch es war, wie Madison es vorausgesagt hatte. Er wusste sofort, wer es war und es war ein leichtes, die Person ins Visier zu nehmen. Ausatmen und abdrücken.
Er atmete ein, dann aus. Ganz ruhig.
Das Foto
Hamburg
Ihr Gesicht wurde weltbekannt. Eine Ikone – zu vergleichen eigentlich nur mit berühmten Bildern, wie dem von Che Guevara oder dem Foto, auf dem Einstein die Zunge herausstreckt. Wirklich jammerschade, dass sie nichts mehr davon hatte, weil sie natürlich tot war. Naja, ich bin immerhin ziemlich sicher, dass auch Albert Einstein und Che Guevara keine Tantiemen für den Verkauf ihrer Fotos bekommen haben.
Im Gegensatz zu ihrem Gesicht war ihr Name übrigens praktisch unbekannt, wahrscheinlich, weil er zu exotisch war. Neben ihrem richtigen Namen, Satsuki (mit einem fast stummen »u«), waren mindestens ein halbes Dutzend falscher im Umlauf, am populärsten war aus irgendwelchen Gründen »Karen«. Nicht einmal im Wikipedia-Artikel war der korrekte Name genannt.
Das Foto war etwas unscharf, wahrscheinlich, weil es im Schatten aufgenommen worden war. Vielleicht, hatte ich mir mal überlegt, vielleicht müssen Fotos, die zur Legende werden sollen, technische Mängel aufweisen, damit sie authentisch aussehen. Nicht, dass an der Authentizität ein Zweifel bestanden hätte. Das abgebildete Mädchen hatte halblanges, dunkles Haar und die Augen lugten unter einem dichten Pony hervor. Hübsch, ja, aber nichts Besonderes eigentlich. In jeder Stadt der Welt gibt es haufenweise 16-jährige Mädchen wie sie. Vermutlich war es der Blick, der das Foto so berühmt gemacht hatte, dieser unendlich traurige, hoffnungslose Blick.
Der und natürlich die Tatsache, dass sie sich, wenige Sekunden, nachdem das Foto von einem namenlosen Passanten aufgenommen worden war, am Bahnsteig zwei des Bahnhofs Fujishiro vor den durchfahrenden Limited Express der Joban Line geworfen hatte; unmittelbar gefolgt von vier anderen Mädchen und zwei Jungen.
Wenn sich eine Person umbringt, ist das tragisch, aber nur eine kurze Meldung in der Lokalzeitung. Wenn sieben junge Menschen aus der Highschool gemeinsam Selbstmord begehen, dann ist das eine Top-Nachricht. Journalisten und Kamerateams aus der ganzen Welt reisten in den verschlafenen Tokyoter Vorort und berichteten, analysierten und spekulierten. Sicher wurde jeder Einwohner dieses Nests ein Dutzend Mal interviewt und jeder Jugendpsychologe und echte oder selbsternannte »Asien-Spezialist« konnte in aller Breite seine Vermutungen und Theorien zum Besten geben.
Das ging knapp zwei Wochen so. Mit Sondersendungen und langen Artikeln in Zeitungen und Zeitschriften; man kennt das ja von Katastrophen aller Art, von Terroranschlag bis Überschwemmung.
Danach wusste auch Otto Normalfernsehzuschauer, dass japanische Kinder in der Schule unter enormem Leistungsdruck standen. Dazu waren ihre Eltern mit der Erziehung oft überfordert und die Zukunftsperspektiven der jungen Leute schienen angesichts einer seit Jahren stagnierenden Wirtschaft auch nicht so rosig. War das der Grund für den Selbstmord? Vielleicht. Dazu kam natürlich das Alter, klar. Wie alt war Goethes Werther, als er seinem Leben ein Ende setzte? Älter? Na ja, die jungen Leute sind heute eben schon reifer und machen so was früher.
Die Programmmanager kramten tief in der Filmkiste und hievten alte Dokumentationen über Kamikaze im zweiten Weltkrieg ins Programm, über Harakiri, Seppukku und wie das alles hieß. So wurde auch dem letzten klar: Japan, das ist eine andere Welt, das begreifen wir ja doch nicht. Etwas mit anderer Kultur und Mentalität, von uns Europäern nicht zu verstehen.
Die Leute langweilte es da schon lange, es passierte nichts mehr und neue Erkenntnisse gab es auch nicht. Die Berichterstattung einigte sich also darauf, dass das Ganze eine typisch japanische Sache war. Für uns im fernen Europa war das ja auch ganz bequem, denn damit war es nicht mehr unsere Sorge; genau wie Fukushima, Erdbeben oder Tsunamis. Naja, hatten sie eben ein Problem mehr in Fernost. So sorry, aber wir haben unsere eigenen Schwierigkeiten.
Die Kamerateams zogen ab und die kleine Vorstadt verfiel wieder in einen Dornröschenschlaf.
Ziemlich genau eine Woche später sprangen in Barcelona sechs junge Rucksacktouristen von einem Turm der Sagrada Familia. Das verwackelte, aber trotzdem schauderhafte Video war eines der meistgesehenen auf Youtube, bis es endlich gelöscht wurde (und gleich darauf auf dieser und ähnlichen Webseiten hundertfach wieder hochgeladen wurde, teilweise mit äußerst geschmackloser musikalischer oder akustischer Untermalung). Natürlich wurde das Bauwerk sofort gesperrt, aber die Selbstmorde beendete das nicht.
Dann ging es Schlag auf Schlag. Wenige Tage später schnitten sich in Freiburg fünf junge Menschen zwischen 17 und 20 Jahren gemeinsam in einem Auto die Pulsadern auf. Zum Glück gab es davon keine Bilder in den Nachrichten, es muss eine wahnsinnige Sauerei gewesen sein.
Acht Tote in Ohio, einer nach dem anderen hatte sich die Pistole in den Mund gesteckt und abgedrückt. Das gleiche, blutige Ding, das muss man sich mal vorstellen.
Und so ging es weiter: Selbstmorde auf der ganzen Welt. Bald sprachen die Medien von einem »Suizid-Virus«, denn es schien sich wie eine Epidemie auszubreiten. Es waren nicht nur junge Menschen, die sich umbrachten, aber die allermeisten waren unter zwanzig Jahre alt. Und das Gros lebte in den so genannten westlichen Industrieländern. Naja, zumindest die meisten, von denen bei uns berichtet wurde.
In Lyon versuchten sich drei Mädchen mit Rattengift umzubringen, überlebten aber. Als man sie befragte, behaupteten sie, nicht zu wissen, warum sie das getan hatten und zuckten nur ratlos mit den Schultern. Einer gelang es noch im Krankenhaus, sich aus dem Fenster zu stürzen, die beiden anderen wurden in geschlossene Anstalten gebracht. Seitdem habe ich nichts mehr über den Fall gehört.
Bald tauchten Poster von Satsuki auf, jenem Mädchen, das zu den Ersten gehört hatte. Sie hingen bald in jedem zweiten Teenager-Zimmer. Zum Missfallen der Eltern natürlich. Eine Untersuchung hatte zwar gezeigt, dass es keinen Zusammenhang gab zwischen der Tatsache, ob ein Bild von Satsuki an der Wand hing und einem möglichen Selbstmord, aber erzählen Sie das einer panischen Mutter! Die meisten Eltern rissen das Bild sofort herunter, wenn sie es im Zimmer ihrer Söhne oder Töchter entdeckten. Dieser Ruch des Verbotenen trug sicherlich entscheidend zu seiner Popularität bei. Hey, es sind Teenager, die würden sich auch keinen Popstar ins Zimmer hängen, den ihre Eltern toll finden. Ich denke, sie hätten das Poster kostenlos in allen Schulen verteilen sollen, wenn sie gewollt hätten, dass die Jugendlichen es so richtig uncool finden.
Manche Eltern versuchten, ihre Kinder Tag und Nacht zu überwachen, einige wohlhabende Mütter und Väter stellten sogar Bodyguards ein. Das brachte aber auch nicht immer den gewünschten Erfolg, bekannt wurde ein Fall, bei dem sich ein Leibwächter gemeinsam mit seinem Schützling umbrachte. Die ebenso bestürzten wie reichen Eltern verklagten daraufhin die Firma, bei der der Bodyguard angestellt gewesen war, auf Schadenersatz in Millionenhöhe. Ich weiß nicht, wie der Fall ausgegangen ist, wahrscheinlich gab es einen außergerichtlichen Vergleich.
Das Time Magazine beschäftigte sich unter der etwas euphemistischen Überschrift »A Generation Disappears« intensiv mit dem Thema. Die Headline war in einer nach unten verblassenden Schrift gesetzt, damit es auch jeder kapierte. Auf dem Titel war wieder das japanische Mädchen zu sehen. Natürlich.
Ich will nicht sagen, dass mir das alles am Arsch vorbei ging. Ich bin kein Schwein, auch wenn ich vielleicht manchmal so wirke. Wenn junge Menschen ihr Leben gewaltsam beenden, lässt das wohl niemanden kalt. Die Selbstmordserie hat mich auch betroffen gemacht. Aber ich habe nun mal kein Kind und der einzige Teenager, den ich persönlich kenne, ist die Tochter meines Bruders und die ist glücklicherweise ein richtiger kleiner Sonnenschein. Von daher sicher keine Selbstmordgefahr.
Ich dachte außerdem, dass die Sache mit den Selbstmorden eben eine Mode ist und dass das irgendwann wieder von selbst aufhört. Wie Tamagotchi oder Plateauschuhe.
Ich habe auch mal einen interessanten Artikel gelesen, der besagte, dass abgesehen von einem gewissen Nachahmungseffekt die Zahl der Selbstmorde nicht höher sei als früher. Aufgrund des aktuellen Hypes wird nur genauer hingesehen und über jeden Fall ausführlich in den Medien berichtet. Das war irgend so ein Effekt, ich habe den Namen vergessen. So wie nach einem Flugzeugabsturz immer so viel über Störungen oder Unfälle im Luftverkehr in den Nachrichten kommt, dass das Gefühl entsteht, es handle sich um eine »Serie«, was in Wirklichkeit aber überhaupt nicht zutrifft. Ich fand das damals sehr plausibel. Und damit war die Sache für mich gegessen.
Eher zufällig habe ich mich irgendwann nebenbei mit dem Foto beschäftigt, weil wir dazu eine Idee für eine Anzeige hatten, aber der Kunde hat abgewinkt, die Sache war ihm zu heiß. Höchst bedauerlich, denn es war eine klasse Idee und wäre ein echter Selbstläufer geworden. Virales Potenzial ohne Ende, danach schreien sie doch sonst immer – von den Kreativpreisen, die uns dadurch entgangen sind, will ich gar nicht anfangen. Schade, schade. Aber gut, so sind Kunden eben, oder? Immer gleich die Hosen voll. Nur nichts Neues riskieren, es könnte ja sein, dass irgendjemand das als nicht »p.c.« empfindet, einen kritischen Artikel in der Zeitung schreibt und dadurch ihre Marke beschädigt.
Die Lage schien sich wirklich beruhigt zu haben, eine ganze Weile hat man nichts mehr erfahren von weiteren Selbstmorden und ich dachte überhaupt nicht mehr daran. Vielleicht hatten die Leute auch einfach keine Lust mehr, etwas darüber zu hören und beschäftigten sich wieder mit wichtigen Dingen, wie dem Dschungelcamp oder dem Wolf, der angeblich irgendwo nördlich von Frankfurt sein Unwesen trieb.
Eines Tages ist mir ein Briefchen mit einem Jobangebot ins Haus geflattert. Als freier Werber bekommt man immer wieder Anfragen per Email oder Telefon, wenn eine per Post kommt, ist das schon sehr ungewöhnlich. Wenn ich mich recht erinnere, war das das erste Mal. Absender war eine bekannte Freelancervermittlung, von daher keine Überraschung, die hatten mir schon so manchen Job zukommen lassen. Das erstaunliche war die astronomische Strafe, die bei Verletzung der Geheimhaltung zu zahlen wäre: 1.500.000 Euro. Da musste ich zwei Mal hinsehen. Einein-fucking-halb Millionen Euro? Ich fragte mich, ob das nicht sittenwidrig war oder so. Ich habe natürlich trotzdem unterschrieben. Ich kann schweigen wie ein Grab.
Ich hatte mal einen Job, da ging’s um eine Kosmetikserie für Männer, die ganz neu auf den Markt kommen sollte. Was den Namen der Firma angeht, schweige ich immer noch, weil ich nicht ganz sicher bin, was eigentlich in dem Vertrag stand, den ich damals unterschrieben habe. Also sagen wir mal, es ging um eine Pflegeserie der Firma XYZ. Unter der neuen Bezeichnung sollten die Pflegeprodukte für die Herren der Schöpfung neu positioniert werden. Der streng geheime Name, den sich die Top-Kreativen in monatelangem Brainstorming überlegt hatten: XYZ Man. Wenn ich das irgendjemandem verraten hätte, bevor das Produkt im Handel war, hätte ich 100.000 Euro Strafe zahlen müssen. Ich habe damals gewitzelt, hoffentlich hat von der Konkurrenz niemand ein Englisch-Wörterbuch, sonst erraten sie am Ende noch unsere Namenskreation. Der Marketingchef fand das nicht so lustig. Wenn 100.000 Euro Strafe verrückt waren, was waren dann 1,5 Millionen? Irrwitzig?
Oder einfach nur verheißungsvoll? Meine Hoffnung war nämlich, dass es um ein richtig großes Ding ging. Ein Job, bei dem ich schön absahnen konnte und außerdem noch etwas für meinen Bekanntheitsgrad tun konnte. Letzterer hat in meiner Branche auch Auswirkungen auf das Bankkonto – wer bekannt ist, bekommt mehr und besser bezahlte Jobangebote.
Also unterschrieb ich die verrückte Geheimhaltungsvereinbarung und schickte sie zurück an die Freelancervermittlung. Noch am gleichen Tag streckte ich unauffällig meine Fühler aus und versuchte, herauszufinden, ob auf Facebook oder in einem der Freelancerforen jemand etwas von einem großen Projekt gehört hatte, in dem die Vermittlung ihre Finger hätte. Leider entdeckte ich nichts – das kann aber auch daran liegen, dass ich zu unauffällig geforscht habe. Ich hatte eben Schiss.
Nach ein paar Tagen fürchtete ich schon, dass das Ganze eine Ente gewesen war. Als ich mich endlich dazu durchgerungen hatte, bei der Freelancervermittlung anzurufen (natürlich taktisch geschickt: »Ich habe jetzt eine andere Anfrage, darum möchte ich wissen, ob ihr Angebot noch aktuell ist«), bekam ich Post. Eine Einladung zu einem Workshop. Absender war immer noch die Vermittlung. Angeblich ging es um eine neue Kampagne. Klasse, dachte ich, vielleicht handelt es ja um ein neues iPhone oder so etwas. Leider wusste ich immer noch nicht, für welchen Kunden ich tätig sein sollte, aber schlimmer als die Versicherung, für die ich neulich einen 24-seitigen Geschäftsbericht verfasst hatte, konnte es auch nicht sein. Zumal die Bezahlung, die sie mir anboten, wirklich erstklassig war, sage und schreibe drei mal mehr als das, was ich normalerweise verlange – und das, bevor ich mich herunterhandeln lasse. Stattfinden sollte das Ganze in Chicago. Warum nicht, ich hatte in den nächsten Wochen sowieso nichts vor. Zumindest nichts, was ich angesichts von so viel Geld nicht liebend gerne abgesagt hätte.
Milwaukee
Jeden Augenblick würden die ersten Läufer auftauchen. Atemlos berichtete der Ansager vor Ort, wer gerade vorn lag. Elijah sagten die Namen nichts. Klar, er hatte auch keine Ahnung von Triathlon. Aber er hatte seiner Mutter versprochen, etwas mit Matt zu unternehmen, und der Milwaukee Triathlon genoss anscheinend eine gewisse Bekanntheit. Okay, es war nicht der New York Marathon, aber immerhin. Und man konnte kostenlos zusehen, zumindest wenn man sich damit zufriedengab, dass man nicht auf der schicken Zuschauertribüne direkt am Zieleinlauf saß, sondern etwas weiter vorne am Straßenrand stand. Er warf einen Blick auf Matthew. Der Junge schien sich mehr für eine schwarzhaarige Frau auf der Tribüne zu interessieren als für den Sport. Naja, es war ja auch noch nichts zu sehen.
»Wie lange dauert das hier eigentlich? Ich habe später noch Bandprobe …« Matt schüttelte seine langen, dunklen Haare. Elijah hasste es, wenn er das tat. Warum ließ sich jemand die Haare so lange wachsen, dass er kaum noch aus den Augen sehen konnte? Dazu das Bürsten, Haarewaschen und Föhnen, was für ein Aufwand. Das war doch weibisch.
Seine Blicke wanderten wieder auf die Tribüne. Die Frau trank einen Schluck Cola Light aus der Dose und warf den Kopf nach hinten. Sie hatte einen langen, hellen Hals, der einen starken Kontrast zu ihren dunklen Haaren bildete. Die Haare sahen irgendwie zu schwarz aus, fast schon blau. Sicher gefärbt, das würde Mutter nicht gefallen, obwohl sie ihre Haare selbst kolorierte, seitdem sie graue Strähnen darin entdeckt hatte. Die Lippen waren auch zu rot, das Gesicht ein wenig zu blass. Sie sah ja aus wie eine Puppe. Oder wie Schneewittchen. Hatte sie gerade hergesehen? Aber wer könnte auf diese Entfernung schon sagen, wen sie angeschaut hat. Er bemerkte, wie er sich automatisch in Pose warf, und ärgerte sich darüber. Mit so einer, das würde sowieso nichts werden. Die ging sicher auf eine teure Uni und ihr Vater war Rechtsanwalt oder Arzt oder so etwas. Sie fuhr ein rotes BMW Cabrio und ging jedes Wochenende auf schicke Partys mit ihren Freundinnen und Freunden, die ebenso reich waren. Kenny hatte mal was mit so einer, das war nicht lange gut gegangen. Felicity war ihr Name gewesen, sie hatte lange, blonde Haare gehabt und hervorragend gemachte C- oder D-Cup Titten. Echtes Kunsthandwerk, hatte Kenny damals gescherzt. Seine Witze waren ihm bald vergangen, denn nach zwei Wochen war Schluss gewesen und jemand anderes erfreute sich an Felicitys Talenten. Das war vor einem halben Jahr gewesen und der ärmste trauerte ihr immer noch hinterher, obwohl allen anderen von Anfang an klar gewesen war, dass sie nur mit ihm gespielt hatte.
Immerhin war Matt nicht schwul. Der Sohn der Bernards von gegenüber, so ein Dürrer, Rothaariger, hatte sich als homosexuell geoutet und seine Eltern waren völlig verzweifelt. Reverend Hornbine war dabei auch keine große Hilfe, zum Entsetzen der Eltern meinte er, dass das ›nicht so schlimm‹ sei und sich in vielen Fällen noch gebe. Vater Bernard hatte geschworen, er werde dem Jungen sein Verhalten ›austreiben‹, er würde niemals eine Schwuchtel unter seinem Dach dulden und ihm diese Perversion schon abgewöhnen. Elijah schauderte bei dem Gedanken, wenn er sich vorstellte, wie er das tun wollte.
»Deine Band. Du weißt, was Mutter und ich davon halten.« Elijah sah es nicht, aber er konnte ganz genau spüren, wie Matt die Augen verdrehte. »Nichts gegen Musik, aber wir finden –«
»Ich weiß, aber mir ist sie wichtig«, unterbrach Matt ihn. Er hatte ja recht, diese Diskussion hatten sie schon oft genug geführt. Und irgendwie war es auch gut, dass ihm seine Band etwas bedeutete. Das sagte er Matt natürlich nicht. Aber es war immer gut, wenn sich Menschen für etwas interessierten. Diese Selbstmörder, die hatten sich für nichts interessiert, hatte der Reverend gesagt. Denen war alles so egal, dass sie am Ende sogar ihr Leben weggeworfen hatten, das Gott ihnen geschenkt hatte. Warum aber musste Matt sich ausgerechnet für eine Band so begeistern? Das war doch keine Zukunftsperspektive.
Elijah drehte sich zu seinem kleinen Bruder und verwuschelte ihm die Haare.
»Hey, lass das!« Lachend wehrte Matt die Attacke ab und richtete seine Haare wieder her.
Elijah sah ihn nachdenklich an. Sein kleiner Bruder war groß geworden. Sicher würde er bald eine Freundin haben, die Mädels schienen sich ja nicht an den langen Haaren zu stören. Oder hatte er längst eine? Wenn er über all dem nur nicht die Schule vernachlässigte. Der Kleine war clever und er sollte es einmal besser haben als er selbst. Den ganzen Tag in einer lauten, schmutzigen Autowerkstatt, das wäre nichts für Matt. Matthew, da waren er und Mutter einig, war für Höheres berufen. Er sollte einmal Priester werden. Der Reverend wollte sie dabei auch unterstützen. Nur entscheiden müsste sich der Junge selbst.
Er unterdrückte ein Gähnen. Dass er so müde war, daran war dieser verdammte, uralte Mercury schuld, bei dem sie am Vortag das Getriebe ausgebaut hatten. Bis spät in die Nacht. Wer so eine Mühle fährt, kann doch nicht erwarten, dass seine Kiste am nächsten Morgen wieder fahrbereit da steht. Warum nahmen sie überhaupt solche Aufträge an? Klar, weil sie sonst gar nichts zu tun hätten. In jeder vernünftigen Werkstatt hätten sie dem Kunden ins Gesicht gelacht, wenn er mit so einem Ding aufgekreuzt wäre. Er seufzte. Das war echte Knochenarbeit gewesen. Immerhin hatte er dafür heute einen halben Tag frei nehmen dürfen. Naja, wenn das Rennen endlich zu Ende war, würden sie sich noch einen Chili Dog genehmigen, dann hätte der Ausflug immerhin etwas Gutes gehabt.
Er sah sich um und schrak zusammen. Direkt hinter ihm stand ein dicker Polizist und sah ihn direkt an. Elijah nickte ihm leicht zu und der Officer nickte zurück, ohne ihn aus den Augen zu lassen.
In einer Seitenstraße schlich ein hellblauer Ford Tempo dahin. Es waren sonst keine Autos unterwegs. Klar, die Innenstadt war ja gesperrt, wahrscheinlich durften heute nur Anwohner und Lieferverkehr für die ansässigen Geschäfte fahren.
Warum sind eigentlich alle Ford Tempo hellblau, fragte er sich. Der Tempo war ein gutes Auto, Elijah mochte es. Ehrlich, solide, keine komplizierte Elektronik und unter der Motorhaube nicht so zugestopft wie die neueren Autos, alle Teile waren gut zugänglich. Früher hatten sie auch so einen gehabt. Damals, als Vater noch lebte …
Der Ford lag tief auf der Straße. Stoßdämpfer im Arsch, dachte er, komm bloß nicht zu uns damit.
Nein, doch nicht, korrigierte er sich, als das Auto durch ein Schlagloch fuhr. Die Stoßdämpfer sind in Ordnung, das Auto ist nur total überladen.
Das Rennen schien auf seinen langweiligen Höhepunkt zuzusteuern. Irgendein Grüppchen hatte sich vom Pulk abgesetzt, wie der Sprecher aufgeregt mitteilte. Großartig, bringen wir es hinter uns und dann holen wir uns einen Hot Dog. Oder einen Burger bei Wendy’s, da ist Matt früher immer so gern hingegangen. Oder fand er Wendy’s inzwischen total uncool? Obwohl Matt nur ein paar Jahre jünger war, fühlte Elijah sich im Gespräch mit seinem jüngeren Bruder manchmal richtig alt.
Plötzlich zupfte ihn jemand am Arm. Überrascht sah Elijah nach unten. Da stand ein blasses, kleines Mädchen von vielleicht fünf oder sechs Jahren. Ihm fiel auf, dass es ein ausgewaschenes T-Shirt mit der Aufschrift Northwestern Mutual trug. So eines hatte er – und ein paar Jahre später natürlich Matt – früher auch einmal gehabt. Er hatte es beim Sommerfest des Kindergartens beim Sackhüpfen gewonnen und er war damals sehr stolz darauf gewesen.
Das Kind sah ihn auffordernd an. Ihr bleiches, rundes Gesicht kam ihm bekannt vor, er vermochte aber nicht zu sagen, woher.
Er sah sie deutlich, wie sie neben ihm stand, und doch war etwas seltsam an dem Kind. Es legte den Finger an die Lippen und zeigte nach hinten. Fragend sah er das Kind an. Was wollte es? Vielleicht hatte es seinen Ball verschossen oder so etwas. Elijah wandte sich um.
Dort fuhr immer noch der alte Ford Tempo, jetzt im Schritttempo. Elijah fragte sich, wo er hinwollte. Suchte er einen Parkplatz? Es war doch alles frei. Oder hatten sie die ganze Innenstadt zu einer Parkverbotszone erklärt? Das wäre natürlich möglich.
Er konnte erkennen, dass der Mann am Steuer schwitzte, obwohl es nicht besonders warm war. Angestrengt kurbelte er am Lenkrad, die Servolenkung war doch nicht etwa auch hinüber? Er wollte wieder zu dem Mädchen sehen, aber als er nach unten blickte, war es weg.
Ich sollte heute wohl mal früher ins Bett, dachte er und strich sich durch die kurzen Haare.
Mit einem Mal wusste er, woher ihm das Mädchen bekannt vorgekommen war. »Madison«, murmelte er. Matthew blickte sich zu ihm um, unsicher, ob sein Bruder etwas zu ihm gesagt hatte. Mit diesem fragenden Blick sah er jung aus, viel jünger als jemand, der schon bald von der Highschool abgehen würde.
Madison! Er setzte sich in Bewegung. Was wollte sie von ihm? Es musste etwas mit dem Tempo zu tun haben. Wie in Trance ging er auf den Wagen zu. Der dicke Polizist sah ihm kurz nach, entschied dann aber wohl, dass von Elijah keine Gefahr ausging, und wandte sich wieder dem Rennen zu.
»Madison«, flüsterte Elijah eindringlich, als könne er sie dadurch beschwören. Was wollte sie ihm sagen? Verdammt, was hatte Madison ihm nur zeigen wollen? Der Tempo stand jetzt mit laufendem Motor da. Der Fahrer hatte die Augen geschlossen und bewegte die Lippen, als betete er.
Das konnte nicht Madison gewesen sein, natürlich nicht. So viel war klar. Das war überhaupt niemand gewesen, er hatte es sich nur eingebildet. Er beschloss, wieder an seinen Platz zurückzukehren. Das Rennen war bald zu Ende, gewiss würden bald viele nach Hause gehen und er sollte lieber sehen, dass er Matt in dem Gedränge nicht verlor.
Während ihm diese Gedanken durch den Kopf gingen, sah er das Mädchen wieder. Sie stand direkt neben dem Wagen und machte eine seltsame Handbewegung. Sie bückte sich, streckte ihre rechte Hand nach vorn, ballte sie zur Faust und zog sie dann schnell zurück. Was sollte diese Pantomime? Tat sie, als zöge sie an einem Hebel? Fragend sah er sie an. Madison lächelte und plötzlich sah sie seiner Mutter so ähnlich, dass ihm beinahe das Herz stehen blieb. Das Mädchen vollführte nochmals die Handbewegung und richtete sich wieder auf. Sie machte beide Hände zur Faust und drückte sie gegeneinander. Darauf riss sie sie plötzlich auseinander und spreizte die Finger. Boom, formte ihr Mund. Dann war sie weg, verschwunden von einem Augenblick auf den anderen, aber Elijah war inzwischen ohnehin klar, dass sie nicht wirklich da gewesen war.
Er wusste, was er zu tun hatte. Mit schnellen Schritten ging er zum Ford und zog mit Schwung am Türgriff. Abgeschlossen. Erschrocken blickte ihn der Fahrer an. Elijah sah sich nach einem harten Gegenstand um. Irgendetwas – ein Pflasterstein, ein Stock, … nichts. Der Wind schob träge eine leere, braune Papiertüte über den Asphalt. Im Rinnstein lag ein plattgefahrener Pappbecher von Starbucks. Fuck. Hektisch legte der Fahrer einen Gang ein. Sein Gesicht war von Panik gezeichnet.
Der dicke Polizist hatte sich umgewandt und sah zu Elijah hin. Auch Matthew sah ihn an. »Elijah, was ist denn los?«
Der Fahrer des Wagens wollte wegfahren, aber er hatte zu viel Gas gegeben und den Wagen abgewürgt. Er drehte den Zündschlüssel und die Zündung stotterte. Elijah griff in die Tasche seiner Baggy Pants und fand endlich, was er suchte. Ein kleiner Schraubenschlüssel. Warum war er da nicht gleich darauf gekommen? Er nahm ihn in die Faust, holte aus und schlug mit aller Kraft gegen die Scheibe. Das Sicherheitsglas des Fensters zersprang in unzählige kleine Teile, die Elijah ins Wageninnere drückte. Der Fahrer schrie um Hilfe.
Wie in Zeitlupe nahm Elijah wahr, dass der Polizist etwas in sein Funkgerät sagte – seinen Namen, den Standort und einen Zahlencode. Sicher etwas wie »Violent Assault – Request Backup«. Sein Vater hatte ihnen einige der Codes beigebracht, aber Elijah erinnerte sich nur noch an den für »Essenspause« – den wichtigsten, wie Dad immer gescherzt hatte.
»Scheiße, Mann, was ist denn los?« Matt kam angelaufen, blieb aber ein paar Schritte vor Elijah stehen. Sein Gesicht spiegelte Verwirrung. So hatte er seinen großen Bruder noch nie erlebt. Elijah griff ins Wageninnere und stürzte sich auf den Mann. Er wollte ihn durch das Fenster aus dem Wagen ziehen, aber das war schwieriger, als er erwartet hatte. Elijah war viel kräftiger, aber der Mann setzte sich mit der Kraft der Verzweiflung zur Wehr. Er schrie um Hilfe und biss seinen Angreifer in die Hand. Elijah spürte, wie Blut seine Hand herablief, dachte aber keine Sekunde daran loszulassen. Er konnte die Geste nicht vergessen, die Madison gemacht hatte. Der Griff nach unten, ein Zug am Hebel, Boom.
»Okay, Sir, treten Sie weg von dem Wagen.« Das war der Polizist. Scheiße. Elijah musste sich nicht umdrehen, um zu wissen, dass er breitbeinig da stand und mit einem Taser auf ihn zielte. Vielleicht auch mit einer Pistole.
»Ich kann nicht!«, schrie er.
»Treten Sie weg! Ich will Ihre Hände sehen!«
»Ich kann nicht!«
»Das war meine letzte Warnung.« Elijah kämpfte mit dem Mann im Auto, versuchte ihn irgendwie nach draußen zu ziehen. Er durfte auf keinen Fall an dem Hebel ziehen, denn dann wäre alles vorbei. Alles. Der Polizist, das Rennen, Schneewittchen auf der Zuschauertribüne. Und er selbst und Matt. Es war eine einfache Rechnung. Wenn er den Mann losließ, würden alle sterben. Wenn er ihn herauszog, würden sie überleben, auch wenn er selbst vielleicht dabei draufging. Elijah war ganz ruhig, alles schien wie in Zeitlupe abzulaufen. Es gab nichts zu überlegen.
Ein Schuss. Elijah spürte nichts, der Polizist hatte in die Luft geschossen. Der nächste Schuss würde kein Warnschuss mehr sein. Der Polizist rief etwas, Matthew schrie, aber Elijah nahm es nur wie durch Watte hindurch wahr. Er registrierte hektische Bewegungen am Rand seines Gesichtsfelds, doch das war unwichtig. Für den Moment bestand das Universum nur aus ihm und diesem Mann. Der Fahrer riss den Mund auf, bei seinem linken Schneidezahn war eine Ecke abgebrochen. Sein Kinn, wo er Elijah gebissen hatte, war blutverschmiert. Er strampelte mit den Füßen, um sich zu befreien und versuchte, nach unten zu greifen. Irgendwo da musste der Schalter sein. Elijah konnte ihn nicht sehen, aber er erinnerte sich an Madisons Geste. Da der Mann nur noch versuchte, den Knopf zu erreichen und sich nicht mehr wehrte oder festhielt, war es einfacher, ihn herauszuziehen. Mit einem Ruck gelang es Elijah, den Oberkörper des Mannes durch das offen stehende Fenster zu ziehen. Er sah Elijah in die Augen und sein Blick war so voller blinder Wut und Verzweiflung, dass Elijah wusste, dass er gewonnen hatte. Beinahe hätte er gelächelt.
Dann traf ihn ein Stromschlag von 50.000 Volt. Ein Kollege des Polizisten hatte ihn getasert. Elijahs Muskeln verkrampften sich und er stürzte hart auf den Boden. Für einen Sekundenbruchteil sah er den Himmel, dann knallte er mit dem Hinterkopf auf den Asphalt und verlor das Bewusstsein.
Island
An dem Morgen, an dem ich nach Chicago fliegen sollte, rief mich meine Nichte an. Das arme Mädchen hat das Pech, die Tochter meines Bruders zu sein, schon allein dafür gebührt ihr mein ganzes Mitgefühl.
»Onkel Stefan?«
»Mia! Schön, dass du anrufst. Wie geht’s dir denn?«
»Ich hab dir doch von dem Jungen aus der Neunten erzählt …«
Angestrengt dachte ich nach. Verdammt, wie hieß der noch … »Sebastian, oder?«
»Bastian.« Sie machte eine Pause. Vor meinem inneren Auge sah ich, wie sie eine ihrer Locken mit dem Finger verdrehte. Das tat sie immer, wenn sie nachdachte oder verlegen war. »Jedenfalls … du hast doch gesagt, ich soll einfach mal auf ihn zugehen.«
Himmel, hatte ich das gesagt? Jetzt war wahrscheinlich trösten angesagt. »Und … das hast du getan?« Was gab ich da für Ratschläge? Ich würde das doch selbst nicht tun. Ich von allen Menschen am allerwenigsten.
Ich hörte, wie sie lächelte. »Ja! Und jetzt gehen wir miteinander.«
Was immer miteinander gehen in diesem Alter bedeutet. Ja, was heißt das eigentlich, wenn man 14 ist? Egal, das war nicht meine Sorge, damit sollten sich ihre Eltern beschäftigen. Mir fiel ein Stein vom Herzen. »Das ist ja klasse. Das freut mich für dich!« Ich warf einen Blick auf meine Armbanduhr. Ich musste wirklich langsam zum Flughafen. »Du, ich würde sehr gerne weiter mit dir quatschen, aber ich muss los. Ich fliege nach Chicago.«
»Wow, cool. Wegen dem Job?«
»Ja.«
»Wenn ich groß bin, will ich auch in die Werbung. Was du immer erzählst, mit Fernsehspots und Modelcastings und so was …«
»Das wirst du schön bleiben lassen. Ich verbiete es dir und werde dafür sorgen, dass du nicht einmal einen Praktikumsplatz bekommst.« Nebenbei gesagt war das so ziemlich das einzige Thema, bei dem ich zu 100% der gleichen Meinung war wie Mias Vater. Obwohl ich immer etwas beleidigt war, wenn er Mia allzu vehement von diesem Berufswunsch abzubringen versuchte. Als schlechtes Beispiel und gescheiterte Existenz dazustehen, ist auch nicht lustig.
»Für wen arbeitest du denn?«
Wenn ich das wüsste. »Ehrlich gesagt, so genau weiß ich das selbst nicht. Eigentlich weiß ich es nicht einmal ungefähr. Streng geheimes Geheimprojekt. Aber sie zahlen gut.«
»Dann pass bloß auf, dass sie dich nicht als Lustsklaven verkaufen oder so.«
Hey, die wird ja immer schlagfertiger, dachte ich. »So viel Glück werde ich wohl nicht haben.« Ich schluchzte theatralisch ins Telefon.
»Wir müssen echt mal eine Frau für dich suchen, Stefan. Du bist doch noch knackig, da finden wir bestimmt was.«
»Willst du mich verkuppeln – jetzt wo du in festen Händen bist?«
»Genau.« Sie glaubte vermutlich wirklich, dass sie die große Liebe ihres Lebens gefunden hatte, und war sicher, dass ihre Beziehung ewig halten würde. Wie beneidenswert, wenn man eine Romanze mit dieser Vorstellung beginnen konnte.
»Ich muss jetzt echt. Ich ruf dich an, ja? Oder schicke dir ’ne E-Mail, okay?«
»Klar. Ciao, Stefan. Und guten Flug.«
»Danke.« Ich machte eine dramatische Pause. »Eine Sache noch, Mia.«
»Ja?«
»Kondome schützen.«
»Onkel Stefan!«, schrie Mia empört. »Du bist–«
»Ich liebe dich auch, Mia.« Ich schmatzte in den Hörer und legte auf.
Ich nahm mir ein Taxi zum Flughafen. Ich hätte auch die S-Bahn nehmen können, angesichts der zu erwartenden Reichtümer glaubte ich aber, dass ich mir den Luxus eines Taxis leisten könnte. Die Rechnung behielt ich trotzdem, falls mein Auftraggeber sie bezahlen wollte – und wenn nicht, dann eben für die Steuer.
Wie ausgemacht stand in der Abflughalle ein Mann, der ein Schild mit meinem Namen hochhielt. Nein, es waren sogar zwei Männer, denn der daneben schien auch dazuzugehören. Zwei schweigsame Männer in dunkelgrauen Anzügen. Sie bugsierten mich aber nicht zum Abflugschalter, sondern durch etliche Türen mit der Aufschrift »Nur für Personal« und Sicherheitskontrollen, durch die wir einfach durchgewinkt wurden, direkt aufs Rollfeld, wo ein Learjet wartete.
Ich fragte den Mann mit dem Schild, was das zu bedeuten hätte, aber er antwortete nur: »Das werden Sie schon bald erfahren, kommen Sie einfach mit.«
Mir war das Ganze dann schon ein bisschen mulmig, aber dann dachte ich, hey, so lange der Kunde zahlt, darf er ruhig wunderlich sein. Außerdem war ich noch nie mit so einem Ding geflogen, mich interessierte, wie sich das anfühlte. Hatten so etwas nicht auch all die Milliardäre dieser Welt?
So toll war’s dann nicht. Ich hatte eine Art fliegendes Wohnzimmer erwartet, mit der neuesten Unterhaltungselektronik, Sofa, Bett, und selbstverständlich einer komplett ausgestatteten Cocktailbar. Pustekuchen. Als ich die Maschine betrat, präsentierte sich das Interieur ziemlich unspektakulär, mit zwei normalen Sitzreihen, einer links und einer rechts. Das war wohl nicht die Milliardärsausführung, höchstens Business-Class.
Schade eigentlich, denn Platz genug wäre gewesen – ich war der einzige Gast an Bord. Damit es nicht so langweilig war, bestellte ich Champagner und lud die Stewardess ein, mit mir gemeinsam zu trinken. Nach einiger Überredung willigte sie ein, »aber wirklich nur ein Glas«. Sie eröffnete mir, dass die Maschine nicht nach Chicago, sondern nach Island fliegen würde. Ich war nach dem dritten Glas schon etwas beschwipst, so dass mir das inzwischen ganz egal war. Na gut, ich hatte den Reisestecker-Adapter »USA« und den Marco Polo Reiseführer »Chicago und die Großen Seen« umsonst gekauft, aber das konnte ich verschmerzen.
Ich machte mir allerdings Sorgen, ob ich die richtigen Klamotten eingepackt hatte, und fragte die Stewardess nach dem Wetter am Zielort. Sie hieß übrigens Annika und mit jedem Schluck Champagner kam ihr sächsischer Akzent mehr zum Vorschein. Es soll ja Leute geben, die Sächsisch nicht sexy finden, aber die kannten Annika bestimmt nicht. Während ich mir die Chancen ausrechnete, »Im Flugzeug« zur beklagenswert kurzen Liste der ungewöhnlichen Orte hinzuzufügen, an denen ich Sex gehabt hatte, stand sie auf, um im Cockpit nach dem Wetterbericht zu fragen.
Leider ist sie dann nicht mehr wiedergekommen, erst kurz vor der Landung erschien sie wieder, räumte ab und forderte mich auf, meinen Gurt anzulegen. Dabei sah sie irgendwie immer an mir vorbei. Vielleicht zur Strafe für meine sündigen Gedanken. Oder ihre eigenen. Ich hoffte natürlich letzteres.
Ich hatte erwartet, dass wir in Reykjavik landen, weil das die einzige Stadt war, die ich auf Island kannte und ich mir nicht vorstellen konnte, dass es noch mehr Flughäfen gab. Aber mit so einem kleinen Flugzeug ist man natürlich nicht auf einen internationalen Flughafen angewiesen. Wir landeten auf einem winzigen Flugplatz, der außer einem Tower, der so niedrig war, dass er kaum als Tower zu erkennen war und einem Hangar, dessen Tor geschlossen war, keinerlei Gebäude vorweisen konnte.
Ich hatte mir vorgenommen, Annika beim Aussteigen noch einmal tief in die Augen zu sehen, aber ich war so zerknittert und es war so kalt und so nass, dass ich alle Hände voll zu tun hatte, dass ich nicht die paar Stufen hinunterfiel. Und blamieren wollte ich mich vor ihr auch nicht. Als ich mich zum Flugzeug umwandte, war Annika schon verschwunden. Naja, mit dem Akzent, das wäre sowieso nichts mit uns geworden.
Es gab keinerlei Sicherheitskontrollen. Ich fragte mich, ob ich nicht doch in etwas Illegales geraten war. Drogen? Naja, notfalls würde ich ihnen auch eine Werbekampagne für Kokain machen. Ich hatte in meiner Laufbahn schon Schlimmeres gemacht. Nicht viel, aber ein paar Sachen fielen mir schon ein.
Ein Mann mit einem blauen Anorak empfing mich und ließ mich in einen weißen Nissan-Minibus einsteigen. Daneben standen noch zwei weitere Minibusse. Ich wollte etwas von der Landschaft sehen, aber der dichter werdende Nebel verhinderte das und dann bin ich auch noch eingenickt. Der Champagner.
Als ich geweckt wurde, standen wir vor einem weißen Prachtbau mit vier Stockwerken. Ich musste mich kneifen, um sicherzugehen, dass ich nicht mehr schlief. Ein wunderbares Hotel, wie geschaffen als Kulisse für einen Werbespot, der in den 50ern spielen soll. Ein Gebäude, wie ich es mir an Orten wie Sankt Moritz oder Nizza vorstellen konnte, aber nicht auf Island.
Es war immer noch sehr neblig und ich konnte aufgrund der Geräusche der Brandung nur erahnen, dass auf der anderen Seite der Ozean sein musste. Ich war völlig verschlafen und auf den paar Metern bis zur Eingangstür fror ich erbärmlich.
Schlaftrunken stand ich an der Rezeption, wo ein würdevoll aussehender Portier mich aufforderte, ihm mein Handy auszuhändigen. Während meines Aufenthalts, erklärte er und zog bedauernd die Augenbrauen hoch, müsste ich darauf verzichten. Für mich Online-Junkie war das ein schwerer Schlag – ohne mein iPhone halte ich es normalerweise keine fünf Minuten aus. Aber ich fühlte mich noch so benommen, dass ich mich nicht einmal wehrte.
Dafür weinte ich innerlich. Wie soll ich wissen, ob ein Essen auch tatsächlich lecker ist, wenn ich keine Fotos davon auf Facebook posten kann? Kann ich ohne die Likes der anderen meinen Espresso im Straßencafé wirklich genießen? Wie soll ich ohne meine virtuellen Freunde entscheiden, welchen Film ich mir im Kino ansehen soll? Das würde eine harte Zeit werden.
Aber gut, ich dachte an die Kohle und biss die Zähne zusammen. Mir fiel Mias Warnung ein, dass ich als Lustsklave verkauft werden könnte, und fand sie auf einmal nicht mehr so lustig. Natürlich kam mir keinen Augenblick in den Sinn, dass irgendjemand so etwas vorhatte, aber was, wenn mir wirklich etwas passierte? Es wusste ja niemand, wo ich war oder mit wem ich mich da eingelassen hatte.
Der Portier hüstelte. »Das Telefon auf Ihrem Zimmer ist übrigens nur für die hausinterne Kommunikation geeignet.« Ich hatte beinahe vergessen, dass ich noch an der Rezeption stand.
Am liebsten hätte ich ihm die polierte Messingglocke auf den Schädel geschlagen, mir mein Handy geschnappt und wäre nach Hause gefahren, aber … richtig: Ich dachte an das Geld. Also fragte ich: »Und wie soll ich zu Hause anrufen?«
»Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Die Maßnahmen mögen Ihnen extrem scheinen, aber die Gründe für dafür wird man Ihnen beizeiten mitteilen. Bis dahin möchte ich Sie um Ihr Verständnis bitten.«
Ich wollte eine freche Erwiderung knurren, aber der Mann sah so vornehm aus, dass ich sie mir verkniff. Okay, die Wahrheit ist, dass mir keine Antwort eingefallen ist. Ich bin Texter, wenn ich länger nachdenke, fällt mir fast immer etwas sehr Schlagfertiges ein, das ich hätte sagen sollen. Aber eben erst eine halbe Stunde später. Ich wäre ein lausiger Stand-Up-Comedian.
War ich beunruhigt? Eigentlich hätte ich es sein sollen. Aber der Portier strahlte eine derartige Ruhe aus, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass mir hier etwas geschehen könnte.