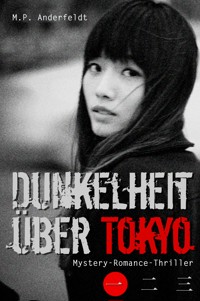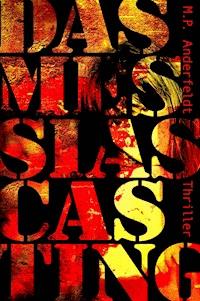Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ein junger Mann hat das einsame Leben in einem Shinto-Schrein in den Bergen Nordjapans satt und fängt in Tokyo ein neues Leben an. Er findet Freunde, einen Job und trifft eine junge Frau. Doch Etwas ist ihm gefolgt aus den Bergen, etwas Gefährliches. Der Tod kommt nach Tokyo und droht sein neues Leben zu zerstören. Und welches Geheimnis verbirgt die junge Frau?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 256
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
M.P. Anderfeldt
Dunkelheit über Tokyo
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Dunkelheit über Tokyo
zero
1
2
3
Naosuke, 1868
4
5
6
Will, 1945
7
Tsubasa, 1985
8
9
Naoki, heute
10
11
Erklärung der japanischen Begriffe
Nachwort des Autors
Nur zehn Tage – Leseprobe
Die Prinzessin der Lilien – Leseprobe
Impressum neobooks
Dunkelheit über Tokyo
Anmerkung: In diesem Buch kommen viele japanische Ausdrücke vor. Die wichtigsten werden im KapitelErklärung der japanischen Begriffeam Ende des Romans erklärt.
zero
Noch einmal, ein letztes Mal, strich Takeo beinahe zärtlich über das verwitterte Holz des Torii, des uralten Tors, das zum Schrein führte. Seine Fingerkuppen ertasteten eine kleine Mulde, ein Astloch. Wie lange mochte es her sein, dass aus diesem Stamm ein frischer Trieb gesprossen war?
Er trat hindurch und wandte sich um. Am oberen Ende der steinernen Treppe mit den unregelmäßigen Stufen lag der Platz mit dem Haiden, dem Hauptgebäude. Unzählige Male, in der Kälte des Winters ebenso wie bei brütender Hitze, war er auf das Dach geklettert um es auszubessern, doch konnte er sich nicht erinnern, dass es jemals richtig dicht gewesen wäre.
Der Fensterladen des kleinen Stands daneben, in dem sie Amulette und Glücksbringer wie Ema, Omikuji und Omamori verkauft hatten, würde sich nun nie wieder öffnen. Naja, außer zu Neujahr war sowieso nie viel los gewesen – und auch das hatte nachgelassen. Viele machte es nichts aus, in den größeren Schrein in Stadt zu fahren.
Alles wirkte leer und verlassen. Einzig das Wasser im Chozuya, dem kleinen Springbrunnen, plätscherte fröhlich wie eh und je. Nur würde kein Gläubiger mehr eine der hölzernen Kellen zur Hand nehmen, um sich zu reinigen. Nie wieder.
Oder doch? Vielleicht würde die alte Teru ja noch mal vorbeischauen. Früher war sie regelmäßig gekommen, sie hatte immer erzählt, wie wichtig das sei. Die meisten anderen regelmäßigen Besucher waren inzwischen gestorben, und auch Teru war schon über 80 Jahre alt und hatte Mühe, den Weg zum Heiligtum zu erklimmen.
Durch die Baumkronen konnte er die strahlend weiße Fassade des Luxushotels erkennen, das seit ein paar Jahren unten an der Küste stand. Es schien so nah.
Sein Vater war ganz aufgeregt gewesen, als das Hotel geöffnet hatte und tatsächlich war eines Tages ein Angestellter gekommen, hatte sich geduldig den Schrein zeigen lassen und dann noch lange mit seinem Vater gesprochen. Der hatte daraufhin gehofft, dass nun viele Touristen kämen. Er hatte sogar davon gesprochen, wieder ein Mädchen als Miko einzustellen.
Doch das war lange her. Die Touristen waren ausgeblieben. Während Takeo die verwitterten Stufen mit traumwandlerischer Sicherheit herabsprang, erinnerte er sich, dass er einmal das Hotel besucht hatte. Er war in einer großen Halle gestanden, die mit einem dicken, dunkelgrünen Teppichboden ausgelegt war. Ein Grüppchen junger Frauen in weißen Bademänteln mit dem Hotel-Logo war schnatternd und lachend an ihm vorübergegangen. Sie hatten gegackert wie Hühner, und schnell gesprochen wie die Moderatoren im Fernsehen. Eine hatte ihm einen Blick zugeworfen und ein wenig gelächelt. Zumindest hatte er sich das eingebildet, vielleicht hatte sie auch nur über einen Witz gelacht, den er nicht verstand.
Takeo hatte die schönen Fotos des Onsen betrachtet, die an der Wand hingen. Man konnte im dampfend heißen Wasser liegen und dabei das Panorama der Küste und der Berge genießen. Texte priesen die Qualitäten des Wassers, das wohltuend und heilsam sein sollte. Auf den Fotos sah man, wie Männer behaglich im dampfenden Wasser lagen und, ein Glas Sake in der Hand, die schneebedeckten Gipfel betrachteten.
Daneben hingen Poster, die für organisierte Ausflüge warben: »New Fashion Outlet Center – 35 Designergeschäfte in einer einzigen Mall«, »Unvergessliche Apfelblüte«, »Island-hopping mit einem traditionellen Fischerboot« und »Tour der 12 Tempel und Schreine«. Die 12 waren auch einzeln aufgeführt, Fotos zeigten eindrucksvolle Gebäude, Priester und Maikos in prächtigen Gewändern. Der Schrein seines Vaters war natürlich aber nicht dabei. Er kannte die anderen Heiligtümer, alle waren viel größer und bestens auf Touristen eingerichtet. Wahrscheinlich auch kulturhistorisch bedeutender.
So hatte sich die Hoffnung zerschlagen, dass Touristen kämen. Auch die Leute aus dem Dorf schauten immer seltener vorbei, die meisten Jüngeren waren sowieso weggezogen, nach Tokyo, Sendai oder Sapporo, und auch die wenigen, die geblieben waren, besuchten den Schrein nur selten. Manchmal kam tagelang gar niemand.
Wahrscheinlich war sein Vater deswegen gestorben. Es gab für ihn einfach keinen Grund mehr zu leben. In den Wochen nach seinem Tod wurde Takeo klar, dass ihn nichts mehr in den nebligen, kalten Bergen hielt. Schon in der Schule hatten sich seine Kameraden über ihn lustig gemacht und als Bergmenschen verspottet. Das Schlimme war: Sie hatten recht. Sie lebten in einer anderen Welt als er. Er kannte ihre laute, bunte Welt aus dem Fernsehen. Der tragbare, orangefarbene Sharp-Fernseher war sein Fenster in diese andere Welt, wo alles bunt war, fröhlich und laut.
Wie anders war da sein Zuhause; wenn er abends seinen letzten Rundgang machte und das Tor verschloss, drang kein Laut zu ihm als das Rauschen des Waldes und der vereinzelte Ruf eines Vogels.
Takeo fühlte sich frei, als er nun endlich den Weg entlang ging. Sayonara, dunkler Wald, dachte er vergnügt. Sayonara, kalte Berge, und: Hallo, Leben!
Er zog die Sporttasche, die von seiner Schulter zu rutschen drohte, wieder hoch. Wie lange hatte er sich danach gesehnt, ein neues Leben zu beginnen. Gleichzeitig hatte er Angst. Er dachte an die Mädchen, die er im Hotel gesehen hatte. Sie waren so quirlig gewesen, so lebendig. Waren in der Stadt alle so? Wenn ich hier schon ein Bergmensch bin, was bin ich dann in Tokyo?
Er würde dort seinen Onkel besuchen, den Bruder seines verstorbenen Vaters. Der war viel jünger als sein Vater und hatte sich immer über diesen lustig gemacht. Bei der Beerdigung hatte er Takeo eingeladen, zu ihm zu kommen. Seine Wohnung sei zwar klein, aber er könne so lange bei ihm bleiben, wie er wolle, hatte er ihm versprochen. Dann hatte er noch irgendetwas von den Verlockungen der Großstadt gefaselt und Takeo immer wieder lachend auf den Rücken geklopft, aber da war er schon ein wenig angetrunken gewesen.
Zum hundertsten Mal tastete Takeo vorsichtig nach seiner Geldbörse. Natürlich war sie noch da. Allzu viel war zwar nicht drin, doch es würde genügen, um eine Fahrkarte nach Tokyo zu kaufen und die ersten paar Tage zu überbrücken.
Er wollte sich ohnehin so bald wie möglich einen Job suchen, erst einmal irgendetwas Kleines. Sein Onkel meinte, der Convenience Store bei ihm am Eck suche immer Verkäufer. Damit werde man zwar nicht reich, aber darum ginge es ja auch nicht. Nein, darum ging es ihm nicht.
Takeo stellte sich vor, wie er zwischen all den bunten Waren im hell erleuchteten Laden stand. Wenn ein kleines Mädchen käme, würde er es anlächeln und ihm ein Bonbon schenken oder so etwas.
Er würde ein Teil dieser bunten, lauten Welt werden. Er würde die alte Welt und ihre verstaubten Traditionen endgültig hinter sich lassen – die Welt seiner Väter … Für einen Moment war ihm, als spürte er ein Frösteln im Rücken, dann schüttelte er sich und ging weiter.
Jetzt gab es ohnehin kein Zurück mehr. Vergnügt ging Takeo die letzten Stufen hinab. Und doch musste er sich zwingen, noch einen letzten Blick auf den Ort zu werfen, der die letzten 20 Jahre seine Heimat gewesen war. Er hatte erwartet, dass er verlassen und tot wirkte, doch dem war nicht so. Die Vögel zwitscherten, die Blätter der gewaltigen Bäume raschelten im Wind, alles war wie immer. Und doch schien es ihm für einen Moment, als hielte der ganze Berg die Luft an.
Deutlich war zu sehen, dass die alte Frau Mühe mit den Treppen hatte. Sie stützte sich auf ihren Stock und blieb immer wieder stehen. Doch lächelte sie jedes Mal, wenn Sie eine Pause machte. Sie genoss die wärmenden Sonnenstrahlen auf ihrem Gesicht und sog die feuchte Morgenluft tief ein. In den Zweigen glänzten Tautropfen und der Nebel hatte sich noch nicht ganz aufgelöst. Teru freute sich über den Spaziergang.
Sie war glücklich, dass sie bald den Schrein besuchen würde, und fragte sich, wie es dem kleinen Takeo ging. Der war ja schon immer ein ruhiger Junge gewesen, aber seit dem Tod seines Vaters schien er ihr noch schweigsamer. Der braucht eben eine Freundin, dachte sie und lächelte, schade, dass ich keine Mädchen in seinem Alter kenne. Oder vielleicht … Megumi? Aber hatte die nicht schon einen Freund? Bei den jungen Leuten verlor sie immer den Überblick. Und wenn sie dann fragte ›Hast du denn einen Bräutigam?‹, verdrehte sie immer nur die Augen und sagte vorwurfsvoll ›Obaachan!‹ Naja, wahrscheinlich war sie genau so gewesen, vor langer, langer Zeit.
Als sie durch den Torii schritt, bemerkte sie, dass etwas nicht stimmte.
Alles wirkte vernachlässigt. Auf den Stufen lagen Blätter, die niemand weggekehrt hatte. Takeo war doch nicht etwa krank?
Oben angekommen, verstärkte sich der Eindruck: Der Platz war leer und verlassen, alle Gebäude verschlossen. Nein, Takeo war nicht krank. Teru lächelte nun nicht mehr. Sie wusch sich die Hände am Chozuya und ging zur Tür des Haiden. Dort hing ein handgeschriebenes Schild, das ihre Befürchtungen bestätigte. Takeo bedankte sich darauf für die Treue der Besucher und entschuldigte sich, dass er den Schrein bis auf Weiteres nicht weiterführen könne. Er lud alle ein, hier dennoch zu beten.
Erschöpft stützte sich die alte Frau an der Tür ab. War schon alles zu spät?
Oder war es doch nur ein Märchen, das ihr ihre Obaachan erzählt hatte? Als Teru noch ein Kind war und mit ihren Geschwistern auf dem Schoß der Großmutter herumgeturnt hatte, ermahnte die sie stets, recht fleißig zum kleinen Schrein auf dem Berg zu gehen. Schon damals hatte Terus Mutter darüber gelächelt, aber natürlich nur heimlich, wenn die Großmutter es nicht sehen konnte. Der kleine, alte Schrein schien ihr ein Überbleibsel aus längst vergangenen Zeiten, ganz anders als die prächtigen Kaiser-Schreine.
Doch Obaachan bestand darauf, dass es wichtig sei, dass alle regelmäßig den Schrein besuchten und so hatte sich Terus Mutter gefügt.
Später dann, als es der Großmutter nicht mehr so gut ging und sie fast nur noch im Bett lag, hatte sie mit Teru über den Schrein gesprochen.
»Meine liebe Teru, ich will dir von dem Schrein erzählen. Es war vor langer Zeit, als ich selbst noch ein kleines Mädchen war. Noch einiges jünger als du jetzt bist, vielleicht vier oder fünf Jahre alt. Damals gab es den großen Schrein in der Stadt noch nicht … eigentlich gab es die ganze Stadt noch nicht.
Aber den kleinen Schrein auf dem Berg, den gab es schon. Und er sah damals fast genau so aus wie heute. Uns kam er damals allerdings noch nicht so ärmlich vor; es waren ja alle Häuser aus Holz und so etwas wie das neue Rathaus in der Stadt – ganz aus Beton! – gab es noch nicht.
Was wollte ich dir eigentlich erzählen? Ach ja. Eines Tages war ich wieder mit meiner Mutter und meinen drei Brüdern beim Schrein. Ich langweilte mich natürlich und lief ein bisschen herum. So lange ich nicht zu weit weg lief oder meinen Kimono schmutzig machte, war das meiner Mutter egal.
Also erkundete ich den dichten Wald, der das Gelände umgab. Ich weiß nicht mehr, was ich tat, wahrscheinlich sammelte ich Stöckchen oder Steine oder so etwas. Plötzlich sah ich eine kleine Höhle vor mir. Vielleicht ein Kaninchenbau, dachte ich und wollte hineinsehen. Ich steckte meinen Kopf hinein, das ging gerade so. Natürlich habe ich nichts gesehen, es war ja stockdunkel. Aber … nach einer Weile habe ich etwas gespürt.
Ich bemerkte: Irgendetwas ist da drin. Und es sah mich an, nein, es analysierte mich geradezu, es blickte auf den Grund meiner Seele. Es wusste alles, was ich wusste, kannte meine geheimsten Gedanken und Gefühle. Frag mich nicht, wie ich das gemerkt habe, vielleicht spüren Kinder das einfach. Ich zog den Kopf heraus und lief schreiend zu meiner Mutter. Meine Mutter und meine Brüder lachten natürlich nur und meinten, ein Kaninchen oder ein Fuchs hätte mich erschreckt, aber der Priester war ganz ernst und wollte genau wissen, was ich gesehen habe. Dann sagte er: Kami.«
Teru unterbrach die Erzählung der Großmutter: »Der Priester meinte, du hättest einen Kami gesehen?«
»Ja«, fuhr diese fort, »und ich kann dir sagen, es ist kein freundliches Wesen. Überrascht dich das? Glaubst du etwa auch, nur weil eine Wesenheit sehr mächtig ist, muss sie automatisch gut sein? So wie die Menschen im Westen, die an einen Lieben Gott glauben?«
»Nein, natürlich nicht, Großmutter.«
»Ein kluger Mann hat mir viel später erklärt, dass die Götter verschiedene Gesichter haben, freundliche, wohlwollende, aber auch böse und chaotische. Du glaubst mir nicht? Wenn ein kleiner Junge einen Ameisenhaufen zertritt, erscheint er den Ameisen dann nicht wie ein Gott? Na, wie auch immer, so war das damals. Und seitdem spürte ich den Kami jedes Mal, wenn ich in die Nähe des Schreins ging. Ich fühlte seine Anwesenheit in einer Höhle, hinter einem Baum oder in einem dunklen Gebäude. Immer gerade außerhalb meines Blicks.«
»Hast du ihn denn niemals gesehen?«
»Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube aber, einmal …,« sie zögerte, »einmal war es anders. Es war ein paar Jahre später und ich hatte mich irgendwie schon daran gewöhnt, ihn immer zu spüren, wenn ich an jenem Ort war.
Dieses Mal war ich allein gekommen und war auch nicht so ganz bei der Sache. Ich dachte an die Schule und dachte an einen jungen Mann …« Sie lächelte ihre Enkelin an, »… ja, Teru, ich war auch einmal jung. Wie dem auch sei, ich saß auf den Stufen zum Haiden, dachte nach und habe wohl vor mich hingestarrt.
Irgendwann bin ich zu mir gekommen und habe bemerkt, dass direkt hinter dem Chozuya etwas stand, keine fünf Meter von mir entfernt. Ich sage nicht: ›jemand‹, denn ich bemerkte sofort, dass das kein Mensch war. Es war zwar so groß wie ein Mensch, aber irgendwie … dunkel. Es hatte die Gestalt eines Menschen, aber ich konnte kein Gesicht sehen, vielleicht hatte es auch keins. Es muss wohl bemerkt haben, dass ich es ansah, denn es verschwand ganz langsam wieder im Schatten, wie ein böser Traum, der dem Tageslicht weichen muss.
Ich hatte danach wochenlang Albträume und wollte nachts das Licht nicht ausmachen, aber ich habe bis heute niemandem etwas davon erzählt. Mein ganzes Leben lang rätsele ich schon, was für ein Wesen das war und ob es böse ist oder gut.«
»Und was denkst du?«
»Früher dachte ich, es müsse böse sein – einfach, weil es so schwarz war und kein Gesicht hatte. Was für ein dummes Argument. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Vielleicht ist es weder gut noch böse. Vielleicht ist es einfach nur ganz anders als wir. Vielleicht werden wir ihn nie verstehen, so wie die Ameisen den Jungen nie verstehen werden.« Die Großmutter schwieg nach dieser langen Erzählung.
»Und der Schrein?«
»Den Schrein haben unsere Ahnen vor langer Zeit errichtet. Ich vermute, so lange der Schrein da ist, bleibt auch der Kami dort. Ob der Schrein ihn irgendwie gefangen hält oder ob er einfach dort bleiben möchte – wer weiß das schon. Doch sicher ist: Dieses Wesen gehört nicht in die Welt der Menschen. Es ist wichtig, dass es dort bleibt, wo es ist.«
Sie sah Teru in die Augen. »Wirst du zum Schrein gehen, wenn ich nicht mehr bin?«
»Aber Obaachan, sag doch nicht so etwas. Du lebst doch noch ganz lange.«
»Ich meine es ernst, Teru. Versprich es mir. Bitte.«
»Na gut. Ich verspreche es.«
An dieses Versprechen hatte sich Teru ihr ganzes Leben lang gehalten. Bis ins hohe Alter war sie regelmäßig zum Schrein gegangen und auch jetzt war sie nur ein paar Wochen zu Hause geblieben, weil sie eine schwere Erkältung gehabt hatte.
Doch nun war der ganze Schrein verlassen. Es gab keinen Priester mehr und gewiss war seit Tagen niemand mehr hier gewesen, um zu beten. Teru stand vor dem Haiden und fühlte sich mit einem Mal ganz klein und hilflos. Sie war plötzlich vier Jahre alt, wie ihre Großmutter, als sie den Kami das erste Mal traf. Sie spürte, wie sich etwas hinter ihr aufbaute, etwas Gewaltiges, etwas von ungeheurer Kraft.
Teru drehte sich um.
1
Natürlich war Takeo schon ein paar Mal in der Provinzhauptstadt gewesen. Und Tokyo, dachte er, wäre sicher auch nicht anders, nur eben noch größer. Zumindest hatte er sich das eingeredet. Wie viel größer, das wurde ihm erst klar, als der Shinkansen Schnellzug nach endlosen Industriegebieten durch die Vororte der Stadt sauste. Schon hier gab es große Wohnblocks, Einkaufszentren und Pachinko-Hallen, wahrscheinlich war jede dieser Vorstädte größer als die Stadt, die bisher für ihn das Maß aller Dinge gewesen war.
Die Gleise machten eine sanfte Kurve und der Zug schoss geräuschlos auf Stelzen über weiße, graue und braune Wohnsilos, die aussahen, als hätte ein Kind sie achtlos hingeworfen. Obwohl sie immer noch mit hoher Geschwindigkeit dahinfuhren, brauchten sie noch über eine halbe Stunde, bis eine freundliche Frauenstimme die Fahrgäste darauf hinwies, dass sie bald am Bahnhof Ueno ankommen würden.
Takeo konnte seinen Blick nicht vom Häusermeer abwenden, das unter ihnen lag. Wohnten wirklich in allen Häusern Menschen? Aßen sie dort, sahen sie fern, badeten sie – lebten sie dort? Und in der nächsten Wohnung, gleich daneben, war wieder eine andere Welt, mit anderen Menschen …
So in Gedanken versunken war er, dass er beinahe nicht gemerkt hätte, wie der Zug abbremste. Einige der Reisenden erhoben sich. Takeo erschrak, als sich direkt vor ihm ein hünenhafter, blonder Mann aus seinem Sitz erhob. Er hatte hellgraue Augen und seine Haut war so rosig wie die eines kleinen Schweins. Bisher hatte er Gaijin nur im Fernsehen gesehen. Koharu, ein Mädchen aus seiner Klasse, hatte zwar behauptet, sie hätte einen Onkel aus Amerika, aber vielleicht wollte sie sich auch nur interessant machen, denn niemand hatte ihn je gesehen.
Schnell sah Takeo woanders hin. Er war entschlossen, sich nicht als Hinterwäldler zu outen und starrte mit dem gleichen leeren, desinteressierten Blick vor sich hin, den er bei seinen Mitreisenden beobachtet hatte.
»Oioioi, das ist aber eine große Stadt. Wahnsinn, so was Großes, oder?« Oh nein, dachte Takeo. Der Akzent kam ihm bekannt vor; es klang nach einem alten Mann aus Takeos Heimat. Jetzt bloß nicht umdrehen.
»Oi, oi, oi. Wo ist denn der Tokyo Tower, mein Junge? Den muss man doch sehen«, jetzt tippte er ihm von hinten auf die Schulter. Notgedrungen wandte Takeo sich um. Vor ihm stand ein alter Mann in einer grauen, angesichts des überheizten Zugs viel zu dicken Jacke.
»Meine Tochter hat nämlich gesagt, dass sie da in der Nähe arbeitet. Aber wie soll man den denn sehen vor lauter Häusern?« Takeo nickte unsicher. Die dunkle Haut des Mannes verriet, dass er sich meist draußen aufhielt.
»Sie arbeitet bei einer großen Firma. Am Empfang. Eine ausländische Firma«, betonte er und sah den Gaijin an, als erwarte er einen Kommentar von ihm. Der Mann blickte ausdruckslos zurück. Hoffentlich hat er das nicht verstanden, dachte Takeo.
Dann griff er in eine Tüte und zog etwas heraus.
»Da! Damit du mal was Ordentliches isst.« Strahlend hielt er dem Jungen einen Apfel hin. Takeo bedankte sich und nahm ihn entgegen. Auch die umstehenden Reisenden bekamen Äpfel, wobei der Mann die Qualität seiner Früchte lobte. Takeo war das Ganze peinlich, Äpfel waren der ganze Stolz seiner Heimat und er hatte Angst, dass der Alte ihn als Landsmann erkennen könnte.
Zum Glück fuhren sie in diesem Augenblick in den Bahnhof ein und der Zug hielt an. Mit einem leisen Zischen öffnete sich die Tür und die Kolonne setzte sich in Bewegung. Auf dem Bahnsteig verabschiedete sich Takeo von dem alten Mann und bat ihn, seine Tochter zu grüßen.
»Mach ich! Heute wollen wir Sushi essen gehen!«
Der Bahnhof wimmelte von Menschen, es schien Takeo wie ein Wunder, dass sie nicht ständig zusammenstießen. Es erinnerte ihn an die Ameisenhaufen, die er als Kind immer wieder beobachtet hatte. Fasziniert betrachtete er die unterschiedlichen Menschen. Büroangestellte in dunklen Anzügen und mit akkurat gescheiteltem Haar hetzten zu ihren nächsten Terminen. Ein paar Mädchen mit aufwendigen Perücken und barocker Fantasiekleidung schlenderten neben ihm. Mit ihren manikürten Fingern tippten sie desinteressiert auf Handys herum, an denen unzählige kleine Plüschfiguren hingen. Wenn einer der Passanten eine Kamera zückte, um ein Foto zu machen, warfen sie sich sofort in Pose und zeigten ebenso routiniert wie gelangweilt das »Peace«-Zeichen.
Zwei ältere Frauen in Kimonos unterhielten sich laut darüber, welchen Zug sie nehmen müssten oder ob ein Taxi nicht doch die bessere Wahl gewesen wäre.
Ein europäisch aussehender Mann schob einen Kinderwagen, neben ihm ging seine Frau. Noch nie hatte Takeo einen derart riesigen Kinderwagen gesehen, der musste doch überall anecken. Und überhaupt, warum schob der Mann den Kinderwagen? Wenn in seinem Dorf ein Mann einen Kinderwagen schieben würde, würden sich die anderen wahrscheinlich noch Jahre später darüber lustig machen.
Eine schicke junge Frau im adrett sitzenden Businesskostüm eilte in Richtung Ausgang. Das gibt’s bei uns nicht, dachte Takeo. Ihr Gesicht schien völlig makellos, wie das einer Puppe, und sie musterte die Menschen mit einer bewundernswerten Gleichgültigkeit.
Am Ausgang stand eine lange Reihe Taxis. Takeo steuerte auf das erste zu. Die hintere Tür öffnete sich automatisch, der Fahrer stieg aus und nahm ihm den Rucksack ab. Er öffnete den Kofferraum und legte ihn hinein.
Takeo nannte sein Ziel. Der Taxifahrer hielt inne und sah Takeo an.
»Da willst du hin? Mit dem Taxi? Bist wohl neu hier, was?«
»Wieso?«
»Pass mal auf, junger Mann. Du denkst vielleicht, Aomori ist ›ne große Stadt. Aber das ist ein Dreck verglichen mit Tokyo. Wenn ich dich da hinbringe, wo du hinwillst, bist du ein armer junger Mann.« Er legte den Kopf schief und musterte ihn. »Weil, so reich siehst du mir nicht aus.«
Takeo errötete.
»Okay, ich gebe dir einen Tipp. Geh noch mal rein in den Bahnhof und such die Yamanote-Linie. Das ist die Linie, die den großen grünen Kreis fährt. Immer im Kreis. Die nimmst du und fährst bis Ikebukuro. Und dann schaust du weiter. Alles klar?«
Takeo nickte unsicher und bedankte sich. »Hey!«, der Taxifahrer hielt die Hand auf, »Kriege ich keinen Apfel?«
»Das – also … ich …«
»Ein Scherz!«, lachte der Mann und klopfte ihm auf die Schulter, »Nur ein Scherz!« Gut gelaunt drückte er Takeo wieder seinen Rucksack in die Hände und ließ ihn verdattert stehen. Takeo ärgerte sich. Warum wussten nur alle, woher er kam? War sein Akzent wirklich so schlimm? Er blickte an sich herab. Oder verriet ihn seine Kleidung? Seufzend schulterte er seinen Rucksack und machte sich wieder auf den Weg.
Es war bereits dunkel, als er das Haus erreichte, in dem sein Onkel lebte. Ein freundlicher Polizist in einer winzigen Polizeibox hatte ihm geduldig den Weg erklärt, sonst hätte er es wohl nie gefunden. Er war nervös und ihm fiel ein, dass er gar kein Geschenk dabei hatte. Zum Glück hatte er am Eck einen Convenience Store gesehen. Rasch ging er dorthin zurück.
Die strahlend hellen Neonröhren im Laden taten seinen Augen weh. Er überlegte, ob er Bier oder Sake kaufen sollte, oder doch das billigere, bierähnliche Malt? Er beschloss, sich nicht lumpen zu lassen und entschied sich für zwei große Dosen echtes Bier. Yebisu, das hatte sein Vater getrunken, wenn er etwas feiern wollte. Dazu noch etwas zu knabbern. Das Mädchen an der Kasse sah ihn prüfend an.
»Darfst du überhaupt schon Bier trinken?«
»Äh, ja … natürlich.« Takeo räusperte sich und versuchte, erwachsen zu wirken. Vermutlich wenig überzeugend, dem Mädchen schien das aber zu genügen.
»Okay.« Gleichgültig scannte sie seine Waren, auf dem Display der Kasse erschien die Summe. Als Takeo in seinem Geldbeutel kramte, stellte er fest, dass seine Barreserven bereits erschreckend zusammengeschmolzen waren.
»Wenn du kein Geld hast, kannst du mich auch in Äpfeln bezahlen.«
Takeo sah das Mädchen an und spürte, wie er knallrot anlief.
»Entschuldige, das war ein dummer Scherz. Wirklich. Es tut mir leid.« Sie verbeugte sich, griff dann unter die Theke und packte ein paar Mini-Tütchen mit Knabberzeugs mit in die Tüte. »Hier, das ist für dich. Gratis-Service.«
Aus irgendwelchen Gründen war das Mädchen auch rot geworden. Immerhin – vielleicht war ihr der Scherz ja wirklich peinlich gewesen. Takeo bedankte sich und verließ den Laden.
Als er bei seinem Onkel klingelte, fragte er sich, ob es nicht schon zu spät sei. Aber schließlich hatte sein Onkel ihm ja immer wieder versichert, dass er jederzeit zu ihm kommen könne. Er hielt den Atem an.
Schlurfende Schritte näherten sich der Tür und blieben dann stehen. Vielleicht sah sein Onkel durch den Türspion. Takeo lächelte. Dann öffnete sich die Tür.
»Guten Abend, Masao-ojisan!«
»Ah, Takeo-kun, was machst du denn hier?«
»Naja, du hattest doch gesagt, ich könne jederzeit …«
»Ach so … ja.« Er warf einen Blick auf Takeos Rucksack. Er sah übermüdet aus, fand Takeo. Bekleidet war er lediglich mit einem schon etwas abgetragen aussehenden Bademantel. Vielleicht war er gerade aus der Badewanne gekommen.
»Was ist denn?«, meldete sich eine Frauenstimme hinter dem Onkel.
»Nichts, falsche Tür.«
Als Takeo ihn entsetzt ansah, entschuldigte er sich: »Heute ist es grad ungünstig. Du verstehst das sicher.« Er lächelte und zeigte mit dem Kopf nach hinten, »Gomen, ne.«
»Masao-chan? Komm doch wieder ins Bett …«
Er zwinkerte Takeo zu. »Ich komme, Liebling.«
Dann kramte er in einer Tasche neben der Tür und steckte Takeo ein paar Scheine zu.
»Geh ins Kino oder so. Komm doch morgen wieder, sagen wir … 10 Uhr? Bis dann!« Damit schlug er die Tür zu und Takeo war wieder allein.
Im giftgrün gestrichenen Flur zählte Takeo das Geld, das ihm sein Onkel gegeben hatte: 900 Yen. In was für ein Kino sollte er damit gehen? Takeo war sauer, aber er traute sich auch nicht, nochmals zu klingeln. Verdammt, warum hatte er auch nicht vorher angerufen? Natürlich wusste er, warum. Er hatte befürchtet, dass es seinem Onkel nicht passte und er sich dann niemals nach Tokyo wagen würde. Aus dem gleichen Grund hatte er sich auch von niemandem verabschiedet; weil er Angst hatte, dass er sich zum Bleiben überreden lassen würde.
Eine Frau mittleren Alters ging an ihm vorbei, ohne ihn eines Blickes zu würdigen. Er war aber sicher, dass sie ihn genau betrachtet hatte. Naja, hier konnte er sowieso nicht bleiben. Eine Weile stand er noch vor der Tür, dann ging er langsam die Treppe hinunter.
Dunkel war die Gasse und der Asphalt war ein schwarzes Loch, das direkt in die Hölle führte. Einzig der Himmel schimmerte gelblich und betonte die grotesken Silhouetten der eng zusammenstehenden Häuser. In diesem Augenblick schaltete die Ampel an der großen Straße auf grün und ließ ihre Melodie ertönen. Unbewusst murmelte Takeo den Text des Kinderlieds mit.
Geht hindurch, geht hindurch.
Wohin führt dieser enge Pfad?
Es ist der schmale Pfad zum Tenjin Schrein.
Hineingehen ist einfach, doch der Rückweg ist grauenvoll.
Geht hindurch, geht hindurch.
Auf einmal schien es ihm, als ginge er durch völlige Dunkelheit, doch als er hochblickte, war der Himmel von dem gleichen blassen Gelb wie vorher. Er schüttelte sich, um den bösen Traum loszuwerden.
2
Er blieb vor dem Schaufenster des Convenience Store stehen, ratlos, was er tun sollte. Eine Frau mit einem kleinen Mädchen hatte gerade an der Kasse bezahlt. Die Mutter wirkte sehr müde. Die Angestellte an der Kasse zog einen Lolli aus einer Schublade, zeigte ihn unauffällig der Frau und als die nickte, lief sie um die Theke herum, kniete sich vor dem Kind auf den Boden und gab ihm strahlend die Süßigkeit. Das Kind lachte und Takeo erkannte an seinen Lippen, dass es »Arigato!« rief.
Die Szene erinnerte Takeo frappierend an seinen Traum von seinem Leben in Tokyo und kam ihm völlig unwirklich vor. Zögernd betrat er das Geschäft.
»Irasshaimase!«, rief die junge Verkäuferin routiniert, ohne richtig aufzusehen. Takeo schlurfte unschlüssig zu den Zeitschriften und begann, darin zu blättern. Da nahm ihn das Mädchen wahr.
»Was?«, murmelte sie überrascht. Takeo drehte sich nicht herum. Was sollte er auch sagen? Er sah auf seine Uhr. Verdammt, gerade mal 21:34. Für ein Hotel hatte er nicht genug Geld. Ein Love Hotel? So etwas kannte er nur aus dem Fernsehen, war das überhaupt billiger als ein normales Hotel? Dann vielleicht doch ins Kino? Sein Geld zusammen mit dem, was ihm sein Onkel gegeben hatte, sollte dafür ausreichen. Aber Kinos hatten doch nicht die ganze Nacht geöffnet, oder? Seufzend blätterte er um. Erst jetzt nahm er wahr, was er da in der Hand hatte – irgend so ein Manga. Schulmädchen mit Matrosenuniform und langen Zöpfen sahen ihn aus riesigen Augen an. Neben ihm stand ein Mann mittleren Alters in einem hellen Trenchcoat, den Aktenkoffer hatte er zwischen den Füßen abgestellt. Er las in einer Computerzeitschrift.
Das Mädchen brachte einen Karton voller Magazine und setzte ihn auf dem Boden ab. Dann begann sie damit, sie einzuräumen. Takeo konnte deutlich sehen, dass sie ihn immer wieder von der Seite ansah. Demonstrativ vertiefte er sich in sein Manga und tat so, als sähe er sie nicht. Er hatte gerade wirklich keine Lust, mit jemandem zu sprechen.
Schweigend nahm sie einen Stapel nach dem anderen aus dem Karton und stellte ihn in das entsprechende Fach. Jedes Mal, wenn ein neuer Kunde den Laden betrat, rief sie lautstark »Irasshaimase!« Hin und wieder eilte sie zur Kasse, um etwas abzukassieren.
Das Handy des Mannes neben Takeo vibrierte.
Der Mann sah sich um, nahm ab und flüsterte: »Ja? … Du sollst mich doch nicht während der Arbeit anrufen. … Was? 39 Grad? Das ist in dem Alter doch nichts Ungewöhnliches, oder? … Nein, leider nicht. Ich muss dann noch mit den Kollegen was trinken gehen. … Nein, das kann ich wirklich nicht. Ich schlafe im Büro. Oder bei Nakamura-kun. … Ja, ich rufe dich morgen früh an.« Mit einem Piepen legte er auf.
Der Mann sah auf seine Uhr. Er räumte die Zeitschrift, in der er gelesen hatte, ordentlich auf, nahm seinen Aktenkoffer und ging zum Kühlregal, in dem das Bier stand.
Die Angestellte nahm eine Handvoll Magazine aus dem Karton und räumte sie in das Fach direkt vor Takeo. Takeo sah auf. Auf dem Titelbild war ein Mädchen im weißen Bikini abgebildet, das lasziv an ihrem Finger lutschte. Die Angestellte sah Takeo an und lächelte. Er wurde rot.
Dann sah sie, dass der Sarariman an der Kasse stand und beflissen eilte sie hin. »Hai! Gomenasai!«
Der Mann stellte zwei Dosen auf den Tresen, eine mit Sapporo-Bier und eine mit Chu-Hi. Er zeigte auf das Chu-Hi: »Sowas mögen junge Frauen doch, oder?«
»Ja! Das schmeckt sehr gut!«, strahlte ihn das Mädchen an und nickte eifrig. Der Mann brummte etwas und zahlte. Dann verließ er den Laden.
»Arigato gozaimashita!« Das Mädchen verbeugt sich. Als die Tür sich öffnete, drang für ein paar Sekunden die Melodie der Ampel von draußen herein.
Das Mädchen ging wieder zu Takeo, um weiter Magazine einzuräumen.