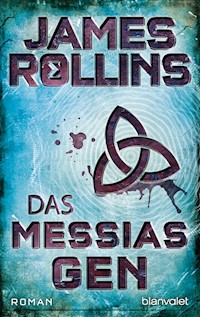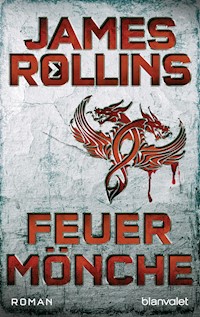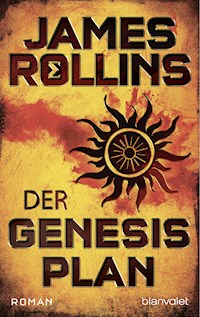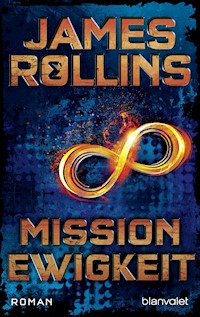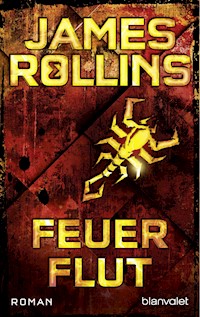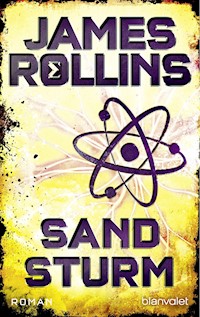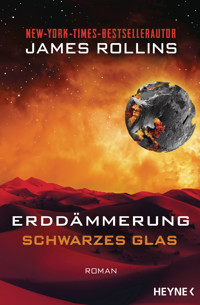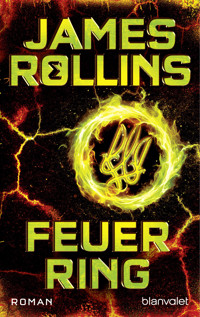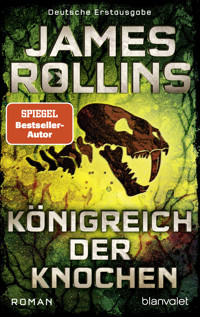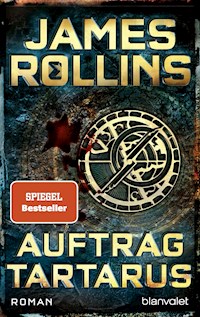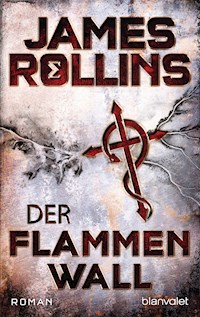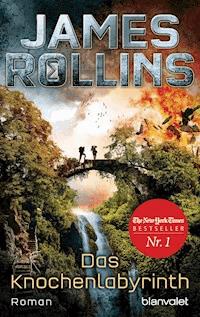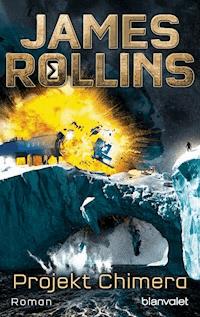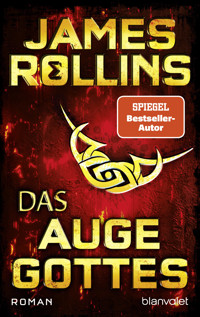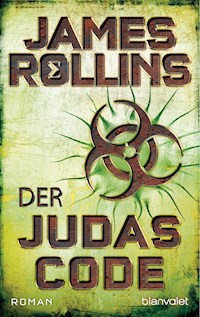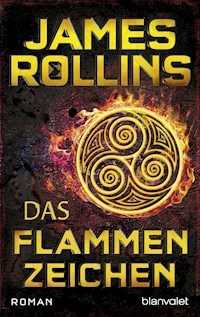Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
© der Originalausgabe 2008 by Jim Czajkowski
Published in agreement with the author, c/o BAROR INTERNATIONAL, INC., Armonk, New York, U.S.A. © der deutschsprachigen Ausgabe 2010 by Blanvalet Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 München© Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com (DrObjektiff; Eky Studio; Gordan; Husjak; Glitterstudio; maximmmmum; Aninna; MysticaLink)
ISBN : 978-3-641-04165-6V007
www.blanvalet.de
www.penguinrandomhouse.de
Inhaltsverzeichnis
Widmung
NATIONAL MALL – WASHINGTON, D. C.
Vorwort
EINS
Kapitel 1
Gegenwart 5. September, 13:38 Washington, D.C.
14:02
15:46
16:02
Kapitel 2
5. September, 17:25 Washington, D.C.
18:32
18:48
Kapitel 3
5. September, 19:22 Washington, D.C.
19:37
19:56
Kapitel 4
5. September, 20:12 Washington, D.C.
20:32
20:38
Kapitel 5
5. September, 21:30 Washington, D.C.
21:40
21:45
Kapitel 6
6. September, 5:22 Kiew, Ukraine
22:25 Washington, D.C.
6:02 Kiew, Ukraine
22:50 Washington, D.C.
Kapitel 7
6. September, 4:55 Washington, D.C.
11:04 Südural Russische Föderation
11:30
11:45
ZWEI
Kapitel 8
6. September, 12:05 In vierzehn Kilometern Höhe über dem Kaspischen Meer
12:22 Südural
6:03 Washington, D.C.
14:04 Agra, Indien
Kapitel 9
6. September, 13:01 Südural
13:02
14:28 Agra, Indien
6:33 Washington, D.C.
14:35 Agra, Indien
Kapitel 10
6. September, 7:45 Washington, D.C.
14:55 Südural
15:15
15:35
16:28 Neu-Delhi, Indien
17:06
Kapitel 11
6. September, 17:38 Prypjat, Ukraine
17:49 Südural
19:04
11:07 Washington, D.C.
23:38
Kapitel 12
6. September, 19:36 Punjab, Indien
20:02
18:38 Prypjat, Ukraine
20:40 Punjab, Indien
Kapitel 13
6. September, 22:26 Südural
14:20 Washington, D.C.
22:42 Südural
16:31 Washington, D.C.
23:50 Südural
18:02 Washington, D.C.
Kapitel 14
6. September, 23:04 Punjab, Indien
23:35 Prypjat, Ukraine
23:45 Punjab, Indien
DREI
Kapitel 15
7. September, 5:05 Südural
00:04 Washington, D.C.
7:05 Südural
Kapitel 16
7. September, 8:11 Prypjat, Ukraine
8:20 Südural
9:32 Prypjat
10:04
Kapitel 17
7. September, 10:07 Südural
00:30 Washington, D.C.
10:07 Südural
00:43 Washington, D.C.
Kapitel 18
7. September, 10:38 Prypjat, Ukraine
00:50 Washington, D.C.
10:53 Prypjat, Ukraine
Kapitel 19
7. September, 11:00 Südural
11:16 Prypjat, Ukraine
11:38 Südural
Kapitel 20
7. September, 2:17 Washington, D.C.
12:20 Südural
12:35 Kyshtym, Russland
12:45
Kapitel 21
7. September, 13:03 Südural
13:15 Kyshtym, Russland
15:18 Washington, D.C.
13:14
Kapitel 22
28. September, 16:21 Washington, D.C.
29. September, 18:21 George Washington University Hospital
19:01
EPILOG
NACHBEMERKUNG DES AUTORS: WAHRHEIT ODER FIKTION?
URTEILEN SIE SELBST.
Danksagung
Copyright
Die Originalausgabe erschien 2008 unter dem Titel »The last Oracle« bei William Morrow, New York.
Für Shay und Bryce, denn ihr seid schwer in Ordnung.
NATIONAL MALL – WASHINGTON, D. C.
VORBEMERKUNG ZUM HISTORISCHEN HINTERGRUND
Nun aber werden uns die größten der Güter durch Wahnsinn zuteil, freilich nur einen Wahnsinn, der durch göttliche Gabe gegeben ist.
Sokrates über das Orakel von Delphi
DIE ALTEN GRIECHEN mit ihrem Götterpantheon glaubten fest an die Gabe der Weissagung. Sie verehrten diejenigen, welche die Vorzeichen aus den Eingeweiden von Ziegen zu deuten verstanden, die Zukunft anhand des von einem Opferfeuer aufsteigenden Rauchs oder mithilfe geworfener Knochen vorauszusagen vermochten. Ein Mensch aber genoss bei ihnen die höchste Wertschätzung: das geheimnisvolle Orakel von Delphi.
Fast zweitausend Jahre lang residierte im Apollotempel an den Hängen des Parnass eine Abfolge streng bewachter Frauen. In jeder Generation bestieg eine Frau den Weissagungsthron und nahm den Namen Pythia an. Mittels eingeatmeter Dämpfe versetzte sie sich in Trance und beantwortete Fragen zur Zukunft – alltägliche wie philosophische.
Zu ihren Bewunderern zählten auch bedeutende Gestalten der griechischen und römischen Geschichte: Platon, Sophokles, Aristoteles, Plutarch und Ovid. Auch die Frühchristen verehrten sie. Michelangelo räumte ihr an der Decke der Sixtinischen Kapelle einen hervorstechenden Platz als Verkünderin des Kommens Christi ein.
Aber war sie vielleicht nur ein Scharlatan, der die Besucher mit kryptischen Antworten täuschte? Wie dem auch sei, eine Tatsache lässt sich nicht bestreiten. Von Königen und Eroberern in der ganzen Welt verehrt, veränderten Pythias Prophezeiungen den Lauf der Geschichte.
Während ihr Wirken nach wie vor geheimnisumwoben ist und weitgehend der Mythologie zugerechnet werden kann, so gibt es doch eine neue Erkenntnis zu vermelden. Im Jahr 2001 entdeckten Archäologen und Geologen unter dem Parnass eine merkwürdige Anordnung tektonischer Platten, durch die Kohlenwasserstoffgase abgeleitet wurden, darunter auch Ethylen, das tranceartige euphorische Zustände und Halluzinationen hervorrufen kann, wie sie in den historischen Schriften beschrieben sind.
Erkenne dich selbst, dann erkennst du den Kosmos und die Götter.
Inschrift am Tempel zu Delphi
398 n. Chr.ParnassGriechenland
SIE WAREN GEKOMMEN, um sie zu töten.
Die Frau stand im Säulenvorbau des Tempels. Sie fröstelte in ihrem dünnen Gewand aus weißem Leinen, das sie an der Hüfte gegürtet hatte, doch es war nicht die Kälte des Morgengrauens, die ihr bis ins Mark drang.
Eine mit Fackeln ausgerüstete Kolonne strömte wie ein Feuerfluss die Hänge des Parnass hoch. Sie folgte dem gepflasterten heiligen Pfad, der sich in Serpentinen zum Apollotempel emporwand. Das Trommeln der Schwerter auf den Schilden tönte herauf; eine römische Kohorte, fünfhundert Mann stark. Der Weg schlängelte sich zwischen verfallenen Monumenten und längst geplünderten Schatzkammern hindurch. Alles Brennbare war in Brand gesetzt worden.
Die über die Ruinen tanzenden Flammen schufen die schimmernde Illusion besserer Zeiten und ließen die alte Pracht scheinbar wieder aufleben: von Gold und Geschmeide überquellende Schatzkammern, zahllose, von den besten Bildhauern geschaffene Statuen, wogende Menschenmassen, die sich versammelt hatten, um die Prophezeiungen des Orakels zu vernehmen.
Das aber war Vergangenheit.
Im Laufe der vergangenen hundert Jahre war Delphi von Galliern erobert und von Thrakern geplündert worden. Vor allem aber war es vernachlässigt worden. Nur noch wenige wandten sich hilfesuchend an das Orakel, etwa ein Ziegenhirt, der an der Treue seiner Ehefrau zweifelte, oder ein Seemann, der nach einem guten Omen für die Fahrt über den Golf von Korinth verlangte.
Dies war das Ende der Geschichte, das Ende des Orakels von Delphi. Nachdem sie dreißig Jahre lang gewahrsagt hatte, würde sie die letzte Trägerin des Namens Pythia sein.
Das letzte Orakel von Delphi.
Diese Bürde aber brachte eine letzte Herausforderung mit sich.
Pythia wandte sich nach Osten, wo bereits der Morgen dämmerte.
Ach, die rosarote Eos, Göttin der Morgendämmerung, würde Apollo drängen, die vier Pferde seiner Sonnenkutsche zu zäumen.
Eine von Pythias Schwestern, eine junge Novizin, trat hinter ihr aus dem Tempel hervor. »Herrin, komm mit uns«, flehte die junge Frau. »Es ist noch nicht zu spät. Wir können uns noch immer mit den anderen zusammen in die hoch gelegenen Höhlen flüchten.«
Pythia legte ihr beruhigend die Hand auf die Schulter. Im Laufe der Nacht hatten sich die anderen Frauen über die zerklüfteten Berghöhen in die Dionysoshöhlen zurückgezogen, die ihnen Schutz bieten würden. Pythia aber hatte noch eine letzte Aufgabe zu erfüllen.
»Herrin, es bleibt keine Zeit mehr für die letzte Prophezeiung.«
»Ich muss es tun.«
»Dann tu es jetzt. Ehe es zu spät ist.«
Pythia wandte sich ab. »Wir müssen warten, bis der siebte Tag anbricht. So haben wir es immer gehalten.«
Als die Sonne am Abend zuvor untergegangen war, hatte Pythia mit den Vorbereitungen begonnen. Sie hatte in der kastilischen Quelle gebadet, hatte von der Kassotisquelle getrunken und auf dem schwarzen Marmoraltar des Tempels Lorbeerblätter verbrannt. Sie hatte das Ritual peinlich genau befolgt, so wie die erste Pythia vor Tausenden von Jahren.
Diesmal aber war das Orakel bei seinem Reinigungsritual nicht allein gewesen.
Ein Mädchen von kaum zwölf Jahren hatte ihm Gesellschaft geleistet.
Ein solch kleines Geschöpf von seltsamem Gebaren.
Das Kind hatte nackt im Quellwasser gestanden, während die ältere Frau es gewaschen und gesalbt hatte. Es hatte kein Wort gesprochen, sondern lediglich den Arm ausgestreckt und die Hand geöffnet und geschlossen, als ob es nach etwas greifen wollte, das es allein sehen konnte. Welcher Gott hatte das Kind bestraft und es gleichzeitig gesegnet? Bestimmt nicht Apollo. Was es vor dreißig Tagen gesagt hatte, konnte jedoch nur von den Göttern stammen. Seine Worte hatten sich verbreitet und das Feuer entfacht, das nun auf Delphi zuwanderte.
Ach, hätte man das Kind doch nicht hierhergebracht.
Pythia hatte sich damit abgefunden, dass Delphi allmählich in Vergessenheit geriet. Sie erinnerte sich an den unheilkündenden Ausspruch einer ihrer Vorgängerinnen, die bereits seit mehreren Hundert Jahren tot war.
Kaiser Augustus hatte ihre verstorbene Schwester gefragt: »Weshalb ist das Orakel verstummt?«
Und sie hatte geantwortet: »Ein Hebräerjunge, ein Gott, der unter den Seligen herrscht, gebietet mir, dies Haus zu verlassen …«
Diese Prophezeiung hatte sich erfüllt. Der erstarkende Christuskult hatte das Reich zerstört und alle Hoffnung auf eine Wiederherstellung der alten Bräuche zunichtegemacht.
Dann hatte man vor einem Monat das seltsame Mädchen zum Tempel gebracht.
Pythia wandte den Blick von den Flammen ab und schaute zum Adytum, dem innersten Heiligtum des Apollotempels. Dort wartete das Mädchen.
Sie war eine Waise aus der fernen Stadt Chios. Im Laufe der Jahrhunderte hatte man viele solche Kinder hierhergebracht, deren Eltern danach trachteten, die Last der Erziehung der Schwesternschaft aufzubürden. Die meisten waren abgewiesen worden. Nur die geeigneten Mädchen durften bleiben; die unverdorbenen mit geraden Gliedmaßen und klarem Blick. Ein minderwertiges Gefäß hätte Apollo für seine Prophezeiungen nicht akzeptiert.
Als man diese Weidengerte von einem Mädchen nackt auf den Tempelstufen präsentiert hatte, hatte Pythia ihr zunächst keine Beachtung geschenkt. Das Kind war ungekämmt, das dunkle Haar verfilzt und zottig, die Haut von Pockennarben verunstaltet. Pythia aber hatte gespürt, dass mit dem Kind etwas nicht stimmte. Es schaukelte mit dem Oberkörper vor und zurück. Seine Augen schauten blicklos in die Welt.
Seine Begleiter hatten behauptet, das Kind stehe in Kontakt mit den Göttern. Es könne auf einen Blick erkennen, wie viele Oliven in einem Baum hingen, und genau vorhersagen, wann ein Schaf werfe, ohne es auch nur zu berühren.
Diese Geschichten hatten Pythias Interesse geweckt. Sie rief dem Mädchen zu, es solle zum Tempeleingang kommen. Das Kind gehorchte, bewegte sich aber ungelenk, als werde es vom Wind vorwärtsgetrieben. Pythia fasste es bei der Hand und zog es auf die oberste Tempelstufe.
»Kann du mir deinen Namen sagen?«, fragte sie das magere Kind.
»Sie heißt Anthea«, antwortete einer ihrer Begleiter vom Fuß der Treppe aus.
Pythia musterte das Kind forschend. »Anthea, weißt du, weshalb man dich hierhergebracht hat?«
»Dein Haus ist leer«, murmelte das Kind mit niedergeschlagenem Blick.
Dann kann sie also immerhin sprechen. Pythia blickte ins Tempelinnere. In der Mitte des großen Saals brannte das Feuer. Im Moment war der Tempel tatsächlich leer, doch die Worte des Mädchens waren aufgeladen mit unterschwelliger Bedeutung.
Vielleicht lag es an ihrem Gebaren. So fremdartig, so abwesend, als stünde sie nur mit einem Bein in dieser Welt.
Das Kind schaute mit klaren, unschuldig blauen Augen zu ihr auf. Seine Worte hingegen straften diesen Eindruck Lügen.
»Du bist alt. Du wirst bald sterben.«
Ihr Begleiter wollte sie ausschelten, doch Pythia sagte mit milder Stimme: »Wir müssen alle irgendwann sterben, Anthea. So ist der Lauf der Welt.«
Anthea schüttelte den Kopf. »Der Hebräerjunge nicht.«
Der unergründliche Blick bohrte sich in ihre Augen. Pythia bekam eine Gänsehaut. Offenbar hatte man das Mädchen im Kult Christi und des blutigen Kreuzes unterwiesen. Aber welch ein Ausspruch. Und dann der eigenartige Tonfall.
Der Hebräerjunge …
Sie musste an die unheilvolle Prophezeiung ihrer Vorläuferin denken.
»Doch es wird jemand anders kommen«, fuhr das Mädchen fort. »Ein anderer Junge.«
»Ein anderer Junge?« Pythia beugte sich vor. »Wer? Woher wird er kommen?«
»Aus meinen Träumen.« Das Mädchen rieb sich mit dem Handballen übers Ohr.
Pythia spürte, dass in dem Mädchen Schätze verborgen waren, die nur darauf warteten, gehoben zu werden. »Dieser Junge«, sagte sie. »Wer ist das?«
Die Antwort des Mädchens brachte die Anwesenden zum Staunen – wenngleich sie sich der darin enthaltenen Blasphemie durchaus bewusst waren.
»Der Bruder des Hebräerjungen.« Das Kind klammerte sich an den Saum von Pythias Gewand. »Er brennt in meinen Träumen … und er wird alles verbrennen. Nichts wird überdauern. Nicht einmal Rom.«
Im Laufe des vergangenen Monats hatte Pythia sich bemüht, weiteren Aufschluss über die Prophezeiung zu bekommen. Sie hatte das Mädchen sogar in die Obhut der Schwesternschaft genommen. Das Kind aber hatte sich immer mehr in sich zurückgezogen und war verstummt. Doch es gab noch eine Möglichkeit, mehr in Erfahrung zu bringen.
Wenn das Mädchen wahrhaft gesegnet war, dann würde Apollos Atem – sein prophetischer Odem – vielleicht freibrennen, was in dem seltsamen Mädchen sonst noch verborgen war.
Aber würde die Zeit reichen?
Eine Berührung am Ellbogen unterbrach ihre Träumereien und versetzte sie wieder in die Gegenwart zurück. »Herrin, die Sonne …«, drängte ihre jüngere Schwester.
Pythia blickte nach Osten. Der flammend rote Himmel kündete vom unmittelbar bevorstehenden Sonnenaufgang. Von weiter unten drangen die Rufe der römischen Legionäre herauf. Die Kunde vom Mädchen hatte sich verbreitet. Die Untergangsprophezeiungen hatten sich weit herumgesprochen und waren selbst dem Kaiser zu Ohren gekommen. Ein kaiserlicher Kurier hatte mit der Begründung, das Mädchen sei von Dämonen besessen, dessen Überstellung nach Rom verlangt.
Pythia hatte sich geweigert. Die Götter hatten das Kind zum Apollotempel und an ihre Schwelle geführt. Ohne ihm zuvor auf den Zahn gefühlt zu haben, wollte Pythia es nicht hergeben.
Im Osten versengten die ersten Sonnenstrahlen den Morgenhimmel.
Der siebente Tag des siebten Monats brach an.
Sie hatten lange genug gewartet.
Pythia wandte den Legionären mit den lodernden Fackeln den Rücken zu. »Komm. Wir müssen uns sputen.«
Sie eilte ins Tempelinnere. Auch hier wurde sie von Flammen begrüßt, doch dies war die freundliche Wärme des heiligen Tempelfeuers. Zwei der Schwestern beaufsichtigten das Feuer, beide zu alt, um den beschwerlichen Aufstieg zu den Höhlen bewältigen zu können.
Sie nickte ihnen dankbar zu, dann eilte sie am Feuer vorbei.
Ganz hinten im Tempel führte eine Treppe zum innersten Heiligtum hinunter. Nur denjenigen, die dem Orakel dienten, war es gestattet, das unterirdisch gelegene Adytum zu betreten. Als sie hinabstieg, machte der Marmor grob behauenem Kalkstein Platz. Die Höhle war vor Urzeiten von einem Ziegenhirten entdeckt worden. Als er der Höhlenmündung nahe kam, war er unter den Einfluss von Apollos süßem Atem geraten und hatte seltsame Visionen gehabt.
Möge das Wunder sich ein letztes Mal wiederholen.
Das Kind wartete in der Höhle. Es trug eine weiße, viel zu große Alba und saß im Schneidersitz neben dem Dreibein aus Bronze, das den heiligen Omphalos stützte, einen hüfthohen, phallischen Stein, der den Nabel der Welt darstellte, den Mittelpunkt des Universums.
Ansonsten gab es in der Höhle nur noch einen erhöhten Sitz, der auf drei Beinen stand. Er befand sich über einer Bodenspalte natürlichen Ursprungs. Wenngleich Pythia den Atem Apollos gewohnt war, prallte sie vor dem aus der Tiefe aufsteigenden Geruch nach Mandelblüten erst einmal zurück.
Der Prophezeiungen schenkende göttliche Odem.
»Es ist Zeit«, sagte sie zu der jüngeren Schwester, die ihr ins Heiligtum gefolgt war. »Bring mir das Kind.«
Pythia ging zu dem Dreibein hinüber und nahm darauf Platz. Die Dämpfe, die aus der Bodenspalte aufstiegen, hüllten sie ein. »Mach schnell.«
Die jüngere Schwester hob das Kind hoch und setzte es ihr auf den Schoß. Pythia schloss es zärtlich in die Arme wie eine Mutter ihr Kind, doch das Mädchen reagierte nicht auf die Zuwendung.
Pythia spürte bereits die Wirkung des göttlichen Odems. Ein wohlvertrautes Prickeln erfasste ihre Gliedmaßen. Als Apollo in sie eindrang, begann ihr Schlund zu brennen. Ihr Gesichtsfeld verengte sich.
Das Kind aber war noch empfänglicher für den göttlichen Atem als sie.
Der Kopf fiel ihm in den Nacken; die Lider sanken herab. Lange würde das Mädchen dies nicht aushalten. Doch wenn sie nicht alle Hoffnung fahren lassen wollte, musste sie ihm die Frage stellen.
»Kind«, sagte Pythia, »erzähl uns mehr von diesem Jungen und dem Verhängnis, das von ihm ausgeht. Woher wird er kommen?«
Die schmalen Lippen zuckten. »Aus mir. Aus meinen Träumen.«
Das Kind tastete mit seinen kleinen Fingern nach Pythias Hand und drückte sie.
Die Worte sprudelten jetzt aus seinem Mund. »Dein Haus ist leer … deine Quellen sind versiegt. Doch es wird ein neuer Quell der Prophezeiung fließen.«
Pythia schloss die Arme fester um das Mädchen. Der Niedergang des Tempels dauerte schon viel zu lange an. »Ein neuer Quell.« Hoffnung schwang in ihrer Stimme mit. »Hier in Delphi?«
»Nein …«
Pythias Atem beschleunigte sich. »Wo wird er entspringen?«
Das Mädchen bewegte die Lippen, doch kein Laut kam heraus.
Sie schüttelte das Kind. »Wo?«
Das Mädchen hob das magere Ärmchen und legte es sich auf den Bauch.
Plötzlich hatte Pythia eine Vision. Silbriges Wasser ergoss sich aus dem Nabel des Mädchens und aus seinem Schoß. Ein neuer Quell. Aber stammte diese Vision wirklich von Apollo? Oder war sie lediglich Ausdruck ihrer Hoffnung?
Ein Schrei riss sie aus ihrem Dämmerzustand. Von oben war Stimmenlärm zu vernehmen. Eine Gestalt stolperte die Treppe herunter. Eine der Älteren, die sich um das Feuer kümmerten. Die Frau hatte sich an die Schulter gefasst. Blut quoll unter ihrer Hand hervor. Zwischen den Fingern schaute eine schwarze Pfeilspitze hervor.
»Zu spät!«, rief die Frau und sank auf die Knie. »Die Römer …«
Pythia hatte die Frau gehört, blieb aber im Nebel der Dämpfe gefangen. Sie gab sich der Vision hin und beobachtete, wie sich das dunkle Wasser zu einer schwarzen Gestalt formte … zum Schatten eines Jungen. Hinter ihm loderten Flammen.
Die Worte, die das Kind vor einem Monat gesprochen hatte, hallten in ihrem Geist wider.
Der Bruder des Hebräerjungen … der, welcher die Welt in Brand stecken würde.
Pythia hielt das erschlaffte Mädchen in den Armen. Seine Prophezeiung kündete von Verhängnis und Rettung. Vielleicht wäre es am besten, es der kaiserlichen Legion zu überlassen und der Ungewissheit ein Ende zu machen. Lautes Geschrei drang zu ihr herunter. Es war zu spät, um noch zu flüchten. Der einzige Ausweg war der Tod.
Gleichwohl schwoll die Vision in ihr an.
Ein neuer Quell wird entspringen.
Tief atmete sie die Dämpfe ein, nahm Apollo vollständig in sich auf.
Was soll ich tun?
Der römische Zenturio schritt durch den Tempel. Er hatte genaue Anweisungen. Er sollte das Mädchen töten, das den Untergang des Reiches prophezeit hatte. Am Abend zuvor hatten sie eine Tempeldienerin gefangen genommen, eine junge Frau. Als man sie peitschte, hatte sie verraten, dass sich das Kind noch immer im Tempel aufhielt. Dann hatte er sie seinen Männern überlassen.
»Bringt die Fackeln!«, rief er. »Durchsucht jeden Winkel!«
An der rückwärtigen Wand fiel ihm eine Bewegung ins Auge. Er zog das Schwert.
Eine Frau trat aus dem Schatten eines Treppenabgangs hervor. Benommen stolperte sie zwei Schritte in den Tempelraum hinein. Sie war weiß gekleidet und trug einen Lorbeerkranz auf dem Kopf.
Er wusste sogleich, wen er da vor sich hatte.
Das Orakel von Delphi.
Der Zenturio unterdrückte seine aufflackernde Angst. Wie viele Legionäre praktizierte auch er insgeheim die alten Riten. Er opferte Mithras sogar Stiere und badete in ihrem Blut.
Jetzt aber ging eine neue Sonne auf.
Niemand konnte sie aufhalten.
»Wer wagt es, den Frieden des Apollotempels zu stören?«, rief die Frau.
Der Zenturio, der die Blicke seiner Männer wie ein steinernes Gewicht auf sich lasten spürte, schritt der Frau entgegen. »Gib mir das Mädchen!«, verlangte er.
»Es ist nicht mehr hier. Es befindet sich außerhalb eurer Reichweite.«
Der Zenturio wusste, dass sie log. Der Tempel war umzingelt.
Die Sorge aber trieb ihn vorwärts.
Das Orakel verstellte ihm den Weg zur Treppe. Sie legte die Hand auf seinen Brustharnisch. »Der Zutritt zum Adytum ist Männern verboten.«
»Für den Kaiser gilt das nicht. Und ich führe seine Befehle aus.«
Die Frau rührte sich nicht. »Du darfst hier nicht eintreten.«
Arcadius, der Sohn des Kaisers, hatte ihm die mit dem Siegel Kaiser Theosius’ versehenen Befehle persönlich überreicht. Die alten Götter mussten zum Schweigen gebracht, ihre Tempel niedergerissen werden. Im ganzen Reich, auch in Delphi. Der Zenturio hatte noch einen weiteren Befehl erhalten.
Er war entschlossen, ihn auszuführen.
Er trieb dem Orakel die Klinge bis zum Heft in den Bauch. Ein Stöhnen kam aus dem Mund der Frau. Sie sank wie eine Geliebte gegen seine Schulter. Grob stieß er sie von sich.
Blut spritzte auf seine Rüstung und auf den Boden.
Das Orakel brach zusammen und fiel auf die Seite.
Sie streckte den zitternden Arm zu der Blutlache aus und legte die flache Hand hinein. »Ein neuer Quell …«, flüsterte sie, als wäre es ein Versprechen.
Dann erschlaffte sie.
Der Zenturio trat über sie hinweg und stieg mit gezücktem Schwert die Treppe hinunter, die in eine kleine Höhle führte. In einer dunklen Blutlache lag eine Tote, die von einem Pfeil getroffen worden war. Neben einer Bodenspalte war ein dreibeiniger Stuhl umgekippt. Er durchsuchte den Raum, bis er wieder an der Treppe angelangt war.
Unmöglich.
Die Felskammer war leer.
März 1959KarpatenRumänien
MAJOR JURI RAEW kletterte aus dem russischen ZiS-151-Laster und sprang auf die unbefestigte Straße hinunter. Ihm zitterten die Beine. Mit einer Hand stützte er sich an der grünen Stahltür des zerbeulten Lasters ab, den er in einem Atemzug verfluchte und lobte. Von dem Gerüttel der einwöchigen Fahrt ins Gebirge hatte er Rückenschmerzen. Er hatte das Gefühl, selbst seine Backenzähne hätten sich gelockert. Doch man brauchte ein solch robustes Fahrzeug, um die steinigen Serpentinen und die überfluteten Straßen zu bewältigen, die zu diesem abgelegenen Winterlager führten.
Er blickte sich gerade um, als die Hecktür sich klappernd öffnete. Soldaten in schwarz-weißen Uniformen sprangen heraus. Ihre Tarnuniformen verschmolzen mit dem Schnee und dem Granit des dicht bewaldeten Hochlands. In den Senken hingen Nebelschwaden, die störrischen Gespenstern glichen.
Die Männer stampften auf den Boden und fluchten. Funken stoben, als Zigaretten weggeworfen wurden. Klirrend machten die Soldaten ihre Kalaschnikows einsatzbereit. Doch das war lediglich die Nachhut, die der Kolonne den Rücken freihalten sollte.
Juri blickte nach vorn, als der stellvertretende Kommandeur, Leutnant Dobritsky, heranmarschiert kam. Der stämmige Ukrainer mit dem pockennarbigen Gesicht und der schiefen Nase trug ebenfalls eine Tarnuniform. Um die Augen hatte er von der Schneebrille rote Druckstellen.
»Major, das Lager ist gesichert.«
»Sind sie das? Sind das die Gesuchten?«
Dobritsky zuckte mit den Schultern und ließ die Antwort offen. Es hatte bereits einen Fehlalarm gegeben, und sie hatten das Winterlager halb verhungerter Bauern gestürmt, die mit dem Brechen von Steinen ein karges Leben fristeten.
Juri schaute finster drein. Die Berge entstammten einer anderen Zeit, der Steinzeit. Hier herrschten Aberglaube und Armut. Das zerklüftete, bewaldete Hochland bot lichtscheuem Gesindel aber auch hervorragende Versteckmöglichkeiten.
Juri trat zur Seite und musterte den gewundenen, von Schlaglöchern übersäten Weg, der als Straße herhalten musste. Die voranfahrenden Fahrzeuge hatten den Matsch und den Schnee aufgewühlt. Zwischen den Bäumen machte Juri mehrere Motorräder vom Typ IMZ-Ural aus, in deren Beiwagen jeweils ein bewaffneter Soldat saß. Die schweren Motorräder waren vorgefahren, hatten das Gelände gesichert und alle Fluchtwege abgeschnitten.
Gerüchte und unter Folter erpresste Aussagen hatten sie zu diesem abgelegenen Ort geführt. Dennoch waren sie gezwungen gewesen, das Hochland zu durchkämmen und ein paar Gehöfte niederzubrennen, um deren Besitzer gesprächiger zu machen. Nur wenige waren von sich aus bereit, über die karpatischen Roma zu sprechen. Zumal man sich über diesen isolierten Clan erzählte, er stehe mit strigoi und moroi in Verbindung. Mit bösen Geistern und Hexen.
Hatte er sie jetzt endlich gefunden?
Leutnant Dobritsky trat von einem Bein aufs andere. »Was nun, Major?«
Juri entging nicht die sauertöpfische Miene des Ukrainers. Juri war zwar Major der Sowjetarmee, aber dennoch kein Soldat. Er war einen Kopf kleiner als Dobritsky, hatte ein Bäuchlein und ein teigiges Gesicht. Er war von der staatlichen Universität Leningrad angeworben worden und hatte im militärischen Wissenschaftsbereich Karriere gemacht. Mit seinen gerade mal achtundzwanzig Jahren leitete er bereits das biophysikalische Labor des staatlichen Instituts für medizinische und biologische Forschung.
»Wo ist Major Martowa?«, fragte Juri. Die Vertreterin des sowjetischen militärischen Geheimdienstes wich nur selten von Dobritskys Seite und hielt ein Auge auf alle offiziellen Vorgänge.
»Sie erwartet uns am Eingang des Lagers.«
Dobritsky stapfte über die Straße. Juri ging am Rand entlang, wo der Boden noch gefroren und das Vorankommen leichter war. Als sie die letzte Biegung erreichten, zeigte der Leutnant auf ein Lager, das zwischen steilen Felsen lag und von Nadelwald umgeben war.
»Zigeuner«, brummte Dobritsky. »Wie Sie angeordnet haben, da?«
Aber war das auch der richtige Roma-Clan?
Die Zigeunerwagen waren in blassen Grün- und Schwarztönen gestrichen, die Räder reichten Juri bis zum Kopf. Stellenweise war die Farbe abgeblättert, und darunter kamen buntere Farbtöne zum Vorschein, die von glücklicheren Zeiten kündeten. Auf den großen Holzwagen lag Schnee, von den Dächern hingen Eiszapfen. Die Fensterscheiben waren mit Eisblumen bedeckt. Es gab mehrere rußgeschwärzte Feuergruben. Im Inneren des Lagers brannten noch zwei Feuer, deren Flammen bis zum Dach des höchsten Wagens emporloderten. Ein Wagen war zerstört und niedergebrannt.
An der einen Seite stand ein Schuppen, den man aus Brettern und Steinen errichtet hatte. Die darin untergebrachten Gäule hatten einen Hohlrücken und ließen die Köpfe hängen. Ziegen und ein paar Schafe streiften umher.
Die Soldaten hatten das Lager umzingelt. Auf dem Boden lagen mehrere Tote in zerlumpten Kleidern und Pelzjacken. Die Lebenden machten kaum einen besseren Eindruck. Man hatte die Bewohner des Lagers aus den Wagen und den schweren Zelten hervorgezerrt.
Von weiter hinten war Geschrei zu hören. Dort wurden die letzten Zigeuner zusammengetrieben. Maschinengewehre knatterten. Kalaschnikows. Juri musterte die finster dreinschauende Menge. Einige Frauen waren niedergekniet und schluchzten. Die dunkelhäutigen Männer musterten die Eindringlinge. Die meisten hatten blutende Verletzungen und gebrochene Gliedmaßen.
»Wo sind die Kinder?«, fragte Juri.
Die Antwort kam von der anderen Seite, so spröde und kalt wie das Eis des Hochlands. »Haben sich in der Kirche verbarrikadiert.«
Juri wandte sich Sawina Martowa zu, der Geheimdienstoffizierin. Sie hatte sich in einen schwarzen Mantel mit pelzverbrämter Kapuze eingemummt. Ihr schwarzes Haar glich der Mähne des russischen Wolfs.
Sie hob den schlanken Arm und zeigte auf eine Anhöhe hinter den Wagen und Zelten. Das Gebäude dort war anscheinend das massivste des ganzen Lagers. Aus Steinen errichtet, verschmolz die Kirche mit den umliegenden Felsen.
»Die Kinder hatten sich bereits dort versammelt, als unsere Einsatzkräfte eingetroffen sind«, berichtete Sawina.
Dobritsky nickte. »Haben wohl die Motorräder gehört.«
Sawina erwiderte Juris Blick. Ihre grünen Augen funkelten in der Morgensonne. Die Geheimdienstoffizierin machte sich ihre eigenen Gedanken. Sawina hatte die geheimen Forschungsberichte in Juris Institut gebracht, Notizblöcke und Unmengen von Akten aus Auschwitz-Birkenau. Die meisten Unterlagen hatten sich auf die Arbeit Dr. Josef Mengeles bezogen, der auch als »Todesengel« des Konzentrationslagers bezeichnet wurde.
Nach der Lektüre war Juri des Öfteren schweißgebadet aus Albträumen erwacht. Es war bekannt, dass Dr. Mengele die unterschiedlichsten grauenhaften Experimente mit den Lagerinsassen durchgeführt hatte, doch dieses Ungeheuer hatte eine spezielle Vorliebe für Zigeuner und zumal deren Kinder entwickelt. Er schenkte ihnen Süßigkeiten und Schokolade. Sie nannten ihn »Onkel Pepe«. Auf diese Weise machte er sich die Kinder gefügig. Am Ende ließ er sie alle ermorden – zuvor aber hatte er ein einzigartiges Zwillingspaar entdeckt.
Zwei eineiige Mädchen. Sascha und Meena.
Juri hatte die Unterlagen mit einer Mischung aus Faszination und Entsetzen gelesen.
Mengele hatte sich akribisch Notizen über die bemerkenswerten Zwillinge gemacht und deren Alter, Familiengeschichte und Stammbaum vermerkt. Er folterte ihre Angehörigen, um weitere Details in Erfahrung zu bringen, die er von den Mädchen verifizieren ließ. Mengele beschleunigte seine Experimente. Als das Kriegsende nahte, war er gezwungen gewesen, seine Versuche vorzeitig abzubrechen. Er tötete die Zwillinge, indem er ihnen Phenol ins Herz spritzte.
Mengele hatte seiner Enttäuschung Ausdruck verliehen.
Wenn ich nur mehr Zeit gehabt hätte …
»Sind Sie bereit?«, fragte Sawina.
Juri nickte.
Begleitet von Dobritsky und einem weiteren Soldaten, drangen sie ins Lager vor. Er wich einem Leichnam aus, der bäuchlings in einer gefrorenen Blutlache lag.
Die Kirche tauchte vor ihnen auf. Sie war aus Bruchsteinen errichtet und fensterlos. Die Eingangstür war geschlossen. Sie bestand aus behauenen, dicken Holzbalken und war mit Kupferbeschlägen verstärkt. Das Gebäude glich eher einer Festung als einer Kirche.
Zwei mit Rammböcken ausgerüstete Soldaten flankierten den Eingang.
Dobritsky blickte fragend Juri an.
Er nickte.
»Brecht die Tür auf!«, befahl der Leutnant.
Die beiden Männer holten mit dem Rammbock aus und schmetterten ihn gegen die Tür. Holz splitterte. Zwei Attacken hielt die Tür stand. Dann barst sie mit einem lauten Krachen.
Juri folgte Sawina ins Innere der Kirche.
Öllämpchen erhellten den düsteren Raum. Rechts und links Reihen von Kirchenbänken, die auf einen erhöhten Altar hin ausgerichtet waren. Kinder aller Altersstufen saßen in seltsamem Schweigen auf den Bänken.
Als Juri zum Altar schritt, musterte er die Kinder. Viele wiesen eigenartige Deformationen auf: Kleinköpfigkeit, Hasenscharten, Zwergwüchsigkeit. Ein Kind hatte keine Arme. Inzucht. Juri bekam eine Gänsehaut. Kein Wunder, dass die Landbewohner diesen Roma-Clan fürchteten und von Geistern und Ungeheuern munkelten.
»Wie wollen Sie erkennen, dass dies hier die richtigen Kinder sind?«, fragte Sawina mit unverhohlenem Abscheu.
Juri zitierte aus einem Folterprotokoll Mengeles. »Das Lager der Chovihanis.« Dort waren die Zwillinge geboren worden, an einem Ort, den die Zigeuner seit der Gründung des Clans geheim hielten.
»Sind sie das?«, hakte Sawina nach.
Juri schüttelte den Kopf. »Ich weiß es nicht.«
Er näherte sich einem Mädchen, das vor dem Altar saß. Sie drückte sich eine zerfledderte Stoffpuppe an die Brust, und ihr eigenes Kleid war kaum besser als das der Puppe. Das Kind war von Missbildungen anscheinend verschont geblieben. Seine kristallblauen Augen funkelten im trüben Licht.
Diese Augenfarbe war selten bei den Roma.
Auch die Zwillinge Sascha und Meena hatten blaue Augen gehabt.
Juri kniete vor ihr nieder. Sie schien ihn nicht wahrzunehmen. Ihr Blick ging durch ihn hindurch. Er spürte, dass mit dem Kind etwas nicht stimmte. Es hatte einen Defekt, der schlimmer war als körperliche Missbildung.
Ohne dass sich ihr Blick scharf gestellt hätte, hob sie die Hand und zeigte auf ihn. »Unchi Pepe«, lispelte sie mit dünnem Stimmchen.
Juri verspürte einen Anflug von Angst. Onkel Pepe. Der Kosename Josef Mengeles. Alle Zigeunerkinder hatten ihn so genannt. Diese Kinder aber waren zu jung, als dass sie ein Konzentrationslager von innen gesehen hatten.
Juri blickte in die leeren Augen. Ahnte das Mädchen, was er und sein Forschungsteam vorhatten? Woher hätte sie es wissen sollen? Mengeles Worte gingen ihm durch den Sinn:
Wenn ich nur mehr Zeit gehabt hätte …
Dieses Problem würde sich Juri nicht stellen. Sein Team würde alle Zeit der Welt haben. Das Forschungsgebäude war bereits im Bau. Vor neugierigen Blicken gut geschützt.
Sawina trat näher. Sie musste sich Gewissheit verschaffen.
Juri kannte die Wahrheit; er hatte es in dem Moment gewusst, da er dem Mädchen in die Augen blickte. Dennoch zögerte er.
Sawina berührte ihn am Ellbogen. »Major?«
Es gab kein Zurück mehr, weshalb Juri nickte. Das Grauen würde seinen Lauf nehmen. »Da. Das sind die Chovihanis.«
»Sind Sie sicher?«
Juri nickte erneut, wobei er dem Kind unverwandt in die
EINS
1
Gegenwart 5. September, 13:38 Washington, D.C.
ES KAM NICHT jeden Tag vor, dass einem ein Mensch in den Armen verstarb.
Commander Gray Pierce ging die National Mall entlang, als er von einem Obdachlosen angesprochen wurde. Gray hatte schlechte Laune, denn eine Auseinandersetzung lag bereits hinter ihm, und er war unterwegs zur nächsten. Auch die Mittagshitze trug zu seiner Reizbarkeit bei. In D.C. herrschte die übliche Schwüle, und das Pflaster des Gehsteigs verströmte eine Gluthitze. Bekleidet mit einem marineblauen Blazer, Baumwollhemd und Jeans, kam er sich bereits halbgar vor.
Ein paar Häuser entfernt machte Gray eine hagere Gestalt aus, die ihm entgegengeschlurft kam. Der Obdachlose hatte sich die ausgebeulte Jeans hochgekrempelt, sodass man die abgenutzten Armeestiefel mit den nachschleifenden Schnürsenkeln sah. Um seinen gebeugten Oberkörper schlotterte ein zerknittertes Sakko. Sein struppiger Bart war angegraut, und seine trüben, geröteten Augen huschten suchend umher.
Bettler gab es auf der National Mall viele, zumal die Feierlichkeiten zum Labor Day erst gestern geendet hatten. Die Touristen waren in den Alltag zurückgekehrt, die Bereitschaftspolizei hatte sich in die Bars zurückgezogen, und die Reinigungskräfte hatten die Straßen gesäubert. Übrig geblieben waren die Bettler, die nach verlorenem Kleingeld suchten und wie Krabben, welche die letzten Fleischreste von alten Knochen schabten, die Mülltonnen nach Flaschen und Getränkedosen durchstöberten.
Gray, der sich über den Jefferson Drive dem Smithsonian Castle näherte, wich dem Vagabunden nicht aus. Er stellte sogar Augenkontakt her, um die von ihm ausgehende Gefahr einzuschätzen und ihm zu zeigen, dass er ihn zur Kenntnis nahm. Zwar gab es sicherlich auch ein paar Schwindler, die auf die Bettelei eigentlich gar nicht angewiesen waren, doch die meisten derer, die auf der Straße lebten, hatten entweder Pech gehabt, waren drogensüchtig oder geistesgestört. Viele waren auch Veteranen der bewaffneten Streitkräfte. Gray wollte nicht wegschauen – und vielleicht war das der Grund, weshalb sich die Miene des Fremden aufhellte.
Unter der Schmutzschicht und den Falten zeigte sich eine Mischung aus Erleichterung und Hoffnung. Sein schlurfender Gang wurde zielstrebiger. Vielleicht fürchtete er, seine Beute könnte ihm in die Burg entwischen, bevor er sie erreichte. Die Gliedmaßen des Mannes zitterten. Entweder er war betrunken oder litt unter Entzug.
Er streckte die Hand aus.
Das war eine universale Geste – in den brasilianischen Slums ebenso gebräuchlich wie in den Straßen Bangkoks.
Bitte helfen Sie mir.
Gray langte zur Innentasche des Blazers. Viele hielten es für falsch, einem Penner etwas zu geben. Die kaufen sich von dem Geld doch bloß Schnaps oder Crack. Ihm war es egal. Das hier war ein Mitmensch in Not. Ein Urteil stand ihm nicht zu. Er zückte die Brieftasche. Wenn ihn jemand anbettelte, dann gab er auch etwas. Das war sein Motto. Und vielleicht profitierte ja auch Gray dabei, und seine Mildtätigkeit diente dazu, ein tief verwurzeltes Schuldgefühl zu beschwichtigen, das er sich selbst nicht eingestehen wollte.
Ein, zwei Dollar konnte er leicht verschmerzen.
Kein schlechtes Tauschgeschäft.
Er schaute ins Geldfach. Alles Zwanziger. Soeben hatte er sich am Automaten in der U-Bahn-Station Geld auszahlen lassen. Achselzuckend zog er einen Geldschein mit Andrew Jacksons Porträt hervor.
Okay, hin und wieder reichten ein, zwei Dollar nicht.
Als sie sich gegenüberstanden, schaute er hoch. Gray wollte dem Mann den Zwanzigdollarschein reichen, doch dessen Hand war gar nicht leer. Auf der Handfläche lag eine matte Münze von der Größe eines Fünfzigcentstücks.
Gray runzelte die Stirn.
Dies war das erste Mal, dass ein Obdachloser ihm Geld geben wollte.
Ehe er sich über die Situation klar werden konnte, taumelte der Mann plötzlich nach vorn, als hätte er einen Stoß in den Rücken bekommen. Mit staunend aufgerissenem Mund kippte er gegen Gray, der den älteren Mann auffing.
Er war erstaunlich leicht, nur Haut und Knochen, ein Skelett im Anzug. Seine Hand streifte Grays Wange. Sie war glühend heiß. Die Angst vor einer Ansteckung mit einer schlimmen Krankheit durchzuckte Gray, doch er ließ auch dann nicht los, als der Mann in seinen Armen zusammensackte.
Während er den erschlafften Mann stützte, verlagerte Gray den linken Arm. Mit der Hand berührte er in dessen Kreuz etwas Warmes, Feuchtes. Es strömte ihm über die Finger.
Blut.
Instinktiv wandte Gray sich um. Ohne den Mann loszulassen, ließ er sich seitlich vom Gehsteig fallen. Das dichte Gras dämpfte den Sturz.
Die nächsten Schüsse hörte Gray nicht, sah aber an der Stelle, wo er eben noch gestanden hatte, zwei Querschläger vom Beton abprallen. Er wälzte sich weiter bis zu einem Hinweisschild aus Metall und Beton, das auf der Grasfläche vor dem Smithsonian Castle stand. Die Aufschrift lautete: SMITHSONIAN INFORMATIONSZENTRUM IN DER BURG.
Informationen konnte Gray im Moment gut gebrauchen.
Zum Beispiel hätte er gern gewusst, wer da auf ihn schoss.
Das massive Schild schirmte ihn von der Mall ab. Es bot ihm vorübergehend Deckung. Zehn Meter entfernt lockte der Nebeneingang des Smithsonian Castle. Das Gebäude mit seinen Türmen und Türmchen war aus rotem Sandstein erbaut, der aus Seneca Creek in Maryland stammte, eine normannische Burg und eine wahre Festung. Bis zu den sicheren Mauern waren es nur wenige Schritte, doch wenn er sich aus der Deckung gewagt hätte, wäre er dem Heckenschützen schutzlos ausgeliefert gewesen.
Stattdessen riss Gray eine Pistole aus dem Rückenhalfter – eine kompakte Sig Sauer P229. Nicht, dass er gewusst hätte, wohin er hätte zielen sollen. Trotzdem brachte er für den Fall eines direkten Angriffs die Waffe in Anschlag.
Der Obdachlose stöhnte. Am Rücken war das Sakko blutgetränkt. Über das Pech des Mannes konnte Gray nur den Kopf schütteln. Der arme Kerl hatte es auf ein Almosen abgesehen gehabt und stattdessen eine Kugel in den Rücken abbekommen, die eigentlich für Gray gedacht gewesen war.
Wer aber wollte ihn umbringen? Und weshalb?
Der Obdachlose hob zitterig den Arm. Mit jedem keuchenden Atemzug wurde er schwächer. Dem aus der Eintrittswunde strömenden Blut nach zu schließen, hatte die Kugel eine Niere getroffen, eine tödliche Verletzung für einen so stark geschwächten Menschen. Er öffnete die Hand, und die matte Münze fiel heraus. Die ganze Zeit über hatte er sie festgehalten. Die Münze fiel auf Grays Bein und kullerte ins Gras.
Ein Abschiedsgeschenk.
Ein letztes Dankeschön.
Als das vollbracht war, erschlaffte der Fremde. Sein Kopf sank auf Grays Schulter. Gray fluchte verhalten.
Tut mir leid, alter Mann.
Mit der Linken zog er das Handy aus der Tasche. Er klappte es auf und drückte die Notruftaste. Es wurde augenblicklich abgenommen.
Gray schilderte kurz seine Lage.
»Hilfe ist bereits unterwegs«, erklärte der Direktor. »Wir sehen Sie auf dem Monitor der Überwachungskamera. Da ist eine Menge Blut. Sind Sie verletzt?«
»Nein«, antwortete Gray knapp.
»Bleiben Sie in Deckung.«
Gray hatte keine Einwände dagegen. Bislang waren keine weiteren Schüsse abgefeuert worden. Es waren keine Kugeln in das Schild eingeschlagen. Vielleicht war der Schütze ja bereits geflüchtet. Trotzdem wagte Gray es nicht, sich zu bewegen – er wartete auf das Eintreffen der Kavallerie.
Gray steckte das Handy ein und nahm die Münze in die Hand. Sie war schwer und dick und wies eine primitive Prägung auf. Zerstreut rieb er daran. Mit dem Blut an seinen Fingern entfernte er den Oberflächenschmutz. Darunter kam das Abbild eines griechischen oder römischen Tempels zum Vorschein, sechs Säulen unter einem spitzen Giebel.
Was zum Teufel hatte das zu bedeuten?
In der Mitte der Münze prangte ein einzelner Buchstabe.
Gray erkannte darin den griechischen Buchstaben ∑.
Sigma.
In der Mathematik stand der Buchstabe Sigma für die Summe aller Teile, doch er war auch das Symbol der Organisation, für die Gray arbeitete: die Sigma Force, ein Elite-Team von Exsoldaten der Spezialeinsatzkräfte, die eine wissenschaftliche Zusatzausbildung absolviert hatten und nun dem verdeckt arbeitenden militärischen Arm der DARPA angehörten, der Forschungs- und Entwicklungsabteilung des Verteidigungsministeriums.
Gray blickte zur Burg. In den noch aus dem Zweiten Weltkrieg stammenden unterirdischen Bunkern war das Hauptquartier von Sigma untergebracht. Aufgrund seiner zentralen Lage verfügte es über beste Kontakte zu den Regierungsstellen, dem Pentagon und den verschiedenen privaten und staatlichen Forschungseinrichtungen.
Gray konzentrierte sich wieder auf die Münze und stellte fest, dass er einer Täuschung aufgesessen war. Der Buch – stabe war kein griechisches ∑ – sondern ein großes E. In seiner Panik hatte er die beiden Buchstaben verwechselt und das zu sehen gemeint, was ihn gerade beschäftigte.
Er schloss die Faust um die Münze.
Nur ein E.
In den vergangenen Wochen war es schon häufiger vorgekommen, dass Gray Querverbindungen sah, wo gar keine waren – zumindest war das die einhellige Ansicht seiner Kollegen. Einen ganzen Monat lang hatte Gray nach dem Verbleib seines vermissten Freundes Monk Kokkalis geforscht und dabei alle Mittel ausgeschöpft, die Sigma zur Verfügung standen. Bislang war er immer nur in Sackgassen gelandet.
Sie jagen nach Gespenstern, hatte Painter Crowe ihn nach den ersten Wochen gewarnt.
Vielleicht hatte er recht damit gehabt.
In der Vorderfront der Burg sprang eine Tür auf. Mehrere schwarz gekleidete Gestalten stürmten mit angelegten Waffen heraus, die sie sich beidhändig an die Schulter drückten.
Die Kavallerie. Die Männer bewegten sich vorsichtig, wurden jedoch nicht unter Feuer genommen.
Kurz darauf hatten sie Gray erreicht und sicherten nach allen Seiten.
Einer der Männer kniete neben dem Obdachlosen nieder. Er stellte einen Notfallkoffer ab, um Erste Hilfe zu leisten.
»Ich glaube, er ist tot«, sagte Gray.
Der Arzt tastete nach dem Puls und bestätigte Grays Vermutung.
Tot.
Gray richtete sich auf.
Zu seiner Verwunderung machte er seinen Chef Painter Crowe am Nebeneingang aus. Mit hochgekrempelten Hemdsärmeln trat der Direktor ins Freie. Seine Miene war finster. Obwohl er zehn Jahre älter war als Gray, bewegte Painter sich noch immer so geschmeidig wie ein schlanker Wolf. Offenbar schätzte der Direktor das Risiko als gering ein. Oder aber er spürte wie Gray, dass der Heckenschütze bereits geflüchtet war.
Aber was verstand der Mann eigentlich unter einem Schreibtischjob?
Painter ging ihm entgegen, während in der Ferne Polizeisirenen ertönten. »Ich lasse die Mall von der Polizei abriegeln«, sagte er knapp.
»Zu wenig, zu spät.«
»Wahrscheinlich. Die Ballistiker werden das Schussfeld einengen und herausfinden, wo die Schüsse abgefeuert wurden. Ist Ihnen jemand gefolgt?«
Gray schüttelte den Kopf. »Mir ist jedenfalls nichts aufgefallen.«
Gray konnte sehen, wie es hinter der Stirn des Direktors arbeitete, als er die Mall musterte. Wer hatte es gewagt, einen Mordanschlag auf Gray zu verüben? Noch dazu unmittelbar vor ihrer Haustür. Das war eine deutliche Warnung, doch worauf zielte sie ab? Seit dem Einsatz in Kambodscha war Gray nicht mehr aktiv gewesen.
»Wir haben Ihre Eltern bereits unter Bewachung gestellt«, sagte Painter. »Eine reine Vorsichtsmaßnahme.«
Gray nickte dankbar. Allerdings konnte er sich denken, dass sein Vater nicht besonders glücklich darüber sein würde. Und seine Mutter auch nicht. Sie hatte sich noch immer nicht vollständig von dem Kidnapping vor zwei Monaten erholt.
Trotz des Toten verspürte Gray auf einmal neue Hoffnung.
»Direktor, wäre es möglich, dass der Schütze …«
Painter hob die Hand. Auf seiner Stirn hatte sich eine tiefe Sorgenfalte eingegraben. Er ließ sich neben dem Obdachlosen auf ein Knie nieder und drehte dessen Gesicht behutsam herum. Nach einer Weile hockte er sich auf die Fersen und kniff die Augen zusammen. Auf einmal wirkte er besorgter denn je.
»Was ist, Sir?«
»Ich glaube nicht, dass es der Schütze auf Sie abgesehen hatte, Gray.«
Gray blickte zum Gehsteig und dachte an die Querschläger.
»Jedenfalls waren Sie nicht das vorrangige Ziel.«
»Weshalb sind Sie sich da so sicher?«
Painter nickte zu dem Toten hin. »Ich kenne den Mann.«
Gray reagierte mit Bestürzung.
»Das ist Archibald Polk, Professor für Neurologie am M.I.T.«
Gray musterte skeptisch das gelbliche Gesicht des Toten und den schmutzigen Dreitagebart, doch der Direktor hatte anscheinend nicht gescherzt. Wenn er richtig lag, hatte der Bursche schwere Zeiten durchgemacht.
»Wie zum Teufel konnte er so enden?«, fragte Gray.
Painter richtete sich auf und schüttelte den Kopf. »Keine Ahnung. Der Kontakt zu ihm ist vor zehn Jahren abgebrochen. Aber es gibt eine noch wichtigere Frage: Weshalb wurde er erschossen?«
Gray blickte auf den Leichnam. Er musste seine anfängliche Einschätzung korrigieren. Eigentlich hätte er erleichtert sein sollen, dass der Heckenschütze es nicht auf ihn abgesehen gehabt hatte, doch wenn Painter recht hatte, stand der Angriff nicht in Zusammenhang mit Grays eigenen Nachforschungen.
Ärger wallte in ihm auf – und Gewissensbisse.
Der Mann war in seinen Armen gestorben.
»Er muss absichtlich hierhergekommen sein«, murmelte Painter und blickte zur Burg. »Er wollte mich sprechen. Aber weshalb?«
Gray musste an die drängende Geste des Mannes denken. Er streckte die Hand aus. Auf der blutigen Handfläche lag die Münze. »Ich glaube, er wollte mir das hier geben.«
14:02
Während in der Ferne Polizeisirenen gellten, ging der alte Mann langsam die Pennsylvania Avenue entlang. Er war mit einem staubgrauen Anzug bekleidet. In der einen Hand trug er einen ramponierten Reisekoffer, an der anderen Hand führte er ein Mädchen. Das Kleid der Neunjährigen passte farblich zum Anzug des Mannes. Das dunkle Haar hatte sie sich mit einem roten Band aus dem blassen Gesicht zurückgebunden. Ihre glänzenden schwarzen Schuhe wiesen einen trocknenden Schlammspritzer auf, der von dem Spielplatz stammte, auf dem sie bis gerade eben gespielt hatte.
»Papa, hast du deinen Freund gefunden?«, fragte sie auf Russisch.
Er drückte ihr die Hand und antwortete mit müder Stimme: »Ja, das hab ich, Sascha. Aber denk bitte daran, Englisch zu sprechen, mein Schatz.«
Als Reaktion auf den Tadel schlurfte sie ein bisschen mit den Füßen, dann ging sie weiter. »Hat er sich gefreut, dich zu sehen?«
Der Mann vergegenwärtigte sich den Blick durchs Zielfernrohr und wie der Mann zusammengebrochen war.
»Ja, das hat er. Er war sehr überrascht.«
»Können wir jetzt heimfliegen? Marta wartet bestimmt schon auf mich.«
»Bald.«
»Wann ist bald?«, fragte sie und kratzte sich am Ohr. Dort, wo es juckte, schimmerte glänzender Stahl durch ihr dunkles Haar.
Er drückte ihren Arm behutsam nach unten und strich das Haar glatt. »Ich muss vorher noch etwas erledigen. Dann fliegen wir nach Hause.«
Er näherte sich der Zehnten Straße. Das Gebäude lag zu seiner Rechten, ein hässlicher Kastenbau, den jemand mit Fahnen zu schmücken versucht hatte. Er näherte sich dem Eingang.
Sein Ziel.
Die FBI-Zentrale.
15:46
In Grays Spind summte es.
Er eilte darauf zu und wäre auf dem nassen Boden um ein Haar ausgerutscht. Er kam gerade aus der Dusche und hatte sich lediglich ein Handtuch umgelegt. Nach einer kurzen Besprechung mit Direktor Crowe hatte er sich in die Umkleideräume im Keller der Sigma-Bunker zurückgezogen. Als Erstes nahm er eine Dusche, dann stemmte er eine Stunde lang Gewichte und duschte erneut. Die Anstrengung half ihm, wieder einen klaren Kopf zu bekommen.
Vollständig gelungen aber war es ihm nicht.
Erst musste er herausfinden, was es mit dem Mord auf sich hatte.
Er öffnete den Spind und hob den Blackberry auf. Das musste Direktor Crowe sein. Als er das Handy berührte, hörte es auf zu vibrieren. Der Anrufer hatte aufgelegt. Gray warf einen Blick aufs Display und runzelte die Stirn. Painter Crowe war es nicht gewesen.
Auf dem Display stand: R. Trypol.
Den hätte er beinahe vergessen gehabt.
Captain Ron Trypol von der Marineaufklärung.
Der Captain hatte den Rettungseinsatz vor der indonesischen Insel Pusat geleitet. Heute wollte er über den Stand der Arbeiten zur Bergung des gesunkenen Kreuzfahrtschiffs Mistress of the Seas Bericht erstatten. Er hatte zwei U-Boote vor Ort, die das Wrack und dessen Umgebung absuchten.
Gray aber hatte ein ganz persönliches Interesse an der Suche.
Sein Freund und Kollege Monk Kokkalis war vor der Insel Pusat zum letzten Mal gesehen worden. Er hatte sich in einem schweren Tarnnetz verfangen und war unter Wasser gezogen worden. Captain Trypol hatte sich bereit erklärt, nach Monks Leiche zu suchen. Der Captain war ein guter Freund und ehemaliger Kollege von Monks Witwe Kat Bryant. Heute Morgen war Gray zum Amt für Marineaufklärung in Suitland, Maryland, gefahren, weil er hoffte, dort Neues zu erfahren. Man hatte ihm jedoch eine Abfuhr erteilt und ihn aufgefordert, sich bis zum Abschluss der Untersuchung zu gedulden. Anschließend war er zur Sigma-Zentrale zurückgeeilt, weil er den Direktor bitten wollte, Druck auf die Navy auszuüben.
Gray verspürte einen Anflug schlechten Gewissens, weil er sein eigentliches Anliegen aus dem Blick verloren hatte. Er drückte die Rückruftaste und hob das Handy ans Ohr. Während er darauf wartete, dass die Verbindung hergestellt wurde, ließ er sich auf eine Bank sinken. Sein Blick fiel auf den gegenüberliegenden Spind. Auf ein Stück Klebeband an der Tür hatte jemand mit schwarzem Filzstift den Namen des ehemaligen Besitzers geschrieben.
KOKKALIS.
Obwohl Monk mit Sicherheit tot war, hatte sich niemand aufraffen können, das Klebeband zu entfernen. Es war ein Hoffnungszeichen. Auch wenn Gray vielleicht der Einzige war, der die Hoffnung nicht aufgeben wollte.
Das war er seinem Freund schuldig.
Monk hatte zusammen mit Gray bei Sigma Karriere gemacht. Er war zum gleichen Zeitpunkt, als man Gray aus dem Leavenworth Gefängnis herausgeholt hatte, von den Green Berets angeworben worden. Gray hatte in Leavenworth eine Haftstrafe wegen Tätlichkeit gegen einen Vorgesetzten verbüßt, die er sich während seiner Dienstzeit bei den Army Rangers hatte zuschulden kommen lassen. Sie waren rasch Freunde geworden, obwohl sie bei Sigma ein seltsames Paar gewesen waren. Monk war nur knapp eins sechzig groß gewesen und hatte neben dem größeren, hageren Gray wie ein geschorener Pitbull gewirkt. Die eigentlichen Unterschiede aber lagen tiefer. Mit seiner lockeren Art hatte er einen günstigen Einfluss auf den kompromisslosen, stahlharten Gray ausgeübt. Ohne die Freundschaft zu Monk wäre Gray vermutlich bei Sigma ebenso gescheitert wie bei den Army Rangers.
Während er wartete, dachte Gray an seinen ehemaligen Partner. Im Laufe der Jahre hatten sie viele brenzlige Situationen gemeistert. Monks zahlreiche Narben waren ein Beleg dafür gewesen. Bei einem Einsatz hatte er sogar die linke Hand verloren und trug seitdem eine Prothese. Gray vernahm im Kopf noch immer Monks bellendes Gelächter … und seine leise, eindringliche Stimme, die den hohen IQ des Gerichtsmediziners und Wissenschaftlers durchklingen ließ.
Wie war es nur möglich, dass ein solch eindrucksvoller, lebendiger Mensch einfach spurlos verschwand?
Endlich klickte es in der Leitung. »Captain Ron Trypol …«
»Captain, hier spricht Gray Pierce.«
»Ah, Commander. Gut, dass Sie anrufen. Ich hatte gehofft, Sie noch heute Nachmittag zu sprechen. Bis zur nächsten Sitzung bleibt mir nicht viel Zeit.«
Der Mann klang gestresst. »Captain?«
»Ich komme gleich zur Sache. Ich habe Anweisung, die Suche abzubrechen.«
»Was?«
»Wir konnten bislang zweiundzwanzig Leichen bergen. Ein Abgleich des Zahnstatus hat ergeben, dass Ihr Mann nicht dabei ist.«
»Nur zweiundzwanzig?« Das war selbst nach zurückhaltenden Schätzungen nur ein Bruchteil der Toten.
»Ich weiß, Commander. Aber die Bergungsarbeiten wurden durch die extreme Tiefe und den hohen Druck erschwert. Der Grund der Lagune ist von Höhlen und Lavakanälen durchzogen, die ein Labyrinth mit meilenweiten Gängen bilden.«
»Aber trotzdem …«
»Commander«, sagte Trypol mit fester Stimme. »Vor zwei Tagen haben wir einen Taucher verloren. Einen guten Mann mit Familie und zwei Kindern.«
Gray schloss die Augen. Er wusste, wie sehr ein solcher Verlust die Hinterbliebenen schmerzte.
»Wenn wir die Höhlen noch länger absuchen, setzen wir das Leben weiterer Männer aufs Spiel. Und wozu das alles?«
Gray schwieg.
»Commander Pierce, ich nehme an, Sie haben ebenfalls nichts Neues zu vermelden. Keine geheimnisvollen Botschaften mehr?«
Gray seufzte.
Um den Captain zur Zusammenarbeit zu bewegen, hatte er ihm von der einen Botschaft erzählt, die er erhalten hatte … oder möglicherweise erhalten hatte. Der Vorfall hatte sich ein paar Wochen nach Monks Verschwinden ereignet. Von dem Einsatz auf der Insel hatte er Monks Handprothese übrig behalten, ein Biotechnologieprodukt, ausgestattet mit neuester DARPA-Technik und einer Funkschnittstelle. Als er die Prothese zu Monks Bestattung bringen wollte, hatten die Finger ein schwaches SOS gemorst. Das Ganze hatte nur wenige Sekunden gedauert – und Gray allein hatte es gehört. Dann hatte es wieder aufgehört. Die Techniker, welche die Hand untersuchten, waren zu dem Schluss gekommen, es habe sich um einen elektrischen Kurzschluss gehandelt. Im digitalen Protokoll der Hand war kein hereinkommendes Funksignal vermerkt gewesen. Es war eine Fehlfunktion aufgetreten. Das war alles. Ein elektrischer Flaschengeist.
Gray aber wollte die Hoffnung nicht aufgeben – auch wenn Woche um Woche verstrich.
»Commander?«, sagte Trypol.
»Nein«, räumte Gray verdrossen ein. »Keine weiteren Botschaften.«
Nach kurzem Schweigen sagte Trypol bedächtig: »Dann ist es vielleicht an der Zeit, die Sache ad acta zu legen, Commander. Das liegt im allgemeinen Interesse.« Sein Tonfall wurde etwas weicher. »Und was ist mit Kat, Monks Frau? Was sagt sie zu alledem?«
Das war ein wunder Punkt. Gray bedauerte, ihr überhaupt von dem Vorfall erzählt zu haben. Aber war er nicht dazu verpflichtet gewesen? Monk war ihr Mann; sie hatten eine kleine Tochter, Penelope. Vielleicht wäre es besser gewesen, er hätte ihr nichts davon gesagt. Kat hatte sich seinen Bericht mit regloser Miene angehört. In ihrem schwarzen Trauerkleid hatte sie stocksteif dagestanden, die Augen vor Trauer ganz eingesunken. Sie wusste, es war ein winziger Rettungsanker, eine vage Hoffnung. Sie hatte erst Penelope angeschaut, die auf dem Rücksitz der schwarzen Limousine saß, und dann wieder Gray. Sie hatte kein Wort gesagt, sondern nur einmal den Kopf geschüttelt. Sie konnte den Rettungsanker nicht ergreifen. Monk ein zweites Mal zu verlieren wäre zu viel für sie gewesen. Sie war bereits angegriffen, doch dies hätte ihr den Rest gegeben. Außerdem musste sie an Penelope denken, das Einzige, was Monk ihr hinterlassen hatte. Ein Wesen aus Fleisch und Blut. Und keine Phantomhoffnung.
Gray hatte Verständnis für sie gehabt. Deshalb hatte er die Untersuchung selbstständig weitergeführt. Seit jenem Tag hatte er nicht mehr mit Kat gesprochen. Zwischen ihnen bestand eine stillschweigende Abmachung. Sie wollte erst dann wieder mit ihm reden, wenn die Angelegenheit auf die eine oder andere Art abgeschlossen wäre. Grays Mutter aber hatte ein paar Nachmittage mit Kat und dem Kind verbracht. Von dem SOS-Signal wusste sie nichts, hatte aber gespürt, dass mit Kat etwas nicht stimmte.
Kat sei voller Qual, hatte sie gemeint.
Gray wusste, was sie quälte.
Ungeachtet ihrer bewussten Entscheidung hatte Kat nämlich tatsächlich nach dem Rettungsanker gegriffen. Ihr Verstand mochte sich der Hoffnung gegenüber verschließen, doch ihrem Herzen gelang das nicht.
Um ihretwillen, um ihrer Familie willen, musste Gray sich der grausamen Realität stellen.
»Ich danke Ihnen für Ihre Bemühungen, Captain«, murmelte er.
»Sie haben getan, was Sie konnten. Das müssen Sie sich immer vor Augen halten. Aber irgendwann muss das Leben weitergehen.«
Gray räusperte sich. »Es tut mir sehr leid, dass Sie einen Mann verloren haben, Sir.«
»Mein Beileid auch Ihnen.«
Gray unterbrach die Verbindung. Eine Weile stand er da. Schließlich trat er zum gegenüberliegenden Spind und legte die flache Hand auf die Metalltür, die so kalt war wie ein Grab.
Tut mir leid.
Mit einem Ruck riss er das Klebeband ab.
Lebewohl, Monk.
16:02
Painter versetzte die alte Münze auf seinem Schreibtisch in Drehung. Er betrachtete den blitzenden Silberschemen und grübelte über das darin verborgene Geheimnis nach. Vor einer halben Stunde war die Münze aus dem Labor zurückgekommen. Den detaillierten Untersuchungsbericht hatte er bereits gelesen. Man hatte die Münze mit dem Laser auf Fingerabdrücke untersucht und die Oberfläche wie das Innere mit dem Massenspektrometer analysiert. Zahlreiche Fotos waren angefertigt worden, unter anderem auch Stereoaufnahmen. Die Rotation der Münze verlangsamte sich, dann kippte sie auf die Mahagoni-Arbeitsfläche. Nach der sorgfältigen Reinigung funkelte die alte Prägung hell.
Ein von sechs dorischen Säulen gestützter griechischer Tempel. In der Mitte des Tempels ein großer Buchstabe.
E
Der griechische Buchstabe Epsilon.
Auf der Rückseite war eine Frauenbüste mit der Unterschrift DIVA FAUSTINA abgebildet. Dem Bericht zufolge war inzwischen zumindest die Herkunft der Münze geklärt.
Aber was hatte das alles zu bedeuten?
Die Sprechanlage summte. »Direktor Crowe, Commander Pierce ist eingetroffen.«
»Sehr schön. Lassen Sie ihn reinkommen, Brant.«
Painter zog den Untersuchungsbericht zu sich heran, als auch schon die Tür aufging. Gray trat ein, das schwarze, noch feuchte Haar frisch gekämmt. Er hatte die blutigen Kleidungsstücke abgelegt und trug nun ein grünes T-Shirt mit der Aufschrift ARMY, schwarze Jeans und Stiefel. Seine Miene war düster, doch in seinen graublauen Augen lag eine Art müder Entschlossenheit. Painter hatte eine Vermutung, was es damit auf sich hatte. Er verfügte beim Amt für Marineaufklärung über seine eigenen Kontaktleute.
Painter forderte Gray mit einer Handbewegung auf, Platz zu nehmen.
Als er sich gesetzt hatte, wurde Painter auf die Münze aufmerksam. Neugier regte sich in seinem Blick.
Gut.
Painter schob Gray die Münze entgegen. »Commander, ich weiß, Sie haben darum gebeten, für unbestimmte Zeit vom Dienst freigestellt zu werden, aber ich möchte Sie trotzdem bitten, die Ermittlungen zu diesem Fall zu leiten.«
Gray machte keine Anstalten, die Münze in die Hand zu nehmen. »Dürfte ich Ihnen zunächst eine Frage stellen, Sir?«
Painter nickte.
»Der Tote. Der Professor.«
»Archibald Polk.«
»Sie haben erwähnt, er habe zu Sigma gewollt. Um sich mit Ihnen zu treffen.«
Painter nickte. Er ahnte, worauf Grays Fragen abzielten.
»Dann hatte Professor Polk also Kontakt mit Sigma? Trotz der hohen Geheimhaltungsstufe wusste er Bescheid über unsere Organisation?«
»Ja. So kann man es ausdrücken.«
Gray runzelte die Stirn. »Wie meinen Sie das?«
»Archibald Polk hat Sigma erfunden.«
Painter registrierte Grays Überraschung nicht ohne Genugtuung. Der Mann konnte eine kleine Erschütterung gut vertragen. Gray straffte sich.
Painter hob die Hand. »Ich habe Ihre Frage beantwortet, Gray. Jetzt sind Sie an der Reihe. Werden Sie die Ermittlungen leiten?«
»Da der Professor vor meinen Augen erschossen wurde, habe ich ein besonderes Interesse an einer Aufklärung des Falls.«
»Und was ist mit Ihren … außerplanmäßigen Aktivitäten?«
Grays Augen nahmen einen schmerzlichen Ausdruck an. Seine Gesichtszüge verhärteten sich, als ob er sich innerlich zusammenkrampfte. »Ich nehme an, Sie sind auf dem Laufenden, Sir.«
»Ja. Die Navy hat die Suche abgebrochen.«
Gray atmete tief durch. »Ich habe alles versucht. Jetzt kann ich nichts mehr tun. Das lässt sich nicht leugnen.«
»Und Sie glauben nach wie vor, Monk könnte noch am Leben sein?«
»Ich … ich weiß es nicht.«
»Und Sie können mit der Ungewissheit leben?«
Gray erwiderte unverwandt Painters Blick. »Das werde ich wohl müssen.«
Painter nickte zufrieden. »Dann lassen Sie uns über die Münze sprechen.«
Gray nahm die Münze in die Hand. Er wendete sie zwischen den Fingern und betrachtete die frisch gereinigte Oberfläche. »Haben Sie herausgefunden, was es damit auf sich hat?«
»Wir sind inzwischen um einiges schlauer. Das ist eine römische Münze, die im zweiten Jahrhundert geprägt wurde. Beachten Sie die Frauenbüste auf der Rückseite. Das ist Faustina die Ältere, die Gattin des römischen Kaisers Antoninus Pius. Sie war die Schutzherrin verwaister Mädchen und hat sich generell für Frauen engagiert. Außerdem war sie fasziniert von der Schwesternschaft der Sibyllen, der weissagenden Frauen eines bestimmten Tempels in Griechenland.«
Painter forderte Gray auf, die Münze umzudrehen. »Der Tempel ist auf der Vorderseite abgebildet. Der Tempel von Delphi.«
»Der mit dem Orakel? Wo die Seherinnen zu Hause waren?«
»Genau der.«
Dem Untersuchungsbericht auf Painters Schreibtisch lag auch ein historisches Informationsblatt über das Orakel bei. Darin stand, die Frauen hätten halluzinogene Dämpfe inhaliert, bevor sie die Fragen der Bittsteller beantworteten. Ihre Prophezeiungen waren jedoch mehr gewesen als reine Wahrsagerei, denn sie hatten großen Einfluss auf den Gang der Geschichte gehabt. »Im Laufe von tausend Jahren spielten die Prophezeiungen des Orakels eine Rolle bei der Befreiung vieler tausend Sklaven. Es legte die Saat für die Demokratie westlicher Prägung und setzte sich ein für die Unverletzlichkeit des menschlichen Lebens. Manche Leute sind der Ansicht, das Orakel sei maßgeblich daran beteiligt gewesen, dass Griechenland den Übergang von der Barbarei zur modernen Zivilisation geschafft hat.«
»Aber was ist mit dem großen E in der Mitte des Tempels?«, fragte Gray. »Ich nehme an, das ist der griechische Buchstabe Epsilon.«
»Ja. Der steht ebenfalls in Beziehung zum Tempel des Orakels. Man hat dort einige Inschriften gefunden: Gnothi seauton, was so viel bedeutet wie …«
»Erkenne dich selbst«, beendete Gray an seiner Stelle den Satz.
Painter nickte. Er rief sich in Erinnerung, dass Gray in der alten Philosophie gut bewandert war. Als er ihn aus dem Leavenworth Gefängnis holte, hatte Gray gerade Chemie und Taoismus studiert. Grays einzigartige Denkweise hatte Painter von Anfang an fasziniert. Allerdings hatten derlei Vorzüge auch ihren Preis. Gray arbeitete nicht immer gut im Team, wie er in den vergangenen Wochen wieder einmal unter Beweis gestellt hatte. Es tat gut zu erleben, dass er sich wieder dem Hier und Jetzt zuwandte.
»Und dann war da noch dieses mysteriöse E«, fuhr Painter fort und deutete mit dem Kinn auf die Münze. »Es war in die Wand des innersten Heiligtums eingeritzt.«
»Und was bedeutet es?«
Painter zuckte mit den Schultern. »Das weiß niemand. Nicht einmal die Griechen selbst. Seit Plutarch, dem griechischen Gelehrten, haben Historiker die verschiedensten Spekulationen angestellt. Bei den Gegenwartshistorikern herrscht die Ansicht vor, es müsse einmal zwei Buchstaben gegeben haben. Ein E und ein G, das Zeichen der Erdgöttin Gaia. Der erste Tempel von Delphi wurde Gaia zu Ehren errichtet.«
»Wenn die Bedeutung unklar ist, weshalb wurde der Buchstabe dann auf der Münze abgebildet?«