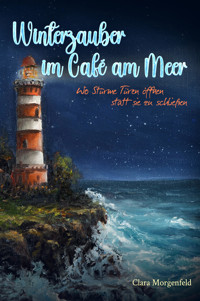8,99 €
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mara funktioniert. Sie lebt, plant, erledigt – und verliert sich dabei immer mehr aus den Augen. Erst der Tod einer alten Vertrauten bringt etwas in Bewegung, das sie lange überhört hat: ein unscheinbares, abgenutztes Notizbuch. Darin keine Rezepte für ein besseres Leben, keine schnellen Lösungen, sondern hundert kleine Aufgaben. Leise. Einfach. Ehrlich. Zögernd beginnt Mara, ihnen zu folgen. Fünf Minuten stehen bleiben. Einen Satz für sich finden. Nein sagen. Zuhören. Hingucken. Und mit jedem Schritt verändert sich etwas – nicht laut, nicht dramatisch, aber tief. Erinnerungen tauchen auf, alte Träume klopfen an, eine Mentorin tritt in ihr Leben, und zwischen Vergangenheit und Gegenwart entsteht ein neuer, behutsamer Raum: für Wahrheit, für Mut, für Langsamkeit. „Das Notizbuch der kleinen Schritte“ erzählt von einem Weg, der nicht nach Perfektion sucht, sondern nach Echtheit. Von einer Frau, die lernt, sich selbst wieder zu spüren – mit all ihrer Müdigkeit, ihren Fragen und ihrer stillen Sehnsucht nach Bedeutung. Ein berührender Roman über Selbstfürsorge, zweite Chancen und die Kraft kleiner Entscheidungen. Über das Ankommen im eigenen Leben. Und darüber, wie leise Veränderung sein darf, wenn sie echt ist. Dieses Buch ist eine Einladung: Nicht, dich neu zu erfinden – sondern dich wiederzufinden. Für Leser:innen von Janne Mommsen, Julie Leuze und Anne Barns. Ein Herzensbuch für stille Abende – sanft wie Kerzenschein, tief wie das Meer und tröstlich wie ein vertrauter Blick, der dich daran erinnert, wer du bist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Das
Notitzbuch der kleinen Schritte
–
Wie du dich wiederfindest, ohne dich neu erfinden zu müssen
Clara Morgenfeld
Erste Auflage 2025
© 2025 Clara Morgenfeld
Alle Rechte vorbehalten
Der Fund
Der Regen hing schwer über der Stadt, als hätte jemand einen grauen Vorhang über den Tag gezogen. Tropfen perlten an der Fensterscheibe entlang, zogen unentschlossene Bahnen und verschwanden im unsichtbaren Rahmen. Mara saß am Küchentisch, der Laptop aufgeklappt, die Kaffeetasse halb leer, das Mailprogramm geöffnet. Auf dem Bildschirm blinkten ungelesene Nachrichten, Terminerinnerungen, „Dringend“-Markierungen. Ihr Blick glitt darüber, ohne wirklich zu lesen. Das Summen in ihrem Kopf war lauter als alles, was da vor ihr aufleuchtete.
Sie rieb sich die Schläfen. Eigentlich hätte sie längst losmüssen. Der Redaktionsmorgen begann nie zu spät. Nachrichten warteten nicht. Geschichten auch nicht. Zumindest die der anderen nicht. Ihre eigene war irgendwo zwischen Eil-Meldungen und Sonderseiten stecken geblieben.
Das Handy vibrierte neben der Tasse. Mara sah auf das Display und dachte zuerst an eine weitere Erinnerung aus ihrem Kalender. Stattdessen stand dort eine Nummer, die sie nicht kannte.
„Ja, bitte?“ Ihre Stimme klang wacher, als sie sich fühlte.
„Guten Morgen, bin ich mit Frau Mara Thomsen verbunden?“ Die Stimme war ruhig, sachlich, mit diesem Tonfall, der nach Papier und Akten roch.
„Ja.“
„Hier spricht Notar Dr. Albrecht. Es geht um den Nachlass von Frau Ingeborg Falk.“
Der Name traf sie wie ein Stolperstein. Inge. Ihre „Tante“, die eigentlich keine war, aber in ihrer Kindheit oft näher gewirkt hatte als mancher Verwandte. Apfelkuchen, Zigarettenrauch, eine tiefe, warme Stimme. Und Geschichten, immer Geschichten.
„Ist… ist etwas passiert?“ Die Frage war überflüssig, sie kannte die Antwort, bevor sie ausgesprochen wurde.
„Frau Falk ist vor einigen Wochen verstorben“, sagte der Notar. Er ließ eine kleine Pause, als würde er ihr Raum geben, den Satz zu erreichen. „Sie sind in ihrem Testament als Erbin eines persönlichen Gegenstandes genannt. Wenn es Ihnen möglich ist, würde ich Sie gern zu einem kurzen Termin in mein Büro bitten.“
Mara setzte sich aufrechter hin, obwohl ihr innerlich der Boden ein Stück nachgab. Verstorben. Das Wort hing im Raum, schwer wie der Regen draußen. Sie konnte sich nicht erinnern, wann sie zuletzt mit Inge telefoniert hatte. Es musste lange her sein. Zu lange.
Sie vereinbarten einen Termin für den Nachmittag. Nachdem sie aufgelegt hatte, blieb Mara einen Moment einfach sitzen. Die Geräusche der Wohnung wirkten plötzlich lauter – das Summen des Kühlschranks, das Tropfen im Heizungsrohr, das Ticken der Uhr. Sie nahm einen Schluck vom kalt gewordenen Kaffee und konnte den bitteren Geschmack kaum von der Bitterkeit in ihrem Innern unterscheiden.
Inge war tot. Und irgendwo in einem Notariat lag „ein persönlicher Gegenstand“, den sie ihr vermacht hatte. Die Formulierung wirkte nüchtern. Und doch spürte Mara, dass sich dahinter etwas verbarg, das mehr bedeutete als ein zufälliges Stück Erinnerung. Inge war nie beliebig gewesen. Wenn sie etwas tat, hatte es einen Grund.
Auf dem Weg zur Arbeit funktionierte Mara wie immer. Sie schrieb, telefonierte, nickte in Meetings an den richtigen Stellen. Niemand sah, dass in ihr eine Tür aufgegangen war, hinter der sich Trauer und ein leises schlechtes Gewissen staute. Hätte sie sich melden sollen? Hätte sie öfter vorbeifahren müssen? Hätte sie…
Sie unterbrach die Gedankenspirale, indem sie sich auf eine Überschrift konzentrierte. „Wohnungsnot in der Stadt“ blinkte ihr entgegen. Ein weiterer Text, eine weitere Analyse, ein weiterer Tag im gewohnten Tempo.
Doch unter allem blieb das Wissen: Da gab es noch etwas, das auf sie wartete.
Am Nachmittag stand sie vor der schweren Glastür des Notariats. Der Regen hatte aufgehört, aber die Straßen glänzten noch nass. Sie strich sich eine feuchte Haarsträhne aus dem Gesicht, atmete einmal tief durch und trat ein.
Der Empfang roch nach Papier und Möbelpolitur. Eine Frau in einem dunklen Blazer bat sie, kurz Platz zu nehmen, dann öffnete sich eine Bürotür.
„Frau Thomsen?“
Der Mann dahinter war älter, die Haare licht, die Brille schmal. Er erhob sich, reichte ihr die Hand, sprach ein formelles Beileid aus. Mara nickte, sagte Danke, fühlte sich, als stünde sie neben sich selbst und beobachte eine Szene, die jemand anders betraf.
Die eigentliche Abwicklung ging schnell. Ein paar Sätze aus dem Testament, eine Unterschrift. Dann öffnete der Notar eine Schublade und holte ein flaches, schmales Kästchen hervor.
„Ihre Tante hat verfügt, dass Sie dies erhalten“, sagte er. „Sie hat außerdem vermerken lassen, dass es Ihnen helfen soll, ‚Ihre eigenen Schritte wieder wahrzunehmen‘.“
Mara sah ihn an. „Das hat sie so formuliert?“
„Genau so.“ Er schob das Kästchen zu ihr hinüber. „Sie können es gern hier öffnen, wenn Sie möchten. Es ist nichts… Dramatisches. Aber offenbar etwas, das ihr am Herzen lag.“
Sie legte die Fingerspitzen auf den Deckel. Das Material fühlte sich kühl an, glatt, ohne Verzierungen. Ein Augenblick lang verspürte sie den Impuls, das Kästchen einfach einzustecken und zu gehen. Später, dachte sie. Wenn ich mehr Ruhe habe. Wenn ich bereit bin.
Doch „später“ war ein Wort, das in den letzten Jahren zu oft alles verdeckt hatte, was wichtig gewesen wäre. Später telefonieren. Später besuchen. Später anfangen.
Sie hob den Deckel.
Innen lag ein Notizbuch.
Es war unspektakulär und doch auf eine seltsame Weise schön. Der Einband war in ein verblasstes Blau gehüllt, das an Jeans erinnerte, die man zu oft getragen hatte, oder an Sommerhimmel, an die sich niemand mehr genau erinnerte. Die Ecken waren abgenutzt, die Kanten weich.
Mara holte es vorsichtig heraus, als könnte es zerbrechen.
In diesem Moment – mit dem Gewicht des Notizbuchs in ihrer Hand, dem Geruch von Papier in der Luft und dem leisen Ticken der Uhr an der Wand – verschob sich etwas in ihr. Kein Donnerschlag, kein großer Schock. Eher ein inneres Klicken, als hätte jemand einen längst verstaubten Schalter umgelegt.
Sie konnte es nicht benennen, aber sie spürte: Dies hier war mehr als ein Erinnerungsstück. Es war eine Art Angebot. Vielleicht ein letzter Rat. Vielleicht eine leise Aufforderung. Vielleicht beides.
„Danke“, sagte sie leise.
Der Notar nickte. „Ihre Tante hat oft von Ihnen gesprochen“, fügte er hinzu. „Sie war stolz auf Sie.“
Der Satz ging ihr näher, als sie erwartet hatte. Stolz. Auf das Leben, das sie führte? Oder vielleicht auf etwas, das sie längst vergessen hatte?
Draußen vor dem Gebäude blieb sie einen Moment stehen. Menschen eilten an ihr vorbei, Autos rauschten, irgendwo schlug eine Tür. Sie hielt das Notizbuch fest an sich gedrückt, als müsste sie verhindern, dass der Regen, der wieder eingesetzt hatte, etwas davon wegwusch.
Der Moment, der alles verschob, sah von außen aus wie jede andere Szene auf einer nassen Stadtstraße. Eine Frau, die aus einem Bürogebäude trat, ein Buch im Arm. Niemand blieb stehen. Niemand ahnte, dass ihr Leben gerade eine leise neue Richtung genommen hatte.
Nur sie spürte es. Ganz tief, halb Angst, halb Hoffnung.
Das Notizbuch lag auf ihrem Küchentisch, als wäre es schon immer dort gewesen. Neben ihr stand eine Tasse Tee, der vor sich hin dampfte, vergessen. Mara hatte das Licht über dem Tisch eingeschaltet, obwohl es dafür noch zu früh war. Es war mehr ein Reflex als eine Notwendigkeit gewesen – als müsste sie den Raum heller machen, um sich an dieses Fremde nicht zu nah heranzutrauen.
Sie setzte sich, zog den Stuhl näher an den Tisch. Eine Weile betrachtete sie das Buch nur. Den Einband, die leicht aufgeplatzte Stelle am Rücken, eine Stelle am Rand, an der sich ein dunkler Fleck befand. Tinte, vielleicht. Oder Kaffee. Oder beides.
Es sah benutzt aus, aber nicht nachlässig. Eher wie etwas, das über Jahre hinweg oft in die Hand genommen worden war. Ein Gebrauchsgegenstand, keine Dekoration.
Mara strich mit dem Daumen über eine abgeriebene Ecke. Sie konnte Inge förmlich vor sich sehen: wie sie am Küchentisch saß, eine Zigarette im Aschenbecher, einen Stift in der Hand, den Blick konzentriert, manchmal mit diesem schiefen Lächeln, wenn ihr ein Satz gefiel.
„Schreib, was wahr ist“, hatte sie früher oft gesagt. „Der Rest langweilt nur.“
Mara atmete tief durch und schlug das Notizbuch auf.
Auf der Innenseite des Deckels stand eine Zeile in Inges Handschrift. Die Buchstaben waren ein wenig zittriger als in Maras Erinnerung, aber unverkennbar:
Für Mara. Für deine eigenen Schritte. Du bist näher dran, als du glaubst.
Sie las den Satz zweimal, dreimal. Ihre Kehle wurde eng. Sie hatte nicht damit gerechnet, direkt angesprochen zu werden, so nah, so vertraut. Für einen Moment fühlte sie sich wieder wie das Mädchen, das in Inges Küche saß und heimlich die letzte Ecke vom Kuchen stibitzte.
Darunter stand eine Jahreszahl. Mara runzelte die Stirn. Das Notizbuch war deutlich älter, als sie vermutet hätte. Viele Jahre. Es war nicht in den letzten Monaten entstanden, nicht in einem Anflug von plötzlicher Weitsicht kurz vor dem Tod. Es hatte lange auf sie gewartet.
Sie blätterte die erste Seite um. Das Papier war leicht vergilbt, aber angenehm glatt. Keine Tagebuch-Einträge, keine Datumsangaben. Stattdessen stand mittig auf der Seite – eingerahmt von viel Weiß – ein einziger Satz.
Er wirkte so schlicht, dass sie im ersten Moment fast enttäuscht war. Wie konnte etwas, das sich so bedeutungsvoll anfühlte, mit einem so einfachen Satz beginnen?
Dann las sie.
Und las noch einmal.
Und spürte, wie die Enttäuschung einem anderen Gefühl wich.
Der Satz lautete:
Beginne dort, wo du gerade bist.
Sie saß da, das Notizbuch vor sich, den Stift noch unangerührt neben dem Rand, und ließ diese sieben Worte in sich sinken. Ihr erster Reflex war beruflich konditioniert: Zu banal, dachte sie. Zu platt. Ein Satz für Kalenderblätter und Motivationsposter.
Doch je länger sie hinsah, desto weniger passte er in diese Schublade. Vielleicht, weil sie wusste, wer ihn geschrieben hatte. Inge hatte nie Geduld für Floskeln gehabt. Wenn sie etwas aufschrieb, dann, weil es für sie eine gelebte Wahrheit war. Keine Dekoration.
Beginne dort, wo du gerade bist.
Nicht: Warte, bis du soweit bist. Nicht: Fang an, wenn du mehr Zeit hast. Nicht: Änder erst alles, dann leg los.
Dort, wo du gerade bist. Mitten im Chaos. Mitten in der Müdigkeit. Mitten im Halbfertigen. Mitten in einem Leben, das von außen betrachtet in Ordnung wirkt und sich von innen oft verloren anfühlt.
Mara merkte, wie sich ihr Atem vertiefte. Es war, als hätte der Satz eine kleine Lampe in einen Raum gestellt, den sie bisher nur im Dunkeln betreten hatte. Nicht, weil sie ihn nicht kannte, sondern weil sie ihn gemieden hatte.
Sie schluckte. Ein Teil von ihr wollte das Notizbuch wieder zuklappen, so tun, als wäre nichts gewesen, als wäre das hier nur eine sentimentale Geste einer alten Frau, die die Welt zu rosig sah. Ein anderer Teil aber – der Teil, der nachts nicht schlafen konnte, obwohl er todmüde war – blieb.
Sie blätterte weiter. Auf der nächsten Seite stand eine kurze Erklärung, wieder in Inges Schrift. Keine langen Sätze, keine komplizierten Gedanken. Nur eine Art Einführung, ruhig und direkt:
Du wartest vielleicht darauf, dass sich etwas Großes ändert, bevor du losgehst. Mehr Mut, mehr Zeit, mehr Klarheit, mehr Irgendwas. Ich habe mein Leben damit verbracht zu merken: Das Große kommt selten zuerst. Es beginnt fast immer mit etwas Kleinem, das du lange unterschätzt. Eine Entscheidung. Ein Satz. Ein Schritt.
Mara spürte, wie sich ihre Augen mit einem Brennen meldeten, das sie seit Monaten erfolgreich wegorganisiert hatte.
Unter dem Text folgte eine leicht eingerückte Zeile:
In diesem Notizbuch findest du 100 kleine Aufgaben. Sie sind nicht dazu da, dich zu optimieren. Sie sind dazu da, dich zu erinnern. An dich. An das, was leise ist. An das, was bleibt, wenn der Lärm vorbei ist. Wenn du willst, geh sie nacheinander durch. Wenn du willst, schlägst du irgendwo auf. Aber bitte, mein Kind: Sei ehrlich zu dir. Dieses Notizbuch hält viel aus – Lügen gehören nicht dazu.
Mein Kind.
Mara legte eine Hand an ihr Gesicht, als müsste sie sich vergewissern, dass sie noch hier war. Niemand nannte sie mehr so. Niemand durfte das. Es war ein Wort aus einer anderen Zeit. Und doch traf es sie mit einer Wärme, die sie nicht erwartet hatte.
Sie blätterte weiter, sah, wie jede Seite oben eine Zahl trug. 1. 2. 3. Darunter kurze Sätze. Aufgaben. Darunter leere Linien, Platz für Antworten, Notizen, Widerstände.
Es war kein Tagebuch im klassischen Sinne. Es war ein Gesprächsangebot.
Mit ihrer Tante. Mit den Aufgaben. Vor allem aber mit sich selbst.
Mara atmete tief ein, tief aus. Ihre Finger lagen am Rand der Seite mit der Nummer 1. Ein kleiner Teil von ihr war neugierig. Ein größerer Teil hatte Angst. Wovor genau, wusste sie nicht. Vielleicht davor, dass sich wirklich etwas ändern könnte, wenn sie sich darauf einließ.
Sie senkte den Blick. Und begann zu lesen.
Im Grunde war es nur ein Notizbuch. Papier, Tinte, Worte. Und doch war es zugleich etwas anderes: der erste Satz auf einem Weg, den sie noch nicht kannte – und der genau dort begann, wo sie gerade war.
Der Moment, der alles verschiebt
In der Nacht, nachdem Mara das Notizbuch zum ersten Mal aufgeschlagen hatte, schlief sie schlecht. Nicht, weil etwas Dramatisches passiert wäre. Es gab keinen äußeren Grund. Kein Streit, keine Katastrophe, keine Nachricht, die ihr Leben von einer Sekunde auf die andere umkrempelte. Es war eher, als hätte jemand in einem sehr alten Haus eine Tür geöffnet, die lange verschlossen gewesen war – und nun wehte ein Luftzug durch Räume, die sie vergessen hatte.
Sie lag im Dunkeln, die Decke bis zum Kinn gezogen, der Schein der Straßenlaterne zeichnete hellere Rechtecke auf die Zimmerdecke. Neben ihr auf dem Nachttisch lag das Notizbuch. Sie konnte es nicht sehen, aber sie wusste genau, wo es lag. Der Gedanke war fast körperlich spürbar, wie eine leise Anziehung, die nichts forderte und doch da war. Anfangs hatte sie noch versucht, ihre Gedanken zu ordnen. Sie hatte sich eingeredet, es sei ganz normal, dass so eine Nachricht – der Tod von Inge, das Testament, das unerwartete Geschenk – sie durcheinanderbrachte. Dass sich das wieder legen würde. Schließlich war sie Profi darin geworden, Dinge gedanklich in Schubladen zu legen, zu etikettieren und weiterzumachen. „Später“, hatte sie sich gesagt. Wieder einmal.
Doch je länger sie da lag, desto weniger funktionierte das. Immer wieder tauchte der Satz auf, den sie im Notizbuch gelesen hatte: Beginne dort, wo du gerade bist. Es war, als würde jemand diesen Satz in ihrem Kopf in regelmäßigen Abständen wiederholen. Nicht laut, nicht aufdringlich. Eher wie eine Hintergrundmelodie, die sich nicht abstellen ließ. Sie drehte sich auf die andere Seite, versuchte, an den nächsten Tag zu denken. Konferenz um neun, Hintergrundstück zur Verkehrspolitik, ein Interview, das sie schon zweimal verschoben hatte. Termine, Überschriften, Deadlines – das vertraute Raster ihres Alltags.
Aber selbst in dieser Liste schob sich der Satz dazwischen, wie eine Fußnote, die auf einmal wichtiger war als der Haupttext. Beginne dort, wo du gerade bist. Nicht dort, wo du glaubst, sein zu müssen. Nicht dort, wo andere dich sehen wollen. Dort, wo du jetzt bist: müde, überdreht, irgendwie erfolgreich und gleichzeitig seltsam leer.
Irgendwann drehte sie sich noch einmal auf den Rücken und streckte die Hand zum Nachttisch aus. Ihre Finger fanden das Buch sofort. Sie brauchte kein Licht, um den Einband zu ertasten, die weiche, abgenutzte Oberfläche, die vertraute Fremdheit. Einen Moment lang hielt sie es einfach nur fest, spürte das Gewicht in ihrer Hand. Dann legte sie es zurück. „Morgen“, murmelte sie. Und zum ersten Mal seit langer Zeit merkte sie, dass sie dieses Morgen nicht als Drohung, sondern als Möglichkeit dachte.
Als der Wecker sie weckte, fühlte sie sich, als wäre sie mitten aus einem unaufgeräumten Traum gerissen worden. Ihr erster Impuls war der alte Reflex: Hand ausgestreckt, Snooze-Taste, fünf Minuten mehr, in denen sich nichts wirklich erholte. Doch bevor sie den Knopf berühren konnte, fiel ihr ein, was neben ihrem Bett lag. Sie hielt inne. Es waren nur ein paar Sekunden, aber sie fühlten sich länger an.
Sie richtete sich auf, rieb sich die Augen und griff nach dem Notizbuch. Das Papier war im Morgenlicht anders als am Abend zuvor. Heller, nüchterner. Als wolle es ihr sagen: Jetzt ist kein sentimentaler Abend mehr, jetzt ist Alltag. Und, was machst du jetzt mit mir?
Mara blätterte zurück zur ersten Aufgabe, ohne groß darüber nachzudenken. Seite 1. Oben eine schlichte Handzahl. Darunter Inges Schrift, ruhig, fest, minimal schief nach rechts geneigt. Sie las die Zeile und spürte, wie sich ihre Lippen unwillkürlich zu einem kaum wahrnehmbaren Lächeln verzogen. Es war ein so kleiner Satz, dass er beinahe übersehen werden konnte. Ein Satz, den sie schon tausendmal jemandem hätte empfehlen können – in einem Ratgeberartikel, in einer Kolumne, in einem Interview mit irgendeinem Life-Coach. Aber jetzt war er nicht an „die Leserinnen und Leser“ gerichtet. Er war an sie gerichtet.
Sie las ihn noch einmal. Dann klappte sie das Buch zu. Nicht aus Ablehnung, eher aus einer Art Respekt. Es fühlte sich falsch an, den Satz einfach so nebenbei zu überfliegen, während der Wecker noch seine zweite Erinnerung schickte. Wenn das hier etwas verändern sollte – und ein leiser Teil von ihr hoffte, dass es das könnte –, dann wollte sie es nicht zwischen Zähneputzen und E-Mail-Check erledigen.
Im Bad betrachtete sie ihr Gesicht im Spiegel. Sie sah die gewohnten Dinge: die leichter gewordenen Schatten unter den Augen, kleine Fältchen an der Stirn, die sich immer dann zeigten, wenn sie zu lange konzentriert auf einen Bildschirm gestarrt hatte. Es war kein schlechtes Gesicht, dachte sie. Nur ein Gesicht, das sich selbst aus den Augen verloren hatte. „Beginne dort, wo du gerade bist“, murmelte sie vor sich hin, fast spöttisch. „Na dann: hier.“
Sie fuhr zur Arbeit, stand im Stau, hörte Nachrichten, die sich anfühlten wie ein endloses Echo derselben Themen. Krise hier, Konflikt dort, Kommentar auf Kommentar. Es war der vertraute Klang ihres Berufs. Normalerweise schaltete sie an dieser Stelle innerlich in den Modus, den sie „berufliche Klarheit“ nannte. Eine Mischung aus Distanz, Analyse und der Fähigkeit, auch aus dem kompliziertesten Sachverhalt eine verständliche Geschichte zu machen. Heute jedoch blieb etwas quer. Nicht laut. Nur quer.
Im Büro begrüßten sie Kolleginnen und Kollegen, es gab ein kurzes Schulterklopfen, ein flüchtiges „Alles gut bei dir?“, auf das sie wie automatisch mit „Klar“ antwortete. Niemand fragte nach, niemand bohrte nach. Sie hatten alle ihre eigenen Eilmeldungen, ihre eigenen inneren Staus. Die Konferenz verlief wie immer: Themen, Prioritäten, Zeitpläne. Mara machte sich Notizen, nickte an den richtigen Stellen, stellte ein, zwei kluge Fragen, die sie selbst kaum hörte. In einer kurzen Pause griff sie in ihre Tasche, ertastete den bekannten Einband des Notizbuchs und ließ die Finger kurz darauf ruhen. Allein die Berührung reichte, um den Geräuschpegel um sie herum für einen Augenblick leiser erscheinen zu lassen.
Der Moment, der alles verschiebt, kommt selten mit Fanfaren, dachte sie später. Er kommt nicht mit einem klaren „Davor“ und „Danach“, das sich eindeutig markieren lässt. Er beginnt oft mit einem sehr unspektakulären Satz in einem sehr gewöhnlichen Moment. In ihrem Fall begann er nach der Konferenz, als sie mit einer Kollegin im Flur stand und auf die Kaffeemaschine wartete.
„Du siehst müde aus“, sagte die Kollegin, mehr beiläufig als besorgt. „Wieder zu viel los?“
Mara setzte zu der üblichen Antwort an – etwas mit „Ja, aber das kennst du ja“ und einem dünnen Lächeln. Doch bevor sie sprechen konnte, flackerte in ihrem Kopf ein anderer Satz auf: Sei ehrlich zu dir. Es war eine der Zeilen aus Inges Einleitung, die sie am Abend zuvor gelesen hatte. Und plötzlich hörte sie sich etwas sagen, das sie selbst überraschte.
„Ich glaube, ich bin nicht nur müde“, sagte sie. „Ich bin… leer.“
Die Kollegin blinzelte. Die Kaffeemaschine zischte, irgendwo im Großraumbüro lachte jemand zu laut. „Oh“, sagte sie nach einem Moment. Es klang nicht abwehrend, eher irritiert. „Okay. Soll ich dir später noch was abnehmen beim Layout?“
Mara schüttelte den Kopf. „Schon gut“, sagte sie schnell. „War nur so ein Gedanke.“ Sie winkte ab, nahm ihre Tasse und ging zurück an ihren Platz. Aber die Worte hingen nach. Ich bin leer. Es war das erste Mal seit langer Zeit, dass sie dieses Gefühl nicht nur innerlich als diffuses Unbehagen wahrnahm, sondern es aussprach. Laut. Vor einem anderen Menschen.
Dieser Satz war unscheinbar. Er veränderte nicht sofort ihren Alltag. Niemand im Büro hielt plötzlich inne, niemand fragte, ob sie eine Auszeit brauchte, niemand legte ihr die Hand auf die Schulter und sagte, sie solle erst einmal durchatmen. Das Leben lief weiter: Artikel, Mails, Anrufe. Und doch war da etwas, das sich verschoben hatte. Eine Mini-Verschiebung, kaum sichtbar, aber spürbar.
Am späten Nachmittag, als der innere Lärm seinen üblichen Höhepunkt erreicht hatte, merkte sie, dass sie mit den Gedanken immer wieder zu dem Notizbuch zurückkehrte. Es lag in ihrer Tasche, eingeklemmt zwischen Laptop und Wasserflasche. Ein stiller Gegenstand inmitten eines Tages, der von Terminen strukturiert war.
Als sie sich auf den Heimweg machte, war der Himmel noch immer grau, aber heller als am Vortag. In der U-Bahn war es voll, die Menschen standen dicht an dicht, starrten auf Bildschirme, hörten Musik, telefonierten halblaut. Mara hielt sich an einer Stange fest, die andere Hand lag auf der Tasche. Sie spürte das Buch darunter, als wäre es ein Herzschlag. Eine ältere Frau ihr gegenüber hatte die Augen geschlossen, die Stirn an die Fensterscheibe gelehnt. Ein junger Mann tippte in atemberaubendem Tempo Nachrichten, ein Kind zählte die Stationen laut mit. Alltag. Ein bewegtes Standbild.
Und mittendrin kam er: dieser Moment. Kein Blitz, kein plötzlicher Entschluss, der sich wie eine Offenbarung anfühlte. Es war eher, als würde jemand innerlich eine sehr einfache Frage stellen: Willst du wirklich so weitermachen?
Nicht heute und morgen – das wusste sie, dass sie da durchkam. Sie war gut darin, weiterzumachen. Sondern: so. In diesem Modus. In diesem Tempo. Mit dieser seltsamen Mischung aus funktionierender Effizienz und innerer Abwesenheit.
Mara ließ den Blick durch den Waggon schweifen. All diese Gesichter, all diese Geschichten, die sie beruflich so gern erzählte, wenn sie in Porträts und Reportagen schrieb. Sie liebte es, anderen Menschen zuzuhören, ihre Wendepunkte zu beschreiben, ihre Entscheidungen zu beleuchten. „Der Moment, der alles veränderte“ – wie oft hatte sie solche Formulierungen in Artikeln verwendet. Wie oft hatte sie fremde Leuchtmomente sortiert, ohne sich zu fragen, wo ihre eigenen geblieben waren.
Beginne dort, wo du gerade bist.
Zum ersten Mal an diesem Tag nahm sie den Satz nicht nur als Gedanken wahr, sondern als eine Art inneres Angebot. Sie musste dafür nichts vorbereiten, nichts kündigen, nichts Großes planen. Sie musste auch nicht sofort „ihr Leben ändern“. Alles, was sie tun musste, war, einen einzigen, kleinen Schritt ernst zu nehmen.
Die U-Bahn erreichte ihre Station. Die Türen gingen auf, die Menschen drängten hinaus, hinein, weiter. Mara stieg aus, ließ sich von der Bewegung mitreißen, stieg die Treppe hinauf. Draußen war die Luft kühler als erwartet, ein Windstoß strich ihr durchs Haar. Sie blieb an der Ampel stehen, wartete auf Grün, und als sie losging, merkte sie, dass irgendetwas in ihrem Innern eine Entscheidung getroffen hatte, ohne sie groß zu fragen.
Zu Hause stellte sie die Tasche auf den Tisch, zog Jacke und Schuhe aus, stellte Wasser für Tee auf, fast automatisch. Der Fernseher blieb aus. Stattdessen nahm sie das Notizbuch aus der Tasche und legte es in die Mitte des Küchentisches. Diesmal setzte sie sich nicht einfach nur davor. Sie holte einen Stift aus der Schublade, drehte ihn zwischen den Fingern, als müsste sie ausprobieren, ob er noch schrieb.
Sie schlug die erste Seite mit der Aufgabe auf. Las den Satz. Diesmal wich sie nicht aus. Sie spürte, wie ein Teil von ihr Widerstand leisten wollte – mit all den üblichen Argumenten: keine Zeit, lächerlich, sentimentaler Unsinn. Aber etwas in ihr war an diesem Tag schon zu weit gegangen, um noch glaubwürdig zurückzurudern. Sie hatte sich das Wort „leer“ abgerungen, hatte zum ersten Mal wirklich zugehört, was da in ihr sprach.
Der Moment, der alles verschiebt, war vielleicht genau dieser hier: Sie beschloss, sich selbst ernst zu nehmen. Nicht irgendwann, nicht „wenn es ruhiger wird“, nicht im nächsten Urlaub. Jetzt. An einem grauen Abend, an einem ganz gewöhnlichen Küchentisch, mitten in einem Leben, das von außen betrachtet normal weiterlief.
Sie legte die Hand flach auf die Seite, auf der die erste Aufgabe stand. Atmete ein. Atmete aus. Dann nickte sie, obwohl niemand da war, der es sehen konnte.
„Okay“, sagte sie leise. „Ich fang an.“
Es waren nur vier Worte. Kein Mensch hatte sie gehört. Und doch markierten sie eine unsichtbare Linie in ihrem Leben: ein Davor, in dem sie ständig später sagen wollte – und ein Danach, in dem sie zum ersten Mal bereit war, tatsächlich dort zu beginnen, wo sie gerade war.
Sie griff nach dem Stift. Und machte sich bereit für den ersten kleinen Schritt.
Das Notizbuch mit den vergilbten Rändern
Mara saß am Küchentisch und betrachtete das Notizbuch, als wäre es ein fremdes Wesen, das sich in ihre Wohnung geschlichen hatte und nun still darauf wartete, erkannt zu werden. Das Licht der kleinen Hängelampe fiel schräg auf den Tisch, ließ das Holz warm und weich wirken, während draußen die Geräusche der Stadt langsam verebbten. Ein paar Autos zogen noch vorbei, irgendwo schlug eine Haustür, ein fernes Lachen wehte durch das offene Fenster. Doch in ihrer Küche war es still. Nicht diese bedrückende, schwere Stille, die sie sonst oft begleitete, sondern eine, die Raum ließ. Raum für etwas, das sie noch nicht benennen konnte.
Sie schob das Notizbuch ein kleines Stück näher zu sich heran. Es lag da, unscheinbar und doch voller Geschichten. Der Einband war nicht glatt oder neu, sondern von Jahren gezeichnet. Die Farbe hatte sich an manchen Stellen fast vollständig verabschiedet, andere Partien wirkten wie von zahllosen Händen berührt, immer wieder aufgehoben, abgelegt, weitergereicht. Die Ränder der Seiten waren vergilbt, leicht wellig, als hätten sie vieles gesehen, vieles behalten – und trotzdem geduldig gewartet.
Mara ließ ihre Fingerspitzen langsam über den Rand gleiten. Das Papier fühlte sich anders an als das, auf dem sie täglich schrieb, härter und doch vertrauter, als trüge es Wärme in sich. Sie musste an Inges Hände denken. An die Art, wie sie früher ihre Notizbücher hielt, leicht schräg, immer mit einem Stift zwischen den Fingern, bereit, einen Gedanken einzufangen, bevor er sich wieder verflüchtigte. Inge hatte nie viel von großen Worten gehalten. Sie liebte leise Dinge. Dinge, die nicht gleich auffielen, aber blieben.
„Alles, was wirklich wichtig ist, hinterlässt Spuren“, hatte sie einmal gesagt, als Mara sie gefragt hatte, warum sie ihre alten Bücher nicht einfach ersetzte. „Und wenn du genau hinsiehst, erzählen dir diese Spuren viel mehr als jede neue Verpackung.“
Jetzt, Jahre später, saß sie da und hielt ein solches Stück Vergangenheit in den Händen. Ein Notizbuch voller Spuren. Voller unsichtbarer Geschichten. Und vielleicht voller Antworten, die Mara längst gesucht, aber nie zu stellen gewagt hatte.
Sie schlug das Buch erneut auf, diesmal nicht mit der Eile des neugierigen ersten Blicks, sondern mit der Vorsicht von jemandem, der ahnt, dass hier etwas verborgen liegt, das Respekt verdient. Ihre Augen glitten über die Seite mit der ersten Aufgabe, doch diesmal blieb ihr Blick nicht an den Worten hängen. Stattdessen betrachtete sie das Papier selbst. Die leichte Verfärbung, die kleinen Unregelmäßigkeiten, winzige Flecken, kaum sichtbar und doch da. Vielleicht ein Tropfen Tee. Vielleicht ein verwischter Tintenrest. Vielleicht eine Träne. Inges Träne?
Der Gedanke ließ sie innehalten. Sie fragte sich, in welchen Momenten dieses Notizbuch entstanden war. Ob Inge es in stillen Nächten beschrieben hatte, wenn die Welt draußen ruhig war und nur der Mond durchs Fenster fiel. Oder an sonnigen Nachmittagen, wenn sie am Küchentisch saß, eine Zigarette zwischen den Fingern, die Gedanken klar und wach.
Mara blätterte weiter, ohne konkret etwas zu lesen. Sie ließ sich treiben, von Seite zu Seite, wie bei einem Spaziergang durch eine Landschaft, die sie noch nicht verstand, aber spürte. Immer wieder blieb sie an den vergilbten Rändern hängen. Sie wirkten wie ein Rahmen um das, was darin stand. Ein stiller Zeuge der Zeit. Ein Zeichen dafür, dass diese Worte nicht für den schnellen Konsum gedacht waren, sondern für ein langsames Hineinwachsen.
Ihr Blick blieb an einer Seite hängen, auf der nichts geschrieben war. Oder vielleicht doch? Sie beugte sich näher heran, strich mit den Fingern sanft darüber. Da waren feine Eindrücke, kaum sichtbar, als hätte einst jemand hier geschrieben und die Worte wieder entfernt. Spuren von Druck, von Zögern, von etwas, das vielleicht nie ganz ausgesprochen worden war. Mara stellte sich vor, wie Inge mit dem Stift über dem Papier schwebte, unsicher, ob sie diesen Gedanken wirklich festhalten wollte. Wie sie ihn vielleicht wieder durchstrichen hatte, weil er zu wahr war, zu nah.
Ein Beweis dafür, dass auch Inge gezweifelt hatte. Dass dieses Notizbuch nicht aus einer perfekten Weisheit heraus entstanden war, sondern aus einem echten Leben. Mit Brüchen. Mit Fragen. Mit Mut und mit Angst.
Mara lehnte sich zurück und ließ den Blick durch ihre Küche schweifen. Alles sah plötzlich ein wenig anders aus. Der Tisch, auf dem sie so viele hastige Mahlzeiten eingenommen hatte. Der Stuhl, auf dem sie oft mit dem Laptop balancierte, während sie noch schnell einen Artikel korrigierte. Alles wirkte noch immer vertraut, aber als hätte sich eine unsichtbare Schicht darübergelegt. Eine leise Einladung, genauer hinzusehen. Auch hier. Auch bei sich.
Sie nahm das Notizbuch wieder auf und wog es kurz in ihrer Hand. Es war nicht schwer, aber es fühlte sich bedeutungsvoll an. Als würde es mehr tragen als nur Papier und Tinte. Als läge darin ein stiller Plan, den nur sie entschlüsseln konnte.
„Du bist näher dran, als du glaubst.“
Der Satz aus Inges Widmung tauchte wieder in ihr auf. Was hatte sie damit gemeint? Näher dran an was? An sich selbst? An einem mutigeren Leben? An einer Entscheidung, die sie längst vor sich herschob?
Mara schlug das Buch auf und blieb auf einer Seite stehen, die keine Aufgabe enthielt, sondern nur eine kleine Randnotiz, schräg und fast zärtlich geschrieben:Vergiss nicht: Auch die Ränder gehören zum Bild.
Sie runzelte die Stirn und lächelte gleichzeitig. Inge und ihre kleinen Lebensweisheiten. Wie oft hatte sie diese erst Jahre später wirklich verstanden. Auch die Ränder gehören zum Bild. Vielleicht ging es nicht nur um das Notizbuch. Vielleicht ging es um all das, was Mara bis dahin als nebensächlich, als unwichtig abgetan hatte. Ihre Müdigkeit. Ihre Sehnsucht nach Ruhe. Diese leisen Zweifel, die sie stets mit Lautstärke und Effizienz übertönt hatte.
Vielleicht gehörten genau sie auch dazu. Zu ihrem Bild. Zu ihrem Leben.
Sie dachte an die vergangenen Jahre. An den Weg, der sie scheinbar genau dorthin geführt hatte, wo sie immer hatte sein wollen: in einem angesehenen Job, unabhängig, kompetent, gefragt. Und doch war da dieses Gefühl geblieben, als würde sie ständig auf einer Bühne stehen, eine Rolle spielen, die sie irgendwann verlernt hatte zu hinterfragen.
Vor ihr lag nun dieses Notizbuch mit den vergilbten Rändern. Ein stiller Gegenentwurf zu ihrer Welt aus E-Mails und Deadlines. Kein Kalender. Keine To-do-Liste. Kein Zeitmanagement-Tool. Sondern eine Einladung, sich Zeit zu nehmen. Für Fragen, für Ehrlichkeit, für diese kleinen Schritte, die sich nicht messen, aber spüren ließen.
Sie blätterte weiter und ließ die Zahlen der Aufgaben an sich vorbeiziehen. 4. 5. 6. Jede Seite ein leeres Feld, das darauf wartete, gefüllt zu werden – nicht mit Perfektion, sondern mit Wahrheit. Und während sie so dasaß, das Buch zwischen den Händen, wurde ihr klar, dass es nicht nur ein Erbstück war.
Es war ein Spiegel.
Ein Spiegel, der nicht zeigte, wie sie aussah, sondern wer sie war. Und vielleicht auch, wer sie sein könnte.
Mara schloss kurz die Augen. Lauschte in die stille Küche, in das leise Ticken der Uhr, in das ferne Rauschen der Stadt. Sie spürte, wie ihre Schultern sich ein wenig entspannten, wie ihr Atem ruhiger wurde. Als hätte allein das Betrachten dieses Notizbuchs etwas in ihr beruhigt, das lange auf Alarm gestanden hatte.
„Ich sehe dich“, flüsterte sie leise und wusste nicht einmal genau, an wen sie diese Worte richtete. An das Buch. An Inge. An sich selbst. Vielleicht an alle drei.
Sie legte das Notizbuch behutsam auf den Tisch, als würde sie einen Schatz ablegen. Nicht aus Angst, sondern aus Achtung. Dann stand sie auf, ging zum Fenster und sah hinaus in die Dämmerung, die sich langsam über die Stadt legte. Die Lichter begannen zu flimmern, Wohnungen wurden zu kleinen, warmen Inseln im Grau.
In diesem Moment wurde ihr klar, dass dieses Notizbuch nicht einfach nur ein Gegenstand war, der in ihr Leben getreten war. Es war eine Brücke. Zwischen der Frau, die sie gewesen war, und der, die sie noch werden konnte. Zwischen dem Tempo, das sie gewohnt war, und der Langsamkeit, die sie insgeheim vermisste.
Die vergilbten Ränder erzählten nicht nur von vergangener Zeit. Sie erzählten davon, dass jedes Leben Schichten hat. Dass nichts neu beginnt, ohne das Alte zu berühren. Und dass genau in diesen Rändern, diesen Übergängen, diese stillen Wahrheiten wohnen, die zu leise sind für den Alltag – und zu wichtig, um sie weiter zu überhören.
Mara kehrte an den Tisch zurück und setzte sich wieder. Sie strich ein letztes Mal über den Einband, als wollte sie sich vergewissern, dass dieses Gefühl real war. Dann nahm sie den Stift zur Hand, schlug die Seite mit der ersten Aufgabe auf und sah ihr entgegen.
Das Notizbuch mit den vergilbten Rändern lag still vor ihr. Und irgendwo zwischen Vergangenheit und Gegenwart begann etwas Neues sich leise zu regen.
Kein großer Umbruch. Kein dramatischer Entschluss. Nur ein stilles Wissen: Sie war angekommen bei etwas, das sie lange gesucht hatte, ohne es benennen zu können.
Und sie war bereit, hinzusehen.
Der erste Satz, der bleibt
Mara starrte auf die Seite, als würde sie gleich anfangen, sich zu bewegen. Die Worte standen in Inges Schrift da, ruhig und klar, ohne Schnörkel, ohne Unterstreichung, ohne den kleinsten Versuch, sich wichtiger zu machen, als sie waren. Nur eine Zahl oben in der Ecke. Und darunter, in der Mitte der Seite, mit viel Weiß drumherum, dieser eine Satz.
Sie las ihn einmal. Sie las ihn noch einmal. Dann ließ sie den Blick schweigend über das leere Papier darunter gleiten, als müsste sie erst prüfen, ob der Satz wirklich aushielt, was er in ihr auslöste.
Bleib heute fünf Minuten stehen.
Mehr nicht. Kein „am besten hier“, kein „am besten dort“. Kein Kontext, keine Erklärung, keine Liste mit möglichen Vorteilen. Kein „Du wirst merken, dass…“, kein psychologischer Hinweis, keine Begründung. Nur diese sieben Worte, die sich auf der vergilbten Seite ausbreiteten, als wären sie größer, als sie aussahen.
„Fünf Minuten“, murmelte Mara. Ihre Stimme klang in der stillen Küche ungewohnt laut. „So schwer kann das ja nicht sein.“
Sie wollte den Satz wegwinken, wie man eine harmlose Fliege vertreibt. Ein Teil von ihr begann sofort, Argumente zu sammeln, reflexartig, geübt: Fünf Minuten, das sei doch nichts. Fünf Minuten habe sie ständig irgendwo zwischendurch. In der Schlange im Supermarkt, im Fahrstuhl, beim Warten auf eine Antwortmail. Fünf Minuten, das sei keine Aufgabe, das sei… Kinderkram.
Und trotzdem blieb da dieses andere Gefühl, das sich nicht wegdiskutieren ließ. Ein winziges Ziehen irgendwo zwischen Brustbein und Kehle. So, als hätte der Satz nicht nur ihre Zeit, sondern auch etwas in ihr selbst gebeten, stehenzubleiben.
Bleib heute fünf Minuten stehen.
Sie lehnte sich zurück, legte den Stift quer über das Notizbuch und sah zur Uhr an der Wand. Halb neun. Normalerweise hätte sie jetzt den Laptop noch einmal aufgeklappt, kurz „nur die wichtigsten Mails“ gecheckt, vielleicht nebenbei eine Serie laufen lassen, um das Gefühl zu haben, sich zu entspannen, während sie innerlich weiter auf Hochtouren lief. Doch heute saß sie einfach da. Zwischen ihr und dem üblichen Abendprogramm lag dieser Satz wie eine unsichtbare Schwelle.
Sie versuchte, sich an den Tag zu erinnern, an dem sie das letzte Mal bewusst stehengeblieben war. Nicht, weil eine Ampel rot war oder der Fahrstuhl klemmte. Sondern weil sie entschieden hatte: Ich halte jetzt an. Nur für mich. Ohne Zweck. Ohne Produktivität. Der Versuch, sich daran zu erinnern, war ernüchternd. Ihre Gedanken liefen rückwärts durch die letzten Wochen, Monate, Jahre – Termine, Artikel, Abgaben, Wochenenden, die mit „Ich müsste dringend mal…“ begannen und mit „Morgen dann“ endeten.
Vielleicht war genau das das Problem. Dass fünf Minuten für sie längst nur noch als Lücken existierten, als zufällige Restzeit zwischen zwei Aufgaben. Nicht als etwas, das man sich schenkt.
Sie nahm den Stift wieder in die Hand, drehte ihn zwischen den Fingern. Unter dem Satz war Platz. Platz für Gedanken, für Widerstände, für Ehrlichkeit. Für einen Moment spielte sie mit dem Gedanken, direkt darunter zu schreiben: „Klingt lächerlich einfach. Und gleichzeitig weiß ich nicht, wann ich das zuletzt gemacht habe.“ Es wäre ein guter Einstieg gewesen. Eine Art ironische Distanz, wie sie sie aus ihren Kolumnen kannte, wenn sie ein Thema leicht und trotzdem ernst einführen wollte.
Stattdessen lag der Stift weiterhin unbenutzt zwischen ihren Fingern. Sie merkte, dass sie auf die Ränder starrte, auf das leichte Vergilben, das Inges Handschrift noch lebendiger wirken ließ. Dieser Satz war nicht gestern entstanden. Er hatte Jahre überdauert. Er war durch Inges Leben gereist, hatte vielleicht schon einmal jemand anderem gegolten, war möglicherweise an einem Tag geschrieben worden, an dem Inge selbst nicht stehengeblieben war. Aber sie hatte ihn festgehalten. Für sich. Für irgendwann. Für Mara.
„Bleib heute fünf Minuten stehen“, wiederholte Mara in Gedanken, dieses Mal langsamer. Jeder Teil des Satzes bekam Gewicht.
Bleib – nicht lauf weiter, nicht funktionier, nicht schieb auf.heute – nicht irgendwann, nicht wenn es passt, nicht, wenn es weniger wird.fünf Minuten – nicht den Rest deines Lebens, nicht eine Woche, nicht einmal eine Stunde.stehen – nicht scrollen, nicht lesen, nicht ablenken. Da sein. Mit dir.
Sie schloss für einen Augenblick die Augen. Spürte das Pochen ihrer Schläfen, den leichten Druck hinter den Augen, den sie inzwischen als „Normalzustand“ verbucht hatte. Wenn sie ehrlich war, hatte sie sich an dieses Grundrauschen aus Anspannung, Müdigkeit und innerer Unruhe gewöhnt. Es gehörte zu ihr wie ihr Name in der Signatur unter ihren Artikeln. Und doch – in den letzten Monaten war manchmal eine Frage dazwischengefunkt: Ist das wirklich alles?
Vielleicht, dachte sie, war dieser Satz nicht nur eine Aufgabe, sondern eine Antwort. Oder zumindest der erste Schritt in Richtung einer Antwort.
Sie öffnete die Augen wieder und nahm den Stift fester in die Hand. Diesmal setzte sie die Spitze tatsächlich aufs Papier. Ihre Handschrift unterschied sich von Inges, war kantiger, etwas eilig, als würde sie selbst beim Schreiben die Uhr im Blick behalten. Unter den Satz schrieb sie:
„Ich weiß nicht, ob ich stehenbleiben kann, ohne sofort weiterzudenken. Aber ich will es versuchen.“
Sie hielt inne, las, was sie geschrieben hatte, und bemerkte erst jetzt, dass sie einen anderen Ton angeschlagen hatte, als sie erwartet hätte. Kein Spott, keine ironische Distanz. Es klang… ehrlich. Fast ein bisschen verletzlich. So schrieb sie sonst nur in Texten, die nie jemand zu sehen bekam. In Mails, die sie nie abschickte. In Gedanken, die sie schnell wieder wegschob.
Der Gedanke, dass Inge genau das gewollt haben könnte – diese Art von Ehrlichkeit –, ließ ihre Kehle wieder enger werden. Sie hörte fast ihre Stimme: „Schreib, was wahr ist. Der Rest langweilt nur.“
Was wahr war, spürte sie in diesem Moment schmerzlich klar: Stehenbleiben bedeutete für sie mehr als einen körperlichen Zustand. Es bedeutete, die inneren Stimmen nicht länger wegzudrücken. Die, die nachts lauter wurden, wenn alles andere endlich schwieg. Die fragen, ob das Tempo, in dem sie lebte, wirklich ihr eigenes war – oder nur eine Übernahme aus einer Welt, in der alle immer „beschäftigt“ waren.
Sie legte den Stift zur Seite, doch dieses Mal klappte sie das Notizbuch nicht zu. Es blieb offen vor ihr liegen, wie eine kleine Vereinbarung. Eine, die niemand unterschrieben hatte, aber die in der Luft lag.
„Gut“, sagte sie, diesmal ohne Ironie. „Fünf Minuten. Heute.“
Sie sah auf die Uhr. Halb neun war inzwischen zu sechsunddreißig nach geworden. In ihrem alten Modus hätte sie gedacht: Der Tag ist doch praktisch vorbei. Was soll jetzt noch groß passieren? Aber der Satz in dem Notizbuch hatte etwas in ihr verschoben. Fünf Minuten waren kein Tagesprogramm. Sie waren ein Punkt. Ein klarer, gesetzter Punkt in einem sonst fließenden Text.
Die Frage war: Wo? Wo in diesem Tag, der sich bereits seinem Ende näherte, würde sie diese fünf Minuten unterbringen? Sie konnte sich vorstellen, wie Inge bei dieser Frage gelächelt hätte. „Wenn du anfängst, fünf Minuten zu planen wie einen Langstreckenflug“, hätte sie gesagt, „brauchst du sie dringender, als du denkst.“
Mara stand auf, stellte die Teetasse in die Spüle, wusch sie nicht ab, obwohl sie sonst genau solche Kleinigkeiten sofort erledigte. Kleine Beschäftigungen, kleine Ausweichmanöver. Stattdessen ging sie zum Fenster und schob es einen Spalt weiter auf. Die Luft war kühl, ein dünner Windzug strich über ihr Gesicht. Nur wenige Menschen waren noch unterwegs, die meisten Fenster im gegenüberliegenden Haus waren hell, einzelne schon dunkel.
Sie stützte die Hände auf die Fensterbank und atmete ein paar Mal bewusst tief ein und aus. Zählte innerlich bis vier beim Einatmen, bis vier beim Ausatmen. Es war keine richtige Meditation, kein bewusstes Ritual. Eher ein Tasten. Ein vorsichtiges Hineinhorchen, wie es sich anfühlte, nicht sofort weiterzugehen.
Ein Teil von ihr wollte die fünf Minuten auf morgen verschieben. In der Mittagspause vielleicht, auf dem Weg zur Bahn, irgendwo, wo es nicht so nach „Ich nehme mir jetzt ernsthaft Zeit für mich“ aussah. Einfach, um sich nicht so… pathetisch vorzuhaben. Aber je länger sie da stand, desto klarer wurde ihr, dass genau das der Punkt war: Dieses „nicht so ernst nehmen wollen“ hatte sie seit Jahren begleitet. Sie nahm ihren Job ernst, nahm die Erwartungen anderer ernst, nahm Deadlines ernst – nur sich selbst hatte sie konsequent hinten angestellt, als wäre da immer noch Luft nach hinten.
Fünf Minuten. Heute. Nicht morgen.
Sie ließ den Blick durch die Straße schweifen. Ein Mann führte seinen Hund Gassi, eine Frau rollte eine Mülltonne über das Pflaster, ein Fahrrad fuhr ohne Licht vorbei. Alltägliche Dinge. Nichts Besonderes. Und gleichzeitig war genau das die Welt, in der ihr Leben stattfand. Nicht in den Schlagzeilen, die sie schrieb. Nicht in den Analysen, für die sie recherchierte. Sondern hier. In diesem Fensterrahmen. In dieser Straße. In dieser Atmung, die tiefer wurde, je mehr sie sich traute, einfach nur dazustehen.
Sie wusste, dass dies noch nicht die eigentliche Erfüllung der Aufgabe war. Es fühlte sich mehr an wie ein Vorgriff, ein leises „Ich komme, ich hab dich gesehen.“ Der richtige Moment würde morgen kommen, dachte sie. Vielleicht unterwegs. Vielleicht an einem Ort, an dem sie sonst immer nur durchlief. Aber etwas hatte sich jetzt schon verändert: Der Satz war in ihr eingezogen.
Bleib heute fünf Minuten stehen.
Sie sprach ihn nicht aus, aber sie hörte ihn, wie man einen Song hört, der sich im Hintergrund festgesetzt hat. Und sie merkte, dass er sich innerlich mit einem anderen Satz verband, der seit dem Abend zuvor in ihr nachklang:
Beginne dort, wo du gerade bist.
Diese beiden Sätze passten zueinander wie zwei Seiten einer Münze. Der eine zeigte ihr, wo der Startpunkt war: hier, mitten in diesem Leben, mit all seinen offenen Tabs. Der andere zeigte ihr, wie klein der erste Schritt sein durfte, ohne an Bedeutung zu verlieren: fünf Minuten. Nicht mehr. Aber auch nicht weniger.
Sie schloss das Fenster wieder, kehrte zum Tisch zurück und setzte sich. Das Notizbuch lag noch immer offen vor ihr, nicht aufdringlich, aber präsent. Sie nahm den Stift und schrieb eine zweite Zeile unter ihre erste Notiz:
„Dieser Satz lässt mich nicht los. Vielleicht ist genau das sein Sinn.“
Als sie den Punkt setzte, spürte sie eine kleine Bewegung in sich. Kein großer Triumph, keine Euphorie. Eher so, als hätte jemand eine minimal verzogene Tür ein Stück gerader gerückt, sodass sie sich leichter öffnen ließ.
Der erste Satz, der bleibt, dachte sie, ist selten der lauteste. Es ist der, der dich auch dann begleitet, wenn du glaubst, längst mit ihm fertig zu sein.
Sie klappte das Notizbuch diesmal ganz bewusst zu. Nicht als Flucht, sondern als Abschluss für diesen Abend. Legte es wieder auf den Nachttisch, als sei es dort ab jetzt zu Hause. Und während sie sich bettfertig machte, blieb der Satz bei ihr, leise, aber beständig.
Bleib heute fünf Minuten stehen.
Noch wusste sie nicht, wo sie morgen stehenbleiben würde. Ob sie sich trauen würde, wirklich nichts zu tun, außer da zu sein. Aber zum ersten Mal seit langer Zeit ging sie mit dem Gefühl schlafen, dass ein kleiner, echter Schritt auf sie wartete.
Nicht ein Schritt für ihre Karriere. Nicht für ihr Ansehen. Nicht für ihr „Funktionieren“.
Ein Schritt nur für sie.
Das leise Erwachen
Es begann nicht mit einem lauten Knall, nicht mit einer großen Entscheidung oder einem dramatischen Satz, der alles veränderte. Es begann, wie so vieles in Maras Leben in den letzten Jahren, ganz unscheinbar. Mit einem Moment, der so still war, dass er beinahe übersehen worden wäre. Und genau darin lag seine Kraft.
Sie bemerkte es zum ersten Mal an einem Morgen, der äußerlich genauso begann wie unzählige davor. Der Wecker klingelte, ihr Arm tastete im Halbschlaf danach, schaltete ihn aus, zog ihn wieder näher ans Bett, als könnte sie noch ein wenig Zeit festhalten, obwohl sie längst wusste, dass sich Zeit nicht festhalten ließ. Das schwache Licht frühmorgendlicher Helligkeit lag wie ein zögernder Schleier über dem Raum, grau und sanft, ohne jede Dringlichkeit.
Normalerweise wäre sie jetzt aufgesprungen, hätte sich mit routinierter Bewegung aus dem Bett geschält, in Gedanken bereits den Tag vorstrukturiert, bevor ihre Füße den Boden berührten. Doch an diesem Morgen blieb sie liegen. Nicht aus Müdigkeit, nicht aus Trotz. Sondern aus einem Gefühl heraus, das sie nicht sofort einordnen konnte.
Es war ein leises Zögern. Ein Innehalten, das sich nicht erklären ließ.