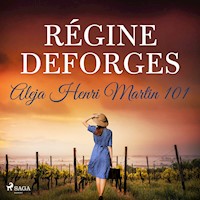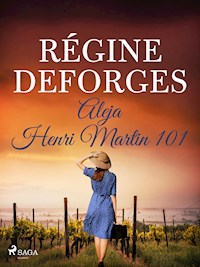Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Das blaue Fahrrad
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
In den letzten beiden Kriegsjahren des Zweiten Weltkrieges sieht Léa Delmas sich erneut mit den Wirren des Schicksals konfrontiert: Nachdem sie mitansehen muss, wie ihr Weingut in Montillac niederbrennt, ist Léa am Boden zerstört. Doch ihr Wille ist ungebrochen. Über das mittlerweile befreite Paris und Brüssel gelangt sie nach Berlin, wo der Krieg noch immer tobt.Das mitreißende Finale von Régine Deforges dramatischer Trilogie rund um die Winzertochter Léa Delmas. -
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 541
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Régine Deforges
Das rote Leuchten
Aus dem Französischen von Hild Wollenhaupt
Roman
Saga
Das rote Leuchten
Übersezt von Hild Wollenhaupt
Titel der Originalausgabe: Le Diable en rit encore
Originalsprache: Französisch
Le diable en rit encore © Libraire Arthème Fayard, 1993.
© der deutschsprachigen Ausgabe 2002 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
Erschienen im Ullstein Taschenbuch Verlag
Cover image: Shutterstock & Unsplash
Copyright © 2002, 2022 Régine Deforges und SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788728422397
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
www.sagaegmont.com
Saga ist Teil der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt.
Für meinen Vater,
für meinen Sohn Franck
Wo wir sind, da ist immer vorn,
Und der Teufel, der lacht nur dazu.
Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha!
»Nun tut die Zeit ihr Werk. Eines Tages werden die Tränen versiegt, das Wüten erloschen, die Gräber eingeebnet sein. Doch Frankreich wird bleiben.«
Charles de Gaulle, Kriegserinnerungen
1.
Für Léa begann eine lange Zeit des Wartens.
Das Wetter, das zum Jahresbeginn 1944 mild und regnerisch gewesen war, wurde mit dem 14. Februar schlagartig kälter und das Thermometer zeigte morgens minus 5 Grad. Vierzehn Tage lang lieferte sich der Nordwind mit dem Schnee ein Duell. Mitte März wurde es endlich wärmer und es war zu spüren, dass der Frühling nahte. Auf Montillac befragte Fayard besorgt den Himmel. Keine einzige Wolke; es hatte schon lange nicht mehr geregnet. Die Trockenheit brachte die Landwirte zur Verzweiflung, denn sie wussten nicht mehr, wie sie ihr Vieh ernähren sollten, und fürchteten um die künftige Heuernte.
Das Verhältnis zwischen den Bewohnern des »Schlosses« und Fayard, dem Verwalter und Kellermeister, war gespannt, seit ein Finanzexperte die Bücher des Weinguts einer eingehenden Prüfung unterzogen hatte. Der Meister der Reben hatte seine Weinverkäufe an die Besatzungsbehörden eingestehen müssen, die er trotz des von Léa – und zuvor bereits von ihrem Vater – ausgesprochenen Verbots durchgeführt hatte. Zu seiner Verteidigung hatte der gute Mann angeführt, dass Montillac das einzige Weingut der Gegend sei, das seinen Wein nicht an die Deutschen verkaufe, dass man ihnen im Übrigen bereits lange vor dem Krieg Wein verkauft hätte und die meisten der in der Region stationierten hochrangigen Boches in ihren Heimatorten bedeutende Weinhändler seien, von denen viele seit über zwanzig Jahren Geschäftspartner in Bordeaux hatten. Mit einigen hätten sogar langjährige Beziehungen bestanden. Erinnerte sich denn Mademoiselle Léa nicht mehr an den alten Freund von Monsieur d’Argilat, der 1940 während der Weinlese gekommen war, um auf Montillac guten Tag zu sagen?
Léa erinnerte sich sehr wohl daran. Und sie erinnerte sich auch, dass ihr Vater und Monsieur d’Argilat den braven Münchner Händler, der zum Wehrmachtsoffizier mutiert war, gebeten hatten, sie für die Dauer des Krieges nicht mehr zu besuchen. Fayard bekannte, die Erlöse aus diesen Verkäufen mit Rücksicht auf gewisse Ideen Mademoiselle Léas »auf die Seite« gelegt zu haben, behauptete jedoch, stets die Absicht gehabt zu haben, ihr diese Gelder auch wieder auszuhändigen. Ein Teil dieser Beträge sei schließlich auch für Wartung und Erneuerung von Geräten und Material verwendet worden. Mademoiselle Léa hatte ja keine Vorstellung, was Weinfässer heutzutage kosteten!
O doch! Léa wusste durchaus, was die Dinge kosteten. Der dicke Scheck, den ihr François Tavernier ausgestellt hatte, war von dem alten Bankier in Bordeaux erleichtert entgegengenommen worden. Er hätte nur höchst ungern die Tochter seines alten Schulfreundes wegen ungedeckter Schecks und nicht eingelöster Wechsel gerichtlich verfolgen lassen. Unglücklicherweise waren die Dachziegel des rechten Flügels des Hauses von einem nächtlichen Sturm heruntergeweht worden, und so waren die Gutskonten erneut in den roten Zahlen. Der von Tavernier geschickte Finanzexperte hatte ihnen eine Summe vorgestreckt – im guten Glauben, diese bald durch Tavernier zurückerstattet zu bekommen. Doch weder der Experte noch Léa hatten seit Mitte Januar etwas von ihm gehört. Jetzt war es schon Ende März.
Der Finanzexperte beendete seine Arbeit und riet, in Anbetracht der Situation entweder mit Fayard zu verhandeln oder ihn wegen Unterschlagung anzuzeigen. Léa wies sowohl den einen wie den anderen Vorschlag zurück. Ohne den kleinen Charles, der mit seinen Spielen und seinem Juchzen ein wenig Fröhlichkeit ins Haus brachte, wäre die Atmosphäre auf Montillac sehr düster gewesen. Doch jede der Frauen bemühte sich, ihre Sorgen vor den anderen zu verbergen. Nur Bernadette Bouchardeau ließ hin und wieder eine Träne über ihre magere Wange rinnen. Camille d’Argilat lebte Tag und Nacht nur für die von Radio London ausgestrahlten Meldungen, in der Hoffnung, so ein Lebenszeichen von Laurent zu erhalten. Sidonie hatte seit dem Tod von Doktor Blanchard deutlich an Kraft verloren. Sie schleppte sich täglich von ihrem Bett zu einem Lehnstuhl, der vor der Haustür platziert war. Von dort blickte sie auf das Gut und die weite Ebene, über der der Rauch der Schornsteine von Saint-Macaire und Langon aufstieg. Das Rattern der die Garonne überquerenden Eisenbahnzüge unterbrach ihre stillen und einsamen Stunden. Die alte Köchin wäre viel lieber nach Bellevue zurückgekehrt. Ruth brachte ihr jeden Tag das Essen und Léa, Camille und Bernadette schauten abwechselnd für ein paar Minuten bei ihr herein. Dann brummelte Sidonie, die Damen verschwendeten nur ihre Zeit, sie hätten Besseres zu tun, als sich um eine schwache Alte zu kümmern. Doch alle wussten, dass einzig diese Besuche sie noch am Leben hielten. Selbst die sonst so abgeklärte Ruth war von dieser Atmosphäre des Trübsinns und der Sorgen ergriffen worden. Erstmals seit Beginn des Krieges fürchtete auch sie sich. Die Angst, plötzlich die Gestapo oder die Miliz auftauchen zu sehen, brachte die bodenständige Elsässerin um den Schlaf.
Um die Zeit totzuschlagen, stürzte sich Léa mit wütendem Eifer darauf, den Gemüsegarten umzugraben und das Unkraut unter den Weinstöcken auszureißen. Wenn das nicht genügte, um ihren Körper zu erschöpfen und ihren Geist zu ermüden, radelte sie kilometerweit durch die hügelige Landschaft. Nach ihrer Rückkehr ließ sie sich auf das Sofa im Arbeitszimmer ihres Vaters fallen und sank in einen unruhigen Schlaf, ohne Erholung zu finden. Wachte sie auf, stand fast immer Camille mit einem Glas Milch oder einem Teller Suppe neben ihrem Lager. Die beiden Freundinnen tauschten ein Lächeln und betrachteten lange schweigend das im Kamin prasselnde Feuer. Wenn das Schweigen drückend wurde, schaltete eine von ihnen den großen Radioapparat, der auf einer Kommode nahe dem Sofa thronte, ein und versuchte London zu bekommen. Wegen der Störungen wurde es immer schwieriger, die ersehnten Stimmen, die von Freiheit sprachen, deutlich zu verstehen.
»Ehre und Vaterland. François Morland, ein den Stalags Entkommener, Mitglied des Führungskomitees der Vereinigung der Kriegsgefangenen in Frankreich, spricht zu Ihnen:
›Liebe heimgekehrte und entkommene Kriegsgefangene, Kameraden der Widerstandsgruppen. Zuerst möchte ich euch die gute Nachricht verkünden . . .‹«
Knistern überdeckte die Stimme des Redners.
»Es ist immer das Gleiche: Nie erfahren wir die gute Nachricht«, schimpfte Léa und versetzte dem Apparat mehrere Fausthiebe.
»Lass das, du weißt doch, dass es nichts nützt«, sagte Camille und schob ihre Freundin sanft beiseite. Dann schaltete sie den Apparat mehrmals ein und wieder aus. Sie wollte schon aufgeben, als dieselbe Stimme wieder zu hören war:
»In eurem Namen habe ich General de Gaulle von dem Glauben gesprochen, der euch beseelt. In eurem Namen habe ich Kommissar Frenay, einem Entkommenen wie wir, berichtet, was uns am Leben erhält. Doch diese Männer, denen es zur Ehre gereicht, stets an die Zukunft geglaubt zu haben, wussten bereits, welche Hoffnungen wir in uns tragen . . .«
Die Störungen verstärkten sich, so dass nur noch einige Satzfetzen durchkamen, hörten dann aber plötzlich auf.
». . . Doch ihr Anspruch geht noch weiter und ist noch umfassender. Weil sie in den Lagern und in den Trupps sich gegenseitig schätzen gelernt haben, streben sie nach einem Vaterland, das von allen Anzeichen der Erschöpfung und des Alterns befreit ist. Weil sie sich zusammengefunden haben, streben sie nach einem Vaterland, in dem alle Klassen, Kategorien, Hierarchien eingebunden sind in eine Gerechtigkeit, die stärker ist als alle Wohltätigkeiten. Weil sie in den Städten und Regionen ihres Exils mit Männern aller Rassen und Nationen das gleiche Elend geteilt haben, wollen sie auch die Annehmlichkeiten eines zukünftigen Lebens mit ihnen teilen.
Ja, meine Kameraden, für alle und für all dies kämpfen wir. Erinnern wir uns des Schwurs, den wir geleistet haben, als wir abfuhren und die Unsrigen zurückließen. Sie baten uns: Vor allem enttäuscht uns nicht und sagt Frankreich, dass es uns mit seinem schönsten Gesicht empfangen soll.
Entkommene, Heimgekehrte, Angehörige der Hilfsorganisationen und der Widerstandsgruppen: Der Augenblick ist gekommen, dieses Versprechen einzulösen.«
»Noch ein Idealist!«, rief Léa aus. »Ah, es ist ja auch wirklich schön, das Gesicht Frankreichs. Dieser Morland soll nur kommen und sich anschauen, wie dieses schöne Gesicht aussieht: aufgedunsen von Furcht, Hass und Neid, der Blick verschlagen und der Mund triefend von Verleumdungen und Denunziationen.«
»Beruhige dich! Du weißt sehr wohl, dass Frankreich nicht nur aus solchen Leuten besteht, sondern auch aus Männern und Frauen wie Laurent, François, Lucien, Madame Lafourcade.«
»Na, wenn schon!«, schrie Léa. »Die werden alle sterben oder sind schon tot. Nur die anderen werden überleben.«
Camille wurde bleich. »Oh, sei still! Sag so etwas nicht!«
»Psst! Jetzt kommen die persönlichen Botschaften.«
Sie beugten sich so dicht zu dem Apparat, dass ihre Köpfe das polierte Holz berührten.
»Alles schwillt gegen mich an, alles bedrängt mich, alles versucht mich . . . Ich wiederhole: Alles schwillt gegen mich an, alles bedrängt mich, alles versucht mich . . . Die Enten von Ginette sind gut angekommen . . . Ich wiederhole: Die Enten von Ginette sind gut angekommen . . . Barbaras Hündin hat drei Junge . . . Ich wiederhole: Barbaras Hündin hat drei Junge . . . Laurent hat sein Glas Milch ausgetrunken . . . Ich wiederhole . . .«
»Hast du das gehört?«
»Laurent hat sein Glas Milch ausgetrunken . . .«
»Er lebt! Er lebt!«
Lachend und weinend zugleich fielen sie einander in die Arme. Laurent d’Argilat war wohlauf. Dies war eine der vereinbarten Botschaften, um sie wissen zu lassen, dass sie sich nicht zu sorgen brauchten.
In dieser Nacht schliefen Léa und Camille tief und friedvoll. Eine Woche nach Ostern kam ihr Freund Robert, der Metzger von Saint-Macaire, der bei der Flucht von Pater Adrien Delmas mitgewirkt hatte, in seinem Lieferwagen zu Besuch. Das Auto machte mit seinem Holzvergaser einen solchen Krach, dass man bereits Minuten vorher von seinem Erscheinen unterrichtet war. Als das Gefährt auf dem Gut ankam, standen Camille und Léa bereits auf der Schwelle der Küchentür.
Robert, der ein in ein schneeweißes Tuch gehülltes Paket trug, kam mit breitem Lächeln auf sie zu.
»Guten Tag, Madame Camille, guten Tag, Léa.«
»Guten Tag, Robert. Ich freue mich, Sie zu sehen. Es ist schon bald ein Monat, dass Sie nicht mehr hier waren.«
»Ach, Madame Camille, heutzutage kann man nicht einfach tun, was man möchte. Darf ich eintreten? Ich habe Ihnen einen schönen Braten mitgebracht und Kalbsleber für den Kleinen. Mireille hat mir noch eine Hasenterrine dazugepackt. Die wird Ihnen schmecken.«
»Danke, Robert. Wenn Sie nicht wären, würde es hier nicht oft Fleisch zu essen geben. Wie geht es Ihrem Sohn?«
»Gut, Madame Camille, gut. Er schreibt, es sei ziemlich hart und er hätte sehr unter seinen Erfrierungen gelitten, aber jetzt geht es ihm besser.«
»Guten Tag, Robert. Trinken Sie eine Tasse Kaffee?«
»Guten Tag, Mademoiselle Ruth. Sehr gern. Ist es echter?«
»Fast«, antwortete die Haushälterin und ergriff die Kaffeekanne, die auf dem Herd warm gehalten wurde.
Der Metzger setzte seine Kaffeeschale ab und fuhr sich mit dem Handrücken über die Lippen.
»Sie haben Recht, es ist fast echter. Kommen Sie bitte näher, ich habe Ihnen etwas Wichtiges zu sagen. Also: Gestern habe ich eine Nachricht von Pater Adrien erhalten. Möglicherweise taucht er bald wieder in dieser Gegend auf.«
»Wann?«
»Das weiß ich nicht. Es ist gelungen, den Brüdern Lefèvre zur Flucht aus dem Hospital zu verhelfen.«
»Wie geht es ihnen?«
»Sie werden von einem Arzt in der Nähe von Dax behandelt. Sobald sie wieder wohlauf sind, kehren sie zur Widerstandsgruppe von Dédé le Basque zurück. Erinnern Sie sich an Stanislas?«
»Stanislas?«, fragte Léa.
»Aristide, wenn Ihnen das mehr sagt.«
»Ja, natürlich!«
»Er ist wieder hier in der Gegend, um die Organisation neu aufzubauen und die Verräter, die Kameraden angezeigt haben, zu bestrafen.«
»Arbeiten Sie mit ihm zusammen?«
»Nein, ich arbeite mit denen von La Réole, aber da wir hier an der Grenze von zwei Sektoren sind, bin ich Mittelsmann zwischen Hilaire und ihm. Eine von Ihnen sollte Madame Lefèvre mitteilen, dass es ihren Jungen gut geht.«
»Das mache ich«, erbot sich Léa. »Ich freue mich so sehr für die beiden. Ist es sehr schwierig gewesen?«
»Nein. Wir hatten Mithelfer im Hospital und die wachhabenden Polizisten waren Männer von Lancelot. Haben Sie gestern Abend über Radio London die Botschaft von Monsieur Laurent gehört?«
»Ja. Es ist, als kämen nach all den vielen Tagen des Bangens jetzt alle guten Nachrichten auf einmal.«
»Gut sind sie nur für einige wenige. Ich darf gar nicht an die siebzehn kleinen Bürschchen aus der Gruppe von Maurice Bourgeois denken, die die Schweinehunde am 27. Januar erschossen haben.«
Alle erinnerten sich an die Ausgabe der Petite Gironde vom 20. Februar, die berichtet hatte: Hinrichtung von Terroristen in Bordeaux.
»Haben Sie sie gekannt?«, stammelte Camille.
»Einige. Wir haben uns gelegentlich geholfen, obwohl sie Kommunisten sind und wir Gaullisten. Einer war dabei, Serge Arnaud, den mochte ich gern. Er war so alt wie mein Sohn. Es ist schlimm, mit neunzehn sterben zu müssen.«
»Wann wird das endlich alles vorbei sein?«, seufzte Ruth und wischte sich die Augen.
»Bald, hoffe ich! Wir sind allerdings nicht mehr viele. Die Gestapo-Leute sind schlau. Seit der Welle von Verhaftungen, Deportationen und Hinrichtungen in Gironde wird es für Aristide und die anderen immer schwieriger, Freiwillige zu bekommen.«
Eine Fahrradklingel unterbrach ihn. Die Tür öffnete sich und Armand, der Briefträger, erschien.
»Guten Tag, die Damen. Ich habe einen Brief für Sie, Mademoiselle Léa. Ich hoffe, er macht Ihnen mehr Freude als der, den ich dem alten Fayard gebracht habe.«
»Noch ein Schreiben von der Bank«, stöhnte Léa.
»Und wissen Sie, was darin war?«, fuhr Armand fort. »Sie brauchen gar nicht zu überlegen, das raten Sie nie: ein Sarg.« Alle außer Robert schrien auf: »Ein Sarg!«
»Wenn ich es Ihnen sage. Ein kleiner, schwarzer, aus Pappe ausgeschnittener Sarg. Und ich glaube, Fayards Name stand darauf.«
»Aber wieso denn?«, verwunderte sich Camille.
»Na, alle, die mit den Boches zu eng Zusammenarbeiten, kriegen so etwas, um ihnen klar zu machen, dass es ihnen nach Kriegsende an den Kragen gehen wird.«
»Wegen ein paar Flaschen Wein«, murmelte Camille verächtlich.
»Nicht nur wegen ein paar Flaschen Wein, Madame Camille«, sagte der Metzger kalt.
»Was wollen Sie damit sagen, Robert?«, fragte Léa.
»Es ist zwar nicht ganz sicher, aber Fayard ist mindestens zweimal gesehen worden, wie er die Kommandantur in Langon verließ.«
»Da sind wir doch alle mal gewesen.«
»Das weiß ich wohl, Madame Camille, aber es kursieren auch Gerüchte und vor allem ist da sein Sohn. Wenn ich daran denke, dass ich ihn schon als kleinen Knirps gekannt habe. Ich sehe euch noch, wie ihr euch durch die Rebstöcke gejagt und euch mit dem Saft der Trauben beschmiert habt. Wissen Sie noch, Mademoiselle Léa?«
»Ja . . . Es scheint schon so lange her zu sein.«
»Das wird Fayards Laune nicht gerade verbessern«, meinte Ruth und schenkte dem Briefträger ein Glas Wein ein.
»Bestimmt nicht. Er ist erst rot geworden und dann ganz blass, als er gesehen hat, was in dem Umschlag war. Da habe ich mich schleunigst verdrückt.«
Er leerte sein Glas in einem Zug.
»Das ist sicher noch nicht alles. Aber ich quatsche und quatsche und bin noch gar nicht fertig mit meiner Tour. Also, auf Wiedersehen, die Herrschaften, bis zum nächsten Mal.«
»Auf Wiedersehen, Armand. Auf bald.«
»Ich muss mich auch auf den Weg machen«, erklärte Robert. Léa begleitete ihn zu seinem Lieferwagen.
»Es werden demnächst Waffen per Fallschirm abgesetzt. Können Sie nachsehen, ob das Versteck am Kalvarienberg noch intakt ist? Es müsste eine Kiste mit Patronen und eine mit Granaten drin sein.«
»Ich gehe morgen hin.«
»Wenn alles in Ordnung ist, malen Sie mit weißer Kreide ein Kreuz auf den Gitterzaun um den Engel auf der Kreuzung.«
»Gut.«
»Seien Sie vorsichtig. Ihr Onkel würde es mir nie verzeihen, wenn Ihnen was passierte. Und nehmen Sie sich vor dem alten Fayard in Acht.«
In der Kapelle des Kreuzweges schien alles ganz normal, die Kisten waren unberührt. Trotz des schönen Wetters lag der Kalvarienberg verlassen.
In der Nacht vom 15. auf den 16. April hatte heftiger Regen Furchen in die abschüssigen Alleen gegraben und dort, wo der Boden wieder eben wurde, kleine Häufchen Kiesel hinterlassen, die unter den Füßen rutschten. Léa ging auf dem Rückweg am Friedhof vorbei. Sie verhielt am Grab ihrer Eltern und zupfte ein paar Unkräuter aus, die Ruth entgangen waren. Der Ort war menschenleer. Kindergeschrei war zu hören. Es ist große Pause, dachte sie, während sie das Portal der Basilika aufstieß. Die feuchte Kälte ließ sie erschauern. Drei alte betende Frauen drehten sich bei ihrem Eintritt nach ihr um. Was tat sie hier? Sainte-Exupérance in ihrem Schrein sah mehr denn je nach dem aus, was sie war: eine große Wachspuppe mit verstaubten Gewändern. Wo war die Ergriffenheit ihrer Kindheit geblieben? Was war mit dem wunderbaren Abbild der kleinen Heiligen geschehen, deren Namen sie jetzt für einige Menschen trug? All dies wurde lächerlich und gefährlich zugleich. Eine düstere Stimmung breitete sich in ihr aus. Ein Bedürfnis, alles zum Teufel zu jagen und sich wieder auf dem Boulevard Saint-Michel einzufinden oder auf den Champs-Élysées mit Laure und ihren modenärrischen Freunden, um Cocktails mit exotischen Namen und Farben zu schlürfen, auf geheimen Bällen zu tanzen und verbotene amerikanische Schallplatten zu hören, statt durch Reben und Felder zu radeln, um Botschaften zu überbringen oder Granaten, um Kontobücher zu überprüfen und am Radioapparat auf Nachrichten von François, Laurent oder der unwahrscheinlichen Landung der Alliierten zu warten! Sie hatte genug davon, ständig in Angst vor der Gestapo oder der Miliz zu leben, vor der Rückkehr von Mathias und vor dem Mangel an Geld. François Tavernier musste wohl tot sein, denn er hatte sein Versprechen nicht gehalten . . . Dieser Gedanke warf sie fast auf die Knie: Nur das nicht, lieber Gott!
Niedergeschlagen verließ Léa die Kirche.
Eine ungeheure Müdigkeit hatte sich ihrer bemächtigt. Ihre schlechten Schuhe mit den Holzsohlen erschienen ihr bleischwer. Als sie am letzten Gehöft des Dorfes vorüberkam, folgten ihr kurze Zeit ein paar magere Hunde mit ihrem Gebell, die jedoch bald wieder beruhigt in ihre Hütten zurückkehrten. Auf der »Kreuzung mit dem Engel« versicherte sie sich, dass niemand außer ihr da war, und markierte dann die rostige Gittertür mit einem weißen Kreuz. Vom Kirchturm von Verdelais schlug es sechs Uhr abends. Über den Himmel fegten große dunkle Wolken.
War es ein Wink des riesigen, aufgewühlten Himmels? Léa befand sich auf dem Weg, der zu Sidonies Haus führte. Ihr Kleinmut erschien ihr angesichts der Unermesslichkeit dieser Landschaft lächerlich. Wie Recht die alte Frau gehabt hatte, als sie nach Bellevue zurückkehren wollte. Von hier aus konnte die Seele ausfliegen bis zu den Landes in der Ferne, bis zum wandernden, wandelbaren Ozean und bis zur Unendlichkeit des Himmels. Beim Anblick dieser vertrauten Umgebung empfand Léa stets ein Gefühl des Friedens, ein Verlangen nach Ruhe, nach Träumen – nach Meditation, wie Adrien Delmas gesagt hätte.
Ein Jaulen riss sie aus ihren Gedanken. Belle, Sidonies Hündin, drückte sich winselnd gegen die Haustür.
Léa streckte die Hand nach dem Tier aus, das knurrend aufsprang. »Kennst du mich denn nicht mehr?«
Beim Klang der vertrauten Stimme kam die Hündin zu Léa, legte sich vor ihr nieder und stieß ein unheimliches Geheul aus. Beunruhigt öffnete Léa die Tür und trat ein. Im Raum herrschte ein unglaubliches Durcheinander, als hätte ein Orkan die Möbel umgeworfen, das Geschirr zerschmettert und Wäschestücke und Papiere verstreut. Die vom Bett heruntergerissenen Leintücher und die umgedrehten Matratzen deuteten jedoch auf eine ganz normale Hausdurchsuchung hin. Wer konnte derart mit den armseligen Einrichtungsgegenständen einer alten kranken Frau gehaust haben? Léa wusste die Antwort, weigerte sich aber noch, sie für sich selbst zu formulieren.
»Sidonie? Sidonie?«
Die unter dem Bett kauernde Hündin winselte leise. Eingeklemmt zwischen der Wand und dem Seitenteil des Bettes, lag die alte Frau. Sie war bewusstlos. Léa hatte große Mühe, sie hochzuheben und auf die Matratze zu betten. Ihre Haut war erdfarben, aus der Nase rann ein wenig Blut und eine Prellung gab der linken Gesichtshälfte eine bläuliche Färbung. Léa beugte sich über sie: Nur schwach kam der Atem aus dem halb geöffneten Mund. Der Ausschnitt ihres weißen Baumwollnachthemds ließ Fingerabdrücke auf der welken Haut ihres Halses sehen.
Fassungslos betrachtete Léa den ausgestreckten Körper der Frau, die sie einst getröstet und ihr heimlich Leckereien zugesteckt hatte, wenn sie von Ruth oder ihrer Mutter bestraft worden war. Bei der Erinnerung an ihre Schmusesitzungen in dem großen Sessel vor dem Kaminfeuer der Küche auf Montillac brach sie in Tränen aus und rief mit ihrer Kleinmädchenstimme von damals:
»Donie! Donie! Sag doch etwas!«
Sich gewaltsam aus der tödlichen Ohnmacht, die sie gefangen hielt, reißend, öffnete die alte Frau die Augen. Léa warf sich über sie.
»Sidonie, ich bitte dich, sprich doch!«
Langsam hob Sidonie den Arm und legte ihre Hand auf Léas gesenkten Kopf. Ihre Lippen öffneten und schlossen sich, doch es entwich ihnen kein Laut.
»Streng dich an; sag mir, wer das getan hat.«
Die Hand wurde schwerer. Léa legte das Ohr an ihren Mund. »Bring . . . Bring . . . Bring dich in Sicherheit!«
Noch schwerer drückte die Hand. Léa versuchte behutsam sich zu befreien und flüsterte:
»Was willst du damit sagen?«
Wie bedauernd verließ die Hand Léas dichtes Haar, glitt plötzlich ab und schlug mit einem dumpfen Geräusch gegen die hölzerne Bettstatt.
Belle stimmte ein Jammergeheul an.
Doch Léas Tränen versiegten, als sie ungläubig das alte, geliebte Antlitz betrachtete, das auf einmal so fremd und abweisend wirkte.
Es konnte nicht wahr sein! Noch vor einem Augenblick hatte sie Sidonies warmen Atem auf ihrer Wange gespürt und jetzt lag diese Masse vor ihr im schamlos hochgerutschten Nachthemd . . .
Wütend zog sie das Hemd herunter. Wenn doch bloß dieser Hund endlich still wäre. Was hatte das dumme Tierüberhaupt zu heulen? Weinte sie vielleicht?
Da hörte Léa hinter sich ein Geräusch und fuhr herum. Ein Mann stand auf der Schwelle. Sie war vor Schreck wie versteinert. Was tat er in diesem verwüsteten Haus, vor diesem noch warmen Leichnam? Plötzlich schien sie zu begreifen. Eine gemeine Furcht fegte ihre ganze Selbstachtung hinweg.
»Ich bitte dich, tu mir nichts!«
Mathias Fayard sah sie kaum an; er schob sie mit der Hand beiseite und ging blass, die Fäuste geballt, zum Bett.
»Sie haben es gewagt!«
Mit großer Zartheit faltete er die groben Hände, schloss die Augen jener Frau, die er als Kind »Mama Sidonie« genannt hatte und die ihm so geschickt geholfen hatte, die Ohrfeigen seines Vaters zu vermeiden. Er kniete nieder; nicht, um ein seit langem vergessenes Gebet zu sprechen, sondern aus übergroßem Kummer.
Léa betrachtete ihn ängstlich. Doch als er ihr sein schmerzverzerrtes, tränenüberströmtes Gesicht zuwandte, stürzte sie sich ebenfalls weinend in seine Arme.
Lange verweilten sie kniend und sich aneinander klammernd vor dieser sterblichen Hülle, die das, was ihnen noch von ihrer Kindheit geblieben war, mit sich in die Kälte des Grabes nahm.
Belle, die auf das Bett gesprungen war, leckte winselnd die Füße ihrer Herrin.
Mathias richtete sich als Erster auf.
»Du musst fort.«
Léa reagierte nicht. Mathias zog ein bereits etwas verschmutztes Taschentuch aus seiner Hosentasche und trocknete damit die Augen seiner Freundin und dann seine eigenen. Sie ließ ihn gewähren, war wie abwesend. Er schüttelte sie, erst sanft, dann fast heftig.
»Hör mir zu! Du musst weg von Montillac. Camille und du, ihr seid denunziert worden.«
Noch immer keine Reaktion von ihr; er hätte sie am liebsten geohrfeigt.
»Herrgott noch mal, so kapier doch! Dohses Leute und die Miliz wollen dich verhaften.«
Na endlich! Sie schien ihn zu verstehen, ihn wahrzunehmen. Langsam wichen Kummer und Niedergeschlagenheit einem Ausdruck ungläubigen Entsetzens.
»Und ausgerechnet du kommst und willst mich warnen!«
Bei diesem Ausruf ließ er den Kopf sinken.
»Ich habe gehört, wie Denan Fiaux, Guilbeau und Lacouture den Befehl gegeben hat.«
»Ich dachte, du würdest für sie arbeiten?«
Sie hatte plötzlich ihre Kraft und ihre Verachtung wiedergefunden.
»Es kommt vor.Aber was immer du von mir denkst, ich will nicht, dass sie dich in die Hände kriegen.«
»Ach, richtig! Du kennst ja ihre Methoden!«
Mathias erhob sich und starrte auf Sidonies Leichnam.
»Ich habe mir eingebildet, sie zu kennen.«
Léa folgte seinem Blick und erhob sich ebenfalls, die Augen erneut voller Tränen.
»Warum Sidonie?«
»Ich habe Fiaux sagen hören, dass Sidonie in einem Brief beschuldigt wurde, deinen Cousin Lucien versteckt zu haben und gewusst zu haben, wo die Brüder Lefèvre waren. Aber ich habe nicht einen Augenblick geglaubt, sie würden kommen und sie verhören. Ich habe nur an dich gedacht, nur daran, dich zu warnen. Was ich nicht verstehe, ist, dass sie nicht gleich anschließend zum Schloss gefahren sind.«
»Woher weißt du das?«
»Ich habe die Abkürzung durch die Weinberge genommen. Ich hätte ihre Autos gesehen oder gehört. Es sei denn, sie hielten sich in der Pinienschonung versteckt.«
»Ich habe nichts bemerkt, als ich von Verdelais her dort vorbeigekommen bin.«
»Komm, lass uns lieber hier abhauen.«
»Aber wir können Sidonie doch nicht einfach so liegen lassen.«
»Für sie kann niemand mehr etwas tun. Sobald es dunkel ist, sage ich dem Pfarrer Bescheid. Beeil dich.«
Léa küsste ein letztes Mal die erkaltete Wange und ließ die winselnde Hündin als Totenwache bei dem Leichnam zurück.
Draußen sah auch der Himmel bedrohlich aus.
Am Fuß der Terrasse hielt Mathias sie zurück.
»Warte hier auf mich. Ich werde nachsehen, ob jemand da ist.«
»Nein, ich komme mit dir.«
Er zuckte die Achseln und half ihr, die Böschung hochzuklettern. Alles schien ruhig zu sein. Es war bereits so dunkel, dass man kaum die Fassade des Hauses erkennen konnte.
Léa bemerkte, dass Mathias die noch kaum begrünten Laubengänge entlangging, um außer Sicht des Verwalterhauses zu bleiben. Er wollte vermeiden, von seinen Eltern gesehen zu werden.
Ein kleiner Lichtschein sickerte durch die Fenstertür, die auf den Hof führte. Camille musste nach ihr Ausschau gehalten haben, denn die Tür öffnete sich plötzlich und sie erschien in ihrem marineblauen Mantel, so als wollte sie gerade ausgehen.
»Da bist du ja endlich!«
Léa schob sie beiseite und ging an ihr vorbei hinein.
»Sidonie ist tot.«
»Was?«
»Die Kumpel von dem da sind zu ihr gekommen und haben sie ›befragt‹.«
Camille presste ihre Hände auf die Brust und starrte Mathias ungläubig an.
»Schauen Sie mich nicht so an, Madame Camille. Wir wissen gar nicht, was genau passiert ist.«
»Hör dir das an! ›Wir wissen gar nicht, was genau passiert ist!‹ Hältst du uns für Idioten? Wir wissen sehr wohl, was passiert ist. Muss ich es dir etwa erklären?«
»Das ist nicht nötig und das würde auch nichts ändern. Es gibt Wichtigeres. Ihr müsst verschwinden.«
»Wer sagt uns, dass das keine Falle ist und dass du uns nicht geradewegs zu deinen Freunden von der Gestapo bringst?« Mathias ging mit zusammengebissenen Zähnen und erhobener Faust auf sie los.
»So ist’s recht! Schlag mich nur, fang schon mal mit deren Arbeit an. Prügeln magst du ja.«
»Madame Camille, bringen Sie sie zum Schweigen. Die Zeit, die wir hier verlieren . . .«
»Wie sollen wir wissen, ob wir Ihnen vertrauen können?«
»Das können Sie nicht wissen. Aber Sie lieben doch Ihren Mann, und so werden Sie mir vielleicht glauben, wenn ich Ihnen schwöre, dass ich Léa liebe und dass ich trotz allem, was uns trennt, was ich getan haben mag, bereit bin zu sterben, damit ihr nichts geschieht.«
Camille legte Mathias die Hand auf den Arm. »Ich glaube Ihnen. Aber warum wollen Sie auch mich retten?«
»Léa würde es mir nie verzeihen, wenn Sie festgenommen würden.« Ruth kam herein mit einem bis zum Bersten voll gepackten Rucksack, den sie Léa übergab.
»Nimm! Ich habe warme Kleidung, eine Taschenlampe und zwei Weckgläser mit Fleisch eingepackt. Und nun geht.«
»Nun geht . . . Nun geht . . .«, sang der kleine Charles, der sich seine Mütze bis über die Ohren heruntergezogen hatte.
»Kommt, beeilt euch«, mahnte Ruth und schob sie hinaus.
»Aber du kommst doch mit uns!«
»Nein. Es muss jemand da sein, der ihnen Rede und Antwort steht, wenn sie kommen.«
»Das möchte ich nicht – nach dem, was sie Sidonie angetan haben.«
»Sidonie?«
»Sie haben sie zu Tode gefoltert.«
»Mein Gott!«, stieß die Haushälterin hervor und bekreuzigte sich.
»Schnell, Mademoiselle Ruth, entscheiden Sie sich: Kommen Sie nun mit oder nicht?«
»Nein, ich bleibe. Ich kann Monsieur Pierres Haus nicht im Stich lassen. Macht euch keine Sorgen, ich weiß schon, wie ich mit ihnen reden muss. Mir liegt nur eines am Herzen . . .«
»Gemeinsam werden wir sie leichter davon überzeugen können, dass ihr nach Paris abgereist seid«, erklärte Bernadette Bouchardeau, die gerade hereinkam.
»Deine Tante hat Recht. Die Anwesenheit der beiden lässt eure Abwesenheit natürlicher erscheinen.«
»Aber sie könnten umgebracht werden!«
»Das könnten sie auch, wenn ihr hier bleiben würdet.«
»Das stimmt«, sagte Ruth. »Geht, es ist jetzt Nacht. Mathias, kann ich dir die beiden anvertrauen?«
»Habe ich Sie je getäuscht?«
»Was hast du vor?«
»Sie zu Robert zu bringen, der sie verstecken wird.«
»Wieso zu Robert?«, schrie Léa auf.
»Weil er im Widerstand ist und wissen wird, was mit euch zu tun ist.«
»Wie kommst du denn auf so was?«
»Hör auf, mich für einen Idioten zu halten. Ich weiß schon seit langem, dass er englische Piloten versteckt, dass er die Plätze der Fallschirmabsetzungen kennt und dass er an der Flucht der Brüder Lefèvre beteiligt war.«
»Und du hast ihn nicht denunziert?«
»Es ist nicht meine Art, Leute zu denunzieren.«
»Dann dürftest du bei deinen Vorgesetzten wohl nicht gut angeschrieben sein.«
»Es reicht!«, rief Camille heftig. »Ihr könnt eure Streitigkeiten später austragen. Jetzt müssen wir sehen, dass wir verschwunden sind, wenn sie kommen. Bist du sicher, Ruth, dass du nicht mitkommen willst, und auch Sie, Madame Bouchardeau?«
»Ganz sicher, meine liebe Camille. Ich möchte hier sein, falls Lucien oder mein Bruder mich brauchen. Und außerdem bin ich zu alt, um bei Nacht und Nebel herumzuwandern und im Freien zu nächtigen. Sie werden uns Charles dalassen müssen. Er wird bei uns in bester Obhut sein.«
»Ich danke Ihnen sehr, aber es ist mir eine größere Beruhigung, wenn ich ihn bei mir habe.«
»Ich gehe rüber zu meinen Eltern, damit sie nicht mitkriegen, dass ihr geht. In einer Viertelstunde treffen wir uns in Montonoire, da habe ich den Geländewagen stehen lassen.«
Mathias verließ das Haus durch die Küchentür. Die beiden jungen Frauen und das Kind aßen einen Teller Suppe, knöpften dann ihre Mäntel zu, küssten Ruth und Bernadette Bouchardeau zum Abschied und gingen in die Nacht hinaus.
Fast zwanzig Minuten warteten sie schon in ihrem Versteck nahe dem schwarzen Geländewagen auf Mathias.
»Er kommt nicht. Ich sage dir, er kommt nicht.«
»Doch, doch, er wird schon kommen. Psst! Horch mal! Es kommt jemand die Straße entlang.«
Camille, die in der Nähe des Wagens kauerte, drückte ihren kleinen Jungen fest an sich. Es war so dunkel, dass die Gestalt des Mannes mit dem Himmel verschmolz.
»Léa, ich bin’s.«
»Du hast aber lange gebraucht!«
»Ich konnte einfach nicht gegen das Geschimpfe meines Vaters und das Jammern meiner Mutter ankommen. Ich musste regelrecht flüchten. Beeilt euch mit dem Einsteigen.«
Charles, der Léas Plüschteddy, den Ruth wiedergefunden und geflickt hatte, an sich presste, kletterte vergnügt in das Auto. Er war der Einzige, dem die Situation Spaß machte.
Nie waren ihnen die Gassen der kleinen mittelalterlichen Stadt Saint-Macaire so eng und so dunkel erschienen. Das bläuliche Licht der verdunkelten Scheinwerfer genügte kaum, um den Weg zu finden. Schließlich kamen sie jedoch vor dem Haus des Metzgers an. Mathias stellte den Motor ab. Kein Licht, kein Laut, nur die bedrückende Stille einer finsteren Nacht, die nie enden zu wollen schien. Im Inneren des Wagens hielten alle gespannt den Atem an, selbst Charles, der das Gesicht am Hals seiner Mutter vergraben hatte. Ein Klicken ließ Léa zusammenzucken: Mathias lud seine Pistole.
»Es ist besser, du gehst hin«, flüsterte er.
Geräuschlos stieg sie aus, ging zur Haustür und klopfte. Nach dem fünften Mal fragte eine undeutliche Stimme:
»Was ist denn?«
»Ich bin’s, Léa.«
»Wer?«
»Léa Delmas.«
Die Tür öffnete sich und die Frau des Metzgers zeigte sich im Nachthemd, ein Tuch um die Schultern und eine Taschenlampe in der Hand.
»Kommen Sie schnell herein, Kindchen. Sie haben mir einen schönen Schrecken eingejagt. Ich dachte, Robert wäre etwas passiert.«
»Er ist nicht da?«
»Nein, er ist in Saint-Jean de Blaignac wegen eines Fallschirms . . . Aber was bringt Sie denn hierher?«
»Die Gestapo. Ich bin mit Camille d’Argilat und ihrem Sohn gekommen. Mathias Fayard hat uns hergefahren.«
»Mathias Fayard? Hierher? Dann sind wir verloren!«
Camille und Charles vor sich herschiebend, trat Mathias ein und schloss die Tür.
»Sie haben nichts zu befürchten, Mireille. Wenn ich Sie hätte denunzieren wollen, hätte ich es schon längst getan. Ich möchte Robert und seine Kameraden nur bitten, die drei hier so lange zu verstecken – wo, will ich gar nicht wissen –, bis ich eine andere Lösung gefunden habe.«
»Ich traue dir nicht. Jeder weiß, dass du mit denen zusammenarbeitest.«
»Ist mir egal, was ihr wisst. Es geht nicht um mich, sondern um sie. Wenn es Robert und die anderen beruhigt, können sie ja meine Eltern als Geiseln nehmen.«
»Dummes Geschwätz!«, stieß Mireille verächtlich hervor.
Mathias zuckte die Achseln.
»Sie können von mir denken, was Sie wollen. Wichtig ist nur, dass die drei nicht von der Gestapo erwischt werden. Falls Robert mit mir reden will, soll er mir eine Nachricht im Lion d’Or in Langon hinterlassen. Ich bin bereit, mich mit ihm zu treffen, wo immer er mich hinbestellt. Jetzt muss ich aber gehen.«
Als er sich Léa näherte, wandte sie sich ab. Nur Camille hatte aufgrund des Kummers in seinen Augen Erbarmen mit ihm.
»Danke, Mathias.«
Die drei Frauen blieben unbeweglich im Flur zur Küche stehen, bis das Motorengeräusch verklungen war. Der kleine Charles war auf einem Stuhl neben dem erloschenen Herdfeuer eingeschlafen, ohne seinen Teddy loszulassen.
Es war drei Uhr morgens, als Robert von der Fallschirmabsetzung zusammen mit dem Gendarm Riri, dem Tankwart Dupeyron und dem Chausseearbeiter Cazenave nach Hause zurückkehrte. Alle vier trugen eine Maschinenpistole über der Schulter.
»Léa! Madame Camille! Was ist denn los?«
»Sie werden von der Gestapo gesucht.«
Die vier Männer erstarrten.
»Und das ist noch nicht alles«, fuhr Mireille mit immer schrillerer Stimme fort. »Sidonie ist ermordet worden und der junge Fayard hat sie hierher gebracht. Du sollst sie verstecken.«
»Dieser Scheißkerl«, fluchte der Tankwart.
»Der verpfeift uns bestimmt«,jammerte der Gendarm.
»Das glaube ich nicht«, murmelte der Metzger nachdenklich.
»Er hat gesagt, wenn ihr ihm nicht traut, sollt ihr seine Eltern als Geiseln nehmen«, platzte Mireille heraus.
Camille merkte, dass sie eingreifen musste. »Ich bin sicher, dass er niemanden verraten wird.«
»Möglich, Madame Camille, aber wir dürfen absolut kein Risiko eingehen. Ich glaube, meine liebe Mireille, jetzt heißt es in den Untergrund gehen.«
»Das ist doch nicht dein Ernst! Was wird denn aus dem Geschäft? Und wenn der Junge uns erreichen will? Wenn er uns braucht? Geh, wenn du willst; ich bleibe.«
»Aber Mi . . .«
»Spar dir deine Worte, ich bin fest entschlossen.«
»Also dann bleibe ich auch.«
Die vollbusige Metzgersfrau umhalste ihren Mann, der sie an sich drückte und versuchte, seine Rührung zu verbergen.
»Na, siehst du! Kannst du dir etwa vorstellen, dass ich den Ochsen von der alten Lécuyer schlachte?«, neckte sie ihn, und alle mussten lächeln.
»Aber was machen wir denn mit ihnen?«, fragte der Gendarm und wies auf Camille und Léa.
Robert schob seine Kameraden ans andere Ende der Küche. Sie flüsterten kurz miteinander, dann gingen Riri und Dupeyron hinaus.
»Sobald sie zurück sind und die Luft rein ist, fahren wir los. Wir bringen Sie zu verlässlichen Freunden. Dort bleiben Sie ein paar Tage, dann sehen wir weiter. Alles hängt davon ab, was mir Mathias erzählt, wenn ich mich mit ihm treffe.«
Er wandte sich an seine Frau: »Mireille, mach uns einen anständigen Korb zurecht.«
»Das ist nicht nötig, wir haben alles, was wir brauchen«, erklärte Camille.
»Lassen Sie nur, Sie wissen ja nicht, wie lange Sie sich versteckt halten müssen.«
Der Tankwart kam zurück. »Es kann losgehen, alles ist ruhig. Riri passt auf.«
»Gut, fahren wir. Mireille, mach dir keine Sorgen, falls ich vor Morgengrauen nicht zurück sein sollte. Ich nehme den Kleinen, Cazenave nimmt den Korb. Und jetzt sagt euch Adieu.«
Der Lieferwagen war nicht gerade bequem und rüttelte hart in den Wegfurchen.
»Ist es noch weit?«, stöhnte Léa.
»Nicht sehr; kurz vor Villandraut. Die Gegend ist sicher. In der Untergrundorganisation hier sind lauter Kumpel. Ihr Onkel kennt sie alle.«
»Glauben Sie, dass wir lange dort bleiben müssen?«
»Keine Ahnung. Das werden wir sehen, wenn ich mit Mathias gesprochen habe. Jetzt sind wir gleich da.«
Nach einem kurzen Wegstück zwischen niedrigen Gebäuden hindurch hielten sie vor einem etwas abseits gelegenen Haus. Ein Hund bellte. Eine Tür öffnete sich. Ein mit einem Gewehr bewaffneter Mann näherte sich.
»Bist du das, Robert?«, fragte er leise.
»Ja. Ich bringe dir zwei Freundinnen, die in Schwierigkeiten stecken.«
»Du hättest mir vorher Bescheid geben können.«
»Das war nicht möglich. Hast du momentan Platz?«
»Du hast Glück, die Engländer sind letzte Nacht gegangen. Bleiben sie lange?«
»Weiß ich nicht.«
»Frauen und ein Gör«, brummelte er vor sich hin. »Passt mir gar nicht. Mit den verflixten Weibern gibt es immer nur Ärger.«
»Sehr liebenswürdig«, zischte Léa zwischen den Zähnen.
»Machen Sie sich nichts aus ihm«, sagte Robert. »Der alte Léon meckert die ganze Zeit, aber es gibt keinen besseren Schützen in den Landes noch ein besseres Herz.«
»Bleibt nicht hier draußen stehen. Die Nachbarn gehören zwar alle zu uns, aber heutzutage schleicht sich schnell mal ein schwarzes Schaf in die Herde.«
Der Raum, den sie betraten, war lang und niedrig und hatte einen gestampften Lehmboden. Drei große hohe Betten mit verschossenen roten Vorhängen, die an den Deckenbalken befèstigt waren, holzgeschnitzte Truhen, die zwischen ihnen standen, ein riesiger Tisch, beladen mit Tierfallen, roten und blauen Patronen, einer auf Zeitungspapier auseinander genommenen Maschinenpistole, schmutzigem Geschirr und alten Lappen, mehrere ungleiche Stühle, ein von langen Jahren des Gebrauchs geschwärzter Herd, ein Kamin von imponierenden Ausmaßen, dekoriert mit den unvermeidlichen gravierten Geschosshülsen aus dem letzten Krieg, ein abgenutzter Spülstein, über dem vergilbte und mit Fliegendreck besprenkelte Kalender hingen (der des Jahres 1944, auf dem Kätzchen abgebildet waren, wirkte mit seinen schreienden Farben geradezu anachronistisch), bildeten das gesamte Mobiliar, das vom gelben Lichtschein einer Petroleumhängelampe erhellt wurde. Das Gehöft hatte noch keinen elektrischen Strom.
So viel Ländlichkeit, verbunden mit dem starken Geruch gebündelter Tabakblätter, die unter der Decke hingen, ließ die beiden jungen Frauen auf der Schwelle verharren.
»So bald hatte ich noch keine neuen Gäste erwartet. Ich habe noch keine Zeit gehabt, die Betten zu machen«, erklärte Léon, während er Laken aus einer der Truhen nahm.
»Gibt es denn nicht noch einen Raum?«, flüsterte Léa Robert ins Ohr.
»Nee«, antwortete ihr Gastgeber, der ein feines Gehör hatte. »Das hier ist alles, was ich Ihnen anbieten kann, kleines Fräulein. Kommen Sie, helfen Sie mir beim Betten beziehen. Die Betten sind gut, das werden Sie feststellen. Echte Gänsedaunen. Wenn man einmal drin ist, möchte man gar nicht mehr raus.«
Die Laken waren grob gewebt, dufteten jedoch frisch nach Kräutern.
»Der Abort ist hinter dem Haus; da haben Sie so viel Platz, wie Sie nur wollen«, fügte Léon etwas boshaft hinzu.
»Und wo kann man sich waschen?«
»Draußen steht eine Schüssel und der Brunnen ist nicht weit.«
Léa musste wohl ein komisches Gesicht machen, denn trotz ihrer Müdigkeit brach Camille in Lachen aus.
»Du wirst sehen, wir werden es hier gut haben. Komm, ich helfe dir.«
Charles wachte nicht einmal auf, als seine Mutter ihn auszog und ins Bett legte.
2.
Camille und Léa hatten schon lange nicht mehr so gut geschlafen. Selbst der kleine Charles, sonst stets als erster wach, schlummerte noch trotz der fortgeschrittenen Morgenstunde. Das durch die roten Vorhänge sickernde Licht war weich und rosenfarben. Man erriet, dass draußen schönes Wetter war. Die Tür musste offen sein, denn beruhigende Bauernhofgeräusche drangen bis zu ihnen hinein: Hühnergegacker, das Quietschen der Zugkette, ein Eimer, der an den Brunnenrand stieß, Taubengurren, Pferdegewieher, die Stimme eines Kindes, das nach seiner Mutter rief. Es war, als könne nichts diesen Frieden stören. Jemand betrat den Raum und schüttete Kohlen auf das Herdfeuer. Bald darauf verbreitete sich der Duft von echtem Kaffee. Wie von diesem Aroma belebt, schoben Camille und Léa gleichzeitig ihre Bettvorhänge beiseite. Der Anblick der beiden zerzausten Frauenköpfe entlockte Léon ein Grunzen, das einem Lachen ähnelte.
»Na, ihr Hübschen, man muss schon die besten Mittel anwenden, um euch aus den Federn zu kriegen: nichts Geringeres als echten kolumbianischen Kaffee.«
Léa hatte es so eilig, dass sie fast aus dem Bett fiel, dessen Höhe sie vergessen hatte. Sie nahm die Schale, die Léon ihr reichte, führte sie an ihre Nase und sog genießerisch den wundervollen Duft ein.
»Ich habe zwei Stück Zucker hineingetan. Ich hoffe, das ist Ihnen nicht zu viel.«
»Zwei Stück Zucker! Hast du das gehört, Camille?«
»Ja, hab ich«, antwortete sie und trat heran, so zart in ihrem langen weißen Nachthemd, dass sie wie eine Pensionatsschülerin aussah.
Léon, der sich an ihrem Vergnügen zu freuen schien, reichte auch ihr eine Schale Kaffee.
»Wie kommen Sie denn an so etwas?«
»Die Engländer haben mir zum Abschied eine Packung Kaffee dagelassen. Und das ist nicht mal alles.«
Er entnahm einer Truhe, die wohl als Speiseschrank diente, einen großen Brotlaib.
»Das wird Ihnen schmecken: richtiges Weißbrot, eine echte Brioche!«
Er holte sein Messer aus der Hosentasche, öffnete es gemächlich und schnitt drei große Stücke ab. Léa steckte ihre Nase in das feste weiche Brot und roch so gierig daran, als befürchtete sie, dieser Duft könne für immer verschwinden. Camille betrachtete ihr Stück mit dem gleichen Ernst, den sie auch auf alle anderen Dinge verwandte.
»Brot . . . Brot . . .!«
Charles, der auf dem Bett stand, streckte seine Ärmchen aus. Léon nahm ihn auf, setzte ihn auf sein Knie und schnitt ihm eine dicke Scheibe Brot ab.
»Das ist viel zu viel für ihn, Monsieur, so viel wird er nie aufessen!«, rief seine Mutter aus.
»Das sollte mich wundern bei so einem kräftigen Kerlchen. Nun trinken Sie mal Ihren Kaffee, sonst wird er kalt.«
Der alte Bauer aus den Landes behielt Recht. Charles aß das ganze Stück Brot.
Drei beschauliche Tage vergingen. Es war schönes, ein wenig kühles Wetter. Am Abend des 21. April kam Robert wieder. Er hatte sich mit Mathias in Langon getroffen. Der junge Mann hatte sich bereit erklärt, sich gefesselt und mit verbundenen Augen im Kofferraum eines Autos in ein Versteck der Widerständler in der Nähe von Mauriac bringen zu lassen. Dort hatte er alle Fragen des Metzgers und seiner Kameraden rückhaltlos beantwortet. Da ihn seine Antworten zufrieden stellten, hatte Robert ihn im Laufe der Nacht nahe dem Bahnhof von La Réole freigelassen.
»Ist die Gestapo auf Montillac erschienen?«, fragte Léa.
»Die Gestapo nicht, aber Leute von Kommissar Penot.«
»War Maurice Fiaux mit dabei?«
»Nein.«
»Wie ist es abgelaufen? Wie geht es meiner Tante und Ruth?«
»Sehr gut. Ruth zufolge sind sie sehr höflich befragt worden, doch ihre Antworten wurden kaum beachtet.«
»Was wollten sie denn eigentlich?«
»Sie wollten wissen, ob sie etwas von Pater Adrien gehört hätten. Nach Ihnen und Madame d’Argilat haben sie mit keinem Wort gefragt.«
»Merkwürdig! Warum hat mir dann Sidonie noch, bevor sie starb, gesagt, ich solle mich in Sicherheit bringen, und wieso hat Mathias geglaubt, wir würden verhaftet?«
»Weil er, wie er uns erklärt hat, ein Gespräch zwischen dem Chef der Miliz und Fiaux mit angehört hat, die beide meinten, Sie wüssten eine Menge über die Flucht der Brüder Lefèvre und würden auch den Aufenthaltsort von Pater Adrien und Ihrem Cousin Lucien kennen.«
»Und wieso waren sie dann zuerst bei Sidonie?«
»Ein Denunziationsschreiben – ich habe so meinen Verdacht bezüglich des Absenders –, in dem stand, dass sie Widerständler verstecke, wurde der Polizei zugeschickt.«
»Warum hat uns Mathias nicht früher gewarnt?«
»Denan hätte ihn angeblich stundenlang in seinem Büro zurückgehalten.«
»Wer ist dieser Denan?«, wollte Léa wissen.
»Ein schöner Dreckskerl ist dieser Lucien Denan! Er ist mit den Flüchtlingen nach Bordeaux gekommen. Bis 1942 war er Verkäufer in der Kurzwarenabteilung vom Kaufhaus Dames de France. Wenn er dort Feierabend hatte, ist er zum Sitz der Sicherheitspolizei gegangen, wo er alles, was er über die Angestellten des Kaufhauses in Erfahrung bringen konnte, in eine Kartei eingetragen hat. Er wurde dann sehr schnell deren Informant Nr. 1, hat bei Dames de France gekündigt und ist erst zum stellvertretenden Inspektor für Jüdische Fragen, dann zum Regionalabgeordneten ernannt worden. Als dann die Miliz in Bordeaux aufgestellt worden ist, wurde er Chef der 2. Abteilung. Es heißt, er arbeite auch noch für den deutschen Nachrichtendienst unter dem Namen ›Monsieur Henri‹. So sieht das Porträt dieses braven Mannes aus. Aber um auf den jungen Fayard zurückzukommen: Sobald er konnte, ist er mit einem Dienstwagen losgefahren. Zu Sidonies Unglück war es schon zu spät. Heute Morgen ist die arme Alte begraben worden. Es waren nur wenige Leute, die hinter dem Leichenwagen hergegangen sind.«
Léa konnte ihre Tränen nicht zurückhalten.
»Ruth hatte sich um alles gekümmert«, fuhr Robert fort. »Ich habe Belle zu mir genommen, aber ich fürchte sehr, dass das arme Tier bald seiner Herrin nachfolgen wird.«
»Werden wir nun gesucht oder nicht?«, fragte Camille.
»Laut Mathias jedenfalls nicht offiziell. Aber das bedeutet gar nichts. Er meint, es sei besser, dass Sie sich noch eine Weile versteckt halten.«
»Weiß er, wo wir sind?«
»Selbstverständlich nicht. So weit geht unser Vertrauen nicht. Wir haben uns für den 24. in Bordeaux am Bahnhof Saint-Jean verabredet. Ich werde versuchen, am nächsten Tag herzukommen. Bis dahin lassen Sie sich lieber nicht zu viel sehen.«
Es war herrliches warmes Wetter, wenn auch morgens noch recht kalt. Der würzige Duft der Kiefern gab Léa und Camille das Gefühl, in den Ferien zu sein. Körper und Geist waren wie von einer Betäubung ergriffen, gegen die sie nicht ankämpften. Die Tage, die sie im Wald verbrachten, wo sie picknickten, sich in einer sandigen Mulde aalten, mit Charles Verstecken spielten, ließen sie die Wirklichkeit vergessen. Diese brachte sich ihnen jäh in Erinnerung, als ein Widerständler kam und dem alten Léon die Verhaftung des Metzgers und seiner Frau mitteilte. Mireille war zum Fort du Hâ gebracht worden, Robert zur Route du Médoc (die in Avenue du Maréchal-Pétain umgetauft worden war), wo er verhört werden sollte.
Camille wurde blass. Sie dachte an die Tage, die sie in den Kellern des finsteren Gebäudes verbracht hatte, an die Schreie der Gefolterten.
»Wann ist er verhaftet worden?«
»Als er sich mit dem jungen Fayard am Bahnhof Saint-Jean treffen wollte.«
»Er ist denunziert worden!«, rief Léa.
»Das halten wir für unwahrscheinlich. Aristide war sicherheitshalber informiert worden und zwei seiner Leute haben die Bahnhofseingänge beobachtet, ein Dritter hat in der Nähe des Treffpunkts auf Mathias Fayard gewartet. Alles schien normal. Ich bin zusammen mit Robert und Riri fünf Minuten vor der vereinbarten Zeit dort angelangt. Wir sind aber von der Menschenmenge, die mit dem Pariser Zug angekommen war, getrennt worden. Riri und ich haben Mathias kommen sehen; er schien allein zu sein. Also haben wir kehrtgemacht. Ungefähr zehn Meter von uns entfernt stand Robert, eingekreist von einem deutschen Offizier, zwei deutschen Soldaten und drei Franzosen in Zivil. Wir haben gehört, wie er gesagt hat: ›Das muss ein Irrtum sein.‹
Die Menschenmenge hat sich vor der Gruppe geteilt, und ich glaube, in dem Moment hat Mathias mitgekriegt, was da ablief. Er ist blass geworden, hat ein paar Schritte auf sie zu gemacht und ist dann stehen geblieben. Ich stand dicht neben ihm.
›Saukerl‹, hab ich zu ihm gesagt, ›dir werden wir die Haut abziehen.‹
Er hat mich angestarrt, als ob er kein Wort verstünde. ›Ich hab nichts damit zu tun, ich verstehe das alles nicht. Das muss ein Zufall sein.‹
›Den Zufall wirst du bezahlen müssen.‹
›Hör auf mit dem Quatsch, kein Mensch hat gewusst, dass ich mit ihm verabredet war.‹
›Wolltest du etwa einen Beweis liefern?‹
›Denk, was du willst; lass uns hinter ihnen hergehen. Ich will wissen, wohin sie ihn bringen. Komm mit.‹
›Dass du mich auch festnehmen lassen kannst!‹
›Hier, nimm meine Pistole, dann kannst du mich abknallen, wenn du glaubst, ich würde dich reinlegen.‹
Er hat mir seine Waffe hingehalten, einfach so, ohne auch nur zu versuchen, sie zu verbergen. Alle hätten es sehen können. Ich hab sie ihm aus den Händen gerissen und gesagt: ›Bist du verrückt?!‹
Ich habe nachgesehen, ob sie geladen war, und habe sie in meine Tasche gesteckt. Dann haben wir uns in Richtung Ausgang in Bewegung gesetzt. Riri hat sich uns wieder angeschlossen. Er sah aus, als hätte er Mathias am liebsten auf der Stelle umgelegt.
›Erklär’s ihm‹, hat Mathias ruhig gesagt und ist auf einen Geländewagen zugegangen, der unten an der Treppe geparkt war. Inzwischen war Robert nur ein paar Meter von uns entfernt in einen Citroën 15 mit deutschem Nummernschild gestoßen worden. Ich bin zu Mathias in den Wagen gestiegen, Riri hat sich davon gemacht.
›Kommt er nicht mit?‹, hat mich Mathias gefragt.
›Er traut dir nicht. Er kommt mit ein paar Kameraden von hier hinter uns her.‹
›Dann sollen sie sich beeilen‹, hat er zu mir gesagt und ist dem deutschen Wagen nachgefahren.
Ich hab die Pistole gezogen und auf Mathias gerichtet, so dass ich ihn im Notfall sofort hätte abknallen können. Ich habe mich mehrmals umgedreht, weil ich mich gefragt habe, wie Riri und die Kameraden uns hätten folgen können. Das Auto der Boches vor uns fuhr ziemlich schnell.
›Scheiße‹, hat Mathias gesagt, ›sie fahren nicht zum Cours du Chapeau-Rouge.‹
›Was ist denn am Cours du Chapeau-Rouge?‹
›Eins der Büros von Poinsot.‹
›Na und?‹
›Das heißt, dass sie ihn den Deutschen überlassen, und es ist viel schwieriger, ihren Klauen zu entkommen als denen der französischen Polizisten.‹
Am Cours Aristide-Briand sind sie abgebogen und haben den Cours d’Albret genommen. Ich hab mir gesagt: Sie bringen ihn zum Fort du Hâ. Aber nein, sie sind weitergefahren, am Gefängnis vorbei. In der Rue de l’Abbé-del’Epée hat mich Mathias gefragt, ob meine Kameraden hinter uns seien. Außer Fahrrädern und einem Laster der deutschen Wehrmacht war kein Fahrzeug zu sehen. In der Rue de la Croix-de-Seguey habe ich begriffen, wohin sie fuhren. Am Schlagbaum der Rue du Médoc sind wir von deutschen Flics angehalten worden. Ich hab meine Pistole in die Tasche gesteckt, mir war ganz schön mulmig. Mathias hat ihnen eine Karte gezeigt und sie haben uns durchgewunken. Auf den Straßen von Bouscat waren nur wenige Leute und kein einziges Auto. Mathias ist langsamer gefahren, um den Abstand zwischen ihnen und uns zu vergrößern. Noch immer nichts zu sehen von den Kameraden. Als die Boches angehalten haben, haben auch wir gehalten, etwa hundert Meter dahinter. Wir haben gesehen, wie sie Robert in das – wie wir wussten – zentrale Verhörbüro der Gestapo geschleppt haben. Da war nichts mehr zu machen. Ich habe Mathias angeschaut, er war noch immer sehr blass und die Knöchel seiner um das Lenkrad geklammerten Hände waren weiß. Ich hätte ihn am liebsten sofort umgebracht. Das hat er erraten, denn er hat zu mir gesagt:
›Das Einzige, was du davon hättest, wäre, dass sie dich auch verhaften. Seine Frau und die anderen müssen gewarnt werden. Ich schwör’s dir, ich habe niemanden verraten. Es muss bei euch Verräter geben.‹
Ich hab ihm gesagt, er soll losfahren, und wir sind langsam an dem Schloss, in dem Kommandant Luther wohnt, fast direkt gegenüber von der Nr. 197, vorbeigefahren. Alles war ruhig.«
Der Mann leerte sein Glas Wein, das ihm Léon gebracht hatte. »Und dann?«, fragte Léa.
»Dann sind wir zum Bahnhof Saint-Jean zurückgefahren, um zu sehen, ob die anderen vielleicht dort wären. Nachdem wir uns im Bahnhof umgesehen hatten, meinte Mathias:
›Wir dürfen hier nicht bleiben, wir würden bloß auffallen. Fahren wir nach Saint-Macaire und warnen Mireille.‹
Wir sind das rechte Ufer der Garonne entlanggefahren. Kurz vor Rions sind wir von Milizen gestoppt worden, die nach den Urhebern eines am Vorabend verübten Sabotageaktes gesucht haben. Am Ausgang von Saint-Maixant war wieder eine Kontrolle, diesmal von den Deutschen. Als wir endlich in Saint-Macaire ankamen, waren seit Roberts Festnahme schon drei Stunden vergangen.
›Wir sollten besser den Weg am Hafen entlang nehmens‹, hat Mathias gesagt.
Unterhalb der Schlossruine hat er angehalten und das Auto in einer Grotte versteckt, die die Tresterschnapsbrenner als Remise benutzen. Dann sind wir die Böschung raufgeklettert und waren hinter der Kirche.
›Mach bloß kein Geräusch‹, hat er zu mir gesagt und schien gar nicht zu bemerken, dass die Pistole wieder auf ihn gerichtet war. Kein Mensch war auf den Gassen, die meisten Fensterläden waren geschlossen, obwohl noch Tag war. Plötzlich waren zwei Schüsse auf der Straße zu hören.
›Das kommt aus der Richtung von Roberts Haus!‹, hat Mathias ausgerufen. Im Schutz einer Toreinfahrt haben wir dann die Verhaftung von Mireille miterlebt, die von einem deutschen Unteroffizier in ein Auto geschoben wurde. Vor der Metzgerei hat ein Hund seinen letzten Blutstropfen vergossen. Ein Soldat hat dem Kadaver lachend einen Fußtritt versetzt, so dass er fast bis zu uns hergerollt ist. Ich hab gehört, wie Mathias gemurmelt hat: ›Belle! Sie haben Belle erschossen!‹«
»Sidonies Hund!«, rief Léa aus. »Das arme Tier!«
»Was habt ihr dann gemacht?«, fragte Léon.
»Ich hab Mathias gezwungen, zurückzufahren. In der Nähe von Bazas habe ich ihn erst einmal Georges’ Leuten übergeben, bis wir zu einer Entscheidung kommen.«
»Woher wusstet ihr, wohin Mireille gebracht worden ist?«
»Als wir bei Georges angekommen sind, hatte ihnen gerade ein Kamerad von der Polizei in Bordeaux die Festnahme der beiden gemeldet und auch den jeweiligen Ort, an den sie gebracht worden sind.«
Alle schwiegen bedrückt.
Léon ergriff als Erster wieder das Wort und wandte sich an die beiden jungen Frauen, die Charles an sich gedrückt hielten, dessen Augen ängstlich von einer zur anderen gingen.
»Sie sind hier nicht mehr sicher.«
»Wie können Sie so etwas sagen!«, rief Léa aufgebracht. »Robert würde uns nie verraten.«
»Er wird so lange standhalten, wie er kann, da bin ich mir ganz sicher, aber es ist ein Risiko, das wir nicht eingehen können. Vergessen Sie nicht, dass auch seine Frau verhaftet worden ist. Wenn sie sie in seinem Beisein foltern, wird er reden.«
»Das ist richtig.«
Plötzlich riss Léon seine Flinte, die gewöhnlich im Bett versteckt war, vom Gewehrständer und richtete sie auf die Eingangstür. Alle verstummten. Ein Kratzen war zu hören, dann öffnete sich die Tür und ein Mann im Anorak erschien.
»My goodness, Léon, erkennen Sie mich denn nicht?«
Der Alte ließ das Gewehr sinken und brummte:
»Aristide! Es ist sehr unvorsichtig, einfach so bei den Leuten hereinzuplatzen.«
»Stimmt. Guten Tag, Léa, erinnern Sie sich noch an mich?«
»Sehr gut. Ich freue mich, Sie wiederzusehen.«
»Madame d’Argilat, wenn ich nicht irre«, sagte er und wandte sich Camille zu.
»Ja. Guten Tag, Monsieur.«
»Ich habe gute Nachrichten für Sie. Wegen der bevorstehenden Landung der Alliierten hat Ihr Mann mit der von General Leclerc aufgestellten Division Marokko verlassen. Er ist am 21. April im Hafen von Swansea im Süden von Wales eingetroffen. Der General ist selbst zur Begrüßung erschienen.«
Camille strahlte vor Freude. Wie schön sie ist, dachte Léa. Aus einem Impuls der Zuneigung heraus küsste sie sie. Wie fern erschien ihr jetzt die Zeit, da sie Camille hasste als Ehefrau des Mannes, den sie zu lieben geglaubt hatte und den sie während einer Nacht in den backsteinroten Kellergewölben von Toulouse zu ihrem Geliebten gemacht hatte. Heute teilte sie ohne Hintergedanken das Glück dieser jungen Frau, die ihre Freundin geworden war.
»Ich danke Ihnen für diese gute Nachricht, Monsieur.«
»Ich glaube, ich kann Ihnen versichern, dass Sie bald weitere Nachrichten erhalten werden. Doch jetzt müssen Sie fort von hier. Ich hätte Sie gern zu einer Freundin in Souprosses gebracht, aber ich fürchte, sie wird von Grand-Cléments Leuten, die mich suchen, beobachtet.«
»Und wenn wir einfach nach Montillac zurückgingen, da wir doch nicht gesucht werden?«
»Das wissen wir nicht. Es wäre ein zu großes Wagnis.«
»Für ein paar Tage könnten wir ins Taubenhaus gehen«, schlug Léon vor. »Das findet keiner im Wald. Es ist zwar nicht sehr komfortabel, aber . . .«
»Das Leben ist wichtiger als der Komfort«, erklärte Aristide. »Packen Sie Kleidung und Vorräte für ein paar Tage zusammen, wir brechen sofort auf. Gibt es Wolldecken in dem Haus?«
»Ich glaube, ja. Ich werde noch eine saubere für den Kleinen mitnehmen.«
»Was haben Sie mit Mathias vor?«, fragte Léa Aristide, den englischen Agenten.
»Wenn’s nach mir ginge, ich ließe ihn im Wald Schwerarbeit verrichten«, brummelte Léon.
»So leicht kann man ihn nicht davonkommen lassen. Er muss verhört werden. Und obwohl ich sonst wirklich jedem misstraue, neige ich dazu, ihn für unschuldig an diesen Verhaftungen zu halten.«
»Immerhin arbeitet er für die.«
»Da ist er leider nicht der Einzige. Doch es ist nicht bewiesen, dass er selbst jemanden getötet hat.«
»Wir sind bereit, Monsieur«, erklärte Camille, die ihre kleine Reisetasche schon in der Hand hielt.
Oberst Claude Bonnier, Militärbeauftragter für die Region und bekannt unter dem Decknamen Hypothenuse, war im November 1943 vom Zentralbüro für Nachrichtendienste und Aktionen mit dem Auftrag nach Frankreich geschickt worden, den Widerstand in Aquitanien nach Grand-Cléments Verrat neu zu organisieren.
Im Februar 1944 nahm ihn die Gestapo in Bordeaux gefangen, als er von seinem Sendegerät in der Rue de Galard aus eine Botschaft nach London schicken wollte. (Sein Funker war nach einer Denunziation verhaftet worden und hatte seinerseits Hypothenuse denunziert, der dann in einen von einem Leutnant Kunesch gelegten Hinterhalt geriet.)
Er war nach Le Bouscat an der Route du Médoc gebracht und gegen achtzehn Uhr von Dohse selbst verhört worden. Er hatte hartnäckig geleugnet, dass er von London geschickt worden sei, dass er Claude Bonnier alias Bordin heiße (obwohl von Toussaint, den Brüdern Lespine, Durand und Grolleau identifiziert) und dass er die Exekution von Oberst Camplan1, der des Verrats verdächtigt wurde, angeordnet habe.
Nach etwa zwanzig Minuten hatte Dohse wütend angeordnet, ihn in eine Kerkerzelle zu bringen. Er wolle das Verhör nach dem Abendessen fortsetzen. Bonnier wurde eingesperrt, ohne dass man ihm die Handschellen abgenommen hatte. Spätnachts wurde Dohse aus der Offiziersmesse herbeigeholt: In Hypothenuses Zelle gingen merkwürdige Dinge vor. Als er im Keller des Hauses Nr. 197 der Route du Médoc, das als Gefängnis diente, erschien, lag Bonnier auf dem Boden, von Krämpfen geschüttelt und mit schäumendem Mund, Gesicht und Lippen staubverschmiert. Er stöhnte leise. Der Wachhabende, der über ihn gebeugt war, richtete sich auf.
»Er hat sich mit Zyankali vergiftet.«
»Das seh ich auch, Dummkopf! Haben Sie ihn nicht durchsucht?«
»Selbstverständlich, Herr Leutnant, aber die Kapsel muss in seinem Jackenfutter versteckt gewesen sein.«
»Wie hat er das fertig gebracht, mit gefesselten Händen?«
»Er muss die Kapsel mit den Zähnen erwischt haben, aber dann ist sie ihm entfallen. Die Flüssigkeit hat sich auf dem Fußboden ausgebreitet und er hat sie aufgeleckt. Daher stammt auch der Staub in seinem Gesicht und deshalb war er auch nicht sofort tot.«
»Rufen Sie schnell einen Arzt.«
»Zu Befehl, Herr Leutnant!«
Er ging hinaus und schrie: »Einen Arzt, schnell, einen Arzt!«
Vergeblich hielten sich die Gefangenen in den Nachbarzellen die Ohren zu, um die Schreie und das Stöhnen nicht zu hören. Hatten sie Gewissensbisse angesichts des Leidens des Mannes, den sie denunziert hatten, diese zwanzigjährigen Widerstandskämpfer, die von Dohse manipuliert worden waren? Nein, gewiss nicht. Es erschien ihnen nur gerecht, dass der, der Oberst Camplan, ihren Chef, hatte töten lassen, dies mit seinem Leben bezahlte.
Claude Bonnier starb im Morgengrauen, ohne geredet zu haben.
Friedrich Dohse hatte tief beeindruckt gemurmelt: »Diese Leute aus London sind nicht wie die anderen.«
Paradoxerweise hatte dieser Tod, der alle Energien hätte lähmen müssen, die Untergrundkämpfer mobilisiert und ihre Kräfte neu belebt.
So war es auch, als Robert verschwand.