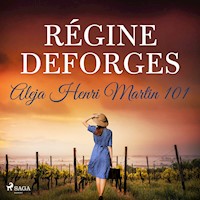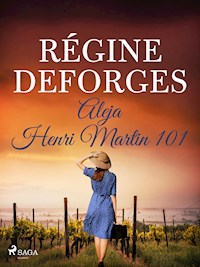Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Das blaue Fahrrad
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Frankreich zu Zeiten des zweiten Weltkriegs. Léa Delmas übernimmt nach dem Tod ihrer Eltern das Weingut der Familie in Montillac. Mit dem Fortschreiten des Krieges und der Besatzung durch Deutschland wird die Lage für Léa, ihre Freunde und ihr Weingut immer schwieriger. Schließlich schließt sie sich der Widerstandsbewegung an. Der dramatische zweite Teil von Régine Deforges Bestseller-Trilogie "Das blaue Fahrrad". -
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 530
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Régine Deforges
Die weiße Lilie
Übersezt von Hild Wollenhaupt
Roman
Saga
Die weiße Lilie
Übersezt von Hild Wollenhaupt
Titel der Originalausgabe: 101, avenue Henri-Martin
Originalsprache: Französisch
101, Avenue Henri Martin © Libraire Arthème Fayard, 1993.
© der deutschsprachigen Ausgabe 1999 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
Erschienen im Ullstein Taschenbuch Verlag
Cover image: Shutterstock & Unsplash
Copyright © 1999, 2022 Régine Deforges und SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788728422380
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
www.sagaegmont.com
Saga ist Teil der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt.
Für meine Tochter Camille
PROLOG
In der Nacht vom 20. auf den 21. September 1942 schlug das bis dahin sehr heiße Wetter um; es begann zu regnen, und ein für die Jahreszeit zu kalter Wind blies von der Girondemündung die Garonne hinauf. Den ganzen Sommer über hatten heftige Unwetter, die teils von Hagelschauern begleitet waren, die Winzer in Sorge versetzt. Es würde kein guter Jahrgang werden.
Von der Kathedrale St. André schlug es vier Uhr. Prosper Guillon und sein Sohn Jean wurden durch Schläge an die Tür ihrer Zelle im Fort du Hâ geweckt. Nacheinander erleichterten sie sich in der Dunkelheit, hockten sich dann wieder auf ihre Strohsäcke und warteten auf das Tageslicht und den Viertelliter gefärbten Wassers, den sie als Kaffee vorgesetzt bekamen. Jean dachte an seine Frau Yvette, die in der Boudet-Kaserne interniert war und von der er nichts mehr gehört hatte seit jenem Tag im Juli, als Gestapo und Polizei um fünf Uhr morgens in Les Violettes, seinen Hof in Thors, eingedrungen waren. Er sah die Verhaftung seiner Eltern wieder vor sich und die von Albert und Elisabeth Dupeyron, beide militante Kommunisten, die in Bordeaux Waffen für die Gruppe F.T.P. besorgen wollten.
Der Schreinergeselle Gabriel Fleureau fuhr schreiend aus dem Schlaf auf. Das ging so jede Nacht seit den Verhören, denen ihn die beiden Schweinehunde der Brigade des Kommissars Poinsot unterzogen hatten. Sie hatten ihm alle Finger der rechten Hand gebrochen, doch er hatte nichts ausgesagt. Er schöpfte Mut aus seiner Liebe zu Aurore, einem jungen Mädchen, das regelmäßig in das Möbelgeschäft von Monsieur Cadon am Quai de la Salinière kam und Flugblätter ablieferte, die Bergua und er dann verteilten. Daß auch seine Freundin verhaftet worden war, wußte er nicht. Vorsichtig bewegte er seine geschundenen Finger.
Auf dem Strohsack neben ihm richtete sich René Antoine stöhnend auf. Das Bild seines kleinen zehnjährigen Michel, der die Arme nach ihm ausstreckte und »Papa« rief, während er zusammen mit seiner Mutter Hélène weggeschafft und in der Boudet-Kaserne interniert wurde, verfolgte ihn. Sie mußten denunziert worden sein, sonst hätten die Deutschen den Waffenvorrat, der im hintersten Winkel seines Gartens in Bègles versteckt war, nicht gefunden.
Denunzierung vermutete auch René Castera. Sein Vater, seine Mutter und sein Bruder Gabriel waren am 8. Juli verhaftet worden, er selbst am 14. desselben Monats. Seit zwei Jahren versteckte seine Familie Juden und andere Verfolgte und leistete den Angehörigen von Inhaftierten Beistand. Wie René Antoine war auch er ohne jede Nachricht von seinen nächsten Verwandten.
In einer anderen Zelle im Erdgeschoß tröstete Albert Dupeyron den erst zwanzigjährigen Camille Perdriau. Das bewahrte ihn davor, ständig an seine junge Frau Elisabeth zu denken, die gleichzeitig mit ihm festgenommen worden war.
Alexandre Pateau ballte die Fäuste, während er an die Mißhandlungen dachte, die seiner Frau Yvonne in Gegenwart des vierjährigen Stéphane zugefügt worden waren. Sie gehörten beide dem Widerstand an. Man hatte sie in ihrem Haus in Saint-André-de-Cognac aufgespürt, zunächst nach Cognac gebracht, dann ins Fort du Hâ.
Raymond Bierge grübelte darüber nach, welcher Mistkerl ihn und seine Frau Félicienne denunziert haben mochte und dabei verraten hatte, daß sie Druckmaterial bei sich versteckten. Hoffentlich würde sich die Großmutter gut um den Kleinen kümmern!
Jean Vignaux aus Langon wunderte sich, daß er sich so deutlich an das junge Mädchen erinnerte, in das seine besten Freunde, Raoul und Jean Lefèvre, verliebt waren, an die bezaubernde Léa Delmas. Das letzte Mal, daß er sie gesehen hatte, war sie mit wehendem Haar auf ihrem Rad die Straße zum Gut Montillac entlanggefahren.
In den Zellen gingen die Glühlampen an, eine nach der anderen. Die Gefangenen blinzelten und erhoben sich langsam.
Seit dem gestrigen Abend wußten sie es.
Die ganze Nacht über hatte der Wind geweht, sich in Stößen durch die Türritzen und die schlecht zusammengefügten Bohlen der Baracken gedrängt und den Männern ein wenig Luft gebracht, die dort auf unbequemen, notdürftig mit schmutzigen Strohsäcken bedeckten Metallpritschen lagen. Es war fünf Uhr morgens. Die Gefangenen schliefen nicht.
Lucien Valina aus Cognac dachte an seine drei Kinder, besonders an den kleinen Serge, der gerade sieben Jahre alt geworden war und von seiner Frau Margot zu sehr verwöhnt wurde. Mit welcher Brutalität hatten die Deutschen sie auf einen Kleinlaster gestoßen! Wo mochten sie jetzt wohl sein?
Gabriel Castéra machte sich Gedanken um seinen Vater Albert, den er einige Stunden zuvor zum Abschied umarmt hatte. Dann wurde er abgeholt und in eine Baracke gebracht, die ein wenig abseits von den anderen stand. Die Erinnerung an die Tränen auf den Wangen des alten Mannes war ihm unerträglich. Glücklicherweise war sein älterer Bruder René noch da.
Jean Lapeyrade tat das Herz weh, wenn er René de Oliveria betrachtete oder auch jenen jungen Burschen, dessen Namen er nicht kannte und der die halbe Nacht Mundharmonika gespielt hatte, um seine Angst zu verbergen. Wie jung sie waren! »Berthe, wo bist du?«
»Erzieh den Kleinen nicht im Geiste der Vergeltung und des Hasses«, hatte Franc Sanson seiner Frau geschrieben.
Im Lager herrschte ein ungewohntes Hin und Her. Als die Tür plötzlich aufgestoßen wurde, erblickte Raymond Rabeaux Lastwagen der Wehrmacht, umgeben von Dutzenden Infanteristen. Die kalte, feuchte Luft überraschte ihn. Es war noch immer dunkel. Die Sturmlaternen ließen große Wasserpfützen aufglänzen. Gegenüber der Tür brachten die Deutschen ein Maschinengewehr in Stellung. Die Harmonika war verstummt.
Seit dem gestrigen Abend wußten sie es.
Ein Untergebener des Lagerleiters Rosseau, der mit einem deutschen Offizier sprach, trat in die Baracke.
»Also, ihr kommt raus, wie ihr aufgerufen werdet. Laßt die Männer nicht warten, beeilt euch. Espagnet, Jougourd, Castéra, Noutari, Portier, Valina, Chardin, Meiller, Voignet, Eloi . . .«
Einer nach dem anderen traten die Gefangenen heraus, stellten sich unter den Stößen der Soldaten in einer Reihe auf, schlugen die Jackenkragen hoch und setzten sich ihre Basken- oder Schildmützen auf.
»Vorwärts, steigt auf die Lastwagen! Jonet, Brouillon, Meunier, Puech, Moulias . . .«
Mit der Behendigkeit seiner zweiundzwanzig Jahre kletterte Franc Sanson als erster hinauf.
Durch das Lager ging es wie ein Lauffeuer. Hinter den Fenstern jeder Baracke drängten sich die auf geheimnisvolle Weise unterrichteten Gefangenen. Erst einer, dann zwei, zehn, hundert, tausend Männer stimmten die Internationale an. Wie ein mächtiges Dröhnen schwoll es an in jeder Brust und grüßte die Abfahrenden, half ihnen, Mut und Würde zu bewahren. Der Schlamm, der Regen, das Geschrei der Wachmänner, selbst die Angst waren wie ausgelöscht durch diese herrliche, hoffnungsvolle Melodie.
Es war sieben Uhr morgens. Die Lastwagen, die von der Boudet-Kaserne, vom Fort du Hâ und dem Lager Mérignac aufgebrochen waren, fuhren die Straße nach Souges entlang. Beim Anblick des vorbeifahrenden Konvois bekreuzigten sich die Frauen, und die Männer nahmen die Kopfbedeckung ab. Auf der Zufahrt zum Militärlager bremsten die Fahrer die Lastwagen ab. Die Gefangenen hingen unter den Planen ihren Gedanken nach und ließen sich von den vier Soldaten, die ihre Waffen auf sie gerichtet hielten, nicht beeindrucken. Das Gerüttel auf dem zerfurchten Weg warf sie gegeneinander.
Die Lastwagen hielten an. Die Soldaten schlugen die Plane zurück, ließen die Rückklappe herab und sprangen in den Sand.
»Schnell . . . schnell . . . Aussteigen!«
Die in einer Ecke zusammengetriebenen Gefangenen begannen unwillkürlich zu zählen: Siebzig. Sie waren siebzig. Siebzig Männer, die seit dem gestrigen Abend wußten, daß sie sterben würden.
Nach einem Attentat auf einen deutschen Offizier in Paris hatten Karl Oberg, Chef der SS und der Polizei, und Helmuth Knochen von der Vichy-Regierung einhundertundzwanzig Geiseln gefordert, alle namentlich aufgelistet. Sechsundvierzig Gefangene aus den Lagern von Compiègne und Romainville. Wilhelm Dohse von der Gestapo in Bordeaux hatte die Namensliste vervollständigt.
»Gabriel!«
»René!«
Die Brüder Castéra fielen sich in die Arme. Jeder hatte inständig gehofft, daß der andere verschont bliebe.
Ein dicklicher Offizier pflanzte sich vor den Geiseln auf und verlas ein Schriftstück: zweifellos das Urteil. Als ob ihnen das noch etwas bedeutete! Plötzlich übertönte eine junge Stimme die des Deutschen:
Allons enfants de la patrie
Le jour de gloire est arrivé.
Contre nous de la tyrannie
L’étendard sanglant est levé . . .
Zunächst verhalten, dann kraftvoll schlägt der Gesang den Feinden entgegen. Diese verstehen zwar die drohenden Worte nicht, begreifen jedoch, daß sich der zitternde Haufen in eine Horde verwandelt hat, die Vergeltung schwört.
Entendez-vous dans nos campagnes,
Rugir ces féroces soldats . . .
Alle fünf Meter erhebt sich ein Pfahl. Es sind insgesamt zehn, entlang einer sandigen Böschung, vor denen sich nun eine entsprechende Anzahl Männer aufstellt. Sie werden an die Pfähle gebunden, lassen es jedoch nicht zu, daß man ihnen die Augen verbindet. Ein alter zittriger Priester erteilt ihnen den Segen. Das Exekutionskommando nimmt die Plätze ein. Ein Befehl erschallt, die erste Salve wird abgeschossen. Beim Aufprall der Kugeln bäumen sich die Körper auf und sinken dann langsam zusammen.
Die Stimmen haben für den Bruchteil einer Sekunde innegehalten; dann, kräftiger als zuvor, erklingen sie durch den regnerischen Morgen:
Aux armes, citoyens . . .
Siebzigmal wird der Todesschuß abgefeuert. Die Leichen der Hingerichteten werden in einen breiten, hinter der Böschung ausgehobenen Graben geworfen. Der Regen hat aufgehört. Die bleiche Sonne scheint auf die Sandgrube. Ein Geruch nach Pilzen und Kiefern vermischt sich mit dem Pulverdampf. Am Fuß der Pfähle glänzt das mit dem Wasser der Pfützen vermischte Blut, ehe es vom Sand aufgesogen wird.
Nachdem sie ihre Mission erfüllt haben, ziehen die Soldaten ab. Es ist neun Uhr morgens in der Heide von Souges bei Bordeaux am 21. September 1942.
1.
Nach dem Tod von Pierre Delmas hatte sich seine Schwester Bernadette Bouchardeau bemüht, die Gutsverwaltung in die Hand zu nehmen. Dabei war ihr guter Wille ebenso offensichtlich wie ihre Unfähigkeit, ein Weingut wie Montillac zu leiten.
Sie saß hinter dem Schreibtisch ihres Bruders, hatte Unterlagen vor sich ausgebreitet und wandte sich seufzend an Camille d’Argilat, die angeboten hatte, ihr zu helfen.
»Mein Gott, wie soll das bloß weitergehen? Ich verstehe diesen Zahlenkram nicht. Ich muß Kellermeister Fayard fragen.«
»Gehen Sie ruhig schlafen, Madame, ich werde versuchen, mich durchzuarbeiten.«
»Danke, meine liebe Camille, das ist sehr freundlich von Ihnen«, sagte Bernadette während sie sich erhob. »Léa sollte sich mehr zusammennehmen«, fügte sie hinzu und nahm ihre Brille ab. »Ich habe auch meinen Kummer, aber ich lasse mich nicht so gehen.«
Camille verbarg ein Lächeln.
»Sie sind zweifellos stärker.«
»Zweifellos«, bestätigte Bernadette Bouchardeau.
Wie dumm diese Frau doch ist, dachte Camille.
»Gute Nacht, mein Kind. Gehen Sie nicht zu spät zu Bett.«
Die Tür schloß sich geräuschlos. Schwerfällige Schritte treppauf, das Knarren der zehnten Stufe, dann wieder die Stille des schlafenden Hauses, eine Stille, die hin und wieder von den Stößen des kalten Novemberwindes unterbrochen wurde, der die Wände erschauern und die Flammen im Kamin auflodern ließ.
Camille betrachtete das Feuer, ohne es wahrzunehmen. Plötzlich brach ein Scheit auseinander und ließ Funken und Glutstückchen auf den Teppich stieben. Die junge Frau fuhr zusammen und beeilte sich, die Stücke mit der Feuerzange einzusammeln. Dabei warf sie gleich noch etwas Rebenholz aufs Feuer, das alsbald fröhlich prasselte. Dann band sie die Kordel ihres Morgenrocks fester und setzte sich an den Schreibtisch von Pierre Delmas.
Camille arbeitete konzentriert einen Teil der Nacht hindurch und hob den Kopf nur, um sich den schmerzenden Nacken zu reiben. Die Standuhr schlug drei.
»Du schläfst ja noch nicht!« rief Léa, als sie hereinkam.
»Du offensichtlich auch nicht«, antwortete Camille mit freundlichem Lächeln.
»Ich wollte mir nur ein Buch holen, ich kann nicht schlafen.«
»Hast du das Pulver genommen, das dir Doktor Blanchard verschrieben hat?«
»Ach, das macht mich nur tagsüber ganz benommen.«
»Sag’s ihm, er verschreibt dir dann etwas anderes. Du mußt doch schlafen.«
»Das möchte ich ja auch gerne, aber gleichzeitig fürchte ich mich davor. Sobald ich einschlafe, erscheint mir wieder der Mann aus Orléans mit seinem blutüberströmten Gesicht. Er kommt näher, versucht mich zu packen und fragt: ›Warum hast du mich umgebracht, du Miststück, du kleine Hure? Komm, meine Süße, komm, ich werde dir zeigen, wie schön es ist, sich mit einem Toten zu lieben. Das wird dir bestimmt gefallen. Na, los, du Miststück, Aas magst du doch . . .‹«
»Hör auf«, schrie Camille, packte Léa bei den Schultern und schüttelte sie. »Hör auf!«
Erschöpft fuhr sich Léa mit der Hand über die Stirn und ließ sich auf das alte Ledersofa fallen.
»Du kannst es dir gar nicht vorstellen. Es ist einfach schrecklich, besonders, wenn er zu mir sagt: ›Genug gespielt. Jetzt wollen wir uns mit deinem Vater treffen. Er erwartet uns schon bei seinen Freunden, den Würmern . . .‹«
»Sei still!«
»›. . . zusammen mit deiner geliebten Mama.‹ Dann folge ich ihm und rufe dabei laut nach meiner Mutter.«
Camille kniete sich vor Léa hin und nahm sie in die Arme, wiegte sie, wie sie es bei ihrem Sohn tat, dem kleinen Charles, wenn ein böser Traum ihn weinend in ihr Bett trieb.
»Komm, beruhige dich. Denk nicht mehr daran. Wir alle beide haben den Mann umgebracht. Erinnere dich doch: Ich habe als erste auf ihn geschossen. Ich dachte, er sei tot.«
»Das stimmt; aber ich war es, ich ganz allein, die ihn schließlich getötet hat.«
»Du hattest keine andere Wahl; entweder er oder wir. Dein Onkel Adrien hat dir doch versichert, daß er es an deiner Stelle genauso gemacht hätte.«
»Das hat er nur gesagt, um mich zu beruhigen. Oder kannst du dir das vorstellen: ein Dominikaner, der einen Menschen umbringt?«
»Ja, wenn es sein müßte.«
»Das haben mir Laurent und François Tavernier auch erklärt. Aber ich bin überzeugt, daß Adrien dazu nicht fähig ist.«
»Lassen wir das Thema. Ich habe Ordnung in die Bücher deines Vaters gebracht. Die Lage ist nicht gerade rosig. Ich verstehe Fayards Buchführung nicht. Aber wenn wir uns einschränken, müßten wir hinkommen.«
»Wie sollen wir uns denn noch mehr einschränken?« rief Léa aus und sprang auf. »Es gibt nur einmal wöchentlich Fleisch, und was für welches! Wenn wir ein paar Leute weniger wären, könnten wir es schaffen, aber so . . .«
Camille senkte den Kopf.
»Ich weiß sehr wohl, daß wir dir eine große Last sind. Ich werde dir später einmal alles zurückzahlen, was du für uns ausgegeben hast.«
»Bist du verrückt? Das wollte ich doch damit nicht sagen.«
»Ich weiß«, antwortete Camille traurig.
»Also, nun mach bloß nicht so ein Gesicht. Man darf dir aber auch gar nichts sagen.«
»Verzeih mir.«
»Ich habe dir nichts zu verzeihen. Du machst deine Arbeit und momentan meine sogar auch noch.«
Léa zog die Vorhänge auf. Der Mond erhellte mit seinem kalten Licht den bekiesten Hof, während der Wind versuchte, der großen Linde die letzten Blätter zu entreißen.
»Glaubst du, daß der Krieg noch lange dauern wird?« fragte sie. »Alle scheinen es ganz normal zu finden, daß die Vichy-Regierung mit Deutschland kollaboriert.«
»Nein, Léa! Nicht alle. Du brauchst dich nur in unserer Umgebung umzuschauen. Da gibt es mindestens zehn Personen, die den Kampf fortführen.«
»Was sind schon zehn gegen die Hunderttausende, die tagtäglich ›Es lebe Pétain‹ schreien?«
»Wir werden bald Hunderte und Tausende sein, die sich widersetzen.«
»Ich glaube es nicht mehr. Alle denken doch nur noch daran, sich satt essen zu können und nicht mehr frieren zu müssen.«
»Wie kannst du so was sagen! Die Franzosen sind zwar noch wie betäubt von der Niederlage, aber ihr Vertrauen in Marschall Pétain bröckelt. Sogar Fayard meinte neulich: ›Finden Sie nicht auch, Madame Camille, daß er ein bißchen zu weit geht, der Alte?‹ Und das von Fayard!«
»Der wollte dich aufs Glatteis führen. Ich kenne ihn, das ist ein ganz Gerissener. Der versucht herauszukriegen, was du denkst, und spielt es dann gegen dich aus, wenn es ihm nützlich ist. Ihm bedeuten nur ARBEIT, FAMILIE, VATERLAND etwas.«
»Mir auch, aber nicht dasselbe.«
»Sei auf der Hut. Sein einziges Ziel ist, uns Montillac wegzunehmen. Dabei schreckt er vor nichts zurück. Außerdem ist er überzeugt, daß sein Sohn Mathias nur wegen mir fortgegangen ist.«
»So ist es doch wohl auch, oder?«
»Das ist nicht wahr«, schrie Léa wütend. »Ich habe im Gegenteil versucht, ihn zurückzuhalten. Es ist nicht meine Schuld, daß er nicht hören wollte und lieber nach Deutschland gegangen ist, um dort Geld zu verdienen, statt auf Montillac zu arbeiten.«
»Meine Liebe, du übertreibst. Du weißt sehr gut, warum er gegangen ist.«
»Nein!«
»Weil er dich liebt.«
»Na, großartig! Wenn er mich liebte, wie du behauptest, hätte er hierbleiben müssen, um mir zu helfen und um zu verhindern, daß sein Vater uns bestiehlt.«
»Er hätte sich auch General de Gaulle anschließen können. Jedenfalls habe ich Verständnis dafür, daß er gegangen ist.«
»Du bist zu nachsichtig.«
»Das darfst du nicht glauben. Ich verstehe sein Verhalten, weil er es aus Liebe getan hat. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn ich in der Situation von Mathias oder Françoise gewesen wäre. Ich hätte vielleicht genauso gehandelt wie sie.«
»Du redest dummes Zeug. Du hättest dich nie von einem Deutschen schwängern lassen, wie die unglückselige Françoise.«
»Sprich nicht so von deiner Schwester.«
»Sie ist nicht mehr meine Schwester. Papa ist nur wegen ihr gestorben.«
»Das ist nicht wahr. Doktor Blanchard hat gesagt, sein Herz sei schon seit Jahren angegriffen gewesen, doch er habe sich trotz der inständigen Bitten deiner Mutter stets geweigert, sich behandeln zu lassen.«
»Ich will das nicht hören! Wenn Françoise nicht gegangen wäre, würde er noch leben«, schrie Léa und verbarg ihr Gesicht schluchzend in den Händen. Ihre Schultern bebten.
Camille verspürte den Drang, Léa zu trösten, ließ dann aber doch davon ab. Wie konnte Léa die Gefühle anderer derart mißachten? Das ist ihre Stärke, behauptete Laurent. Sie will nur das Nächstliegende sehen. Sie prescht voran und stellt sich die Fragen erst hinterher. Nicht aus Mangel an Intelligenz, sondern aus einem Überschuß an Vitalität heraus.
Léa verkniff es sich, wie früher als Kind mit dem Fuß aufzustampfen, und wandte sich Camille zu.
»Hör auf, mich so anzuschauen. Geh schlafen! Du müßtest mal sehen, wie du aussiehst.«
»Du hast recht, ich bin müde. Aber du solltest dich auch hinlegen. Gute Nacht.«
Camille gab ihr einen Kuß, den Léa gleichgültig hinnahm, ohne ihn zu erwidern. Wortlos verließ Camille das Zimmer.
Wütend auf Camille und auf sich selbst, warf Léa noch etwas Rebenholz in das Kaminfeuer, entnahm einem der unteren Fächer des Bücherschranks die karierte Decke, in die sich ihr Vater so gern eingehüllt hatte, löschte die Lampe und streckte sich auf dem Sofa aus. Sie blickte jedoch nicht lange in die Flammen; das Flakkern ließ sie bald einschlafen.
Seit dem Tod ihres Vaters verbrachte Léa häufig die Nacht in diesem ihr liebgewordenen Raum, dem einzigen, in dem sie nicht von den Bildern der Vergangenheit bedrängt wurde.
Die Kälte weckte Léa auf. Ich muß daran denken, mein Federbett herunterzubringen, sagte sie sich. Sie öffnete die Vorhänge und hatte das seltsame Gefühl, in den Wolken zu sein, so dicht war der Nebel draußen. Dennoch ließ sich hinter diesem Schleier das Tageslicht erraten. Es wird schön werden, dachte sie. Mit sicheren Bewegungen zündete sie das Feuer wieder an und blieb einen Augenblick davor hocken, um sich zu wärmen. Mechanisch zählte sie das Schlagen der Standuhr. Elf. Elf! Es war schon elf Uhr. Warum hatte man sie nur so lange schlafen lassen.
Die Feuerstelle der Küche verdrängte mit hohen Flammen aus aufgeschichtetem Rebenholz die Dunkelheit, die der Nebel, der sich nicht heben wollte, über den großen Raum gebreitet hatte. Auf dem mit blauem Wachstuch bedeckten Tisch stand Léas Kaffeeschale, daneben lag ihre Serviette, in die ein Stück Brioche eingeschlagen war. Gierig schnupperte Léa an dem duftenden Gebäck. Die Brioche hat Sidonie gebacken, dachte sie. In einer Ecke des Herdes stand die alte blauemaillierte Kaffeekanne. Léa schenkte sich Kaffee ein, der mehr eine dünne braune Brühe war. Gut, daß die Milch den Geschmack überdeckte.
Während sie aß, überlegte sie: Welchen Tag haben wir denn heute, daß es Brioche gibt? Die Antwort erhielt sie beim Blick auf das Kalenderblatt. Der 11. November. Sidonie hatte auf ihre Weise das Ende des Krieges 1914/18 begehen wollen. Mit einem freudlosen Lächeln zuckte Léa die Achseln. Wann würde das Ende dieses Krieges kommen? Er dauerte nun schon über zwei Jahre. Heute, am 11. November 1942, war Frankreich noch immer zweigeteilt. Immer mehr junge Leute weigerten sich, in Deutschland zu arbeiten, und flüchteten in die Berge oder die Wälder, wo sie Banden bildeten, die nach einem Anführer suchten. Sie lebten von der Großzügigkeit der Bevölkerung, gelegentlich auch von Plünderungen. Laurent d’Argilat hatte den Auftrag, die Rebellen in seinem Bezirk zu gruppieren und sie den Widerstandsorganisationen einzugliedern, die sich gebildet hatten. Laurent . . . Léa hatte ihn seit der Beerdigung ihres Vaters nicht wiedergesehen. Seine Frau Camille hatte sich einmal in Toulouse mit ihm getroffen, und Léa war ganz krank gewesen vor Eifersucht. Und Tavernier, was mochte der wohl machen? Er hätte sich zumindest mal nach ihrem Befinden erkundigen können. Wegen ihm hatte sie schließlich die größte Angst ihres Lebens ausgestanden: schwanger zu sein. Dieser falsche Alarm ließ sie die Ratlosigkeit ihrer Schwester Françoise besser verstehen, deren Baby nun bald zur Welt kommen würde. Françoise hatte ihr einen Brief geschrieben und sie inständig gebeten, ihr bei der Geburt ihres Kindes zur Seite zu stehen. Doch Léa hatte sich so in ihren Kummer und Haß eingekapselt, daß sie nicht geantwortet hatte.
»Camille, Ruth, Léa, Tante Bernadette«, schrie Laure, während sie in die Küche gestürzt kam.
»Was gibt’s denn?« fragte Léa und erhob sich.
»Bist du das, Laure, die hier so schreit?« wollte Ruth beim Hereintreten wissen. Doch Léas jüngste Schwester konnte vor Atemlosigkeit nicht sprechen.
Durch die Tür, die auf den Gang führte, kam Fayard herein, gefolgt von seiner Frau.
»Haben Sie schon gehört?«
»Was gehört? So reden Sie doch«, bat Ruth.
»Die Boches . . .«
»Was ist mit den Boches?« rief Léa.
»Sie sind in die freie Zone eingefallen«, sagte Laure schnell.
Léa ließ sich auf ihren Stuhl sinken. Camille drückte ihren Sohn fest an sich, der dachte, dies sei ein Spiel, und laut aufjuchzte.
»Wir haben es im Radio gehört«, erklärte Fayard.
»Radio Paris hat angekündigt, daß die Besetzungsentschädigung auf fünfhundert Millionen täglich festgelegt worden ist. Wie soll denn so viel Geld aufgebracht werden?« fügte seine Frau hinzu.
2.
Das Haus der Damen de Montpleynet hatte sich seit Léas letztem Parisbesuch sehr verändert. Die beiden im gleichen Stockwerk gelegenen und durch eine Tür miteinander verbundenen Wohnungen, in denen es einst so lebhaft zuging, waren jetzt der Kälte ausgeliefert. Die zwei Schwestern und ihre Haushälterin bewohnten nur vier Räume. Mehr zu beheizen war nicht möglich. Die drei Schlafzimmer am Ende des Korridors und Albertines gesamte Wohnung blieben unbenutzt, die Möbel durch Tücher geschützt, die Fensterläden geschlossen, die Kamine kalt. Die beiden Damen hatten sich mit dieser Einschränkung abgefunden. Sie hatten alle Räume, die sie nicht heizen konnten, »das kalte Logis« getauft und betraten sie nie.
»Du mußt uns verstehen; wir konnten sie doch nicht allein und krank in diesem Hotel lassen. Das hätte uns deine Mutter nie verziehen«, sagte Lisa de Montpleynet und betupfte sich die Augen mit einem Taschentuch.
»Darüber gibt es nichts mehr zu reden, wir haben unsere Pflicht getan, als Verwandte und als gute Christen«, fügte ihre Schwester Albertine barsch hinzu.
Léa, die in dem kleinen Pariser Wohnzimmer stand, hatte Mühe, ihren Zorn zurückzuhalten.
Ein alarmierender Brief von Albertine – der ihr gar nicht ähnlich sah – hatte Léa veranlaßt, den ersten Zug zu nehmen, der sie nach halbtägiger Wartezeit im Gedränge des Bahnhofs von Bordeaux nach Paris brachte. Bei ihrer Ankunft in der Rue de l’Université war sie von der in buntscheckige Schals gehüllten Estelle, Haushälterin und Mädchen für alles der Damen de Montpleynet, mit offenkundiger Erleichterung an die Brust gedrückt worden. Dabei wiederholte diese ständig, als müsse sie sich selbst überzeugen:
»Da sind Sie ja endlich, Mademoiselle Léa, da sind Sie ja endlich!«
»Was ist denn los, Estelle, wo sind meine Tanten? Sind sie krank?«
»Ach, Mademoiselle Léa, wenn Sie wüßten . . .«
»Léa, da bist du ja«, hatte Lisa ausgerufen, die einen Pelzmantel über ihrem Morgenrock trug.
Kurz darauf war Albertine erschienen, gefolgt von einem Mann, der eine Arzttasche trug. Ihre Tante hatte ihn zur Tür begleitet und gesagt:
»Auf Wiedersehen, Doktor, bis morgen.«
Léa hatte die drei Frauen erstaunt angesehen.
»Wollt ihr mir nicht endlich sagen, wer hier krank ist?«
»Deine Schwester Françoise«, hatte Albertine erwidert.
Diese Antwort hatte Léa die Sprache verschlagen. Dann war auf die Überraschung der Zornausbruch gefolgt. Ihre unbarmherzigen Äußerungen hatten die sensible Lisa in Tränen ausbrechen lassen.
»Léa, Léa, bist du es?« rief eine schwache Stimme hinter einer sich langsam öffnenden Tür hervor. Dann kam Françoise zum Vorschein, den gewölbten Bauch nur halb von einer Wolldecke verhüllt.
Albertine eilte zu ihr. »Was machst du denn da? Der Arzt hat dir doch verboten aufzustehen.«
Ohne ihre Tante zu beachten, ging Françoise auf ihre Schwester zu und streckte ihr die Arme entgegen. Die Decke glitt von ihren Schultern und zeigte ihren riesigen Leib, der noch durch ein zu enges Nachthemd und die Magerkeit ihres Gesichts hervorgehoben wurde.
Sie fielen sich in die Arme.
»O Léa! Danke, daß du gekommen bist.«
Léa brachte sie in ihr Zimmer zurück, das kaum wärmer war als der kleine Wohnraum.
Nachdem sie sich hingelegt hatte, ergriff Françoise die Hand ihrer Schwester, führte sie an die Lippen und murmelte: »Du bist gekommen . . .«
»Beruhige dich doch, mein Schatz, Aufregung schadet dir nur«, sagte Albertine und schüttelte die Kissen auf.
»Nein, Tante Albertine, das Glücklichsein kann einem nicht schaden. Léa, du mußt mir alles erzählen. Alles, was sich in Montillac getan hat.«
Zwei Stunden später schwatzten die Schwestern noch immer.
Léa konnte sich nicht entschließen, das warme weiche Bett zu verlassen, in dem sie sich seit dem Erwachen aalte. Die Vorstellung, in dieser Kälte aufstehen und sich anziehen zu müssen, war ihr unerträglich. Ah, im Bett bleiben zu können, schön im Warmen, bist zum Ende des Winters . . . Bis zum Ende des Krieges . . .
Sie erinnerte sich staunend, welches Vergnügen es ihr gestern abend bereitet hatte, mit Françoise zusammen die glücklichen Augenblicke ihrer Kindheit heraufzubeschwören. Innerhalb weniger Minuten hatte sich eine Vertrautheit zwischen ihnen entwickelt, die sie zuvor nie gekannt hatten. Sie hatten sich gute Nacht gesagt mit dem Gefühl, sich wiedergefunden zu haben, doch sie hatten sorgsam vermieden, das Problem anzusprechen, das sie beide beschäftigte: die Geburt des Kindes und die Zukunft von Françoise.
Es klopfte an der Tür. Estelle kam mit dem Frühstückstablett herein.
»Na so was: Tee und richtiger Zucker!« rief Léa aus, während sie sich aufsetzte: »Wie macht ihr das denn?«
»Das erste Mal seit drei Monaten. Zu deinen Ehren! Ein Freund von Madame Mulstein, ein Schriftsteller, glaube ich, hat uns dazu verholfen.«
»Raphael Malh?«
»Ja, so heißt er. Ein wirklich ziemlich übler Herr. Ich habe ihn neulich auf der Terrasse des Deux Magots gesehen, mit einem jungen deutschen Offizier, dem er den Arm um die Taille gelegt hatte, während er ihm ins Ohr flüsterte. Die anderen Gäste hatten sich geniert abgewandt.«
Léa hatte Mühe, ihr Lächeln zu verbergen, das die alte Bedienstete nicht verstanden hätte.
»Ich habe meinen Damen die Szene beschrieben und ihnen gesagt, daß sie diesen Herrn nicht mehr empfangen dürfen«, fuhr Estelle fort. »Mademoiselle Lisa hat mir geantwortet, daß ich überall nur Böses sähe, daß Monsieur Malh ein vollkommener Gentleman sei und wir es ihm zu verdanken hätten, daß wir noch nicht ganz und gar verhungert seien. Und Mademoiselle Albertine meinte, man dürfe nicht nach dem äußeren Schein urteilen. Was sagen Sie denn dazu, Mademoiselle?«
»Ich kenne Monsieur Malh kaum, Estelle. Ich werde aber meine Tanten bitten, im Umgang mit ihm vorsichtig zu sein.«
»Ich habe eine Kanne heißes Wasser ins Badezimmer gestellt und den elektrischen Heizofen angemacht. Er wärmt zwar nicht viel, aber er macht die Atmosphäre etwas angenehmer.«
»Danke, Estelle; ich hätte ja gern ein Bad genommen.«
»Ein Bad! Die Wanne ist schon seit Monaten nicht mehr benutzt worden. Meine Damen gehen jede Woche einmal in die öffentliche Badeanstalt.«
»Ah, das möchte ich sehen! Sie werden sich kaum trauen, sich auszuziehen, bevor sie ins Wasser steigen.«
»Es ist nicht nett von Ihnen, sich über sie lustig zu machen, Mademoiselle Léa. Das Leben hier ist schwierig. Wir frieren, wir hungern. Und wir haben Angst.«
»Wovor? Für euch besteht doch keine Gefahr.«
»Wer weiß das schon, Mademoiselle. Erinnern Sie sich an die Dame im ersten Stock, die Ihre Tanten ab und zu zum Tee besucht haben?«
»Madame Lévy?«
»Ja. Die Deutschen haben sie verhaftet. Sie war krank, doch sie haben sie aus dem Bett gezerrt und im Nachthemd mitgenommen. Mademoiselle Albertine hat Monsieur Tavernier Bescheid gegeben . . .«
»Tavernier?«
». . . und ihn gebeten, nachzuforschen.«
»Und?«
»Als er ein paar Tage später zu uns kam, war er ganz blaß und wirkte irgendwie zum Fürchten.«
»Was hatte er denn zu berichten?«
»Daß Madame Lévy nach Drancy gebracht worden sei und von dort aus in ein Lager in Deutschland, zusammen mit tausend anderen, fast alles Frauen und Kinder. Seitdem haust in ihrer Wohnung eine Schauspielerin, die auf großem Fuß lebt und häufig Besuch von deutschen Offizieren bekommt. Sie machen einen Höllenlärm, doch keiner wagt es, sich zu beschweren, aus Angst vor Repressalien.«
»Wann war Monsieur Tavernier zuletzt hier?«
»Vor ungefähr drei Wochen. Er hat Ihre Tanten dazu gebracht, Françoise bei sich aufzunehmen.«
Léa spürte, wie ihr Herz schneller schlug. Françoise kümmerte sich um ihre Tanten und ihre Schwester . . .
»Ich muß jetzt gehen, Mademoiselle. In der Rue de Buci soll es heute Fisch geben. Da darf ich nicht zu spät kommen, sonst kriege ich nur noch die Gräten.«
Léa machte schnell Katzenwäsche, streifte über ihr blaues Wollkleid noch einen schwarzen Pullover und eine Jacke, zog dicke Socken an und trat so eingemummelt ins Zimmer ihrer Schwester.
Im Bett sitzend, eingehüllt in Bettjäckchen und rosa Schals, die ihrem Teint Farbe verliehen, frisiert und ausgeruht, sah Françoise Léa lächelnd entgegen.
»Guten Morgen; hast du gut geschlafen?« fragte sie. »Ich habe seit Monaten nicht mehr so gut geschlafen. Das verdanke ich dir.«
Léa küßte sie, ohne zu antworten.
»Gut, daß du da bist. Jetzt werde ich schnell wieder auf den Beinen sein. Ich möchte die Premiere des Stücks von Henry de Montherlant Die tote Königin nicht verpassen.«
»Wann findet sie denn statt?«
»Am 8. Dezember in der Comédie Française.«
»Am 8. Dezember! Das ist ja übermorgen.«
»Na und? Das Baby kommt erst in über einem Monat, und es geht mir eigentlich sehr gut. Eine Schwangerschaft ist ja keine Krankheit. Das wirst du merken, wenn du an der Reihe bist.«
»Hoffentlich nie!«
»Warum nicht? Es ist einfach wundervoll, ein Kind von einem Mann zu erwarten, den man liebt.«
Beim Anblick von Léas verschlossenem Gesicht erkannte Françoise, daß sie zu weit gegangen war. Sie wurde rot und senkte den Kopf. Dann nahm sie ihren ganzen Mut zusammen, hob die Augen und sagte mit unsicherer Stimme:
»Ich weiß, was du denkst. Ich habe versucht, mich davon zu überzeugen, daß es unrecht von mir war, Otto zu lieben. Es ist mir nicht gelungen. Alles an ihm gefällt mir: seine Güte, seine Liebe zur Musik, sein Talent, sein Mut, sogar, daß er Deutscher ist. Das einzige, was ich mir wünsche, ist, daß der Krieg enden möge. Du verstehst das doch, nicht wahr? Versuch es zu verstehen!«
Léa gelang es nicht, über diese Situation ruhig und mit kühlem Kopf nachzudenken. Tief in ihrem Inneren revoltierte etwas gegen diese Liebe, die sie schockierte. Gleichzeitig verstand sie sehr wohl, was Otto und Françoise miteinander verband. Wäre Otto kein Deutscher, würde er einen ganz reizenden Schwager abgeben.
»Was willst du denn tun?« fragte Léa.
»Ihn heiraten, sobald er aus Berlin zurück ist und die Erlaubnis seiner Vorgesetzten erhalten hat. Versprich mir, daß du Trauzeugin sein wirst. Bitte versprich es mir!«
»Das hängt vom Datum ab. Wenn eure Trauung während der Weinlese oder im Frühjahr stattfindet, kann ich nicht.«
»Du wirst es schon einrichten können«, meinte Françoise lächelnd und glücklich darüber, keine deutliche Absage erhalten zu haben.
»Otto ist wundervoll. Er schreibt mir jeden Tag und macht sich solche Sorgen um mich und das Baby. Er hat mir Friedrich Hanke als Beschützer zur Seite gestellt. Du erinnerst dich doch an ihn, er hat dir damals bei Camilles Niederkunft beigestanden.«
»Na prima; notfalls könnte er immerhin für die Hebamme einspringen.«
Bei soviel boshafter Ironie konnte Françoise die Tränen nicht zurückhalten. Léa schämte sich für ihre Grobheit und hätte sich bei ihrer Schwester entschuldigt, wenn Tante Albertine nicht gerade in dem Moment eingetreten wäre.
»Léa, du wirst am Telefon verlangt. Aber Françoise! Was hast du denn?«
»Nichts, Tantchen. Ich bin nur ein bißchen erschöpft.«
»Hallo? Mit wem spreche ich?«
»Sind Sie Léa Delmas?«
»Ja, das bin ich. Wer sind Sie?«
»Sie erkennen mich nicht? Sie haben aber kein feines Gehör.«
»Nein. Sagen Sie mir, wer Sie sind, oder ich lege auf.«
»Energisch wie eh und je. Kommen Sie, schöne Freundin, strengen Sie sich ein bißchen an.«
»Ich habe keine Lust, mich anzustrengen, und finde diese Art Scherze albern.«
»Legen Sie nicht auf. Erinnern Sie sich an Le Chapon fin, die Kirschen von Mandel, La Petite Gironde, die Sankt-Eulalia-Kirche, die Rue Saint-Genès . . .«
»Raphael!«
»Das hat aber lange gedauert!«
»Entschuldigen Sie bitte, aber mir sind telefonische Rätselspiele ein Greuel. Woher wissen Sie, daß ich in Paris bin?«
»Ich bin über alles, was meine Freunde betrifft, immer gut informiert. Wann sehen wir uns?«
»Das kann ich noch nicht sagen, ich bin ja gerade erst angekommen.«
»Ich schaue um fünf zum Tee vorbei. Sie brauchen sich um nichts zu kümmern, ich bringe alles Notwendige mit. Nur Wasser müssen Sie aufsetzen.«
»Aber . . .«
»Wie geht es Ihrer reizenden Schwester und Ihren Tanten? Übermitteln Sie ihnen bitte meine Verehrung. Bis gleich, meine Liebe, ich freue mich, Sie wiederzusehen.«
Raphael Malh legte auf und ließ Léa verblüfft am anderen Ende zurück. Woher wußte er es? Ein Schauder überlief sie, und sie hatte ein ungutes Gefühl.
»Halte dich nicht in diesem eisigen Flur auf, mein Liebes, du wirst dich erkälten.« Lisas Stimme schreckte sie auf.
»Wie lange ist es her, daß ihr Raphael Malh zuletzt gesehen habt?«
»Ich weiß nicht . . . Vierzehn Tage vielleicht.«
»Hat er dabei auch Françoise gesehen?«
»Nein, sie ist einen Tag nach seinem Besuch hier angekommen, und seither hat sie das Haus nicht verlassen. Aber was sollen alle diese Fragen?«
»Das war eben Raphael Malh, der mich angerufen hat, und ich frage mich, woher er weiß, daß ich in Paris bin.«
»Durch Zufall.«
»Bei jemandem wie ihm glaube ich nicht an Zufall.«
Lisa hob die Schultern in einer Geste der Ratlosigkeit.
»Ach, fast hätte ich es vergessen: Er kommt zum Tee.«
»Aber wir haben doch nichts im Hause!«
»Er hat gesagt, außer dem heißen Wasser bringe er alles mit.«
Die Standuhr im Wohnzimmer hatte gerade fünfmal geschlagen, als die Klingel der Wohnungstür ertönte. Estelle, die über ihren üblichen Kittel eine blütenweiße gerüschte Schürze gebunden hatte, öffnete die Tür. Halb verdeckt von einem Berg verschnürter Päckchen, trat Raphael Malh ein.
»Schnell, meine gute Estelle; helfen Sie mir, sonst fallen alle diese Köstlichkeiten noch auf den Teppich.«
Brummend nahm ihm die Haushälterin die Sachen ab.
»Raphael, Sie sind einfach großartig!«
»Léa!«
Sie betrachteten sich lange, ehe sie aufeinander zugingen, so als wollten ihre Augen in einem einzigen Moment möglichst viele Einzelheiten aufnehmen.
Sie waren so gegensätzlich – in ihren Vorstellungen vom Leben, von der Freundschaft, von der Liebe –, doch ein vertrautes Gefühl, das sie nicht bekämpften, zog sie zueinander. Es war jedoch Raphael, der sich die meisten Fragen stellte über das, was er »den Teil des Selbst, der noch nicht von Fäulnis befallen war«, nannte. Er, der Schwindler, der Lügner, der Dieb, der Polizeispitzel, der Gestapo-Kollaborateur, der Jude, der Gelegenheitsberichterstatter von Je suis partout, Gringoire, Pilori und Nouveau Temps. Sein Antisemitismus schockte sogar die unübertrefflichen Herausgeber und Redakteure dieser Publikationen, die immerhin vorgaben, »Judenfresser« zu sein. Er fühlte sich Léa gegenüber wie ein großer Bruder, der seine kleine Schwester vor dem Schmutz des Lebens bewahren möchte.
»Schöne Freundin, wie machen Sie es nur, mir jedesmal, wenn ich Sie sehe, Augen und Seele zu verzaubern?«
Sie lachte ihr ein wenig rauchiges Lachen, das die Männer erregte und die Frauen ärgerte, und küßte ihn auf beide Wangen.
»Ich sollte es zwar nicht, aber ich freue mich, Sie wiederzusehen.«
»Etwas Angenehmes und etwas Unangenehmes in einem einzigen Satz. Aber ich mache gute Miene und halte mich an das Angenehme. Als ich hereinkam, haben Sie gesagt, Sie fänden mich großartig. Ich bin schick, nicht wahr? Besonders stolz bin ich auf meine Schuhe. Wie gefallen sie Ihnen? Sie haben mich ein Vermögen gekostet. Maßarbeit von Hermès.«
»Und wie haben Sie soviel Geld aufgetrieben? Haben Sie eine alte Dame beraubt, Ihren Körper an einen fetten, rosigen deutschen Hauptmann verkauft oder einen zarthäutigen Knaben der Prostitution zugeführt?«
»Sie liegen gar nicht so falsch. Was wollen Sie, liebste Freundin, jeder Mensch zimmert sich sein Glück nach seinen Ansprüchen, und meist ist das Geld Maß aller Dinge. Da mich ohne Geld auch das armselige bißchen Glück, das mir vergönnt sein dürfte, verlassen wird, habe ich beschlossen, mir welches zu beschaffen. Gegenwärtig ist nichts leichter als das. Alles ist verkäuflich: der Körper wie das Gewissen. Je nach den Umständen verkaufe ich mal das eine, mal das andere: Oder auch beide, wenn der Käufer besonders großzügig ist.«
»Sie sind abscheulich!«
»Das Gute ist so unvollkommen, daß es mich nicht interessiert. Es ist ein großer Irrtum, bezaubernde Freundin, den Menschen für ein vernünftiges Wesen zu halten. Die Fähigkeit zu denken führt nicht zu Vernunft. Ich war schon immer überzeugt, daß eine Vorliebe für vernünftige Dinge das Prinzip der Mittelmäßigkeit ist. Ich muß unbedingt irgendwann ein ›Lob der Mittelmäßigkeit‹ schreiben. Das würde in dieser Republik der Schreiberlinge Aufsehen erregen. Doch vor der Ausarbeitung dieses Meisterwerks erlauben Sie mir bitte, daß ich Ihren Frau Tanten und Ihrer Frau Schwester meine Aufwartung mache.«
Im Zimmer von Françoise war auf einem runden Tisch mit besticktem Tischtuch das gute Teeservice gedeckt.
»Sie haben wohl sämtliche Konditoreien und Konfiserien von Paris geplündert!« rief Léa aus, angesichts der mit Pralinen, Petits fours, Törtchen und glasierten Früchten überhäuften Platten.
»Sie können sich gar nicht vorstellen, wie recht Sie haben. Ich hatte die größte Mühe, das alles zu beschaffen: Die Petits fours mit Couvertüre sind von Lamoureux in der Rue Saint-Sulpice, die mit Creme von Guerbois in der Rue de Sèvres, die Schokoladentorte kommt selbstverständlich von Bourdaloue, die Kekse stammen von Galpin in der Rue du Bac, und den Rest habe ich bei Debauve & Gallais in der Rue des Saints-Pères bekommen, ehemals Hoflieferanten der Könige von Frankreich!«
»Vor dem Krieg haben wir dort auch gekauft«, seufzte Lisa mit einem begehrlichen Blick auf all die Leckereien.
»Und den Tee«, fuhr Raphael fort, während er eine Dose aus der Tasche zog, »hat mir ein Freund aus Rußland mitgebracht. Er ist stark, aromatisch, köstlich. Er wird Ihnen schmecken.«
»Monsieur Malh, Sie verwöhnen uns. Das ist sehr liebenswürdig von Ihnen. Wie können wir Ihnen nur jemals danken für all die guten Dinge.«
»Indem Sie zugreifen, meine Damen.«
Für einige Minuten waren nur Eßgeräusche zu vernehmen. Als erste erklärte Françoise, keinen weiteren Bissen mehr herunterzubringen, gefolgt von Albertine und Raphael. Nur Lisa und Léa fuhren fort, die Leckereien gierig zu verschlingen. Ihre Hände bewegten sich mit erstaunlicher Geschwindigkeit vom Tisch zum Mund. Tante und Nichte waren wie zwei schlecht erzogene Gören, deren beschmierte Finger und Münder von großer Gefräßigkeit zeugten. Raphael Malhs dröhnendes Lachen ließ sie zusammenfahren. Mißtrauisch blickten sie um sich, als fürchteten sie, das verbliebene Gebäck würde ihnen weggenommen.
»Schämst du dich denn gar nicht, Lisa?« tadelte Albertine in gespielt strengem Ton.
Errötend senkte Lisa den Kopf.
»Wenn man dich gewähren ließe, würdest du nicht einmal an die arme Estelle denken«, fuhr ihre Schwester erbarmungslos fort.
»Ich hatte solchen Hunger. Bitte verzeiht mir. Aber du hast recht, ich werde Estelle etwas bringen«, sagte sie mit so viel Zerknirschung, daß alle in Lachen ausbrachen, sogar Albertine.
Die Nacht war schon lange hereingebrochen, als sich Raphael Malh verabschiedete. Léa begleitete ihn zur Tür.
»Ich muß Sie allein sprechen. Können wir morgen zusammen Mittag essen?«
»Ich weiß nicht; Sie machen mir angst. Es gelingt mir nicht zu glauben, daß Sie so schlecht sind, wie Sie sich darstellen, und dennoch sagt mir ein innerer Widerstand, daß ich mich vor Ihnen in acht nehmen sollte.«
»Oh, wie recht Sie haben, meine Liebe. Sie können sich gar nicht genug vor mir in acht nehmen. Sie wissen doch, daß man die größte Gefahr läuft, die zu verraten, die man liebt. Da ich ein begeisterter Leser der Heiligen Schrift bin, wird es Sie nicht verwundern, wenn ich Ihnen sage, daß Judas meine Lieblingsgestalt ist, mein Bruder, mein Freund, mein Doppelgänger. Durch ihn sollte das Böse kommen, denn es mußte geschehen, was geschrieben stand. Er, der intelligente, der Intellektuelle der ganzen Bande, mußte ausgerechnet den Menschen verraten, den er am meisten liebte. Und durch diese Tat, die ihn für alle Ewigkeit gezeichnet hat, ist Judas der Jünger, Judas der Verräter, verdammt bis zum Ende aller Zeiten. Das ist doch ungerecht, finden Sie nicht?«
»Das weiß ich nicht, ich habe mich nie besonders für Judas interessiert.«
»Das sollten Sie aber; er ist der einzig wirklich interessante der zwölf Apostel, abgesehen von dem sanften Johannes mit seiner Engelsvisage, Jesu Lieblingsjünger und sein Geliebter«, erklärte er auf Léas fragenden Blick. »Denn wie Sie wissen, waren sie allesamt homosexuell.«
»Sie sind ja verrückt!«
»Und homosexuell.«
»Wenn meine Tanten Sie so lästern hörten, würden sie Ihnen das Haus verbieten.«
»Dann schweige ich wohl besser, denn ich liebe die Gesellschaft alter Damen. Von der ganzen weiblichen Spezies sind sie die einzig erträglichen Exemplare. Sie ausgenommen natürlich, und meine schöne Freundin Sarah Mulstein. Ach, übrigens: Haben Sie etwas von ihr gehört? Ich bin schon seit Tagen ohne jede Nachricht von ihr.«
Darauf wollte er also hinaus. Léa erschauerte und hatte plötzlich einen ekelerregenden Geschmack im Mund. Kurz und knapp antwortete sie: »Ich habe auch nichts von ihr gehört.«
»Oh, Sie frieren! Ich bin ein Rohling, daß ich Sie in diesem eisigen Flur aufhalte. Wärmen Sie sich schnell bei Ihrer charmanten Schwester auf. Kennen Sie ihren zukünftigen Ehemann? Ein hochgebildeter Mensch, dem eine große Zukunft prophezeit wird. In den gegenwärtigen Zeiten ist eine solche Verbindung äußerst nützlich. Wird Ihr Dominikaner-Onkel das Paar trauen?«
Eine jämmerliche Furcht ergriff Léa.
»Ihre Zähne klappern ja, mein Herz, und Sie sind ganz blaß. Das ist meine Schuld, wegen mir werden Sie sich noch erkälten. Haben Sie Fieber?«
Besorgt ergriff Raphael ihr Handgelenk.
»Rühren Sie mich nicht an, es geht mir sehr gut«, rief Léa und entriß diesem Schwätzer heftig ihre Hand.
»Bis morgen, schöne Freundin. Ich werde Sie am späten Vormittag anrufen. Ruhen Sie sich inzwischen aus, Sie haben es nötig, wenn Sie Ihre Nerven behalten wollen.«
3.
Am nächsten Vormittag verließ Léa schon sehr früh die Wohnung in der Rue de l’Université, um Raphael Malhs Anruf zu entgehen. Sie hatte eine sehr schlechte Nacht verbracht, denn sie mußte ständig an Raphaels Worte denken, die sie als Drohung gegen ihre Familie und ihre Freunde verstand. Sie mußte unbedingt Sarah Mulstein und ihren Onkel Adrien Delmas warnen. Daß sie nicht wußte, wo sich die beiden aufhielten und wie sie vorgehen sollte, versetzte sie in wahnsinnige Angst. Wer konnte wissen, wo sich Sarah und der Dominikaner verbargen? François! Natürlich: François Tavernier.
Am Tag der Beerdigung ihres Vaters hatte er darauf bestanden, daß Léa sich eine Adresse einprägte, wo sie ihn im Notfall antreffen oder eine Nachricht für ihn hinterlassen konnte. Damals hatte sie gedacht, da könne er aber lange warten, bis sie ihn in Paris wiedersehen wolle, und hatte die Adresse schleunigst vergessen. Was hatte er nur gesagt? In der Nähe des Etoile? Avenue . . . Avenue . . . Herrgott, es lag ihr auf der Zunge. Der Name eines napoleonischen Generals oder Marschalls: Hoche? Marceau? Kléber? Kléber, das war es: Avenue Kléber 32. Sie war aufgestanden, um sich die Adresse zu notieren, weil sie fürchtete, sie wieder zu vergessen, und war dann mit dem Gedanken eingeschlafen: Morgen früh muß ich diese Adresse verbrennen.
Das Wetter war schön, aber kalt. Vom Boulevard Raspail aus ging Léa mit schnellen Schritten zur Kreuzung Sèvres-Babylone, warm eingepackt in einen prächtigen Nerzmantel, den ihr Françoise geliehen hatte. Ihr Haar war unter einer dazu passenden Pelzkappe verborgen, ihre Füße steckten in gefütterten Stiefeln, die ihr ein wenig zu groß waren.
Die wenigen, meist schäbig gekleideten Fußgänger drehten sich nach der eleganten jungen Frau um, die der Kälte und allen Einschränkungen zu trotzen schien. Es machte Léa ein solches Vergnügen, ihr Gesicht in den seidigen Pelz zu schmiegen, daß sie die feindseligen oder verächtlichen Blicke gar nicht bemerkte. An der Buchhandlung Gallimard verlangsamte sie ihren Schritt. Der junge dunkelhaarige Verkäufer, der die Romane von Marcel Aymé so liebte, dekorierte Bücher im Schaufenster. Als sich ihre Blicke kreuzten, erkannte er sie sofort.
Lächelnd zeigte er ihr das Buch, das er gerade in der Hand hielt: Es war von Raphael Malh. GIDE stand in Großbuchstaben auf dem Umschlag. Dieses »Zusammentreffen« erweckte erneut alle ihre Ängste. Sie ging schneller. Als sie an der Wohnung von Camille und Laurent vorbeikam, die sie im Juni 1940 in Panik verlassen hatten, schenkte sie dem Haus nur einen gleichgültigen Blick.
Fahnen mit den Nazi-Emblemen flatterten an der Fassade des Hotels Lutétia, ein Schmuck, der an diesem schönen sonnigen Morgen besonders beleidigend wirkte. Auf den Eingangsstufen diskutierten mehrere Personen mit zwei deutschen Offizieren. Unter ihnen – nein, das konnte doch nicht möglich sein! Um sich zu vergewissern, überquerte Léa die Straße und zwang sich, langsam an der Gruppe vorbeizugehen. Sie hatte sich nicht getäuscht. Es war tatsächlich François Tavernier, der sich mit den beiden Deutschen bestens zu verstehen schien. Léa zitterten die Knie, so elend fühlte sie sich. Die Tränen liefen ihr unaufhaltsam über die Wangen. Das war die schlimmste Demütigung: vor diesem Mistkerl und seinen düsteren Genossen zu weinen!
»Schau, schau, eine hübsche Dame, die offenbar großen Kummer hat«, sagte einer der Offiziere beim Anblick des jungen Mädchens.
François Tavernier folgte seinem Blick. Das gab es doch nicht! Aber sie war es: die einzige Frau, die auch in Tränen noch hübsch aussah.
»Entschuldigen Sie mich, meine Herren, das ist meine jüngere Schwester. Ihr Pudel wird entlaufen sein; sie ist so sensibel.«
»Verdammter Schwerenöter«, rief einer der Zivilisten und klopfte ihm auf die Schulter. »Wieder eine Ihrer Eroberungen. Gratuliere, mein Lieber, Sie haben einen ausgezeichneten Geschmack. Frisch wie der junge Morgen. Sie sollten sich schämen, so viel Schönheit für sich allein zu behalten. Bringen Sie sie doch mal zu einem unserer Abendessen mit.«
»Das werde ich. Meine Herren, bitte entschuldigen Sie mich jetzt. Bis bald.«
Er sprang die Stufen hinunter, nahm Léa beim Arm und zog sie mit sich fort.
»Gib dich bitte ganz natürlich, wir werden beobachtet.«
Einige Minuten gingen sie, ohne zu sprechen, überquerten die Rue du Cherche-Midi und liefen dann die Rue d’Assas hinauf.
»Laß mich los, ich kann allein gehen.«
Er gehorchte.
»Noch immer die gleiche liebenswürdige Art. Ich freue mich zu sehen, daß du dich nicht verändert hast, und stelle mit Vergnügen fest, daß sich deine materielle Situation offensichtlich gebessert hat. Dieser prächtige Pelz steht dir großartig.«
Als Antwort zuckte Léa nur die Achseln.
»Für ein anständiges junges Mädchen ist er allerdings höchst unpassend. Nur Gattinnen und Mätressen von Schwarzhändlern, gewisse Schauspielerinnen und einige von Deutschen ausgehaltene Nutten wagen es, so etwas zu tragen.«
Léa errötete und fand nur eine armselige Antwort, über die sie sich sofort ärgerte: »Der Mantel gehört mir nicht. Ich habe ihn mir von meiner Schwester ausgeliehen.«
François lächelte flüchtig. »Was tust du in Paris? Und warum hast du geweint?«
»Das ist unwichtig.«
Er blieb stehen, ergriff ihren Arm und zwang sie, ihn anzusehen.
»Weißt du denn nicht, du Dummchen, daß mir alles, was dich berührt, wichtig ist?«
Wieso fühlte sie sich durch seine Worte getröstet? Sanft befreite sie ihren Arm und ging weiter. Sie kamen zum Eingangstor des Jardin du Luxembourg.
»Komm, gehen wir hinein, dort können wir in Ruhe reden«, schlug er vor.
Um das Bassin herum jagten sich kreischend einige Knirpse in Wollmützen und Schals unter Aufsicht ihrer Mütter, die vor Kälte mit den Füßen aufstampften und die Arme um sich schlugen.
»Und jetzt sag mir, wieso du in Paris bist.«
»Wegen Françoise. Es geht ihr nicht gut.«
»Das ist in ihrem Zustand normal.«
»Wahrscheinlich; aber meine Tanten waren so besorgt, daß ich den ersten Zug genommen habe. Doch ich werde wohl nicht lange bleiben. Sobald ich von Montillac weg bin, habe ich Angst, daß etwas passiert.«
»Hast du Nachricht von Laurent d’Argilat?«
»Nein, nichts seit der Geiselhinrichtung am 21. September in Souges.«
»Ich habe ihn kurz danach gesehen. Er konnte es sich nicht verzeihen, daß es ihm nicht gelungen war, die Männer zu retten«, sagte Tavernier und ergriff wieder Léas Arm.
»Was hätte er denn tun können?«
»Er kannte das Lager Mérignac, aus dem sich die Deutschen die Geiseln geholt haben, ganz genau.«
»Wieso kannte er es?«
»Kurz nach der Beerdigung deines Vaters wurde er bei einer Razzia in der Rue Sainte-Catherine in Bordeaux aufgegriffen. Seine falschen Papiere waren einwandfrei, trotzdem wurde er im Lager Mérignac interniert. Drei Tage später ist er geflohen und brachte einen genauen Plan des Lagers mit. Außerdem hatte er dort Kontakte geknüpft, die uns nützlich hätten sein können. Als er erfuhr, daß siebzig willkürlich festgenommene Männer erschossen werden sollten als Vergeltung für das in Paris verübte Attentat, hat er sich zusammen mit dem Abbé Lasserre und einigen Kameraden seiner Organisation bemüht, eine Rettungsaktion auf die Beine zu stellen. Sie wollten versuchen, die Lastwagen mit den Geiseln anzuhalten, dann die Wachen erschießen und die Gefangenen befreien. Im letzten Augenblick erhielten sie den Befehl, nichts zu unternehmen.«
»Wer hat diesen Befehl erteilt?«
»Das weiß ich nicht. Vielleicht London.«
»Das ist doch absurd!«
»In der Politik sind es häufig die scheinbar absurden Entscheidungen, die man akzeptieren muß wie ein Gesetz.«
Er blickte ihr in die Augen und sagte unvermittelt:
»Ich würde dich sehr gern küssen.«
»Ich möchte noch lieber wissen, wie du zu deinen ›Freunden‹ vom Hotel Lutétia stehst.«
»Darüber kann ich nicht mit dir sprechen. Das sind Dinge, von denen du – in deinem und unser aller Interesse – nichts wissen solltest.«
»Ich habe eben einen richtigen Schock bekommen, als ich dich mit denen zusammen gesehen habe. Ich war gerade auf der Suche nach der Adresse, die du mir damals genannt hattest.«
»Avenue Kléber 32?«
»Ja.«
»Bedanke dich bei meinen ›deutschen Freunden‹, wie du sie nennst, denn wenn ich mich nicht zufällig dort mit ihnen unterhalten und dich dadurch getroffen hätte, wärst du geradewegs in die Höhle des Löwen geraten. Und es ist keineswegs sicher, daß ich dich da hätte herausholen können, trotz meiner Beziehungen und der Freundschaft, die mir Otto Abetz entgegenbringt.«
»Der deutsche Botschafter?«
»Ja. Erinnerst du dich nicht mehr? Wir haben uns doch in seinem Hause getroffen und miteinander getanzt. Hast du unseren Tanz vergessen?«
Sie hatten sich mit den Ellbogen auf die Balustrade gestützt, die den Blick freigab auf die umgepflügten Rasenflächen und das Bassin. Hinter ihnen erhob sich der Musikpavillon. Im winterlichen Licht wirkte das Senatspalais wie ein schlafendes Schloß, von schwarzen Bäumen bewacht, deren kahle Äste sich halb flehend, halb drohend gen Himmel reckten. Ein Gärtner schob eine Schubkarre voller Karotten, Rüben und Porree vorbei. Als sie das Quietschen des Rades hörten, drehten sie sich um.
»Was macht er denn hier mit all dem Gemüse?« fragte Léa erstaunt.
»Weißt du denn nicht, daß der Jardin du Luxembourg in einen Gemüsegarten umgewandelt wurde?«
»Gar keine schlechte Idee«, meinte sie mit so ernsthafter Miene, daß François in Lachen ausbrach.
»Nein, keine schlechte Idee, wenngleich ich mich frage, wem dieses Grünzeug zugute kommt. Aber du hast mir noch immer nicht gesagt, warum du mich erreichen wolltest.«
»Es ist alles so verwirrend für mich. Wer bist du? Stehst du auf der Seite der Deutschen oder der Franzosen? Bist du ein Freund von Otto Abetz oder von Sarah Mulstein?«
»Es ist noch zu früh, um dir eine Antwort zu geben. Aber eines solltest du wissen: Nie wird dir durch mich ein Leid geschehen. Du kannst mir alles sagen.«
»Hast du Nachricht von Sarah?«
»Wenn du etwas weißt, dann verschweig es mir nicht. Sie ist in ständiger Gefahr«, sagte er und ergriff ihre Hand.
Léas Augen versuchten vergeblich, in François’ undurchdringlichem Gesicht zu lesen. Trotz des Pelzes fröstelte sie.
Er zog sie an sich und bedeckte ihr kaltes Gesicht mit Küssen. Léa war, als habe sie auf diesen Augenblick gewartet, seit sie ihn auf der Treppe des Hotels Lutétia erblickt hatte. Als sich ihre Lippen berührten, wurde sie von einem warmen Glücksgefühl überwältigt, und ihr Körper preßte sich fest an ihn.
»Du hast dich nicht verändert. Wie haben wir es nur so lange ohne einander ausgehalten?«
Seine Hand, die sich unter ihren Pullover schob und ihre aufgerichteten Brustspitzen liebkoste, war kalt und heiß zugleich.
»Philippe! Marianne! Schaut da nicht hin. Das ist ja widerlich! Sogar vor den Kindern! Sie sollten sich schämen!« entrüstete sich eine Frau in Kindermädchentracht, die einen riesigen Kinderwagen schob und mit zwei Gören von vier oder fünf Jahren schimpfte.
»Die Dame hat recht, dies ist kein passender Ort. Komm, gehen wir Mittagessen bei meiner Freundin Marthe Andrieu, das ist hier ganz in der Nähe.«
»Marthe Andrieu?«
»Die Wirtin eines illegalen Restaurants in der Rue Saint-Jacques.«
Beim Verlassen des Gartens verlangten französische Polizisten in Zivil ihre Ausweise. Offenbar eine Routinekontrolle. Sie ließen sie passieren, ohne ihnen auch nur eine einzige Frage zu stellen.
»Wen suchen sie denn?« fragte Léa, während sie den Boulevard Saint-Michel überquerten.
»Terroristen, Juden, Kommunisten, Gaullisten . . .«
»Wenn nun jemand geschnappt wird, was geschieht dann mit ihm?«
»Kommt drauf an, welche Polizei es ist, aber meistens versuchen sie, sich der Leute zu entledigen. Sie übergeben sie der Gestapo, die sie entweder foltert, deportiert oder umbringt, je nachdem.«
»Was würden sie mit Sarah machen?«
»Als ich sie das letzte Mal gesehen habe, gehörte sie zu einer Widerstandsgruppe, die darauf spezialisiert ist, Juden in die freie Zone zu bringen.«
»Und heute?«
»Heute habe ich mehr Angst um sie als je zuvor. Wenn man ihre Aktivitäten für den Widerstand entdeckt, wird man sie foltern. Wie ich sie kenne, wird sie nichts sagen und wird deshalb sterben.«
Mit gesenktem Kopf und zusammengepreßten Lippen stürmte François Tavernier vorwärts. Léa klammerte sich an seinen Arm und mußte große Schritte machen, um mithalten zu können. Sie spürte die innere Anspannung ihres Gefährten und war beunruhigt. Vor ihnen ragte das Panthéon in den düsteren Himmel auf, und ein kalter Wind ließ den Staub der Rue Soufflot aufwirbeln.
Ein Grüppchen Studentinnen in kurzen, karierten Faltenröcken rempelten sie lachend an. Sie trugen Windjakken oder Regenmäntel, und an ihren Füßen, die in festen Schuhen steckten, leuchteten farbenfrohe Wollsocken.
»Wir müssen sie finden.«
»Wen?«
»Sarah. Ich habe auch Angst um sie. Gestern war Raphael Malh bei meinen Tanten zu Besuch. Er hat mich gefragt, ob ich von ihr gehört hätte.«
»Ich kann daran nichts Alarmierendes finden. Er und Sarah kennen sich seit langem, und du weißt, daß sie ihm gegenüber immer sehr nachsichtig war.«
»Ich sehe ihm auch vieles nach. Er amüsiert mich und bringt mich zum Lachen, auch gegen meinen Willen. Aber jetzt kommt er mir irgendwie enthemmt vor, so als habe er keine Kontrolle mehr über das Schlechte, das in ihm steckt. Das spüre ich, verstehst du, das habe ich im Gefühl. Anders kann ich es dir nicht erklären.«
»Hat er etwas gesagt, das dich beunruhigt hat?«
Léa senkte den Kopf. Wie sollte sie ihm ihre Befürchtungen mitteilen? Sie war sich sicher, daß durch Raphael Malh Sarah etwas Schreckliches geschehen würde . . .
»Er hat mich gefragt, ob mein Onkel Adrien die Trauung von Françoise und . . . und . . .«
Tavernier kam ihr zu Hilfe.
»Sturmbannführer Kramer. Unter anderen Umständen wäre er der perfekte Ehemann für deine Schwester gewesen. Es gibt wohl kaum etwas Harmonischeres als ein musikbegeistertes Paar! Leider ist Kommandant Kramer nicht nur Musiker, sondern auch SS-Offizier. Ich kann dir auch noch sagen, daß er von seinen Vorgesetzten sehr geschätzt wird, obgleich man ihn verdächtigt, sich nur seinem kranken Vater zuliebe als Freiwilliger gemeldet zu haben, der wiederum ein guter Freund von Heinrich Himmler, dem SS-Führer, ist. Er wird auch noch von einem weiteren Freund seines Vaters protegiert, dem berüchtigten Paul Haussner, Gründer der Offiziersschule der SS, dem er es zu verdanken hat, daß er jeden Tag einige Stunden der Musik widmen kann. Ich habe mich sehr gewundert, als ich hörte, daß er die Absicht hat, deine Schwester zu heiraten. Das wird der alte Kramer nie zulassen.«
»Aber was soll dann aus Françoise werden?«
Ihre Ankunft vor dem Gebäude in der Rue Saint-Jacques, in dem sich das illegale Restaurant von Marthe Andrieu befand, ließ ihn eine Antwort schuldig bleiben.
Der Empfang war sehr herzlich, doch die Augen der Wirtin waren gerötet.
»Was haben Sie denn, Marthe? Sind es die Zwiebeln, die Ihnen die Tränen in die Augen treiben?«
»Nein, Monsieur François«, antwortete sie und trocknete sich die nassen Wangen. »Es ist wegen René.«
»Und was ist mit ihm? Er sieht doch aus, als ginge es ihm bestens.«
»Er soll nach Deutschland geschickt werden.«
René trat zu ihnen.
»Beruhige dich, Mama. Die Gäste fragen sich sonst, was hier los ist.«
»Es ist mir egal, was die Gäste denken. Ich will nicht, daß du gehst.«
François Tavernier umfaßte ihre Schultern. »Gehen wir in die Küche, da können Sie mir ausführlich berichten. Entschuldige mich, Léa.«
»Folgen Sie mir, Mademoiselle, ich zeige Ihnen Ihren Tisch«, sagte René und zog sie mit sich.
Während sie an ihrem Glas Sauternes nippte, schaute sich Léa im Raum um und fragte sich, wer wohl diese Leute sein mochten, die sich den Luxus leisten konnten, in solchen Lokalen zu essen, denn seit ihrer Ankunft in Paris hatten die Preise schwindelerregende Höhen erreicht. Die Männer waren konservativ gekleidet, nicht mehr ganz jung, die Gesichter eher feist. Die Frauen trugen Hüte, in ihren Gesichtern war der unerträgliche Ausdruck befriedigter Eitelkeit. Über die Stuhllehnen hatten sie ihre Pelzmäntel drapiert. Léa, im Mantel ihrer Schwester, war sich bewußt, daß sie ihnen ähnelte. Das war ihr unangenehm, und sie wäre vielleicht gegangen, wenn François nicht in dem Moment gekommen wäre, mit einer sorgenvolle Miene.
»Stimmt etwas nicht?«
»Du hast doch gehört: René soll zur Zwangsarbeit nach Deutschland. Ich habe ihm geraten zu gehen.«
»Ist das dein Ernst?«
»Das ist mein Ernst. Wenn er sich nicht stellt, kommt die Polizei hierher, und dann kriegen die Eltern Ärger.«
»Kannst du nichts für ihn tun?«
»Ich werde es versuchen. Aber es wird immer schwieriger. Die Deutschen haben für das laufende Trimester zweihundertfünfzigtausend Mann angefordert und für das erste Trimester 1943 noch einmal so viele.«
François Tavernier warf einen schnellen Blick in die Runde und fuhr mit leiserer Stimme fort:
»Reden wir von etwas anderem. Wie geht es Camille?«
»Gut. Sie hilft mir sehr bei der Verwaltung von Montillac.«
»Und Fayard, euer Kellermeister, kommt er seinen Pflichten nach? Hat er immer noch ein Auge auf das Gut geworfen?«
»Er spricht nicht mehr davon, aber ich bin auf der Hut. Ich habe den Eindruck, daß er jede unserer Bewegungen beobachtet. Wenn ich ihn frage, ob er etwas von Mathias gehört hat, schaut er mich ganz merkwürdig an, dreht mir den Rücken zu und murmelt irgend etwas. Er verzeiht es mir nicht, daß sein Sohn nach Deutschland gegangen ist.«
Das Rührei mit Trüffeln, das Marthe ihnen brachte, war ein Hochgenuß.