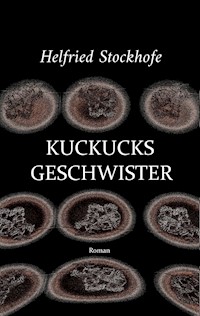Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Menschen unterschiedlichen Alters, die in einer städtischen Wohnanlage leben, beobachten sich und lernen sich nach dramatischen Ereignissen näher kennen. Die anfangs uneindeutigen oder andersartigen Beziehungen entwickeln sich in neue verschiedene Richtungen. Im Mittelpunkt steht ein Brüderpaar unterschiedlichen Alters und Temperaments, das vor allem mit der weiblichen Nachbarschaft einen zwiespältigen Kontakt aufbaut.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
Helfried Stockhofe: Das schwarze Zimmer
Text und Umschlaggestaltung: © 2023 Copyright Helfried Stockhofe
Verlag: Helfried Stockhofe, Untere Ringstr. 22, 93455 Traitsching
Druck: epubli, ein Service der Neopubli GmbH, Berlin
Ist es ein Schmetterling oder ´ne Made?
Vieles ist Schein und nur Fassade!
Ist Wasser seicht und nicht sehr tief,
geht alles leicht …
und nichts geht schief?
Leiden und Leidenschaften
1Die Schwüle war an diesem Tag schier unerträglich. Er schwitzte aus allen Poren, sie aber saß da, als ob ihr die spanische Hitze wie ein Labsal trocken-kühlend über die Stirn streichen würde. Sie trug ein luftiges dezent gemustertes Kleid. Ihre schlanken nackten Beine hatte sie übereinandergeschlagen und mit dem freien Fuß wippte sie ihrem Beobachter einladend zu. Sie trug beige Pantoletten, von denen der eine bei jedem Wippen herabzufallen drohte, doch sie verstand es, ihm nur so viel Spiel zu geben, dass er immer wieder auf ihren Fuß zurückglitt. Als sie ihre Beine nebeneinander stellte, erhaschte er einen kurzen Blick auf ihr Höschen, bevor sie den Saum ihres Kleids herabzog. Nun ließ sie ihre Arme seltsam ermüdet herabhängen. Sie saß jetzt mit gesenktem Kopf auf der Bank im Innenhof des Gebäudekomplexes, so als mache sie ein Nickerchen. Ihre Hände aber waren wach, sie schlossen sich immer wieder zur Faust und öffneten sich mit entspannten Fingern. Ihr dünnes Kleid und ihre ebenso dünne Statur erinnerten ihn an Audrey Hepburn. Es fehlte eine große Sonnenbrille und ein noch größerer Hut. Die kleinen Brüste waren aber passend.
Ferdinand sah vom ersten Stock auf sie herab und die Männer in den anderen Wohnungen taten es wohl auch – sofern sie daheim von ihren Frauen alleingelassen waren. Sein suchender Blick glitt nun über die Fassade des gegenüberliegenden Gebäudes, über die Fenster und Balkone und hinauf zu den zurückgesetzten Dachterrassenwohnungen: Kein Mensch war zu sehen, jeder schien sich vor der Hitze schützend hinter fast vollständig herabgelassenen Rollläden zu verstecken. Seine gläserne Schiebetür zum Französischen Balkon stand offen und lag im Schatten. Jeder, der ihn sehen wollte, konnte es tun.
Ab und zu sah die junge Frau zu ihm hinauf und lächelte. Beim ersten Blick der täglichen Begegnung hob sie auch immer ihre Hand zu einem leichten Winken – und er winkte lächelnd hinab. Es war immer der frühe Nachmittag, täglich, seit Anfang Juni, seit Beginn dieser Trockenheit unter der Herrschaft der spanischen Luft.
Gerne hätte er das Fernglas genommen, um sie genauer betrachten zu können, doch ein schlechtes Gewissen hielt ihn davon ab – aber auch die Möglichkeit, dass ein Aufblitzen des Objektivs seine Beobachtungslust verraten könnte. Er war sich unsicher, was ihr seine Beobachtung bedeutete. Sie war ihr zumindest nicht so unangenehm, dass sie sie vermeiden wollte. Oft glaubte er, dass sie es liebte, von ihm beobachtet zu werden. Meist aber hielt er seinen Wunsch für den Vater seiner Gedanken.
Eine Nachbarin von der Dachterrassenwohnung gegenüber, die jetzt die Szene betrat, hatte da schon ein anderes Naturell: Sie legte sich des öfteren nackt auf eine Liege ihrer Terrasse und stand dann immer wieder auf, um lasziv ans Geländer gelehnt, eine Zigarette zu rauchen. Diese Frau verdiente sein Fernglas!
Als die Sonne etwas niedriger stand - die Nackte und die Audrey waren längst verschwunden -, spiegelte sie sich in einem riesigen, bis zum Boden reichenden Schiebetüren-Fenster gegenüber. Es war das Einzige, das an der Sonnenfront dieser heißen Tagen ohne Rollo auskam. Ein paar Minuten später verschwand die Reflexion und die Sonne fraß sich in das Zimmer hinein, so dass es in Gänze eingesehen werden konnte: Der Raum war weitgehend leer. Seine Wände waren in einem tiefen Schwarz gestrichen; von der Decke baumelte an einem langen nackten Kabel eine Glühbirne; ein kleiner dunkler Holztisch mit zwei Stühlen und ein ebenso dunkles Wandregal komplettierten ein Ambiente, das an einen Verhörraum erinnerte. Diesem Zweck mochte auch die Schreibtischlampe dienen, die auf dem Tisch stand und nachts manchmal ein grelles Licht bis zu Ferdinand hinüberwarf. An den Wänden kein Bild und keine Uhr. Gelegentlich hinkte ein Mann ins Zimmer und setzte sich an den Tisch. Die Flasche, die er mit sich trug und behutsam vor sich hinstellte - und auch sein vorsichtiger und doch schwankender Gang -, sprachen für seine Liebe zum Alkohol. Immer drückte er mit der flachen Hand auf einen Gegenstand, der auf dem Tisch lag. Der Mann schien mit spärlicher Bekleidung der im Zimmer gesammelten Wärme trotzen zu wollen. Bei genauem Hinschauen war ein Hitlerbärtchen zu erkennen und der Beobachter im Haus gegenüber rechnete stets damit, dass er ihn mit gestrecktem Arm grüßen würde - oder auch mit gestrecktem Mittelfinger, was ihm sympathischer wäre. Dieses Mal schien der Mann mit Luchsaugen das Fernglas gesehen zu haben, denn er ging aus dem Zimmer und holte einen Gegenstand, der wie ein Gewehr aussah.
2Ferdinand-Franz zu Heißenlohe bemerkte, dass nun nicht nur die Schwüle, sondern auch die Angst seine Schweißdrüsen stimulierte. So zog er sich von seinem Beobachtungsposten zurück ins Badezimmer, beugte seinen Kopf über die Wanne und griff nach einem Duschkopf. Das kalte Wasser tat ihm gut, doch er musste darauf achten, nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Seine heutigen Beobachtungen waren ihm zu Kopf gestiegen: Die junge Frau im kleinen Innenhof-Park, die Laszive auf dem Balkon und der Hitler-Verschnitt – sie brachten ihn zu sehr aus der Ruhe. Dabei liebte er doch so sehr seine Ruhe! Niemand wollte ihm das so recht abnehmen und alle, die es gut mit ihm meinten, glaubten, ihn besuchen zu müssen. Es waren zum Glück nur wenige, regelmäßig kam nur einer: sein Bruder. Der Blick aus dem Fenster auf die Nachbarschaft und den kleinen Park, der Gesang der Vögel - manchmal auch eines musikalischen Nachbarn -, das Farbenspiel der Jahreszeiten in den Büschen und Bäumchen, vielleicht auch die Flugzeuge am Himmel oder sogar das Lachen und Geschrei von Kindern – all dies reichte ihm. Wenn nur keiner etwas von ihm wollte oder ihn gar bedrohte!
Er lugte hinüber zum Hitler. Die Sonne jedoch war ein Stück weitergewandert - oder wie Ferdinand sagen würde: Die Erde hatte sich wieder ein Stück weitergedreht. Die Sonne war hinter der Häuserfront verschwunden und leuchtete nicht mehr in die gegenüberliegende Wohnung hinein. So blieb dem Bangen nur die vage Vermutung, dass der da drüben sich wohl zurückgezogen habe in eines seiner, wer weiß, wie viel, anderen Zimmer.
Das Telefon klingelte: Ob er Lust habe zu einer kleinen Partie Schach. Bei ihm sei es sicher kühl und deshalb komme er gerne. Ferdinand schmunzelte. Nicht nur ihm gelangen solche etwas unvorsichtigen Feststellungen. Er verbiss es sich aber, dem Anrufer zu sagen, dass es höflicher und freundlicher wäre, nicht wegen der Kühle der Räumlichkeiten zu kommen, sondern wegen ihm, dem Bruder - oder wegen einer Schachpartie mit ihm.
„Bei mir ist es auch nicht besonders kühl“, stellte Ferdinand richtig.
„Na, aber doch kühler als woanders. Du hast doch nur morgens die Sonne im Zimmer.“
„Bring aber ein Gewehr mit“, erwiderte Ferdinand ganz trocken. Ihm machte es Spaß, seinen Bruder vor Rätsel zu stellen.
„Wie? Ich hab jetzt Gewehr verstanden. Was hast du gesagt?“
„Bring ein Gewehr mit“, wiederholte Ferdinand.
Der andere ließ eine Pause. „Was spinnst du denn wieder zusammen?“, fragte er in einer Mischung aus Unsicherheit und freundschaftlichem Tadel. „Selbst wenn ich ein Gewehr hätte ...“ Er brach den Satz ab, denn natürlich wollte er die Aufforderung nicht ernst nehmen. „Also in einer halben Stunde. Ist es dir recht?“
„Dann bring wenigstens eine Pizza mit, wenn du schon kein Gewehr hast“, entgegnete Ferdinand. „Bis dann.“
Er legte den Hörer beiseite. Mit einiger Anstrengung und einem Seufzer zog er sich von einem altmodischen Telefonbänkchen an seinem Rollator hoch und dackelte zum Kühlschrank, um nach dem Biervorrat zu schauen. Er musste seinen Schachpartner abfüllen. Nicht nur, um die Partien zu gewinnen, sondern auch um keine Gespräche über seine Leiden aufkommen zu lassen. Lieber unterhielt er sich über seine Leidenschaften. Er wusste, dass seine Leiden ohnehin nicht ernst genommen würden: Warum er denn am Rollator gehe, ob er schon wieder Schmerzen habe, was der Arzt sage und so weiter. Wenn der Bruder aber betrunken war, dann erzählte der von sich selbst, auch das wusste Ferdinand.
Ferdinand-Franz zu Heißenlohe war seit einigen Jahren ein Rentner. Er hatte sehr lange gearbeitet, zu lange, wie er jetzt meinte. Seit dem Rentenbeginn ging es ihm schlechter. Es stellten sich Schmerzen ein, Wanderschmerzen, wie er sie nannte, und zynisch ergänzte: Wenigstens die Schmerzen können noch wandern! Sein Gang wurde immer unsicherer und seit einem halben Jahr benutzte er in der Wohnung einen Rollator, der ihm ein wenig Sicherheit gab. Draußen vor der Tür war er selten unterwegs, obwohl er mit dem Lift ins Erdgeschoss hinabfahren und ohne größere Schwellen hinaus gelangen konnte. Ferdinand meinte, er habe doch in seiner Wohnung alles, was er brauche, es gäbe Lieferdienste und freundliche Leute, die ihm etwas mitbrächten und zu Ärzten …? Da gehe er nicht mehr hin, denn die könnten ihm nicht weiterhelfen. Bei Ärzten käme er sich vor, wie ein Ratloser bei Ahnungslosen - seltener umgekehrt, was aber auch nicht besser sei. Mit den „freundlichen Leuten“ übertrieb er ein wenig, denn nachdem er jahrelang signalisiert hatte, dass er Besucher nicht vermisse, ließen sich nur manche Unerschrockene nicht vertreiben oder die wenigen, denen Ferdinand etwas zu bieten hatte, eine Schachpartie zum Beispiel.
Außer seinem Bruder gab es noch einen Unerschrockenen, der gelegentlich zu einer Schachpartie kam: Ferdinands Nachbar Roxy. Der junge Mann aus der Wohnung nebenan war allerdings eher selten daheim. Wenn Jazzmusik durch die Wand zu hören war oder sich in den Innenhof ergoss, registrierte nicht nur Ferdinand die Anwesenheit seines Nachbarn. Die Wohnung gehörte Roxys Vater, einem reichen Zahnarzt, und war wohl als Geldanlage gedacht. Ob der Zahnarzt jemals in diesen Räumen war, wusste niemand. Meist lag die Wohnung, wie noch andere in diesem Wohnkomplex, still und leer, was manche angesichts grassierender Wohnungsnot aufregte. Seinen Beteuerungen nach, war der Zahnarztsohn unter der Woche ebenfalls berufstätig und wohnte woanders „ganz bescheiden“. Er arbeitete in der väterlichen Praxis mit, wobei nicht klar war, welche Funktionen er dort übernahm. Seine Statur ließ eher vermuten, dass er in einer Mucki-Bude Stammgast war, zumal das Fitnesszentrum ebenfalls dem reichen Vater gehörte.
Roxy, eigentlich Robert-Alexander, war äußerlich ein Frauentyp und wenn er zum Plaudern oder Schachspielen an Ferdinands Tür klopfte und dieser ihn mit dem Rollator hereinbat, hätte jeder Außenstehende gedacht, dass der behinderte Alte den Besuch seines breitschultrigen Krankengymnasten bekäme. Trotz und wegen der Unterschiede der beiden Männer plagten Ferdinand Neidgefühle, denn so hätte er auch gerne einmal ausgesehen - wenigstens zu früheren Zeiten. Zum Glück war der muskelbepackte Schönling ein miserabler Schachspieler und Ferdinand genoss es, der Überheblichkeit des Jungen Dämpfer zu versetzen.
3Ferdinands Bruder Reginald brachte tatsächlich eine Pizza mit, kam deshalb etwas später, und meinte: „Statt Gewehr eine Pizza aus Neapel“. Wie immer grinste er. Nicht nur wegen des Scherzes. Reginald gehörte zu den Frohnaturen. Er störte sich auch nicht an Ferdinands direkten, aber auch manchmal väterlich-herablassenden Aussagen. Wo andere sich beleidigt abgewandt hätten, schmunzelte er nur und dachte sich Seines. So machte es ihm auch nichts aus, dass Ferdinand auf seine Frage „Wie geht´s?“ diesmal gar nichts antwortete.
„Ein Bier?“, fragte Ferdinand.
„Logo!“
Ferdinand stellte zwei Bierflaschen auf ein kleines Tischchen, das fast ausschließlich aus einem hölzernen Schachbrett bestand, einem Schachbrett auf vier Beinen. Eine Erweiterung des Bretts war für eine Schachuhr gedacht, doch für zwei Bierflaschen reichte sie auch. Für die Pizza wurde aber noch ein Hocker danebengestellt. Die Figuren hatte Ferdinand längst platziert. Hinter seinem Rücken nahm er zwei Bauern in die Hände, einen weißen und einen schwarzen, und streckte dann seinem Bruder die geschlossenen Fäuste zur Auswahl hin.
„Immer kriegst du Weiß!“, behauptete Reginald, der den schwarzen Stein gewählt hatte, und spielte den Beleidigten. Er ließ zur Kontrolle Ferdinand auch die zweite Hand mit dem weißen Bauern öffnen.
„Selbst schuld“, erwiderte Ferdinand, der heilfroh um die weißen Figuren war. Weiß beginnt war eine Schachregel und gerne bestimmte er die Eröffnung. Eröffnungen waren das Einzige, was Ferdinand noch zuverlässig konnte. Je länger sich ein Spiel hinzog, umso mehr geriet er in Nachteil. Doch im Kühlschrank warteten ja weitere Flaschen …
Reginald nahm alles aber nicht so ernst und gleich zu Beginn der Partie öffnete er den Pizzakarton und begann, genüsslich an einem Viertel zu kauen. „Die wird sonst ganz kalt“, bemerkte er dazu.
Ferdinand ignorierte die Pizza, denn sein Bruder hatte wieder einmal völlig unkonventionell auf seine lehrbuchmäßige Eröffnung reagiert und damit die mühsam im Gedächtnis gespeicherten Fortsetzungen über den Haufen geworfen. Ferdinand war es wichtig, seinem Bruder im Schach Paroli bieten zu können. Der jüngere Reginald war der begabtere Spieler. Statt ständig Schachtheorie und Spiele von Großmeistern zu studieren, zog er seine Figuren meist intuitiv drauflos und brachte mit dieser Art seinen älteren Bruder durcheinander, ließ ihn besonders angestrengt nachdenken und machte ihn aber auch ärgerlich, weil die lockere Intuition das angestrengte Wissen zu besiegen drohte. Dazu gab Reginald auch noch irgendwelche Kommentare ab, stellte ablenkende Fragen, gab störende Geräusche von sich.
„Wozu das Gewehr?“, fragte er. „Willst du deinen Nazi erschießen?“
Ferdinand machte eine abweisende Handbewegung, mit der er seinen Bruder zum Schweigen bringen wollte. Reginald begann, leise zu pfeifen.
„Oder wolltest du die Nackte erschrecken?“, legte er nach, nachdem er seinem Bruder das erste „Schach“ geboten hatte.
Ferdinand antwortete nicht. Seine Stirn zog tiefe Denkerfalten. Er stützte seinen Kopf ab und starrte auf das Brett. Bald begann er, an einem Fingernagel zu kauen. Der Bruder schaute gelangweilt umher, ihm dauerte alles zu lang.
„Wo hast du eigentlich deine Schachuhr versteckt?“
Ferdinand verstand den Wink mit dem Zaunpfahl. Die Schachuhr, die ihm sein Bruder einmal geschenkt hatte, wurde nach einigen erfolglosen Blitzschachspielen nicht mehr benutzt. Im Schnellschach war der Ältere dem Jüngeren total unterlegen.
„Wir könnten wieder mal Blitzschach spielen“, störte Reginald erneut die Konzentration. Ferdinand reagierte nicht, sondern zog einen unbedeutenden Zug mit einem Bauern. Reginalds Antwort dauerte nicht lang – und Ferdinand vertiefte sich wieder in die Stellung. Reginald stand genervt auf und holte sich ein weiteres Bier. Mit ihm stellte er sich ans Fenster und ließ den Blick über die gegenüberliegende Fassade schweifen.
„Kein Mensch zu sehen“, sagte er enttäuscht. „Da ist ja bei mir daheim mehr los.“ Dann setzte er sich wieder ans Schachtischchen.
„Schachmatt in drei Zügen!“, sagte Ferdinand. Er hatte den gewinnbringenden Zug gefunden und strahlte über das ganze Gesicht.
4Reginald lebte im Haus der verstorbenen Eltern. Ferdinand hatte keinen Wert darauf gelegt, das Elternhaus zu übernehmen. Ihm war es recht, dass ihn sein Bruder auszahlte und er sich eine Stadtwohnung kaufen konnte. Reginald waren zwei Ehefrauen davongelaufen und auch seine Nicht-Ehefrauen hielten es nicht lange mit ihm aus. Zu Ferdinand hatte niemals eine Frau hingefunden, auch nicht in die Stadtwohnung. Die Brüder waren sich einig: Jetzt sind wir zu alt für Frauen. Zumindest nach außen hin vertraten sie diese Meinung. Insgeheim hofften sie aber, dass der Immobilienbesitz ein Argument für eine Frau sein könnte, sich mit ihnen einzulassen, möglichst eine jüngere. Reginald rechnete dem Bruder vor: „Ein Lebensjahr ist mindestens fünfzigtausend Euro wert, also bei fünfhunderttausend Vermögen, können wir locker zehn Jahre älter sein als die Frauen und die werden sich immer noch für uns interessieren.“ Ferdinand konnte über solche Argumentationen nur den Kopf schütteln. Seinem jüngeren Bruder traute er aber zu, dass er noch einmal eine junge Frau an sich binden könnte.
Reginald war jetzt fünfundfünfzig geworden, Ferdinand war fast zwanzig Jahre älter. Sie waren in anderen Zeiten aufgewachsen und Ferdinand erklärte sich damit den Wesensunterschied. Der Jüngere behauptete, er sei von einem anderen Vater gezeugt worden und hatte dabei einen Fernsehkomiker im Auge, der damals ein Arbeitskollege seiner Mutter gewesen war. Ihre Unterschiedlichkeit hinderte die Brüder aber nicht an geschwisterlicher Zuneigung. Ihre unauflösliche Beziehung war den beiden sehr wichtig, für den Jüngeren, weil er die Erfahrung gemacht hatte, andere Menschen nicht langfristig an sich binden zu können, und für den Älteren, weil er keine Bindung zu anderen Menschen wollte – wohl wissend oder glaubend, dass es eh niemand länger mit ihm aushalten könnte. Die beiden taten immer alles für den anderen, wenn Hilfe erbeten wurde. Sie waren sich der gegenseitigen Zuneigung sicher, sie liebten sich. Da bedurfte es keiner „amerikanischen Liebesbezeigungen“, wie es Ferdinand nannte, und auch Reginald hätte niemals „Ich hab dich lieb“ zu seinem Bruder gesagt.
Es ist naheliegend, dass Ferdinand seinen Bruder oft um dessen Optimismus und Lockerheit beneidete, ihm dies aber lieber nicht eingestand, damit der Bruder nicht angespornt würde, zügellos zu werden. Reginald beneidete den Bruder nur um Eines: um dessen Zeit. Schließlich stand er noch im Arbeitsprozess und hatte noch lange hin bis zur Rente, der Bruder aber konnte Zeit „zum Fenster hinauswerfen“ oder wie er in Anspielung auf dessen Beobachtungen auch sagte: „Zeit zum Fenster hinausschauen“. Ferdinand war es tatsächlich oft langweilig und er erwiderte seinem Bruder manchmal, dass er eher die Zeit „totschlage“. Am liebsten hätte er bei solchen Gesprächen gerne darüber philosophiert, was „Zeit“ eigentlich ist und was man mit ihr alles anstellen könnte und sollte und wie sich „Zeit“ im Weltall darstellte. „Ist schon gut“, sagte da Reginald und klopfte seinem Bruder auf die Schulter. „Du weißt doch, dass du dir für solche Diskussionen andere Gesprächspartner suchen musst.“
So gab es nach dem Ende der Schachpartie und mit zunehmenden Biergenuss Geschichten über die Macken des brüderlichen Autos, das in letzter Zeit immer wieder in der Werkstatt verschwand, und das dort in der Werkstatt, man stelle sich das vor, doch tatsächlich von einer Frau repariert wurde und dass diese Mechanikerin obendrein auch noch attraktiv wäre. Seitdem, so frotzelte Ferdinand, sei er, Reginald, wohl öfter bei den Reparaturen dabei. Worauf dieser antwortete, dass die Frau eher mundfaul sei und leider eine hochgeschlossene Arbeitskleidung trage. Dann wurde das Gespräch von Reginald auf seinen Beruf gelenkt, hier insbesondere auf pedantische Chefs und pingelige Kunden.
Doch dann sahen die beiden, wie sich dank der verschwundenen Sonne einige Rollläden öffneten. Manche der Nachbarn, vielleicht die glücklicheren oder die mit mehr Geld, traten auf den Balkon hinaus, die anderen stellten sich bei geöffneten Türen hinter die Gitter ihrer Französischen Balkone und atmeten durch. Der Hitler war nicht dabei und auch nicht die Nackte und der Rest wurde schnell von Reginald als „uninteressant“ abgetan.
5Ferdinand hatte seinem Bruder gegenüber ein schlechtes Gewissen und hätte ihm gern ein wenig von seiner Zeit abgegeben. Um seine vermeintliche Schicksalsbevorzugung abzuschwächen, musste er seinem Bruder immer deutlich vor Augen führen, dass das Alter nicht nur Freiheiten, sondern auch Einschränkungen mit sich bringt. Womöglich war es gar kein Zufall, dass seine Schmerzen und die anschließende Gehbehinderung just mit seiner Verrentung einsetzten. Sein Klagen über Schmerzen führte dazu, dass der Bruder, statt empathisch mitzuschwingen, eher alles verharmloste, um keine depressive Stimmung aufkommen zu lassen. Für die andere Strategie, die in solchen Konstellationen gerne angewendet wird, war Reginald noch zu jung und zu fit: Das Hervorheben eigener Leiden. Ein gemeinsames Jammern war also nicht möglich. Reginalds Dagegenreden, wenn der Bruder klagen wollte, brachte den Gesprächen schnell eine Wendung, hinterließ bei Ferdinand aber natürlich ein Gefühl des Nicht-verstanden-werdens und so überlegte er, ob der Kontakt zu anderen Alten oder Kranken für ihn zum Vorteil wäre. Vielleicht aber, so befürchtete Ferdinand, würde es dabei zu einem Wettbewerb kommen: Wer ist der Kränkere? Möglich wäre auch, dass so ein Kontakt aber auch die Einsicht brächte, dass es anderen noch viel schlechter geht und er mit seinem Leid zufrieden sein kann. Theorie, Theorie!, mahnte er sich bei solchen Überlegungen, ich kenne ja ohnehin niemand.
Eine weitere Variante überlegte er auch noch: Die Anstellung einer Pflegekraft, die berufsbedingt Empathie aufbringen musste und keine eigenen Leiden den seinen entgegenstellen durfte. Theorie, Theorie, dachte er wiederum, die Pflegekräfte sind auch nur Menschen und heutzutage darf jeder eine Pflegekraft sein, auch grobe und nicht einfühlsame Leute. Und über die Kosten wollte er lieber erst gar nicht nachdenken, sie wären aber auch kein Problem gewesen. Nein, nein, es ist schon gut so, wie es ist. Menschen kann man sich nicht schnitzen.
Reginald war unsicher, wie schlecht es seinem Bruder wirklich ging und in manchen Nächten, wenn er unerklärlicherweise einmal nicht gut schlafen konnte, kam ihm die Befürchtung, es könnte mit ihm auch einmal so weit kommen. Das versöhnte ihn andererseits mit der Tatsache, dass er sich beruflich noch lange mit unfähigen Leuten abplagen musste, denn lieber als ein kranker Rentner, war er doch ein gestresster Berufstätiger. Er hob seine beruflichen Probleme gegenüber seinem Bruder hervor, um nicht ganz als derjenige dazustehen, der als Gesunder und Gutgelaunter vom Schicksal bevorzugt wäre.
6Beide Brüder konnten aber nicht mithalten mit dem Hitler auf der anderen Seite! Sie hatten auch keine Ahnung, wie es bei dem wirklich aussah. Der seltsame Mensch war nämlich tatsächlich ein vom Schicksal Gebeutelter: Eine schleichend zunehmende Augenerkrankung ließ ihn innerhalb von Monaten fast erblinden und dann kam ein schwerer häuslicher Unfall dazu, der ihn gehbehindert machte. Nun lebte er in einer weitgehend leeren Wohnung, ausgestattet nur mit dem Nötigsten. An sonnigen Tagen schleppte er sich in den größten Raum seiner Wohnung, besonders zur Abendzeit, wenn die Sonne in das schwarze Zimmer hineinschien, denn er wollte wenigstens noch ein bisschen Licht in seine nahezu blinden Augen hineinlassen. Das gab ihm das Gefühl, nicht gänzlich in einer dunklen Welt zu leben. Leicht bekleidet und mit einer Flasche Wasser ausgestattet, hielt er es dort aus. Oft drückte er auf seine auf dem Tisch liegende Blindenuhr, um sich zeitlich zu orientieren, doch es half nichts: Die Zeit verging zu langsam. Wird es noch einmal besser? Sollte ich nicht doch etwas unternehmen?
Über die Nackte wusste Ferdinand auch nichts. Sie wohnte allein, war ein Single, wurde allenfalls einmal von der Mutter besucht, vom Vater aber nicht. Das Vater-Tochter-Verhältnis hatte sich in letzter Zeit zu einer Nicht-Beziehung gewandelt und es schien, als ob dies für beide die beste Lösung wäre. Äußere Konflikte mit ihm waren Vergangenheit. Der Vater war ein reicher Mann, hatte sein ganzes Geld in die große Immobilie gesteckt, in der die Tochter nun in einer Penthouse-Wohnung residierte. Selten, dass sie einmal in sich eine Dankbarkeit dafür spürte, dass sie der Vater dort kostenlos wohnen ließ. Nur die Nebenkosten musste sie selbst tragen. Und natürlich hatte sie sich auch niemals direkt beim Vater bedankt. Sie ging davon aus, dass er gut von den Mieteinnahmen der anderen Mieter leben konnte und keineswegs auf ihren finanziellen Beitrag angewiesen war. Die Tochter arbeitete bei sich daheim. Und für ihre Arbeit benötigte sie ein attraktives Äußeres mit einem sonnengebräunten Teint.
Ferdinand wusste auch nichts über die junge Frau auf der Parkbank, die er Audrey nannte. Sie erschien ihm als Geheimnisvollste seiner Nachbarschaft. Sicherlich beschäftigte er sich innerlich auch deswegen mit ihr am meisten, weil sie die Einzige war, die mit ihm durch ihr Winken Kontakt aufnahm. Er hatte zufällig einmal durch einen Artikel im Feuilleton seiner Tageszeitung herausbekommen, was Audrey auf der Bank praktizierte: Das Anspannen der Hände zu Fäusten und wieder Loslassen war weder eine Wut- noch eine Nervositätsgeste, wie er vorher spekuliert hatte, sondern ein Entspannungstraining. Aus den Entspannungsübungen schloss er, dass sich Audrey von ihrer Arbeit gestresst fühlte. Und ihr Arbeitsplatz musste gleich in der Nähe sein, womöglich im selben Häuserkomplex. Audrey erschien ihm als ein so zartes, zerbrechliches Wesen, dass er davon ausging, dass die junge Frau vielleicht als Vorleserin bei einer reichen kranken, ans Bett gefesselten Witwe tätig war. Vielleicht auch als Au-pair bei streng erzogenen und hoch gebildeten Kindern. Zu Letzterem passte aber nicht der Zeitpunkt ihrer Arbeitspause am Nachmittag. Reginald hingegen meinte, sie schleiche sich verbotenerweise in den für die Bewohner reservierten Innenhof herein. Sie sei wohl eine Bäckereifachverkäuferin am Vormittag und gehe nach einer Mittagspause noch als „Tippse“ in dem Steuerbüro um die Ecke arbeiten, weil das Geld hinten und vorne nicht reiche. Deshalb sei sie auch nur „ein Strich in der Landschaft“ und er wolle ihr, wenn er sie mal sähe, etwas zum Essen hinabbringen – was ihm Ferdinand aber strikt untersagte, denn die Audrey gehörte ihm! Reginald glaubte, diese Frau inzwischen gut zu kennen, denn er erkundigte sich auch bei den häufigen Telefonaten nach dem „zarten Wesen“. Selbstverständlich ging Reginald davon aus, dass der „alte Knacker“ auch als „ausgehungerter Mann“ von der jungen Frau fasziniert war.
Ferdinand machte in der Tat die Erfahrung, dass Alter nicht vor Torheit schützt. Allerdings war es bei ihm keine Torheit im Handeln, sondern nur im Denken. Er war froh, dass Reginald keinen Kontakt zu Audrey hatte, denn diesem traute er zu, dass er auch mit Handeln aktiv würde. Nach Reginalds Rechnung hätte ein 55-Jähriger auch eine kleine Chance, aber ein 74-Jähriger wohl weniger, denn Audrey wurde von Ferdinand auf vierundzwanzig geschätzt, also fünfzig Jahre jünger. Das wären dann fünfzig mal fünfzigtausend, also genau zweieinhalb Millionen Euro Vermögen – und da fehlte es weit bei Ferdinand! Junge Frauen blieben also den reichen alten Amerikanern oder den ebenso nach Bestätigung lechzenden vermögenden deutschen Unternehmern, Politikern oder Profisportlern vorbehalten. Reginald widersprach dem Bruder aber mit der Feststellung, dass bei armen dünnen Mädchen der Berechnungssatz sicher niedriger anzusetzen sei. Ferdinand entgegnete mit Argumenten, die die äußere Attraktivität und das Leistungsvermögen im Bett betrafen, was Reginald dazu brachte, das bald zu erwartende Erbe dagegen zu rechnen. Zum Glück für die junge Frau bekam sie von den männlichen Flapsigkeiten nichts mit …
Solche brüderlichen Gespräche brachten Ferdinand allerdings dazu, nach Möglichkeiten zu suchen, wie er seine Audrey kennenlernen könnte. Er wollte sich ihr aber nicht im Innenhof am Rollator schleichend nähern. Und überhaupt: Sein Äußeres erschien nur aus der Ferne akzeptabel. Dabei war es nicht einmal die Kleidung, für die er sich schämen musste, sondern seine Altershaut, bei der selbst das Gesicht nicht gnädig ausgespart wurde, und seine Kopfhaare und der Vollbart, beide schon äußerst licht. Das Haar war auch ziemlich lang und dank seiner schwer zu bändigenden Natur auch etwas wirr, so dass Reginald oft und wenig schmeichelhaft von einem „Obdachlosenlook“ seines Bruders sprach. Zudem waren Ferdinands Finger von Arthrosen verbogen und wirkten ungepflegt. Und es gab vieles mehr, was sicher so eine junge Frau abschrecken würde.