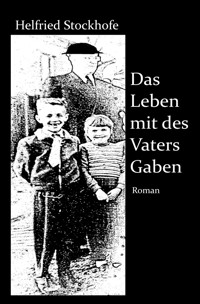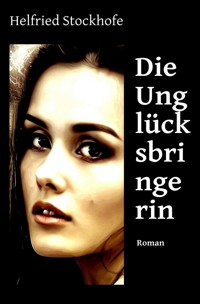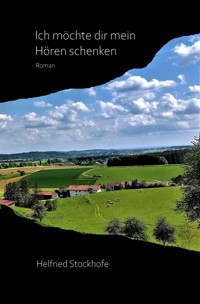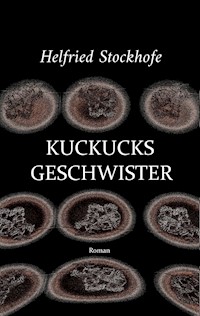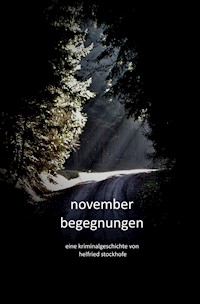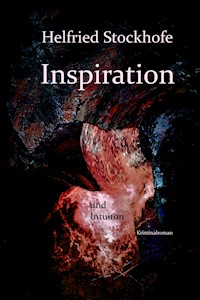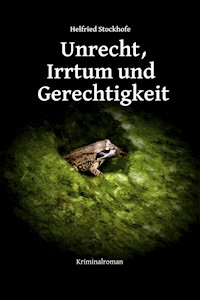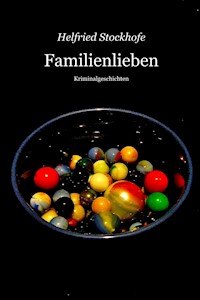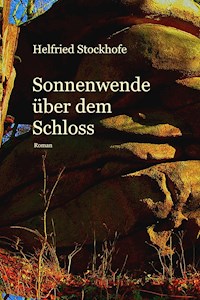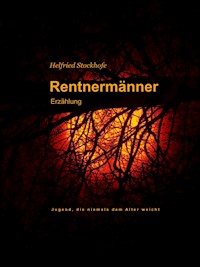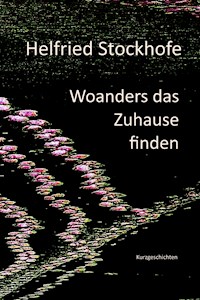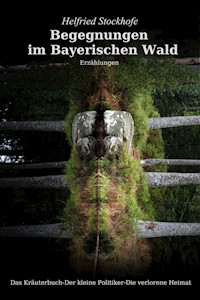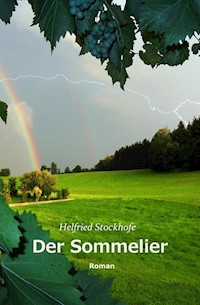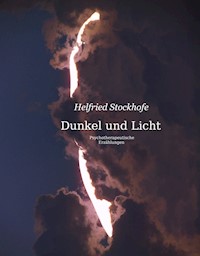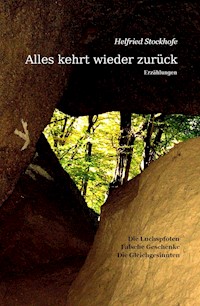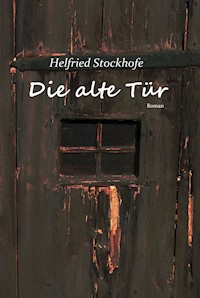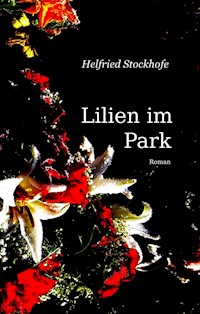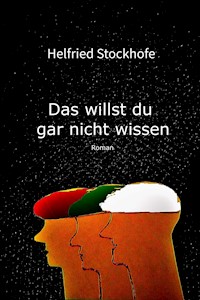
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Ein Kind, das nicht mehr mit seinen Eltern spricht und deshalb mehrere Psychotherapeuten beschäftigt; sein älterer Bruder, der seine Familie verlässt und zum zweiten Mal der Sohn einer anderen Familie wird; und der Kontakt dieses jungen Mannes zu einer dritten Familie bilden die Handlungsgrundlage für ein Verwirrspiel aus Wahrheit und Lüge, Schuld und Schicksal, Einsamkeit und Zugehörigkeit, Flucht und Suche.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 190
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das willst du gar nicht wissen
Helfried Stockhofe
Copyright: © 2017 Helfried Stockhofe
Verlag: Helfried Stockhofe, Traitsching
helfried.stockhofe(at)web.de
Druck: epubli, ein Service der Neopubli GmbH, Berlin
Kapitel 1
In der Oberpfalz
Kapitel 2
In Berlin
Kapitel 3
In der Oberpfalz
Kapitel 4
In Unterfranken
Handlung und Personen sind frei erfunden.
Die im Roman verwendeten Gedichte können
am Schluss des Buchs nachgeschlagen werden,
ebenso die Buchtitel, auf die im Text mit
eingeklammerten Zahlen verwiesen wird.
Glitschige Welt
im Dezember bei den Schweinen im Wald,
im März zwischen den Rebgassen,
im Gewitterregen des Frühjahrs,
vor Jahrzehnten auf den Straßen,
bei der Zeugung, bei der Geburt und beim Tod
hinein- und hinausgerutscht.
Kapitel 1
In der Oberpfalz
In der Oberpfalz analysieren die Psychotherapeuten Gedichte, eine Familie und selbstverständlich auch sich selbst.
1
„So Jonas, jetzt haben wir beide unsere Depressionen hinter uns!“ Mit diesen Worten empfing mich meine Schwester, als ich aus der Klinik entlassen wurde. Ihr Wort in Gottes Ohr, dachte ich mir, obwohl ich es eigentlich mit Gott nicht so habe. Aber man sagt es halt so. Manche sagen Dein Wort in Gottes Gehörgang, was auch andeutet, dass sie es mit Gott nicht so ernst nehmen wollen. Die Gehörgangs-Formulierung wird nämlich als despektierlich empfunden, obwohl sie es nicht ist. Die Verwendung dieser Sprüche zeigt, dass wir nicht glauben, alles selbst unter Kontrolle zu haben. Und bei meiner Schwester und mir geht es da konkret um die psychische Gesundheit, also darum, eigenverantwortlich gesund bleiben zu können oder schuldhaft erneut krank zu werden. Es liegt nicht in unserer Macht sagen die Gläubigen.
Überhaupt diese Sprüche!
Meine Patienten verwenden gerne solche Sprüche. Und ich als Psychotherapeut kann sehr oft daraus etwas ableiten. Aus allem kann ich etwas ableiten! So sagen jedenfalls meine Kollegen und grinsen dabei. Besonders diejenigen, die nicht zu meiner Fraktion der Tiefenpsychologen gehören. Sogar aus Namen kann ich etwas ableiten. Natürlich auch aus meinem eigenen Namen. Ich heiße Jonas, mit vollem Namen: Jonas Weber. Jonas hat man mich genannt, weil meine Mutter in der Schwangerschaft so dick war, nachdem ich mich in ihr so breit gemacht hatte wie Jonas im Wal. So war mein Scherz früher. Nachdem ich aber erfuhr, was mit meiner Mutter bei der Geburt meiner jüngeren Schwester passiert ist, ist mir das Scherzen vergangen.(4)
Aber zurück zu den Sprüchen meiner Patienten! Und zu den falschen Ausdrücken, die manchmal natürlich auch mit dem Bildungsstand zusammenhängen, aber eigenartigerweise oft ein ganzes Leben lang beibehalten werden, trotz besseren Wissens! Oft sind es Verwechslungen, die zeigen, dass der falsch angewandte Ausdruck zwar gekannt, aber nicht verstanden wird. Wer hat nicht schon folgende Beispiele gehört:
Arrangieren statt engagieren, integrieren statt intrigieren, Effekt statt Affekt, Stadion statt Stadium, professorisch statt provisorisch und so weiter. Aus diesen Fehlern lässt sich psychologisch wenig ableiten, schon eher aus Neuschöpfungen wie diesen hier:
Trottur statt Tortur, es herrscht heiteler Sonnenschein, übers Ohr gezogen, steter Tropfen ölt den Stein, aufs Tablett schmieren, von Sodom zu Gomorrha gehen, die Kuh beim Schwanz fangen (statt: das Pferd von hinten aufzäumen – aber wer weiß, vielleicht hat sich die Redewendung mit der Kuh bei unseren Milchbauern längst durchgesetzt), ein strenges Register führen, Pik und Bello, nicht über meine Leiche.
Manches davon wird hoffähig, weil es von vielen Menschen fälschlicherweise so ausgedrückt wird. Die Verwechslung Tablett/Tapet wäre ein Beispiel dafür. Wer kennt heutzutage noch ein Tapet?
Aber es gibt auch richtige Freudsche Versprecher – und da weiß natürlich gleich ein jeder, was dahintersteckt – und jedes Psychologenherz jubelt:
absamen statt absahnen,
pinkelig – oder pimmelig - statt pingelig,
murmelig statt mulmig,
nachhacken statt nachhaken,
aufgeflaut statt aufgeflammt,
traktieren statt taktieren,
marode statt Marotte,
aufdoktruieren statt aufoktruieren.
Wenn mir meine Patienten solch gelungene „Freudsche Fehlleistungen“ mitbringen, wird eine ausführliche Besprechung fällig...
Das Wort meiner Schwester sollte also in Gottes Ohr eindringen. Was mit der Hoffnung verbunden ist, dass Gott, wenn er das hört, auch wirklich wohlgesonnen seine schützende Hand über uns hält und uns nie mehr depressiv werden lässt. Nein, bei mir als überzeugtem Atheisten wird er den Teufel tun... Upps...
Ich muss mich also selbst um mich kümmern, schauen, dass weder die Depression, noch die Zwänge mich jemals wieder beherrschen! Nun, ganz allein bin ich ja nicht! Jetzt meine ich aber nicht meine Schwester, sondern meine Psychotherapeutin, also die Kollegin, die sich immer schnäuzt, wenn ich ihr zu nahe komme. (4)
Ich werde ihr gelegentlich einen Besuch abstatten. Ach, auch in eine Selbsthilfegruppe könnte ich gehen. Und beruflich kürzer treten! Das sowieso.
In meiner Praxis stapelt sich nicht die Arbeit. Das geht zum Glück nicht bei uns Psychotherapeuten. Da stapelt sich nichts. Ich werde vorerst keine neuen Patienten aufnehmen und bei den alten langsam wieder einsteigen. Es muss nicht jeder wöchentlich zu mir kommen. Ich kann die Termine etwas strecken.
2
Als Jonas in unsere Intervisionsgruppe kam, in der wir unter Kollegen unsere Fälle besprechen, war ich mir etwas unsicher. Aber ich hatte vor den anderen so getan, als wäre es gut, noch einen Mann aufzunehmen. Damit ich nicht mehr der einzige bin! Drei „Mädels“ und ein Mann, da war ich vorher der Hahn im Korb. Aber nein, das Geschlecht spielt eigentlich keine besondere Rolle unter uns Kollegen. Dazu sind auch die Frauen zu unterschiedlich. Ich spürte weder ein Sich-Verbünden der Frauen gegen mich, noch wurde mir eine besondere Rolle als Mann angetragen, etwa im Sinne von „Hahn im Korb“. Später fragte mich Jonas einmal: „Sag mal, Max, hast du etwas mit der Alina?“
Natürlich verneinte ich das! Klar, unsere Kollegin Alina und ich sind außerhalb der Intervisionen manchmal auch privat zusammen, unternehmen etwas miteinander. Aber wir „haben“ nichts miteinander. Aber seit dieser Frage von Jonas ist seine Anwesenheit in unserer Gruppe irgendwie ein wenig störend. Vielleicht „habe“ ich doch etwas mit Alina – und fürchte um meine Stellung bei ihr! Womöglich fragte mich Jonas auch nur, um sein Terrain zu sondieren!
Nun passe ich jedenfalls immer auf. Die Unbefangenheit ist mir etwas verloren gegangen. Ich überlege oft, wie ich etwas ausdrücken soll, zügele meine spontane und lockere Art. Aber eigentlich braucht es das nicht. Jonas ist doch eher ein Langweiler, was Frauen anbetrifft. Der überlegt zehn Mal mehr als ich, was er sagt. Und besonders humorvoll kommt es dann auch nicht rüber.
Ich hielt ihn anfangs für ziemlich gestört. Ein Zwängler par excellance. Erst, als er mich einmal zu sich einlud, wurden wir warm miteinander. Er wollte meinen Rat und das machte ihn etwas sympathischer. Er gönnte mir auch meine Überlegenheit bei den Computerfragen. Und diesbezüglich war und bleibe ich auch im Team die Nummer eins!
Dann kam seine Depression. Die machte ihn auch sympathischer. Ich musste ihn nun ganz und gar nicht mehr fürchten. Damit meine ich nicht nur ihn fürchten als „Mann“, sondern auch, was die fachliche Qualifikation anbetrifft. Aber das ist ohnehin schwer vergleichbar. Er ist halt ein Tiefenpsychologe und arbeitet doch ganz anders als ich. Obwohl es immer heißt, alle Verhaltenstherapeuten und Tiefenpsychologen würden sich im Verlauf der Zeit angleichen – wenn sie älter werden. Vielleicht sind wir nicht alle.
Ob ich auch einmal depressiv werden könnte? Die Tiefenpsychologen wüssten darauf eine Antwort. Von wegen Kindheitstraumata und so. Ich glaube nicht, dass ich einmal depressiv werden könnte. Oder gar schizophren. Außerdem hatte ich ja auch keine Vorfahren, die diesbezüglich aufgefallen wären.
Man merkt, ich bin im Verlauf meiner Psychotherapeutentätigkeit immer mehr dazu gekommen, auch den erblichen Faktoren einen großen Einfluss zuzuschreiben. Die Analytiker und Tiefenpsychologen gehen immer von Mehrfachdeterminierung aus. Sie finden also immer irgendwelche Ursachen, viele Ursachen, für die psychischen Erkrankungen, brauchen meist nicht das Erbe bemühen. Besonders unsere schlaue Ilona, die Psychoanalytikerin. In was rede ich mich da wieder rein? Die Ilona ist in Ordnung! Überhaupt sind alle in Ordnung! Sonst würde es ja auch gar nicht so gut funktionieren in unserer Intervision. Auch die Inge ist in Ordnung! Fachlich ist sie mir zu sehr ein Gutmensch. Keine knallharte Verhaltenstherapeutin. Da ist mir die Alina schon lieber. Trotz ihres tiefenpsychologischen Ansatzes. Aber vermutlich denke ich da gar nicht so sehr an die fachlichen Qualitäten...
Hab ich vorhin bei Jonas gedacht, dass seine Depression die fachliche Qualität verringert? Das war Quatsch!
3
Mein Gott, der Max! Ich weiß nie, wann ich ihn ernst nehmen kann. Mal erscheint er mir oberflächlich, dann wieder tiefsinnig. Wie ist er wirklich? Obwohl ich ihn nun schon lange kenne, überrascht er mich oft – im Positiven, wie im Negativen.
Jonas ist da berechenbarer. Ob das daran liegt, dass er auch ein Tiefenpsychologe ist. Nein, es liegt wohl eher an seiner Art, etwas unflexibel, zwanghaft, eben berechenbarer. Warum fühle ich mich dann trotzdem zu Max mehr hingezogen? Alina, pass auf! Muss wohl etwas zwischen Mann und Frau sein. Ein Mann ist Jonas nämlich überhaupt nicht für mich.
Da fällt mir Walter ein. Warum nicht mein Bernd? Vielleicht ist es etwas ganz anderes. Bernd ist mein Ehemann und Max und Walter sind...? Ja, was sind die eigentlich? Gute Freunde? Freunde? Wirklich?
An Walter, meinen blinden Freund, muss ich oft denken.(1) Wir sehen uns viel zu selten. Hab ich gerade sehen formuliert? Wir treffen uns viel zu selten, wäre richtiger. Das liegt wohl auch daran, dass er nun eine Familie hat. Ob er seiner Partnerin von mir und meinen Annäherungen erzählt hat? Damals dachte ich noch, er wäre auch hinter mir her. Falsch gedacht. Nun ist er ein Freund. So wie Flinker? Wenn ich an Walter denke, kommt mir auch „mein Kommissar“ in den Sinn. Aber das mit Flinker ist anders. Der ist ja auch um einiges älter.
Was hab ich nur mit den Männern? Zu meiner Entschuldigung kann ich sagen, dass alle Männer gerne meine Gesellschaft suchen. Also nicht umgekehrt. Oder? Was fühlen denn die anderen Frauen?
Ich merke, dass ich zu wenig intime Frauenfreundschaften habe. Auch nicht mit meinen Intervisionskolleginnen Inge und Ilona. Selbst der Kontakt zur Berliner Kollegin Sarah ist nur spärlich.(3) Ab und zu einmal eine Nachricht auf dem Smartphone oder ein Telefonat, ein langes Telefonat allerdings. Wie oft nehme ich mir vor, meine Kontakte besser zu pflegen!
Mit Walter wird es nun bald etwas werden. Ich meine das mit dem Kontakt. Ich habe nämlich einen glänzenden Anlass!
Es ist eine Patientin von mir, Lisa, die mir den Anlass bietet. Sie bringt mir in die Sitzungen Gedichte mit. Und wer anders als Walter kennt sich mit Gedichten aus!
ist es gut?
wenn die wälder hinter dem schnee verschwinden
wenn das geplapper der menschen verschluckt wird
wenn der fuß ins leere tritt
und in der hand der schnee treibt
dann laufe ich
dann laufe ich
ich laufe über steine
ich laufe über straßen autos und häuser
ich laufe über regenwürmer und nullfolgen
ich laufe und höre meinen atem
ich laufe und keuche
ich laufe im takt meines herzens
4
„Lies es mir bitte noch einmal vor!“
„Walter, jetzt habe ich es doch schon drei Mal vorgelesen!“ Es war nur eine gespielter Tadel, den Alina mit einem leisen Aufseufzen verband. Und Walter antwortete mit einem Schmunzeln: „Aber, Alina, du weißt doch, ich höre deine Stimme so gerne!“
Zunächst zögerte Alina, denn für einen Blinden bedeutet die Stimme wirklich schon fast alles. Dann aber sah sie sein Grinsen. „Walter, du bist ein Schmeichler!“
„Nein, Alina, das meine ich nicht als Kompliment! Ja, schon auch als Kompliment. Aber ich bin manchmal etwas traurig darüber, dass wir uns so selten sehen.“
Wieder zögerte Alina. Sie hatte sich in der Kommunikation mit dem blinden Walter angewöhnt, vorsichtig mit den Worten umzugehen. Und jetzt sprach Walter selber so locker das Wort „sehen“ aus. Vermutlich war für ihn diese Redewendung ganz normal. Er war ja schließlich nicht seit seiner Geburt blind. Erst seit seinem Autounfall vor 17 Jahren.
„Ja, die Umstände eben“, sagte Alina und suchte damit eine Erklärung für den seltenen Kontakt. „Man kann nicht immer, wie man will.“
„Spielst du auf meine Partnerin an?“
„Nein! - Ja. Auch. Aber vor allem darauf, dass wir beide so beschäftigt sind.“
„Und dass ich als Blinder nicht so mobil bin...“
„Vielleicht auch... Aber interessant finde ich ja, dass du nicht davon ausgehst, dass zu den Umständen auch meine eigene Partnerschaft gehört.“
„Na ja, Alina, die hat dich doch noch nie abgehalten!“
„Jetzt wirst du aber frech!“
„Entschuldige! Ich wollte dir nicht zu nahe treten!“
Beide dachten an ihre „Bettgeschichte“ zurück. (1)
Ja, damals wäre es fast passiert – wenn Walter nicht im letzten Moment einen Rückzieher gemacht hätte. Seine Figur hat er gehalten, bemerkte Alina. Trotz des vielen Weins. Aber vielleicht muss ein Sommelier gar nicht selber trinken. Er wird wohl auch fleißig Fitness betreiben. Die Muskeln kommen ja auch nicht von ungefähr.
„Also zurück zum Thema!“, mahnte Alina Walter, aber noch mehr sich selbst. „Was sagst du zu diesem Gedicht?“
„Mmh. Ich kenne es nicht. Klingt ein wenig nach Walt Whitman.“
Sie runzelte die Stirn. „Dem Amerikaner?“
„Ja. Walt Whitman, einer aus dem 19. Jahrhundert.“
„Meinst du?“
„Nein, Alina, ich sage doch nur, es klingt so. Was ist denn eine Nullfolge?“
„Keine Ahnung.“
„Und du sagst, dass du dieses Gedicht von einer Patientin bekommen hast?“
„Ja. Aber angeblich ist es von ihrem Sohn.“
„Ihrem Sohn? Wie alt?“
„14 Jahre.“
„Wie 14 klingt das aber nicht!“
„Nun, alles ist klein geschrieben und ohne Satzzeichen.“
Walter war erstaunt: „Ja, das musst du mir aber sagen! Aus deiner Stimme höre ich das nicht heraus!“
Alina fühlte sich bei ihrer Unaufmerksamkeit ertappt: „Entschuldige!“
„Ja, ja, so ernst habe ich das nicht gemeint. Aber wieso soll das auf einen 14-Jährigen hindeuten? Ein 14-Jähriger sollte wohl wissen...“
„Nein, nein“, unterbrach Alina, „ich hatte eine andere Idee! Die Kleinschreibung deutet auf einen Protest hin. Und ein Junge in der Pubertät...“
„Ach so. Aber andere haben auch klein geschrieben. Denk mal an Stefan George!“
„Ja, den kenne ich! Ich hatte einmal einen Patienten, der immer Stefan George rezitiert hat (6). Etwas mit einem Park.“
„Komm in den totgesagten Park!“
„Genau, das war´s. Ich wusste doch, du bist ein Lyrik-Genie!“
Walter räusperte sich. „Nun ja.“
„Okay. Also, Walter, was ich wissen wollte, ist, ob das Gedicht deiner Meinung nach, von einem 14-Jährigen stammen könnte. Oder ob es vielleicht von einem bestimmten Dichter ist.“
Walter fühlte sich geschmeichelt, dass Alina ihn als Lyrik-Fachmann sah. „Auf jeden Fall ist mir das Gedicht nicht bekannt“, antwortete er. „Und frühreife 14-Jährige soll es geben.“
„Okay. Ich danke dir!“
„Was, das war´s schon? Nein, nein, so schnell kommst du mir nicht davon!“ Und mit diesen Worten griff er erstaunlich zielsicher nach Alinas Armen. Sie ließ sich das gerne gefallen.
„Ich bleib schon noch ein bisschen!“, beruhigte sie ihn und küsste ihn auf die Wange. Er strahlte! Sie aber löste sich wieder aus seiner Nähe. Und passend zu ihrer kleinen Distanzierung fragte sie: „Schreibst du eigentlich auch noch Gedichte?“
Walter war verwundert. „Wie kommst du drauf, dass ich Gedichte schreibe?“
Alina errötete. Zum Glück sah er das nicht! Sie war sich unsicher, ob sie das überhaupt wissen durfte. Womöglich hatte sie etwas verraten, was sie für sich behalten sollte.
„Ich habe das mal läuten hören“, sagte sie. (1)
Natürlich dachte auch Walter gleich an die ersten Monate seines Kennenlernens mit seiner jetzigen Partnerin: Verliebtsein lässt lyrische Adern schwellen.
„Das kannst du vergessen!“ antwortete er schließlich. „Dazu braucht es eine ganz besondere Inspiration. Und derzeit habe ich hauptsächlich Arbeit. Aber noch einmal zurück zu deinem Gedicht!“, kam er wieder auf das ursprüngliche Thema. „Wichtiger wäre doch der Inhalt. Und die Frage, warum dir deine Patientin die Gedichte mitbringt!“
Auch Alina war froh um die Gesprächsverlagerung. „Ja, ich weiß. Aber das bespreche ich besser mit meinen Kollegen.“
„Natürlich!“
„Sei nicht beleidigt!“
„Nein, nein!“
„Das ist gut!“
„Ist es gut?“
„Wie jetzt?“ Alina war etwas verwirrt.
„Das Gedicht heißt so!“
„Ach so.“
„Also, Alina“, beruhigte Walter die Situation wieder, „das Gedicht zu verstehen, ist gar nicht so schwierig. Das erste ist eine einfache Naturbeschreibung, die doch jeder kennt – sogar ich erinnere mich: Wenn man bei heftigem Schneefall über die Wiesen auf die Wälder zuläuft, dann verschwinden diese hinter dem dicht fallenden Schnee. Und jeder Lärm, etwa aus dem naheliegenden Dorf, wird vom Schnee verschluckt. Und in dem hohen Schnee kann man schon mal stolpern und hinfallen. Und dann bleibt der Wanderer nicht liegen, sondern fängt das Laufen an.“
Alina war erstaunt, wie sehr sich der blinde Walter das Gedicht eingeprägt hatte, und Walter fuhr nach kurzem Nachdenken fort:
„Aber nun ist nicht mehr von Schnee die Rede, sondern von Steinen, Straßen und von Dingen, die im Weg stehen. Diese werden überwunden und das ist anstrengend.“
Jetzt widersprach Alina: „Aber Walter, das ist doch nur die halbe Wahrheit! Schau dir doch einmal die Überschrift an!“
Verdammt, jetzt hatte sie „schau“ gesagt!
„Ach ja, die Überschrift.“ Walter stutzte. „Die ist wirklich seltsam. Die ist etwas für deine Denke, Alina!“
„Der junge Schreiberling ist auf jeden Fall unsicher“, sagte Alina, „unsicher, ob das alles richtig ist.“
„Was alles?“
„Das Laufen. Vielleicht ist es ein Davonlaufen.“
„Oder ein Darüberlaufen, so im Sinne von Nichtbeachten oder noch besser Nichtwürdigen dieser anderen Sachen.“
„Das ist gut, Walter! Dafür spricht etwa die letzte Zeile: Ich laufe im Takt meines Herzens! Also nicht im Takt der anderen!“
„Dann würde mit der Überschrift ein Zweifel ausgedrückt, ob man so egoistisch sein darf.“
„Dafür spricht auch die Formulierung mit dem Geplapper der Menschen. Das klingt schon sehr abwertend!“
„Aber gut. Besprich es mit deinen Leuten! Ich bin ja nur ein einfacher blinder Sommelier!“ Und wieder grinste er.
Und Alina lachte. „Der Walter ist wieder mal beim fishing for compliments!“ Dabei boxte sie ihn zärtlich auf seine muskulöse Brust, was den blinden Walter ein wenig erschreckte. Und er natürlich mit übertriebener Schmerzgestik und Gestöhne honorierte.
5
In Alinas Intervisionsgruppe stürmte es in den Gehirnen der fünf Psychotherapeuten: „Einsamkeit! Das höre ich heraus! Der junge Mann fühlt sich einsam. Sagte ich Mann? Der Junge fühlt sich allein.“
„Und er ist enttäuscht. Enttäuscht von den plappernden Menschen.“
„Und haltlos ist er. Er findet keinen festen Boden unter den Füßen, tritt ins Leere.“
Jonas unterbrach das Brainstorming: „Sag mal, Alina, warum bringt dir deine Patientin dieses Gedicht überhaupt mit? Das ist doch wichtig!“
„Ja, das ist natürlich auch wichtig“, relativierte Alina. „Sie sagte mir, dass sie sich große Sorgen um ihren Sohn mache. Vermutlich erhofft sie sich, dass ich aus diesem Gedicht etwas herauslesen kann.“
„Wieso macht sie sich große Sorgen um den Sohn?“
„Weil er nicht redet, zumindest mit ihr nicht redet. Oder selten redet.“
„Mein Gott!“, warf Max ein, „Das kommt bei Pubertierenden schon mal vor!“
„Aber Max, der redet schon Jahre nicht mehr mit ihr!“
„Ach so.“
„Vielleicht nach einem Trauma?“
„In der Schule redet er aber.“
„Mmh.“
„Sag mal, Ilona, was hältst du davon?“, fragte Alina nun ihre gescheite Analytikerkollegin. Ilona hatte sich bisher zurückgehalten. Sie wollte wohl wieder extra gefragt werden.
„Vielleicht“, meinte Ilona und richtete sich in ihrem Sessel auf, „vielleicht schreibt er ihr Gedichte, damit sie endlich kapiert, wie es um ihn steht.“
„Nein, Ilona, der Sohn weiß doch gar nicht, dass die Mutter die Gedichte liest...“
„... und diese ihrer Therapeutin zeigt?“
„Das weiß der auch nicht.“
„Und dass die Therapeutin diese Gedichte ihren Kollegen vorlegt, weiß er natürlich auch nicht!“ Nun war Ilona in ihrem Element. Wieder einmal konnte sie ihre Strenge einbringen.
„Natürlich nicht!“, erwiderte Alina, die den tadelnden Unterton der Kollegin erkannt hatte. „Aber in einer Intervision wird man wohl so etwas besprechen dürfen!“
„Ich weiß nicht. Ich wär da vorsichtig!“, sagte Ilona und drückte mit einer wedelnden Handbewegung ihre Skepsis aus.
„Ach, Ilona, du nimmst es wieder einmal sehr genau!“, stöhnte Max und rollte, zu Jonas gewandt, mit den Augen.
„Immerhin ist der Sohn ja nicht dein Patient, sondern die Mutter!“, rechtfertigte Ilona ihre Rüge.
„Apropos“, mischte sich Jonas wieder ein, „warum ist die Mutter eigentlich bei dir? Es wird doch nicht nur um den Sohn gehen!“
„Ja, Jonas, da triffst du eine wunde Stelle!“, musste Alina eingestehen. „In der Tat redet sie meist über den Sohn, statt über sich.“
„Dann soll sie den halt zu einer Jugendlichentherapeutin schicken!“, drängte Ilona.
„Hat sie versucht. Das will er nicht. Da geht er nicht hin!“
„Aber du kannst doch nicht den Sohn via Mutter behandeln! Gib ihr wenigstens die Adresse einer Jugendlichenpsychotherapeutin mit.“
„Hab ich ja gemacht. Ich weiß, dass ich den Sohn nicht behandeln kann.“
„Und? Warum versuchst du das dann?“, legte Ilona nach.
Nun wurde es Alina peinlich. „Ach, stochert doch nicht immer darin herum. Ich hab es ja schon bereut, diese Patientin aufzunehmen. Aber ihre Hausärztin hat mich wieder einmal überredet!“
Jetzt war Inge an der Reihe. Sie hatte bisher aufmerksam, aber schweigend zugehört. Nebenbei war sie wieder einmal damit beschäftigt, einen beruhigenden Tee zuzubereiten. Doch so ganz außen vor bleiben, wollte sie nicht.
„Und mit welcher Diagnose behandelst du die Patientin?“, fragte sie.
„Mit Verdacht auf Persönlichkeitsstörung?“
„Persönlichkeitsstörung? Wieso denn das?“
„Verdacht auf Persönlichkeitsstörung!“
„Ja. Und wieso?“
„Nun, Inge, ich glaube, die ist narzisstisch so gestört, dass man schon von einer Persönlichkeitsstörung sprechen kann.“
„Und gibt es da einen Zusammenhang zur Sohn-Problematik?“
„Ich denke schon. Zum einen bei der Therapiemotivation. Ich meine damit, dass die Persönlichkeitsstörung der Grund ist, warum sie eher ein Bewusstsein für die Störung des Sohnes hat als für ihre eigene Störung. Wie es eben so ist bei den Persönlichkeitsgestörten. Aber auch inhaltlich: Der Sohn ist womöglich wegen der Problematik der Mutter gestört. Aber die Behandlung ist ja noch ganz am Anfang. Mal schauen, wie sich alles entwickelt. Vielleicht dauert das Ganze gar nicht so lang.“
„Du meinst, dass die Patientin irgendwann einmal die Therapie abbricht?“
„Das kann ich mir gut vorstellen. Aber auch umgekehrt: Dass ich die Behandlung beende.“
„Weil sie nicht selbstexplorativ arbeiten kann?“
„Ja, auch. Aber auch, weil sie für mich schwierig ist.“
„Schwierig?“, fragte Ilona rhetorisch. „Fast alle sind doch schwierig! Persönlichkeitsgestörte erst recht.“
„Da ist wohl noch etwas anderes. Etwas Persönliches. Etwas bei mir“, musste Alina nun eingestehen. „...Die Patientin hat so Redemechanismen, die ich nicht leiden kann … Also ich nenne mal einige Beispiele: Sie fängt viele Sätze mit Schauen Sie an oder beendet sie mit Ja oder Verstehen Sie.“
„Ach, du meinst dieses belehrende Art“, deutete Max. „Die kannst du nicht verknusen. Aber das haben doch viele Leute.“ Dabei richtete er ziemlich unverschämt einen Blick Richtung Ilona, die gerade über ihren heißen Tee blies und den Seitenblick nicht bemerkte.
„Ja, leider“, bestätigte Alina.
„Außerdem kann das doch eine Unsicherheit ausdrücken. Die wurde vielleicht wirklich oft nicht verstanden und will sicher gehen, dass du sie verstehst“, interpretierte Inge die belehrend erscheinende Art.
„Kann schon sein. Aber bei ihr klingt es unwillig, fordernd, dominativ. So im Sinne von Kapier das endlich!“
„Ja, so können Narzissten eben sein“, bemerkte Max trocken.
„Ich weiß. Ich müsste es als ein Teil einer behandelbaren Störung sehen. Und dürfte es nicht persönlich nehmen. Aber das meinte ich ja. Es ist etwas Persönliches, das auch mit mir zu tun hat.“
„Du solltest die Therapie sich noch etwas entwickeln lassen, vielleicht wird alles ganz anders!“, schlug Inge vor.
„Ich glaub nicht an den Weihnachtsmann!“, reagierte Alina etwas scharf.
Dieses Mal schlichtete Jonas: „Ja, das wäre ein gutes Datum: Bis nach den Weihnachtsferien lässt du ihr Zeit!“
„Dieses Jahr?“, fragte Alina zynisch.
„Sei nicht so pessimistisch!“
„Okay. In unserer ersten Intervision im neuen Jahr werde ich euch berichten!“
6
Lisa Grabstetter hatte schon wieder etwas mitgebracht.„Hier, sehen Sie, Frau Winner, wieder so ein Vers!“
Alina probierte es mit einer betont legeren Reaktion: „Frau Grabstetter, haben Sie etwa Ihrem Sohn schon wieder ein Gedicht geklaut?“
Die Patientin schaute böse. Und Alina musste sich schon wieder über sich ärgern:
Verdammt, das hätte ich doch nicht so sagen dürfen. Da fühlt sie sich sicher angegriffen. Vielleicht auch zu recht.
„Geklaut? Was reden Sie da? Der hat sicher nichts gemerkt. Ich bin da geschickt, wissen Sie. Und es ist doch nur zu seinem Besten, ja!“
„Nun, ich meine, es ist doch sehr persönlich, was er schreibt!“
Mal schauen, ob die Patientin mit dieser Rechtfertigung einverstanden ist.
„Aber wenn er doch nicht mit mir redet!“
Soll das Selbstmitleid sein? Dann müsste ich meine Empathie ausdrücken: Das macht Ihnen sehr zu schaffen. Oder ist es eher ein Vorwurf an den Sohn? Aber nein, locker oder scharf darf ich nicht schon wieder reagieren! Neutral bleiben!
„Also gut, zeigen Sie mal!“
holla
welch kühler seelenspanner
der da mit seinen weiten händen
am kalender rupft
wenn er am morschen fädchen zupft
weiß man wie spät es ist
holla
ich bin noch nie so froh gewesen
holla
was ist das für ein rufen
so schön in der silvesternacht
und ganz besonders hier
wo grausge erlen stehn und mir
ja mir das rufen gilt
holla
ich bin noch nie so froh gewesen
„Und, Frau Winner, was können Sie da herauslesen?“
Warum schaut sie dabei so triumphierend? Ich weiß. Es geht ihr nicht um die Hilfe für den Sohn! Sie will mir meine Grenzen aufzeigen! Ich soll es gar nicht verstehen! Vielleicht, weil sie es auch nicht versteht. Mir unterlegen sein, will sie auf keinen Fall.
„Langsam, Frau Grabstetter! Das muss ich öfters durchlesen. Darf ich es mir wieder kopieren?“
„Natürlich. Wenn Sie es erst studieren müssen.“
„Was lesen denn Sie heraus? Sie haben das Gedicht sicher schon öfters angeschaut.“
Da bin ich aber gespannt, ob sie sich ihre Frage von mir so einfach zurückwerfen lässt!
„Ja glauben Sie, ich könnte mir stundenlang so einen Blödsinn durchlesen? Wissen Sie, ich hab genügend anderes zu tun! Sie sind doch der Fachmann, ja!“
Schon wieder eine Spitze! Warum hat sie das nur nötig? In dieser Schärfe. Ich werde ablenken.
„Und Ihr Mann? Was sagt der dazu?“
„Mein Mann? Dem kann ich mit so etwas nicht kommen!“
„Wieso nicht?“
„Der hat doch keine Ahnung von so etwas!“
Jetzt rollt sie mit den Augen. Wie sehr sie ihn verachtet!
„Weiß er denn, dass Sie sich die Gedichte Ihres Sohnes anschauen?“
„Nein, natürlich nicht. Mein Mann würde den Kleinen sofort konfrontieren damit. Er ist nicht besonders diplomatisch, wissen Sie!“
Dieses höhnische Lachen! Der arme Mann! Der Mann kommt später dran, jetzt soll sie mir erst etwas zum Gedicht sagen.
„Also, probieren Sie es doch einmal! Welche Stimmung kommt denn bei Ihnen auf beim Lesen des Gedichts?“