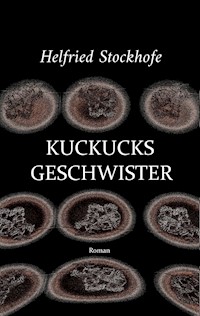Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Der sensitive und lebensverneinende Theo ist ein kontaktarmer Außenseiter. Er gerät unversehens in eine Beziehung zu einer jungen Frau im Koma. Ihre und seine Lebensgeschichte sind, wie sich herausstellt, miteinander verwoben. Sein bisher ruhiges Beziehungsleben wird auch durch weitere Kontakte am Krankenbett lebhafter und lässt ihn seine Suizidideen überdenken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 165
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
Helfried Stockhofe
Ich möchte dir mein Hören schenken
Text und Umschlaggestaltung: © 2023 Copyright Helfried Stockhofe
Verlag: Helfried Stockhofe, Untere Ringstr. 22, 93455 Traitsching
Druck: epubli, ein Service der Neopubli GmbH, Berlin
Die Handlung, handelnde Personen und die genannten Orte sind frei erfunden. Der auf dem Cover abgebildete Bauernhof steht in keinem Zusammenhang mit dem fiktiven Geschehen im Roman. Die Zitate im Text stammen aus der Abhandlung des Autors: „Modische Strömungen bei rationalen und irrationalen öffentlichen Meinungen“ (H. St. 2020).
Wenn Sinn-los sinnlos ist,macht Sinn-haft keinen Sinn.
Ein Fall
1Der Mensch, die Krone der Schöpfung, ist das nutzloseste Wesen auf der Welt. Er dient nicht einmal als Nahrung für andere und er trägt auch nicht zur Fortpflanzung anderer Arten bei, weil an seinem Körper nirgends maßgebliche Samenmengen hängen bleiben und seine stets vergifteten Ausscheidungen fast immer ungenutzt in der Kanalisation verschwinden. Ohne den Menschen wäre alles besser, denn er zerstört die Grundlagen allen Lebens, zum Glück auch des Überlebens seiner eigenen Art.
So unnütze Gedanken! An einem Mai-Tag, so schön, dass man nicht nach Madeira, Thailand oder in die Karibik reisen muss. Der hagere Mann auf der holzgrauen Bank am Rande des Radwegs spürte keinen Neid auf die vielen Flugreisenden, die vielleicht gerade auf ihn herabschauten. Die Maschinen zeichneten weiße Kondensstreifen in den blauen Himmel, kreuz und quer, langsam sich verbreiternd und wieder geschnitten durch die nächsten scharf und schnell vorüberziehenden. Es war ein Tag zum Sterben schön! Die sinkende Nachmittagssonne legte sich sanft auf sein Gesicht, er schloss die Augen und hörte, wie mit einem leichten Luftzug der Klang der weit entfernten Kirchenglocken seines Wohnorts „Zehnkirchen“ – Nomen est Omen - zu ihm hergetragen wurde. Dann kam ihm ein Geruch in die Nase, der ihn die Augen öffnen ließ: Die braun gescheckten Kühe, die idyllisch weit unten auf einer großen Wiese vor ihm grasten, konnten es nicht sein, der Geruch kam von der Seite. Er schaute sich um: Eine Joggerin lief auf dem Radweg hinter ihm vorbei. Es war ein Waschmittel, das der Mann roch, und ein Anstrengungsschweiß, aber nicht nur dieser, sondern auch ein Angstschweiß, der sich dahinter versteckte.
Die Joggerin hatte den Mann von weitem taxiert, vielleicht auf seine Gefährlichkeit hin oder auf seine Kommunikationsbereitschaft. Solange er sich nicht zu ihr hin drehte, fixierte sie ihn. Trapp, trapp, trapp, trapp. Als er kurz zu ihr hinsah, wandte sie den Blick ab, registrierte aber im Augenwinkel, ob sich der Mann bewegte oder gar sich anschickte, sie aufzuhalten. Ihre auffällige Nervosität ließ sie etwas straucheln, sie touchierte sein am Rand des Weges stehendes Fahrrad, das daraufhin umkippte. Sie richtete es wieder auf, entschuldigte sich, schien unschlüssig, was zu tun sei. Der Hagere schaute sie kurz an, lächelte, winkte ab: Sein Rad war sturzerprobt und hatte keine zusätzliche Schramme abbekommen. Sie lief schnell weiter, ohne sich noch einmal umzusehen. Er sah ihr nach, bemerkte einen modischen pinkfarbenen Rucksack auf ihrem Rücken, hörte noch ihre Atmung und die Regelmäßigkeit ihrer Schritte, die sich im selben Tempo entfernten, wie sie sich genähert hatten. Trapp, trapp, trapp, trapp, immer leiser. Doch der Geruch blieb noch länger bei ihm und begann ärgerlicherweise, ihn immer mehr zu irritieren.
Es war nicht das Waschmittel, das er schon hundert Mal gerochen hatte und das er inzwischen auch einer bekannten Marke zuordnen konnte, sondern die Duftnote hinter dem Schweiß der Anstrengung. Der Tag zum Sterben schön war verflogen, das Hirn begann zu arbeiten. Schnelle Erklärungen waren nicht seine Sache und gar nicht darüber nachzudenken, schon zwei Mal nicht. Nein, er musste schon immer prinzipiell über alles nachgrübeln, konnte es nicht beiseite legen. Verdammt, murmelte er, warum muss ich so sein! Über alles und jeden nachdenken und täglich überschwemmt werden von Eindrücken. Es geht mich doch nichts an! Es half auch nichts, sich mit den Fingern die Nase zu verschließen: Es war zu spät. Längst hatte der Geruch sein Gehirn erreicht, wo er in Milliarden Windungen hin und her kreiste, umgewandelt in Gedanken und Gefühle, die meistens keine lustigen Wendungen vollführten und seinen Tag mit Frohsinn bereicherten. Froh-Sinn, nein, dieser Ausdruck passte nun gar nicht mehr!
2Der Mann auf der Bank am Radweg oberhalb der großen Wiese hieß Theo. Er war 43 Jahre alt und seinen Namen, na ja, den hatte er von seinem Vater und Großvater, beide hießen Theo! Im Unterschied zu den beiden galt er jedoch als Zweifler, Grübler und Pedant, der sich über alles aufregte, und es war kein Wunder, dass er sich immer mehr in die Stille zurückzog, das Abseits suchte, statt die Gemeinschaft. Er selbst hatte Jahrzehnte gebraucht, bis ihn ein zufällig gelesener Zeitungsartikel auf die Sprünge half: Er hatte alle Anzeichen von Menschen, die sich als sogenannte Hochsensitive durchs Leben plagen! Die ungewöhnliche Sensibilität stimmte auch ihn keineswegs positiv, denn Verständnis oder Anerkennung dafür bekam er nicht. Allenfalls verstand er sich selbst jetzt besser und konnte so sein Selbstwertgefühl etwas stabilisieren. Die Übersensibilität seiner Sinne rückte ihn mehr in die Nähe der Tiere, was er zwiespältig registrierte. Machte ihn das wertvoller? Nützlicher? Es machte sein Leben auf jeden Fall schwerer. Schon lange schaute er nicht mehr in den Fernseher, ja, er hatte ihn sogar verkauft. Die reißerisch dargebrachten Ausstrahlungen mit Lichtershows, Gejohle, Gepfeife und Getrampel, manchmal sogar bei simpelsten Ratesendungen, aber auch die ständigen Krimis mit zunehmender Gewaltverherrlichung und die immer schlimmer werdenden Nachrichten hatten ihn überfordert. Mit Bedacht las er in der Zeitung, übersprang vieles, was ihn aufregte, und ihn regte Vieles auf! Doch beim Lesen hatte er alles selbst in der Hand, konnte auswählen und war vor größeren Überraschungen sicher. Aber:
Die Nachricht von einer schwer verletzten Joggerin konnte er nicht ignorieren!
Er stieß darauf, zwei Tage nachdem er diese Frau gesehen hatte. Eher gerochen als gesehen, auch gehört, doch alle Sinneseindrücke hatte er aus dem Gedächtnis verbannt, soweit es ihm möglich war. Das Bild von dieser Person war kaum mehr zu finden in den Gehirnwindungen, präsent war jedoch der Angstschweiß, eigentlich der geringste unter den Sinneseindrücken dieses schönen Tages und dieser kurzen Begegnung. Es geht mich nichts an, versuchte er sich gänzlich zu distanzieren, mit mir hat das nichts zu tun! Doch seine Aufmerksamkeit richtete sich wie von einem Magneten angezogen auf den Artikel. Eine junge Frau, verletzt in einem Gebüsch am Radweg, gefunden am Abend von einem Spaziergänger mit Hund, mit schwersten Kopfverletzungen, vielleicht Fremdeinwirkung.
Kurz kam er auf die Idee, sich als Zeuge zu melden, doch das verwarf er schnell wieder. Was hatte er denn schon bemerkt? Er war, als ihr Trapp-trapp nicht mehr zu hören war, in die andere Richtung den Radweg zurückgefahren, hatte wieder einmal Überlegungen angestellt, wie er sich an einem so schönen Tag suizidieren könne, aber so, dass ihn niemand fände und von seiner grauenhaften Leiche traumatisiert wäre. Dann hatte er gehofft, einfach tot umfallen zu können, mitten auf dem Weg, und bald gefunden zu werden vom Hund eines Spaziergängers, eines alten Mannes, der schon einige Tote gesehen hatte und der schwach oder gnädig genug war, ihn nicht zu reanimieren. Seine Existenz war ja so nutzlos! Daheim hatte er bemerkt, dass um das Fahrlicht seines Rads eine Kette baumelte, eine goldene Armkette mit der Gravur „Lena“. Wo kam die her? Es war nur eine Vermutung: Vielleicht war der Joggerin das Armband herabgeglitten und hatte sich im Fahrradlicht verfangen.
Die Joggerin lag im Krankenhaus, war nicht bei Bewusstsein. Sie hatte keine Papiere bei sich gehabt, niemand wusste, wer sie war. Die Polizei entschloss sich schließlich, mit Zeitungs- und Internetveröffentlichungen nach ihrer Identität zu suchen. Auch ihr Gesicht, dem eine kosmetisch versierte Krankenpflegehelferin ein angenehmes Äußeres zurückgegeben hatte, wurde gezeigt. Erfolgreich war der Fahndungsaufruf nicht. Die unbekannte weibliche Person, Mitte 20, 170 cm groß, knapp 50 Kilogramm schwer, schien niemand zu kennen. Die leichte Bekleidung der Joggerin wurde auch zur Schau gestellt, doch auch darauf keine Reaktion aus der an solchen Geschehnissen so interessierten Leserschaft. Die Verletzungsursache wurde immer noch nicht exakt genannt, man wollte das Täterwissen nicht verwässern, sofern es wirklich ein Verbrechen gewesen war.
3„Theo!“
Der Radfahrer erschrak. Er hatte nicht damit gerechnet, dass ihn aus der Gruppe der Herumstehenden einer ansprechen würde. Es war sein Nachbar, der mit anderen ebenfalls radelnd unterwegs war und einen Halt an der Stelle eingelegt hatte, wo vor einer Woche eine Joggerin verletzt im Gebüsch lag.
„Servus!“, grüßte Theo zurück, absichtlich locker, und sah sich genötigt, kurz stehen zu bleiben, obwohl er eigentlich ganz schnell dort vorbeifahren wollte.
„Auch unterwegs?“, fragte der Nachbar rhetorisch.
Theo nickte nur.
„Schau, an diesen Baum muss sie geprallt sein und dann ins Gebüsch gerollt.“
Der Nachbar ging selbstverständlich davon aus, dass selbst der zurückgezogene Theo von dem Unfall der Joggerin erfahren hatte.
„Sie ist wohl vom Weg abgekommen, mit dem Fuß umgeknickt und dann den kleinen Abhang hinuntergestürzt“, vollendete er seine Analyse des Geschehens und zeichnete Theo mit großzügigen Gesten den Sturz der Bedauernswerten nach.
Theo nickte. „Kann sein.“ Und ihm wurde übel.
Doch ein anderer, ein Jüngerer mit bekannter Trikotwerbung, widersprach: „Überfallen wurde sie! Glaubt ihr denn, dass eine junge Frau so einfach vom Weg abkommt und da hinunterfällt?“ Der Möchtegern-Rennfahrer schüttelte den Kopf.
„Sexualverbrechen!“, konstatierte ein Weiterer ganz nüchtern und malte sich das Verbrechen sicherlich gedanklich aus.
„Man weiß es nicht“, sagte Theo, der sich immer noch nicht losreißen konnte – trotz nun ständig zunehmender Magenschmerzen.
„Man sagt es uns nicht!“, meinte einer. „Das war wohl ein Flüchtlingsmädchen und man will nicht verbreiten, dass ein Deutscher sie vergewaltigt hat.“
„Aber, mein Lieber, doch eher wohl umgekehrt!“, erwiderte ein anderer. „Ein Asylant hat dieses deutsche Mädchen überfallen!“
„Oder warst du es, Theo?“, fragte schmunzelnd einer und alle schauten gespannt zu Theo. „Du sitzt doch immer dort weiter hinten auf der Bank.“
Alle lachten, denn alle verstanden es als Scherz. Theo winkte ab, lächelte verlegen, drohte ein wenig mit dem Finger, um ganz cool zu erscheinen.
Die Männergruppe tauschte grinsend und murmelnd vielsagende Blicke aus und Theo hatte das Gefühl, das Gerede gelte ihm. Bald jedoch hing ein jeder wieder neuen Theorien nach. Der Theo interessierte sie nicht mehr.
„Einen schönen Tag noch!“, rief Theo endlich, setzte sich aufs Rad und suchte das Weite. Es schmerzte ihn, an dieser Stelle stehengeblieben zu sein, Gedanken und Gefühle beunruhigten ihn. Mit großer Kraft trat er in die Pedale, nicht nur um wegzukommen, sondern auch um sich abzulenken. Bald brannten seine Oberschenkel. Gut so!
Er war ja selbst schuld. Warum musste er so kurz nach dem Geschehen wieder diesen Radweg nutzen. Hatte ihn sein Unterbewusstsein hergetrieben? Ein Schuldgefühl? Hätte er die Gesundheit der jungen Frau retten können, wenn er ihr damals in ihre Richtung nachgefahren wäre? War denn der Angstschweiß kein Indiz für das folgende Unglück? Er trat noch heftiger in die Pedale. Und für den Rückweg wählte er eine andere Strecke.
Ihm war bewusst, dass er nicht nur vor dem Geschehen um die Joggerin fliehen wollte, sondern auch vor der Gruppe der diskutierenden Männer aus Zehnkirchen, die zwar mindestens so gern wie er durch die Gegend radelten, denen gegenüber er sich aber dennoch fremd fühlte. Da half ihm auch eine 25-jährige Nachbarschaft nicht. Theo hatte nichts gegen die Männer, zumindest nichts gegen die meisten von ihnen, aber er fühlte sich immer so, als gehöre er nicht hierher, nicht hierher, nicht in dieses Land und nicht in diese Welt.
4Der Bauer, dem die riesige Wiese gehörte, auf der die braven Kühe weideten, war kein dummer Mann, ganz im Gegenteil. Viele Bauern sind nicht nur schlau, sondern auch gescheit. Auch vom Schulabschluss her hatte er etwas vorzuweisen. Er war auf einem Internat gewesen, wo er mit der Mittleren Reife, wie es damals hieß, abschloss. Er war also kein dummer, aber auch kein braver Mann. Er war zu reich, um brav zu sein, oder andersherum: Weil er nicht brav war, war er umso reicher. So dachte jedenfalls Theo über reiche Leute. Seinen Reichtum verdankte der Bauer jedenfalls nicht seinem Fleiß, aber auch nicht nur seinem Bösesein, und schon gar nicht seinen Kühen, sondern vor allem seinen Vorvätern, die ihm viel Land hinterlassen hatten, das alsbald zu Baugrund umgewandelt worden war und ihm das Geld einbrachte. Die große Wiese, auf die Theo von seiner Bank immer herabschaute, war der Rest seines Landes und die Kühe darauf waren mehr sein Hobby als sein Lebensunterhalt. Und während Theo hinabschaute, schaute der Bauer hinauf, manchmal mit einem Fernglas. Das machte ihm mehr Spaß als ein Mittlere-Reife-Angestellten-Job.
Der Bauer wurde „Schlehbauer“ gerufen, wie seine Vorväter, wohl deshalb, weil seine Vorfahren noch viel Wert darauf legten, ihre Wiesen mit Hecken einzugrenzen, vielleicht auch, weil sie aus den Schlehen gerne Schnaps herstellten. Der Schlehbauer unserer Zeit machte beides nicht mehr. Er trank aber gerne Schnaps, meist zum Bier dazu. Sein Hof war mit Nebengebäuden und neuen Häusern so stattlich, dass er in der großen Landgemeinde als einer der über zwanzig Ortsteile einen eigenen Namen bekam, „Schlehhof“ natürlich. Auch der Bauer war stattlich, also mit einem stattlichen Bauch geschmückt, und stattlich, auch was die Anzahl seiner Familienmitglieder anbetraf, von denen die Kinder schon erwachsen waren und in Häusern neben dem Elternhaus wohnten. Ihre Arbeit hatten sie aber allesamt woanders, denn keiner wollte den Hof übernehmen und schon gar nicht dem Vater Konkurrenz machen. Natürlich waren es die Frauen, die bei den Kindern daheim blieben. Der Schlehbauer und seine Schlehbäuerin wurden auch manchmal zur Beaufsichtigung der Enkel eingespannt. Man kann sagen, es war eine Vorzeige-Großfamilie und zwar eine äußerst klischeehafte.
Den beiden Alten, die so alt auch noch nicht waren, gehörte noch der Zuchtbetrieb. Sie kümmerten sich, durch manche ihrer erwachsenen Kinder oder großen Enkel gelegentlich unterstützt, selbst um das Land und um das Vieh, also um die Kühe mit ihrem Nachwuchs. Der Bauer hatte einen Stier, der noch auf altmodische Art für weitere Kälber sorgte, die immer wieder an den Schlachter verkauft wurden. Der Schlehbauer war ungeheuer stolz auf seinen Stier.
So idyllisch alles dalag, so laut wurde es manchmal in der Großfamilie. Wenn Theo auf der Bank oberhalb der Wiese saß, konnte er, undank seiner scharfen Sinne, oft das Geschrei hören. Es dauerte zum Glück nie lange, weil der Alte immer mit einem unfeinen Machtwort die Diskussionen beendete. Der Schlehbauer war es gewohnt, dass man ihm gehorchte, was ihn auch auswärts zu einem unbequemen Gesprächspartner machte. Keiner wollte sich gegen ihn stellen und ihn damit verärgern.
Natürlich war so ein reicher Machtmensch im örtlichen Gemeinderat und konnte so die Geschicke der Großgemeinde mitgestalten. In seiner Funktion als Vorsitzender seiner Partei lernte er auch Parteirepräsentanten außerhalb des Ortes, ja im gesamten Bezirk, kennen und er war auch dort für seine herrische Art bekannt. Noch mehr gefürchtet, aber stets nur bei den Betroffenen, war er für eine Eigenart, die ihm viel Einfluss und Vorteile sicherte. Mit dieser Taktik konfrontierte der Schlaue auch den Radfahrer Theo, den er immer wieder oben am Radweg vor seiner Wiese sitzen sah:
Der Schlehbauer kontaktierte Theo, weil er von dem unglücklichen Tod der Joggerin gehört hatte. Er rief ihn an und teilte ihm ohne Umschweife mit, dass er ihn an diesem Tag bei der Bank beobachtet habe und ihm einiges aufgefallen sei. Er blieb bei der schwammigen Formulierung und Theo war nicht in der Lage nachzufragen. Der Bauer machte deutlich, dass seine Beobachtungen von Bedeutung für den unglücklichen Fall der Joggerin seien, wobei er die Doppelbedeutung des Wortes „Fall“ betonte, dass er aber keine Gegenleistungen für sein Schweigen der Polizei gegenüber wolle. Damit beendete er das Telefonat.
Es reichte dem Bauern, wenn der andere wusste, dass er etwas gegen ihn in der Hand hatte, das er bei Gelegenheit auch einmal ausspielen könnte. So war er seinerzeit auch zu der Umwidmung seines Ackerlands zu großen Baugebieten gekommen, die Methode hatte sich also bewährt. Eine Hand wäscht die andere, besonders unter Politikern in Zehnkirchen, aber vermutlich überall. Die Partei des Schlehbauern dominierte nicht nur den Gemeinderat, sondern den Landkreis, den Bezirk, das ganze Bundesland. Wer weiß, ob er den seltsamen Theo nicht auch einmal zum Handwaschen gebrauchen könnte – auch wenn dieser kein Politiker war.
Der Bauer wusste allerdings nur wenig über Theo, der in der Gemeinde sehr zurückgezogen lebte. Irgendetwas stimmte mit dem nicht. Theo arbeite wohl für eine Internetfirma und deshalb könne er sich seine Zeit so einteilen, dass er auf der Bank die Sonne genieße, während andere schufteten. Der Bauer missgönnte dem Radfahrer seine Freiheiten, ungeachtet dessen, dass er sich selbst auch solche Freiheiten nahm, und ihm war natürlich nichts bekannt von der lebensverneinenden Art des Sonnenanbeters, der nur wenige Vergnügungen seinem Wunsch nach Sterben entgegensetzen konnte.
5Theo war durch das Telefonat wie vor den Kopf geschlagen. Er dachte an manche Begebenheit seiner Kindheit und Jugend, als er einiger Taten beschuldigt worden war, die er seiner Meinung nach nie begangen hatte. Und er hatte nicht vergessen, dass es dafür angebliche Beweise gab, die ihn so verunsicherten, dass er wirklich nicht mehr wusste, ob er etwas getan hatte, an das er sich anschließend nicht mehr erinnerte. Ein Mensch wie er, in den die banalsten Sinneseindrücke so heftig einströmen, könnte ja so anormal sein, dass er Dinge tut, die er anschließend wieder verdrängt, gerade weil sie so heftig gewesen waren.
Theo dachte zurück an seine Eltern, die alle Vorwürfe über ihn, die von außen kamen, für bare Münze hielten. Der Vater strafte Theo dafür, weil er sich niemals nachsagen lassen wollte, dass sich sein Sohn ungestraft danebenbenehmen darf. Manchmal gab ihm Vaters Kontrolle aller seiner Schritte auch ein Gefühl der Sicherheit: Der Vater hatte stets ein Auge auf ihn. Der Sohn ahnte nicht, dass es dem Vater nur um die Familienehre ging und nicht um das Wohlbefinden seines Kindes.
Die Eltern hielten Theo eigentlich für einen Schwindler und alles, was andere über ihn erzählten, war glaubwürdiger. Das lag auch daran, dass Theo andere eigenartige Dinge über sich behauptete. So etwas wie Hypersensitivität war damals unbekannt – und wenn es bekannt gewesen wäre, hätte der Vater seinem Jungen sicher beigebracht, sich gefälligst nicht anormal zu benehmen. Notfalls wären Schläge dafür hilfreich gewesen. Und der Junge hätte anschließend kleinlaut eingestanden, doch ganz normal zu sein.
Die beiden medizinischen „psychopathologischen Diagnosen“ eines kompetenten und wohlwollenden Hausarztes, die in ihrer Kombination fatal waren, nahmen sie auch nur mit skeptischen Blicken entgegen: Theo soll unter Somnambulismus und Narkolepsie leiden, also jemand sein, der am Tag plötzlich einschläft und schlafwandelnd Dinge tut, die ihm danach nicht mehr erinnerbar sind. So einen Unsinn, meinte der Vater, könne ja nur ein Dorfdoktor verzapfen. Was ihm der Junge wohl dafür gegeben habe?
So verrückt sei noch keiner in seiner Familie gewesen, ergänzte der Vater, allenfalls in der Familie seiner Frau. Doch wahrscheinlich sei wohl, dass ihm der missratene Sohn untergeschoben worden sei – und dafür gäbe es auch einen Beleg! Bei solchen Streitigkeiten mit seiner Frau schob der Vater stets den linken Ärmel seines Hemdes hoch und demonstrierte dort ein herzförmiges Muttermal. Das habe auch sein Vater gehabt, doch der Sohn habe das nicht!
Theos Schlafwandeln trat auch in der Nacht nur selten auf. Da er ohnehin immer eingeschlossen wurde, passierte ihm auch nichts. Er verstellte einige seiner Sachen und erkannte so am Morgen, dass er wieder einmal schlafend unterwegs gewesen sein musste. Auch sein plötzliches Einschlafen während des Tages war ein seltenes Ereignis. Seinem Großvater passierte das öfters, aber da schrieb man es dem Alter zu. Der Großvater aber rührte sich nicht vom Fleck, wenn er beim Sitzen im Sessel die Augen geschlossen hatte, der kleine Theo soll aber aufgestanden sein und etwas angestellt haben, etwa die herumliegende Pfeife seines Vaters aus dem Fenster geworfen oder seinen Tabak im Zimmer verstreut haben.