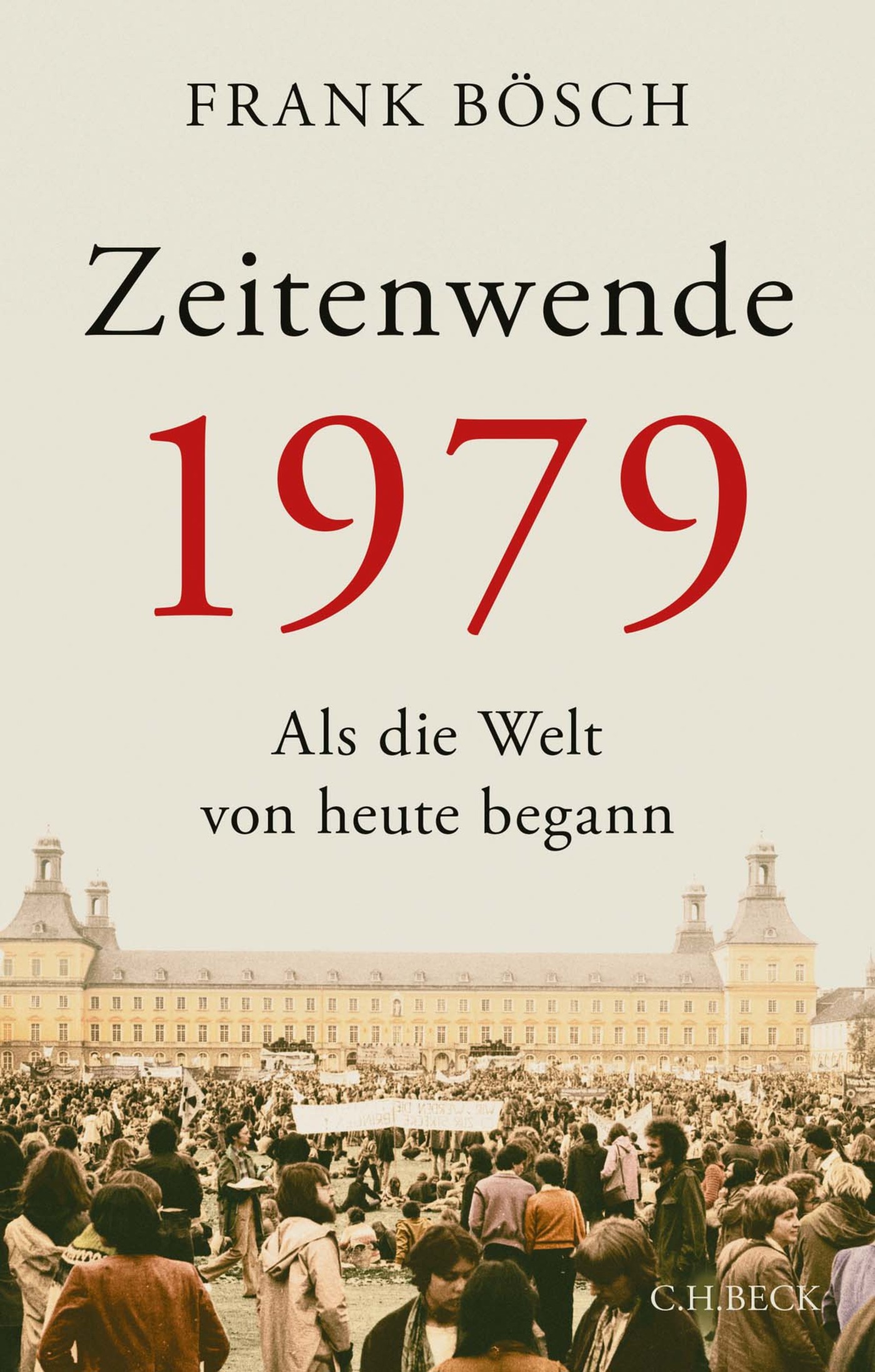24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Umgang mit Diktatoren hat die bundesdeutsche Demokratie von Anfang an herausgefordert. Frank Bösch zeigt auf der Grundlage umfassender Archivrecherchen, welche Interessen dabei aufeinandertrafen und was in den Hinterzimmern besprochen und angebahnt wurde. Mit den Regierungen wandelte sich der Austausch mit Autokratien in Südamerika, Ostasien oder im Ostblock. Durch gesellschaftlichen Protest gewannen Werte und Sanktionen allmählich an Bedeutung. Doch der wirtschaftsorientierte Pragmatismus blieb, wie Frank Bösch anschaulich zeigt, das vorherrschende Muster, das die Geschichte der Bundesrepublik zutiefst prägte. Dezember 1964: Der kongolesische Ministerpräsident Tschombé wird feierlich in Berlin empfangen. Demonstranten stürmen über die Absperrungen. Den «Mörder von Lumumba» trifft eine Tomate «voll in die Fresse», wie Rudi Dutschke mit Genugtuung notiert. Für Dutschke war dies der «Beginn unserer Kultur-Revolution». Nachdem in den fünfziger Jahren die «Kaiser» aus Iran und Äthiopien bejubelt worden waren, führten in den Sechzigern Proteste von oppositionellen Migranten, antikolonialen Gruppen oder auch von Amnesty International zu einer stärker wertebasierten Diplomatie mit Diktatoren: Handel ja, aber bitte auch Freilassung einzelner Oppositioneller. Frank Bösch zeigt in seinem glänzend geschriebenen Buch, wie sich in den Jahrzehnten nach dem Nationalsozialismus im Umgang mit Diktaturen wirtschaftliche, politische und zivilgesellschaftliche Interessen zu einem Schlingerkurs verschränkten, dessen Widersprüche und Folgen uns bis heute beschäftigen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Frank Bösch
Deals mit Diktaturen
Eine andere Geschichte der Bundesrepublik
C.H.Beck
Zum Buch
Dezember 1964: Der kongolesische Ministerpräsident Tschombé wird feierlich in Berlin empfangen. Demonstranten stürmen über die Absperrungen. Den «Mörder von Lumumba» trifft eine Tomate «voll in die Fresse», wie Rudi Dutschke mit Genugtuung notiert. Für Dutschke war dies der «Beginn unserer Kultur-Revolution». Nachdem in den fünfziger Jahren die «Kaiser» aus Iran und Äthiopien bejubelt worden waren, führten in den Sechzigern Proteste von oppositionellen Migranten, antikolonialen Gruppen oder auch von Amnesty International zu einer stärker wertebasierten Diplomatie mit Diktatoren: Handel ja, aber bitte auch Freilassung einzelner Oppositioneller. Frank Bösch zeigt in seinem glänzend geschriebenen Buch, wie sich in den Jahrzehnten nach dem Nationalsozialismus im Umgang mit Diktaturen wirtschaftliche, politische und zivilgesellschaftliche Interessen zu einem Schlingerkurs verschränkten, dessen Widersprüche und Folgen uns bis heute beschäftigen.
Über den Autor
Frank Bösch ist Professor für Europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts an der Universität Potsdam und Direktor des Leibniz-Zentrums für Zeithistorische Forschung (ZZF). Bei C.H.Beck erschien bereits der SPIEGEL-Bestseller Zeitenwende 1979. Als die Welt von heute begann (6. Aufl. 2019, C.H.Beck Paperback 2. Aufl. 2020).
Inhalt
Einleitung: Mit Diktaturen umgehen
Eine andere Geschichte der Bundesrepublik
Zugänge
1. Jubel, Handel und Zensur: Iran und autokratische Partner in der Ära Adenauer
Pompöse Staatsempfänge und Restriktionen
Autokraten als Reformer?
Expertenaustausch im Schatten des Nationalsozialismus
Hallstein-Doktrin, Handel und Korruption
«Lex Soraya»: Einfluss auf die Pressefreiheit
2. Eingeschränkte Nähe: Francos Spanien und Salazars Portugal
Schrittweise politische Annäherung in den 1950er Jahren
Militärische Kooperation und die Bewertung Spaniens
Militärkooperation mit Salazars Portugal
Gastarbeiter, Exilanten und die Förderung der spanischen Opposition
Die SPD und der Zusammenbruch der Diktatur
3. Abgrenzung und erste Kontakte: Die sozialistischen Diktaturen
Mit Nebenwirkungen: Die Delegitimierung der DDR
Pragmatischer Handel mit der DDR
Erste Begegnungen in der Sowjetunion
Adenauer in Moskau
Handelsförderung und Ausreisen
4. Nieder mit dem Schah: Migrantische Proteste und ihre Folgen in den 1960ern
Kongo und das Aufkommen des antiimperialistischen Protestes
Frühe iranische Proteste
Abschiebung und neues Ausländergesetz
Auftakt zum Schahbesuch 1967
Folgen der Proteste
Verklärte Diktatoren: Der Kult um Mao und Castro
5. Breiter Protest: Griechenlands Diktatur (1967–1974)
Migranten und Deutsche in Kritik vereint
Folter aufdecken: Amnesty International
Begrenzte Reaktionen der Bundespolitik
Sanktionen im internationalen Rahmen
Oppositioneller Migrantensender? Die Deutsche Welle
6. Entführungen und Sanktionen: Der Umgang mit Südkoreas Diktatur (1967–1987)
Antikommunistische Bande und die Verschleppung von Oppositionellen
Bundesweite Proteste und Sanktionsdrohungen
Gebremste Annäherung und erneuter Protest 1980
7. Die deutsche Sektion von Amnesty International
Die Etablierung von Amnesty Deutschland
Anschreiben gegen Diktaturen
Spenden für Verfolgte
Aktivismus, Konflikte und Grenzen des Einsatzes
Abgrenzende Kooperation mit dem Auswärtigen Amt
8. Solidarität und Flüchtlingshilfe für Chilenen unter Pinochet
Voraussetzungen für die Empörung über Pinochets Militärdiktatur
Bundesdeutscher Protest nach dem Putsch
Bürgerlich-konservative Zustimmung?
Sanktionen in den 1970er Jahren
Die Bundesregierung, Amnesty und die Aufnahme der ersten Flüchtlinge
Transnationale Flüchtlingshilfe
Föderale Blockaden
«Freikauf» und Austausch von Gefangenen
Die CDU/CSU und Chile in den 1980er Jahren
9. Grenzen der Menschenrechte: Lateinamerika und Afrika
Fortgesetzte Kooperation mit Argentinien und Brasilien
Einsatz für argentinische Opfer
Zwischen Zaire, Bonn und Bayern: Mobutu als Partner
Menschenrechte, Polizeiausbildung und Schulden
10. Öl und Terrorismus: Gaddafis Libyen
Reaktionen auf Gaddafis Herrschaft in den 1970er Jahren
«Den Tiger streicheln»: Umstrittene Staatsbesuche
Libyscher Staatsterrorismus in Deutschland
Deutsche Abwehr von US-Sanktionen
Deutsche Kaufleute und Experten in Libyen
«Auschwitz im Wüstensand»? Die Chemiefabrik in Rabta
Libysches Einlenken
11. Neue Annäherungen: Aporien der Ostpolitik
Gesellschaftliche Annäherungen in den 1960er Jahren
Neue Verflechtungen in den 1970er Jahren
Menschenrechte, Ausreisen und Meinungsfreiheit
Gesprächsbereit in den Krisen ab 1980
Die Grünen und die Annäherung an die Opposition und Gorbatschow
12. Partnerschaft und kritische Kooperation: China unter Deng
Politische Annäherung durch Christdemokraten
Enger Austausch nach Dengs Reformen
Hürden bei der Kooperation
Grenzfälle: Hightech, Waffen und AKW-Exporte
Tibet, die Grünen und das Aufkommen der Menschenrechtsdebatte
Tiananmen-Platz 1989: Reaktionen und Sanktionen
Umsetzung und Aufweichung der Sanktionen
Wege der politischen Annährung
«Business as usual» seit den 1990er Jahren?
13. Ausblick: Die Deutschen und die Diktaturen in einer globalisierten Welt
Neuer globaler Umgang mit Diktaturen
Zurückhaltung: Deutsche Militäreinsätze und Sanktionen
Migration und die Kooperation mit Diktaturen
Von der Ost- zur Frostpolitik
Umkämpfte Partner: Ein Fazit
Dank
Anhang
Abkürzungen
Anmerkungen
Einleitung: Mit Diktaturen umgehen
1. Jubel, Handel und Zensur: Iran und autokratische Partner in der Ära Adenauer
2. Eingeschränkte Nähe: Francos Spanien und Salazars Portugal
3. Abgrenzung und erste Kontakte: Die sozialistischen Diktaturen
4. Nieder mit dem Schah: Migrantische Proteste in den 1960ern
5. Breiter Protest: Griechenlands Diktatur (1967–1974)
6. Entführungen und Sanktionen: Der Umgang mit Südkoreas Diktatur (1967–1987)
7. Die deutsche Sektion von Amnesty International
8. Solidarität und Flüchtlingshilfe für Chilenen unter Pinochet
9. Grenzen der Menschenrechte: Lateinamerika und Afrika
10. Öl und Terrorismus: Gaddafis Libyen
11. Neue Annäherungen: Aporien der Ostpolitik
12. Partnerschaft und kritische Kooperation: China unter Deng
13. Ausblick: Die Deutschen und die Diktaturen in einer globalisierten Welt
Literatur
Verzeichnis der Archive
Bildnachweis
Personenregister
Einleitung:
Mit Diktaturen umgehen
Der Umgang mit undemokratischen Staaten ist eine schwierige Herausforderung. Das zeigte sich etwa 2022 bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar. Viele deutsche Fans kündigten einen Boykott der WM an, aber dennoch sahen rund siebzehn Millionen Deutsche die Spiele ihrer Elf im Fernsehen. Dass die deutsche Nationalmannschaft sich vor ihrem Auftaktspiel symbolisch den Mund zuhielt, verspotteten die einen als zu halbherzig, die anderen als Moralismus. Ähnlich kontrovers war die vorherige Katarreise von Wirtschaftsminister Robert Habeck, der dort um Gaslieferungen warb, um unabhängiger von Russland zu werden. Denn im Umgang mit Diktaturen treffen unterschiedliche politische, ökonomische und moralische Ziele aufeinander. Regierungen müssen ausloten, ob sie Diktaturen mit Handschlägen und Handel oder mit Sanktionen begegnen. Und im Alltag müssen wir entscheiden, ob wir Waren aus Diktaturen kaufen, Urlaube dort verbringen oder Verfolgten helfen.
Die engen Beziehungen zu Autokratien wie China, Russland oder Saudi-Arabien, die heute viel diskutiert werden, sind nicht erst durch die gegenwärtige Globalisierung oder die Männerkumpaneien von Politikern wie Gerhard Schröder entstanden. Schon seit Gründung der Bundesrepublik trugen viele Akteure dazu bei, eine langfristige Zusammenarbeit mit Diktaturen aufzubauen. Dieses Buch zeigt, wie Kooperationen mit Diktaturen seit der Ära Adenauer aufkamen und wie sie sich im Laufe der Zeit veränderten. Interne Akten der Bundesregierung verdeutlichen, wie viele Politiker, Diplomaten und Unternehmen die Zusammenarbeit mit Autokratien unterstützten, um «deutsche Interessen» zu fördern. Das stärkte zugleich den öffentlichen Protest gegen einige Autokratien, der den Umgang mit ihnen veränderte und neue Werte aufbrachte. Kooperation und Kritik hingen oft eng zusammen. Welche Staaten daraufhin sanktioniert wurden, änderte sich, und die Reaktionen blieben oft vielstimmig.
Eine andere Geschichte der Bundesrepublik
Der Blick auf den Umgang mit Diktaturen eröffnet eine andere Perspektive auf die Geschichte der bundesdeutschen Demokratie. Bislang wurde vor allem die erfolgreiche innere Demokratisierung der Bundesrepublik betrachtet, die anfangs mit der Westbindung und dann mit der Ostpolitik einherging.[1] Oft thematisiert wurde zudem der sich wandelnde Umgang mit der nationalsozialistischen Diktatur und der DDR. Weniger Beachtung fand, dass die bundesdeutsche Demokratisierung rasch mit einem intensiven politischen und ökonomischen Austausch mit zahlreichen Diktaturen in allen Weltteilen einherging. Das galt für die südeuropäischen Diktaturen in Spanien, Portugal und Griechenland ebenso wie für viele Militärdiktaturen in Südamerika.[2] Bereits bei der Fußball-WM in Argentinien 1978 musste sich die deutsche Nationalmannschaft zur dortigen Diktatur positionieren, die zehntausende Gegner töten ließ. Im Ringen um Einfluss umwarb die Bundesrepublik afrikanische Autokratien, und der wachsende Ölhandel verfestigte die Beziehungen mit den Regimen im Nahen und Mittleren Osten. Ihre «Petrodollars» machten viel kritisierte Diktaturen wie die in Libyen oder Iran zu attraktiven Geschäftspartnern. Mit der Ostpolitik der 1970er Jahre intensivierte sich der Austausch mit den staatssozialistischen Ländern. Kurz darauf umwarben die Deutschen die Volksrepublik China. Meist war die Bundesrepublik rasch einer der größten Handelspartner dieser Diktaturen und genoss bei ihnen politisch, ökonomisch und kulturell ein hohes Ansehen.[3]
Der deutsche Austausch mit Diktaturen nahm schon deshalb zu, weil sich fast überall in Afrika, Asien und Lateinamerika Autokratien verfestigten. In den 1970er Jahren galt nur noch rund ein Viertel aller Staaten weltweit als Demokratie.[4] Genau in dieser Zeit nahmen sowohl die globalen Verflechtungen als auch das Eintreten für Menschenrechte stark zu. Seit den 1960er Jahren kam es in der Bundesrepublik vermehrt zu Protesten gegen die Kooperation mit Diktaturen. Gewerkschaften, die Neuen Linken und Migranten aus den betroffenen Staaten wandten sich in Deutschland gegen «befreundete» Autokratien, ebenso Journalisten, neue NGOs wie Amnesty International sowie Oppositionsparteien wie später besonders die Grünen. Wie dieses Buch zeigt, führten die Proteste mitunter zur Einstellung von Staatsbesuchen, zur Aufnahme von Verfolgten, mitunter sogar zu Sanktionen, denn die immer engeren politischen und ökonomischen Verflechtungen erleichterten Interventionen.[5] Die Proteste trugen dazu bei, die in Deutschland gängigen Vorstellungen von Politik und Moral zu verändern und die Werte in der Außenpolitik zu verschieben. Wertebasiert war allerdings bereits die frühe Politik in der Ära Adenauer, die sozialistische Staaten sanktionierte und antikommunistische Autokratien tolerierte oder gar akzeptierte.
Wie Demokratien mit Diktaturen umgehen, ist kein spezifisch deutsches Thema. Auch andere Demokratien standen vor der Frage, welches Gewicht sie ökonomischen, strategischen und moralischen Zielen beimessen sollen. Diktaturen fordern viele Demokratien durch ihre nationalistische Machtpolitik heraus, die dazu führt, dass sie Absprachen und in der UN fixierte Rechte brechen. Ihre zentralistische Lenkung, Zensur und Korruption sind eine Herausforderung für den wirtschaftlichen und kulturellen Austausch. Sie greifen zudem direkt in Demokratien ein, indem sie Oppositionelle im Ausland bedrohen und damit Reaktionen erzwingen.
Obwohl alle Demokratien vor diesen Herausforderungen stehen, war der bundesdeutsche Umgang mit Diktaturen von Beginn an durch einige Besonderheiten geprägt. Eine erste ist die nationalsozialistische Vergangenheit. Viele Deutsche sahen sich seit den 1950er Jahren erneut mit Regimen konfrontiert, die Oppositionelle verfolgten und die Meinungsfreiheit unterdrückten. Die Erfahrung des Nationalsozialismus führte dabei zu unterschiedlichen Reaktionen auf Diktaturen: Sie konnte das antikommunistische Verständnis für autoritäre Ordnungen fördern, ebenso aber auch den Einsatz für Menschenrechte oder eine scheinbar unpolitische Neutralität. Noch 1977 argumentierte etwa das Auswärtige Amt: «Nicht zuletzt wegen unserer eigenen Geschichte sollten wir uns etwas zurückhalten, wenn es darum geht, Menschenrechtsverletzungen in anderen Staaten anzuprangern.»[6] Mit Verweis auf ihre Vergangenheit hielt sich die Bundesrepublik machtpolitisch und militärisch eher zurück. Stattdessen suchte sie vor allem ökonomisch und kulturell nach Anerkennung, Vertrauen und Einfluss. Die Bundesrepublik galt zwar selbst als ein Paradebeispiel dafür, dass aus einer Diktatur eine erfolgreiche Demokratie entstehen konnte, aber aufgrund ihrer Vergangenheit stand sie unter besonderer internationaler Beobachtung und war darum fortlaufend um ihr Ansehen im Ausland besorgt.[7] Engere Kooperationen mit geächteten Diktaturen waren für die Deutschen riskanter als für andere Länder. Angesichts der NS-Vergangenheit hatte etwa die deutsche Zusammenarbeit mit Franco-Spanien, Griechenlands Militärdiktatur oder mit israelfeindlichen Staaten wie Libyen einen besonderen Beigeschmack.
Zweitens sorgte die starke Exportorientierung der Bundesrepublik dafür, dass der deutsche Austausch mit nicht-demokratischen Staaten besonders intensiv war. Die Bundesrepublik liberalisierte gezielt ihren Außenhandel, und ihr Aufstieg zum «Exportweltmeister» ging mit vielfältigen engen Verbindungen zu Autokratien einher. Vom Umfang her war der bundesdeutsche Handel mit den westlichen Demokratien zwar größer, aber insgesamt profitierten die Deutschen von ihren weltweiten Geschäften. Vor allem für Diktaturen war diese Kooperation zentral, da die Bundesrepublik seit den 1960er Jahren zumeist zu ihren größten Handelspartnern zählte. Die Bundesregierung unterstützte dies mit ihrer Handelsförderung. Die Frage, wie sich diese Handelspolitik zu den Ansprüchen an Demokratie und Menschenrechte verhielt, stellte sich vor allem für Güter wie Waffen und Atomkraftwerke, deren Export in Diktaturen als besonders heikel galt.
Eine dritte prägende Besonderheit war die deutsche Teilung. Die bundesdeutsche Abgrenzung zur DDR prägte auch den Umgang mit anderen Diktaturen. Dass die Bonner Regierung bis Anfang der 1970er Jahre eine alleinige Anerkennung verlangte, erleichterte vielen Diktaturen eine privilegierte Partnerschaft mit der Bundesrepublik. Der «Global Cold War» wertete selbst wirtschaftsschwache Autokratien wie Zaire oder Äthiopien auf, die taktisch um Förderung warben und drohten, sonst mit der DDR zu kooperieren.[8] Beide deutsche Teilstaaten konkurrierten zunehmend im Süden um Ansehen und Kontakte, und auch die DDR betonte, für Menschenrechte einzutreten.[9]
Die Geschichte der Bundesrepublik wurde zumeist als eine erfolgreiche Demokratisierung im Rahmen der Westbindung dargestellt.[10] Das «westliche Lager» umfasste jedoch auch antikommunistische Diktaturen – in Europa etwa Portugal, Spanien und Griechenland, außerhalb Europas Staaten wie Iran, Südkorea, oder Brasilien. Durch die Blockbildung konnten sich solche Staaten dem «freien Westen» zuordnen.[11] Die damalige Einteilung der Welt in Ost und West, Nord und Süd sowie in kommunistisch oder antikommunistisch überdeckte vieles. Die Nord-Süd-Einteilung problematisierte die globale Verteilung von Macht und Reichtum, nicht aber Machtkonzenration und Unfreiheit in einzelnen Staaten. Eine Einteilung der Welt in demokratische und autokratische Staaten etablierte sich dagegen im Kalten Krieg kaum. Dieses Buch erweitert somit die oft thematisierte bundesdeutsche Westbindung und Ostpolitik um einen Blick nach Süden, wobei die Himmelseinteilungen als wirkungsmächtige Konstrukte der Zeit aufzufassen sind.[12] Im zeitgenössischen Sinne spreche auch ich mitunter von «Westen», «Osten» und «Süden».
Die deutsche Demokratiegeschichte wurde bislang vor allem im Kontext der Ost-West-Teilung betrachtet. Die Normen der Demokratie entwickelten sich jedoch auch durch den Umgang mit Diktaturen jenseits der DDR. Begegnungen mit Autokratien – bei Staatsbesuchen, zivilgesellschaftlichen Kontakten oder beim Handel – verlangten eine gewisse Positionierung und Anpassung. Wie dieses Buch zeigt, beeinflusste der Umgang mit Diktaturen die demokratischen Normen und Praktiken der Bundesrepublik. Die Kritik an Diktaturen förderte die innere Demokratisierung Westdeutschlands. Selbst Sanktionen gegen Diktaturen waren auch Signale nach innen und Teil der demokratischen Selbstverständigung.[13] Sie waren zudem Botschaften an das westliche Ausland, das das deutsche Verhalten genau beobachtete. So warnte 1967 ein Abteilungsleiter des Auswärtigen Amtes beim Umgang mit Griechenlands Diktatur, die «Haltung der Bundesregierung könnte als Gradmesser für demokratische Gesinnung gesehen werden».[14]
Der Blick auf den bundesdeutschen Umgang mit Diktaturen erweitert so die Sicht auf die Nachgeschichte des Nationalsozialismus. Viele Studien haben bereits die hohe Personalkontinuität nach 1949 herausgestellt, etwa in Ministerien, in der Justiz oder im Journalismus.[15] Am deutschen Umgang mit den weltweiten Diktaturen zeigt sich, welche Folgen das Erbe des Nationalsozialismus hatte. Sich an die heimische Demokratie anzupassen, gelang den meisten Eliten. Ihr Auftreten im autokratischen Ausland war hingegen eine Art Lackmustest, inwieweit diese Werte verinnerlicht worden waren. Wie handelten etwa altgediente Diplomaten, die nun in Teheran, Santiago de Chile oder Seoul erneut in Diktaturen agierten? Die jeweilige zeitgenössische Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen beeinflusste ihren Umgang mit Diktaturen und neuen Genoziden.[16]
Zugänge
Dieses Buch beschreibt den Wandel des bundesdeutschen Umgangs mit Diktaturen, aber nicht die Geschichte der Diktaturen selbst. Es blickt auf unterschiedliche Akteurinnen und Akteure, die autokratische Staaten unterstützten, bekämpften oder pragmatisch Kontakte pflegten. Im Vordergrund steht dabei das «dealing with dictatorships», also Handlungen im Umgang mit diesen Staaten. Der leicht pejorative Begriff «Deal» im Titel betont diese aktive Form der Kooperation, wobei sich das Buch nicht auf einzelne Absprachen und Verträge verengt, sondern Interaktionen im weiteren Sinne untersucht. Selbst Menschenrechtsorganisationen mussten mit Diktaturen interagieren, um Gefangenen dort zu helfen.
Im Zentrum stehen einerseits Politiker, Ministerialbeamte und Diplomaten, sei es bei Staatsbesuchen und vertraulichen Gesprächen, bei der Handelsförderung oder dem Einsatz für Menschenrechte. Andererseits blickt das Buch auf gesellschaftliche Gruppen, die sich mit Diktaturen auseinandergesetzt haben, wie Journalisten, Menschenrechtsaktivisten, Gewerkschaften, die Neue Linke oder Unternehmer. Auch Migrantinnen und Migranten werden dabei als Teil der deutschen Demokratiegeschichte berücksichtigt.[17] Der Blick auf das Zusammenspiel der unterschiedlichen Akteure verspricht Antworten auf die Frage, wann und wie sich der Umgang mit Diktaturen wandelte. Das Buch ist damit eine Geschichte internationaler Politik, die Interventionen aus der Zivilgesellschaft und Öffentlichkeit miteinbezieht.[18]
Eine Geschichte des bundesdeutschen Umganges mit den Diktaturen der Welt liegt bislang nicht vor. Dennoch knüpft dieses Buch an vielfältige Forschungen an. Das gilt zunächst für Studien über bilaterale außenpolitische Beziehungen zu nicht-demokratischen Staaten. Besonders gut untersucht sind, neben der deutschen Ostpolitik, etwa die Beziehungen zu Spanien in den 1950er Jahren, zu Indonesien, Argentinien und zum Iran in den 1970er Jahren.[19] Sie zeigten bereits das autoritäre Erbe des Nationalsozialismus und die exportgetriebene Suche nach Kooperation. Dieses Buch ergänzt diese Arbeiten um neue archivgestützte Schwerpunkte und bietet einen erweiterten politischen Zugang. Nur mit Seitenblicken thematisiert es dagegen den bereits gut untersuchten Protest gegen Staaten wie Südafrika und Nicaragua.[20] Ein wichtiger Bezugspunkt sind zudem Forschungen zur Geschichte der Menschenrechte. Sie fokussierten vor allem die 1970er Jahre als die Phase, in der Menschenrechte an Bedeutung gewannen.[21] Ob, wann und inwieweit Menschenrechte in der bundesdeutschen Außenpolitik eine Bedeutung entfalteten, ist bislang jedoch kaum systematisch erforscht.[22] Mein Buch fragt offen nach den Grenzen des Menschenrechtsdiskurses und blickt auch auf Akteure, die nur selektiv Verfolgten halfen.
Wie Menschen aus Demokratien mit einer Diktatur umgehen, wurde bisher vor allem für den Nationalsozialismus und die Sowjetunion untersucht. Zahlreiche Bücher beschreiben die ökonomische Zusammenarbeit mit dem «Dritten Reich» oder die Kooperation von Journalisten, um Nachrichten von der NS-Elite zu erhalten.[23] Vor allem um Chamberlains Appeasement-Politik 1938/39 kreist bis heute die Debatte, welche Form des Dialogs mit Diktaturen angemessen ist.[24] Es gibt zwar erste Studien von Politikwissenschaftlern zu gegenwärtigen Beziehungen zu Diktaturen, insbesondere zu Russland und China, aber auch hier sind vergleichende Studien zum bundesdeutschen Umgang mit Diktaturen rar.[25] Einige Forschung liegt dagegen zu den internationalen Sanktionen in der Gegenwart vor, die überwiegend als wirkungslos gelten.[26]
Umstritten war und ist, welche Staaten überhaupt als Diktatur gelten. Viele Länder ohne frei gewählte Regierung beschrieben sich selbst als Demokratien. Die DDR nannte sich bekanntlich «Deutsche Demokratische Republik» und Nordkorea offiziell «Demokratische Volksrepublik Korea». Auch Libyens Herrscher Muammar Gaddafi beanspruchte für sich, eine «wahre Demokratie» zu leiten, während er Länder wie die USA als «tyrannische Diktaturen» ansah.[27] Andere undemokratische Staaten, wie Saudi-Arabien, wurden und werden als Monarchien bezeichnet. Die Herrscher undemokratischer Staaten wurden im öffentlichen Sprachgebrauch selten «Diktator» genannt, sondern König, Schah, Staatsoberhaupt, Präsident oder Generalsekretär. Nur wenige Länder sprachen von sich selbst als einer Diktatur – wie etwa China von einer «Diktatur des Proletariats». «Diktatur» war somit meist eine gezielte Zuschreibung, die diskreditieren sollte.
Weil der Begriff «Diktatur» wertend ist, vermeidet ihn die heutige Sozialwissenschaft.[28] Historiker verwenden ihn für ausgewählte Regime des 20. Jahrhunderts, insbesondere für den Nationalsozialismus und einzelne militärisch regierte Autokratien («Pinochets Diktatur»), verschiedentlich für sozialistische Staaten («SED-Diktatur»), aber selten für Staaten des globalen Südens.[29] Stattdessen gebraucht die Forschung vermehrt den Oberbegriff «Autokratie» für Staaten ohne frei gewählte Regierung, mit schwacher Gewaltenteilung und stark eingeschränktem Pluralismus. Er umfasst unterschiedliche Regime wie Militärdiktaturen, absolute Monarchien oder Einparteiendiktaturen.[30] In diesem Buch werden die Begriffe «Diktatur» und «Autokratie» synonym für derartige Formen der nicht-gewählten Alleinherrschaft gebraucht, die sich auf Gewalt stützt und Opposition stark unterdrückt. Beide Begriffe benennen Herrschaftsformen klarer, die offizielle Bezeichnungen wie «Monarchie» oder «Volksrepublik» eher verdecken. Vom Begriff der Diktatur werden «autoritäre Demokratien» abgegrenzt, die als Zwischenform heute etwa in der Türkei oder Ungarn vorherrschen. In diesen Staaten gibt es trotz Repressionen zumindest noch eingeschränkt freie Wahlen und einzelne Oppositionsparteien, die trotz aller Hindernisse einen gewaltfreien Regierungswechsel erlangen können. Den Umgang mit derartigen autoritären Regimen behandelt dieses Buch nicht. Freilich gibt es fließende Übergänge, und auch die Zuordnungen zu diesen Herrschaftsformen wandeln sich.[31]
Das Buch behandelt mit vertiefter eigener Archivauswertung den deutschen Umgang mit knapp einem Dutzend Ländern und bezieht andere Staaten ergänzend auf Basis der Forschungsliteratur ein. Da es um Kooperationen geht, blickt es auf Diktaturen, die für die Bundesrepublik eine größere wirtschaftliche und politische Bedeutung hatten – wie Libyen, Iran, die Sowjetunion oder China. Dabei wurden Staaten aus unterschiedlichen Kontinenten und Kulturräumen gewählt, die zugleich unterschiedliche Typen von Diktaturen repräsentieren – etwa antikommunistische Militärdiktaturen (wie Südkorea, Griechenland und Chile), sozialistische Einparteiendiktaturen (wie China und die Sowjetunion) und personalistische Autokratien (wie Libyen, Iran und Zaire) – sowie unterschiedliche Kooperationsformen – etwa eher strategisch motivierte (wie bei Portugal, Griechenland), energiebasierte (Iran, Libyen, später Sowjetunion/Russland) oder exportbezogene (China, Brasilien).
Im Vordergrund steht immer eine markante, zeittypische Form des Umgangs. Für die Ära Adenauer wird die verständnisvolle Kooperation mit antikommunistischen Diktaturen verdeutlicht, ebenso die vorsichtige, aber blockierte Annäherung an die Sowjetunion. Für die 1960er Jahre rücken die Straßenproteste in den Vordergrund, die oft Migranten anstießen und dann deutsche Gruppen unterstützten. Beim bundesdeutschen Einsatz für Verfolgte in Diktaturen spielte Amnesty International eine Schlüsselrolle, weshalb diese NGO auch in einem eigenen Kapitel betrachtet wird. Die Annäherung an die sozialistischen Staaten im Osten Europas wurde als ein wichtiger Kontrast und Bezugspunkt berücksichtigt, gerade um den bisherigen Blick auf die Ostpolitik zu erweitern. Viele Kapitel verdeutlichen, wie begrenzt die jeweiligen Regierungen für Menschenrechte eintraten, wenn öffentlicher Protest ausblieb.
Bei der Quellenrecherche erwiesen sich die Bestände des Archivs des Auswärtigen Amts in Berlin als sehr ergiebig, um Kontakte zu Diktaturen, Entscheidungen und Wahrnehmungen zu analysieren. So vermitteln die regelmäßigen Berichte aus den bundesdeutschen Botschaften in den Diktaturen einen guten Eindruck von den alltäglichen Begegnungen im Ausland, sei es von Politikern, Unternehmen, Geheimdiensten, Kulturschaffenden oder Oppositionellen. Im Bundesarchiv Koblenz wurden insbesondere die Regierungsakten aus dem Kanzleramt sowie dem Innen- und Wirtschaftsministerium ausgewertet, um Denken und Handeln der Bürokratien nachzuvollziehen. Das BND-Archiv gab nach langem Drängen einige Akten zu relevanten Aktivitäten frei. Unterlagen in Archiven der parteinahen Stiftungen erlaubten eine Annäherung an wichtige politische Akteure jenseits der Kanzler und Minister, wie etwa die Nachlässe von Petra Kelly (Grüne), Franz Josef Strauß (CSU) oder Hans Matthöfer (SPD).
Um die Aktivitäten von Menschenrechtsgruppen zu beschreiben, war der erstmals mögliche Zugang zum Archiv von Amnesty International Deutschland besonders wichtig. Zu Solidaritätsgruppen und Migranten wurden Archive von politischen Bewegungen herangezogen, neben dem Archiv Grünes Gedächtnis etwa das Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika Berlin (FDCL). Um öffentliche kontroverse Debatten zu erschließen, wurden die Protokolle des Bundestags und diverse Medien analysiert. Unterlagen zur Deutschen Welle, die besonders im Umgang mit Griechenlands Diktatur eine zentrale Rolle spielte, fanden sich im Bundesarchiv Koblenz. Als etwas weniger ergiebig erwies sich die Recherche in Unternehmensarchiven wie von Siemens und VW, da die Unternehmen kaum über den Charakter der Diktaturen reflektierten, was letztlich auch ein Befund ist. Ergänzend wurden einzelne Gespräche mit Zeitzeugen aus der «zweiten Reihe» geführt, etwa mit Personen aus dem Kanzleramt, dem BND, aus der Frühphase der Grünen oder mitreisenden Experten und Geschäftsleuten.
Es ist ein Privileg der historischen Forschung, aus bislang geheimen Unterlagen zu schöpfen und so neue Sichtweisen zu eröffnen. Angesichts der Sperrfrist von dreißig Jahren war dies bis 1992 möglich, weshalb nur ein Ausblick bis zur Gegenwart auf Basis öffentlicher Quellen und Literatur das Buch abrundet. Trotz der reichen Quellenfunde wäre eine Auswertung der Archive in den behandelten Diktaturen hilfreich gewesen. Bei einem globalen Fokus auf über ein Dutzend Staaten wäre das allerdings nicht nur sprachlich schwierig. Vor allem aber sind zeithistorische Archive in Diktaturen wie China, Iran, Russland, Libyen oder der Demokratischen Republik Kongo für die Wissenschaft nicht zugänglich. Für Teheran war es mir durch einen Kooperationspartner möglich, einige Archivquellen zu Deutschland zu erhalten und zu übersetzen. In anderen, nunmehr demokratischen Staaten wie Südkorea herrschen weiterhin sehr eingeschränkte Archivzugänge. Dieses Buch ist deshalb bewusst eine Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, die aber globale Kontexte miteinbezieht.
1. Jubel, Handel und Zensur:
Iran und autokratische Partner in der Ära Adenauer
Die ersten Staatsoberhäupter, die die Bundesrepublik besuchten, stammten nicht aus den westlichen Demokratien. Der erste US-Präsident reiste 1959 – noch gegen das Votum seiner Berater[1] – für einen knappen Tag nach Bonn und der französische Präsident Charles de Gaulle erst drei Jahre später. Das niederländische Königspaar betrat sogar erst 1971 deutschen Boden, die Staatsoberhäupter von Norwegen und Schweden in den Jahren danach. Offensichtlich hatten Krieg, NS-Diktatur und Besatzung zu tiefe Wunden hinterlassen, um Deutschland in den 1950er Jahren zu besuchen. Obgleich die Bundesrepublik rasch zum Partner der westlichen Staatenwelt wurde, erschienen wohl auch Medienbilder von Empfängen mit deutschen Soldaten wenig opportun.
Die ersten Staatschefs, die Adenauers Regierung mit großem Pomp für lange Aufenthalte empfing, waren vielmehr Autokraten und autoritäre Herrscher aus südlichen Ländern. So gehörten 1954 der äthiopische Kaiser Haile Selassie und der türkische Ministerpräsident Adnan Menderes zu den ersten Staatsgästen, dann ein Jahr später der Schah von Persien, Mohammad Reza Pahlavi, gefolgt vom indonesischen Präsidenten Achmed Sukarno. Sie zählten meist zwar zum «westlichen» antikommunistischen Lager, bauten aber in ihren Heimatländern einen zunehmend autoritären Herrschaftsstil aus. Gleiches galt für die danach folgenden Staatsgäste aus Togo, Pakistan und Afghanistan, Senegal und Sudan. Politisch und wirtschaftlich waren dies aus heutiger Sicht keine hochrangigen Kontakte. Ihre Besuche trugen damals jedoch dazu bei, der Bundesrepublik internationale Anerkennung zu verschaffen. Die südlichen Staaten traten weniger als Bittsteller auf, sondern die Deutschen buhlten anfangs um die Besuche, um politische und ökonomische Kontakte zu fördern. Aufgrund der vorerst verlorenen Absatzmärkte im sozialistischen Osten sahen viele neue Chancen im Nahen Osten, Lateinamerika und Afrika.[2] Diese Staaten als Verbündete zu gewinnen, hatte im Kalten Krieg auch eine große politische Bedeutung. Der enge Kontakt mit den Autokratien im Süden sollte, im Sinne der Hallstein-Doktrin, die alleinige diplomatische Anerkennung der Bundesrepublik absichern und internationale Kontakte der DDR verhindern. Darum eröffnete die Bundesregierung auch in Afrika rasch flächendeckend Botschaften, um so zugleich Fürsprecher in der UN zu gewinnen.[3]
Wie sich die Deutschen auf derartige Staaten einließen, zeichnete sich schon beim ersten großen Besuch eines Staatsoberhauptes ab, bei Haile Selassie aus Äthiopien. Noch deutlicher werden die Tücken dieser Beziehung zu autoritären antikommunistischen Regimen im Umgang mit Iran. Gerade am Beispiel Irans lässt sich verdeutlichen, wie die bundesdeutsche Politik, Wirtschaft und Gesellschaft im Schatten des Nationalsozialismus mit Autokratien kooperierten und welche Rückwirkungen dies auf die junge Demokratie hatte.
Pompöse Staatsempfänge und Restriktionen
Am 8. November 1954 reiste Haile Selassie, der «Kaiser von Äthiopien», für eine Woche in die Bundesrepublik. Der Empfang war denkbar pompös. Als Selassie mit goldbestickter Gala-Uniform voller Orden, mit Säbel und einem mit Löwenhaaren verzierten Zweispitz auf dem Kopf aus dem Sonderzug trat, begrüßten ihn Kanzler Konrad Adenauer und Bundespräsiden Theodor Heuss, fast alle Bundesminister und viele Staatssekretäre sowie rund 50.000 jubelnde Bürger. In Bonn und anderen Orten erhielten die Kinder schulfrei, um an mit Blumen geschmückten Straßen winkend Spalier zu stehen, von 1500 Polizisten gesichert. An der Rheinbrücke hatte die Stadt Bonn neben den Zuschauern sogar Elefanten und Kamele eines gastierenden Zirkus aufgestellt.[4] Das dichte Besuchsprogramm mit zahllosen hochkarätigen Empfängen reichte vom Hamburger Hafen über niedersächsische Hospitäler, eine Landwirtschaftsschule in Westfalen, die Schwerindustrie im Ruhrgebiet, den Kölner Domschatz bis hin zur Medizintechnik bei Siemens, wobei viele weitere Unternehmen um einen Besuch geworben hatten.[5]
Mit dem aufwendigen Staatsakt suchte die junge Bundesrepublik noch etwas unbeholfen eine Selbstdarstellung, die weltpolitische Anerkennung versprach. Zugleich war die pompöse Aufwartung ein Signal für die heimische Öffentlichkeit, indem sie den erreichten Wohlstand, Modernität und regionale Traditionen zur Schau stellte.[6] Die großen Empfänge lieferten, wie ein Beobachter schrieb, nach den Trümmerjahren die Gewissheit, «daß die ‹Gesellschaft› davongekommen und mit heiler Haut gerettet ist».[7] So versammelten sich allein beim Bankett für Haile Selassie rund 600 hohe Würdenträger aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Eine «Haltung der Zurückhaltung», die der Historiker Johannes Paulmann treffend für die außenpolitische Repräsentation ausmachte, fand sich hier noch nicht.[8] Der laute Applaus für den Staatsgast war zugleich ein Applaus für den eigenen Neuanfang. Wie Reporter ermittelten, war vielen Zaungästen ohnehin nicht klar, wer genau der Gast aus dem Orient war. Bei den glamourösen Staatsakten stand vielmehr das Ereignis selbst im Vordergrund, das wie eine exotische Alternative zum schmucklos-kargen Parlamentarismus erschien. Es sollte zur internationalen Reputation der Bundesrepublik und zur nationalen Selbstfindung im geteilten Deutschland beitragen.
Dass Haile Selassie kein demokratisch gewähltes Staatsoberhaupt war, bemerkten einzelne Stimmen. Zumindest die liberale Öffentlichkeit sah ihn als ein Relikt einer fernen Zeit, die nun wiederbelebt würde. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel monierte unter der Überschrift «Der letzte Selbstherrscher», dass Selassies Auftreten an Kaiser Wilhelm II. erinnere, da er ohne Parlament regiere und die «Zentralgewalt des Kaiserhauses» gestärkt habe.[9] Ebenso titelte der Stern zweideutig: «Wunderschön! Der letzte absolute Herrscher der Welt […] besuchte als erster Souverän die Bundesrepublik.»[10] Die FAZ sprach wohlwollender von seiner «patriarchalischen Behutsamkeit», die ein Vorbild sei, «wie in dem explosiven Afrika der unaufhaltsame Modernisierungs- und Demokratisierungsprozess gesteuert und gebremst werden kann».[11] Hier klang die damals gängige Sichtweise an, die wenig entwickelten südlichen Staaten seien noch nicht reif für die Demokratie und bedürften vorerst eines starken Führers.
Die Reden der deutschen Politiker priesen statt der Demokratie daher den gemeinsamen christlichen Glauben. Heuss und Adenauer integrierten Äthiopien quasi in das christliche Abendland, indem sie es als «ältesten, sichersten und treuester Vorposten christlichen Glaubens» charakterisierten und Selassies «göttlichen Auftrag» betonten.[12] Grundlage dieser Bande war, dass Äthiopien als ein antikommunistischer, von den USA gestützter Außenposten galt, wo nun US-Militärbasen im Gegenzug für Wirtschaftshilfen entstanden.[13] Für mehr Demokratie dort traten weniger die westlichen Staaten als einige Äthiopier ein, die Mitte der 1950er Jahre nach dem Studium im «Westen» in ihr Heimatland zurückkehrten.[14]
Der nächste Besuch eines Staatsoberhauptes in der Bundesrepublik, der des «persischen Kaisers» Schah Mohammad Reza Pahlavi, ähnelte dem vorangegangenen. Erneut wurde 1955 ein Staatsmann, der im eigenen Land seine autoritäre Herrschaft ausbaute, von einer denkbar großen Delegation am Bahnhof empfangen. Heuss, Adenauer und zwölf Bundesminister, Bundesrats- und Bundestagspräsident und sogar der Chef der Bundesbahn begrüßten das Kaiserpaar am Bahngleis.[15] Die Zahl der Festakte, Ehrengäste und Programmpunkte bei dem zehntägigen Staatsbesuch übertraf sogar Selassies Empfang. Bei den einzelnen Stationen füllten noch mehr Menschen die Straßen, jubelten zu Zehntausenden und verlangten, dass sich das Kaiserpaar vom Hotelzimmer aus zeige.[16] Fotos und Geschichten vom Schah und seiner zweiten Frau Soraya Esfandiary Bakhtiary hatten schon vorher die Illustrierten mit einem märchenhaften Glanz gefüllt. Soraya, Tochter eines persischen Adligen und einer deutschen Verkäuferin, wurde als die «Deutsche auf dem Pfauenthron» in den 1950er Jahren zur Ersatzkaiserin der Deutschen, zu einer neuen Sissi oder Königin Luise, deren jugendliche Schönheit, Aufopferung und Tragik die Gazetten füllten. Soraya bildete damit einen glamourösen Kontrast zu jenen – wie man heute sagen würde – alten weißen Männern, die die Demokratie aufbauten.
Die Bevölkerung in München jubelt 1955 dem Schah von Iran zu.
Diese Staatsakte waren für selbstdarstellerische Monarchen konzipiert, die große Auftritte aus der Heimat gewohnt waren. Die Kosten dafür liefen beide Male mit der damals gewaltigen Summe von 186.000 und 170.000 DM völlig aus dem Ruder.[17] Bundespräsident Heuss erreichten auch aus der FDP Klagen, derartige Empfänge passten nicht zur Lebenssituation der Bundesrepublik und würden an das Wilhelminische Kaiserreich und den Nationalsozialismus erinnern.[18] Heuss selbst, der ebenfalls kritisch vom «teils wilhelminischen, teils adolfinischen Stil» der Empfänge sprach, erklärte Adenauer gegenüber den immensen Aufwand für Staatsbesuche «insbesondere aus den überseeischen Gebieten» mit einem «Wettstreit der europäischen Länder».[19] Sie alle buhlten im Kalten Krieg um die Gunst der südlichen Staaten, da die Europäer in der zunehmend postkolonialen Konstellation des Kalten Krieges um neuen Einfluss rangen. Heuss setzte dagegen, seinem persönlichen Stil entsprechend, auf ein Pathos der Nüchternheit.[20] Weil die Empfänge in den südlichen Autokratien oft noch pompöser waren, wollte Bonn in der Ehrerbietung mithalten.
Dass die beiden «Kaiser» bereits Mitte der 1950er Jahre die Bundesrepublik besuchten, war nicht selbstverständlich. Die Bundesregierung buhlte vielmehr in beiden Fällen um einen kurzen Besuch im Rahmen der bereits geplanten USA- und Europa-Reise. Die Regierungen in London, Paris und Den Haag rieten Selassie von einem Besuch in Bundesrepublik sogar explizit ab, und auch der Schah schwankte.[21] Neben politischer Anerkennung erhoffte sich das Auswärtige Amt vor allem «erhebliche Vorteile für die deutsche Wirtschaft» angesichts der «scharfen Konkurrenz» in Äthiopien und Iran.[22]
Das symbolische Gefälle, das selbst zu Äthiopien bestand, zeigte sich bereits bei Haile Selassies erstem Besuch in der frisch eröffneten bundesdeutschen Gesandtschaft in Addis Abeba. Der bundesdeutsche Gesandte musste mangels besserer Ausstattung das zerschlissene Mobiliar mit Seidenvorhängen bedecken, die er dafür vorher zerschnitt. Dabei konnte er den Kaiser nur zum Frühstück begrüßen, da für eine Abendeinladung noch angemessene Leuchten fehlten.[23] Kulturell fühlten sich die Deutschen überlegen, der materielle und außenpolitische Neuanfang machte sie jedoch anfangs oft zu Bittstellern.
Bereits beim Schahbesuch zeigte sich, dass der Besuch von Autokraten demokratische Grundrechte belasten konnte. Das galt zunächst für den Bereich der inneren Sicherheit. Der Schah machte die Entscheidung über seine Anreise gegenüber dem bundesdeutschen Botschafter davon abhängig, ob die Bundesregierung in der Lage sei, «kommunistisch beeinflusste iranische Studenten in der Bundesrepublik […] in Schach zu halten».[24] Die Bundesregierung sicherte, um den Besucher zu gewinnen, sogleich die Ausschaltung möglicher Demonstranten zu. Irans Presseattaché übergab dafür dem Auswärtigen Amt eine Liste von 22 Iranern, die zu überwachen seien, und regte an, die drei aktivsten Oppositionellen nach der weiterhin gültigen Ausländerpolizeiverordnung von 1938 vorher nach Iran auszuweisen, weil Iran ihre Pässe nicht erneuert habe. Iran sollte die Kosten für die Flüge übernehmen.[25] Im Bundesinnenministerium (BMI) griffen die zuständigen Beamten, Abteilungsleiter Walter Bargatzky und der Referent für Aufenthalts- und Ausländerrecht, Kurt Breull, dies eifrig auf. Da zuvor Studenten vor der iranischen Gesandtschaft in Köln demonstriert hätten, sollten nun Sicherheitsmaßnahmen solche Störungen verhindern. Breull teilte mit: «Grundsätzlich bestehen gegen die Ausweisung keine Bedenken», aber sein Referat «legt Wert darauf, daß die Ausweisungen so zeitig erfolgen, daß sie nicht in unmittelbaren Zusammenhang mit dem bevorstehenden Besuch des Schahs gebracht werden».[26] Das Innenministerium überprüfte daraufhin mit dem BKA, dem Bundesamt für Verfassungsschutz, dessen Landesämtern sowie den «infrage kommenden alliierten Dienststellen» die Aufenthaltsorte der Personen und bereitete die Ausweisung nach Iran vor. Dass dort vermutlich eine Kerkerhaft, eventuell auch Folter drohte, thematisierte die geheim gehaltene Planung nicht.[27]
Diese Kooperation mit der iranischen Autokratie gelang wohl auch durch die politische Prägung und Vergangenheit der Beamten so geräuschlos. So war der für die Abschiebung und Überwachung zuständige Ausländerreferent Kurt Breull bereits 1930 in die NSDAP eingetreten, und hatte als Göttinger Student an politischen Kämpfen teilgenommen. Der zuständige Abteilungsleiter Walter Bargatzky war SA- und Parteimitglied gewesen und hatte als Jurist beim deutschen Militärbefehlshaber in Frankreich antisemitische Verfolgungsmaßnahmen kriegsrechtlich legitimiert.[28] Nun standen sie zwar auf der Seite Demokratie, setzten aber ähnlich wie beim Schahbesuch auch in anderen Fragen auf restriktive autoritäre Maßnahmen. Bargatzy favorisierte sogar eine Monarchie für Deutschland, und der Ausländerreferent Breull sprach sich etwa gegen die Aufnahme jüdischer Rückkehrer aus Israel aus, ebenso für die Abschiebung von vormals verfolgten und nunmehr staatenlosen Sinti und Roma.[29] Gleichzeitig arbeitete das Ministerium an einer Notstandsgesetzgebung, die eine merkliche Aushebelung der Grundrechte und parlamentarischen Demokratie bedeutet hätte, insbesondere für Ausländer.[30] Dementsprechend sahen sie die vom persischen Autokraten geforderten Einschränkungen der Meinungs- und Versammlungsfreiheit nicht als eine Gefährdung der Demokratie an, sondern als notwendigen Schutz des bundesdeutschen und iranischen Staates vor Kommunisten.
Die beteiligten Beamten setzten bereits 1955 auf verschärfte Sicherheitsmaßnahmen beim Schahbesuch. Der zuständige Kriminalrat riet, «über die bevorstehende Reiseroute des Schahs zunächst Fehlmeldungen herauszugeben» und «auch bei Mitteilungen an die Presse mit der gebotenen Vorsicht zu verfahren», um Proteste zu verhindern. Tatsächlich erhielt die FAZ eine gezielte Falschmeldung.[31] Dies und das enorme Polizeiaufgebot entsprang eher einem Sicherheitsverständnis aus der Zeit vor 1945, da es keine Hinweise auf mögliche Attentate gab. Zudem bestand bei einer Besprechung der Ministerien einhellig die Meinung, «dass das Presseamt noch mehr als beim Kaiser von Äthiopien die Presse überwachen müsse».[32] Schon vor 1955 hatte die Bundesregierung bei zahlreichen Gelegenheiten in die Pressefreiheit eingegriffen, wenn der Schah sich von Medienkritik beleidigt gefühlt und deshalb mit dem Abbruch der Beziehungen gedroht hatte.[33]
Bereits die Staatsempfänge bescherten somit komplexe Deals mit Diktaturen: Die Deutschen passten sich bereitwillig an die autoritären Erwartungen der Gäste an und schränkten demokratische Grundrechte ein, um durch pompöse, aber kritikfreie Staatsbesuche der Welt zu zeigen, dass die Bundesrepublik wieder ein souveräner, geordneter Staat war.
Autokraten als Reformer?
Der Schah und seine Frau Soraya zählten in der Ära Adenauer zu den bekanntesten und beliebtesten Persönlichkeiten. Als die Meinungsforscher 1961 nach der prominentesten Frau der Welt fragten, kam die zweite Schahgattin Soraya auf Platz 1 und ihre Nachfolgerin Farah Diba auf Platz 3. Bei den Männern rangierte der Schah immerhin auf Platz 5.[34] Wie erklärt sich diese Faszination? Die glamourösen Illustriertenfotos und der pompöse Staatsbesuch ließen jenen monarchischen Glanz erstrahlen, den viele in der Demokratie vermissten. Soraya und ihr Mann verkörperten Macht und Weltläufigkeit, symbolisiert durch ihre extravagante Kleidung und luxuriösen Reisen. Einer der wenigen Staatsbesuche, die Bundeskanzler Adenauer außerhalb der Nato-Staaten machte, führte ihn deshalb nach Iran. Nicht zufällig geschah dies im Wahlkampf 1957, da dies exzellente Werbebilder versprach.
Mohammad Reza Pahlavi galt in der Ära Adenauer eben nicht als ein Diktator. Die offizielle Anrede, mit der er auch 1955 in Deutschland begrüßt wurde, war wie bei Haile Selassie «Ihre Kaiserliche Majestät» und «Seine Kaiserliche Hoheit».[35] Der Kaisertitel verschleierte und romantisierte seine Alleinherrschaft und weckte positive Assoziationen zum deutschen Kaiserreich. In den vorbereitenden Unterlagen des Auswärtigen Amts klang intern vor dem Staatsbesuch an, dass es in Iran keine Demokratie im westlichen Sinne gebe und Parteien nicht zugelassen seien.[36] Öffentlich dominierte nicht nur in der Politik ein anderes, werbendes Bild. «Ein moderner Kaiser» titelte etwa die FAZ zum Staatsbesuch 1955: «In Europa erzogen, regiert liberal und verfassungsmäßig […], ein moderner Monarch mit sozialen Neigungen, der seine Landgüter unter den Bauern aufteilt.»[37] Dass er ein Schweizer Internat besucht hatte und eine Frau mit deutschen Wurzeln wählte, ließ ihn als westlich geprägten Reformer erscheinen. Auch die vielgelesenen Illustrierten malten das Bild eines liberalen westlichen Monarchen, der gegen orientalische Korruption und Intrigen, gegen Müßiggang, Rückständigkeit und eine träge Bürokratie kämpfe. So schrieb eine Illustrierte 1956: «Der Schah wie Soraya sind abendländisch erzogen worden. Von Kindesbeinen an hat man sie die Spielregeln der Demokratie gelehrt. Was Wunder, dass sie beide nach demokratischen Spielregeln auch ihrem Vaterland die Vorzüge westlicher Technik, Wissenschaft und Wirtschaftsform zugänglich machen wollen!»[38] Der Schah galt somit als zukunftsweisender Brückenbauer zwischen Nord und Süd.
Die große Beliebtheit von Soraya in der Bundesrepublik rührte auch daher, dass ihre Mutter eine deutsche Verkäuferin war. Der märchenhafte Aufstieg und die spätere Ehekrise aufgrund ihrer Kinderlosigkeit elektrisierten die Medien. Der Reichtum und die Machtfülle des Pfauenthrons schreckten in den 1950er Jahren nicht ab, sondern faszinierten durch die wahrgenommene Verbindung von orientalischer Exotik und westlicher Moderne. Dieser Blick auf das Herrscherpaar blendete die Situation im Iran aus. Einige Journalisten erwähnten zwar die dortige Armut, glaubten aber, sie werde durch die Modernisierungspolitik des Schahs verschwinden. Sein autoritärer Stil sei nötig, um in einem Land mit Analphabeten schrittweise die Demokratie einzuführen. «Wo Demokratie nicht schon Tradition sein kann, bedarf sie der Wegbereitung durch anerkannte Führung», kommentierte etwa der Politikwissenschaftler und Herausgeber der Zeitschrift Außenpolitik, Heinrich Bechtoldt, 1961 wohlwollend den politischen Kurs des Schahs.[39] Wie bei Haile Selassie schien damit ein autoritärer Weg zur Demokratie angemessen, weil sonst, solange in diesen Staaten keine allgemeine Bildung vorherrsche, Populismus, Chaos und schließlich der Sozialismus triumphieren würden. Ähnliches lässt sich auch gegenüber anderen Staaten ausmachen. So sahen die frühen Berichte des westdeutschen Generalkonsuls in Ankara die Türkei als noch nicht reif für eine westliche Demokratie an und klagten, «daß der Versuch einer Demokratisierung des politischen Lebens geschichtlich zu früh unternommen wurde.»[40] Die Formulierungen verrieten zugleich viel über politische Prägung und demokratische Reife der Deutschen.
Der Schah selbst pries sich als ein Modernisierer, der Iran schrittweise die «Demokratie» beschere. In seiner Autobiographie, die 1961 auch auf Deutsch erschien, betonte der Schah, wie er Persien von einem «autokratischen Staat» zu einem demokratischen Zwei-Kammersystem verwandelt habe, mit einer Verfassung nach belgischem Vorbild und einem Justizwesen nach französischem Modell.[41] Tatsächlich war eher das Gegenteil der Fall: Die demokratischen Elemente in Iran nahmen in den 1950er Jahren ab. Mohammad Reza Pahlavis frühe Versuche, die Verfassung zu seinen Gunsten zu verändern, scheiterten 1948 noch am Veto der westlichen Alliierten. Im Kalten Krieg ließen die USA dem antikommunistischen Herrscher dann mehr Spielraum, um seine Macht auszubauen.[42] Nach einer eher demokratischen Phase 1953 war der gewählte Premierminister Mohammad Mossadegh unter Beteiligung des britischen und US-Geheimdienstes gestürzt worden, nachdem er die Verstaatlichung der britisch kontrollierten Ölförderung versucht hatte. Von nun an baute der Schah seine Machtstellung schrittweise aus.
Dass der Schah seine Position den Westmächten verdankte, förderte seine Macht und blieb zugleich sein größter Makel. Im Unterschied zu den Autokraten in ehemaligen Kolonien, die Kriege gegen fremde Machthaber geführt hatten, fehlte dem Schah dieser antiwestliche Heroismus, der später die Linke faszinierte. Der wachsenden iranischen Opposition galt der Schah vielmehr als verachtenswerte Marionette der neokolonialen USA. Der Sturz Mossadeghs 1953 blieb für sie das Symbol für eine antidemokratische Einmischung des Westens und der Ausgangspunkt für antiwestliche Ressentiments in Iran.[43] Auch die bundesdeutschen Diplomaten begrüßten die Absetzung des gewählten iranischen Premiers Mossadegh als Herstellung der Staatsordnung.[44] Denn der Schutz des Staates – und eigener Interessen – stand bei ihnen vor der demokratischen Legitimation. Eine «Marionette der USA», wie es die Linke später formulierte, war der Iran trotz der Unterstützung jedoch nicht: Der Schah suchte vielmehr auch Kontakte zu sozialistischen Staaten und brachte sich in der Bewegung der Blockfreien Staaten ein. Gerade dadurch umwarben die westlichen Staaten Iran umso mehr.
Unter Demokratie verstand der Schah vor allem Entwicklung, Wohlstand und Kampf gegen den Analphabetismus, nicht die Volkssouveränität. Um die Anerkennung des Westens zu erreichen, erprobte er allerdings verschiedene demokratische Fassaden. Einzelne Parteien wurden zugelassen, dann wieder verboten, Parlamente gewählt und dann aufgelöst.[45] Besonders die 1960 angesetzte Wahl in Iran schuf Erwartungen, die der Schah durch Eingriffe und die Parlamentsauflösung wieder enttäuschte. Die eingesetzten Premierminister waren ihm ergeben oder wurden andernfalls ausgewechselt. Zugleich baute er den Sicherheitsapparat aus, insbesondere den 1957 gegründeten Geheimdienst SAVAK sowie das Militär, das dank westlicher Ausrüstung seine zentrale Machtquelle war. Die Oppositionsgruppen, die besonders um 1960 zunahmen und 1963 massenhaft protestierten, ließ er scharf bekämpfen und viele Angehörige hinrichten. Vor allem Kommunisten wurden seit den 1950er Jahren rigoros verfolgt und vor Militärgerichte gestellt.
Diese Seite des Irans wurde beim Staatsbesuch 1955 kaum thematisiert. Lediglich die «Iranische Nationale Widerstandsbewegung», die sich in der Bundesrepublik formierte, schrieb an verschiedene deutsche Politiker, dass mit dem Sturz von Mossadegh in Iran eine «Militärdiktatur faschistischer Prägung» entstanden sei, die die Opposition unterdrücke und Wahlergebnisse fälsche.[46] Noch jedoch war diese kleine Migrantengruppe, die bereits die Rhetorik der 68er benutzte, ohne öffentlich vernehmbare Stimme. Schahtreu war die westdeutsche Medienöffentlichkeit nicht. Wie noch zu zeigen ist, kamen ab Mitte der 1950er Jahre, vor allem ab 1958, durchaus kritische Töne auf.
Auch der Bonner Regierung war bewusst, dass Iran keine Demokratie im westlichen Sinne war. Die vorbereitende Mappe für Adenauers Reise nach Iran erwähnte Korruption, die Unzufriedenheit in der Bevölkerung und dass, «wie meist im Orient», die Exekutive durch die Polizei eine Machtvollkommenheit habe.[47] In den Gesprächen mit Adenauer stellte der Schah vor allem dar, wie er das Land politisch und wirtschaftlich modernisieren wolle, etwa durch die Gründung von zwei Parteien: «Beide Parteien sollten im patriotischen und fortschrittlichen Geiste erzogen werden, um dann ihrerseits eine erzieherische Wirkung auf die Bevölkerung ausüben.»[48] Adenauer lag dieses eher «erzieherische» Verständnis des Demokratieaufbaus nicht fern. Den großen Jubel der gelenkten Öffentlichkeit, den Adenauer 1957 auf Teherans Straßen erhielt, kommentierte er gegenüber den Journalisten humorvoll: «Ich glaube, hier würde ich auch gewählt werden.»[49]
Expertenaustausch im Schatten des Nationalsozialismus
Die späteren Verbindungen zu Iran basierten vor allem auf Öllieferungen. Anfangs war zugleich die Wahrnehmung wichtig, ein ähnliches Schicksal zu teilen und an lange etablierte Kontakte anzuknüpfen. Tatsächlich hatten deutsche Firmen bereits in den 1920/30er Jahren beim Aufbau staatlicher Infrastrukturen, der Eisenbahn, der Nationalbank und des Militärs in Iran mitgewirkt. 1938 war Deutschland bereits größter Handelspartner Irans.[50] Die nationalsozialistische Propaganda stieß in Iran und dem Nahen Osten auf positive Resonanz, wenngleich der Schah wie sein Vater kein Antisemit war und dort weiterhin eine große jüdische Gemeinde lebte.[51] Dass die Briten den Schah 1941 zum Rücktritt zwangen, seinen jungen Sohn zum Nachfolger ernannten und das Land besetzten, da es angeblich mit den Deutschen kooperieren würde, stärkte nach dem Krieg das wechselseitige Verbundenheitsgefühl. Und wie in der Bundesrepublik waren es die US-Amerikaner, die in Iran mit generöser Wirtschaftshilfe und einem großen Heer an Experten den Aufbau und die Westorientierung des Landes unterstützten, um einen Außenposten gegen die Sowjetunion abzusichern. Ähnlich wie etwa die Türkei sahen sich beide Staaten als Grenzländer am Rande der freien Welt. Iran war zwar kein Nato-Mitglied, über den CENTO-Pakt und die Militärhilfe aber fester Teil der westlichen Verteidigungsarchitektur. Iran erschien zudem bereits durch seine Einwohnerzahl als ein attraktiver Absatzmarkt. Mit damals rund zwanzig Millionen Bürgern war es neben Ägypten das bevölkerungsreichste Land im Nahen Osten.
Die bundesdeutschen Unternehmen verfügten anfangs noch nicht über Kapital für große Investitionen. Was Adenauer dem Schah in Gesprächen anbot, waren westdeutsches Know-how und Experten, auch um Öl zu erschließen.[52] Iran wiederum bemühte sich seit Anfang der 1950er Jahre, den starken Einfluss der Briten und der USA zu mindern, indem man westdeutsche Experten und Handelspartner umwarb.
Die deutschen und iranischen Akteure knüpften auch an Verbindungen aus der Zeit des Nationalsozialismus an. Die 1936 entstandene deutsch-iranische Handelskammer wurde 1952 von ähnlichen Mitgliedern als Brückenkopf begründet. Der erste westdeutsche Gesandte und Botschafter in Teheran, Lutz Gielhammer, hatte bereits in den 1930er Jahren länger in leitender Funktion für die Nationalbank Irans gearbeitet.[53] Als Finanzexperten lud Iran in den frühen 1950er Jahren mehrfach Hjalmar Schacht ein, der in Hitlers Kabinett Reichswirtschaftsminister gewesen war und in dieser Funktion bereits 1936 Iran bereist hatte. Seit 1949 agierte Schacht als Wirtschaftsberater und Bankier in vielen autokratischen muslimischen Staaten, besonders in Ägypten, Syrien und Indonesien. Seine neu aufgebaute Privatbank finanzierte insbesondere den Außenhandel im Nahen Osten.[54] Ebenso wurden wichtige Infrastrukturprojekte in Äthiopien, wie der Hafen in Assab, von deutschen Ingenieuren gebaut.[55]
Eine frühere Karriere im Nationalsozialismus war im Nahen und Mittleren Osten kein Hindernis, um dort in der Botschaft oder als Experte zu wirken. So amtierte ab 1956 mit Henning Thomsen ein ehemaliger SS-Mann als Botschaftsrat in Teheran, während das frühere SS-Mitglied Hans Schmidt-Horix in der Botschaft Pakistans, dann in der Iraks wirkte.[56] Der Botschafter in Indonesien, Werner Otto von Hentig, vor 1945 Abteilungsleiter im Auswärtigen Amt und Berichterstatter an der Ostfront, forcierte unter den muslimischen Staaten Proteste gegen die Wiedergutmachung für Israel 1952/53; nach seinem Ausscheiden aus dem Amt wurde er persönlicher Berater des Saudischen Königshauses.[57] In westlichen Demokratien wären diese Karrieren kaum möglich gewesen. In Äthiopien unter Haile Selassie stützten ebenfalls NS-Eliten den Staatsaufbau. Ab 1954 agierte dort als «Berater und Verwaltungskommissar» der Stadt Addis Abeba Hermann Neubacher, von 1938 bis 1940 Wiener Oberbürgermeister, im Krieg dann ab 1942 «Sonderbeauftragter des Reiches für wirtschaftliche und finanzielle Fragen in Griechenland» und Sonderbevollmächtigter des Auswärtigen Amtes für den Südosten.[58] Die Verwalter der Zerstörung Europas mutierten so zu Aufbauhelfern im fernen Süden und Nahen Osten, die viel Verständnis für die dort zunehmend autokratische Herrschaft aufbrachten. So berichtete Gielhammer, dass er in Teheran mit «großer Freundlichkeit» aufgenommen worden sei und auch die Vertreter der arabischen Staaten sich «germanophil» zeigten.[59]
Das Auswärtige Amt schickte die früheren Nationalsozialisten unter den Diplomaten bevorzugt in rechte Autokratien, während eher unbelastete Beamte in westlichen Demokratien unterkamen. Kurt Luedde-Neurath etwa, der 1933 der SA und 1937 der NSDAP beigetreten war, arbeitete von 1953 bis 1956 in Franco-Spanien, in den 1960er Jahren während der antikommunistischen Massaker in Indonesien und war seit 1973 deutscher Botschafter in Chile, also zu Beginn der Diktatur Pinochets. Wenngleich sich derartige Diplomaten nun zur Demokratie bekannten, erklärt ihre Vergangenheit sicher mit, warum sie so erstaunlich viel Verständnis für das autoritäre Handeln in diesen Ländern mitbrachten und die dortige Verfolgung von Sozialisten weitgehend tolerierten. Auch die Botschafter in Iran, Lutz Gielhammer und sein Nachfolger Reinhold von Ungern-Sternberg, waren ehemalige NSDAP-Mitglieder und vor 1945 im Auswärtigen Amt aktiv. Nun warben ihre Berichte um Verständnis für Iran und verteidigten das Schah-Regime gegen Kritiker.[60] Generell stellten sie ihre spezifischen deutschen Staatsinteressen über demokratische Anforderungen.
Iran war, gerade im Vergleich zu Syrien, Ägypten und Argentinien, kein «Nazi-Nest». Auch politisch unbelastete Experten stärkten die frühe Bande. Als Quasi-Diplomaten reiste 1949 etwa eine Gruppe von westdeutschen Ärzten nach Teheran, die dort von der Kronprinzessin und dem Parlament empfangen wurden und dann mehrfach dem Bundespräsidenten über die Lage in Iran berichteten. Frühzeitig schrieben sie werbend, wie beliebt die Deutschen hier seien, und ihre medizinische Arbeit stärkte das Ansehen der Bundesrepublik.[61] Ein Bekannter des Botschafters war für die Organisation des Siebenjahresplans in Iran verantwortlich, was bundesdeutsche Aufträge erleichterte.[62] Nach Iran kamen zahlreiche westdeutsche Berater, etwa zum Aufbau des Eisenbahn- und Telefonnetzes und von zwei Gewerbeschulen.[63] Als Experiment wurde 1957 die Leitung eines staatseigenen Baumwollunternehmens als «Patenschaft» an einen deutschen Textilunternehmer abgegeben.[64] Selbst in der iranischen Postverwaltung waren Bundesbürger leitend tätig.[65] Die Deutschen, die in vielen Teilen Europas noch als kriegslüsterne Nationalisten galten, genossen in dieser Region das Image, aufbauende Partner zu sein. Während die Deutschen in Europa als Zerstörer galten, erschienen sie hier als Meister des Aufbaus und des Wirtschaftswunders – und damit als Vorbilder.
Im Schatten des Nationalsozialismus erfolgte zudem eine militärische Beratung. Viele südliche Autokratien stellten nach dem Zweiten Weltkrieg Experten aus der Wehrmacht und den NS-Organisationen ein, die beratend ihr Militär aufbauen sollten. Bundesdeutsche Militärexperten befanden sich nach einer Aufstellung des Auswärtigen Amtes 1953 bereits in der Türkei, Ägypten, Indonesien, Syrien und China.[66] Besonders in Syrien und Ägypten bauten ehemalige SS-Männer und Offiziere wie Franz Rademacher, Alois Brunner oder Walther Rauff nun Armeen und Geheimdienste auf.[67] Fluglinien im Nahen Osten stellten Piloten und Techniker aus der Wehrmacht ein,[68] und ein früheres Vorstandsmitglied der Reichswerke Hermann Görings, Wilhelm Voss, leitete 1951 das «Central Planning Board» im ägyptischen Kriegsministerium.[69] Die antisemitische Haltung dieser Experten machte ihren Wechsel in den Nahen Osten besonders brisant. Ähnlich wie die Lateinamerika-Auswanderer solchen Schlages arbeiteten einige von ihnen als BND-Informanten für eine Bundesbehörde und nahmen so Einfluss auf die positive Bewertung dieser Autokratien.
Mitunter richteten die Autokratien offizielle Anfragen an die Bundesregierung nach derartigen Experten. So erkundigte sich Irans Regierung beim Auswärtigen Amt 1953 nach «2 deutsche Propaganda-Psychologen mit besten Erfahrungen für die iranische Armee», um die vaterländische Gesinnung, den Kampfgeist und die «Erziehung zu militärischen Höchstleistungen» zu fördern. Iran schlug ehemalige Mitarbeiter aus Goebbels’ Propagandaministerium vor.[70] Das iranische Militär bat zugleich um deutsche Literatur über den Zweiten Weltkrieg, und ein iranischer General, der selbst Deutsch sprach, übersetzte ein Buch über Erwin Rommel, der im Nahen Osten wegen seines Kampfes gegen die Briten zu Ansehen gekommen war. Während die «Dienststelle Blank», der Vorläufer des Verteidigungsministeriums, hier zuarbeitete, sprach sich das Bundeskanzleramt gegen die Entsendung der ehemaligen Goebbels-Mitarbeiter aus. Die Angst, dies könne zu einem Ansehensverlust bei den Alliierten führen, überwog.
Generell bremste die Rücksichtnahme auf Interessen der Westalliierten zunächst den Kontakt zu Autokratien. Als die iranische Regierung im Zuge ihrer Abgrenzung von den Briten etwa ab 1951 mehr westdeutsche Ölexperten anfragte, intervenierte die Bundesregierung aus Rücksicht auf ihren westlichen Partner. Das Wirtschaftsministerium bat die Mineralölindustrie und die rund 45 westdeutschen Ölexperten, die sich 1951 für eine Arbeit in Iran interessierten, deshalb sogar, von ihrer Bewerbung Abstand zu nehmen.[71] Erst in den folgenden Jahren wurde aus Anlass von Adenauers Besuch in Teheran die Öl-Erschließung durch bundesdeutsche Experten besiegelt.[72] Auch gegenüber nordafrikanischen Staaten wie Marokko, das der Bundesrepublik damals Getreide lieferte, wies das Auswärtige Amt die Wirtschaft an, sich bei Aufträgen zurückzuhalten, da diese Region als Einflusssphäre Frankreichs galt. So wurde ein Auftrag von Siemens für das Telefonnetz zugunsten französischer Unternehmen zurückgezogen.[73]
Die Absicherung der Westbindung hatte also anfangs klar Vorrang vor der Kooperation mit südlichen Autokratien. Die Akzeptanz (früherer) kolonialer Einflusssphären prägte das bundesdeutsche Taktieren. Gerade deshalb erschien der Nahe und Mittlere Osten für die Deutschen attraktiv, da dort die kolonial geprägten Ansprüche der westlichen Nachbarn geringer waren als in Afrika. Auch nachdem die Westbindung gefestigt war, sah Adenauer 1958 den Mittleren Osten als «ein geeignetes Feld, unsere politischen Stärken einzusetzen», und uns «aktiv in die dortige Politik einzuschalten», wie er seinem Außenminister schrieb.[74]
Bereits der Schahbesuch 1955 hatte die engere Zusammenarbeit im Feld der inneren Sicherheit gezeigt, also beim Geheimdienst, der Polizei und der Verfolgung von Kommunisten. Iran war früh an der westdeutschen Polizeiarbeit interessiert. Auf Wunsch erhielt es regelmäßig die Ausgaben der bundesdeutschen Polizei- und Militärzeitschriften.[75] Bereits in den 1950er Jahren nahmen kleinere Gruppen von iranischen Polizeioffizieren an bundesdeutschen Schulungen teil.[76] Offen war, ob dies eher zur Demokratisierung der dortigen Polizei beitragen würde oder zur Bekämpfung von Demokraten.
Heikler war die Kooperation der Nachrichtendienste. Hier kam es zur westdeutschen Unterstützung des 1957 aufgebauten Geheimdienstes SAVAK, der in Iran maßgeblich die politischen Gegner verfolgte. Auf die iranische Anfrage nach einem Experten für den Kampf gegen den Kommunismus empfahl das Verteidigungsministerium Eberhard Taubert, der 1959 in Teheran für vier Jahre mit hohem Gehalt für den SAVAK Propaganda und Schulungen durchführte.[77] Taubert war vormals leitender Beamter in Goebbels’ Propagandaministerium gewesen und hatte das Drehbuch von «Der ewige Jude» geschrieben. Unter Strauß agierte er als Berater im Verteidigungsministerium, bis er unter dem Namen Dr. Max Huber nach Iran wechselte.[78] Dort stand er mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz in Verbindung und nicht mit dem BND, der erst 1961 dessen Identität entdeckte.[79]
Obwohl der Verfassungsschutz eigentlich für das Inland zuständig war, kooperierte dieser generell eng mit Iran. Dass der SAVAK seine deutsche und europäische Zentrale in der iranischen Botschaft in Köln hatte, erleichterte den Kontakt zum ebenfalls in Köln ansässigen Verfassungsschutz. Nach Stasi-Informationen arbeiteten dort mehrere hauptamtliche SAVAK-Mitarbeiter, die zahlreiche Informanten anwarben.[80] Ihr deutscher Verbindungsmann war der spätere stellvertretende Leiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Günther Nollau. Er reiste 1960 sogar für drei Monate in den Nahen Osten, insbesondere nach Iran, wo er sich mit dem SAVAK austauschte. Sein daraus entstandenes Buch hielt werbend fest, «Persien [sei] für die Verteidigung des Westens lebenswichtig».[81] Der Schah sitze zwar fest im Sattel, werde aber durch die internationale kommunistische Verschwörung auch von Deutschland aus gefährdet, etwa durch den kommunistischen Exil-Radiosender aus Leipzig. Damit erschien die Verfolgung iranischer Oppositioneller als eine gemeinsame Aufgabe. Bei Gerichtsverfahren gegen iranische Kommunisten in Deutschland sagte Nollau als Experte aus.[82] Wie die BND-Akten berichten, erhielt der iranische Geheimdienst bereits in den 1950er Jahren «des öfteren Material über persische Studenten» vom Kölner Bundesamt für Verfassungsschutz.[83] Zugleich hatte der BND einen Residenten in der bundesdeutschen Botschaft in Teheran. Die Verfolgung von iranischen Kommunisten in der Bundesrepublik rechtfertigte diese internationale Kooperation.
Für die Iraner war die nationalsozialistische Vergangenheit offensichtlich kein Malus. Mitunter war diese Zeit bei einflussreichen Eliten sogar positiv besetzt. Der Adjutant des Schahs und spätere iranische Botschafter in Bonn, Amir Aslan Afshar, berichtete etwa in seinen Memoiren stolz, dass er fünf von Hitler gezeichnete Bilder in seinem Haus aufgehängt hatte.[84] Er selbst wurde, wie viele Iraner der Oberschicht, in Deutschland ausgebildet: 1939 machte er in Berlin sein Abitur und erinnerte sich gerne an seine Zeit in der Hitlerjugend. 1942 promovierte er an der nunmehr deutschen Universität Wien über die «Entwicklungsmöglichkeiten der iranischen Volkswirtschaft». Der erste iranische Gesandte in Bonn 1950, Abdullah Entezam-Saltaneh, hatte die Deutsche Schule in Teheran besucht. Dass er ab 1953 als Außenminister und danach als Leiter einer iranischen Ölgesellschaft amtierte, war für die Bundesregierung ein vorteilhafter Kontakt. Im Deutschland der 1930er Jahre hatte auch der spätere Bonner Botschafter Irans, Mozaffar Malek, studiert und dann sogar in der Wehrmacht am Feldzug gegen Polen teilgenommen.[85] Der iranische Botschafter in den 1950er Jahren, Khalil Esfandiary Bakhtiary, hatte in Berlin seine Ausbildung absolviert und hier eine Deutsche geheiratet, wodurch er häufiger nach Deutschland kam; aus dieser Ehe stammte die Tochter Soraya, das Symbol der deutsch-iranischen Verbindung.
Zu diesem positiven Deutschlandbild in Iran trug der bekannte iranische Journalist Abba Schahandeh bei, Herausgeber der Teheraner Tageszeitung Ferman. Nachdem er als Gast der Bundesregierung Westdeutschland bereist hatte, publizierte er 1955 in Iran das Buch Deutschland nach dem Krieg. Dies betonte nicht nur die enge Verbundenheit der beiden Länder, den wirtschaftlichen Austausch und die Aufbaukraft des deutschen Volkes, sondern auch, dass alle Bundesbürger das Kaiserpaar lieben und er in jedem westdeutschen Haushalt, den er besuchte, ein Bild der Kaiserin Soraya gefunden habe.[86] Beide Seiten buhlten somit um eine Zuneigung, die die Deutschen in westlichen Nachbarstaaten kaum erhielten.
Viele Deutsche, die in den Iran, den Nahen Osten, nach Afrika oder Ostasien kamen, berichteten ebenfalls über das äußerst positive Deutschlandbild in diesen Regionen. Während die Westdeutschen in Europa als moralisch diskreditiert galten, trafen sie hier auf einen Bonus der «kolonialen Unverdächtigkeit», wie es oft hieß. Gerade im Nahen Osten, so berichteten Reisende und Diplomaten, sei das Bild der Deutschen sehr positiv, weil sie sich weder am Kolonialismus noch am Imperialismus in größerem Maße beteiligt hätten.[87] Auch aus der Türkei häuften sich die Berichte über das positive Deutschlandbild.[88] Selbst der Zweite Weltkrieg fand eine entlastende Deutung. Luitpold Werz, der 1934 in die NSDAP eingetreten war, an der Botschaft in Südafrika und Spanien arbeitete und schließlich 1945 als Referatsleiter die Verbindung zum SD und zur Sicherheitspolizei hielt,[89] berichtete etwa Außenminister Schröder 1965 rückblickend: «Während meiner Tätigkeit in Buenos Aires, Madrid und Kolumbien und ebenso in Südostasien habe ich zu meiner Überraschung festgestellt, welch’ hohes Maß an Achtung Deutschland trotz oder wegen des verlorenen Krieges genießt. Die Siege der deutschen Truppen, die Namen der einzelnen Heerführer sind überall noch in Erinnerung. Daß all das mit einer fürchterlichen Niederlage endete, scheint keine Rolle zu spielen, ja eher Sympathien einzubringen. Seltsamerweise verblassen demgegenüber auch all die Gräueltaten, die im deutschen Namen durch Deutsche begangen wurden.»[90]
Die Autokratien des Südens, so lässt sich bilanzieren, boten vielen Experten aus dem Nationalsozialismus neue Karrierechancen. Denn hier konnten sie nicht nur persönlichen Zuspruch, sondern die unveränderte Reputation ihres Landes genießen. Sie erhielten Gestaltungsspielräume, ohne vorwurfsvolle Erinnerungen an die nationalsozialistischen Verbrechen fürchten zu müssen.
Hallstein-Doktrin, Handel und Korruption
Bei der Annäherung an autokratische Staaten wie Iran oder Äthiopien gingen politische und wirtschaftliche Ziele Hand in Hand. Politisch strebte die Bundesregierung eine internationale Anerkennung an, die zugleich die Nicht-Anerkennung der DDR sichern sollte. Diese Strategie, die später als Hallstein-Doktrin bekannt wurde, setzten zunächst die westlichen Alliierten, dann ab Ende 1953 auch die Bonner Regierung mit zahllosen Sanktionsdrohungen und Demarchen durch.[91] Adenauer verlagerte so seine Wiedervereinigungspolitik in den globalen Süden, um im eigenen Land die Westbindung zu festigen. Bereits kleinste Formen der symbolischen Anerkennung der DDR im Ausland, wie eine gehisste DDR-Flagge auf einer Handelsmesse, führten zu sofortigen Protesten aus Bonn. Da sich die DDR ebenfalls um internationale Anerkennung bemühte, kam es zu einem Wettlauf um die Gunst der außereuropäischen Staaten.
Den moralischen Maßstab der bundesdeutschen Außenpolitik prägten somit weniger die Menschenrechtsverletzungen in südlichen Ländern als die in der DDR. Die westdeutsche Abgrenzung von der Diktatur in Ostdeutschland förderte dadurch die Annäherung an außereuropäische Diktaturen. Um per Hallstein-Doktrin die demokratische deutsche Einheit zu fördern, erschien die Kooperation mit undemokratischen nicht-sozialistischen Partnern akzeptabel.
Die außereuropäischen Staaten nutzten diese innerdeutsche Konkurrenz im Kalten Krieg zur Stärkung ihrer Position. Indem sie Kontakte und Gespräche zu beiden Blöcken und Teilen Deutschlands suchten, erhöhten sie ihren Wert. Dies zeigte sich besonders bei Staaten wie Indien oder Ägypten, die zum Sozialismus neigten, aber dank westlicher und bundesdeutscher Unterstützung die DDR vorerst nicht anerkannten. Doch selbst klar antikommunistisch regierte Staaten wie Iran stärkten dieses Werben durch Staatsbesuche und Gespräche mit der Sowjetunion und deren Verbündeten. Die im Auswärtigen Amt immer wieder wahrgenommene Gefahr, derartige Staaten könnten kommunistisch werden, legitimierte engere politische Kontakte, Waffenlieferungen, finanzielle Hilfen und vergünstigte Kredite.[92] Diese Politik war insofern erfolgreich, als dass die DDR jenseits der sozialistischen Bündnispartner kaum diplomatisch Fuß fassen konnte. Der moralische Preis war die enge Unterstützung von Militärdiktaturen.
Flankiert wurde die Hallstein-Doktrin durch eine massive Exportförderung gegenüber diesen Staaten. Anfang der 1950er Jahre erschienen der Nahe Osten, Lateinamerika, Teile Afrikas und Ostasiens als große Zukunftsmärkte. Wirtschaftliche Interessen, geopolitische Ziele und die Sehnsucht nach internationaler Anerkennung verschränkten sich. Wirtschaftsminister Ludwig Erhard ermunterte die westdeutschen Exportkaufleute 1950: «Wenn Sie herausgehen in die fremden Märkte, deutsche Waren zu verkaufen, dann handeln Sie zuletzt im demokratischen Auftrag des deutschen Volkes, der Ihnen [sic!] und dessen Lebensrechte neu zu erringen und zu sichern heißt.»[93] Erhards programmatisches Buch Deutschlands Rückkehr zum Weltmarkt forderte 1953 nicht minder deutlich, die Welt durch Handel zu erschließen und so die Ausbreitung des kommunistischen Einflusses zu verhindern.
Neben den «Chancen in Lateinamerika» sah Erhard ebenso wie viele Unternehmer den Nahen Osten als Ersatz für den verlorenen Absatzmarkt im Osten Europas, zumal die Region deutschfreundlich sei und geographisch nahe liege.[94] Auch auf das sich dekolonisierende Afrika setzten viele Deutsche große Hoffnungen. Der Historiker Dirk van Laak machte in der frühen Bundesrepublik «sentimental geprägte Erinnerungsreminiszenzen an ein vermeintlich konfliktfreies Verhältnis zwischen deutschen Kolonisatoren und ihren ‹Schutzbefohlenen›» aus, etwa wenn der CDU-Bundestagsabgeordnete Gustav-Adolf Gedat nach seinen Afrikareisen 1954 das Buch Europas Zukunft liegt in Afrika veröffentlichte.[95] Auch der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) setzte in den 1950er Jahren stark auf den Export in den Nahen Osten und «Übersee», wie die Welt außerhalb Europas damals genannt wurde. Große Industrieausstellungen in Kairo (1957) und Teheran (1960), zu der allein rund tausend Gäste aus Deutschland eingeladen waren, unterstrichen diesen Kurs.[96