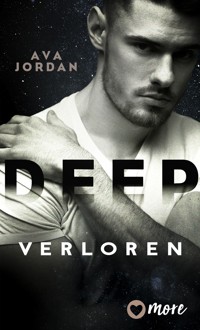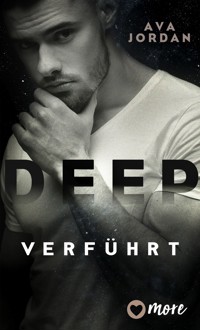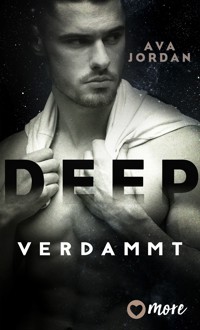
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Obsessed Reihe
- Sprache: Deutsch
Lea ist allein. Sie weiß nicht, was aus Jax geworden ist, nachdem sie untertauchen musste. Inzwischen lebt sie in Las Vegas und arbeitet in einer Autowerkstatt. Doch die Vergangenheit holt sie schneller ein, als Lea gedacht hat. Plötzlich soll sie Entscheidungen treffen, die nicht nur über ihre Zukunft bestimmen, sondern auch darüber, ob sie noch einmal glücklich werden darf ...
Das große Finale der Trilogie um Lea und Jax. Wir empfehlen die Titel in der richtigen Reihenfolge zu lesen.
Der Titel erschien vormals unter "Obsessed - Schmerz" unter dem Pseudonym Tiffany Jones.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 277
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Liebe Leserin, lieber Leser,
Danke, dass Sie sich für einen Titel von »more – Immer mit Liebe« entschieden haben.
Unsere Bücher suchen wir mit sehr viel Liebe, Leidenschaft und Begeisterung aus und hoffen, dass sie Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern und Freude im Herzen bringen.
Wir wünschen viel Vergnügen.
Ihr »more – Immer mit Liebe« –Team
Über das Buch
Lea ist allein. Sie weiß nicht, was aus Jax geworden ist, nachdem sie untertauchen musste. Inzwischen lebt sie in Las Vegas und arbeitet in einer Autowerkstatt. Doch die Vergangenheit holt sie schneller ein, als Lea gedacht hat. Plötzlich soll sie Entscheidungen treffen, die nicht nur über ihre Zukunft bestimmen, sondern auch darüber, ob sie noch einmal glücklich werden darf …
Das große Finale der Trilogie um Lea und Jax. Wir empfehlen die Titel in der richtigen Reihenfolge zu lesen.
Der Titel erschien vormals unter »Obsessed – Schmerz« unter dem Pseudonym Tiffany Jones.
Über Ava Jordan
Ava Jordan wuchs in Westfalen auf. Nach einigen Jahren im Rheinland kehrte sie in die Heimat zurück und bewohnt dort nun mit ihrem Mann und unzähligen Büchern ein kleines Häuschen. Sie schreibt und übersetzt schon sehr lange und kann sich ein Leben ohne das Schreiben einfach nicht vorstellen.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
https://www.aufbau-verlage.de/newsletter-uebersicht
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
Epilog
Impressum
Ava Jordan
Deep – Verdammt
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
Epilog
1. Kapitel
»Willkommen bei Pattie’s Garage, was kann ich für Sie tun?«
Ich blicke mein Gegenüber erwartungsvoll an. Der Typ stinkt nach Geld, und das ist hier selten. Pattie’s Garage ist eine preiswerte Hinterhofwerkstatt, in der all die unzähligen Arbeitsbienen, die Tag und Nacht das Leben in dieser Stadt am Laufen halten, ihre Autos reparieren lassen. Zu unseren Kunden gehören Croupiers, Prostituierte, Elvis-Imitatoren, Zimmermädchen und Kellner.
Und keine Multimillionäre, denen das Geld förmlich aus der Zahnleiste springt, weil sie sich in einem Moment geistiger Umnachtung einen Brillanten auf den Schneidezahn haben zementieren lassen.
»Mein Wagen ist kaputt, er macht immer so ein schleifendes Geräusch, wenn ich die Kupplung trete. Mein Mädchen sagt, ihr seid die Besten und kostet nicht so viel.«
»Hmhm.« Ich angle ein rosafarbenes Formular aus der Ablage, klippe es auf ein Klemmbrett und reiche ihm Brett und Stift über den Tresen. »Dann füllen Sie das hier aus. George schaut sich den Wagen gleich an.«
Er steht etwas belämmert vor mir. Sein Anzug stinkt nicht nur nach Geld, er sieht auch nach der Art Reichtum aus, die ich besonders abstoßend finde. Glänzend und dunkelblau, mit schwarzem Hemd und einer passenden Krawatte. Die goldene Krawattennadel hat auch ein paar Brillanten abbekommen.
»Äh, also … Ich dachte, Sie machen das.« Er hält mir das Klemmbrett mit einem – wie er vermutlich glaubt – entwaffnenden Lächeln hin.
Ich schüttle den Kopf.
»Aber …«
»Hören Sie«, unterbreche ich ihn. »Sie wollen doch Ihr Auto repariert haben, richtig? Und Sie sind hier, weil Ihr ›Mädchen‹ sagt, wir sind die Besten und Billigsten. Das klappt aber nur, wenn Sie mitarbeiten. Also: Formular ausfüllen und warten, bis George für Sie Zeit hat.«
Ich zeige auf den Wartebereich, in dem bereits andere Kunden über ihren Klemmbrettern brüten. Montagmorgen ist bei uns besonders viel los.
»Können wir das nicht anders regeln?« Er kramt in der Hosentasche und zieht eine Geldklammer hervor, die kaum die Hunderter zu bändigen vermag, die sich unter das vergoldete Metall drücken.
Ich seufze. Klar, für Geld kann man alles kaufen. Auch die bevorzugte Behandlung bei einer der billigsten Werkstätten von Las Vegas.
Er schiebt einen Hunderter über den Tresen, zusammen mit dem Klemmbrett.
Ich nehme beides und schaue mich nach George um, der gerade aus der Werkstatt in den Verkaufsraum kommt. Sofort bemerkt er meinen Blick und steuert auf uns zu.
»Mr. …«
»White. Eddie«, fügt er hinzu.
»Okay, also Mr. White ist als nächstes dran, er hat es heute eilig.«
Um die Eile zu unterstreichen, drehe ich das Klemmbrett so, dass George den Geldschein sieht. Er nickt.
Wir machen immer halbe-halbe, wenn jemand sich die Wartezeit durch eine gewisse Zuwendung sparen will. Welchen Sinn es dann noch hat, eine billige Werkstatt aufzusuchen, ist mir ein Rätsel. Aber okay – es ist ja auch nicht mein Geld, das da unter der Klammer klemmt.
Obwohl ich es gerne hätte, ehrlich gesagt …
Ich schiebe den Gedanken beiseite. Pattie ist eine gute Chefin. Sie zahlt ihren Leuten keinen Hungerlohn, wie man es bei den Preisen vermuten würde. Reich wird natürlich auch keiner, aber sie drückt ein Auge zu, wenn wir uns nebenbei was dazuverdienen. Dass George und ich Mr. White um ein bisschen Geld erleichtern, wird sie nicht stören.
Ich fülle sogar für ihn das Klemmbrett aus und reiche es dann an George weiter, der Mr. White bittet, ihm in die Werkstatt zu folgen. Die anderen Kunden blicken nur kurz auf, als die beiden verschwinden. Für sie ist es normal, dass man sich für Geld alles kaufen kann – schließlich sind wir hier in Vegas, Baby! Es gibt nichts, was es nicht gibt!
Ich setze mich auf den wackligen Bürostuhl hinter dem halbrunden Tresen. Das Telefon klingelt, und ich nehme den Anruf an. Ein Stammkunde, der die Heckscheibe seines Autos austauschen lassen will und nach einem »diskreten Termin« fragt. Wahrscheinlich gab’s wieder mal irgendwo eine Schießerei, und er ist mit knapper Not entkommen. Soll nur keiner wissen, dass seine Karre durchsiebt wurde. Vor allem nicht die Polizei. Ich notiere sein Anliegen und gebe ihm einen Nachmittagstermin.
Auch das ist Vegas. Die Unterwelt hat mich nicht losgelassen, so sehr ich es auch versucht habe …
Mittags überquere ich die Straße und betrete die kleine Wohnung im Hinterhof, in der ich seit acht Monaten wohne. Ich habe eine Stunde Zeit, bevor ich wieder am Schreibtisch sitzen muss, wo ich Telefonanrufe annehme, Kunden betreue, Verträge aufsetze, Rechnungen schreibe und all die unzähligen administrativen Aufgaben erfülle, die so eine Autowerkstatt mit Gebrauchtwagenhandel mit sich bringt.
Ich habe den Job nicht gelernt. Wie schon damals in New York bei »Jimmy’s« wurde ich ins kalte Wasser geworfen und musste schnell schwimmen lernen. Aber Pattie hat es mir zugetraut, und siehe da – nach ein paar Wochen »training on the job« fiel mir diese Arbeit sehr viel leichter als das Kellnern im Diner.
Endlich habe ich das Gefühl, einen Job gefunden zu haben, den ich länger als nur ein paar Monate ausüben kann. In einer Stadt, die ich hasse und zugleich irgendwie auch liebe.
Ich führe ein einsames Leben. Sechs Tage die Woche arbeite ich drüben bei Pattie’s Garage. Sonntags bleibe ich zu Hause, liege bis mittags im Bett, bevor ich mich in Joggingklamotten werfe und fünf Meilen renne. Alle drei Wochen färbe ich den Ansatz meiner Haare nach – Tarnung ist alles – und ich verbringe die Abende vor dem Fernseher oder mit billigen Taschenbüchern, die ich für 99 Cent das Stück aus der Wühlkiste bei Wal-Mart ziehe.
Ich habe keine Freunde. Die Versuche meiner Kollegen, mich in ihr soziales Gefüge einzupassen, habe ich fast alle abgeschmettert. Erst trauten sie sich ohnehin nicht an mich heran, weil ich so deprimiert und blass war. Und als sie dann anfingen, mit mir zu reden, mich einzuladen oder sich mir aufzudrängen, hatte ich mich soweit im Griff, dass sie kaum eine Chance hatten, meinen Panzer zu durchdringen.
George ist die Ausnahme. Aber George respektiert auch die Grenzen meiner Freundschaft. Und er hat mich gerettet, als sonst niemand da war.
Während ich in der Mikrowelle die Reste vom gestrigen Abendessen warm mache, gieße ich mir ein Glas Milch ein und starre müde aus dem Fenster. Die Mülltonnen im Innenhof quellen wieder mal über vom Müll der umliegenden Häuser. Das ist das Einzige, was man von den Nachbarn mitbekommt – wie sie ihren Müll entsorgen.
Und mehr wissen sie über mich vermutlich auch nicht.
Willkommen in der Unterschicht. Dort, wo sich das Heer aus Arbeitsbienen eingerichtet hat, wo das Leben so anders ist als in der Welt, aus der ich komme. Früher hatte ich alles – und ich hätte es behalten können, wenn ich gewollt hätte. Wenn ich die Augen vor der Wahrheit verschlossen hätte, dass mein Vater eines der größten Drogenkartelle des Landes leitete, das inzwischen in den Händen meines Bruders Dean liegt. Los Angeles gehört der Familie Tevez – so ist es seit Jahrzehnten gewesen und so wird es, wenn es nach meinem Bruder geht, auch in Zukunft bleiben.
Ich bin vor diesem Leben geflohen, als ich es nicht länger aushielt. Und ich habe alles aufgegeben – den Reichtum, die Sicherheit, die Liebe meines Lebens. Seit knapp einem Jahr bin ich in Las Vegas. Manchmal macht mich die Einsamkeit schier verrückt.
Es ist nicht so, dass es mir an Gelegenheiten mangeln würde, Freunde zu finden. Oder einen Mann, der mit mir ausgehen möchte. Man kann auch nicht behaupten, dass ich irgendwie besonders schüchtern wäre. Oder dass es mir leichtfällt, so isoliert zu leben.
Die Mikrowelle plingt, und ich nehme den Teller mit Lasagne heraus und trage ihn zum Tisch. Während ich esse, lese ich einen Schmachtfetzen. Lady Helena und ihr unglaublich attraktiver Duke haben noch 70 Seiten, um zueinander zu finden. Das interessiert mich natürlich brennend.
Nach dem Essen wasche ich Teller, Glas und Gabel ab, räume das Geschirr weg und gehe noch mal durch alle Räume meines Apartments: Wohnzimmer, offene Küche, Schlafzimmer, Badezimmer. Die Rollläden sind überall fest verschlossen gegen die drohende Nachmittagshitze.
Es ist eine andere Wohnung als die, in die ich bei meiner Ankunft in Las Vegas eingezogen bin. Jene hatte zwei Schlafzimmer. Doch nach zwei Monaten kehrte ich dem Apartment den Rücken – und mit ihm all den winzigkleinen Babysachen, die ich zwischendurch im Ausverkauf erstanden hatte.
Ich ertrug es dort keinen Tag länger als unbedingt nötig, nachdem ich Jacksons Baby verloren hatte.
Der Gedanke schmerzt auch jetzt noch, zehn Monate nach dem Verlust. Jeden Tag weiß ich ganz genau, wie alt das Baby jetzt wäre, wenn es gesund am Stichtag zur Welt gekommen wäre. Doch das Schicksal schien sich eines Besseren besonnen zu haben.
Oder das Schicksal hat eingesehen, dass ich als Mutter nichts tauge. Vielleicht ist es so besser …
Trotzdem tut es weh. Immer noch und immer wieder.
Ich reiße mich von diesem Gedanken los, verlasse die Wohnung und schließe hinter mir ab. In fünf Minuten muss ich wieder am Schreibtisch hinter dem Tresen sitzen, Formulare ausfüllen, Rechnungen tippen und einen Papierberg bezwingen, der jeden Tag aufs Neue die Größe des Mount Everest erreicht.
Am Nachmittag kann ich ziemlich unbehelligt das meiste wegarbeiten. Nach Feierabend überquere ich die Straße und betrete den kleinen Drugstore. Dort kaufe ich fürs Abendessen ein – ein Sixpack Bier, eine Flasche Cola, zwei Hotdogs und ein Wegwerfhandy.
Mit dem Sixpack und der Tüte beladen kehre ich zur Werkstatt zurück. Hinter dem großen Gebäudekomplex gibt es einen erstaunlich hübschen, ruhigen Garten, in dem die Natur wie durch ein Wunder – und dank regelmäßiger Bewässerung durch die Jungs aus der Werkstatt – ein wild wucherndes Paradies erschaffen hat.
George wartet bereits auf mich.
Ich habe mir geschworen, keine Freundschaften zu schließen. Oder auch nur jemanden so nahe an mich heranzulassen, damit derjenige irgendwas über mich erfahren könnte, das über das äußerlich Ersichtliche hinausging.
Die einzige Ausnahme ist George.
Er ist ein riesiger Kerl, ein Schrank, muskelbepackt und braun gebrannt. Der Schädel glattrasiert. Nach Feierabend kommt er immer mit einem sauberen, karierten Hemd und Cargo-Hose aus der Werkstatt und bietet mir als Erstes eine Zigarette an, obwohl er weiß, dass ich nicht rauche.
Und jedes Mal versetzt mir dieses Ritual einen kleinen Stich, weil es mich daran erinnert, wie mir ein anderer Kollege damals in New York eine Zigarette anbot – Zuko, der Mann vom FBI.
Doch ich vertraue George. Er ist das, was einem Freund am nächsten kommt.
»Harten Tag gehabt?«, fragt er. Ich gebe ihm einen Hotdog und eine Flasche Bier. Er hockt sich neben mich auf die kleine Steinbank, steckt die Zigarette in den Mundwinkel und legt das Hotdog auf die Knie. Zischend öffnet er die Bierflasche und trinkt einen großen Schluck.
»Nicht mehr als sonst«, sage ich und genehmige mir ebenfalls einen Schluck Bier.
Er knufft mich in die Seite. »Mr. White?«
»Ach ja, klar.« Ich ziehe ein paar zerknitterte Dollarnoten aus der Gesäßtasche und gebe ihm seinen Anteil. Er brummt zufrieden und versenkt das Geld in der Hemdbrusttasche.
George hat zwei uneheliche Kinder. Er kann jedes bisschen Extrageld gut gebrauchen.
»Du hast wieder ein Handy gekauft.« Er zeigt mit der Bierflasche auf die Plastiktüte.
Ich nicke. »Ja, es ist wieder so weit.«
»Man merkt nur daran, wie die Zeit vergeht. Alle zwei Wochen kaufst du so ein Wegwerfding.«
Ich lächle traurig. So durchschaubar bin ich also geworden. Alle zwei Wochen, meist am Dienstag, manchmal auch schon am Montag, kaufe ich gegenüber ein Wegwerfhandy.
»Willst du’s nicht hinter dich bringen? Danach bist du immer so scheiße drauf, ich dachte, wir machen’s heute mal sofort, damit ich dich trösten kann.«
Ich seufze und ziehe die Verpackung aus der Plastiktüte. Längst brauche ich keine Anleitung mehr, um die SIM-Karte aus der Halterung zu brechen, ins Handy einzulegen und die PIN einzugeben. Das alles läuft schon fast automatisch ab.
Ich wähle die Nummer aus dem Gedächtnis. Nach zweimaligem Klingeln wird auf der anderen Seite abgehoben, und ich höre eine Stimme, die mir das Herz zerreißt.
»Lea? Bist du das?«
Mein Herz rast. Ich presse das Handy ans Ohr, versuche die Stille von meiner Seite, das Schweigen, das ich mir auferlegt habe, mit Gedanken zu füllen.
Ja, ich bin’s, Liebster. Ich bin hier. Ich lebe. Unser Baby ist tot, aber ich lebe und ich vermisse dich noch immer so sehr, dass ich nicht anders kann. Alle zwei Wochen muss ich dich anrufen, und sei es nur, um deine Stimme zu hören. Alle zwei Wochen wird die Sehnsucht zu groß. Wie ein Junkie, der auf den nächsten Schuss hinfiebert, sehne ich mich nach diesen Abenden, an denen ich deine Stimme hören darf …
»Lea, du musst mit mir reden.«
Wir haben nicht viel Zeit, das weiß ich. Sechzig Sekunden, maximal neunzig. Danach könnte man mein Handy theoretisch orten. Vielleicht hat er das auch schon versucht. Was ich tue, ist gefährlich – vor allem für mich.
Aber ich kann nicht anders.
»Ich vermisse dich. Vermisst du mich auch?«
Ich fange an zu weinen. George bemerkt es und legt mir tröstend den Arm um die Schultern. Ich lehne mich bei ihm an, sein beruhigendes, leises Brummen treibt mich fort und lässt Jax’ Stimme nur noch wie ein fernes Flüstern zu mir durchdringen …
»Sag mir, wo du bist, Lea. Ich komme zu dir. Wenn du nur mit mir sprichst …«
Seine Verzweiflung ist so greifbar, dass ich irgendwas dagegen tun will. Aber das geht nicht. Es ist unmöglich, und das wissen wir beide.
Ich lege auf, nehme die SIM-Karte aus dem Handy und zertrümmere sie mit der Bierflasche auf der Betonplatte. Dann gebe ich das Handy George, der es zu den fünfzig Dollars in seine Hemdbrusttasche steckt. Er wird es übers Internet verticken. Noch ein bisschen Geld für seine Kids.
Wie betäubt sitze ich da, trinke mein Bier und versuche, mir Jax’ Worte in Erinnerung zu rufen.
Ich komme zu dir …
Das kann er sich ja wohl mal gepflegt in die Haare schmieren. Denn als ich ihn tatsächlich gebraucht hätte, mehr als alles andere auf der Welt, war er nicht da.
Natürlich hat er damals nicht gewusst, dass ich ihn brauchte. Trotzdem blieb dieser Schmerz, dass ich manches ohne ihn habe durchstehen müssen.
Das kann ich ihm nie verzeihen.
Und wenn er wüsste, dass ich seinen Freund Marcus erschossen habe – das könnte auch er mir nicht verzeihen, davon bin ich überzeugt.
»Geht’s wieder?«, fragt George. Er reicht mir ein Papiertaschentuch, ich putze mir umständlich die Nase und nicke. Klar, alles bestens. Ich habe meine Familie verlassen, den Mann, den ich liebe, ich habe mein Baby verloren und keine Freunde auf der Welt. Mir geht’s prima.
Immerhin lebe ich.
»Dein Typ wird verlangt.«
Ich blicke auf. Vor dem Tresen steht Pattie und vergräbt die abgearbeiteten, öligen Hände tief in den Hosentaschen des roten Overalls, den sie jeden Tag trägt. Sie ist klein und drahtig, die Haare sind zu Dreads geflochten und reichen bis zu ihrem Po. Die schokoladenbraune Haut, die wachen, dunklen Augen und der Goldzahn, der einen Schneidezahn ersetzt, wirken blank und sauber.
Sie ist die beste Chefin, die ich mir wünschen könnte. Ihr Alter kann ich nur schwer schätzen, aber aus den Gesprächen mit Kollegen habe ich rausgehört, dass sie die Werkstatt seit über fünfundzwanzig Jahren führt. Darum muss sie mindestens Mitte vierzig sein, sieht aber eher aus wie eine jung gebliebene Mittdreißigerin.
»Von wem?«
Sie zeigt mit dem Daumen über die Schulter. Mr. White – Eddie – steht in einiger Entfernung und begutachtet ein zitronengelbes New-Beetle-Cabrio, das wir vor drei Wochen in Zahlung genommen und wieder fit gemacht haben.
Ich seufze und krame in der Ablage nach der Rechnung für ihn. Dann gehe ich auf ihn zu.
»Mr. White.«
»Ah!« Er strahlt mich an. »Miss …«
»Miller.« Ich lächle unverbindlich.
»Miss Miller, genau. Ich wollte mich nochmals mal für den hervorragenden Service von gestern bedanken. Und ich habe eine Frage an Sie.«
Ich händige ihm die Rechnung aus. Ehe er weiterspricht, zieht er sie aus dem Umschlag und überfliegt die einzelnen Positionen. Dann nickt er zufrieden.
»Kann ich bar zahlen?«
»Klar.«
Ich kehre hinter den Tresen zurück und öffne mit einem Schlüssel die Schublade mit der Kasse. Mr. White schiebt mir einen Stapel Hunderter zu, ich gebe ihm das Wechselgeld und quittiere den Empfang der Summe.
»Also, was ich fragen wollte …«
Ich stehe wieder auf. Einen Korb verteilt man besser auf Augenhöhe.
»Würden Sie mit mir mal essen gehen?«
Klar. Ich habe nichts Besseres vor, du Trottel.
»Was wird denn Ihr ›Mädchen‹ dazu sagen?«
Er macht eine wegwerfende Handbewegung. »Die muss heute mal im Stall bleiben und was für ihren Lebensunterhalt tun.«
Wow, das nenne ich mal direkt. So richtig habe ich mich noch nicht daran gewöhnt, dass die Klientel von Pattie auch aus Zuhältern, Nutten und anderem zwielichtigen Gesocks besteht. Manchmal bereitet mir der Umstand Sorgen; mir wäre es lieber, wenn ich keinen Kontakt mehr zur Unterwelt hätte.
Weder mein Bruder Dean noch Jax wissen, wo ich stecke. Nachdem ich den Deal mit dem FBI nicht eingehalten habe, bin ich untergetaucht. Damals konnte ich nur hoffen, dass Dean mich nicht jagt oder seiner Frau Juno etwas antut, um sich an mir zu rächen. Aber ich habe ihn nicht verraten. Nach wie vor ist er der Herr über die Unterwelt von Los Angeles. Wäre es anders, hätte ich davon gehört.
Und Jax?
Er ist ebenso verschwunden wie ich. Vermutlich sitzt er wieder in New York und arbeitet für Black Swan. Raimund Swan kontrolliert die Ostküste, und bevor er mich traf, war Jax für ihn der erste Mann. Derjenige, der die Drecksarbeit delegierte, der die Fäden im Hintergrund zog und das Kartell nach außen bei Verhandlungen repräsentierte.
»Also? Wie sieht’s aus? Sie und ich, heute Abend? Ich kenne ein paar hervorragende Restaurants, französisch, italienisch … Wonach auch immer Ihnen der Sinn steht.«
Ich mustere Mr. White. Das dunkelbraune Haar ist gefärbt, dafür habe ich einen Blick. Er hat es sorgfältig nach hinten gegelt, um die beginnende Glatze zu kaschieren. Um die Körpermitte hat er einen Rettungsring, den er vermutlich ohne Erfolg mit Sport zu bekämpfen versucht. Seine kleinen Schweinsäuglein sind verschlagen, aber das muss nichts heißen. Viel mehr Sorgen bereitet mir die Ausbeulung unter seinem glänzenden Jackett. Er trägt eine Waffe.
»Tut mir leid, aber ich gehe nicht mit Ihnen aus.«
»Oh«, sagt er, als käme das für ihn völlig überraschend. Doch dann beugt er sich verschwörerisch vor und bedeutet mir, es ihm gleichzutun. »Und wenn ich Ihnen sage, dass ich eine Nachricht von Jackson Bennett für Sie habe?«
Mein Herz bleibt stehen. Wie ein Motor, den man in voller Fahrt abwürgt. Peng. Da ist in meiner Brust für diesen winzigen Sekundenbruchteil eine Leere, ein Schmerz, den nichts zu ersetzen vermag. Wortlos starre ich ihn an und warte, dass der Herzschlag zurückkommt. Eins, zwei, drei, tok. To-tok. Es beginnt zögerlich, als könnte es sich nicht darauf verlassen, dass der Körper, in dem es wohnt, überhaupt noch Verwendung für sein regelmäßiges Pulsieren hat.
»Mr. White, Sie verwechseln mich«, sage ich leise und eindringlich. »Ich kenne keinen Jackson Bennett.«
»Ich hole Sie heute Abend um acht ab.« Er strahlt mich an, als hätte ich ihm gerade das größte Geschenk gemacht. Dann klopft er mit der Geldscheinklammer auf den Tresen, nimmt die Rechnung an sich und marschiert aus dem Verkaufsraum.
Ich sinke auf den Bürostuhl. Das Blut rauscht mir in den Ohren, mein Mund ist staubtrocken und ich habe das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen.
Panik.
Ich spüre, wie die Attacke heranrauscht. Es ist nicht die erste, die ich erlebe, darum weiß ich, dass ich das, was nun kommt, nicht verhindern kann. Es wird passieren, egal, ob ich mich dagegen wehre oder nicht. Das Einzige, was jetzt hilft, ist: atmen. Einatmen, ausatmen, atmen, irgendwie!
Jeder Atemzug schmerzt. Vor meinen Augen tanzen schwarze Punkte. Ich bin nicht ich selbst, das spüre ich allein daran, wie mein Sichtfeld sich einengt, bis ich nur noch auf einen winzigen Punkt auf dem Schreibtisch starre.
Schnipp-schnipp.
»Sally? Alles in Ordnung bei dir?«
Ich blicke auf. Pattie steht vor mir und schnipst ungeduldig mit den Fingern direkt vor meinen Augen.
»Ja, alles okay.« Ich stehe auf und stütze mich am Schreibtisch ab. Mir ist schwindelig, und ich brauche dringend einen Schluck Wasser. Oder Wodka, das wäre natürlich noch besser. Eine ganze Flasche Wodka. Auf ex. Danach geht’s mir vielleicht etwas besser …
Ich stürme an Pattie vorbei nach draußen und blicke mich suchend um. Wenn Eddie White eine Nachricht von Jax hat, kann er mir die genauso gut jetzt mitteilen, dann brauche ich nicht mit ihm zu Abend essen. Doch der Kundenparkplatz ist bis auf einen alten Ford leer.
George kommt von der Werkstatt über den Hof. »Hey Sal!«, ruft er. »Wie sieht’s mit dem Feierabendbier aus?«
Ich hebe die Hand, was so ziemlich alles bedeuten kann zwischen Zustimmung und Ablehnung. Ich laufe an ihm vorbei und verschwinde auf der Mitarbeitertoilette.
Dort muss ich mich übergeben.
Habe ich wirklich geglaubt, irgendwann in Sicherheit zu sein? Von der Bildfläche verschwinden zu können, ohne dass mich jemand wieder aufspürt?
War ich zu unvorsichtig? Hätte ich lieber einen Job in einer Konservenfabrik annehmen sollen, wo ich acht Stunden am Band stehe und bestimmt nicht mit der Unterwelt in Berührung komme?
Ich habe gedacht, hier wäre ich in Sicherheit. In Reichweite, aber unter dem Radar.
Ich war so dumm …
2. Kapitel
Am Abend um zwei Minuten nach acht klopft jemand an die Wohnungstür. Ich hocke auf dem Sofa, die Knie angezogen, meine verschwitzten Finger umschließen die Pistole, die ich immer neben dem Bett liegen habe. Mir steht der Schweiß auf der Stirn, weil ich die Klimaanlage heute Abend nicht eingeschaltet habe. Es ist stickig, und mir rinnt der Schweiß über das Gesicht. Ich traue mich nicht, ihn mit dem Ärmel abzuwischen, weil jede Bewegung mich verraten könnte.
Die Panik ist immer noch da.
Ich warte. Es klopft nach einer Minute erneut, dann höre ich Eddie Whites Stimme durch das dünne Sperrholz.
»Sally, ich weiß, dass Sie da sind. Machen Sie auf. Ich komme unbewaffnet und in guter Absicht.« Er lacht affektiert, als könnte er sich selbst nicht trauen. Ich bleibe, wo ich bin. Mein Blick heftet sich auf die Tür. Ich bin auf der Hut, denn sobald sich der Türknauf bewegt, schieße ich.
Das habe ich mir fest vorgenommen. Sobald er versucht, in meine Wohnung einzudringen, erschieße ich diesen widerlichen Zuhälter.
»Jackson schickt mich.« Er verstummt, als ob er mir Zeit geben will, diese Information zu verarbeiten. »Hören Sie, Sally? Lea?«
Ich schließe die Augen.
Lea.
So hat mich niemand mehr genannt, seit …
Seit mein neues Leben begann. In einer finsteren, voll gemüllten Gasse in New Orleans.
Die Sommerhitze von New Orleans. Ich hatte sie mir nicht so klebrig und durchdringend vorgestellt. So lähmend. Tagsüber lag ich in meinem Hotelzimmer, und im Restaurant unter meinem Fenster lief eine ständige Party mit Musik von frühmorgens bis spät in der Nacht. Das Zimmer war so billig, dass ich diesen Lärm einfach akzeptierte. Schlafen konnte ich ohnehin immer und überall. Ich brauchte nur ein Bett oder irgendwas, worauf mein Kopf ruhen konnte.
Ich wartete. Auf den Anruf meines Kontaktmanns, auf meine neuen Papiere. Darauf, eine horrende Summe für eine neue Identität auszugeben. Noch mehr Spuren verwischen, noch unsichtbarer werden.
Vielleicht war sogar New Orleans schon ein Fehler. Denn hatten Jax und ich das nicht immer geplant? New Orleans als letzter Ausweg, weder Osten noch Westen, einfach nur der Süden … Alaska wäre das andere Extrem gewesen, aber wir glaubten wohl beide, nicht für ein Leben in Schnee und Kälte geschaffen zu sein.
Irgendwann hatte er auch mal Argentinien ins Spiel gebracht. Ins Ausland, wo weder das FBI noch die Kartelle uns finden konnten … Aber ich hatte dann nur gelacht. Die USA verlassen? Das war doch verrückt.
Darum hatten wir uns auf New Orleans versteift. Und hier war ich nun, in der Stadt, die uns beiden hätte Unterschlupf bieten sollen. Wenn wir gemeinsam untergetaucht wären.
Aber ich war allein.
Morgens stürzte ich aus dem Bett, sobald ich die Augen aufschlug und übergab mich so heftig, dass mein Hals und Rachen sich danach wund anfühlten. Nichts half gegen die Morgenübelkeit außer ausgiebiges Kotzen.
Am dritten Tag dachte ich, mein Kontaktmann sei einfach wieder abgetaucht, verschwunden mit den zwei Riesen, die ich ihm als Anzahlung hatte geben müssen, damit er überhaupt seinen Arsch in Bewegung setzte. Ich fing an zu überlegen. Sollte ich zurück nach Las Vegas fahren, mich dort weiterhin verstecken und mit irgendwelchen illegalen Jobs durchschlagen? Oder wäre es besser, wenn ich auch Las Vegas hinter mir ließ und irgendwo in den Weiten des Mittleren Westens versuchte, mich mit meinem richtigen Namen und den echten Papieren über Wasser zu halten? Was war richtig?
Ich wusste es nicht.
Und darum blieb ich, wo ich war. Ich lag auf dem schmalen Bett mit der Tagesdecke, die Brandflecke hatte (und einige andere, über deren Ursprung ich lieber nicht zu genau nachdenken wollte, weil mir davon sofort wieder kotzschlecht wurde), versuchte durch den Mund zu atmen, wenn die Übelkeit von den Küchendämpfen aus dem Restaurant hervorgelockt wurde und lutschte Eiswürfel, die ich am Ende des Flurs aus der Eiswassermaschine holte. Ich wusste, dass ich was essen sollte, dass ich mehr trinken sollte, aber jeder Versuch in die Richtung endete über der Kloschüssel.
Also ließ ich es bleiben. Ich hielt das billige Wegwerfhandy fest umklammert, döste vor mich hin und wartete auf den Anruf.
»Ich habe Papiere für dich.«
Als mein Kontaktmann anrief und die erlösenden Worte sagte, war ich für einen Moment wie betäubt. Ich hatte ihn und die zweitausend Dollar schon abgeschrieben. Eine letzte Nacht wollte ich in diesem Hotel bleiben, bevor ich auscheckte und abtauchte. Aber jetzt rief er an und versprach mir etwas, das mir völlig neue Wege eröffnete.
»Wir treffen uns in einer Stunde.« Er nannte mir eine Adresse, und bevor ich nachfragen konnte, wie ich dorthin kam, legte er auf.
Ich verließ das Hotelzimmer und stieg die Treppe hinunter. Zwei Nutten kamen mir mit ihren Freiern entgegen, und ich versteckte mein Gesicht hinter einer riesigen Sonnenbrille. In der finsteren Lobby stand ein alter Computerschreibtisch, wie man sie vor zwanzig Jahren in Wohnzimmerecken gequetscht hatte. Der alte Röhrenmonitor fiepte, als ich die Maus antippte und online ging, um die Adresse über Google Maps herauszusuchen.
Zum Glück war es nicht weit dorthin. Ich wagte mich in die nachmittägliche Hitze und lief den kurzen Weg zu Fuß. Vor der Gasse, in der Müllcontainer neben Bergen schwarzer Müllsäcke standen, drückte ich mich herum und wartete.
»Du bist zu früh.«
Ich drehte mich um. Mein Kontaktmann verbarg seine Augen ebenfalls hinter einer Sonnenbrille, riesig und verspiegelt. Er war in jenem undefinierbaren Alter zwischen fünfunddreißig und fünfzig, die Haut wirkte aschig und der dunkle Dreitagebart irgendwie unsauber. Er trug ein Jeanshemd mit abgeschnittenen Ärmeln und eine Jeans, dazu staubige Cowboystiefel.
»Ich will nicht länger als unbedingt nötig in der Stadt bleiben.«
Er nickte nur. »Dann wollen wir mal.«
Wir betraten die Gasse. Meine Hände umklammerten die Umhängetasche, als hätte ich Angst, dass aus einem der Müllberge ein Taschendieb auftauchen und sie mir entreißen könnte. Mein Kontaktmann grinste. Er schob sich einen Zimtkaugummi in den Mund und rief dann: »Kannst rauskommen, Sal.«
Ich drehte mich um.
Die belebte Einkaufsstraße war nur fünfzig Meter hinter mir, und doch war es, als hätte ich eine andere Welt betreten. Das dunkle New Orleans. Den Teil der Stadt, der bei keiner Reiseführung den Touristen vorgeführt wurde. Nach Katrina, so erzählte man sich, waren diese dunklen Ecken größer geworden. Sie hatten sich wie ein Geschwür ausgebreitet.
Ich hoffte plötzlich, dass es keine Falle war. Dass ich nicht plötzlich von hinten niedergeknüppelt wurde. Es wäre auch für meinen Kontaktmann einfach, er müsste gar nicht so viel Gewalt anwenden.
Meine Hand fuhr in die Tasche. Der Schlagring war noch da. Mein ständiger Begleiter in den kalten New Yorker Winternächten, der mir Sicherheit geschenkt und mich einmal sogar vor einem Raubüberfall bewahrt hatte …
»Hast du das Geld?«
Ich nickte. Neben dem Schlagring ertastete ich das dicke Geldbündel, das in einem braunen Umschlag steckte.
»Gib’s her.«
Nur zögernd zog ich den Umschlag hervor. Ich misstraute meinem Kontaktmann. Aber ebenso schien es um die Person bestellt zu sein, die uns meine neuen Papiere liefern sollte, denn noch rührte sich nichts in der Gasse.
»Deine Papiere brauche ich auch.« Er zählte das Geld im Umschlag nicht durch, als wüsste er, dass ich ihn nicht aufs Kreuz legen würde.
»Nein«, erwiderte ich. »Erst die Ware.«
»Sal!«, rief er leise. »Verdammt, du blöde Kuh, komm raus.«
Von unserem Standpunkt konnte ich die Gasse recht gut überblicken. Links und rechts die Kartons, Müllsäcke und Container. Vorne eine massive Ziegelwand. Wo sollte sich hier ein Mensch verbergen? Im Müll etwa?
Wer tat denn so was?
Jemand, der genauso paranoid ist wie du, dachte ich.
»Hier ist niemand«, erklärte ich, nachdem wir weitere zwei Minuten gewartet hatten.
Mein Kontaktmann hielt mich am Arm fest. »Einen Moment noch.« Er trat zu einem Berg Pappen und trat dagegen. »Sal! Komm raus.«
Und dann passierte es. Die Pappen bewegten sich. Zwei Kartons wurden beiseitegeschoben. Eine verdreckte, dürre Hand schob sich nach draußen, und mein Kontaktmann packte sie ohne Scheu und zog ein schmales, völlig verwahrlostes Ding heraus. Ein Wesen, ein … Tier?
Die Augen waren die eines Tiers. Gehetzt und voller Angst. Sie starrten mich sekundenlang an, und als ich den Blick nicht senkte oder woanders hinschaute, wollte sich dieser Wesen-Tier-Mensch schon losreißen.
Mein Kontaktmann hielt sie fest. »Whohoho, hiergeblieben«, sagte er beruhigend. Seine Stimme war überraschend sanft, fast die eines Vaters, der sein Kind tröstet, wenn es nachts aus Alpträumen erwacht. »Du wusstest, dass ich nicht allein komme.«
Sie starrte mich immer noch stumm an. Ich zog die Hand aus der Umhängetasche. Von dieser Frau ging keine Gefahr aus. Sie war viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um andere zu bedrohen. Außerdem bezweifelte ich, dass in diesem Körper besonders viel Kraft steckte, die sie gegen mich einsetzen konnte.
»Ist sie das?«
Ihre Stimme war die einer alten Frau. Ich sah sie mir genauer an. Die Haare waren grau, aber das mochte am Staub und Dreck liegen, in dem sie lebte. Ihr Gesicht war von der Sonne gebräunt, aber es wirkte unter der Schicht aus Schmutz und Bräune irgendwie alterslos. Sie hatte große, helle Augen, die mich musterten, als müsste sie erst herausfinden, ob ich es würdig war, mit ihr Geschäfte zu machen.
»Das ist sie.«
»Sie sieht mir nicht ähnlich.«
»Aber sie sieht deinen Papieren ähnlich.«
Sie schluckte, leckte sich über die Lippen. Ihre Hand fuhr zum Bauch, wo sie eine lila Kängurutasche aus billigem Nylon trug. Ihre Finger fummelten an dem Reißverschluss herum, bis sie ihn aufbekam und darin kramte.
Sie tat mir leid. Alles an ihr erzählte von der Verwahrlosung, dem Leben auf der Straße als Obdachlose. Ich hatte selbst nicht viel im Moment, und die Existenzangst saß mir fest im Nacken. Trotzdem wollte ich ihr plötzlich helfen. Sie aus diesem Elend herausholen.
Ich machte einen Schritt zurück. »Ich weiß nicht, ob das richtig ist.«