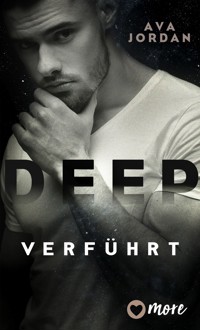
8,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Obsessed Reihe
- Sprache: Deutsch
Leas Leben als Kellnerin in Brooklyn scheint auf den ersten Blick eher langweilig, doch sie hat eine Vergangenheit, die sie sogar vor ihren Freunden und Kollegen verbirgt. Als sie eines Abends Jackson begegnet, scheint diese Vergangenheit sie einzuholen. Sie kann nur erahnen, wie gefährlich er für sie ist. Wie gefährlich es ist, etwas für ihn zu empfinden ... Doch dann offenbart sich ihr, dass alles noch viel schlimmer ist. Wie kann sie den Feind lieben? Den Mann, der für sie den Untergang bedeutet?
Lea rennt um ihr Leben - und fürchtet nichts mehr, als Jackson für immer zu verlieren ...
Erster Teil der Trilogie um Lea und Jax. Wir empfehlen die Titel in der richtigen Reihenfolge zu lesen.
Der Titel erschien vormals unter "Obsessed - Verführung" unter dem Pseudonym Tiffany Jones.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Liebe Leserin, lieber Leser,
Danke, dass Sie sich für einen Titel von »more – Immer mit Liebe« entschieden haben.
Unsere Bücher suchen wir mit sehr viel Liebe, Leidenschaft und Begeisterung aus und hoffen, dass sie Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern und Freude im Herzen bringen.
Wir wünschen viel Vergnügen.
Ihr »more – Immer mit Liebe« –Team
Über das Buch
Leas Leben als Kellnerin in Brooklyn scheint auf den ersten Blick eher langweilig, doch sie hat eine Vergangenheit, die sie sogar vor ihren Freunden und Kollegen verbirgt. Als sie eines Abends Jackson begegnet, scheint diese Vergangenheit sie einzuholen. Sie kann nur erahnen, wie gefährlich er für sie ist. Wie gefährlich es ist, etwas für ihn zu empfinden … Doch dann offenbart sich ihr, dass alles noch viel schlimmer ist. Wie kann sie den Feind lieben? Den Mann, der für sie den Untergang bedeutet?
Lea rennt um ihr Leben – und fürchtet nichts mehr, als Jackson für immer zu verlieren …
Erster Teil der Trilogie um Lea und Jax. Wir empfehlen die Titel in der richtigen Reihenfolge zu lesen.
Der Titel erschien vormals unter »Obsessed – Verführung« unter dem Pseudonym Tiffany Jones.
Über Ava Jordan
Ava Jordan wuchs in Westfalen auf. Nach einigen Jahren im Rheinland kehrte sie in die Heimat zurück und bewohnt dort nun mit ihrem Mann und unzähligen Büchern ein kleines Häuschen. Sie schreibt und übersetzt schon sehr lange und kann sich ein Leben ohne das Schreiben einfach nicht vorstellen.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
https://www.aufbau-verlage.de/newsletter-uebersicht
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
Impressum
Ava Jordan
Deep – Verführt
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
Impressum
1. Kapitel
»Kommst du nachher noch mit, was trinken?«
Meine beste Freundin und Kollegin Eleni beugt sich über den Tresen und lässt eine bonbonrosa Kaugummiblase platzen. Ich schüttele den Kopf und befülle weiter die Zuckerstreuer. Mein Blick geht zum hundertsten Mal in den letzten dreißig Minuten zur Wanduhr über der Tür des Diners. Viertel vor zehn. Noch fünfundvierzig Minuten bis zum Feierabend.
»Ach, Spielverderberin.«
»Ich bin müde, Eleni. Und morgen muss ich früh raus.«
»Na und? Wir sind nur einmal dreiundzwanzig. Und in drei Wochen bist du schon vierundzwanzig, schwupps, bist du dreißig und hast nicht gelebt.«
»Tisch 14.« Ich bin nicht nur eine Spielverderberin, sondern auch Schichtleiterin in »Jimmy’s Diner« in Williamsburg. In Sichtweite von Manhattan und doch Welten davon entfernt. Und als Schichtleiterin muss ich Eleni hin und wieder darauf hinweisen, wenn sie Gäste in ihrem Bereich übersieht. Das macht sie nicht mit Absicht. Sie quatscht einfach gerne.
»Herrje.« Eleni verdreht die Augen, wirft die blonde Lockenmähne über die Schulter und marschiert in ihrer knappen Uniform zu Tisch 14, an dem drei Typen mit Schlapphüten und Cordhosen Platz genommen haben. Typische Einwohner von Williamsburg also. Möchtegern-Künstler ohne Sinn für Ästhetik.
Ich schraube die Zuckerspender zu und drehe mit der Kaffeekanne die übliche Runde durch den Raum. Um diese Tageszeit ist nicht viel los, und darüber bin ich froh. Meine Füße schmerzen. Ich sehne mich nach meinem Bett. Noch fünfunddreißig Minuten.
Die Tür geht auf, die Glöckchen tanzen wild, und zwei weitere Gäste betreten das Diner. Ich begrüße sie und schaue mich nach Eleni um. Die neuen Gäste setzen sich in eine der Nischen und legen die dicken Schals und Mützen ab. Draußen herrscht der New Yorker Winter mit Schnee und Eiseskälte.
Und ich kann gerade nur darüber nachdenken, was das für meine Heizkosten und damit für mein Konto bedeutet.
Weil Eleni mit den Jungs von Tisch 14 flirtet – wahrscheinlich müssen die drei später mit ihr um die Häuser ziehen –, zücke ich meinen Block, schnappe mir zwei Speisekarten und kümmere mich um ihre anderen Gäste.
»Guten Abend und willkommen in ›Jimmy’s Diner‹.« Ich lächle die beiden Männer tapfer an. Der eine starrt nur auf sein Smartphone, aber der andere blickt zu mir auf und … holy shit, was für wahnsinnig braune Augen!
Ich starre ihn an. Er schaut zurück, und dann sagt er: »Hi!« Eine Stimme wie der flüssige Kern eines warmen Schokoladentörtchens.
»Hi«, erwidere ich. Mir werden die Knie gerade puddingweich und ich fürchte, ich muss mich gleich am Tisch festhalten. Himmel, wie kann ein Mann so wahnsinnig sanfte braune Augen und so eine Stimme haben?
»Bestell mir nen Käsekuchen, der soll hier der beste von New York sein«, sagt sein Kumpel, ohne vom Smartphone aufzublicken. »Und Kaffee, Alter. Ich übersteh die Nacht nicht, wenn ich keinen ordentlichen Kaffee kriege.«
Mr. Brown Eyes lächelt.
Und jetzt auch noch dieses Lächeln … Fast ein bisschen schüchtern wirkt er. Dabei hat er dafür nun wirklich keinen Grund. Er sieht verdammt gut aus. Ebenmäßige Gesichtszüge, gebräunter Teint, ein gepflegter Dreitagebart. Die schwarzen Haare trägt er lässig aus dem Gesicht gekämmt, und sie sind eine Spur zu lang, um modern zu sein.
Wäre ich eine Heldin im Liebesroman, würde ich jetzt mindestens in Ohnmacht fallen.
Aber ich bin Lea, Schichtleiterin in »Jimmy’s Diner« in Williamsburg, einem hippen Restaurant, das mit seinem Ambiente die Besucher direkt in die Fünfzigerjahre katapultiert. Wir servieren Kaffee aus Glaskannen, dürfen mit offenem Mund Kaugummi kauen und reden die Gäste mit »Schätzchen« an. Die Leute lieben den Laden, sie lieben unseren Käsekuchen, die Burger mit Fritten und die Glaspitcher, aus denen wir eiskaltes Bier ausschenken.
»Du hast meinen Freund gehört. Zweimal Käsekuchen und extra starken Kaffee, bitte.«
»Kommt sofort.« Ich nehme die Speisekarten wieder mit und gehe zurück hinter den Tresen. Eleni stürmt an mir vorbei in die Küche und gibt ihre Bestellung bei Jimmy auf. Hier steht der Chef noch persönlich am Herd. Kochen war immer schon seine Leidenschaft, und das sieht man ihm auch an. Aber er hat das Gemüt eines satten Bären und für ihn zu arbeiten, ist echt ein Vergnügen. Die Bezahlung ist fair und das Arbeitsklima stimmt auch. Was will man mehr?
Eleni gibt ihre Bestellung zuerst in den Kassencomputer ein, der die Bons dann direkt bei Jimmy und seinen Köchen auswirft. Ich stehe neben ihr.
»Hast du etwa meinen Tisch übernommen?«, fragt sie, als ich beginne, die Bestellung von Mr. Brown Eyes einzugeben.
»Du warst ja mit den drei Hipstern beschäftigt.«
»Pffft. Hab dich nicht so.«
Ich vergaß zu erwähnen: Der einzige Dickkopf an Bord ist Eleni. Aber nur, wenn sie hungrig ist. Sie behauptet dasselbe übrigens von mir.
»Diese Typen sind neu in der Stadt. Total süß. Wenn du wirklich gleich schon nach Hause willst, ziehe ich mit denen noch los.«
Ich mache eine Handbewegung, die alles oder nichts heißen kann. Vor allem heißt sie: Tu, was du nicht lassen kannst. Ich halte dich nicht auf.
Das kann nämlich keiner.
Eleni steht immer unter Strom. Sie ist die Flippige, die dank ihrer fröhlichen, offenen Art das meiste Trinkgeld kassiert und darum viel besser über die Runden kommt als ich.
Darf ich präsentieren? Lea, die schlechteste Kellnerin New Yorks. Meine Haare sind immer wie ein Haufen wilde, müde Spaghetti mit Tomatensauce, genauso rot und mindestens so klebrig. Ist mir ein Rätsel, wie Eleni es schafft, ihre blonde Lockenmähne auch nach einer Zehnstundenschicht noch so fluffig aussehen zu lassen. Meine Haare machen die Küchendämpfe fertig. Und das Haarfärbemittel. Außerdem fühle ich mich in der kurzen Uniform an schlechten Tagen unwohl, weil ich das Gefühl habe, alle starren mich an. Aber was will man machen – Jimmy mag mich, er hat mich zur Schichtleiterin gemacht, obwohl (oder gerade weil?) die Gäste nicht so auf mich fliegen. Ich bekomme zwei Dollar mehr pro Stunde und kann damit doch nicht annähernd ausgleichen, was Eleni an Trinkgeld zusätzlich kassiert. Die Welt ist ungerecht. Sie hat das Charisma eines übersprudelnden Springbrunnens, und ich erinnere mit meiner ruhigen Art wohl eher an einen Waldsee. So einen modrigen, gräulich schwarzen, den niemand beachtet.
»Okay, dann ziehe ich mit denen noch um die Häuser.«
Ehe ich weiß, wie mir geschieht, hat Eleni meinen Block geschnappt und tippt auch meine Bestellung ein. Ich schaue zur Uhr: noch achtzehn Minuten.
Mir ist es egal, dass sie jetzt die beiden Männer auch bedient. Schade um Mr. Brown Eyes, denke ich. Mit dem hätte ich gerne geflirtet.
Aber ich flirte nicht. Das ist nicht meine Art. War es noch nie, und seit ich hier arbeite, halte ich vor allem meinen Kopf unten und versuche, nicht aufzufallen. Früher war ich anders. Aber die Lea von früher gibt es nicht mehr. Die Lea von früher ist vor acht Monaten gestorben.
Und an einem Mittwochabend im Februar kurz vor meinem Schichtende werde ich diese Lea bestimmt nicht wieder auferstehen lassen.
Die letzten Minuten unserer Schicht vergehen wie im Zeitlupentempo. Ich stehe wieder hinter dem Tresen und kann Mr. Brown Eyes nicht aus den Augen lassen.
Sein Kumpel hat die beiden Stücke Käsekuchen in Nullkommanix verdrückt. Eleni hat beiden Kaffee nachgeschenkt und dreht eine letzte Runde. Eine Gruppe Anzugtypen ist noch gekommen und sitzt an einem der großen Tische. Sie bestellen Burger und Bier. Die Anwälte kommen aus einer der Kanzleien auf der anderen Seite der Brücke. Das erkenne ich sofort. Investmentbanker verirren sich nicht zu uns. Anwälte schon. Bei denen sind wir eine Art Geheimtipp, und diese hier gehören zu unseren Stammgästen. Einer ist neu in der Runde, und er schaut zu mir rüber.
Ich entspanne mich und versuche, durchzuatmen.
Alles in Ordnung. Du kennst die Männer, und heute ist nur ein neuer Kollege dabei. Du brauchst keine Angst zu haben.
Außerdem sieht auch sein Anzug teuer aus. Ich fürchte mich nicht vor Männern mit teuren Anzügen. Eher vor denen, die so billige, schwarze Polyesteranzüge tragen. Dazu eine schmale, schwarze Krawatte. Die zwanzig Meter gegen den Wind nach FBI riechen. Vor denen würde ich sofort weglaufen.
Trotzdem jagt mir jeder Anzugtyp eine Wahnsinnsangst ein. Dabei kann die Gefahr überall lauern. Meine Nervosität, die mir im letzten Dreivierteljahr mehr als einmal das Leben schwer gemacht hat, ist inzwischen nur noch anstrengend. Es ist nichts passiert. Keine meiner schlimmsten Befürchtungen trat ein. Ich bin ein wildes Tier, das jeden Moment aufspringen und rausrennen könnte, hinein in den Dschungel dieser Großstadt. Es hat lange gedauert, bis ich diesen Job machen konnte, ohne die halbe Schicht unkontrolliert zu zittern. Aber ich brauche den Job, und darum habe ich mich auch daran gewöhnt, ständig auf der Hut zu sein.
Bis ich mich davon überzeugt habe, dass mir keine Gefahr droht.
Ob Mr. Brown Eyes auch manchmal Anzug trägt? Jetzt sieht er ganz harmlos aus – grauer Kaschmirpullover, eine dunkle Stoffhose, Sneakers. Alles vom Feinsten, dafür habe ich einen Blick. Richtig, richtig teuer. Nichts, was sich ein Automechaniker oder ein Fabrikarbeiter leisten kann.
Sein Begleiter ist da ganz anders. Der trägt ein altes, graues T-Shirt und eine Jeans, die schon fast in Fetzen hängt. Die Bikerboots, die er unter dem Tisch hervorstreckt, sind mindestens fünf Jahre alt und sehen aus, als hätte er sie in der ganzen Zeit nie ausgezogen. Na ja, nachts vielleicht. Ich will ihm ja nichts unterstellen. Außerdem sieht er ungepflegt aus. Als hätte Mr. Brown Eyes ihn gerade von der Straße aufgesammelt.
Jetzt schaut Mr. Brown Eyes hoch. Eleni guckt gerade in seine Richtung, doch er schüttelt unmerklich den Kopf. Dann dreht er sich zum Tresen um, entdeckt mich dort und hebt die Hand.
Nur widerwillig gehe ich zu ihm.
»Die Rechnung, bitte.«
»Ja, natürlich …« Ich bleibe wie angewurzelt vor seinem Tisch stehen und starre ihn an.
Er lächelt. »Ist noch was?«
Außer, dass ich keinen Ton herausbringe, weil mein Herz bis zum Hals schlägt und ich mir wünsche, er würde es hören? Außer, dass ich mich danach sehne, ihm irgendwie näherzukommen? Was so ziemlich das Absurdeste ist, was ich in so einer Situation empfinden könnte. Aber ich möchte ihn nach seinem Namen fragen, nach seiner Adresse, ich möchte seine linke Hand in meine nehmen, weil ich wissen will, ob er einen Ehering trägt. Oder ist er einer dieser Männer, die es nicht nötig haben, einen Ring zu tragen, weil für jeden offensichtlich ist, dass dieser Mann bereits die Frau oder den Mann fürs Leben gefunden hat?
»Die Rechnung?«, stottere ich.
»Genau. Können Sie sie bringen?« Er lächelt nachsichtig.
Ich nicke wie betäubt. Gehe zurück zum Tresen, gebe die Tischnummer ein und ziehe den Kassenbon. Ich lege ihn auf ein kleines Tablett, zusammen mit zwei quietschbunten Kaubonbons in neonpinkem Einwickelpapier, und trage es an den Tisch. Auch das ist »Jimmy’s Diner« – hier gibt’s noch einen süßen Absacker für die Gäste. Bisher fand ich das eine charmante Idee, aber bei Mr. Brown Eyes finde ich es absolut albern und unnötig. Hastig schiebe ich die Bonbons in meine Rocktasche, ehe ich ihm das Tablett hinschiebe.
»Danke.« Er sieht nicht auf, sondern hat seine Geldbörse gezückt und zählt das Geld ab. Ich drehe mich um und gehe. Eleni kommt mir entgegen, und wortlos nehme ich ihr die halbvolle Kaffeekanne ab.
»Zisch schon ab«, sage ich.
»Echt?« Eleni strahlt.
»Na klar. Hopp! Wir sehen uns morgen.«
»Ich kassiere grad noch für dich ab.« Sie nickt zu Mr. Brown Eyes, und ich folge ihrem Blick nicht.
»Brauchst du nicht, ich habe ihnen schon die Rechnung gebracht.«
Die Müdigkeit ist verschwunden. Gleich geht Mr. Brown Eyes, und danach beende ich meine Schicht und verlasse das Diner. Bis zu meiner Wohnung ist es ein Fußmarsch von zwanzig Minuten durch die klirrende Kälte. Danach werde ich völlig durchgefroren sein, und es wird noch mal eine Stunde dauern, bis ich die Wohnung und mich genug aufgewärmt habe, um schlafen zu können.
Das ist nicht das Leben, das ich mir gewünscht habe.
Doch es ist das einzige Leben, das ich führen kann.
Eleni hüpft an mir vorbei. Sie grinst breit. Offenbar gab’s von Mr. Brown Eyes ein extra dickes Trinkgeld. Na klar … Ich kriege weiche Knie, und sie kriegt die Kohle. Mir bleibt nur, hinter den Gästen den Tisch abzuräumen.
Mr. Brown Eyes und sein Kumpel, den ich heimlich Mr. Slack Ass getauft habe, weil ihm die Hose so locker um den Arsch hängt, stehen auf. Sie ziehen die Mäntel an, wickeln sich die Schals bis zur Nase um den Hals und verlassen das Diner. Eleni huscht an mir vorbei. »Gute Nacht!«, ruft sie. Draußen bleibt sie bei den beiden stehen und lässt sich von Mr. Slack Ass Feuer geben. Sie lachen zusammen, und Eleni plappert munter auf sie ein.
Und ich stehe hier drin, ein vollbeladenes Tablett mit dreckigem Geschirr in den Händen. Alles in mir schreit danach, es einfach auf den nächsten Tisch zu knallen, nach draußen zu stürmen und Mr. Brown Eyes bei der Hand zu nehmen. Ihm etwas ins Ohr zu flüstern, das ihn lachen lässt. Mir würde schon was einfallen, das weiß ich ganz genau. Ich bin nicht dumm. Und im Flirten bin ich nicht so ungeübt, wie Eleni denkt. Sie zieht mich manchmal damit auf, dass ich seit acht Monaten in der Stadt wohne und noch kein einziges Date hatte. Für sie ist das ein Beweis dafür, dass ich nicht lebensfähig bin.
Dabei habe ich einfach nur Angst.
Angst, mich fallen zu lassen. Aber auch Angst, die Menschen zu verlieren, die ich liebe. Denn ich weiß, wie sich das anfühlt. Durch diese Hölle bin ich bereits gegangen, und ich bin noch nicht bereit, noch einmal alles aufs Spiel zu setzen. Denn das passiert, wenn man liebt: Man riskiert sein eigenes Leben. Ich will mich nie wieder so verlieren wie beim letzten Mal. Nie wieder so viel aufs Spiel setzen. Mein Leben. Mein Seelenheil. Nur um mit leeren Händen an einem Grab zu stehen und zu hören, wie jemand sagt, dass deine beste Freundin »ein guter Mensch« war und diesen Tod nicht verdient hat.
Diesen Tod hat niemand verdient.
Damals vor acht Monaten bin ich entkommen, mit knapper Not und heiler Haut. Doch unter der Haut bin ich versehrt. Ich habe einen hohen Preis gezahlt für das, was ich jetzt bin – eine unscheinbare, kleine Kellnerin in einem Diner, die ein winziges Zweizimmerapartment bewohnt und sich gerade so mit zwei Jobs über Wasser hält. Ich habe mich gerettet und mir damals geschworen, kein zweites Mal in eine Situation zu gelangen, in der mich allein der Schmerz am Leben erhält.
Mr. Brown Eyes ist ein Mann, in den ich mich Hals über Kopf verlieben könnte. Das spüre ich. Etwas zieht mich zu ihm, und ich kann mich gegen dieses Gefühl kaum wehren. Wie gut, dass er mit Eleni flirtet. Wie gut, dass er schon in wenigen Minuten aus meinem Leben verschwindet und niemals wieder auftaucht.
Die drei Hipster, die mit Eleni auf die Piste wollen, stehen auf und verlassen das Diner ebenfalls. Jetzt sind nur noch die Anwälte da. Sie bestellen mehr Bier. Als ich es ihnen bringe, bemerke ich etwas auf dem Tisch, an dem Mr. Brown Eyes und Mr. Slack Ass ihren Käsekuchen gegessen haben.
Auf dem Rückweg zum Tresen verlangsame ich meine Schritte. Ich schiebe die Papierserviette beiseite. Das Tablett mit der Rechnung liegt darunter, und unter der Rechnung liegen dort, fein säuberlich aufgefächert, fünf druckfrische Hundertdollarscheine. Und zusätzlich abgezählt die knapp 20 Dollar für zwei Stücke Cheese Cake und zwei Kaffee.
Fünf. Hundert. Dollar.
Im ersten Moment schockiert mich das Geld einfach nur. Ich meine, wer lässt denn einfach eine so unfassbar große Summe auf dem Tisch liegen? Und dann so hübsch aufgefächert, als sollte man es genau so finden …
Außerdem hatte ich gedacht, Eleni hätte schon kassiert. Und sie hätte sich so ein dickes Trinkgeld bestimmt nicht entgehen lassen. So viel bekommt man alle Jubeljahre mal, und danach fragt man sich meistens, welcher Filmstar das gerade war, der an dem Tisch gesessen hat, ohne dass man ihn erkannte.
Ich blicke hoch.
Mr. Brown Eyes steht noch draußen neben seinem Kumpel, der mit Eleni in eine angeregte Diskussion vertieft ist.
Er sieht mich an. Er sieht mich. Nicht Lea, die Kellnerin, sondern Lea, die Frau. Sein Blick spricht zu mir, und was er mir da gerade sagt, ist so unfassbar viel. Viel zu viel!, schreit alles in mir. Unmerklich schüttle ich den Kopf. Er nickt ermutigend. Darum mache ich einen Schritt zurück. Weg vom Tisch, weg vom Geld.
Ich bin nicht käuflich.
Das Geld könnte ich natürlich gut brauchen. Das ist mehr als die halbe Monatsmiete. Oder ich könnte mir endlich neue Winterstiefel kaufen. Oder ein paar Rechnungen bezahlen. Fünfhundert Dollar sind für mich ein kleines Vermögen.
Und deshalb lasse ich die Scheine liegen und nehme nur den anderen Betrag für die Rechnung.
Ich räume das Geschirr ab, bringe alles in die Küche und begrüße Nora. Sie übernimmt die Nachtschicht. Mit ihren fast 1,90 Körpergröße weiß sie sich zu wehren, falls ein Gast zudringlich wird. Aber die meisten Nachtschwärmer sind friedlich und suchen nur einen warmen Ort, wo sie sich aufwärmen und guten Kaffee trinken können. Eigentlich lohnt es nicht, 24 Stunden geöffnet zu haben. Trotzdem hält Jimmy an dieser Tradition fest. Vor allem in den letzten Wochen kamen oft Penner, die sich einen Dollar fünfzig aufgespart haben und sich in der Wärme für ein paar Stunden an einen Becher Kaffee klammern, den Nora immer wieder auffüllt. Sie knöpft ihnen das Geld ab, immer. »Wer nicht mal einen Dollar für den Kaffee aufsparen kann, hat hier nichts verloren«, sagt sie oft. Aber ich weiß, dass sie das Geld manchmal aus eigener Tasche bezahlt, wenn es sich einer überhaupt nicht leisten kann. Und es geht nicht darum, dass die Kasse stimmt. Für die Obdachlosen ist es eine Art Selbstverständnis, sich nicht von der Güte Noras aushalten zu lassen. Wenn sie ihnen etwas Geld auslegt, kommen sie ein paar Nächte später wieder und geben es ihr zurück.
Erwähnte ich, dass Jimmy schwer in Ordnung ist? Und Nora auch?
»Bist blass um die Nase, Zicklein.« Nora kneift mich in die Wangen. »«Hast du Gespenster gesehen da draußen?«
Ich schüttele stumm den Kopf. »Ich glaub, ein Gast hat sein Geld vergessen«, sage ich. »Es liegt auf Tisch 5.«
»Ist er schon lange weg?«
Ich kaue auf meiner Unterlippe. »Er stand eben noch mit seinem Kumpel draußen, aber …«
Nora seufzt. »Du bist mir wirklich ein Rätsel, Zicklein.« Sie stapft an mir vorbei aus der Küche. Durch die Glasscheibe in der Schwingtür beobachte ich, wie sie an Tisch 5 tritt. Sie nimmt das Geld, zählt es durch und schaut dann zu mir. Ich nicke hinter der Tür. Nora verlässt das Diner. Draußen haben sich inzwischen einige Leute um die Hipster und Eleni versammelt.
Mr. Brown Eyes und sein Freund sind verschwunden.
Nora unterhält sich mit Eleni. Dann fragt sie einen der Hipster etwas. Der schiebt sich verlegen den Hut in den Nacken und schaut sich nach allen Seiten um. Es geht ein paarmal hin und her, ehe Nora wieder reinkommt. Sie stapft den Schnee von den Stiefeln und kommt wieder nach hinten.
»Der war schon weg«, sagt sie. »Aber Eleni meint, wenn das Geld auf dem Tisch lag, war’s wohl für dich. Hat der Typ wohl gesagt – ›für die hübsche Kollegin mit den Honiglocken‹.« Sie schnaubt. Niemand ist schön in ihren Augen außer sie selbst. Vor Noras dunklen Augen können nur wenige Frauen bestehen. Und ich mit meinem geringen Gewicht schon gar nicht.
»Dann kann er mich ja nicht meinen«, versuche ich mich an einem Scherz. Honiglocken, also bitte! Karottenfransen passt besser.
Nora starrt mich finster an.
»Wann lernst du, dich so zu sehen, wie du bist?«, fragt sie.
Interessanterweise darf sie alle anderen kritisieren. Wenn man sich selbst in den Dreck zieht, wird sie stinksauer.
Ich habe eine Menge gelernt, seit ich mit Nora zusammenarbeite. Sie hat mir alles beigebracht, was eine Kellnerin wissen muss. Von ihr weiß ich, wie wichtig gutes Schuhwerk ist, um eine Schicht zu überstehen – und wo man die besten Schuhe bekommt. Sie hat mir Adressen von guten Wohltätigkeitsläden verraten, in denen ich gebrauchte Klamotten bekomme, wenn das Geld nicht reicht.
Aber eines braucht sie mir nicht beibringen – dass ich mich sehe, wie ich bin. Denn das tue ich, ganz bestimmt sogar.
Denn ich bin eine Verlorene. Eine Vergessene. Einst lebte ich in einer anderen Welt, in der ich Nora nicht mal mit einem Naserümpfen bedacht hätte. Ich hätte sie übersehen, weil sie nur eine Kellnerin ist. Meine Champagnergläser hätte ich achtlos auf ihr Tablett gestellt und hätte laut und künstlich gelacht, um meine Überlegenheit zu demonstrieren. Dabei fühlte ich mich schon damals unwohl mit meinem Leben.
Inzwischen schäme ich mich für dieses alte Ich. Dabei habe ich es abgelegt wie eine Schlange ihre Haut, die ihr zu eng wird. Das alte Leben wurde mir zu eng, und ich ließ es einfach auf der Straße liegen, die ich nach Osten ging.
Mich sehen, wie ich bin?
Das wird nie passieren.
Ich habe mich früher anders gesehen.
Ein anderes Leben. Viel zu weit weg, um für dieses eine Bedeutung zu haben.
Trotzdem scheint es mich nicht loszulassen … Die überhebliche Lea, die nur auf ihren Vorteil bedacht war. Stinkreich und verwöhnt. Damals waren 500 Dollar ein Taschengeld, das ich an einem Nachmittag auf den Kopf hauen konnte. Ich besaß Schuhe, die 500 Dollar pro Paar kosteten – dutzendweise! Nichts von alledem konnte ich in mein neues Leben retten. Mir sind nur Erinnerungen geblieben und ein paar Fotos, die ich in einem einbändigen Lexikon versteckt habe. Alles andere ist zu gefährlich.
»Na, wenn du das Geld nicht willst, ich nehm’s gern.« Nora macht Anstalten, es in den Ausschnitt ihrer Bluse zu stopfen. Doch ich nehme ihr die fünf Hunderter ab und schiebe sie in meine Rocktasche. Dann gehe ich zurück in den Gastraum und wische die Krümel vom Tisch und räume die Papierserviette und das Tablett ab.
»Feierabend, mh?« Jimmy kommt aus der Küche. Er sieht müde aus. Von morgens bis abends steht er ununterbrochen am Herd, kocht, brät und bäckt all die Köstlichkeiten, die das »Jimmy’s« in unserem Viertel so berühmt gemacht haben. Er streicht über das fleckige T-Shirt, das sich über dem dicken Bauch spannt, und sieht sehr zufrieden aus.
»War heute wieder ein langer Tag«, sage ich.
»Hast dich gut eingefunden«, meint er unvermittelt. »Bist ne Gute.«
Ich lächle schmal. Wenn er wüsste … »Bis morgen«, sage ich.
Er brummt und zieht aus dem Kühlschrank eine Flasche Coke. Die Anwälte rufen nach Nora, die sofort losläuft. Obwohl sie weit über fünfzig ist, ist sie echt flink unterwegs und ihr Selbstbewusstsein beeindruckt wirklich jede und jeden.
»Na Jungs, was kann ich euch denn noch bringen?«
Die Anzugtypen johlen. Bei einem Pitcher wird’s nicht bleiben, und sie werden Nora großzügig mit Trinkgeld bedenken. Das finde ich okay; nachts gibt’s eh kaum was zu holen. Ich gönne es ihr.
Hinter der Küche führt ein schmaler Gang zum Personalraum. Ich betrete das Kabuff und schließe meinen Spind auf. Rasch schlüpfe ich aus dem Rock und steige in die verwaschene, schwarze Jeans. Den naturweißen Rollkragenpullover von der Wohlfahrt, der nur ein winziges Loch hat, ziehe ich direkt über die knappe Bluse. Dazu die alten Bikerboots statt der flachen Halbschuhe. Das einzige Paar Schuhe, das ich mitgenommen habe. Sie sind inzwischen ziemlich hinüber, weil ich sie täglich trage.
Neue Stiefel, überlege ich. Oder doch lieber einen Wintermantel? Was werde ich mir von den 500 Dollar gönnen?
Ich nehme die kurze Daunenjacke vom Haken im Spind und schnappe mir die Umhängetasche. Den Schal wickle ich dreimal um Hals und Gesicht und streife zum Schluss fingerlose Handschuhe über. In der Jackentasche taste ich nach meinem wichtigsten Utensil – der Schlagring ist noch da. Für einen Moment erlaube ich mir, die Erleichterung zu spüren, die dieses Gewicht in meiner Hand bedeutet. Dann schiebe ich die Finger durch die Öffnungen. Die Hand schließt sich um diese effektive Waffe.
Williamsburg ist bestimmt nicht die sicherste Gegend von New York, aber es gibt schlimmere. Bisher hat niemand versucht, mich anzugreifen. Aber falls so was passiert, bin ich vorbereitet. Weil alles andere fahrlässig wäre. Wenn mich jemand angreift, geht es um Leben und Tod.
Die Tür zum Flur geht auf, und ich fahre herum. Doch es ist nur Zuko, einer der Köche. Er nickt mir stumm zu und geht zu seinem Spind.
Ich entspanne mich. Alles in Ordnung. Zuko tut mir nichts.
Er holt ein Päckchen Zigaretten aus dem Schrank und hält es mir stumm hin. Ich schüttle den Kopf. Das ist inzwischen eine Art Ritual geworden. Wann immer ich in der Nähe bin, wenn er eine seiner Raucherpausen macht, bietet er mir eine Zigarette an. Und ich lehne immer ab.
Vielleicht ist er irgendwie vergesslich. So langsam könnte er ja kapieren, dass ich Nichtraucherin bin.
Mit der linken Hand schiebe ich den Schultergurt der Umhängetasche über den Kopf. »Gute Nacht«, sage ich. Zuko nickt nur, hebt die Hand mit dem Zigarettenpäckchen und starrt auf sein Smartphone in der anderen Hand.
»Gute Nacht, Nora!«
»Gute Nacht, Zicklein! Denk dran, morgen hast du frei!«
»Wie könnte ich das vergessen? Wir sehen uns Samstag.«
Nora schwebt an mir vorbei zu einem Tisch in der Ecke. Dort sitzt Rasputin, einer der nächtlichen Dauergäste, der so heißt, weil er einen pechschwarzen Vollbart hat, der ihm bis auf die Brust reicht. Er bekommt von Nora einen Becher heißen Kaffee und einen Muffin vom Vortag vorgesetzt.
Ich trete in die eiskalte Nachtluft. Der Schnee knirscht unter meinen Stiefeln, und mein Atem steigt als weißer Dampf von meinen Lippen auf. Sofort beginnt meine Gesichtshaut unangenehm zu brennen. Ich bin diese Kälte einfach nicht gewohnt. Ich komme aus Los Angeles. In Kalifornien gibt es keine Jahreszeiten. Jedenfalls keine so kalten wie hier an der Ostküste.
Aber es musste ja unbedingt New York sein.
Ich habe mich bewusst für diese Stadt entschieden, weil sie groß ist. Weil ich hier untertauchen kann. Weil ich mich ein wenig auskenne, aber mich niemand kennt. Sie ist ideal, um im Hintergrund zu verschwinden. Eine Kellnerin, die keiner sieht. Mehr will ich nicht sein.
Als ich Schritte hinter mir höre, drehe ich mich nicht um. Scheinbar lässig ziehe ich die Kapuze meiner Jacke über den Kopf. Meine Finger schließen sich fester um den Schlagring, und ich ziehe die Hand aus der Jackentasche. Es sollen schon Passanten überfallen worden sein, die einen Schlagring hielten und ihn im Eifer des Gefechts nicht aus der Jackentasche bekamen. Das passiert mir nicht. Ich bin vorbereitet. Was auch geschieht, ich kann mich wehren.
Die Schritte nähern sich schnell. Derjenige läuft nicht, aber er ist eindeutig schneller als ich. Noch dreißig Meter bis zur nächsten Straßenecke. Dort kann ich vielleicht einen Blick riskieren, wenn ich um die Ecke biege.
Zwanzig Meter. Ich werde nervös und beschleunige meine Schritte.
Fünfzehn Meter. Inzwischen bin ich überzeugt, dass mein Verfolger fast rennt. Dass er mich wirklich verfolgt, und ich mir das nicht nur einbilde.
Zehn Meter. Unwillkürlich halte ich die Luft an. Wenn ich mich jetzt umdrehe, kann ich ihn vielleicht erkennen. Aber vielleicht ist er bewaffnet. Gegen eine Pistole habe ich keine Chance. Gegen einen Baseballschläger vielleicht. Wenn es nur ein Junkie ist, der versucht, mir die Geldbörse zu klauen, muss ich nur Geduld haben. Junkies stellen keine Gefahr dar – jedenfalls nicht, wenn ich auf einen Angriff vorbereitet bin.
Und wenn mein schlimmster Alptraum wahr wird, habe ich vermutlich ohnehin keine Chance.
Fünf Meter. Mein Körper spannt sich an. Ich kann das. Ich habe Kurse besucht, in denen ich Selbstverteidigung gelernt habe. Ich muss mich nur an das erinnern, was ich durch hundertfache Wiederholung verinnerlicht habe.
Drei Meter.
Und da passiert es.
Ich habe das Gefühl, an der Schulter gepackt und herumgerissen zu werden. Im selben Moment reiße ich den Schlagring nach oben und ziele bewusst auf die Augenhöhle meines Angreifers. Das kann schlimmstenfalls den Verlust seines Augenlichts mit sich bringen. Dessen bin ich mir bewusst. Aber wer Frauen auf offener Straße angreift, hat meiner Meinung nichts Besseres verdient.
Er ist kleiner als ich gedacht habe, weshalb mein gerade ausgeführter Schlag nicht sein Auge trifft, sondern nur die Schläfe streift. Aber auch das genügt, um ihn sofort außer Gefecht zu setzen. Er sieht mich ungläubig an, macht den Mund auf und verdreht die Augen, weil mein Schlag bei ihm alle Lichter ausbläst. Dann kippt er einfach um und bleibt liegen.
Ich trete näher. Das ist natürlich vollkommen falsch. In den Kursen haben sie uns immer eingeschärft, den Angreifer niederzuschlagen und dann schleunigst das Weite zu suchen, um einem zweiten Angriff zu entgehen. Aber von diesem hier habe ich nichts zu befürchten. Ich habe ihn ordentlich erwischt.
Er stöhnt und will sich aufsetzen, kippt aber sofort wieder nach hinten weg. Ich bleibe stehen, den Schlagring erhoben, um jederzeit ein zweites Mal zuzuschlagen. Übelkeit steigt in mir hoch, und ich drehe mich hastig um und übergebe mich in den Rinnstein. Da ich den ganzen Tag kaum was gegessen habe, kommt bald nur noch saure Galle. Ich stütze die Hände auf die Knie und versuche, wieder zu Atem zu kommen.
Lauf weg!, rede ich mir ein, doch die Neugier ist stärker. Ich richte mich auf und baue mich vor meinem Angreifer auf, der sich jetzt auf die andere Seite wälzt.
Und jetzt erkenne ich ihn.
Mr. Slack Ass!
»Scheiße«, murmle ich. Das hat mir gerade noch gefehlt.
Er versucht wieder, sich aufzusetzen, und diesmal klappt es einigermaßen. Ich weiche zwei Schritte zurück, während er sich an der Hauswand hochzieht und benommen den Kopf schüttelt. Er sieht sich suchend nach mir um.
Jetzt sollte ich spätestens weglaufen. Doch ich bleibe stehen.
Es beginnt zu schneien.
»Scheiße, ey!« Er berührt die Schläfe und zieht die Hand zurück. Blut klebt an seinen Fingern. Er hat ganz schön was abgekriegt, aber offensichtlich ist er nicht so leicht außer Gefecht zu setzen. Komisch. Er sieht gar nicht so aus, als könnte er einstecken.
Ich hole mein Handy aus der Hosentasche. Es ist ein altes Wegwerfhandy, das ich gebraucht gekauft habe und mit einer bar bezahlten Prepaidkarte benutze. Alle vier Wochen schmeiße ich die alte Prepaidkarte weg und kaufe eine neue. Das ist umständlich, gehört aber zu den zahlreichen Vorsichtsmaßnahmen, die ich ergreifen muss.
Wenn ich mich nicht schütze, tut es keiner.
»Was machst du da?«, fragt er.
Ich zögere. Ich sollte die Polizei rufen. Er hat mich angegriffen, und solange er noch groggy ist, kann ich ihn in Schach halten.
Aber wenn ich die Polizei rufe, wird sie Fragen stellen. Meine Personalien aufnehmen. Mein Name wird ins System eingegeben.
Vielleicht geht dann auf der anderen Seite des Landes ein Alarm los.
Und dann wäre ich in New York nicht länger sicher.
Ich stecke das Handy wieder ein und wende mich zum Gehen.
»Ey!«, ruft er hinter mir her. »Du kannst nicht einfach verschwinden!«
Ich verlangsame meine Schritte. Jetzt wird’s richtig abgefahren. Er überfällt mich, und als ich verschwinden will, macht er einen Aufstand?
»Jax schickt mich.«
Ich bleibe stehen.
»Wer ist Jax?«, rufe ich über die Schulter.
»Mein Kumpel. Wir …« Er keucht. »Wir waren vorhin im Diner. Du hast uns bedient. Er hat 500 Dollar auf dem Tisch liegengelassen.«
Darum geht’s also.
Ich zögere. Er hat Eleni gesagt, das Geld sei für mich. Offensichtlich war das nur eine Masche.
Nun gut, dann eben keine neuen Stiefel. Keinen Wintermantel. Es wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein.
Ich gehe die fünf Schritte zurück zu ihm und ziehe im Gehen den Reißverschluss meiner Jacke auf. Die fünf knisternden Scheine habe ich vorhin in meine Bluse gesteckt, als ich mich umzog, und sie schmiegen sich an meinen linken Busen. Ich ziehe sie unter dem Pullover hervor und werfe sie ihm hin.
»Du hättest auch einfach fragen können.«
»Wollte ich, aber da hast du mir schon den Schlagring übergezogen.« Er grinst schief. »Jax will …«
Ich drehe mich um und gehe. Ist mir scheißegal, was dieser Jax will oder nicht will. Er hat seine 500 Dollar wieder und soll mich gefälligst in Ruhe lassen.
Mr. Slack Ass ruft irgendwas hinter mir her, aber da bin ich schon um die Ecke gebogen. Ich beschleunige meine Schritte, und weil ich befürchte, dass er mir folgt, verfalle ich in einen leichten Trab. Die Kapuze rutscht mir vom Kopf, und der eisige Wind packt meine Haare und gräbt sich schmerzhaft in die Gesichtshaut.
Zum Glück ist es nicht mehr weit.
Erst als ich die Stufen zur Haustür des schmalen Apartmenthauses hochsteige, spüre ich das Zittern meiner Knie. Der Adrenalinrausch nach einer bedrohlichen Situation. Mit letzter Kraft schleppe ich mich durchs Treppenhaus bis in den vierten Stock und schließe die Tür zu meiner Wohnung auf. Ich lasse das Licht aus und taste mich im Dunkeln bis zum Sofa vor. Dort breche ich zusammen. Ich streife nicht mal die Stiefel ab, obwohl der Straßendreck mich morgen früh wahrscheinlich unendlich nerven wird. Vom Fußende der Couch ziehe ich die löchrige Häkeldecke bis ans Kinn und schließe die Augen.
Schlafen. Vergessen. Retten.
2. Kapitel
Aufwachen. Erinnern. Fliehen.
Ich schrecke am nächsten Morgen hoch und weiß einen kurzen Moment nicht, wo ich bin. Mir ist kalt. Gestern Abend habe ich vergessen, die Heizung einzuschalten, und durch die undichten Fenster pfeift ein eisiger Ostküstenwind.
Richtig munter werde ich schlagartig, als ich in die Küche schlurfe und auf die Uhr schaue. Ich starre ungläubig auf die angezeigte Uhrzeit. Dann fluche ich und renne in das winzige Schlafzimmer, in dem nur Bett und Kommode Platz haben.
Ich hätte vor einer halben Stunde schon in Manhattan sein müssen!
Während ich mich aus den Klamotten vom Vortag schäle, suche ich die Nummer von Catherine raus. Sie geht nach dem zweiten Klingeln dran.
»Lea! Kommst du bald?« Sie klingt genervt.
»Es tut mir leid, ich hab verschlafen!«, rufe ich. Aus dem Schrank greife ich blind eine neue Jeans und einen Pullover. Ich höre Catherine zetern. »Bin in einer Stunde da!«
Bevor sie mich feuern kann oder etwas anderes sagt, das wir beide anschließend bereuen, drücke ich sie weg und stürze zur Tür. Die Stiefel habe ich die ganze Nacht getragen, und rennen kann ich damit auch nicht. Darum schlüpfe ich jetzt in ein Paar Sneaker – das dritte Paar Schuhe, das ich neben den Bikerboots und meinen flachen Arbeitsschuhen besitze – und verlasse die Wohnung.





























