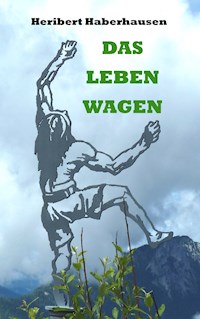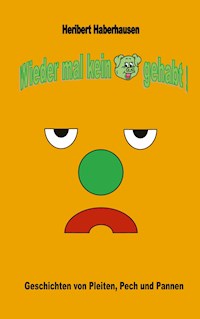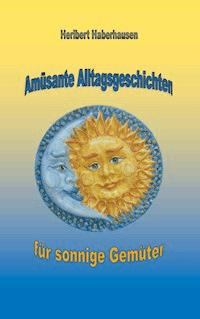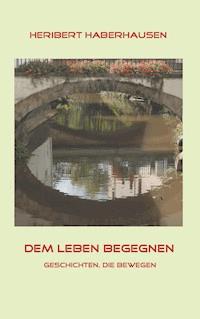
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Menschen lieben Geschichten. Menschen brauchen Geschichten. Wir nutzen sie, um uns selbst und unsere Umwelt zu verstehen. Die kurzen Geschichten, schicksal- oder gleichnishaft, denkwürdig oder heiter, führen Lebenssituationen vor Augen, die uns in unserem Menschsein berühren und zu Sinnfragen des Lebens anregen. Dem Leben begegnen kann man in der Natur, in anderen Menschen, auf der Suche nach Gott . Die Geschichten beschreiben, wie man Menschlichkeit und Miteinander vorlebt, Größe und Güte zeigt, Vorurteile abbaut und Vertrauen schenkt. Sie zeigen Wege, wie man die Natur bewahrt, Kinder respektiert, Senioren achtet, sein Schicksal erträgt, seinen Glauben festigt. Das Buch ist gedacht für die Gemeinde-, Jugend- und Seniorenarbeit, ist ein Beitrag zu einem aufgeklärten, kompetenzorientierten, modernen Religionsunterricht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 294
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jede Schneeflocke und jedes Enkelkind haben etwas gemeinsam. Sie sind einzigartig.
Meinen Enkelkindern
Marli, Joshua und Luzie
Was ist schöner, als mit den Augen der Enkelkinder die Welt neu zu entdecken.
Inhalt
Vorwort
Menschlichkeit beweisen
Überbrückt
Vögel in unserem Kopf
Mit-leid
Willkommenskultur
Geburtstag eines Kindes
Schön wäre es
Den Bruder sehen
Wärmegewitter
Diebstahl
Ein Leben lang
Ein Auge zudrücken
Zwei Gesichter
Kreuzigung
Mitfühlende Herzen
Größe zeigen
Wolf und Schaf in einer Person
Verzeihen
Ein Stadion schweigt
Leidenschaft
Vom Saulus zum Paulus
Tauwetter
Aufgestiegen
Einander respektvoll begegnen
Lebensnotwendig
Auf der Suche
Mut zur Ehrlichkeit
Geschnitten
Die Welt verändern
Leben lernen
Carpe diem
Herzenswunsch
Fehlpass
Auf die innere Stimme hören
Zwangsurlaub
Der Weg ist das Ziel
Ein Spiel mit Gefühl
Versuchung
Vanity Fair
Versäumnis
Von Herzen
Mit dem Sturm segeln
Nasreddins Rat
Drei Wochen ohne
Reif werden
Zufriedenheit schätzen
In die Hände des Schöpfers legen
Glücklicher Pedro
Unser tägliches Brot gib uns heute
Bereit sein
Sich begegnen
Grenzenlos
Kultstätten
Kostbar und kostenlos
Eine Augenweide
Zuhause ankommen
Muttertag
Wann bin ich glücklich?
Vorbildern folgen
Hundert Mal an einem Morgen
Vorbildhaftes Herzstück
Ausgezeichnet
Gegenseitig helfen
Einer trage des anderen Last
Er war glücklich
Der größte Schatz
Zwei Engel
Ich lasse Rosen regnen
Nutze die Zeit
Der Morgen erwacht
Wir brauchen viel mehr
Prozession
Familienleben bewahren
Ein Kardinalfehler
Tapfer
Wir
Unser ganzer Stolz
Es ist alles relativ
Gefunden
Viel gelernt an einem Tag
Worte wie Rauch im Wind
Ihr zweites Leben
Dankbarkeit lernen
Kommafehler
Die Hoffnung stirbt nie
Zwei Herzenswünsche
Digitaler Stubenarrest
Von Kindern lernen
Wer lernt von wem?
Nur Kinder
Menschlichkeit als Brücke
Wenn ihr einmal alt seid
Mehr als ein Geschenk
Fantasie und Staunen nicht verlernen
Mehr hat er nicht zu sagen
Gewinn durch Verzicht
Machen wir den Anfang
Momente des Innehaltens
Weckruf eines Kindes
Mit offenen Augen
Wahre Freundschaft
Ein besonderes Ferienerlebnis
Das Schicksal ertragen
Salomonische Tat
Verurteilt – zu Recht?
Geteiltes Leid
Höchststrafe
Verkauft!
Eine Brücke für unsere Träume
Unbedeutende Meldung
An den Pranger gestellt
Geburtsstunde
Lachen und Weinen sind Zwillingsbrüder
Entführt
Er hält sein Versprechen
Ohne Stachel
Zum Betteln verdammt
Nichts dabei gedacht
Die Natur achten
Des Schöpfers Fehler
Leiser Tod
Fingerzeig der Natur
Verschenktes Leben
Fürsorglich
Vorbild Natur
Ein Zoobesuch anderer Art
Herdentrieb
Woran der Zaunkönig erinnert
Arme Leute, so reich
Verstehen
Geschwisterliebe
Missachtete Gabe
Glauben festigen
In allem Gott verherrlichen
Gott preisen immerdar
Beten heißt
Man weiß es nicht
Hilft beten?
In Gottes Hand
Gott suchen
In terra pax hominibus
Hoffnungsschimmer
Beeindruckend
Auf Gottes Gerechtigkeit bauen
Nur Glück gehabt?
Stille als Weg
Vollkommenheit als Ziel
Dem Tod begegnen
Beistand
Auf der Durchreise
Oma lebt weiter
Ewiges Band
In Frieden ruhen
Lebenslicht
Es gibt keinen Tod
Was uns der nächtliche Sternenhimmel sagt
Geld für den Fährmann
Den Tod überlebt
Ihr seid viel mehr
Ein Stück voraus
Der Tod vom Leben überwunden
Vorwort
Weißes erkennt man besser, wenn man Schwarzes dagegen hält.
(Martin Luther)
Die chinesische Philosophie kennt die Lehre von Yin und Yang. Yin bedeutet „schattige Uferseite des Flusses“, Yang „sonnige Uferseite des Flusses“.
Von einer Seite des Ufers zur anderen führen oft Brücken. Im Gegensatz zu Mauern überwinden sie Klüfte, sind Symbol für Verbindung und Versöhnung. Bei der Einweihung einer Brücke im Nordwesten Norwegens, eine wichtige Verbindung zu Russland, wurde erstmalig kein Band zerschnitten, sondern man knüpfte zwei Bänder zusammen.
Auf der Rückseite aller Euro-Scheine ist eine Brücke abgebildet. Sie steht für den Willen, die Länder, Völker und Kulturen, vor allem die Menschen Europas einander näherzubringen. Gegensätze bestehen in der europäischen Gemeinschaft, existieren zwischen den Menschen, sind in jedem von uns, aber nicht unüberbrückbar.
Yin und Yang zeigen bildhaft diese Gegensätze, das schwarze Yin steht für Dunkelheit und Männlichkeit, Härte und Aktivität, für Sorgen, Leid und Gegeneinander. Das weiße Yang meint Helligkeit und Weiblichkeit, Weichheit und Passivität, Freude, Glück und Miteinander.
Sie sind nicht sich ausschließende Begriffe, sondern eher ergänzende. Das eine ist ohne das andere nicht denkbar, das Leben besteht aus Gegensätzen. Das Symbol zeigt, sie bilden in ihrer Verschlungenheit ein Ganzes.
Die Geschichten thematisieren diese Gegensätze, vor allem die Brücken zueinander.
1 Menschlichkeit beweisen
Überbrückt
In einem kleinen Dorf in Vietnam lebten am Song Hong Menschen, die mit den Bewohnern jenseits des Flusses verfeindet waren. Den Grund für diesen anhaltenden Zwist kannte keiner mehr. Doch muss einmal viel Blut geflossen sein, denn Song Hong bedeutet Roter Fluss. Das Wasser des Flusses ist aber gelb und schlammig, seit eh und je, und nicht blutrot.
Eines Morgens begab sich Ly Bon in den nahe gelegenen Wald, um Bambusstangen zu fällen. Als er einen ansehnlichen Stapel beieinander hatte, schleppte er die Stöcke zum Fluss und rammte sie in den Boden. Zunächst wunderten sich seine Dorfnachbarn über dies merkwürdige Treiben. Doch bald erkannten sie, dass sich Ly Bon anschickte, eine Brücke über den Fluss zu bauen. Das war wirklich kein leichtes Unterfangen. Es war nicht nur schwer, die Stangen tief genug in den Boden zu treiben; immer wieder war Ly Bon dabei auch in Gefahr, selbst ins Wasser zu stürzen. Eines Abends versammelten sich die Dorfältesten und fragten Ly Bon, warum er dies mache.
Ly Bon antwortete ohne zu zögern: „Frieden können wir nur bekommen, wenn wir ihn hinüberbringen.“
Nach einer kurzen Pause sagte er dann fast beschwörend: „Das Bauen von Brücken ist schwierig, besonders diese, aber machbar. Wer Frieden schaffen will, muss damit anfangen.“
Er atmete tief durch und setzte dann hinzu: „Ich muss sogar dann anfangen, wenn ich nicht weiß, ob ich auf der anderen Seite mit Bambusstöcken vertrieben werde. Selbst dann würde ich wieder und wieder damit beginnen.“
Viele standen auf und griffen zu den Bambusstangen.
Vögel in unseren Köpfen
Ein Student der Philosophie fragte seinen Professor: „Ich weiß, die menschliche Seele hat zwei Gesichter, eine dunkle und eine helle Seite. Helle und dunkle Gedanken fliegen wie Vögel durch meinen Kopf. Abwechselnd! Sie gleichen den farbenfrohen, bunten oder den einfarbigen, tristen Himmelsstürmern, ähneln den Buchfinken oder Meisen, den Dompfaffen oder Stieglitzen, dann aber auch den Krähen oder Amseln, den Blauelstern oder Moorenten.“
Der Professor sah seinen Schüler an und bestätigte mit einem Kopfnicken seine Ausführungen: „Du hast recht. Dunkle wie helle Gedanken ziehen wie Schwaden durch unsere Köpfe. Sie gehören zum Menschsein.“
„Was soll ich machen? Wie kann ich die dunklen bekämpfen?“, wollte der Student wissen.
„Gar nicht! Wir Menschen müssen die Polarität in uns akzeptieren. Sie gehört zu unserem Wesen wie das Gute und Böse zu dieser Welt.“
Er machte eine Pause, lächelte und sagte dann: „Einen Rat kann ich dir aber geben. Lass die bunten Vögel bei dir nisten. Achte darauf, dass die schwarzen keine Nester bauen, dann fliegen sie eher fort.“
Mit-leid
Wenn man eine Million im Lotto gewonnen hat, dann glaubt man, man wüsste, was Glück ist. Doch dieses Gefühl ist nicht annähernd vergleichbar mit dem Empfinden einer Mutter, die erfährt, dass ihr todkrankes Kind leben wird.
Im Alter von siebenundzwanzig Jahren bekam die Belgierin Janet Pinon ihr erstes Baby. Nach der Geburt schien alles normal zu verlaufen. Ein halbes Jahr später aber erklärten ihr die Ärzte, dass bei ihrem Sohn Michel der Verdacht auf Erkrankung an Blutkrebs bestünde. Untersuchungen wurden gemacht und die Ergebnisse waren positiv.
„Ist das eine gefährliche Krankheit in diesem Alter?“, fragte Frau Pinon noch völlig ahnungslos, als sie diese Mitteilung bekam.
„Tödlich“, sagte der Arzt unverblümt, setzte aber hinzu, „Hoffnung gibt es immer.“
Erst behandelte man Michel mit Medikamenten. Später folgten Bestrahlungen. Unzählige Krankenhausbesuche wurden fällig. Mit drei Jahren hatte Michel keine Haare mehr auf dem Kopf, sein Körper war ausgemergelt. Seinen vierten Geburtstag feierte er im Krankenhaus. Alle Besucher und er selbst trugen einen Mundschutz. Die kleinste Infektion hätte das Leben des Kindes beenden können.
Ohne eine Knochenmarkübertragung waren seine Tage gezählt. Fieberhaft suchten die Ärzte nach einem geeigneten Spender. Zunächst in Belgien, dann in Deutschland. Ein Wettlauf mit der Zeit begann. Michels Chancen zu überleben wurden mit jedem Tag geringer. Die Krankheit zeichnete ihn.
Am Donnerstag, dem ersten Februar, klingelte bei Frau Pinon das Telefon. Der Chefarzt des Krankenhauses war am Apparat.
„Wir haben einen Spender gefunden“, sagte er, „und die Chancen sind optimal, denn alle Werte stimmen.“
Frau Pinon setzte sich auf einen Stuhl. Das Glück hatte ihre Knie zittrig werden lassen. Dann ging sie an das Bett ihres Sohnes, streichelte ihn und weinte hemmungslos. Sollte es möglich sein, dass dieses Kind ein normales Leben führen kann, dass diese unzähligen Krankenhausbesuche ein Ende nehmen, sollte es wahr werden, dass Michel wie andere Kinder lachen und toben darf, was ihm in seinem kurzen Dasein bisher versagt war?
Frau Pinon wagte das kaum zu hoffen. Doch weitere erfreuliche Nachrichten folgten. Der Spender, ein junger Mann aus Essen, war zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gekommen. Alle waren positiv und der Transplantation stand nichts mehr im Wege. Aber die Zeit drängte auch mächtig. Der Termin sollte am einundzwanzigsten Februar, Aschermittwoch, sein. Frau Pinon betete zu Gott in Dankbarkeit.
Sonntagabend klingelte erneut das Telefon. Wieder war der Chefarzt am anderen Ende. „Wir müssen die Transplantation abgesagen“, sagte er und tiefe Verbitterung klang in seiner Stimme.
„Nein!“, schrie Frau Pinon, denn sie wusste: Dies war das Todesurteil für ihren Sohn!
„Es ist nichts zu machen, der Spender hat seine Bereitschaft zurückgezogen. Alle Versuche der deutschen Ärzte, ihn umzustimmen, sind gescheitert. Selbst die Versicherung, dass der Eingriff harmlos sei und für Michel lebenswichtig, konnte ihn nicht davon abhalten, mit unbestimmtem Ziel zu verschwinden.“
Am Freitag, dem ersten März, starb Michel, nicht einmal fünf Jahre alt. In die Fernsehkameras sagte die Mutter unter Tränen: „Ich verzeihe dem Mann aus Essen.“
Willkommenskultur
Die deutsche Sprache ist schwer. Bei der Kindererziehung handelt es sich um die Erziehung der Kinder, bei der Medienerziehung nicht um die Erziehung der Medien. Der Blumenverkäufer verkauft Blumen, der Straßenverkäufer aber keine Straßen.
Ein Gasthaus ist ein Haus für Gäste, so dachten Wanderer im oberfränkischen Zapfendorf in Bayern und klopften an die Tür. Kawa Suliman bat sie herein. Er legte ihnen weder Getränke- noch Speisekarte vor, sondern bewirtete sie mit dem, was er hatte und viel Herzlichkeit. Ein etwas anderes Gasthaus, dachten die Fremden, aber es gefiel ihnen und alles schmeckte gut, etwas fremdländisch, denn der Wirt war Syrer, sprach aber ziemlich gut Deutsch. In meiner Heimat, meinte er, bedeutet Gastfreundschaft ein wenig Wärme, ein wenig Essen und große Ruhe. Die strahlte er aus, zu essen gab er reichlich und gastfreundliche Wärme erfüllte das Zimmer. Suliman plauderte mit seinen Gästen offenherzig, erzählte von seiner Heimat, die er liebte, seiner Frau, die er liebte, seinen drei Kindern, die er über alles liebte. Leider sind sie noch in Syrien. Er hoffte, sie bald wiederzusehen. Suliman strahlte Zuversicht aus, in seinen Augen spiegelte sich Vorfreude.
Nur plötzlich versteinerte sich Sulimans Gesicht, seine Züge erstarrten, Tränen traten in seine Augen. Die Ausflügler hatten ihr Portmonee auf den Tisch gelegt, sie wollten bezahlen, ihre Rechnung begleichen. „Welche Rechnung?“, fragte Suliman und das blanke Entsetzen war in sein Gesicht geschrieben.
Die Zeitung „Fränkischer Tag“ berichtete ausführlich über diesen Vorfall. Die beiden Wanderer hatten nicht mitbekommen, dass es den ehemaligen Gasthof, in dem sie früher oft und gern eingekehrt waren, gar nicht mehr gab. Hier lebten seit längerer Zeit Asylbewerber. Kawa Suliman hatte sie als Gäste aufgenommen. Diese sind immer willkommen. Das gehört zur Kultur seines Landes.
So ist es mit der deutschen Sprache. Wo Gasthaus drauf steht, muss nicht immer Gasthaus drin sein, es kann auch als Herberge für jedermann genutzt werden.
Geburtstag eines Kindes
Marion hat eingeladen und alle sind gekommen. Ihr Bruder Jan mit Frau und seinen beiden erwachsenen Töchtern, ihre Schwester Jutta mit ihrem Mann und ihre Schwägerin, allein erziehende Mutter eines 18-jährigen Sohnes, der auch mitgekommen ist. Sie sitzen in gemütlicher Familienrunde, essen und plaudern, vor allem loben sie Marions Kochkünste. Nach dem Festschmaus setzen sich alle ins Wohnzimmer, unterhalten sich bei einem Glas Saft, einer Tasse Kaffee, einem guten Tropfen Wein oder einem kühlen Bier und genießen die gesellige Runde. Als man sich verabschiedet, ist man sich einig, es war ein gemütliches Familientreffen.
Die Gäste sind gegangen, der 4-jährige Sohn kommt aus seinem Kinderzimmer mit verweintem Gesicht: „Warum heulst du?“, fragt der Vater. „Ich habe heute Geburtstag“, schluchzt Julius, „den wollten wir feiern.“
„Das haben wir doch auch“, erwidert der Vater, „es waren alle da, wir haben zusammengesessen, erzählt und dabei viel gelacht.“
„Die Großen haben miteinander gefeiert, mich hat keiner beachtet. Ihr habt nicht einmal gemerkt, dass ich in mein Zimmer gegangen bin und alleine gespielt habe.“
„Leider ist das so“, mischt sich die Mutter ein und nimmt ihren Sohn tröstend in den Arm, „und wiederholt sich Millionen Mal.“
„Frau, jetzt übertreibst du“, protestiert ihr Mann.
„Nein, nein“, sagt sie, „es wiederholt sich wirklich Millionen Mal, in Millionen Haushalten, jedes Jahr. Die Menschen feiern Geburtstag so wie wir heute. Jedes Jahr zu Weihnachten, an jedem Heiligabend. Sie feiern bei gutem Essen und reichlich Alkohol und verschwenden keinen Gedanken an das Geburtstagskind. So wie wir heute. Wer denkt schon am Heiligabend daran, dass Jesus, der Retter der Welt, geboren wurde; will gerettet werden, wenn es einem in gemütlicher Runde gut geht?
Schön wäre es
„Ich bin neu bei euch und ich muss noch viel lernen“, sagt Frau Reimann.
„Warum sind Sie Lehrerin geworden?“, fragt Sarah.
„Ich wollte“, antwortet Frau Reimann, „mein Leben nicht hinter einem Schreibtisch verbringen. Ich möchte mit jungen Menschen zusammen sein, ihnen etwas beibringen und natürlich auch etwas von ihnen lernen.“ Die junge Lehrerin geht zu ihrer Aktenmappe und holt ein Heft heraus.
„Obwohl ich erst eine kurze Zeit hier an der Schule bin, habe ich meine Beobachtungen gemacht und sie aufgeschrieben. Ich werde euch meine Notizen vorlesen.“
Ihre Schülerinnen und Schüler nicken, sind gespannt. Frau Reimann trägt vor: „An unserer Schule gibt es 383 Schülerinnen und Schüler, die von 24 Lehrkräften unterrichtet werden. Die meisten von euch kommen gerne zur Schule und lernen fleißig, vor allem achten sie auf Disziplin. Das heißt: Sie kommen pünktlich zum Unterricht, fertigen sorgfältig ihr Hausaufgaben an und verhalten sich im Schulgebäude ruhig. Dem Lehrstoff folgen sie aufmerksam und melden sich, wenn sie einen Beitrag leisten wollen. Keiner spricht ungefragt in die Klasse. Sie respektieren die Meinung der anderen oder setzen sich fair mit ihr auseinander. Bei der Stillarbeit ist es wirklich leise und ruhig, damit sich jeder auf seine Aufgaben konzentrieren kann.“
Frau Reimann schaut in die Runde, ihre Schülerinnen und Schüler sehen sie mit großen Augen an. Dann fährt sie fort: „Ganz erstaunlich ist das Verhalten auf dem Schulhof. Man redet, lacht und spielt miteinander. Nirgendwo gibt es Ärger, Zank oder Streit. Beim kleinsten Rempler entschuldigt man sich höflich. Oft sitzen sogar einige auf den Bänken zusammen und erklären einander den Unterrichtstoff. So hilft man liebevoll den Schwächeren.“
„Das stimmt doch alles gar nicht“, platzt Sarah dazwischen.
„Schön wäre es, wenn es so wäre“, meint Hülya, „wunderschön sogar.“
„Und warum ist es dann nicht so, wenn es so schön wäre?“, fragt Frau Reimann.
Den Bruder sehen
Beim ersten Schulgottesdienst nach den Osterferien geschieht etwas Merkwürdiges. Als der Priester den Altarraum betritt, steht Philip von seinem Platz auf und geht nach vorn. „Wieder der!“, denken die meisten. Viele mögen ihn nicht. Er ist beleibt und unbegabt, in Mathematik und in Rechtschreibung der Schlechteste. Im Sport kann er wegen seines Übergewichtes nicht mithalten. Die Mitschüler meiden ihn so gut es geht, viele hänseln ihn sogar. Auch die Lehrer halten Distanz. Sie sagen zwar nichts, aber man spürt, dass sie oft verzweifelt denken, bei Philip ist wirklich Hopfen und Malz verloren.
Vor Beginn des Gottesdienstes nach den Ferien steht der schwerfällige Junge auf, geht zum Kreuz und heftet ein Bild unter die Füße des Gekreuzigten. Es ist schwer zu erkennen, was es zeigt, weil es sehr klein ist. Doch als Philip sich wieder auf seinen Platz gesetzt hat, geht plötzlich ein Raunen durch die Kirche. Irgendwie hat jemand herausbekommen, was er dort angebracht hat. Und einer sagt es dem anderen: „Philip hat ein Foto von sich ans Kreuz geheftet.“
Auch der Pfarrer hat alles gesehen. Er beginnt den Gottesdienst mit den Worten Jesu: „Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken.“ Er sagt: „Ich füge hinzu: Nicht die Starken bedürfen unserer Hilfe, sondern die Schwachen. Sie sind Jesu Brüder.“
Wärmegewitter
Ehen werden im Himmel geschlossen und auf Erden geführt, meint der Volksmund. Der Hochzeitsfeier mit Festmahl und Fröhlichkeit folgt der Alltag mit täglichem Stress und grauem Einerlei. Es gibt kein Zusammenleben in ständiger Harmonie, vielleicht im Himmel, nicht auf Erden. Auf Erden fordert die Ehe manchmal eher überirdische Geduld. Die Auseinandersetzung, die Meinungsverschiedenheit, auch das immer wieder in den Arm nehmen, das Streicheln der Wangen gehören zu einer Ehe, einer durchaus glücklichen Ehe.
Die Eheleute Sundermann sind umgezogen, haben sich vergrößert, weil Nachwuchs sich bald einstellen wird. Das Kinderzimmer muss eingerichtet, neue Möbel beschafft, die Einrichtung umgestellt werden. Sundermanns sind glücklich, erledigen alles sehr harmonisch.
Nur bei der Anschaffung der Gartenmöbel gibt es Meinungsverschiedenheiten. Sie fingen ganz harmlos an. Er plädierte für Holz-, sie für Rattanmöbel. Jeder hatte seine Argumente, jeder war überzeugt von seiner Meinung, beharrte auf seinem Standpunkt. Wolken zogen auf, der Himmel verfinsterte sich, wurde pechschwarz, Gewitterwolken ballten sich zusammen, entluden sich mit Hagel, Blitz und Donner.
Es schellte. Freund Gerold stand vor der Tür. Sah die verfinsterten Gesichter und das Gewitter, das noch nicht verzogen war. Er war schnell informiert und lud sie ein, mitzukommen. Sie fuhren zum Bauern Dankert. Blitze waren in dessen Eichen eingeschlagen und hatten mächtigen Schaden angerichtet. Der Bauer musste sie fällen und stückweise verkaufen. Am Zaun stand eine Holzscheibe, dreißig Zentimeter dick, mehr als ein Meter im Durchmesser. „Gefällt sie euch?“, fragte Gerold.
„Sie ist wunderschön! Einfach wunderschön!“, sagten sie wie aus einem Mund und waren sich wieder einig.
„Wartet eine Woche!“, sagte er, „ich schenke euch eure Gartenmöbel zur Geburt eures ersten Kindes. Vertraut mir! Aber lasst das Gewitter sich legen, den Himmel wieder klar werden, die Sonne wieder herauskommen. Nach einem Gewitter ist die Luft klarer denn je. Nach einem überstandenen Streit kann eine Ehe sogar glücklicher werden als vorher.“
„Gewitter sind notwendig. Man muss sie nur möglichst schnell vorbeiziehen, sie nicht zu einem Unwetter auftürmen lassen“, meinte sie und lächelte.
„Vor allem dürfen sie keine Schäden hinterlassen wie bei diesem Bauern“, ergänzte der Freund schmunzelnd.
Eine Woche später brachte Gerold die Gartenmöbel auf einem Anhänger. Bald stand die originellste und gemütlichste Sitzgruppe, die je jemand gesehen hat, im Garten. Die große Scheibe war die Tischplatte. Ein dünnerer Stamm der Eiche bildete den Fuß und weitere die sechs Stühle, mit Sitzflächen und Lehnen. „Eure Möbel sind Eiche massiv, nicht Eiche furniert. Wer kann sich das schon leisten? Ein Stück Wald auf eurer Terrasse. Hier können wir so manches Glas gemeinsam leeren, so manches Würstchen essen, in fröhlicher Runde“, strahlte er.
„Hoffentlich immer bei gutem Wetter und viel Sonnenschein“, sagten die beiden und nahmen ihren Freund dankbar in die Arme. „Es ist gut einen Menschen zu haben, der hilft, ein Wärmegewitter zu vertreiben.“
Diebstahl
Herr Grünwald legt die Zeitung beiseite, aus der er erfahren hat, dass organisierte Banden im Ruhrgebiet zugeschlagen haben. Sie sind in mehr als fünfzig Wohnungen eingebrochen, haben im großen Stil abgeräumt. Zum Teil waren sie so dreist und sind mit Lastwagen vorgefahren, um ihre Beute abzutransportieren.
„Die Menschen stehlen, was nicht niet- und nagelfest ist“, denkt er. Der Antrieb der Diebe ist, sich an fremdem Eigentum zu bereichern. Der Ladendiebstahl scheint ihnen heutzutage am geeignetsten dafür zu sein. Jedermann kann schnell zugreifen, vom Personal bis zum Käufer, ob Mann oder Frau, Junge oder Mädchen. Ein Griff - und Wünsche sind kostenlos erfüllt.
Herr Grünwald hat zwei Söhne und eine Tochter. Keines seiner Kinder hat ihn in dieser Hinsicht je enttäuscht. Er hofft, dass es bei seinen vier Enkelkindern genauso ist. Aus seinen Gedanken schrickt er auf.
Ein Polizeiwagen hält vor dem Haus. Zwei Beamte und Max steigen aus. Max ist sein Enkel, zwölf Jahre alt. Sie bringen ihn zum Eingang. Großvater öffnet die Tür.
„Guten Tag! Können wir die Eltern dieses Kindes sprechen?“, fragt einer der Beamten. „Sie wohnen doch hier?“, vergewissert sich der andere.
„Ja“, erwidert der Großvater, „aber sie sind unterwegs und ich weiß nicht, wann sie zurückkommen.“
Es folgt betretenes Schweigen. Großvater spürt, dass Max etwas angestellt hat, sonst würden ihn die Beamten nicht abliefern. Darum sagt er: „Ich gehöre zur Familie. Max ist mein Enkel. Sagen Sie mir, was geschehen ist.“
Die Beamten nicken.
„Der Junge ist beim Stehlen erwischt worden. Er hat ein Computerspiel in seiner Jacke verschwinden lassen. Der Hausdetektiv des Elektromarktes hat das beobachtet. Die Eltern sollten sich ihr Bürschchen vorknöpfen. Ihm klar machen, dass Diebstahl eine Straftat ist.“
„Ich werde es meiner Tochter sagen“, versichert der Großvater, bis ins Mark getroffen. Die Beamten verabschieden sich. Der Enkel verschwindet in seinem Zimmer, wortlos. Herr Grünwald setzt sich ans Fenster und starrt auf die Straße. Er schämt sich.
Ihm fällt ein, dass er auch einmal bei einem Diebstahl ertappt wurde. An jede Einzelheit kann er sich noch genau erinnern. Fast die ganze Nacht hatte er nicht geschlafen, so sehr schmerzte der Bauch. Qualen, die der Hunger verursachte. Fürchterliche Qualen! So erging es vielen Kindern, vielen Erwachsenen in den Nachkriegsjahren. Im Morgengrauen war er aufgestanden, hatte sich angezogen, war leise aus dem Haus geschlichen und über den Zaun in Nachbars Garten gestiegen, um ein paar Kartoffeln aus dem Boden zu graben. Der Nachbar hatte ein großes Feld, voll davon. Als er die vierte Kartoffelstaude griff, bekam er einen Stoß in den Rücken. Er fiel mit dem Gesicht auf die harte Erde. Immer wieder drückte ihn eine starke Hand zu Boden und schrie: „Friss den Dreck, du Dieb! Nun friss schon!“
Das geschah immer und immer wieder. Dann ließ der Nachbar ihn los. Weinend, das Gesicht voller Schmutz, rannte er heim. Dabei fragte er sich, ob der Nachbar nicht wusste, wie weh Hunger tut?
Er hatte versucht zu stehlen, für seine Mutter, seine drei Geschwister und für sich. Er wollte nur ihren Hunger lindern, er wollte ihnen helfen. Herr Grünwald hatte sich wegen seines Diebstahls nicht geschämt, bis heute nicht.
Ein Leben lang
Ein Neugeborenes lag in seinem Bettchen und fragte seinen Schutzengel, den ein jeder Mensch hat: „Wer wird sich um mich kümmern auf meinem langen Lebensweg?“ Der Engel antwortete: „Du wirst Freunde haben.“
„Werden sie auch da sein, wenn ich in Not und Bedrängnis gerate?“
„Sie werden.“
„Wenn ich Freude und Vergnügen empfinde?“
„Sie werden.“
„Werden sie mir beiseitestehen, wenn ich Hilfe und Rat brauche?“
„Sie werden.“
„Immer, ein Leben lang, in guten wie in schlechten Zeiten?“
„Sie werden da sein in jeder Lebenssituation, sei sie auch noch so schlecht, auch noch so gut.“
„Haben diese Freunde auch einen Namen?“
„Es sind Vater oder Mutter, du wirst sie Mama oder Papa nennen.“
„Wer wird sich um mich kümmern auf meinem letzten Lebensweg?“ Der Engel antwortete: „Du wirst Freunde haben.“
„Werden sie da sein, wenn ich nach einem Schlaganfall aufstehen und gehen, essen und trinken will?“
„Sie werden.“
„Wenn ich traurig bin und weine?“
„Sie werden.“
„Wenn ich bei allen Verrichtungen Hilfe brauche?“
„Sie werden.“
„Immer, auch in meiner letzten Stunde, wenn ich diese Welt verlasse?“
„Sie werden da sein; in deiner schwersten Stunde besonders nah, dich in die Arme nehmen, deine Hände falten.“
„Haben diese Freunde auch einen Namen?“
„Du nennst sie Liebes oder Lieber, es sind deine Tochter und dein Sohn.“
Ein Auge zudrücken
Neue Rekorde, negative Rekorde! Alle drei Minuten wird in Deutschland in irgendeine Wohnung oder ein Eigenheim eingebrochen. Die Täter hinterlassen Spuren. Chaos und Verwüstung in dem Zuhause der Betroffenen, psychische Schäden in deren Seelen. Auch die Ladendiebstähle in unserem Land nehmen ständig zu. Sie gehen mittlerweile in die Millionen, der dadurch entstandene Schaden in die Milliarden. Die Polizei weist darauf hin: Ladendiebstahl ist kein Kavaliersdelikt und muss bestraft werden. Zu Recht!
Zwei Kaufhausdetektive sahen das anders. Sie beobachteten ihren Laden auf den Bildern der Überwachungskameras. So entging ihnen nichts, so sahen sie auch, wie ein Obdachloser, denn zerlumpt und verschlissen war seine Kleidung, eine Flasche Wein und ein Stück Wurst in seinen Manteltaschen verschwinden ließ. Der eine wollte ihm nachlaufen, der andere hielt ihn fest. „Er hat gestohlen, ich habe das genau gesehen, der Kameralinse entgeht nichts.“
„Stimmt!“, entgegnete der andere, „das Auge der Kamera ist unbestechlich, das Auge des Menschen hat ein Lid. Dieser Mann nimmt nicht aus Spaß an der Freude, sondern aus Bedürftigkeit in seiner Not. Gönnen wir ihm ein paar schöne Stunden unter der Brücke.“ Sie drückten beide ein Auge zu und ließen ihn laufen.
Noch menschlicher verhielten sich zwei italienische Polizisten. Sie drückten sogar beide Augen zu. Von ihrem Handeln erfuhr die Öffentlichkeit. Wie die Nachrichtenagentur „Ansa“ berichtete, hatte eine 75-jährige Frau in der Provinz Brescia Süßigkeiten im Werte von 27 Euro „mitgehen lassen“. Die Carabinieri beglichen den Schaden an Ort und Stelle. Sie ersparten so der Rentnerin eine Anzeige. Später hat das ganze Polizeirevier sich an den Auslagen der Kollegen beteiligt. Die Rentnerin hat sich entschuldigt mit den Worten: „Ich wollte doch nur meinem Enkelkind auch einmal ein Geschenk machen. Das kann ich nicht mit meiner 400-€-Rente.“
Die Polizisten hatten beide Augen zugedrückt, ihre Herzen weit geöffnet.
Zwei Gesichter
Jeden Freitagabend treffen sie sich „In der Quasselbude“ zum Skat spielen. Sie, das sind Reiner, der Bootsverleiher, Werner, der Gärtnereibesitzer, und Udo, der Hauptkommissar. Sie kennen sich seit ihrer Schulzeit. Ihre Frauen behaupten, das ist keine Skatrunde, sondern ein Kaffeekränzchen. Es gibt aber auch jede Woche so viel zu erzählen. Gesprächsthema heute ist Willi, den alle nur den „Hilfsbereiten“ nennen.
„Hol den Willi!“ Diesen Satz hört man oft im Stadtteil. Jeder kennt ihn und jeder weiß, wenn man in Not ist, holt man Willi. Willi hilft. Er hilft immer, er kann alles. Wenn das Auto nicht anspringt, das Gartentor klemmt, die Waschmaschine nicht läuft. Willi ist da, bringt alles in Ordnung¸ er hat goldene Hände und ein großes Herz.
Für seine Dienste verlangt er nie etwas. Die meisten stecken etwas Kleingeld in seine Tasche, wofür er dankbar lächelt, manchmal mit dem Kopf nickt, nie etwas sagt. Schließlich hat Willi drei Kinder und eine Frau zu ernähren. Er ist ein guter Vater, alle wissen das.
Keiner weiß genau, was er macht, wo er arbeitet. Es heißt nur: „Er macht Geschäfte.“ Udo hat an diesem Morgen, als er die Blumen goss, beobachtet, wie zwei Kriminalbeamte und ein Uniformierter ihn abholten. Sie haben ihm Handschellen angelegt. Udo sagt: „Ich habe gehört, man wirft ihm Autoschieberei, Waffenschmuggel und Drogenhandel vor.“
Nachdenklich meint er: „Kein Kaktus ist so dicht mit Stacheln besetzt, dass er nicht noch Platz für eine Blüte hätte.“
Kreuzigung
In einem kleinen Dorf in Süddeutschland waren ausländische Mitbürger äußerst unerwünscht. Die politischen Kräfte der Gemeinde verhinderten geschickt jede Niederlassung von Bürgern aus anderen Staaten, besonders aus Südost-Europa. Während des Interventionskrieges der Nato gegen Jugoslawien im Jahre 1999 wollte die bayerische Landesregierung Kosovo-Albaner, die vor den mordenden Soldaten und Milizen des Diktators Milosevic geflohen waren, in einer Grundschule einquartieren. Diese bot sich an, weil sie schon seit Jahren leer stand. Es brauchten nur einige Klassen für eine Übergangszeit zu Schlafstätten umfunktioniert werden. Duschen, Toiletten und sogar eine funktionierende Küche waren vorhanden.
Diese Absicht löste bei Bürgern des Dorfes einen Sturm der Entrüstung aus und mit allen Mitteln versuchten sie, dieses Vorhaben zu verhindern.
Am Sonntag hing unter dem großen Kreuz, das sich im Seitenschiff der Dorfkirche befand, ein Schild, das ein Unbekannter angebracht hatte. Darauf stand: In dieser Woche haben auch die Bürger unseres Dorfes Jesus Christus ans Kreuz geschlagen.
Mitfühlende Herzen
„Uroma“, fragt Karoline, „was ist das für ein merkwürdiger Karren, der bei euch auf dem Dachboden steht?“
„Das ist ein Erinnerungsstück.“
„Woran erinnert es?“
„Oh, das ist eine lange Geschichte.“
„Erzähle sie mir, bitte! Wir haben doch Zeit.“ Die beiden setzen sich aufs Sofa.
„Also, vor vielen Jahren ging ein furchtbarer Krieg zu Ende, der Millionen Menschen das Leben kostete, der Millionen Menschen die Heimat nahm. Sie wurden vertrieben. Darunter waren auch ich mit meinen Kindern Elisabeth, Ralf, Bernhard und unsere Großmutter. Der Aufbruch musste sehr schnell gehen, weil feindliche Truppen im Anmarsch waren. Wie unsere Nachbarn packten auch wir in Windeseile ein paar Habseligkeiten zusammen und luden sie auf den Handwagen, den du auf dem Dachboden entdeckt hast. Elisabeth schnappte sich einen Holzkoffer, in den sie Kleinigkeiten legte. Die Großmutter half uns, so gut sie konnte, denn ihr Mann war noch im Krieg. Sie schob den Kinderwagen, in dem Ralf saß. Er war noch zu klein, um zu laufen. Mit der einen Hand zog ich den Karren, an der anderen hielt ich Bernhard, hinter uns her trottete Elisabeth mit ihrem Koffer.
Es wurde ein langer und beschwerlicher Marsch aus dem Sudetenland in den Westen. Als wir aufbrachen, war es Winter, ein sehr kalter Winter. Wie für die anderen Flüchtlinge führte unser Weg durch ein zerstörtes, zerbombtes Land. Zumeist mit dem Ziel: Wir wissen nicht wohin, nur weg!
Eile war geboten, denn die feindlichen Truppen rückten immer näher. Weit schafften es viele wegen der wunden Füße, der erschöpften Körper aber nicht. Sie verdursteten, verhungerten oder erfroren, starben, weil sie am Ende ihrer Kräfte waren. Es fehlte uns an allem, an Nahrungsmitteln, Kleidung, vor allem an dringend benötigtem Brennmaterial.
Fast alle flohen ohne Ziel, aber mit der Gewissheit, sie waren nirgends willkommen. Die Menschen, zu denen wir wollten, hatten selbst nichts zu essen, viele auch keine Bleibe, denn ihre Häuser waren größtenteils zerbombt. Vor allem hatten sie Furcht vor den Fremden.
Die Urgroßmutter machte eine Pause und hielt ihre Hände vors Gesicht. Die Erinnerungen hatten sie sehr mitgenommen.
„Das ist heute genauso. Wir haben in der Schule über die Flüchtlingsströme gesprochen“, unterbricht Karoline die Wehmut.
„Nicht ganz“, erwidert die Urgroßmutter, „die Menschen, zu denen wir damals wollten, hatten selbst alles verloren, hungerten. Wir aber haben heute Nahrung und Unterkünfte im Überfluss, wir haben alles, was damals an allen Ecken und Enden fehlte. In einem aber hast du recht, gleich ist die Angst vor den Anderen, verbunden mit der Ablehnung der Fremden.
„Obwohl sie nicht froh über unser Kommen waren“, ergänzt die Uroma, „ist es damals gelungen, Millionen Menschen zu integrieren. In manchen Gebieten hat sich die Bevölkerungszahl fast verdoppelt.“
„Dagegen sind die heutigen Flüchtlingszahlen geradezu gering, lächerlich“, meint die Urenkelin, „das wenigstens sagt unsere Lehrerin.“
Die Urgroßmutter nickt.
„Wie ging es bei euch weiter?“, will Karoline wissen.
„Unser Ziel war ein kleines Dorf hinter Paderborn. Dort lebte ein Bruder deines Urgroßvaters. Wir hofften, dass sein Haus nicht zerstört war, hofften, dass er uns aufnimmt.
Wir hatten Glück, doppeltes Glück. Er hat uns beherbergt. Noch besser, mein Mann kam aus dem Krieg zurück. Welche Gnade! Wir waren Gott und den Verwandten dankbar für das kleine Zimmer, das sie uns zur Verfügung stellten, in dem wir mit sieben Personen leben durften. Es gab dort kein fließendes Wasser, keine Toilette, aber wir hatten einen Ofen, der uns wärmte, waren froh, ein Dach über dem Kopf zu haben.“ Die Urgroßmutter lächelt bei der Erinnerung selig.
„Im Unterricht waren sich alle einig, auch wir müssen die Ankommenden aufnehmen, ja annehmen“, sagt Karoline.
„Kinder zeigen mehr Hilfsbereitschaft als viele Erwachsene“, denkt die Urgroßmutter, „weil sie mitfühlende Herzen haben.“
2 Größe zeigen
Wolf und Schaf in einer Person
Einmal kam ein junger Mann zum Rabbi und suchte seinen Rat. „Rabbi“, sagte er, „meine Frau hat mich betrogen. Sie hatte eine kurze, aber heftige Affäre mit einem anderen Mann. Jetzt aber will sie zu mir zurückkommen. Was soll ich tun?“
Der Rabbi überlegte nicht lange und antwortete: „In jedem von uns leben ein Wolf und ein Schaf. Der Wolf steht für Gier und Geiz, für Hass und Habgier, für Lüge und Laster, Neid, Selbstmitleid und Eifersucht. Das Schaf aber steht für Friede und Freude, Vergeben und Verzeihen, für Güte und Gelassenheit, aber auch für Demut, Liebe und Barmherzigkeit. Füttere das Schaf, lass den Wolf hungern. Das heißt, übe so oft du kannst die Eigenschaften des Schafes, die positiven Tugenden in dir, lass so wenig wie möglich die Eigenschaften des Wolfes aufkommen, die negativen Seiten.“
Der Rabbi sah den jungen Mann an, merkte, dass dieser mit sich rang. „Wenn du es schaffst und du sie noch liebst“, fuhr er fort, „versuche zu vergeben. Eines wirst du nie können, das kann kein Mensch und das kann darum auch keiner von dir verlangen; du kannst ihr Handeln nicht vergessen. Zu tief sind die Wunden, die sie deiner Seele zugefügt hat. Sie werden in dir nagen ein Leben lang bis zu deinem Tod. Sie begleiten dich tagsüber auf so manchem Schritt und Tritt, abends mehrfach vor jedem Ausruhen und Einschlafen.“
Der Rabbi machte eine Pause, legte väterlich seine Hände auf die des jungen Mannes. Dann mahnte er: „Das Verzeihen aber liegt in deinen Händen. Lass das Schaf in dir Oberhand bekommen, füttere es, zeige Größe.“
Der junge Mann nahm den Rabbi in den Arm und bedankte sich, dann ging er heim.
Verzeihen
(nach einer wahren Begebenheit, Namen geändert)
„Martin, du?“, fragt erstaunt Gregor, als er nach dem Schellen die Haustür öffnet. „Komm bitte rein!“ Während der Woche kommt sein Bruder, der Amtsrichter, nie spätabends noch einmal vorbei. Da muss schon etwas Besonderes passiert sein. Martin begrüßt seine Schwägerin und setzt sich aufs Sofa.
Er berichtet: „Als ich heute ins Amtsgericht kam, saß Frau Kroll an ihrem Schreibtisch und weinte. Du weißt, das ist die Dame, die bei uns die Post öffnet und verteilt. Sie arbeitet schon lange am Gericht und hat schon vieles gehört, gelesen und gesehen. Die wirft so schnell nichts um.
‚Was ist geschehen‘? fragte ich sie. Sie schluchzte zweimal, dann reichte sie mir einen Brief, der vor ihr lag und sagte nur: ‚Lesen Sie selbst!‘.“
Er kramt in seiner Jackentasche und holt einen Zettel heraus. Gregor fällt sofort auf, dass er von vielen Kindern oder Jugendlichen unterschrieben ist. Martin schaut auf den Brief und schildert: „Vor einigen Monaten ist ein Linienbus, weil der Fahrer einen PKW zu spät bemerkt hatte, von der Fahrbahn abgekommen und in einen Schulbus geprallt. Ein Mädchen starb nach wochenlangem Kampf im Koma an den Folgen des Unfalls, viele Kinder waren schwer verletzt. Sie haben diesen Brief geschrieben. Er reicht ihn seinem Bruder. Der liest:
Dortmund, 12. Januar
Sehr geehrter Herr Steiner!