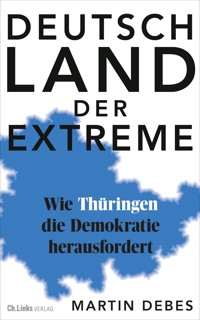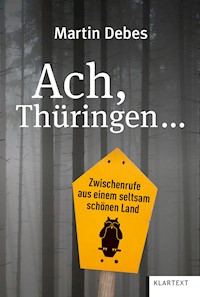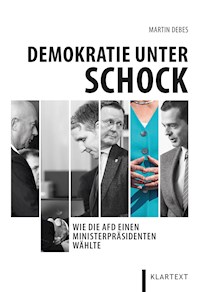
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Klartext Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Bundesrepublik erbebte, als in Thüringen am 5. Februar 2020 Thomas Kemmerich mit Stimmen von AfD, CDU und FDP zum Ministerpräsidenten gewählt wurde. Das Land wurde in seine schwerste politische Krise seit 1990 gestürzt. Die CDU wechselte ihre Führung in Berlin und Erfurt aus, sie zog die Grenzlinie zur AfD neu und duldete gleichzeitig erstmals eine Linke-geführte Landesregierung. Wie kam es zu dieser historischen Zäsur? In seinem Buch zeigt Martin Debes, dass die Wahl Thomas Kemmerichs aus der Überforderung des etablierten Parteiensystems resultierte. Es versagte beim Umgang mit einer völlig neuen Mehrheitssituation. Weil sich die alten Lager gegenseitig lähmten, konnte die AfD das Landesparlament vorführen. Dieses Buch leuchtet die Ereignisse auch an jenen Stellen aus, die bislang im Dunkeln oder im Halbschatten blieben. Die konspirativen Treffen, die geheimen Absprachen, die privaten Textnachrichten, die internen Protokolle, die verborgenen Motivlagen: Erst diese Informationen und Details lassen ein annähernd vollständiges Bild der Ereignisse entstehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 334
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Martin Debes
DEMOKRATIE UNTER SCHOCK
Wie die AfD einen Ministerpräsidenten wählte
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
2. Auflage August 2021
Satz und Layout:
Satzzentrale GbR, Marburg
Umschlagabbildung:
dpa Picture-Alliance GmbH, Bodo Schackow (Handschlag Kemmerich/Höcke);
dpa Picture-Alliance GmbH, Martin Schutt (Ramelow); Sascha Fromm/Thüringer Allgemeine (Merkel; Mohring)
Umschlaggestaltung:
Joachim Bartels, Essen
Druck und Bindung:
Majuskel Medienproduktion GmbH, Elsa-Brandström-Str. 18, 35578 Wetzlar
ISBN 978-3-8375-2431-4
eISBN 978-3-8375-2471-0
Alle Rechte vorbehalten
© Klartext Verlag, Essen 2021
Jakob Funke Medien Beteiligungs GmbH & Co. KG
Jakob-Funke-Platz 1, 45127 Essen
www.klartext-verlag.de
Inhalt
PROLOG
KAPITEL 1THÜRINGER VERHÄLTNISSE
Der Aufsteiger
Die Pastorin
Der Extremist
Das linke Experiment
Gegenkandidaten
„Versöhnen statt Spalten“
Ein Widerspruch namens Ramelow
KAPITEL 2ROTES LAND
Es wird schmutzig
Schwarzer Neubeginn
Höckes Flügel
Mohrings Hoffnung
KAPITEL 3STRATEGISCHE AUFSTELLUNG
Der Schutzengel
„Sag niemals nie“
Der rote Kretschmann
Der Cowboy
Wahlkampf-Finale
KAPITEL 4OHNE MEHRHEITEN
Thüringen-Tag in Berlin
Ausfallschritt nach rechts
Ein unmoralisches Angebot
Die Lehren von Weimar
Verhärtungen
Projekt Regierung
Die zerrissene Union
KAPITEL 5ENDSPIEL
Letzter Versuch
Der Scheinkandidat
Bedenke das Ende!
In der Falle
Sieben Sekunden
KAPITEL 6MINISTERPRÄSIDENT KEMMERICH
Der perfekte Sturm
Chaos
Abschied und kein Willkommen
Geschichtsstunde
Paralysiert in Erfurt
Out of Afrika
Besuch aus Berlin
KAPITEL 7DER PAKT
Endkämpfe in Erfurt
Kapitulationen
Koalitionsausschuss
Rücktritt
Noch mehr Rücktritte
Behelfskabinett
„Martin, hol’ mir ein Glas Wein“
Bratwurst mit Kartoffelsalat
Alles auf Anfang
Im Auge des Hurrikans
Türsteher Ramelow
Verdrängte Vergangenheit
Aschermittwoch
Corona
Drei Wahlgänge
EPILOG
ZU DIESEM BUCH
ANMERKUNGEN
PROLOG
Es war um 13.28 Uhr, als zum ersten Mal an jenem trüben 5. Februar 2020 die Sonne durch die großen Glasscheiben des Plenarsaals im Erfurter Landtag gleißte. Ein Strahl fiel direkt auf den glattrasierten Kopf eines Mannes, der in marineblauem Anzug, offenem weißen Hemd und schwarzen Cowboystiefeln auf grauer Auslegware stand.
Gerade hatte eine einfache Mehrheit des Parlaments ihn, den FDP-Abgeordneten Thomas Kemmerich, dessen Landespartei mit 5,0066 Prozent ins Parlament gelangt war, zum Ministerpräsidenten des Freistaats Thüringen gewählt. Die Abstimmung war geheim. Aber jeder im Saal wusste, dass die meisten Stimmen für ihn nicht von der CDU oder gar von seiner kleinen FDP stammten – sondern von der selbsternannten Alternative für Deutschland. Die AfD-Fraktion hatte ihrem eigenen Bewerber, einem Dorfbürgermeister, keine einzige Stimme gegeben und damit das höchste Verfassungsorgan des Landes belogen und vorgeführt.
Obwohl der Betrug so offensichtlich wirkte, hatte Thomas Kemmerich die Frage, ob er die Wahl annehme, fast ohne Zögern mit „Ja“ beantwortet. Nun stand er, von der Sonne beschienen, vor einer Frau in schwarzem Kostüm. Birgit Keller, die Landtagspräsidentin, gehörte der Linken an, also jener Partei, deren Ministerpräsident Bodo Ramelow gerade abgewählt worden war. Sie soufflierte dem FDP-Mann Halbsatz für Halbsatz den Eidestext, wie er in Artikel 71 der Landesverfassung steht.
Er sprach ihr nach: „Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des Volkes widmen, Verfassung und Gesetze wahren, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde.“ Dann fügte Kemmerich an: „So wahr mir Gott helfe.“
Die Protokollanten notierten: „Beifall AfD, CDU, FDP.“
Damit war Thomas Kemmerich im Amt – und die aus den Trümmern der NS-Diktatur gegründete Bundesrepublik im Innersten erschüttert. Erstmals seit 1945 hatte ein Regierungsmitglied, ein Regierungschef gar, mit Hilfe von Rechtsextremen die Macht erlangt.
An der Spitze jener Thüringer AfD, die Kemmerich zum Ministerpräsidenten gemacht hatte, stand ein Mann, der seit Jahren versuchte, die Partei zu einer völkischen „Widerstandsbewegung“ zu formen. Björn Höcke hatte den rechtsnationalen „Flügel“ gegründet, eine „180-Grad-Wende der Erinnerungskultur“ gefordert, auf Demonstrationen „1000 Jahre Deutschland“ beschworen und damit gedroht, die CDU-Bundeskanzlerin Angela Merkel „in einer Zwangsjacke“ abzuführen.
Und er hatte die Vision eines gewaltsamen Umsturzes beschrieben. „Wenn einmal die Wendezeit gekommen ist, dann machen wir Deutschen keine halben Sachen, dann werden die Schutthalden der Moderne beseitigt“1, sagte er. „Auch wenn wir leider ein paar Volksteile verlieren werden, die zu schwach oder nicht willens sind, sich der fortschreitenden Afrikanisierung, Orientalisierung und Islamisierung zu widersetzen.“
Nach der Wahl Kemmerichs wurden Parallelen zur Weimarer Republik gezogen – und zu Thüringen im Jahr 1924. Damals hatte eine bürgerliche Regierung zum ersten Mal mit Hilfe von Rechtsextremisten eine Linkskoalition abgelöst. Wenige Jahre später konnte die NSDAP den Innenminister stellen. Die Grundlagen der Machtergreifung im Januar 1933 wurden damit auch in Thüringen und dessen damaliger Landeshauptstadt Weimar gelegt.
Nun also, ein knappes Jahrhundert später, hatte das kleine Land, in dem 2,5 Prozent der deutschen Bevölkerung leben und das 1,8 Prozent zum nationalen Bruttoinlandsprodukt beiträgt, für einen „Schock“ (Jürgen Habermas) gesorgt, dessen Wellen international wahrgenommen wurden. In einem Gastkommentar in der „New York Times“ hieß es, dass Deutschlands Post-Nazi-Tabu „zerstört“ worden sei2. Der britische Guardian schrieb von „besorgniserregenden Erinnerungen an Weimar“3.
Die innenpolitischen Auswirkungen waren massiv. Das Ziel, den ersten und einzigen linken Ministerpräsidenten Deutschlands abzulösen, hatte für einen Moment AfD, CDU und FDP insgeheim vereint. Doch erst in der Sekunde, in der Kemmerich die Wahl annahm, sanktionierte er das teils unfreiwillige Bündnis und produzierte einen der größten politischen Skandale in der deutschen Nachkriegsgeschichte.
Gleichzeitig sorgte er damit aber, wie Habermas es formulierte, auch für die „Klärung einer politischen Frontlinie“4. Denn nun wurde die Grenze zwischen den beiden bürgerlichen Parteien CDU und FDP auf der einen Seite und der extremen AfD auf der anderen Seite neu und hart gezogen. Kanzlerin Merkel erklärte, dass der Vorgang „unverzeihlich“ sei und „rückgängig gemacht“ werden müsse. Nur vier Wochen später war das Ultimatum erfüllt. Am 4. März 2020 wählte der Landtag Bodo Ramelow wieder zum Ministerpräsidenten. Er wurde zum Nachfolger seines Nachfolgers.
Der Preis: Die CDU sah sich genötigt, erstmals die Linie gegenüber der SED-Nachfolgepartei Linke zu verwischen. Der so genannte Stabilitätspakt, den die Thüringer Union mit der rot-rot-grünen Minderheitskoalition drei Wochen nach der Wahl Kemmerichs schloss, führte zu einer De-facto-Tolerierung von Ramelows Regierung.
Der 5. Februar 2020 wurde zur Zäsur. Dies galt für die strategische Ausrichtung und Selbstwahrnehmung der deutschen Parteien. Und dies galt für ihre personelle Aufstellung. Mit dem angekündigten Rücktritt der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer begann die lange, zermürbende Suche der größten deutschen Partei nach einer neuen Führung in der Nach-Merkel-Ära. Währenddessen begab sich die Thüringer Union mit dem Abgang ihres Landesund Fraktionsvorsitzenden Mike Mohring auf den schmerzhaften Weg der Selbstfindung.
Doch wie kam es zum Schock von Erfurt, zum Schock der Demokratie? War die Wahl Kemmerichs ein Komplott von AfD, CDU und FDP, ein „von langer Hand“ geplanter „Pakt mit dem Faschismus“5, wie es einige Linke, Sozialdemokraten und Grüne bis heute behaupten? Oder handelte es sich eher um einen „perfiden Trick“6 der AfD, auf den ahnungslose Christdemokraten und Liberale hereinfielen? So jedenfalls möchte es Thomas Kemmerich gerne betrachtet haben.
Es war komplizierter. Programme mischten sich mit Prinzipien, Ideale mit Ideologien, Ambitionen mit Ansprüchen. Hinzu kamen Dreistigkeit, Dickköpfigkeit und Dummheit – und der eine oder andere Zufall. Gleichzeitig lassen sich die Geschehnisse nicht ohne die handelnden Personen und deren Vorgeschichte erklären. Denn dies ist eine Fortsetzungsserie, mit mindestens zwei Prequels, die in den Jahren 2009 und 2014 spielten. Das Sequel dürfte nach der kommenden Landtagswahl folgen.
Der menschliche Faktor ist groß in diesem kleinen Land, in dem sich niemand wirklich aus dem Weg gehen kann. Die landespolitische Kaste, einschließlich aller Landesbischöfe, Hochschulrektoren, Oberbürgermeister und Landräte, passt mühelos in einen mittleren Saal, wobei sich die Mehrzahl parteiübergreifend duzt.
Im Folgenden wird versucht, die politischen und persönlichen Linien darzustellen, die zum 5. Februar 2020 führten. Dies nimmt einen gewissen Raum in Anspruch, bevor dann die eigentlichen Ereignisse um die Wahl von Thomas Kemmerich geschildert werden. Doch dieser Raum ist nötig: Vieles wird nur mit dem Wissen um die gemeinsame Vergangenheit der Beteiligten vollständig verständlich.
Ein Beispiel: Die Idee eines linken Ex-Ministerpräsidenten, seine christdemokratische Amtsvorgängerin als Platzhalterin in die Staatskanzlei zu bugsieren, wirkt ohne Kenntnis der gemeinsamen Vergangenheit der beiden geradezu bizarr. Ebenso wenig lässt sich die Implosion der Thüringer CDU ohne die in Jahrzehnten gewachsene Feindschaft der Männer an ihrer Spitze erklären.
Aber auch sonst ist von dem, was im Herbst 2019 und im Winter 2020 in Thüringen geschah, längst nicht alles erzählt. Dieses Buch leuchtet die Ereignisse auch an jenen Stellen aus, die bislang im Dunkeln oder im Halbschatten blieben. Die konspirativen Treffen, die geheimen Absprachen, die privaten Textnachrichten, die internen Protokolle, die verborgenen Motivlagen: Erst diese Informationen und Details lassen ein annähernd vollständiges Bild der Ereignisse entstehen.
In Zentrum der Handlung steht die Thüringer CDU, die seit ihrer Neugründung im Jahr 1990 nur die Position der Macht gekannt hatte. Umso tiefer war ihr Fall, als sie im Jahr 2014 erstmals in die Opposition musste. Sie betrieb Realitätsverleugnung und versäumte es, sich ernsthaft strategisch und inhaltlich neu aufzustellen. Dies trug neben objektiv widrigen Umständen dazu bei, dass die Partei nach der Landtagswahl 2019 endgültig zwischen Linke und AfD eingeklemmt wurde. Den letzten verbliebenen Bewegungsspielraum nahm ihr die Berliner Parteizentrale.
Ansonsten ist das Versagen – das sich nochmals bei der abgesagten Neuwahl im Juli 2021 zeigte – vornehmlich maskulin. Es waren vor allem Männer und ihre Alpha-Egos, die in Erfurt miteinander rangen. Bodo Ramelow, Mike Mohring, Thomas Kemmerich und Björn Höcke sind Solitäre, die immer dann, wenn es darauf ankam, vor allen anderen auf sich selbst hörten. Auch der Umstand, dass drei von ihnen – Ramelow, Höcke und Kemmerich – aus dem Westen Deutschlands stammen, verdient zumindest Erwähnung. Denn ob sie dies nun wollten oder nicht: Mit ihrer Prägung und Sozialisation hatten sie die ideologischen Rituale und politischen Kämpfe der alten Bundesrepublik in das sogenannte neue Land Thüringen gebracht.
Eine Anmerkung noch. Dieses Buch stellt keine politikwissenschaftliche Abhandlung dar, sondern den journalistischen Versuch, ein politisches Drama zu schildern. Jenseits dessen ist in Thüringen Politik selbstverständlich mehr als die Summe persönlicher Machtkämpfe. Auch hier besteht das demokratische Geschäft hauptsächlich aus harter, zuweilen ehrenamtlicher Arbeit, aus dem Ringen um den nächsten, unbefriedigenden Kompromiss und ja: aus dem Willen, es richtig zu machen.
Doch das, was nach der Landtagswahl 2019 geschah, überforderte alle Beteiligten. Es mag sein, dass die These, mit der Christopher Clark den Ausbruch des Ersten Weltkriegs erklärte, viel zu groß für das kleine Thüringen ist. Aber gefühlt passt sie zu den Geschehnissen von Erfurt: Die etablierten Parteien versuchten, eine neuartige Situation mit den alten, überkommenen Regeln zu bewältigen. Dabei stolperten sie, Schlafwandlern gleich, in eine schwere Regierungskrise. Die Einzigen, die im entscheidenden Moment hellwach wirkten, waren die Abgeordneten der AfD.
KAPITEL 1
THÜRINGER VERHÄLTNISSE
Gut vier Monate vor dem Tag, an dem Thomas Kemmerich im Landtag als Ministerpräsident vereidigt wird, sitzt der Thüringer CDU-Vorsitzende Mike Mohring auf einer großen Dachterrasse in Erfurt. Dunkelheit hat sich über die Stadt gelegt, hinter ihm beleuchten Scheinwerfer die spitzen Türme des Doms und der Kirche St. Severi. Es ist sehr spät geworden an diesem 27. Oktober 2019.
Mohring ist blass, beinahe grau im Gesicht. Einige Freunde aus seiner Landespartei stehen neben ihm, reden leise auf ihn ein. In der Nähe haben sich Mitglieder der Band aufgebaut, die für den Abend bestellt wurde. Sie tragen a cappella die Verse von Paul McCartney vor: „Blackbird fly, blackbird fly, into the light of a dark black night.“ Amsel flieg, in das Licht einer dunklen, schwarzen Nacht. „All your life, you were only waiting for this moment to be free.“ Schon dein ganzes Leben wartest du auf diesen Moment, um frei zu sein.
Der Mann, dem sie Trost singen, hat tatsächlich sein halbes Leben auf diesen einen Abend hingearbeitet, auf dieses eine Ziel, auf das Amt des Ministerpräsidenten von Thüringen. Hier, in einem schicken Neubau, der stolz „Dompalais“ genannt wird, wollte Mohring die Rückkehr seiner CDU an die Macht feiern, die sie fünf Jahre zuvor an die erste und einzige linksgeführte Regierung Deutschlands verloren hatte.
Doch nun ist er nicht frei, sondern in einer extrem komplizierten Situation gefangen. Und er muss den Medien die größte Niederlage seiner Partei in der Geschichte Thüringens erklären. Denn die Thüringer CDU, die seit 1990 immer die meisten Stimmen erhielt, ist bei der Landtagswahl an diesem Sonntag um fast 12 Prozentpunkte auf 21,7 Prozent abgestürzt. Nachdem sie schon 2014 die Regierungsmacht verlor, hat sie nun die vollständige Demütigung erlitten.
Hingegen konnte die Linke, die mit Bodo Ramelow seit fünf Jahren den Ministerpräsidenten stellt, nochmals leicht zulegen. Mit 31 Prozent ist sie erstmals stärkste Partei in einem deutschen Parlament. Gleichzeitig hat die AfD unter Björn Höcke ihre Stimmenanteile mehr als verdoppelt. Sie ist jetzt mit 23,4 Prozent die zweitstärkste Partei im Parlament – vor der CDU.
In der Summe kommen Linke und AfD auf 54,4 Prozent der Stimmen und 51 der 90 Mandate im Landtag. Gegen diese beiden Parteien kann also keine Mehrheit gebildet werden: Auch dies ist eine bislang nie dagewesene Situation in der Bundesrepublik.
Dennoch birgt die Situation für die CDU noch eine Restchance auf die Macht. Denn die Linke hat auf Kosten ihrer beiden Partner SPD und Grüne hinzugewonnen. Die Sozialdemokraten büßten ein Drittel ihrer Stimmen ein und erreichen nur noch 8,2 Prozent. Die Grünen schafften es mit 5,2 Prozent gerade so in den Landtag. Damit fehlen der Koalition, die zuvor mit knapper Mehrheit regieren konnte, plötzlich vier Stimmen im Landtag.
Allerdings ist eine bürgerliche Allianz noch weiter als das Linksbündnis von einer Mehrheit entfernt. Zwar hat es die FDP unter ihrem Landesvorsitzenden Thomas Kemmerich zurück in den Landtag geschafft. Doch jede ohne Linke oder AfD ausdenkbare Koalition, ob nun Jamaika (Schwarz-Rot-Gelb), Kenia (Schwarz-Rot-Grün) oder Simbabwe (Schwarz-Rot-Gelb-Grün), befände sich in der Minderheit.
Für Mohring persönlich gibt es nur zwei Wege, diesem Dilemma zu entkommen. Der erste wäre sein Rücktritt. Der zweite: Er muss die überkommenen Regeln neu interpretieren oder gar brechen, um eine Neuwahl des Landtags zu vermeiden. So könnte er, vielleicht, politisch überleben.
Dass er abtritt, schließt Mohring kategorisch aus. Er, der Sohn eines Maurers und einer Verkäuferin, ist nicht so weit gekommen, um jetzt aufzugeben. Er, der Mann, der erst Monate zuvor eine Krebserkrankung durchstand, wird sich nicht einfach in diese Niederlage fügen.
Der Aufsteiger
Die Politik ist Mohrings Leben, mit ihr hat er den größten Teil seiner 48 Lebensjahre verbracht. Er kennt kaum etwas anderes. Seinen Einstieg markiert der Herbst 1989, als er mit 17 das FDJ-Amt hinter sich lässt und in seiner Geburtsstadt Apolda die Demonstrationen gegen die DDR-Obrigkeit mitorganisiert. Kurz vor seinem Abitur, im Frühjahr 1990, zieht Mohring für das „Neue Forum“ in den örtlichen Kreistag ein. Nachdem der Zivildienst absolviert und das Jura-Studium in Jena begonnen ist, wechselt er 1994 in die CDU, an deren Spitze Ministerpräsident Bernhard Vogel steht. Mohring übernimmt Funktionen in der Jungen Union, wird Fraktionschef im Kreistag. Vor der Landtagswahl 1999 erkämpft er gegen den Willen der Parteispitze einen aussichtsreichen Listenplatz und zieht ins Parlament ein.
Es ist das Jahr, in dem die Thüringer CDU auf den Höhepunkt ihrer Macht gelangt. Sie hat bei der Wahl 51 Prozent der Stimmen erhalten und alle 44 Wahlkreise im Land gewonnen.
Es ist aber auch das Jahr, in dem die PDS mit 21,3 Prozent erstmals vor der SPD liegt. Es ist das Jahr, in dem der Jenaer Jura-Student Christian Carius als jüngster Abgeordneter ins Parlament einzieht. Es ist das Jahr, in dem der Jenaer Politikwissenschaftsstudent Mario Voigt als erster Ostdeutscher an der Spitze des Rings Christlicher Demokratischer Studenten (RCDS) steht. Und es ist das Jahr, in dem der 43-jährige Gewerkschaftsfunktionär Bodo Ramelow, der kurz zuvor in die PDS eingetreten war, Mitglied des Landtags wird.
Die erstmals mit absoluter Mehrheit regierende CDU hat besonders viele Ämter zu vergeben. Mohring ist erst 27, doch er erhält die wichtige Funktion des haushaltspolitischen Sprechers der Fraktion. Sofort profiliert er sich mit medial geschickt platzierten Sparforderungen und Reformvorschlägen. Seinen Parteifreunden, aber auch der politischen Konkurrenz wird rasch klar: Hier will einer nach ganz oben.
Für die CDU wird es eine Wahlperiode des Übergangs. Im Jahr 2000 gibt Bernhard Vogel den Parteivorsitz an Dieter Althaus ab, 2003 übernimmt der Jüngere auch die Staatskanzlei. Allerdings hat die Union damit auch ihren Zenit überschritten. Bei der Landtagswahl 2004 verliert sie unter Althaus deutlich. Nur weil Grüne und FDP an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern, kann sie mit 43 Prozent ihre absolute Sitzmehrheit im Parlament knapp verteidigen. Die Linke, die erstmals mit Ramelow als Spitzenkandidat angetreten ist, wächst auf 26,1 Prozent, derweil die SPD, die mit den Protesten gegen die Hartz-Reformen zu kämpfen hat, nur noch bei 14,5 Prozent landet.
Jetzt geht Mike Mohring den entscheidenden Karriereschritt: Er wird von Althaus zum Generalsekretär der Thüringer CDU berufen. Als er vier Jahre später, 2008, auch die Führung der Landtagsfraktion übernimmt, gilt er als Nummer 2 in der Landespartei – und als natürlicher Aspirant auf die Staatskanzlei. Der Ministerpräsident sitzt inzwischen im CDU-Bundespräsidium und scheint sich für einen Kabinettsposten in Berlin zu interessieren. Mohring muss bloß noch warten.
Doch plötzlich ist alles anders. Am Neujahrstag 2009, es ist 14.43 Uhr, fährt Dieter Althaus in der österreichischen Steiermark Ski. Er biegt mit etwa 40 Kilometern pro Stunde von der Piste „Die Sonnige“ in die Abfahrt „Panorama“ ab. So jedenfalls wird es später ein Gutachten feststellen. Althaus umkurvt ein Absperrnetz und fährt ein paar Meter bergauf, womöglich, um eine Pause einzulegen. Dabei kollidiert er frontal mit einer Frau, die ihm bergab entgegenkommt. Die 41-jährige Mutter eines kleinen Kindes stirbt auf dem Weg ins Krankenhaus. Der Regierungschef, der im Unterschied zu ihr einen Skihelm trug, wird mit einem schweren Schädel-Hirn-Trauma ins künstliche Koma versetzt7.
Der tragische Unfall stürzt die Thüringer CDU, die ja immer noch allein regiert, in eine kollektive Überforderungssituation. Finanzministerin Birgit Diezel muss als Vize-Ministerpräsidentin und erste Stellvertreterin des Landesparteichefs die Geschäfte kommissarisch übernehmen. Sie und Mohring besuchen Althaus in Schwarzach im Krankenhaus. Danach verbreiten sie die Botschaft, dass der Ministerpräsident aufgewacht sei und sich auf dem raschen Weg der Besserung befinde.
Auch der Patient selbst will so schnell wie möglich wieder fit werden, körperlich und politisch. Er akzeptiert, dass ihn ein österreichisches Bezirksgericht wegen fahrlässiger Tötung zur Zahlung von 33.000 Euro verurteilt, da er auf der Piste die Regeln des Internationalen Skiverbands verletzte. Kurz darauf lässt er sich aus der Distanz einer Reha-Klinik am Bodensee zum CDU-Spitzenkandidaten für die Thüringer Landtagswahl wählen, die im Spätsommer 2009 stattfinden soll.
Der Fall Althaus gerät zu einem nicht enden wollenden Medienspektakel. Die öffentlichen und veröffentlichten Reaktionen bestehen mehrheitlich aus Unverständnis, ja Empörung. Die Führenden in der Thüringer CDU halten trotzdem stur zu ihrem Ministerpräsidenten, aus Loyalität und Freundschaft, aber auch, weil ihre Karrieren mit seiner Person verknüpft sind. Scheitert Althaus, sind auch sie gefährdet. Dieser Befund gilt insbesondere für den Nachfolgefavoriten Mohring.
Und so kehrt der Ministerpräsident schon gut drei Monate nach dem Unfall in die Staatskanzlei zurück. Sichtlich angeschlagen spricht er im April 2009 davon, „ganz der Alte“ zu sein. Aber nicht nur er verkennt die Lage. Die gesamte Landesspitze der CDU macht sich etwas vor. Sie führt mit einem Ministerpräsidenten, der rechtskräftig für den Tod einer jungen Mutter verantwortlich gemacht wird, einen merkwürdig tümelnden Wohlfühlwahlkampf. Althaus lässt sich in einer obskuren Zeitschrift sogar als Opfer der Tragödie inszenieren. Und er will keinerlei persönliche Schuld anerkennen, da er sich ja, wie er ständig wiederholt, nicht an den Unfall erinnern könne.
Die Niederlage ist unausweichlich. Bei der Wahl am 30. August 2009 verliert die CDU die absolute Mehrheit im Landtag und stürzt auf 31,2 Prozent ab. Der Machtverlust droht. Denn der einzige mögliche Partner – die SPD – verhandelt ernsthaft mit Ramelows vormaliger PDS, die inzwischen zu „Die Linke“ geworden ist, und den Grünen, die erstmals seit 15 Jahren wieder im Parlament sitzen. Die drei Parteien sind in der Dekade gemeinsamer Opposition gegen die absolut regierende Union zusammengewachsen, bei Volksbegehren, Demonstrationen und Debatten im Landtag. Jetzt kommen sie gemeinsam auf eine solide Mehrheit von 52,1 Prozent.
An diesem Umstand ändert auch der Wiedereinzug der FDP nichts. Die Partei, die wie die Grünen anderthalb Jahrzehnte in der außerparlamentarischen Opposition verbringen musste, hat dank eines fulminanten Bundestrends 7,6 Prozent erreicht. Einer der sieben liberalen Abgeordneten ist Unternehmer, er besitzt eine Friseurkette, führt in Erfurt den Kreisverband der Partei und amtiert als Präsident aller Karnevalclubs der Landeshauptstadt. Er heißt Thomas Kemmerich.
Doch für die erste rot-rot-grüne Koalition in der deutschen Geschichte gibt es eine Hürde: Es ist die Frage, wer Ministerpräsident wird. Die Sozialdemokraten hatten sich in einem Mitgliederentscheid darauf festgelegt, nicht als Juniorpartner mit der Linken zu koalieren. Jetzt wollen sie als deutlich kleinerer Partner den Ministerpräsidenten stellen – oder, falls die Linke nicht zustimmt, lieber mit der Union regieren.
Die Pastorin
Die CDU hat also die Möglichkeit, sich an der Macht zu halten – aber offenkundig nicht unter Althaus. Denn mit ihm will SPD-Landeschef Christoph Matschie nicht einmal reden. Er verlangt nach einem neuen Ansprechpartner. Auch deshalb tritt der Ministerpräsident, der sich zudem erstmals offener Kritik in der eigenen Partei ausgesetzt sieht, überstürzt von allen Ämtern zurück. Er verschwindet ins heimische Eichsfeld und unterlässt es dabei, seine Nachfolge im Sinne Mohrings zu regeln. Dank des Chaos, das er damit produziert, kann sich eine Frau durchsetzen, die viele immer wieder unterschätzt hatten.
Die einstige Pastorin Christine Lieberknecht war seit 1990 alles Mögliche gewesen, Kultusministerin, Staatskanzleiministerin, Landtagspräsidentin, Fraktionschefin, Sozialministerin. Doch in die Nähe des Regierungsvorsitzes gelangte sie nie. Hier standen stets genügend Männer vor ihr.
Hinzu kam ihr Image als Intrigantin. Noch in den letzten Monaten der DDR, im Spätsommer 1990, hatte Lieberknecht dafür gesorgt, dass CDU-Landeschef Willibald Böck, der auf Platz 1 der Landesliste stand, nicht als Spitzenkandidat in den Landtagswahlkampf ziehen durfte. Statt ihm inthronisierte sie den Zweitplatzierten Josef Duchač als Ministerpräsidenten – nur um ein gutes Jahr später einen erfolgreichen Putsch gegen ihn anzuführen. Seitdem galt sie als Verräterin.
Doch nun, im Herbst 2009, nach dem Spontanrücktritt von Althaus, ergibt sich ihre Chance. Man kann Lieberknechts späteren Beteuerungen glauben, dass sie das höchste Regierungsamt nie wirklich anstrebte. Gleichzeitig spricht vieles dafür, dass sie es sich seit Langem zutraute und darauf hinarbeitete. Unumstritten ist jedenfalls: Als Finanzministerin Diezel, die als stellvertretende Partei- und Regierungschefin wieder Althaus vertritt, ihr nach einem Geheimtreffen die Kandidatur für das Ministerpräsidentenamt anbietet, greift sie entschlossen zu.
Die beiden Frauen lassen zu diesem Zeitpunkt noch offen, wer den Vorsitz der CDU übernehmen soll. Lieberknecht drängt Diezel, die aber das ruhigere Amt der Landtagspräsidentin vorzieht. Damit scheint für Mohring zumindest der Weg an die Spitze der Landespartei frei. Doch jetzt stellen sich ihm Mario Voigt und Christian Carius entgegen. Die beiden Landtagsabgeordneten sind seit ihrem Studium in Jena eng befreundet – und Mohring seit Jahren in gegenseitiger Abneigung verbunden.
Mario Voigt, 1977 in Jena geboren, hatte dort auch Politikwissenschaft studiert. Nebenbei führte er für ein Jahr den RCDS und durfte in Bonn den Granden der CDU im Bundesvorstand zuschauen. Nach einem mehrmonatigen US-Praktikum promovierte er über den zweiten Präsidentschaftswahlkampf von Georg W. Bush und arbeitete als Berater für die Bundes-CDU.
Im Jahr 2005 wurde Voigt zum Chef der Jungen Union in Thüringen gewählt. In diesem Moment begann auch die Konkurrenz zu Mohring, der bereits Generalsekretär der Landespartei war und eine seiner Vertrauten an die JU-Landesspitze schieben wollte. Doch Voigt siegte nicht nur gegen sie, er installierte auch seinen Freund Christian Carius als Stellvertreter.
Damit besitzen die beiden eine eigene, kleine Machtbasis. Nun, im Jahr 2009, ist Voigt in den Landtag eingezogen – und organisiert mit Carius in der Fraktion, die gar nicht für Parteifragen zuständig ist, eine Mehrheit für Lieberknecht als CDU-Landesvorsitzende. Mohring muss ohnmächtig dabei zusehen, wie ihn die beiden auf seinem ureigenen Feld ausmanövrieren. Selbst Dieter Althaus, der, wie er verspätet feststellt, trotz seines Rücktritts laut Verfassung noch geschäftsführend im Regierungsamt ist und in die Staatskanzlei zurückeilt, vermag seinem Schützling nicht mehr zu helfen.
Spätestens jetzt sind aus den Konkurrenten Voigt und Mohring erbitterte Feinde geworden. Über die Jahre wird sich der Machtkampf zu einer persönlichen Fehde entwickeln, welche die Thüringer CDU für mehr als eine Dekade prägt – bis hin zur Wahl Kemmerichs zum Ministerpräsidenten. Die beiden Männer misstrauen sich zutiefst, ja, sie verachten sich. Voigt hält Mohring für einen politischen Spekulanten, einen talentierten, aber teamunfähigen Solisten, der dabei ist, die gesamte Landespartei in die Geiselhaft seiner Ambitionen zu nehmen. Für Mohring wiederum ist Voigt nur ein akademischer Westentaschen-Stratege, der glaubt, in Thüringen US-Wahlkampf spielen zu können.
In die gegenseitige Abneigung spielt hinein, dass Voigt promoviert ist, während der Fraktionschef sein Jura-Studium abgebrochen hatte. Ab 2007 belegt Mohring auf Grundlage seiner in Jena erworbenen Scheine insgeheim Kurse an privaten Hochschulen in Innsbruck und Frankfurt am Main – und kann pünktlich im Wahljahr 2009 dem erstaunten Publikum zwei Abschlüsse vorweisen, einen Master of Law und einen Master of International Business & Tax Law. Zu diesem Zeitpunkt bekommen gleich mehrere Journalisten Hinweise, dass irgendetwas mit den Examina nicht stimme. Doch die Recherchen laufen ins Leere, Mohring hat sein Studium ordnungsgemäß abgeschlossen. Er wäre jetzt auch formal bereit für größere Aufgaben.
Aber die Chance ist vergeben. Mario Voigt hat sich, zumindest in dieser Situation, als schneller, energischer und taktisch versierter erwiesen. Christine Lieberknecht zeigt derweil, wie flexibel sie Machtpolitik beherrscht. Sie umschmeichelt die Sozialdemokraten, macht enorme inhaltliche Zugeständnisse, bei Gemeinschaftsschulen oder Gebietsreform. Und sie garantiert der halb so großen Partei die Hälfte der Fachministerien.
Ramelow hält dagegen. In einem spektakulären Schritt verzichtet er gegenüber SPD und Grünen auf den Anspruch der größeren Partei auf das Ministerpräsidentenamt und wirbt für einen parteilosen oder sozialdemokratischen Regierungschef, der am besten nicht aus Thüringen kommen soll. Die Namen des früheren Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse oder des scheidenden Bundesverkehrsminister Wolfgang Tiefensee (beide SPD) werden genannt.
Doch SPD-Landeschef Matschie, der damit in einer rot-rot-grünen Landesregierung zur Nummer 3 degradiert würde, macht da nicht mit. Er nutzt das Zögern innerhalb der Linken, die DDR pauschal als „Unrechtsstaat“ zu bezeichnen, um entgegen dem deutlich erkennbaren Basiswillen eine Koalitionsaussage zugunsten der CDU durchzusetzen. Hinzu kommt, dass sich der Theologe Matschie mit der beurlaubten Pastorin Lieberknecht, die er längst duzt, menschlich einfach besser als mit Ramelow versteht.
Die CDU-Landeschefin hat also ihrer Partei noch einmal die Macht gesichert. Doch trotz dieses nicht selbstverständlichen Erfolgs präsentiert sich die Fraktion tief gespalten. Die alte Althaus-Gang fühlt sich kollektiv düpiert. Als sich Lieberknecht im Landtag der Wahl zur Ministerpräsidentin stellt, fällt sie in den ersten beiden Wahlgängen durch, obwohl Schwarz-Rot über eine solide Vier-Stimmen-Mehrheit verfügt.
Damit kommt es erstmals bei einer Thüringer Ministerpräsidentenwahl zum Drama des dritten Wahlgangs. Hier reicht nach Artikel 70 der Landesverfassung die relative Mehrheit der „meisten Stimmen“. Die Formulierung hatte in den Wochen vor der Wahl zu langwierigen Debatten geführt. Zählen nur die Ja-Stimmen? Stünde, wenn Lieberknecht als Einzelkandidatin mehr Nein- als Ja-Stimmen erhielte, die Legitimität ihrer Wahl infrage? Muss dann das Verfassungsgericht entscheiden? Die Rechtsgelehrten wirken ebenso uneins wie das zunehmend verwirrte Publikum. Die Formulierung der Landesverfassung war in den Zeiten klarer Mehrheiten niemandem aufgefallen.
Doch bevor die Lebenswirklichkeit eine Antwort geben kann und der entscheidende dritte Wahlgang beginnt, erklärt Ramelow auch zur Überraschung der eigenen Partei, dass er gegen Lieberknecht antrete. Aus der Perspektive des Linke-Fraktionsvorsitzenden ist die Bewerbung ein risikofreier PR-Stunt. Die Sondersendungen werden nun von ihm dominiert.
Aber Ramelow hat noch andere Motive. Zum einen hält er den Streit um die Verfassung für unwürdig. Zum anderen will er Lieberknecht schlicht helfen. Tatsächlich sorgt seine Kandidatur dafür, dass sich im dritten Wahlgang die bürgerlichen Reihen schließen. Die CDU-Kandidatin erhält nun alle Stimmen von CDU und FDP – und kommt damit auf eine stattliche absolute Mehrheit.
Dass ein linker Oppositionsführer eine christdemokratische Ministerpräsidentin dabei unterstützt, gesichtswahrend ins Amt zu gelangen, ist wohl so nur im kleinen Thüringen möglich. Lieberknecht und Ramelow kennen sich seit den frühen 1990er Jahren gut – und sie schätzen sich. Sie duzen sich und sprechen oft miteinander; Ramelow lud Lieberknecht sogar zu seiner zweiten Hochzeit ein.
Die beiden verbindet der gemeinsame evangelische Glaube, der wiederum, etwa bei sozialen Themen, gemeinsame politische Ansichten induziert. Gefühlt standen die lutherische Pastorin und der protestantische Gewerkschafter Ramelow nicht selten in gemeinsamer Opposition zu den Katholiken Vogel und Althaus. Falls sie sich mal im Eifer des politischen Gefechts gegenseitig öffentlich verletzten, folgten sofort danach die Entschuldigungen per SMS.
Aber dies geschieht selten. Selbst nach ihrem Amtsantritt greift Ramelow die Ministerpräsidentin selten persönlich an. Ihre Regierungszeit beginnt auch so schon schwierig genug. Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat ihren Höhepunkt erreicht, überall fehlt Geld, das Land muss neue Schulden machen. Gleichzeitig erschwert die CDU-Fraktion das Regieren; Mohring blockiert Reformen und präsentiert stattdessen eigene, unabgestimmte Initiativen.
Lieberknecht scheut die Konfrontation, aus Schwäche, aber eben auch, weil in Thüringen alles so klein ist. Sie wohnt in Mohrings Wahlkreis, und Mohring in ihrem – und sie ist Mitglied des Kreisverbands, den er führt. Christian Carius, den Lieberknecht als Bauminister in ihr Kabinett geholt hat, und Mario Voigt, den Lieberknecht in der Landes-CDU zum Generalsekretär befördert, müssen dabei zusehen, wie der Rivale größere Teile der Agenda bestimmt.
Je näher das Ende der Legislaturperiode rückt, umso nervöser wirkt Lieberknecht. Sie begeht Fehler. Im Vorwahljahr 2013 beginnt eine Kette von Personalaffären, die zwischenzeitlich sogar zu Untreue-Ermittlungen gegen die Ministerpräsidentin führen. Im Ergebnis landet die CDU, die noch im Vorwahljahr in den Umfragen bei bis zu 40 Prozent gelegen hatte, bei der Landtagswahl am 14. September 2014 wieder bloß bei 33,5 Prozent. Das Ergebnis ist kaum besser als das von 2009. In absoluten Stimmen, auf diese Feststellung legt Mohring am Wahlabend großen Wert, fällt es sogar noch schlechter aus.
Mario Voigt, der als Generalsekretär die Kampagne für die CDU organisierte, ahnt schon am Wahlabend, dass das Ergebnis das Ende der Regierung bedeuten könnte. Er, der öffentlich stets kontrolliert und beherrscht auftritt, lässt sich auf der Wahlparty im Erfurter Restaurant „Hopfenberg“ gehen. Vom Alkohol enthemmt lästert er laut über Mohring und die Medien.
Der Extremist
Das, was nach dieser Landtagswahl geschieht, festigt die Grundlage für das, was sich fünf Jahre später ereignen wird. Die Risse im Damm gegenüber der äußeren Rechten bilden sich in diesen Monaten. Denn nun sitzt die „Alternative für Deutschland“ im Landtag. Die mikroskopisch kleine Landespartei, die erst ein gutes Jahr besteht und 350 Mitglieder zählt, hat es aus dem Nichts auf 10,6 Prozent der Zweitstimmen und elf Abgeordnete geschafft.
Ihr Landesvorsitzender, der auch die Fraktionsführung übernimmt, ist 42 Jahre alt und heißt Björn Höcke: ein gebürtiger Westfale, der in Rheinland-Pfalz aufwuchs, einst der Jungen Union angehörte, in Hessen Sport und Geschichte studierte und als Oberstudienrat in einer Gesamtschule in Bad Sooden-Allendorf die Gymnasialstufe unterrichtete. Im Jahr 2008 war er nach Thüringen gezogen, hatte im Dorf Bornhagen im thüringischen Eichsfeld das alte Pfarrhaus gekauft. Hier, unterhalb der romantisch-schönen Burg Hanstein, nur wenige Kilometer von der Landesgrenze zu Hessen entfernt, lebt er mit seiner Frau und vier Kindern.
Höcke, der Wahlkampf-Plakate gegen angebliche „Denkverbote“ kleben ließ, präsentiert sich als rechtskonservativer Freigeist. Sein Modell lautet „Heimat, Volk, Familie“, wobei die Familie aus Mann, Frau und mindestens drei Kindern zu bestehen habe. Er gibt sich gebildet, zitiert Hegel und Heidegger und bedient sich altgriechischer Vokabeln. Er sagt, dass das „Volkswohl“ „keine politische Entropie“ (Informationsmangel) vertrage, dass er über „eine Eschatologie“ (Glaube an die Vollendung des Einzelnen und der Dinge) verfüge und dass er sich selbst in seinen Kindern „transzendiere“.
Der Kern der Höckeschen Begriffswelt ist die Identität. Sie sei „die zentrale Frage der Menschheit im 21. Jahrhundert“, der Schlüssel „zu ökonomischen und ökologischen Homöostasen, also ausgleichenden Selbstregulierungen einer Gesellschaft“. Deutsche und Europäer hätten „die Aufgabe, den Wert ihrer Hochkultur wiederzuentdecken“.
Zur Landtagswahl 2014 ist noch nicht öffentlich bekannt, dass Höcke mit dem NPD-Funktionär Thorsten Heise Kontakte pflegt, dass er mutmaßlich in dessen Blättchen Texte publizierte und dass er 2010 an einer Neonazi-Demonstration in Dresden8 teilnahm. Zudem wissen nur wenige, dass er dem Netzwerk der Neuen Rechten angehört, als dessen geistiger Führer Götz Kubitschek gilt.
Doch ob dies die Wähler abgehalten hätte, für die AfD zu stimmen? Der „Thüringen-Monitor“, eine Langzeitstudie, mit der Jenaer Politikwissenschaftler alljährlich die Wahlberechtigten nach ihren Ansichten befragen, schreibt 17 Prozent der Bürger im Jahr 2014 rechtsextremes Gedankengut zu. Diese Menschen haben nun in der AfD eine Partei, der sie ihre Stimme geben können. Und sie haben mit dem Oberstudienrat Höcke jemanden, der das ausformuliert, was sie empfinden.
Fortan wird der Mann eine von drei Landtagsfraktionen der AfD führen. Nur in Brandenburg und Sachsen, wo gleichzeitig oder kurz zuvor Wahlen stattfanden, sitzt die Partei bisher im Parlament. „Von hier und heute beginnt eine neue Epoche in der Parteiengeschichte der Bundesrepublik Deutschland“9, ruft er auf der Wahlparty ins Mikrofon. Die AfD habe einen „vollständigen Sieg“ errungen, sie sei „eine blaue Bewegung“, die das „Vaterland in eine bessere Zukunft führen“10 werde.
Gleichzeitig, auch das ist Höcke, präsentiert er sich kooperativ. „Natürlich gibt es Schnittmengen mit der CDU, gerade in Thüringen.“11 Aber auch bei der linken Programmatik erkenne er Ähnlichkeiten, etwa beim Thema direkter Demokratie.
Natürlich weiß er, dass die Linke niemals mit ihm reden wird und dass der CDU-Bundesvorstand jedwede Gespräche mit der AfD ausgeschlossen hat. Aber er weiß auch, wie knapp die Mehrheiten sind. Nur weil die FDP im Herbst 2014 aus dem Landtag geflogen ist und deshalb ihre Wähler bei der Sitzverteilung nicht zählen, reicht es im Landtag entweder mit einer Stimme für die Fortsetzung der schwarz-roten Koalition – oder, ebenso knapp, für ein rot-rot-grünes Experiment.
Denn: Die Linke unter Ramelow hat sich nochmals leicht auf 28,2 Prozent verbessert. Trotz Verlusten der SPD würde es für ein Bündnis mit ihr und den Grünen reichen. Und diesmal, das ist der Unterschied zum Jahr 2009, erscheint die SPD ernsthaft dazu bereit, einen linken Ministerpräsidenten zu akzeptieren.
Die Mehrheit der sozialdemokratischen Basis hat damit ohnehin seit Langem kein Problem mehr. Aber auch die Bundespartei hat sich 2013 auf ihrem Leipziger Parteitag gegenüber der Linken geöffnet. Hinzu kommt die Ernüchterung der SPD nach fünf Jahren gemeinsamen Regierens unter der CDU. So wie im Bund musste sie erfahren, dass sie als kleinerer Partner der Union in der Regel verliert.
Das linke Experiment
Auch Bodo Ramelow hat hinzugelernt, genauso wie der Berliner Linke-Stratege Benjamin Hoff, der ihn schon bei den gescheiterten Gesprächen im Jahr 2009 beriet. Deshalb wird die Verhandlungsdelegation diesmal nur mit sorgfältig ausgesuchten Gefolgsleuten besetzt. Die Sondierungen führt eine junge Frau: Susanne Hennig-Wellsow, Mitte 30, frühere Leistungssportlerin und unbelastet von der DDR-Vergangenheit. Sie hatte im Herbst 2013 mit Unterstützung Ramelows den Landesvorsitz der Linken übernommen. Ihr gemeinsames Ziel: die Regierungsmacht.
Entsprechend effizient verlaufen die Gespräche. Die Linke ist rasch zum Schuldbekenntnis als SED-Nachfolgepartei bereit, das SPD und vor allem Grüne vor fünf Jahren vergeblich forderten. Die DDR, konzedieren Hennig-Wellsow und Ramelow, war ein „Unrechtsstaat“.
Währenddessen reden die Sozialdemokraten auch mit der CDU, aber bloß der Form halber und um den Druck auf Linke und Grüne aufrecht zu erhalten. Das gilt umso mehr, da SPD-Landeschef Matschie von Andreas Bausewein abgelöst wird. Der Erfurter Oberbürgermeister war schon 2009 als klarer Befürworter eines Linksbündnisses aufgetreten.
Die CDU macht der SPD den Spurwechsel leicht. Die Partei wirkt wie gelähmt. Alle belauern sich gegenseitig. Obwohl Carius und Voigt die Ministerpräsidentin zum Konflikt mit Mohring drängen, will sie lieber Geschlossenheit demonstrieren und unterstützt die Wiederwahl des Fraktionschefs. Im Gegenzug bringt Voigt Lieberknecht dazu, Carius als neuen Landtagspräsidenten durchzusetzen. Damit soll Mohring, falls man denn in die Opposition muss, ein Gegengewicht bekommen.
Während die CDU mit sich selbst beschäftigt ist, schließen Linke, SPD und Grüne ihre Sondierungsgespräche erfolgreich ab. Danach organisieren die Sozialdemokraten einen Mitgliederentscheid, der Anfang November das gewünschte Ergebnis bringt: Knapp 70 Prozent der Teilnehmer sind für Rot-Rot-Grün. Die Koalitionsgespräche können beginnen.
Doch nun wächst der öffentliche Widerstand. Sogar der Bundespräsident äußert sich. „Ist die Partei, die da den Ministerpräsidenten stellen wird, tatsächlich schon so weit weg von den Vorstellungen, die die SED einst hatte bei der Unterdrückung der Menschen hier, dass wir ihr voll vertrauen können?“12, fragt Joachim Gauck, der sich einst als evangelischer Pastor am DDR-System rieb, rhetorisch in einem Fernsehinterview. Es gebe Teile in der Linkspartei, sagt er, bei denen er wie viele andere auch Probleme habe, dieses Vertrauen zu entwickeln: „Menschen, die die DDR erlebt haben und in meinem Alter sind, die müssen sich schon ganz schön anstrengen, um dies zu akzeptieren.“
Auch auf der Straße formiert sich Protest. Am 9. November, dem 25. Jahrestag des Mauerfalls, versammeln sich 4000 Menschen auf dem Domplatz. Organisiert wird die Demonstration von einem CDU-Mitglied, er ist Vizevorsitzender der Mittelstandsvereinigung der Union im Land13. Viele haben Kerzen mitgebracht, aber es sind auch AfD-Landtagsabgeordnete mit Fackeln zu sehen. „Wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen!“14, wird gerufen, oder „Bodo raus!“. Unter den Demonstranten ist auch Generalsekretär Voigt. Dass der 9. November ebenso der Jahrestag der Pogromnacht ist, an dem in Erfurt die Synagoge brannte, wird in Kauf genommen. Eine kurze Gedenkminute muss für die Opfer des Naziterrors reichen.
Am 19. November 2014 ist der rot-rot-grüne Koalitionsvertrag beschlussfertig15. Ein letzter Streit um das grüne Umweltministerium, dessen Abteilungen für Landwirtschaft und Forst ins linke Infrastrukturministerium wandern, wird notdürftig befriedet. Dann stellen Linke, SPD und Grüne gemeinsam den Antrag im Landtag: Ramelows Wahl soll am 5. Dezember stattfinden.
Gegenkandidaten
Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik könnte ein Linker an der Spitze einer Landesregierung stehen. Erstmals in ihrer Geschichte seit 1990 droht der Thüringer CDU der Verlust der Macht. Damit steht sie auch erstmals vor der Frage, ob sie bei einer Ministerpräsidentenwahl einen Bewerber gegen den Kandidaten der Mehrheit aufstellen soll. Denn für ihn bestünde die Möglichkeit, von der AfD mitgewählt zu werden – ob nun gewollt oder nicht.
Lieberknecht hat für sich entschieden, dass sie sich dieses Risiko nicht antun wird. Doch Mohring erwägt eine Kandidatur. Er sucht auf verschiedenen Wegen Gespräche mit den Sozialdemokraten, er redet auch mindestens einmal mit Höcke.
Anfang November trifft sich Mohring mit seinem Fraktionsvorstand. Was er nicht weiß: Das Gespräch wird mutmaßlich mitgeschnitten. Angela Merkel, erzählt er seinen Kollegen, habe zu ihm gesagt: „Aber passt auf, dass der Ramelow nicht noch die AfD einkauft.“16 Im Umkehrschluss habe er für sich festgestellt: „Wenn sie zu mir sagt, ich soll aufpassen, dass der Ramelow nicht die AfD einkauft, dann muss sie uns aber auch überlassen, dass wir die AfD einkaufen.“ Aus Mohrings Sicht bedeutet dies: „Wenn sie will, dass Ramelow nicht MP wird, brauchen wir die AfD, ob’s ihr passt oder nicht.“
Er selbst, sagt er, könne sich eine Kandidatur vorstellen, aber nur, wenn es eine Chance auf das Ministerpräsidentenamt gebe. „Mindestens muss klar sein: Die CDU muss stehen, und die AfD muss stehen. Also wenn, muss ich mit 45 Stimmen da rausgehen.“ Die AfD soll für ihn ganz offenbar als Mehrheitsbeschaffer dienen.
Aber das sind nur interne Aussagen. In der Öffentlichkeit spricht er nicht über eine Kandidatur. Und er setzt vor allem auf Abweichler aus SPD und Grünen, um eine absolute Mehrheit Ramelows zu verhindern. Schließlich würde den Linken eine einzige fehlende Stimme aus dem rot-rot-grünen Lager in den dritten Wahlgang zwingen – womit es ihm wie Lieberknecht fünf Jahre zuvor erginge. Träte dann niemand gegen ihn an, könnte Ramelow am Ende mehr Nein- als Ja-Stimmen erhalten.
Mohrings Interpretation lautet, dass der Linke damit nicht gewählt sei und alle Gespräche neu beginnen müssten. Oder der Ministerpräsident wäre halt fortan delegitimiert. Den CDU-Fraktionschef kümmert es wenig, dass er damit ein Verfassungsorgan beschädigte und dass seine Landespartei noch 2009 die exakt gegenteilige Rechtsmeinung vertreten hatte.
Die Reaktion folgt prompt. Der geschäftsführende SPD-Justizminister Holger Poppenhäger beauftragt den Verfassungsrechtler Martin Morlok mit einem Gegengutachten. Der begründet auf 28 Seiten, dass es die ausdrückliche Intention der Verfassung sei, nach einer Landtagswahl eine neue, arbeitsfähige Regierung zu bilden. Deshalb stelle Artikel 70, Absatz 3 der Verfassung sicher, dass in jedem Fall ein Ministerpräsident gewählt werde. Der letzte Satz des Papiers lautet: „Alles in allem: Tritt im Wahlgang […] nur ein Bewerber an, so ist er mit jeder Zahl der für ihn abgegebenen Stimmen gewählt, unabhängig von der Zahl der nicht für ihn abgegebenen Stimmen.“17
Mohring lässt sich nicht beirren. Er bleibt bei seiner Strategie, Ramelow zu beschädigen, zumal der wissenschaftliche Dienst der noch von seiner Partei kontrollierten Landtagsverwaltung ein Gutachten erstellt hat, das Morlok widerspricht. Aber nun mischt sich Lieberknecht ein. Noch ist sie die Landesvorsitzende. „Für das Ansehen Thüringens ist jedoch wichtig, dass es gar nicht zu einer solchen Situation kommt und ein Ministerpräsident eine klare und eindeutige Legitimation hat“, sagt sie.18 Das Amt des Regierungschefs dürfe „nicht zum Fall für Gerichte werden“.