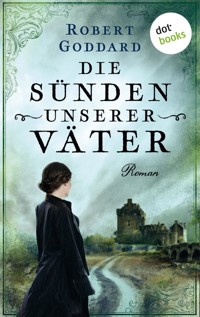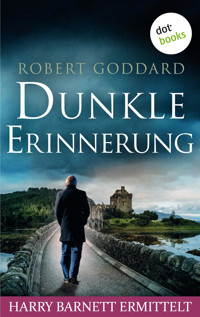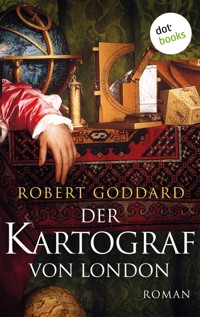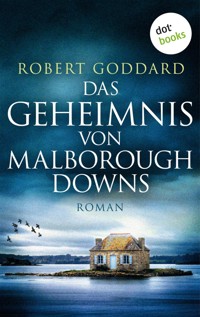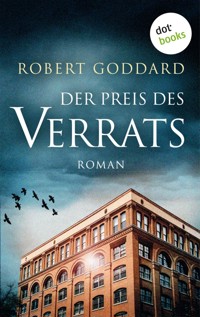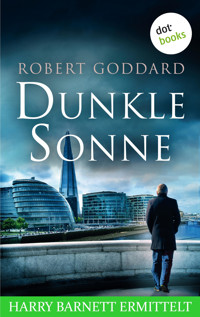
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Harry Barnett
- Sprache: Deutsch
Was würdest Du tun, um Dein einziges Kind zu retten? Der düstere Krimi »Dunkle Sonne« von Robert Goddard jetzt als eBook bei dotbooks. Der etwas in die Jahre gekommene Harry Barnett will eigentlich nur in aller Ruhe sein Bier im Pub trinken – doch er scheint dunkle Schicksale wie magisch anzuziehen. Die Nachricht, dass er vor über 30 Jahren einen Sohn gezeugt hat, von dem er nie erfahren hat, trifft ihn komplett unvorbereitet – noch dazu, weil David nach einem angeblichen Suizidversuch im Koma liegt. Aber warum wollte der weltweit angesehene Mathematiker Selbstmord begehen … und wer hat all seine wissenschaftlichen Aufzeichnungen gestohlen? Harry beginnt, Nachforschungen anzustellen: Alle Spuren führen zu dem ebenso undurchsichtigen wie einflussreichen Unternehmen Globescope, in dessen Forschungsabteilung David an Theorien arbeitete, die alles in Fragen stellen, was wir über die Welt zu wissen glauben. Und nun verschwinden immer mehr seiner Kollegen spurlos. Harry erkennt: Wenn er seinen Sohn retten will, muss er es mit einem Gegner aufnehmen, dessen Macht und Einfluss grenzenlos scheinen … »Ohne Zweifel das bisher fesselndste Buch von Robert Goddard!« The Times Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der packende Krimi »Dunkle Sonne« vom Meister britischer Spannung Robert Goddard ist der zweite Band der Harry Barnetts-Trilogie, deren Bände alle unabhängig voneinander gelesen werden können. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 494
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Der etwas in die Jahre gekommene Harry Barnett will eigentlich nur in aller Ruhe sein Bier im Pub trinken – doch er scheint dunkle Schicksale wie magisch anzuziehen. Die Nachricht, dass er vor über 30 Jahren einen Sohn gezeugt hat, von dem er nie erfahren hat, trifft ihn komplett unvorbereitet – noch dazu, weil David nach einem angeblichen Suizidversuch im Koma liegt. Aber warum wollte der weltweit angesehene Mathematiker Selbstmord begehen … und wer hat all seine wissenschaftlichen Aufzeichnungen gestohlen? Harry beginnt, Nachforschungen anzustellen: Alle Spuren führen zu dem ebenso undurchsichtigen wie einflussreichen Unternehmen Globescope, in dessen Forschungsabteilung David an Theorien arbeitete, die alles in Fragen stellen, was wir über die Welt zu wissen glauben. Und nun verschwinden immer mehr seiner Kollegen spurlos. Harry erkennt: Wenn er seinen Sohn retten will, muss er es mit einem Gegner aufnehmen, dessen Macht und Einfluss grenzenlos scheinen …
»Ohne Zweifel das bisher fesselndste Buch von Robert Goddard!« The Times
Über den Autor:
Robert William Goddard, geboren 1954 in Fareham, ist ein vielfach preisgekrönter britischer Schriftsteller. Nach einem Geschichtsstudium in Cambridge begann Goddard zunächst als Journalist zu arbeiten, bevor er sich ausschließlich dem Schreiben von Spannungsromanen widmete. Robert Goddard wurde 2019 für sein Lebenswerk mit dem renommierten Preis der Crime Writer's Association geehrt. Er lebt mit seiner Frau in Cornwall.
Robert Goddard veröffentlichte bei dotbooks auch die Kriminalromane »Im Netz der Lügen«, »Der Preis des Verrats«, »Eine tödliche Sünde«, »Die Frau im roten Mantel«, »Denn ewig währt die Schuld«, »Das Geheimnis von Trennor Manor«, »Und Friede den Toten«, »Die Sünden unserer Väter«, »Das Geheimnis der Lady Paxton« und »Das Haus der dunklen Träume«.
Robert Goddard veröffentlichte bei dotbooks weiterhin die historischen Kriminalromane »Die Schatten der Toten«, »Jäger und Gejagte«, »Die Klage der Toten« und »Der Kartograf von London«.
Robert Goddard veröffentlichte außerdem bei dotbooks seine drei Kriminalromane mit dem Ermittler Harry Barnett »Dunkles Blut«, »Dunkle Sonne« und »Dunkle Erinnerung«.
***
Aktualisierte eBook-Neuausgabe Juni 2020
Dieses Buch erschien erstmals 1996 unter dem Originaltitel »Out of the Sun« bei Bantam Press, London. Die deutsche Erstausgabe erschien 1997 unter dem Titel »Die Zauberlehrlinge« bei C. Bertelsmann, München
Copyright © der englischen Originalausgabe 1996 Robert Goddard
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1997 C. Bertelsmann, München
Copyright © der aktualisierten Neuausgabe 2020 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/John Gomez, Plus One
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (CG)
ISBN 978-3-96148-893-3
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Dunkle Sonne« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Robert Goddard
Dunkle Sonne
Roman
Aus dem Englischen von Elke vom Scheidt
dotbooks.
Für Duncan
Kapitel 1
Wenn er jetzt ginge oder selbst erst in fünf Minuten, bliebe alles in bester Ordnung. Nur, er würde nicht gehen. Er wußte das. Und sie auch.
»Noch einen?«
»Besser nicht. Sonst kann ich nicht mehr gerade streichen.«
»Dann versuchen Sie's erst gar nicht.«
»Was ist mit Claude? Er wird nicht gerade erfreut sein, wenn der Anstrich bis zum Wochenende nicht fertig ist.«
»Ich werde ihm sagen, es hätte geregnet.«
»Wird er Ihnen glauben?«
»Wen interessiert das? Also, was ist jetzt mit dem Drink?«
»Sie sollten mich nicht in Versuchung führen.«
»Wer sagt denn, daß ich das will?« Sie schenkte ein, und Gin floß in sein Glas.
»Ob Sie's wollen oder nicht«, sagte er, hob das Glas an die Lippen und trank genußvoll etwas von der starken Mixtur, »Sie tun es jedenfalls.«
»Wirklich?«
»O ja. Sehr. Und ich war noch nie gut darin, irgendeiner Versuchung zu widerstehen.«
»Nein?«
»Nein!«
»Das ist komisch.«
»Warum?«
»Ich nämlich auch nicht, Harry.«
Vierunddreißig Jahre, drei Monate und einige Tage später gab es nichts, was Harry Barnett hätte in Versuchung führen können, als er in südlicher Richtung durch die Scrubs Lane trottete. Die steife herbstliche Brise war mit den Abgasen des Straßenverkehrs und einem Stickstoffcocktail aus den Industrieschloten angereichert. Noch mehr davon wäre kaum auszuhalten gewesen. Während er von der Eisenbahnbrücke über die farblose Fläche des Friedhofs von Kensal Green starrte, dessen Gräberreihen eine noch kältere Grauschattierung aufwiesen als der unfreundliche Londoner Himmel, stellte Harry fest, daß so ungefähr das letzte, was er im Augenblick brauchte, eine Extradosis von irgendeinem der trostlosen Bestandteile seines Lebens war.
Einer der trostlosesten war sein Teilzeitjob in der Servicestation Mitre Bridge, die auf halber Höhe der Scrubs Lane in Fahrtrichtung der A40-Straßenüberführung lag. Er war schon zu spät dran für seine fünfstündige Schicht aus Geldzählen und Kartenentwerten, aber sein rechter Fußknöchel tat nach dem gestrigen Straucheln auf dem nächtlichen Heimweg von Stonemason's Arm so weh, daß an eine schnellere Gangart nicht zu denken war. Außerdem war Shafiq ein verständnisvoller Mensch. Für einen Moslem war er wirklich erstaunlich tolerant gegenüber den Ausrutschern, die einem Mann passieren konnten, wenn er ein paar Gläser zuviel intus hatte. Natürlich würde er meckern, das war nicht anders zu erwarten. In gewissem Sinne war das die Art, wie sie beide bei Verstand blieben.
Aber seltsam, als Harry ein paar Minuten später den Vorplatz von Mitre Bridge betrat und nicht allzu schnell durch die von Benzin in allen Regenbogenfarben schillernden Pfützen zum Kassen- und Verkaufsraum der Tankstelle tappte, blickte Shafiq mit einem Ausdruck verwirrten Mitgefühls von der Theke auf. Die Schimpftirade, auf die Harry sich gefaßt gemacht hatte, blieb aus. Daher war er schon besorgt, bevor er die Tür ganz aufgestoßen hatte. Wie sich herausstellte, allerdings nicht halb so besorgt, wie er eigentlich hätte sein sollen.
»Harry, mein Freund«, sagte Shafiq, »gut, dich zu sehen!«
»Du brauchst nicht sarkastisch zu werden. Ich bin gekommen, so schnell ich ...«
»Ich bin nicht sarkastisch, Harry. Wie kommst du bloß darauf?«
»Dazu gehört nicht viel. Aber laß nur, jetzt bin ich ja da. Du kannst nach Hause abhauen.«
»Unter diesen Umständen? Kommt ja gar nicht in Frage.«
Harry, der gerade seinen Anorak ausziehen wollte, hielt mitten in der Bewegung inne. »Wovon redest du eigentlich?«
»Ich bin sicher, Mr. Crowther hätte nichts dagegen, wenn du direkt ins Krankenhaus fahren würdest.«
Mit einem Schulterzucken streifte Harry seinen Anorak wieder über, trat an die Theke, beugte sich darüber und starrte in Shafiqs rundliches, besorgtes Gesicht. »Hast du Frostschutzmittel geschnüffelt, Shafiq? Wovon zum Teufel redest du?«
»Tut mir leid, Harry. Ich hab's nicht richtig erklärt. Aber es war eine Überraschung, ja, direkt ein Schock. Ich hatte ja keine Ahnung, daß du einen Sohn hast.«
Jetzt war Harry mit der Besorgnis an der Reihe. »Einen Sohn?«
»Ja, sie haben vor ungefähr zwanzig Minuten angerufen. Dein Sohn ist im National Neurological Hospital. Ich habe die Zimmernummer notiert.«
Vogelzwitschern und der Geruch frischer Farbe drangen durch das mit einer Tüllgardine verhängte Fenster, während Harry wieder zu Atem kam. Aus dem Augenwinkel konnte er die von der Tür bis zum Bett achtlos verstreuten Kleidungsstücke sehen. In seinen Gedanken war jede Bewegung, mit der sie diese Kleider ausgezogen hatten, schon köstliche Erinnerung. Wenn auch nicht so köstlich wie das, was danach gekommen war. Und auch nicht so berauschend wie die Genüsse, die er vielleicht noch kosten würde.
Sie lag auf der Seite, mit dem Rücken zu ihm. Schämte sie sich vielleicht schon? Bereute sie jetzt, nach dem Höhepunkt, das Verlangen, dem sie erlegen war? Er streckte die Hand aus und fuhr mit den Fingern langsam über ihr Rückgrat, umfaßte ihr Gesäß, glitt zwischen ihre Beine. An dem kehligen Laut, mit dem sie darauf reagierte, merkte er, daß Scham und Reue kein Problem sein würden. Nicht für sie. Und für ihn schon gar nicht.
»Mach's mir noch mal, Harry«, murmelte sie und öffnete einladend die Schenkel.
»Willst du wirklich?«
»Hat mein Mann nicht gesagt, du solltest alles tun, was ich verlange?«
»Aber ja, Mrs. Venning, das hat er.«
»Also, worauf wartest du?« Ihr Atem ging wieder schneller, als er sie streichelte. »Einmal ist nie genug für einen richtigen Endspurt.«
»Wie oft wäre denn genug?«
»Das sag ich dir später«, antwortete sie und stöhnte. »Viel später.«
»Ich habe keinen Sohn, Shafiq. Und auch keine Tochter. Ich habe überhaupt keine Kinder. Ich bin der letzte Barnett. Chingachgook, der letzte Mohikaner. Ende der Fahnenstange. Absolutes Ende. Okay?«
»Wenn du es sagst, Harry.«
»Ich sag's. Wer war denn der Typ, der dich da angerufen hat?«
»Hätte auch eine Frau sein können, weißt du. Eine dieser komischen Stimmen, bei denen man das nicht sagen kann.«
»Wer auch immer. Was auch immer. Die haben was verwechselt. Das da im Krankenhaus muß der Sohn von irgendeinem anderen armen Teufel sein.«
»Aber sie hatten deinen Namen, Harry Barnett.«
»Davon gibt es Dutzende, vielleicht Hunderte.«
»Aber nur einer davon arbeitet hier.«
»Sehr lustig. Und nun schieb ab, ja? Ich habe zu tun.« Er nickte in Richtung auf den Vorplatz, wo mehr oder weniger gleichzeitig drei Autos vorgefahren waren.
»In Ordnung, wenn du sicher bist.«
»Ich bin sicher!«
Shafiq fingerte einen Augenblick an seinem Schnurrbart herum, seufzte dann ohne besonderen Anlaß und schlurfte davon. Harry war froh, ihn gehen zu sehen. Wenn er erst fort war, konnte er hoffentlich den merkwürdig verstörenden Gedanken verdrängen, daß er womöglich irgendwo einen Sohn hatte. Bei dem Leben, das er geführt hatte, war das nicht so ausgeschlossen, wie er Shafiq gegenüber behauptet hatte. Vielleicht gar nicht ausgeschlossen. Andererseits hatte er die letzten zehn oder zwölf Jahre trotz seiner kurzen und einzigen Erfahrung mit der Ehe überwiegend zölibatär gelebt. Irgendeine Vaterschaft, von der er nichts wußte, mußte also derart lange zurückliegen, daß er sicherlich schon vor Ewigkeiten davon erfahren hätte. Wenn überhaupt.
Es gab natürlich eine einfache Methode, die Sache zu klären: im National Neurological Hospital anzurufen und sich zu vergewissern, daß der Patient von Zimmer E318 niemand war, dessen Vater er sein konnte, sosehr er seine Phantasie auch anstrengen mochte.
Warum es ihm so widerstrebte, diesen einfachen Schritt zu tun, hätte Harry nicht erklären können, nicht einmal sich selbst. Aber schließlich war er derart irritiert, weil ihm die Sache nicht aus dem Kopf ging, daß seine Abwehr erlahmte. In einer Pause zwischen zwei Kunden rief er im Krankenhaus an.
»National Neurological Hospital.«
»Man hat mir mitgeteilt, ein enger Verwandter von mir läge auf Zimmer E318 in Ihrem Krankenhaus, aber ich glaube, das muß ein Irrtum sein. Könnten Sie mir den Namen des Patienten in diesem Zimmer sagen? Nur zur Sicherheit.«
»Bitte bleiben Sie am Apparat.« Eine Pause folgte, dann: »Zimmer E318, sagten Sie?«
»Ja.«
»Der Name des Patienten ist Venning. David John Venning.«
»Einmal ist nie genug«, hatte Iris Venning gesagt. Und sie hatte Wort gehalten. Die Ehe mit Claude mußte noch öder sein, als Harry angenommen hatte, um in Iris eine solche Sehnsucht nach physischer Entladung zu wecken, wie Harry sie an diesem Nachmittag unter seinen Händen spürte. Sie blühte auf wie eine exotische Blume, deren Fleisch ebenso warm und sinnlich war wie ihr Duft.
Was ihrer beider Hingabe steigerte – das wurde ihm erst nachträglich klar –, war das gemeinsame Wissen, daß sie auf lange Sicht nichts zu bedeuten hatte. Claude war in den letzten drei Jahren sein Abteilungsleiter im Stadtrat von Swindon gewesen, und in dieser Zeit hatte Harry Iris nicht mehr als ein- oder zweimal gesehen, flüchtig und gewöhnlich dann, wenn alle nach irgendeinem geselligen Anlaß schon zuviel getrunken hatten. Aber vielleicht hatte sein bewundernder Blick ihr trotzdem das signalisiert, was sie suchte. Vielleicht hatte sie und nicht Claude die Idee gehabt, Harry eine freie Woche vorzuschlagen, in der er in einer Schönwetterperiode im Juli 1960 ihr Haus streichen sollte. Claude hatte damals seit zwei Monaten einen neuen und besseren Job beim Manchester City Council, und seine Beziehungen zu Swindon beschränkten sich auf ein Haus, das sich als schwer verkäuflich erwies, und eine Ehefrau, die ihm erst nach Norden folgen konnte, wenn das Haus verkauft war. Wahrscheinlich hatten sie gedacht, ein neuer Anstrich verbessere die Verkaufschancen. Und Harry kam sicher billiger als irgendein Fachmann, das hätte Claudes knauseriger Natur entsprochen. Was der Natur seiner Frau entsprach, sowohl an Häufigkeit als auch an Vielfalt, hatte Harry mit lustvollem Erstaunen entdeckt. Mit der weiteren Erforschung dieses Themas befaßte er sich noch mehrfach, als der Anstrich des Hauses längst fertig war. Der Sommer schritt voran, der Verkauf kam und kam nicht zustande, und der arme alte Claude schlief noch immer sechs von sieben Nächten allein in seinem preiswerten Quartier in Manchester. Während Harry und die schöne Iris ...
Doch jedes Idyll nimmt einmal ein Ende, im besten Fall, wie hier, bevor es schal wird. Im September trat ein Käufer auf den Plan, und Ende des Monats war Iris zu ihrem Mann nach Manchester gezogen. In mancher Hinsicht war das eine Erleichterung, wahrscheinlich für beide. Es schloß ein Kapitel in ihrem Leben ab, das wegen seiner Kürze um so befriedigender gewesen war. Die Trennung war endgültig und in zweierlei Hinsicht gut: Lust ohne Bindung, Erinnerung ohne Andenken.
Gelegentlich, wenn er sich selbst leid tat oder gerade von irgendeinem der vielen Mädchen, die auf seine Anmache nicht reagierten, abgewiesen worden war, dachte Harry an die spektakulär einfache Eroberung von Iris Venning zurück. Dann kamen ihm gewisse Bilder und Empfindungen in den Sinn: ihr gerötetes Gesicht mit geschlossenen Augen und offenem Mund, das er im Spiegel über dem Kamin sah, als sie auf dem Sofa eine akrobatische Vereinigung feierten; das Rascheln von Nylon auf Fleisch, wenn er ihr die schwarzen Strümpfe von den weichen, weißen Schenkeln zog; die kühle Haut und die Üppigkeit ihrer Brüste und Gesäßbacken; der unangestrengte Drang, der sie zusammentrieb, und vor allem ihr heftiges Verlangen, in seiner Phantasie gesteigert, bis sein eigenes ganz nebensächlich erschien – ihr Verlangen und sein Genuß.
Als die Jahre vergingen und Harry andere Erfahrungen machte, verblaßten diese Erinnerungen in seinem Gedächtnis und wurden nur selten, wenn überhaupt, wieder hervorgeholt. Ein verschwommenes Bild ihres Körpers, ein verwischter Eindruck von ihrem Gesicht, ihr leise geflüsterter Name. Sonst nichts. Und am Ende gab es nicht einmal mehr das. Warum auch? Wahrscheinlichkeit und gesunder Menschenverstand sprachen dafür, daß sie sich nie wieder begegnen würden.
Bis zum Ende seiner Schicht und der Ablösung durch Crowther hatte Harry vorgehabt, durch die Scrubs Lane nach Kensal Green zurückzukehren und pünktlich anzukommen, wenn Terry die verriegelte Tür des Stonemason's öffnete. Vermutlich war es auch genau das, was er vernünftigerweise tun sollte. Aber die Neugier und die heimliche Erinnerung ließen ihn nicht mehr los. Also wandte er sich schließlich statt dessen nach Süden zur U-Bahn-Station White City. Dort nahm er die Central Line nach Holborn und ging zur Stoßzeit durch Bloomsbury hindurch zu dem Krankenhauskomplex um Great Ormond Street und Queen Square. Das National Neurological war ein pompöses Bauwerk im edwardianischen Stil: Marmorsäulen, hohe Decken, lange, hallende Gänge. Ein großer, moderner Anbau klebte daran wie ein neues Haus an einer alternden Schnecke; hier dominierten helles Licht und klinische Nüchternheit.
Harrys Weg führte in diesen neuen Teil des Krankenhauses, geleitet von Hinweistafeln und Pfeilen, nicht von Krankenschwestern oder Empfangsdamen, die er nicht gern um Auskunft bitten wollte. Die Gründe für seinen Besuch waren schließlich nicht sonderlich vertrauenerweckend, nicht einmal für Harry selbst.
Aber den Schildern war leicht zu folgen, und keiner schien sich auch nur entfernt für die allein und mit gesenktem Kopf dahintrottende Gestalt zu interessieren. Als er den dritten Stock erreicht und ein leeres Schwesternzimmer passiert hatte, fand er ohne große Schwierigkeiten das Ende eines kurzen Ganges mit einem trüben Fenster, durch das er über ein Durcheinander von Dächern hinweg die schmutzverkrustete Flanke des British Museum erspähte. Zimmer E318. In Augenhöhe hing ein Namensschild an der Tür: David Venning. Also kein Irrtum. Aber trotzdem ein Fremder, da war Harry immer noch sicher. Es sei denn, die vermeintliche Sicherheit war in Wirklichkeit eine verblassende Hoffnung.
Er stieß die Tür auf und trat ein. Das Zimmer war klein, aber komfortabel möbliert. Helles Holz, pastellfarbener Teppichboden und ein großes Fenster mit geblümtem Vorhang schufen eine denkbar helle, luftige und normale Atmosphäre. Allerdings endete die Normalität am Bett. Reglos lag ein junger, dunkelhaariger Mann darin, den Kopf auf ein glattes Kissen gebettet. Seine Arme ruhten gleich stark angewinkelt auf der Bettdecke. Er gab kein vernehmbares Geräusch von sich, und doch war es nicht still, Harry hörte den stetigen Rhythmus künstlicher Beatmung. Auf einem niedrigen Tisch neben dem Bett, durch einen gerippten Plastikschlauch mit einem Ventil am Hals des Mannes verbunden und an den Luftröhrenschnitt angeschlossen, durch den seine Lungen gefüllt und entleert wurden, stand ein Beatmungsgerät mit einer Art Gebläse. Ohne das der Mann, so sagte Harry sein geringes medizinisches Wissen, sterben würde. Das sah nicht gut aus. Friedlich, ja fast heiter. Aber alles andere als gut.
So traurig der Anblick eines scheinbar vitalen und gesunden jungen Mannes auch war, der regungslos und künstlich beatmet dalag, vorerst war er für Harry nicht mehr als das. Er hatte nichts damit zu tun. Er brauchte sich nicht darum zu kümmern. Er ging ihn nichts an. Wer immer David John Vennings Vater war, Harry konnte es nicht sein. Oder doch?
»Geburtsdatum«, murmelte Harry vor sich hin, während er zum Fußende des Bettes ging und ein Klemmbrett mit vielen Aufzeichnungen in die Hand nahm, das an einem der Gitterstäbe hing. »Damit das klar ist.« Und in gewissem Sinn war es dann auch klar. Wenn auch nicht so, wie Harry gehofft hatte. David John Venning. Geb. am 10. 05. 61. »Oh, verdammter Mist!« David John Venning war im Frühling nach dem Sommer von Harrys längst vergessener Affäre mit Iris Venning geboren.
Kapitel 2
Als er das Krankenhaus verließ, hatte Harry keinen ernsthaften Zweifel mehr daran, daß es sich bei dem komatösen Patienten im Zimmer E318 um seinen eigenen Sohn handelte. Nicht nur wegen des Zusammentreffens von Namen und Datum, nicht nur, weil die stolzen Eltern neben David Venning auf einem gerahmten Schulabschlußfoto auf dem Nachttisch als ältere Versionen des Claude, mit dem er gearbeitet hatte, und der Iris, die ihn vor vierunddreißig Sommern verführt hatte, zu erkennen waren. Es war zwar möglich, daß der Junge bei einem von Claudes Wochenendbesuchen zu Hause und nicht in den Tagen dazwischen gezeugt worden war. Möglich, aber unwahrscheinlich, vor allem angesichts von Harrys Meinung über Claudes Manneskraft im Vergleich mit seiner eigenen.
Doch all das war eigentlich nicht entscheidend. Was Harry letztlich überzeugte, war der Anruf. Jemand wußte, daß er tatsächlich Davids Vater war, und meinte, er solle über dessen Zustand unterrichtet werden. Und der war, wie eine Krankenschwester vorsichtig einräumte, ernst, sehr ernst. David Venning war seit fast einem Monat im Krankenhaus und hatte die ganze Zeit in tiefem Koma gelegen. Was die Genesungschancen betraf, wollte die Schwester sich nicht festlegen. Sie mißtraute offenbar Harrys Behauptung, er sei ein alter Freund der Familie, der irgendwie den Kontakt verloren habe. Wenn er Adresse und Telefonnummer der nächsten Angehörigen nicht kenne, so könne sie sie ihm auch nicht geben. Allerdings korrigierte sie ihn in einem Punkt: Davids Mutter hieß Iris Hewitt, nicht Iris Venning. Also geschieden oder verwitwet und wiederverheiratet. Nun, das Schulabschlußfoto war vermutlich vor mehr als zehn Jahren aufgenommen worden. So überraschend war das nicht. Armer alter Claude – so oder so.
Nur wenig mitteilsamer war die Schwester hinsichtlich der Ursache von Davids Koma. Sie sagte nur, es hinge mit Diabetes zusammen. Grausame Schicksalswillkür bei einem so gutaussehenden jungen Mann, und doppelt grausam, wenn man bedachte, daß sein übergewichtiger und immer kränklicher Vater im Grunde ziemlich fit geblieben war.
Harry zuckte zusammen, als er in einem der dunkler werdenden Fenster sein eigenes Spiegelbild erblickte. Er machte keine gute Figur. Nach dem Foto zu urteilen war Iris wesentlich ansehnlicher gealtert als er selbst. Aber das war wohl auch zu erwarten gewesen.
Eine mitfühlendere Lernschwester teilte ihm mit, Mrs. Hewitt besuche ihren Sohn jeden Nachmittag, gewöhnlich zwischen vierzehn und sechzehn Uhr. Wenn Harry sie sehen wolle, solle er es um diese Zeit versuchen.
Ob das klug wäre, erwog er später bei mehreren Bier in einem nahe gelegenen Pub. Vor vierunddreißig Jahren wäre er meilenweit gerannt, um Vater zu werden. Im Prinzip würde er das auch heute noch tun. Doch die ruhige, stille, wartende Gestalt in dem Bett hatte nichts mit Prinzipien zu tun. Sie war eine Person. Ein Körper und eine Seele. Ein Sohn, den er nie gekannt hatte. Ein Mann, den er nie getroffen hatte. Bis jetzt.
Und dann war da noch der Anruf, auf den er immer wieder zurückkam. Wer außer Iris konnte das gewesen sein? Sie allein wußte es sicher. Der Anruf mußte von ihr gekommen sein. Und wenn das so war, dann war er eine Art Aufforderung. Ein Hilfeschrei vielleicht, eine Bitte um Unterstützung. Sie mußte sich einige Mühe gemacht haben, um ihn aufzuspüren. Unter diesen Umständen konnte er sie kaum ignorieren. Aber warum, wenn sie es wirklich war, hatte sie weder Namen noch Telefonnummer hinterlassen? Warum diese Anonymität? Sie mußte doch wissen, daß er dahinterkommen würde.
Vom Pub aus rief Harry Shafiq an und fragte, ob er bereit wäre, morgen die Schicht mit ihm zu tauschen. Zu einer Erklärung gedrängt, räumte er ein, es habe etwas mit den Besuchszeiten des Krankenhauses zu tun. Dann behauptete er, kein Kleingeld mehr zu haben, und legte auf, bevor Shafiq mehr tun konnte als zusagen.
Da der Tausch Harry zu einem unangenehm frühen Arbeitsbeginn zwang, ging er direkt nach Hause und hoffte, Mrs. Tandy sei schon zu Bett gegangen. Doch dieses Glück hatte er nicht. Sie war noch auf und damit beschäftigt, sich Kakao zu kochen und Sardinen kleinzuschneiden, um ihren Kater Neptun von einem benachbarten Dach zu locken. Obwohl Kakao nicht gerade das war, was Harry sich nach vier Bierchen, der plötzlichen Entdeckung eines Sohnes und dem fehlenden Abendessen wünschte, fand er sich schließlich Schokolade trinkend in der winzigen Küche wieder.
Mrs. Tandy stand derweil an der offenen Hintertür, rief nach Neptun und schwenkte die Schlüssel mit den Sardinen durch die Nachtluft, um seine Schnurrhaare von ihrem Duft erzittern zu lassen.
»Ich weiß nicht, warum ich mich mit diesem Kater abmühe«, seufzte sie. »Er wird besser behandelt als die meisten Kinder hier in der Gegend.«
Harry verschluckte sich an seinem Kakao und fragte sich unter Husten und Spucken, wie Mrs. Tandy die unheimliche Gabe entwickelt haben mochte, immer gerade über das Bemerkungen zu machen, was er am dringendsten für sich behalten wollte.
»Selwyn und ich waren nie mit Nachkommen gesegnet. Vielleicht, wenn wir Kinder gehabt hätten ... Aber andererseits, man weiß ja nie, nicht?«
»Was denn, Mrs. Tandy?«
»Wie sie sich entwickelt hätten. Was aus ihnen geworden wäre. Ich glaube, sie sind genauso oft ein Fluch wie ein Segen.«
»Na ja, ich kann da wohl kaum mitreden, oder?«
»Nein.« Mit einem verwirrenden Glitzern in den Augen sah sie sich nach ihm um. »Nein, wohl nicht.«
Kapitel 3
Dienstag war Mrs. Tandys Scrabble-Tag. Für Harry bedeutete das, daß er ungesehen aus Mitre Bridge zurückkehren, ein Bad nehmen, sich rasieren und umziehen konnte, ehe er sich auf den Weg ins Krankenhaus machte. Ein solches mittägliches Herausputzen hätte Mrs. Tandy in höchstem Maß verdächtig gefunden, genau wie seine Alkoholabstinenz, die an Harrys Nerven zerrte, als er sich auf die Reise nach Bloomsbury machte. Ganz zu schweigen von dem halben Dutzend Rundgänge um Russell Square, die er absolvierte, während er den größeren Teil eines Päckchens Karelia-Sertika-Zigaretten rauchte. Er nahm sich vor, später bei Theophilus' Laden in der Nähe von Charing Cross Road vorbeizugehen und sich einen neuen Vorrat der exotischen griechischen Marke zu besorgen, für die er nach seinen Jahren auf Rhodos eine Vorliebe hatte. Doch ob er sich bei allem anderen, was er bald würde bewältigen müssen, an eine so banale Besorgung erinnern würde, wußte er selbst nicht.
Es war fast fünfzehn Uhr, als er das Krankenhaus erreichte. Diesmal war das Schwesternzimmer im dritten Stock besetzt, doch glücklicherweise von keiner der Schwestern, die ihn gestern gesehen hatten.
»Kann ich David Venning besuchen?«
»Nun ja, er hat bereits Besuch.«
»Seine Mutter?«
»Ja.«
»Keine Sorge. Wir kennen uns.«
Er ging den Korridor entlang. Die Tür von Zimmer E318 stand halb offen, Sonnenstrahlen fielen über die Schwelle. Er blieb kurz davor stehen, als er eine Stimme hörte: Iris Venning. Sie las laut vor.
»Als Reaktion auf so unbequeme Daten haben die Kosmologen anscheinend Schweigen vereinbart. Wie kann das Universum bis zu sechzehn Milliarden Jahre alte Sterne enthalten, wenn das Hubble-Teleskop das Alter des gesamten Universums mit nur acht Milliarden Jahren angibt? Die Antwort darauf ist nicht einfach. Doch Wissenschaftlern steht es nicht an, schwierigen Fragen auszuweichen.«
Ihre Stimme hatte sich nicht verändert. Während er sie hörte, konnte er sich fast vorstellen, sie beim Eintreten so zu sehen, wie er sie zuletzt gesehen hatte: mit rotem Haar, hellen Augen und üppiger Figur, die sinnlichen Lippen zu einem einladenden Lächeln oder einem vielsagenden Kichern verzogen. Doch das Foto hatte ihn darauf vorbereitet, was er wirklich sehen würde: eine Dame mittleren Alters mit graumeliertem, vernünftig kurz geschnittenem Haar, einem vorsichtigen Ausdruck auf dem faltigen Gesicht, leblosen und schüchternen Augen, einem Lächeln, das ... Aber sie würde nicht lächeln, nicht wahr? Es gab nichts zu lächeln.
»Möglicherweise wird die Quadratur dieses Kreises die Zukunft der Astrophysik bestimmen. Vielleicht wird man den Urknall einmal als Urirrtum betrachten. Womöglich ergibt sich plötzlich eine Rolle für die oft verspottete kosmologische Konstante. Für viele allerdings wird das verdächtig nach einer letzten Zuflucht aussehen. Was wirklich erforderlich wäre ...«
Sie verstummte in dem Moment, in dem er auf der Schwelle erschien. Über fast vier Meter und einen Abgrund von Jahren hinweg sahen sie sich an. In ihren Blicken kämpfte Wiedererkennen mit Unglauben. Überrascht öffnete sich ihr Mund. Langsam nahm sie ihre Brille ab, legte die Zeitschrift nieder, aus der sie vorgelesen hatte, und starrte ihn an. Anscheinend konnte sie nicht fassen, daß er es wirklich war. Hatte er sich so verändert? Oder hatte sie gedacht, er würde ihre Nachricht ignorieren?
»Entschuldigung«, sagte sie. »Wer ...« Sie runzelte die Stirn, stand von ihrem Stuhl auf und ging um das Bett herum, um ihn besser sehen zu können. »Kenne ich Sie?«
»Ich bin's«, antwortete er und wünschte sich im gleichen Moment, er hätte sich etwas weniger dümmlich vorgestellt.
»Harry?« Ihre Augen verengten sich. Sie kam noch einen Schritt näher. »Das kann nicht sein!«
Er zuckte mit den Schultern und lächelte entschuldigend. »Vermutlich sieht man so aus, wenn man sich gehen läßt.«
Sie sagte nichts und blinzelte rasch, während sie ihn anstarrte, griff hinter sich und umklammerte das Bettgestell, als müsse sie sich stützen.
»Wie geht es dir, Iris?«
»Was ... Was machst du hier?«
»Ich habe deine Nachricht bekommen.«
»Was für eine Nachricht?«
»Über David. Über ... unseren Sohn.«
Alle Farbe wich aus ihrem Gesicht. Der Ring an ihrem Finger begann auf dem hohlen Metall des Bettgestells zu klappern. Sie zitterte, als trete auf einmal Angst an die Stelle des Schocks.
»Ich war gestern hier. Sie wollten mir nicht viel sagen.«
»Du warst das?«
»Ja. Sie haben meinen Besuch doch erwähnt, oder? Sicher hast du erraten, daß ich es war.«
»Erraten, daß du es warst? Natürlich nicht! Ich hätte niemals ...«
»Warum setzen wir uns nicht?«
Zögernd betrat er den Raum. Iris sprang plötzlich an ihm vorbei und schlug die Tür hinter ihm zu. Aus der Nähe konnte er hören, wie kurzatmig sie war, und spüren, in welchem Aufruhr sie sich befand. Aber er konnte es nicht begreifen. Ihre Reaktion ergab keinen Sinn. »Damit ich das richtig verstehe«, sagte sie langsam. »Du behauptest, du hättest irgendeine Nachricht bekommen ... über David?«
»Du hast gestern in der Tankstelle angerufen, wo ich arbeite, kurz bevor ich kam.«
»Und was habe ich gesagt?«
»Daß mein ... Sohn ... hier ist.«
»Dein Sohn?«
»David.«
»Er ist nicht dein Sohn.« Doch etwas in ihrem flackernden Blick zum Bett war so falsch wie ausweichend.
»Komm schon, Iris. Mai 61. Ich kann auch rechnen.«
»Du hast falsch gerechnet.«
»Was sagst du da?«
»Ich sage, daß David nicht dein Sohn ist. Ich sage, daß ich nicht angerufen habe. Und ich sage, daß ich gern möchte, daß du jetzt gehst.«
»Was?«
»Mein Sohn ist schwer krank, und ich mache mir größte Sorgen um ihn. Das letzte, was ich brauche – das allerletzte –, ist, daß jemand, den ich kaum kenne, aus der fernen Vergangenheit auftaucht und Anspruch auf eine Beziehung erhebt, die nur in seiner Phantasie existiert.«
»Iris, um Gottes willen ...« Sie mußte die Verblüffung in seinen Augen erkannt haben, genau, wie er in ihren die Entschlossenheit erkannt hatte. Die Nachricht war nicht von ihr gekommen, doch die entscheidende Tatsache darin stimmte. David war sein Sohn. Aber Iris hatte nicht die Absicht, irgend etwas zuzugeben. Für sie war Harry schlimmer als ein Feind und weniger als ein Fremder. Er war eine Art Rivale. Ein Rivale, den schlagen zu können sie sicher war.
»Wirst du gehen?«
»Nicht einfach wie ...«
Sie öffnete die Tür und trat hinaus in den Korridor. »Ich möchte sofort Schwester Rachel sprechen!« rief sie in Richtung Schwesternzimmer. »Es ist dringend.«
»Es ist bestimmt nicht nötig, daß ...«
»Du hast recht«, sagte sie und sah ihn direkt an. »Nicht nötig, daß du all das getan hast. Wie bist du auf die Idee gekommen, Harry? Hast du einen der Zeitungsartikel über David gelesen und angenommen, da könnte für dich ein bißchen Geld drinstecken?«
»Geld?«
»Du siehst aus, als wärst du klamm. Ich kann nicht behaupten, daß mich das überrascht. Aber wenn du denkst ...«
»Das hat nichts mit Geld zu tun!«
»Ich kann mir nicht vorstellen, was dich sonst aus der Versenkung geholt hätte.«
»Du hast mich angerufen.«
»Nein.«
»Irgend jemand hat es aber getan.«
»Das glaube ich nicht. Tatsächlich ...« In diesem Augenblick kam Schwester Rachel in Sicht, ein Muster geschäftiger, gestärkter Tüchtigkeit. »Danke, daß Sie so schnell gekommen sind, Rachel«, sagte Iris. »Ich glaube, Sie haben diesen Mann gestern kennengelernt?«
»Ja.«
»Sein Name ist Harry Barnett.«
»Ein Freund von Ihnen, hat er gesagt.«
»Ganz und gar kein Freund. Und für meinen Sohn keinerlei Hilfe. Ich habe ihn gebeten zu gehen, aber er weigert sich.«
»Ich habe mich nicht geweigert«, warf Harry ein. »Es ist bloß ...«
»Ich möchte, daß er geht. Und ich möchte nicht, daß er noch einmal kommt. Ist das klar?«
»Es ist klar, Mrs. Hewitt.« Die Schwester sah Harry mit einem unerbittlichen Blick an. »Wir haben Sicherheitspersonal, Mr. Barnett. Muß ich jemanden rufen?«
»Nein, müssen Sie nicht.«
»Dann bitte hier entlang.«
Harry versuchte einen letzten Appell. »Iris, können wir nicht einfach ...« Aber nein. Sie konnten nicht, das war offensichtlich. Mir resigniertem Schulterzucken ging er in einem Tempo, das er für würdevoll hielt, an ihnen vorbei und den Korridor hinunter.
Kapitel 4
Bier war eine Geliebte, die Harrys Aufmerksamkeit niemals verschmähte, eine Freundin, die ihn niemals abwies. Die wurstige Gleichgültigkeit, die er unter dem Einfluß von Bier erreichen konnte, umfing ihn für den Rest des Tages und vergrößerte sich mit jedem Pub, den er auf seinem erratischen Heimweg aufsuchte. Im letzten Lokal, in dem er Zuflucht suchte, konnte sogar der Unwille des Barkeepers, ihn zu bedienen, seiner Kaltblütigkeit nichts mehr anhaben.
»Meinen Sie nicht, daß Sie genug haben, Sportsfreund?«
»Oh, von vielen Sachen. Aber nicht von Bier. ›Auf dem Grund des Bierkrugs kannst du die Welt so sehen, wie sie nicht ist.‹ Das Wahrste, was ich je gelesen habe.«
»Poesie ist hier nicht am Platz.«
»Nein? Na, wenn ich mir die Dekoration ansehe, verstehe ich, was Sie meinen. Trotzdem, ein Gläschen müßte die Aussicht verschönern.«
»Also gut. Aber nur eins.«
»Natürlich. Nur eins. Gott soll mein Zeuge sein.«
Das war ein Schwur, den gebrochen zu haben er am nächsten Morgen bereute. Er erwachte spät und mit bleiernem Kopf und stellte fest, daß selbst das durch die Vorhänge gefilterte Licht der Foxglove Road schmerzhaft blendete, wenn man vor kurzem ganz allein die zu erwartenden Dividenden mehrerer Bierbrauer an ihre Aktionäre um einiges gesteigert hatte.
Er taumelte in die Miniküche, steckte sich eine Zigarette an und begann zu husten. Dann füllte er den Wasserkessel, setzte ihn auf den Herd, schluckte einen halben Liter Londoner Leitungswasser und begann seine Suche nach einem sauberen Kaffeebecher. Ehe er damit fertig war, läutete das Telefon.
»Hallo?« sagte eine krächzende Imitation seiner eigenen Stimme.
»Harry?«
»Ja, wer ...« Es war Iris. Ungläubig verstummte er. Das war einfach nicht möglich. Aber sie war es.
»Störe ich?«
»Äh ...« Er beugte sich vor und stellte das Gas ab. »Nein. Du störst nicht, wirklich nicht.«
»Es ist so ... na ja ... tut mir leid, was ich gestern gesagt habe. Wie ich reagiert habe. Es war ...«
»Verständlich.« Mit der freien Hand massierte er sich kräftig die Stirn. Es half allerdings nichts. »Ehrlich.«
»Es war der Schock. Nach all den Jahren! Der Schock und ...«
»Du brauchst nichts zu erklären.«
»Doch, ich glaube schon. Ich denke, das schulde ich dir, da du ja nun von David weißt. Könnten wir uns vielleicht treffen?«
»Ja, natürlich. Warum nicht? Ich meine ...«
»Du meinst, daß du gestern genau das wolltest und daß ich es verhindert habe. Du hast ganz recht. Ich kann mich nur entschuldigen. Du fragst dich vermutlich, was diesen Sinneswandel bewirkt hat.«
»Ich nehme an, wir hatten beide Gelegenheit, darüber zu schlafen.« Ob man die Bewußtlosigkeit, von der Harry sich noch immer zu erholen versuchte, als Schlaf bezeichnen konnte, wußte er allerdings nicht.
»Sicher. Wie auch immer, ich schlage vor, wir treffen uns woanders als im Krankenhaus. Manchmal trinke ich im Hotel Russell Tee, nachdem ich David besucht habe. Kennst du das?«
»Ja.« Natürlich kannte er es. Es war der Backsteinbau, an dem er bei seinen Runden um den Russell Square gestern nachmittag vorbeigekommen war. Das erinnerte ihn daran, daß er es wie vorhergesehen versäumt hatte, seinen Vorrat an griechischen Zigaretten zu erneuern.
»Ich treffe dich um vier in der Halle.«
»Gut.« Das bedeutete, daß er Mitre Bridge früher würde verlassen müssen. Vielleicht würde er auch einfach krank werden. Er fühlte sich so elend, daß es beinahe stimmte. Wenn seine Verfassung sich auch seltsamerweise gebessert zu haben schien, seit er den Hörer abgenommen hatte. »Ich werde dort sein.«
»Gut. Also ...«
»Eins noch, Iris.« Sein Verstand wurde jetzt klarer, auch ohne die Hilfe von Kaffee. In ihm wuchs der Argwohn, daß ihr versöhnlicher Ton womöglich so etwas wie ein Geständnis war. »Wenn du diese Nummer die ganze Zeit hattest, warum hast du dann am Montag in der Tankstelle angerufen?«
»Das war ich nicht, Harry. Ich habe heute morgen deine Mutter in Swindon angerufen. Sie hat mir diese Nummer gegeben. Oh, mach dir keine Sorgen, ich habe ihr nicht gesagt, wer ich bin. Aber die Nachricht, die du bekommen hast, war nicht von mir. Später wurde mir klar, wie dumm sich mein Gerede über das, worauf du aus wärst, angehört haben muß. Selbst wenn du über David gelesen hättest, hättest du ihn nicht mit mir in Verbindung gebracht, oder? Oder mit dir selber.«
»Wer hat mich denn dann angerufen?«
»Das weiß ich nicht. Niemand außer David und mir wissen davon, Harry. Das ist der Punkt.«
»Wissen, daß ich sein Vater bin, meinst du?«
Ein längeres Schweigen folgte, und Harry mußte sich Mühe geben, es nicht zu brechen. Dann sagte Iris: »Genau.«
Kapitel 5
Sein Hals rieb sich an der ungewohnten Enge eines durch eine Krawatte gezierten Kragens wund, seine Augen registrierten kaum die holzgetäfelte Eleganz der Umgebung. Harry nahm die Tasse mit Assamtee, den Iris ihm eingeschenkt hatte, und lehnte sich auf seinem Stuhl zurück. Er fühlte sich so, wie er auszusehen fürchtete: fehl am Platz und unbehaglich.
Iris Venning, oder Hewitt, wie er sich zu denken bemühte, wirkte im Gegensatz zu ihm völlig zu Hause in der leisen, intimen Atmosphäre. Sie trug ein einfaches, aber schmeichelhaftes Kleid, das Mrs. Tandy vermutlich als Nachmittagskleid bezeichnet hätte. Es bestätigte, daß Iris ihre Figur behalten hatte, während der zweireihige Blazer, den Harry anhatte, den Bauch nicht verbergen konnte, den er seit dem Sommer 1960 angesetzt hatte. Seine und zweifellos auch ihre Gedanken kehrten immer wieder zu diesem Sommer zurück, so sorgfältig sie auch vermieden, direkt davon zu sprechen.
Indirekt waren die Ereignisse dieses fernen Sommers der einzige Grund, warum sie sich an diesem winterlichen Nachmittag getroffen hatten. Ohne sie wäre David John Venning niemals geboren worden und läge jetzt auch nicht, nur ein paar Straßen entfernt, bewußtlos im Koma. So entwickelte die Zeit ihre eigene Rache, sowohl durch Anfänge als auch durch Enden.
»Bist du Diabetiker, Harry?« fragte Iris, nachdem er Zucker abgelehnt hatte.
»Nein.«
»Ich dachte, du wärst vielleicht Diabetiker, verstehst du? Ich dachte, David hätte die Krankheit vielleicht von dir geerbt. Er bekam sie als Teenager. Er machte nicht viel Wind darum, es war einfach ein Problem, das er lösen mußte. Darin war er immer gut. Probleme lösen. Aber diesmal ...«
»Wie ist es passiert? Das Koma, meine ich.«
»Ich weiß nicht. Ich verstehe es nicht. Er war allein in einem Hotelzimmer draußen in Heathrow. Dort hat er übernachtet, bevor er nach Amerika zurückfliegen wollte. Er wohnt und arbeitet in den Staaten, seit, ja, jetzt sind es neun Jahre. Er ist Mathematiker, Harry. Ziemlich brillant sogar. Aber das geht alles über meinen Horizont. Was er macht, worüber er nachdenkt. Über deinen auch, denke ich.«
»Ein brillanter Mathematiker?«
»Ja. Erstaunlich, nicht? In einem Alter, in dem du noch Kinderbücher gelesen hast, hat er Newtons Principia verschlungen. Und Sachen gebastelt, Dodekaeder aus Pappe, Hyperwürfel, Gott weiß was. Er war wirklich ein Wunderkind. Bestnote bei der mathematischen Abschlußprüfung in Cambridge, promoviert mit dreiundzwanzig. Wir waren so stolz auf ihn.«
»Du und Claude?«
»Ja. Claude starb ein Jahr, nachdem David nach Kalifornien gegangen war, um an der UCLA Postpromotionsforschung zu betreiben. Da hat er auch seine Frau kennengelernt. In Los Angeles.«
»Er ist also verheiratet. Hat er ...«
»Nein, keine Kinder. Außerdem sind David und Hope inzwischen wieder geschieden. Vielleicht hast du von ihr gehört. Sie hat wieder geheiratet, diesen Filmstar, Steve Brancaster.«
»Ich glaube nicht.«
»Es spielt auch keine Rolle. Es war gut für David, daß er sie loswurde. Sie hätte ihn nur zurückgehalten.«
»Von was?«
»Vom akademischen Erfolg. Sie wollte immer, daß er in den kommerziellen Sektor geht. Am Ende bekam sie ihren Willen, durch diesen Job bei Globescope. Globescope ist ein internationaler Konzern, der wirtschaftliche Voraussagen macht. David hat bis zum Frühjahr dieses Jahres für ihn gearbeitet. Aber ich glaube nicht, daß er wirklich mit dem Herzen dabei war. Als er uns letzten Monat besucht hat, war er ganz erfüllt von einem neuen Projekt, einem reinen Forschungsvorhaben.«
»Bedeutet ›uns‹ dich und deinen neuen Mann?«
»Ja. Ken war ein Golffreund von Claude. Er war nach Claudes Tod sehr gut zu mir. Wir sind jetzt fünf Jahre verheiratet. Er hat eine Ingenieurfirma in Stockport.«
»Du lebst also noch immer in Manchester?«
»In Wilmslow. Aber seit das hier passiert ist, wohne ich bei meiner Schwester in Chorleywood. David ist hergekommen, um Interesse für sein neues Projekt zu wecken. Er hat in Amerika schon allerhand Geldmittel gesammelt und schien zuversichtlich, daß das auch hier klappen würde. Ein spezialisiertes Institut zur Erforschung der Mathematik höherer Dimensionen. Frag mich nicht, was das ist, ich habe solche Sachen nie verstanden. Aber David war ganz begeistert davon und fand die Aussichten sehr aufregend. Er konnte kaum erwarten, das Projekt endlich in Gang zu bringen. Das ist es, was die Vermutung eines Selbstmordversuchs so völlig ...« Sie bemerkte seinen schockierten Blick. »Tut mir leid, vielleicht hätte ich es von Anfang an ausführlicher erklären sollen. Aber das ist nicht leicht. Ich hätte nie erwartet, daß ich all das jemandem erklären muß ... jemandem, der nie ...«
»Der nie gewußt hat, daß er einen Sohn hat, Iris. Vergiß das nicht. Ich hatte keine Ahnung.«
»Hätte es irgendwas geändert, wenn du es gewußt hättest? Hättest du zu mir gestanden, wenn ich ein paar Monate später nach Swindon zurückgekommen wäre und dir erklärt hätte, daß ich ein Kind erwarte? Ich glaube nicht, Harry. Oder glaubst du das?«
Langsam schüttelte er den Kopf. Er kapitulierte vor seiner eigenen Meinung von sich selbst und der Kraft ihres Arguments. »Nein. Mit Claude als Vater war er sicher besser dran. Aber heute früh hast du gesagt, daß er es weiß. Das über mich, meine ich.«
»Ich habe es ihm nach Claudes Tod gesagt. Ich dachte, er hätte ein Recht darauf, es zu wissen. Aber er machte sich nicht viel daraus. Mathematik war für ihn immer wichtiger als menschliche Fehlbarkeit. Noch ein Grund, warum er niemals an Selbstmord gedacht hätte.«
»Warum nimmt man an, er hätte?«
»Weil das Koma durch eine Überdosis Insulin ausgelöst wurde. Eine zu hohe Überdosis, als daß er sie sich versehentlich hätte injizieren können. Wenn ihn nicht ein Zimmermädchen gefunden hätte, wäre er mit Sicherheit gestorben. Wie die Dinge liegen ...« Sie seufzte. »Man glaubt nicht, daß er sich erholen wird, Harry. Man glaubt nicht, daß er jemals wieder aufwachen wird.«
So war das also. Die letzte Ironie. Vielleicht hatte eine körperlose Schicksalsstimme die Nachricht für Harry hinterlassen, damit er erst erfuhr, daß er einen Sohn hatte, wenn es zu spät war, Anspruch auf ihn zu erheben. »Es gibt keine Hoffnung?«
»Realistisch gesehen nicht viel. Das sagen jedenfalls die Ärzte. Natürlich geschehen manchmal Wunder. Aber sie meinen, daß die Chancen auf vollständige Genesung buchstäblich gleich Null sind. Selbst wenn er aus dem Koma erwacht, wird er bleibende Hirnschäden davontragen. Kannst du dir vorstellen, was das für einen brillanten Mathematiker bedeuten würde?«
»Nein, ich weiß nicht, ob ich das kann.«
»Sie haben vorgeschlagen, ihn von den lebenserhaltenden Maschinen abzuhängen.« Sie sah Harry direkt in die Augen. »Ihn sterben zu lassen.«
»Ich verstehe.«
»Wirklich? Verstehst du wirklich, was das für mich bedeutet?«
»Es zerreißt dich, nehme ich an.«
»Ja. Es zerreißt mich fast.« Sie wandte den Blick ab. Einen Augenblick lang war er versucht, ihre Hand zu ergreifen, physischen Trost zu bieten, wo ihm die Worte fehlten. Aber sie hatten sich nicht mehr berührt, solange David auf der Welt war, und vielleicht würden sie es nie wieder tun. »Manchmal wünschte ich ...«
»Sag es nicht.«
»Es tut mir leid«, sagte sie energisch und sah ihn wieder an. »Das ist nicht dein Problem.«
»Nein?«
»Nein. Absolut nicht. Ken und ich werden ...«
»Was denkt Ken, was du tun solltest?«
Sie schürzte die Lippen. Eine Sekunde lang verriet ihr Gesicht Schwäche. Harry glaubte zu wissen, was Ken dachte, ohne daß sie es sagen mußte. Wenn er recht hatte, war der anonyme Anruf vielleicht doch von Iris gekommen – damit er ihr half, ohne daß sie darum zu bitten brauchte.
»Ich glaube nicht, daß du dich zu etwas überreden lassen solltest, was du später bereuen könntest.«
»Wie überaus vernünftig von dir, Harry.«
»Wer immer mir diese Nachricht hinterlassen hat, hat offenbar gedacht ...«
»Ich war es nicht.«
»Wer dann?«
»Ich weiß es einfach nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, daß David das, was ich ihm gesagt habe, für sich behalten hat.«
»Vielleicht hat er es seiner Frau anvertraut.«
»Das würdest du nicht sagen, wenn du sie jemals kennengelernt hättest.«
»Oder einem engen Freund.«
»Nein. Bevor ich es ihm sagte, war ich nervös. Aber das hätte ich nicht zu sein brauchen. Er ließ keinen Zweifel daran, daß er es nicht sehr bedeutsam fand.«
»Da kannst du nicht sicher sein.«
»Nein? Nun, hat er dich aufgespürt, Harry? Hat er dich gesucht, als er die Chance dazu hatte?«
»Das war vielleicht schwierig. Ich habe im Ausland gelebt.«
»Ja. Auf Rhodos.« Ihr Blick verhärtete sich. »Ich habe in den Zeitungen über dich gelesen. Vor sechs Jahren war es, nicht? Etwas mit einem Mädchen, das in den Ferien verschwand.«
Mit müdem Fatalismus stellte Harry sich dem Augenblick, von dem er die ganze Zeit gewußt hatte, daß er kommen würde. Das Skelett in seinem Schrank war gar kein Skelett und doch sehr viel berühmter als die wirklichen Skelette. »Etwas, ja. Aber die Presse hat aus dem Geheimnis mehr gemacht als aus dessen Lösung. Wie immer.«
»Ich glaube allerdings nicht, daß die Story es bis in die amerikanischen Zeitungen schaffte. Und ich habe David keine Ausschnitte geschickt. Also befand er sich vermutlich in gnädiger Unwissenheit, was deine kurze Bekanntschaft mit dem Ruhm betrifft.«
»Iris, du kannst doch nicht denken, daß ...«
»Wie bist du überhaupt auf Rhodos gelandet? Ich habe mir immer vorgestellt, daß du dein Leben als Angestellter im Stadtrat fristest.«
»Fünf Jahre nachdem du nach Manchester gezogen bist, habe ich den Stadtrat verlassen und mit einem alten Kumpel vom National Service in der Marlborough Road einen Autohandel eröffnet. Ging leider bankrott.« Er beschloß, die betrügerische Rolle seines Partners bei dieser Episode nicht zu erwähnen, weil er fürchtete, Iris würde ihm nicht glauben. »Danach habe ich für eine Firma für Schiffselektronik in Weymouth gearbeitet. Aber leider fiel der Job nach ein paar Jahren flach.« Dieser Satz war ein weiterer Triumph der Verschwiegenheit. Er glaubte nicht, daß er Iris die Erklärung zumuten konnte, man habe ihn fälschlich der Unterschlagung bezichtigt. »Etwa um die gleiche Zeit hat mir ein Freund angeboten, mich um seine Villa auf Rhodos zu kümmern.«
»War der Freund zufällig dieser in Ungnade gefallene Minister – Alan Dysart?«
»Ja. Aber damals war er nicht Minister und nicht in Ungnade gefallen.«
»Woher kanntest du ihn?«
»Er hatte für Barry und mich gearbeitet, als er noch Student war.« Verlegen rutschte Harry auf seinem Stuhl herum. »Ach, wohin soll uns das alles führen?«
»In die Gegenwart, Harry. In deine Gegenwart.«
»Ich lebe in der Foxglove Road 78 in Kensal Green in einer Wohnung im ersten Stock. Meine Vermieterin und ihr Kater wohnen unten. Ich bezahle die Miete, indem ich halbtags in einer Tankstelle und Werkstatt arbeite. Ich komme zurecht. Ich lebe von Tag zu Tag. Ich überlebe. Was willst du sonst noch wissen?«
»Nie geheiratet?«
»Da du schon fragst: doch. Erst vor ein paar Jahren.«
»Aber ihr lebt nicht zusammen?«
»Sie ist nach Newcastle gezogen, um einen Job zu finden. Sie hat da einen Vetter, der Anwalt ist. Er hat sie als Sekretärin eingestellt.« Wachsende Vorsicht hinderte Harry an der Erklärung, daß er Zohra geheiratet hatte, um sie vor der Abschiebung nach Sri Lanka zu bewahren. Es war ein Akt unzweideutiger Großzügigkeit gewesen. Aber irgendwie dachte er, es würde sich nicht so anhören. »Das reicht über mich. Was ist mit dir? Und David?«
Sie trank Tee und wollte offensichtlich Zeit gewinnen, ehe sie antwortete. »Da gibt es etwas, was du verstehen mußt, Harry. Etwas, das nicht leicht auszusprechen ist. Was –vor vierunddreißig Jahren zwischen uns passiert ist, hatte einen tieferen Grund.«
»Was meinst du damit?«
»Claude und ich haben lange versucht, Kinder zu bekommen. Ohne Erfolg. Und ich wollte Kinder, unbedingt. Claude war ein guter Mann. Ich liebte ihn. Aber ...«
»Aber er konnte keine Kinder zeugen?«
»Nein. Aber ...«
»Aber ich konnte es.«
»Das hört sich schrecklich an, nicht? So klinisch. So ... berechnend.«
»Ich dachte, wir hätten einfach Spaß gehabt. Einfachen, unkomplizierten Spaß.«
»Einfach, ja. Unkompliziert, nein.«
»Also war die Erkenntnis, daß du von mir schwanger warst, nicht so sehr ein schrecklicher Schock, sondern eher ein befriedigendes Resultat. Hast du David das erzählt?«
»Ja. Und deshalb hätte er niemals nach dir gesucht.«
»Na, vielen Dank«, sagte er und ließ seine Bitterkeit in seinem Ton mitschwingen. »Vielen Dank, daß du meinem Sohn zu verstehen gegeben hast, daß ich nur ein Mittel zum Zweck war.«
»Dein Sohn ist er nur im strengsten biologischen Sinn.« Sie warf den Kopf zurück, als wolle sie nicht nur ruhig, sondern auch logisch reden. »Ich werde dich nicht daran hindern, ihn zu besuchen, Harry. Ich könnte es, aber ich werde es nicht tun. Andererseits werde ich nicht zulassen, daß du dich in sein Leben drängst oder in meines.«
»Wie lange habe ich Zeit, bevor du ihn abschaltest?«
»So einfach ist das nicht.«
»Würdest du mich wenigstens vorwarnen, wenn du zu einer Entscheidung gekommen bist?«
»Ja.« Sie sah ihn ernst an. »Das werde ich.« Sie nahm ein winziges Notizbuch aus ihrer Handtasche, riß eine Seite heraus, schrieb etwas darauf und schob ihm das Blatt über den Tisch zu. »Adresse und Telefonnummer meiner Schwester. Du kannst mich dort erreichen, wenn es wirklich nötig ist.«
»Weiß sie von mir?«
»Sie wird es erfahren.«
»Und Ken?«
Iris schüttelte den Kopf. »Ich werde keine Fragen mehr beantworten, Harry. Du weißt bereits alles, worauf du ein Recht hast. Vermutlich noch mehr.«
»Wer immer mir diese Nachricht hinterlassen hat, war offenbar anderer Ansicht.«
»Wenn es überhaupt eine Nachricht gab.«
»Du hast selbst gesagt, daß ich es anders nicht hätte herausfinden können.«
»Vermutlich nicht. Einfach noch ein Geheimnis.«
»Wie die Überdosis? Wenn es kein Selbstmordversuch war und kein Unfall gewesen sein kann ...«
»Hör auf!« Zum erstenmal hob sie die Stimme, was ausreichte, neugierige Blicke vom Nebentisch auf sie zu ziehen. »Ich habe diese Spekulationen satt. Glaubst du, ich hätte nicht immer wieder über all das nachgedacht? Am Ende ist das Warum und Wozu unwichtig. Es hilft ihm nicht beim Atmen oder Sprechen oder Gehen. Gar nichts hilft.«
Sie zitterte jetzt und hatte Tränen in den Augen. »Ich frage mich, ob es eine Art Strafe dafür sein könnte, daß ich Claude betrogen habe. Dasselbe habe ich mich schon gefragt, als seine Zuckerkrankheit zum erstenmal diagnostiziert wurde. Und jetzt das. Da kommt man schon ins Nachdenken.«
»Du weißt, daß das lächerlich ist.«
»Ja.« Sie tupfte ihre Augen mit einem Taschentuch ab und putzte sich die Nase. »Natürlich weiß ich das. Und natürlich hoffe ich, daß er wieder gesund wird. Lächerlich. Aber ich kann nicht anders.«
»Ich auch nicht.«
Diese Bemerkung mit ihrer Andeutung von Intimität schien auf einmal zuviel für Iris. »Warum sollte dir daran liegen?« versetzte sie barsch. »Dir bedeutet er nichts.«
»Vielleicht, weil ich sonst niemanden habe, an dem mir liegt.«
»Genau.« Ihr Ausdruck war jetzt hart, gezeichnet von der Qual, die sie durchmachte. »Wenn du selbst eine Familie hättest, würde es dich nicht interessieren, nicht? Du würdest es gar nicht wissen wollen.«
»Du hast leicht reden, weil du weißt, daß ich dir nicht das Gegenteil beweisen kann.«
»Das reicht nicht.« Sie sah auf ihre Uhr. »Ich muß gehen. Blanche wird sich schon fragen, wo ich bin.« Sie stand eilig auf, nahm eine Zehnpfundnote aus ihrer Handtasche und warf sie auf Harrys Seite des Tisches. »Könntest du bitte die Rechnung für mich bezahlen? Das sollte reichen.«
»Es ist nicht nötig, daß du ...« Doch als er im Aufstehen ihrem Blick begegnete, erkannte Harry, daß es aus ihrer Sicht zwingend notwendig war. Sie wollte ihm nichts schuldig bleiben, auch nicht in den trivialsten Dingen. Damit sie und er nicht daran erinnert wurden, was sie sich gegenseitig schuldeten, ohne daran etwas ändern zu können.
»Leb wohl, Harry«, sagte sie mit kühler Endgültigkeit.
Kapitel 6
An nächsten Morgen wirkte Zimmer E318 im National Neurological Hospital warm und dumpf. Die Beatmungsmaschine stieß ihre gemessenen, mütterlichen Atemzüge aus, und eine Vase mit frischer Iris verbreitete symbolische Heiterkeit. Die entfernten Klänge gedämpfter Stimmen und vertrauter Bewegungen verdichteten sich zu einem institutionellen Universum aus Pflege und Mitgefühl. Es umgab Harry von allen Seiten, umschloß ihn und seinen schweigenden Sohn, bezog ihre Vergangenheit ein und das, was sie an Zukunft noch haben mochten.
»Deine Mutter hat meine Verbannung aufgehoben«, bemerkte Harry bei einem seiner einseitigen Konversationsversuche. »Du wirst mich also häufiger sehen. Solange du nichts dagegen hast, heißt das. Wenn du es nicht willst, mußt du es sagen. Wir haben natürlich eine Menge aufzuholen. Wenn du willst, erzähle ich dir von mir. Da gibt es nichts Bemerkenswertes zu berichten. Nicht wie bei dir. Ich meine, Mathematik! Ich wüßte gar nicht, wo ich anfangen sollte. Das Quadrat der Hypotenuse ist gleich der Summe der Quadrate auf den beiden anderen Seiten. Darüber kenne ich einen Witz ... Na ja, ich nehme an, den willst du sowieso nicht hören. Was würdest du gern hören? Meine Lebensgeschichte? Das läßt sich machen. Ich würde gern deine hören und auch, was du über ein oder zwei Sachen denkst, die mich verwirren. Zum Beispiel die Nachricht, die ich bekommen habe. Wenn sie nicht von deiner Mutter war, von wem war sie dann? Und wozu sollte sie mich veranlassen? Zu fragen, wie du hier gelandet bist, vielleicht? Ein Unfall scheidet offenbar aus. Und ein Selbstmordversuch? Das glaube ich nicht. Nicht bei einem Sohn von mir. Die Barnetts haben oft Pech, aber sie sind niemals selbstzerstörerisch. Also, was dann? Was ist in diesem Hotelzimmer passiert? Ich würde ja versuchen, das herauszufinden – ich verspreche, ich würde es wirklich –, wenn du mir bloß sagen würdest, wo ich anfangen soll.«
Doch David konnte Harry nichts sagen. Und Iris, selbst wenn sie konnte, hatte keinen Zweifel daran gelassen, daß sie nicht wollte. Harry blieb also nichts anderes übrig, als Shafiq nach der Person zu fragen, die in Mitre Bridge die Nachricht für ihn hinterlassen hatte. Es führte zu nichts. Shafiq wußte nicht einmal das Geschlecht des Anrufers. Er konnte sich auch an keinen besonderen Akzent erinnern.
»Hast du nicht daran gedacht, nach dem Namen zu fragen?«
»Doch, natürlich. Hältst du mich für blöde?«
»Und was war die Antwort?«
»Gar nichts. Der Anrufer hat aufgelegt.«
»Na, großartig!«
»Tut mir leid. Hättest du es besser gemacht?«
»Vielleicht. Zum Beispiel hätte ich vielleicht die Stimme erkannt.«
»Wenn derjenige gewußt hätte, daß das möglich gewesen wäre, hätte er eben nicht angerufen, solange du hier warst, oder?«
»Nein. Nein, vermutlich nicht.«
»Also ...«
»Jemand muß beobachtet haben, was ich mache. Jemand muß mich überwacht haben.«
Das war eine beunruhigende Möglichkeit. So beunruhigend, daß Harry beschloß, sich Mrs. Tandy zu offenbaren. Er wählte dafür seinen nächsten freien Tag, an dem er sie wie üblich als Blumen- und Wasserträger zum Friedhof von Kensal Green begleitete. Mrs. Tandy war mit einem Vetter verheiratet gewesen, was dazu geführt hatte, daß die verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen ihren und seinen Angehörigen unauflösbar verwickelt waren. Außerdem kamen die Verwandten Harry manchmal zahlreicher vor als das Unkraut zwischen den überwucherten Gräbern.
Als sie sich nach der anstrengenden Tour zu den verstreut liegenden Gräbern sowie zu den Gedenkstätten der engeren Tandy-Verwandtschaft auf einer Bank erholten, erklärte Harry Mrs. Tandy seine mißliche Lage so sachlich, wie es ihm möglich war. Er hatte das Gefühl, ihr seine seltsame Situation begreiflich machen zu müssen. Allerdings war er nicht sicher, ob er sie wissen lassen wollte, wie sehr ihn das alles aus dem Gleichgewicht gebracht hatte.
In seiner Unsicherheit hatte er nicht mit ihrem Scharfsinn gerechnet.
»Ein ziemlicher Schock für Sie, könnte ich mir vorstellen. So spät im Leben zu entdecken, daß Sie Vater sind.«
»Nur technisch gesehen. Vater.«
»Aber der Mann, der sich für den Vater hielt, ist tot, oder? Also sind die technischen Umstände vielleicht unwichtig.«
»Iris findet das nicht.«
»Wessen Bedürftigkeit ist größer, Harry, Davids oder die seiner Mutter?«
»Davids natürlich.«
»Dann sollten Sie vielleicht etwas tun, um ihm zu helfen.«
»Aber was schlagen Sie vor?«
»Finden Sie heraus, was der Grund für sein Koma war und was man tun kann, um ihn zu heilen.«
»Wie denn?«
»Sprechen Sie mit seinem Arzt. Und mit denen, die ihn am besten kannten. Seinen Freunden und Altersgenossen, seinen Mathematikerkollegen, mit irgendwem, der vielleicht die Verfassung kannte, in der er sich in diesem Hotel einschrieb. Oder der weiß, warum ihm vielleicht jemand schaden wollte.«
»Aber Iris ...«
»Ist seine Mutter. Was wird sie wirklich wissen? Haben Sie selbst beispielsweise Ihrer Mutter erzählt, daß sie einen Enkel hat?«
»Natürlich nicht. Was hätte das für einen Sinn?«
»Sehen Sie, was ich meine?«
»Aber seine Freunde sind vermutlich alle in Amerika.«
»Und seine Exfrau?«
»Die bestimmt, denke ich.«
»Wirklich?« Sie grinste boshaft. »Sie sollten in den Zeitungen nicht bloß die Rennseite lesen, Harry, wirklich. Holen Sie doch mal aus dem Abfallkorb da drüben den Telegraph von gestern, ja?«
»Darin habe ich die verwelkten Blumen eingewickelt.«
»Dann wickeln Sie sie wieder aus. Suchen Sie Seite drei oder fünf.«
Achselzuckend und mit widerwilligem Seufzen ging Harry zum Abfallkorb, fischte das Bündel heraus, das die verfaulten Stengel enthielt, strich die Zeitung glatt und versuchte, die feuchten Seiten voneinander zu lösen. »Was genau suche ich eigentlich, Mrs. Tandy?«
»Bringen Sie sie her.«
Harry ließ den Haufen verfaulter Blätter liegen und brachte die Zeitung zur Bank, wo Mrs. Tandy bereits ihre Brille aufgesetzt hatte. Sie nahm die Zeitung mit hochmütigem Lächeln entgegen und legte den Kopf in den Nacken, um schärfer sehen zu können.
»So, dann schauen wir mal, schauen wir mal.« Zwei Seiten mit nassen Rändern wurden sorgfältig getrennt. »Aha, da haben wir's ja. Gestern abend war im MGM-Kino in der Shaftsbury Avenue eine Filmpremiere. Sicher nicht so glanzvoll wie die, die ich vor dem Krieg miterlebt habe, aber egal. Der Punkt ist, einer der Stars von Dying Easy ist kein anderer als Steve Brancaster. Hier ist ein Bild von ihm, wie er mit seiner bildschönen Frau Hope vor dem Kino ankommt.«
Harry setzte sich neben Mrs. Tandy und starrte die Fotos an. Das größte zeigte, wie ein junges Mitglied des Königshauses aus einer Limousine stieg, doch Harrys Blick wurde von einem anderen Foto angezogen. Wie die Bildunterschrift bestätigte, war die großgewachsene, ein wenig raubtierhafte Gestalt in Smoking und offenem Hemd der Schauspieler Steve Brancaster. Neben ihm – langes, blondes Haar auf nackten Schultern, strahlendes Lächeln, funkelnde Augen, die mit einem erstaunlich tiefen Dekolleté um Aufmerksamkeit wetteiferten – stand Hope Brancaster, ehemals Venning, ehemals Gott weiß was.
»Ich nehme an, daß sie noch hier sind«, sagte Mrs. Tandy. »Premieren können sehr anstrengend sein.«
»Meinen Sie?«
»Aber ja.« Sie schaute genauer hin. »Wenn ich Sie wäre, würde ich's im Dorchester versuchen.«
Kapitel 7
Mrs. Tandys Einschätzung des Hotelgeschmacks der Brancasters erwies sich als zutreffend. Harry legte wieder einmal seinen abgenutzten Blazer und die ausgebleichte Krawatte an, ging am späten Nachmittag zum Dorchester und fragte mit soviel Selbstvertrauen, wie er aufbringen konnte, nach Mrs. Brancaster. Er wurde mit der Auskunft belohnt, sie sei tatsächlich Gast im Hause, im Moment aber ausgegangen.
»Kann ich ihr etwas ausrichten, Sir? Oder möchten Sie lieber warten?«
»Nun, äh ...«
»Oh, Sie brauchen gar nicht zu warten.« Der Empfangschef blickte über Harrys Schulter. »Da kommt die Dame gerade.«
Harry wandte sich um und sah Hope Brancasters großen Auftritt in breitrandigem Hut, signalfarbenem Regenmantel und hochhackigen Stiefeletten. Hinter ihr folgte ein Hotelboy, in jeder Hand zwei Einkaufstüten aus der Bond Street, eine fünfte über die Schulter gehängt.
»Dieser Herr hat nach Ihnen gefragt, Mrs. Brancaster«, sagte der Empfangschef, während er ihr den Schlüssel reichte.
»Und wer sind Sie?« fragte Hope mit breitem kalifornischem Akzent. Harry war nah genug, um ihr berauschendes Parfüm und ihren makellosen Teint wahrnehmen zu können.
»Harry Venning«, antwortete er prompt und lächelte beflissen. Da er Zweifel in Hopes Augen flackern sah, fügte er hinzu: »Davids Onkel.« Diese Lüge hatte er sich zurechtgelegt, um bis zu Hopes Zimmer zu gelangen. Jetzt, da er gezwungen war, Auge in Auge mit Hope davon Gebrauch zu machen, fragte er sich, ob Hope wohl wußte, daß David keinen Onkel hatte. Falls ja, konnte er sich auf einen schmählichen Abgang gefaßt machen.
Aber er hatte Glück. Glück – und etwas, womit er nicht hatte rechnen können. »Sie haben dasselbe Lächeln wie er. Wissen Sie das?«
»Finden Sie?«
»Haargenau! Aber merkwürdig, ich erinnere mich gar nicht, daß David Sie je erwähnt hätte.«