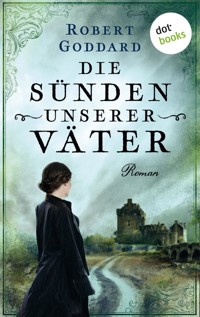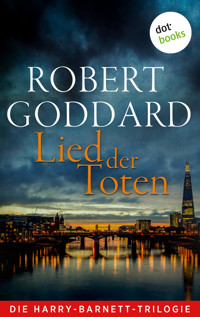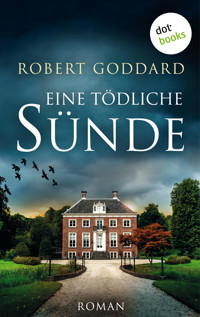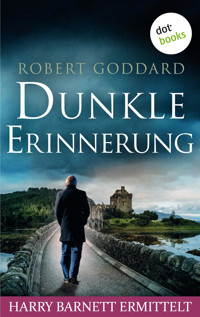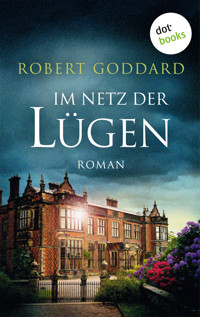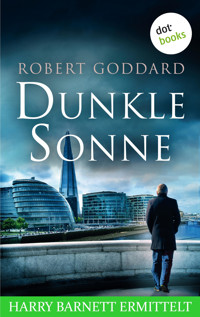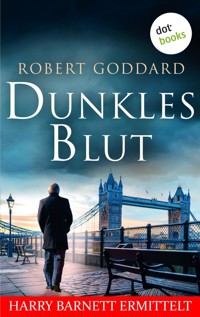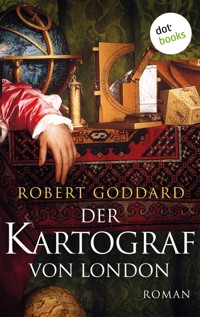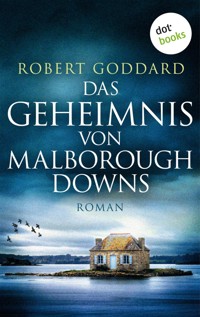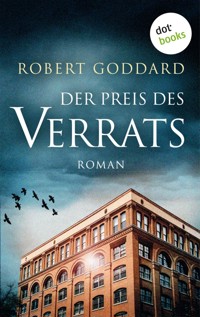Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Englische Intrigen und aristokratische Geheimnisse – drei historische Kriminalromane im Bundle! DIE SCHATTEN DER TOTEN: London, 1882. Als ihr jahrelang tot geglaubter Verlobter James Davenall plötzlich vor ihr steht, ist Constance Trenchard fassungslos und seine adlige Familie stürzt in Chaos: als ältester Sohn ist James der Alleinerbe von Land und Titel – jeder Davenall hätte durch seine Rückkehr von den Toten etwas zu verlieren. Ein intrigantes Spiel beginnt … JÄGER UND GEJAGTE: Der Atlantik, 1931. Max Wingate und Guy Horton, zwei professionelle Hochstapler, müssen wegen einer Betrugsaffäre Amerika verlassen. Doch schon an Bord der »Empress of Britain« haben sie das nächste Opfer gefunden: die reiche Bankierstochter Diana Charnwood. Aber ein Todesfall durchkreuzt ihre Pläne und die beiden Freunde landen inmitten einer unfassbaren Verschwörung … DIE KLAGE DER TOTEN: London, 1923. Als Architekt Geoffrey Staddon erfährt, dass seine Jugendliebe Conzuela des Mords an ihrem Ehemann angeklagt wird, ist er entschlossen ihr zu helfen. So kehrt er zurück zu dem imposanten Anwesen »Clouds Frome« und muss sich seiner Vergangenheit stellen – oder Conzuela wird hängen … Drei rabenschwarze Gesellschaftsporträts und fesselnde historische Spannung für Fans von P.D. James und Georges Simenon.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 2423
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
DIE SCHATTEN DER TOTEN: London, 1882. Als ihr jahrelang tot geglaubter Verlobter James Davenall plötzlich vor ihr steht, ist Constance Trenchard fassungslos und seine adlige Familie stürzt in Chaos: als ältester Sohn ist James der Alleinerbe von Land und Titel – jeder Davenall hätte durch seine Rückkehr von den Toten etwas zu verlieren. Ein intrigantes Spiel beginnt …
JÄGER UND GEJAGTE: Der Atlantik, 1931. Max Wingate und Guy Horton, zwei professionelle Hochstapler, müssen wegen einer Betrugsaffäre Amerika verlassen. Doch schon an Bord der »Empress of Britain« haben sie das nächste Opfer gefunden: die reiche Bankierstochter Diana Charnwood. Aber ein Todesfall durchkreuzt ihre Pläne und die beiden Freunde landen inmitten einer unfassbaren Verschwörung …
DIE KLAGE DER TOTEN: London, 1923. Als Architekt Geoffrey Staddon erfährt, dass seine Jugendliebe Conzuela des Mords an ihrem Ehemann angeklagt wird, ist er entschlossen ihr zu helfen. So kehrt er zurück zu dem imposanten Anwesen »Clouds Frome« und muss sich seiner Vergangenheit stellen – oder Conzuela wird hängen …
Über den Autor:
Robert William Goddard, geboren 1954 in Fareham, ist ein vielfach preisgekrönter britischer Schriftsteller. Nach einem Geschichtsstudium in Cambridge begann Goddard zunächst als Journalist zu arbeiten, bevor er sich ausschließlich dem Schreiben von Spannungsromanen widmete. Robert Goddard wurde 2019 für sein Lebenswerk mit dem renommierten Preis der Crime Writer's Association geehrt. Er lebt mit seiner Frau in Cornwall.
Robert Goddard veröffentlichte bei dotbooks auch die folgenden Kriminalromane:»Im Netz der Lügen«»Der Preis des Verrats«»Eine tödliche Sünde«»Ein dunkler Schatten«»Denn ewig währt die Schuld«»Das Geheimnis von Trennor Manor«»Das Geheimnis der Lady Paxton«»Das Haus der dunklen Erinnerung«»Das Geheimnis von Malborough Downs«»Dunkles Blut – Harry Barnett ermittelt: Der erste Fall«»Dunkle Sonne – Harry Barnett ermittelt: Der zweite Fall«»Dunkle Erinnerung – Harry Barnett ermittelt: Der dritte Fall«
Weiterhin veröffentlichte er bei dotbooks die historischen Kriminalromane:»Die Sünden unserer Väter«»Der Kartograf von London«
***
Sammelband-Originalausgabe Februar 2025
Copyright © der Sammelband-Originalausgabe 2025 dotbooks GmbH, München
Eine Übersicht über die Copyrights der einzelnen Romane, die im Sammelband enthalten sind, finden Sie am Ende dieses eBooks.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: dotbooks GmbH, München
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98952-127-8
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Robert Goddard
Die Schatten der Toten, Jäger und Gejagte & Die Klage der Toten
Drei historische Kriminalromane in einem Band
Aus dem Englischen von Werner Waldhoff
dotbooks.
DIE SCHATTEN DER TOTEN
Aus dem Englischen von Werner Waldhoff
London, 1882. Die sonst so beherrschte Constance Trenchard ist fassungslos: Der Mann, der plötzlich unangemeldet vor ihr steht, scheint ihr ehemaliger Verlobter zu sein – doch das ist unmöglich! Vor vielen Jahren verließ Sir James Davenall sie ohne Erklärung kurz vor der Hochzeit und beging Selbstmord. Für seine adlige Familie droht nun ein weiterer Skandal: Sir James ist als ältester Sohn der Erbe von Land und Titel – jeder der Verwandten hätte durch seine Rückkehr von den Toten etwas zu verlieren. So beginnt ein intrigantes Spiel, das nach und nach die innersten Geheimnisse einer ebenso vornehmen wie verfeindeten Familie offenlegt … und bei dem auch vor Mord nicht zurückgeschreckt wird. Aber immer bleibt die Frage: Ist Sir James wirklich der, der er vorgibt zu sein?
DANK
Ich bedanke mich beim Ticehurst House Hospital, East Sussex, für den mir gewährten Zugang zum Archiv und zum Grundstück. Ebenso danke ich meinem Freund Jeffrey Davis für die psychiatriegeschichtlichen Informationen, die ich seiner Dissertation zu diesem Thema entnehmen durfte.
Meiner Mutter gewidmet
DIE PERSONEN
WILLIAM TRENCHARD
ein ehrbarer Londoner Familienvater, als leitender Angestellter im florierenden Familienunternehmen tätig
CONSTANCE TRENCHARD, geb. Sumner
Williams Ehefrau
PATIENCE TRENCHARD
Constances und Williams kleine Tochter
CANON HUBERT SUMNER
ein anglikanischer Geistlicher gesetzten Alters, Constances Vater
EMILY SUMNER
Constances unverheiratete Schwester, lebt mit ihrem Vater in Salisbury
CATHERINE DAVENALL, geb. Webster
Witwe von Sir Gervase Davenall, 7. Baronet, lebt auf dem Landgut Cleave Court in Südengland
Sir HUGO DAVENALL
Catherines Sohn und seit Gervases Ableben 8. Baronet und Erbe großer Besitztümer, lebt in Bladeney House, dem Stadthaus der Familie in London
RICHARD DAVENALL
Cousin des verstorbenen Sir Gervase, führt als Anwalt auch die Rechtsgeschäfte der Familie
JAMES NORTON
eine rätselhafte Gestalt, die aus dem Nichts auftaucht und mit ihren Forderungen die Kreise der Trenchards und der Davenalls gleichermaßen stört
Dr. DUNCAN FIVEASH
langjähriger Hausarzt der Davenalls
Prinz NAPOLEON JOSEPH CHARLES PAUL BONAPARTE, genannt Plon-Plon, ein Lebemann und langjähriger Freund von Sir Gervase, offizieller bonapartistischer Anwärter auf Frankreichs Kaiserthron
VIVIEN STRANG
Catherine Davenalls Gouvernante, als diese noch Catherine Webster hieß, von deren Vater fristlos entlassen; seither unbekannten Aufenthaltes
ALFRED QUINN
Sir Gervases Butler und von Catherine nach dessen Ableben fristlos entlassen; seither unbekannten Aufenthaltes
Familie LENNOX
die früheren Verwalter des Davenallschen Familienguts Carntrassna in der irischen Grafschaft Mayo; 1859 nach Nordamerika ausgewandert
Familie KENNEDY
die heutigen Gutsverwalter von Carntrassna
ERSTES KAPITEL
I
Es war nun zehn Jahre her, seit William Trenchard die junge Constance Sumner kennengelernt und ihr geholfen hatte, die Tragödie, die sich um den Selbstmord ihres Verlobten rankte, allmählich zu vergessen. Zu der Zeit war sie so tief in ihre Trauer versunken, daß es schon einem Martyrium gleichkam; anfangs war sie fest davon überzeugt gewesen, daß ihr kein Mann jemals wieder das bedeuten könnte, was der nun für immer entschwundene James Davenall für sie gewesen war. Doch in diesem Punkt – wie in so vielen anderen auch – täuschte sie sich.
Vor sieben Jahren waren die damals frisch verheirateten Trenchards nach The Limes gezogen, ein St.-John's-Wood-Stadthaus, das ihnen Williams Vater, Mitbegründer der Trenchard & Leavis-Einzelhandelskette, geschenkt hatte. Zu der Zeit mußten sie angenommen haben, daß die Ungewißheiten der Jugend auf ewig dahin waren. Doch darin – wie in vielen anderen Dingen auch – täuschten sie sich.
Vier Jahre nach der Geburt seiner Tochter Patience schien sich zu bestätigen, daß es sich bei Williams zunehmendem Interesse für die Firma Trenchard & Leavis nicht nur um ein Strohfeuer handelte. Sein Vater begann allmählich zu glauben, daß William – auch wenn er nie die Energie und den Scharfsinn seines Bruders Ernest aufbrächte – zumindest ein respektables Leben führen würde. Doch darin – wie in vielen anderen Dingen auch – täuschte er sich.
Es war gerade ein Jahr her, seit Constance einen Spaziergang zum Regent's Park gemacht hatte, wo sie Patience und deren Kindermädchen, die wie üblich den See mit den Booten besucht hatten, überraschen wollte. Unter den Zuschauern, die sich vom Lord's-Kricketplatz drängten, glaubte sie einen düsteren Mann in mittleren Jahren zu erkennen, dessen Anzug für den warmen Tag viel zu schwer war. Später, als sie am Hanover Gate den Park betrat, fiel ihr ein, wer es gewesen war: Richard Davenall, ein älteres Mitglied der Familie, in die sie beinahe eingeheiratet hätte. Lächelnd überlegte sie, wie merkwürdig es doch war, daß sie nun nie mehr etwas von der Familie Davenall hören würde, der sie einst so nahe gestanden hatte. Doch auch in diesem Punkt – wie in so vielen anderen – täuschte sie sich.
Es war erst zwei Tage her, seit sich William Trenchard, der den Park am Ende eines von leichtem Dunst durchzogenen Altweibersommertags in entgegengesetzter Richtung durchquerte, umdrehte, als vom baumbestandenen Ufer Lachen an sein Ohr drang. Er sah eine wunderschöne junge Frau, die sich auf dem noch sonnenbeschienenen Gras ausruhte und mit ihrem Verehrer scherzte, der zu ihren Füßen kauerte und seine Melone zur Unterstreichung seiner Worte schwenkte. Trenchard hatte die Geste komisch gefunden und gelächelt, war dann jedoch sofort wieder ernst geworden. Er fühlte sich von all der verwegenen Schönheit und den Emotionen, die er flüchtig auf dem Gesicht des Mädchens gesehen hatte, durch Alter und Kleidung und Status ausgeschlossen. Sonst jedoch war er mit seinem Leben nicht unzufrieden; er sehnte keinerlei Störungen des gewohnten Grundmusters seiner Existenz herbei. Er war vierunddreißig Jahre alt; er strahlte eine Zufriedenheit, ja fast Selbstzufriedenheit aus, aber er hatte sie sich auch verdient. Auf dem Heimweg hatte er mit einem Hauch von Resignation sinniert, daß die Freuden seiner eigenen Welt zumindest die Wärme absoluter Sicherheit besaßen. Doch darin – wie in vielen anderen Dingen auch – täuschte er sich.
Es war erst eine Stunde her, seit William Trenchard seine Tochter Patience zu seiner Frau in den Wintergarten befördert hatte, nachdem er lange genug die Schaukel angestoßen hatte. Danach steckte er sich ein gemütliches Sonntagnachmittagspfeifchen an, setzte sich auf die Bank und bewunderte, wie er es oft tat, das komplizierte Flechtwerk der Glyzinie, die den Südgiebel des Hauses bedeckte. Es war der erste Tag im Oktober des Jahres 1882; ansonsten konnte man in der milden Herbstluft keine Neuanfänge entdecken, weder hier noch anderswo in der ganzen ereignislosen Trägheit dieses sicheren, unwandelbaren Empire. Nicht, daß sich William Trenchard häufig philosophischen oder auch nur patriotischen Gedankengängen hingegeben hätte, die über das Niveau eines anständigen Empfindens hinausgegangen wären. Aus einiger Entfernung betrachtet – zum Beispiel durch das offene Seitentor –, hätte man ihn durchaus für die Verkörperung dessen halten können, was in der begrenzten Vorstellung vom durchschnittlichen viktorianischen Gentleman der Oberklasse das Beste und das Schlechteste war. Doch in diesem Punkt – wie in vielen anderen auch – wäre er falsch beurteilt worden. Denn lediglich eine Stunde später hatte sich William Trenchards Leben und das aller anderen Bewohner von The Limes, St. John's Wood, vollkommen verändert– auf immer und ewig. Eine Stunde genügte, um zehn Jahre beiseite zu fegen.
II
Burrows muß das Seitentor offengelassen haben. Ich erinnere mich, daß ich es von meinem Platz auf der Bank aus bemerkte und dachte, wie nachlässig er doch allmählich wurde. Nicht, daß es mich angesichts seines Alters überrascht oder sogar geärgert hätte. Dafür sorgte schon die besänftigende Wirkung des guten Pfeifentabaks und der Abendsonne, doch meine Aufmerksamkeit wurde dadurch auf die Zufahrt zum Haus gerichtet, die im Bogen von der Straße herführte. Jede Bewegung auf der Straße – wo sich im allgemeinen nichts tat – mußte mir ins Auge stechen. Und genau auf diese Weise – nur ein leichtes Flackern am Rande meines Blickfelds – sah ich ihn zuerst.
Sechs Wochen später – unter Umständen, die er niemals hätte voraussehen können – begann William Trenchard einen Bericht über das Geschehen niederzuschreiben, das an jenem scheinbar so unschuldigen Sonntagnachmittag in St. John's Wood seinen Anfang genommen hatte. Der Anlaß für einen derartigen Bericht war ebenso zwingend, wie seine Wirkung enthüllend ist, denn damit ist jeglicher Spekulation der Boden entzogen, warum Trenchard auf die Ereignisse, die ihn überrollten, so und nicht anders reagierte. Jede seiner Handlungen, jede seiner Aussagen steht hier, um beurteilt zu werden – in seinen eigenen Worten.
Ein großer, schlanker Mann, elegant gekleidet mit Zylinder, Gehrock und rehbraunen Hosen, in der Hand einen Spazierstock mit Silberknauf, verharrte kurz, als er am Eingang des Hauses vorbeikam. Er blieb stehen wie jemand, dem gerade eine eher unwichtige Verpflichtung eingefallen ist. Die Sonne spiegelte sich in dem Silber an seinem Stock, als er ihn von dir rechten in die linke Hand warf, mit seiner freien Hand den Gehrock zurückschob und in seine Westentasche griff. Er holte einen Zettel hervor, musterte ihn, steckte ihn wieder zurück und drehte sich langsam in meine Richtung.
Ich habe, mich bemüht, meinen unmittelbaren Eindruck von ihm wieder einzufangen und all das auszulöschen, was anschließend geschah, damit ich ihn deutlich so sehen kann, wie er zu dem Zeitpunkt war: ein Mann ungefähr in meinem Alter, dunkel und gutaussehend, bärtig, perfekt gekleidet, mit glitzernder Krawattennadel und Uhrkette, den Daumen einer behandschuhten Hand in die Westentasche gehakt, während die andere das Malakkastöckchen herumwirbelte. Ich war sicher, daß ich ihn nicht kannte, auch nicht als irgendeinen Einwohner dieses Viertels: Er sah aus, als würde er eher nach St. James's als nach St. John's Wood passen. Die Neigung seines Hutes hatte etwas Weltmännisches an sich, und das verstohlene Lächeln, das um seinen Mund spielte, wirkte vage irritierend und beunruhigend.
Langsam kam er die Zufahrt hoch, fast zu langsam, als daß es eine Stilfrage hätte sein können. Es sah eher so aus, als würde er absichtlich den Zeitpunkt seiner Ankunft hinauszögern. Meine Aufmerksamkeit, die sich anfangs nur flüchtig auf ihn gerichtet hatte, war nun voll auf ihn konzentriert. Als er am Seitentor vorbeikam, bemerkte er, daß ich ihn beobachtete, und richtete seinen Blick auf mich. Urplötzlich lief es mir kalt über den Rücken.
Er trat durch den Torbogen aus Backsteinen, wobei er sich leicht bückte, um nicht mit seinem Zylinder anzustoßen. Dann blieb er ungefähr zehn Meter von mir entfernt stehen; er kam weder näher, noch zog er sich zurück, weder sprach er, noch machte er eine Bewegung. Es schien, als wollte er mich herausfordern, das Schweigen zu brechen.
Ich ging auf ihn zu. »Guten Tag«, sagte ich. »Kann ich Ihnen helfen?«
»Ich bitte um Entschuldigung, daß ich hier einfach so eindringe«, erwiderte er, als ich dicht vor ihm stand. »Habe ich das Vergnügen mit Mr. William Trenchard?« Die Stimme klang volltönend, kultiviert und korrekt. Vielleicht eine Spur zu korrekt, hätte man sagen können, etwas zu manieriert, um wirklich angenehm zu wirken.
»Ich bin William Trenchard, jawohl. Wie Sie sehen«, ich deutete auf meine nachlässige Kleidung, »erwarten wir keinen Besuch.«
»Verzeihen Sie. Die Umstände meines Besuches sind etwas ... ungewöhnlich. Sie müssen auch als Entschuldigung für diesen ... unangemeldeten Besuch dienen.« Er streckte die Hand aus. »Ich nenne mich Norton. James Norton.«
Sein Händedruck war fest und unerschütterlich. »Sind wir uns schon mal begegnet, Mr. Norton?«
»Nein.«
»Handelt es sich um eine geschäftliche Angelegenheit? In diesem Fall sind Trenchard und Leavis ...«
»Es geht um eine absolut persönliche ... und äußerst delikate Angelegenheit. Ich weiß kaum, wo ich anfangen soll.«
Ich wurde allmählich ärgerlich. Diese offen zur Schau getragene Unsicherheit stand in krassem Gegensatz zu dem, was ich bis jetzt von ihm gesehen hatte. Es roch nach Taktik. »Ich glaube, Mr. Norton, es ist vielleicht am besten, wenn Sie mir einfach sagen, worum es geht.«
Er legte eine Pause ein, so genau berechnet, daß ich zu glauben begann, ich könnte ihn schnell loswerden, nur um dann mit der gleichen Höflichkeit wie zuvor fortzufahren. »Selbstverständlich. Sie haben vollkommen recht. Ich sagte, wir seien uns noch nie begegnet, und das entspricht auch der Wahrheit. Es ist Ihre Frau, mit der ich bekannt bin.«
Welcher Mann – selbst ein so glücklich verheirateter Mann wie ich – hätte sich das anhören können, ohne daß ein unwürdiges Mißtrauen in ihm aufgestiegen wäre? »Wie meinen Sie das, Sir? Ich kenne alle Freunde und Bekannten meiner Frau. Sie zählen nicht dazu.«
Er lächelte. »Vielleicht hätte ich mich klarer ausdrücken sollen. Ihre Frau und ich kannten einander vor vielen Jahren, noch bevor Sie sie heirateten. Uni genau zu sein, wir waren sogar einmal verlobt.«
In dem Moment spürte ich, daß er log. Ich fühlte mich sogar erleichtert, daß es sich um eine so offensichtliche Lüge handelte. »Sie irren sich, Mr. Norton. Vielleicht haben Sie sich in der Hausnummer getäuscht.«
Unbeeindruckt fuhr er fort: »Der Mädchenname Ihrer Frau lautet Sumner. Wir waren vor elf Jahren verlobt und wollten heiraten. Ich bin heute zu Ihnen gekommen ...«
»Es handelt sich entweder um ein groteskes Mißverständnis oder um Vorspiegelung falscher Tatsachen.« Er merkte, daß ich zornig war, doch sein Gesichtsausdruck änderte sich nicht. Vielleicht spürte er, daß mein Zorn sich ebenso gegen mich wie gegen ihn richtete. Jenseits jeglicher Logik hatte ich begonnen, das in Frage zu stellen, was Constance mir von ihrem Leben vor unserer gemeinsamen Zeit erzählt hatte. Diese Zweifel wollte ich – ebenso wie diesen Mr. Norton – mit meinen Worten verscheuchen. »Meine Frau war vor elf Jahren mit einem anderen Mann verlobt, das stimmt. Doch dieser Mann ist tot.«
»Nein.« Er schüttelte langsam den Kopf, als würde er es wirklich bedauern, mir meine Illusionen rauben zu müssen. »Ich fürchte, das stimmt nicht, Mr. Trenchard. Ich bin dieser Mann. Mein richtiger Name ist nicht James Norton, sondern James Davenall. Und ich bin, wie Sie sich selbst überzeugen können, alles andere als tot.«
Ich wollte ihn gerade auffordern, sofort zu gehen, als ich Constance vom Haus aus auf uns zukommen sah. Sie muß uns vom Wintergarten aus gesehen und sich gefragt haben, wer wohl der Besucher sei. Zum Glück hatte sie Patience nicht bei sich. Norton kann sie nicht gesehen haben, da er ihr den Rücken zuwandte, doch vielleicht hatte es ihm mein Gesichtsausdruck verraten. Jedenfalls fuhr er fort, als würde er seine Rolle jetzt vor einem größeren Publikum spielen.
»Ich bin weder gekommen, um Sie gegen mich aufzubringen, noch möchte ich Constance schockieren. Ich bin nur hier, um Constance zu bitten, mir behilflich zu sein, meine Identität nachzuweisen. Verstehen Sie, es gibt einige Personen, die bestreiten, daß ich James Davenall bin.«
Die letzten Worte muß Constance gehört haben. Sie blieb abrupt stehen und starrte mich verwirrt und besorgt an. Einen Augenblick zuvor noch war sie die sanfte, schöne Frau gewesen, die ich geheiratet hatte. Nun, bei der Erwähnung dieses Namens, huschte dieser Anflug von Trauer über ihr Gesicht, den ich seit den ersten Tagen unserer Bekanntschaft nicht mehr gesehen hatte.
»Was soll das heißen?« fragte sie.
Ich hätte antworten, hätte sie vorbereiten sollen, damit sie sich gegen ihn wappnen konnte. Doch ich zögerte, und in dem Augenblick drehte sich Norton um und schaute sie direkt an. Ich konnte sein Gesicht nicht sehen, doch Constances Gesicht war für mich deutlich erkennbar, und in ihm las ich, ebenso wie er es getan haben mußte, die Unsicherheit, die deutlicher als irgendwelche Worte zum Ausdruck brachte: Es könnte wahr sein.
»Du siehst kein Gespenst vor dir, Connie«, sagte er. »Ich bin's wirklich. Es tut mir leid, daß ich dich getäuscht habe.«
Sie trat näher heran, unterzog ihn einer genauen Prüfung; langsam schwand aus ihrem Gesicht der ursprüngliche Zweifel. »Sie müssen sich nicht entschuldigen«, sagte sie unbewegt. »Sie haben mich nicht getäuscht. Hier handelt es sich um einen Irrtum. Sie sind nicht James Davenall.«
Mit sanfter, nervtötender Überzeugung erwiderte er: »Du weißt, daß ich es bin.«
»James Davenall hat sich vor elf Jahren das Leben genommen.«
»Vor einem Moment noch hättest du das glauben können. Jetzt weißt du, daß es nicht stimmt.«
Ich beschloß, daß es an der Zeit war, einzugreifen. Ich trat vor und nahm Constances Arm. So standen wir ihm gemeinsam gegenüber, wir auf dem Rasen, er auf dem Kiesweg, während die Schatten um uns herum länger wurden. »Was wollen Sie von uns, Mr. Norton?«
»Ich hatte gehofft, daß Connie – daß Ihre Frau bereit wäre, zuzugeben, daß Sie mich kennt. Meine Familie hat mich abgewiesen und ...«
»Sie waren bei ihr?« fragte Constance.
»Ja. Ich war bei ihr – und sie hat sich gegen mich gewandt.« Er blickte zu Boden, als würde ihn der Gedanke schmerzen. Dann richtete er den Blick wieder auf uns oder vielmehr auf Constance, denn ich hatte lediglich die Funktion eines Zuschauers. »Willst du dich ihrem Täuschungsmanöver anschließen – oder dir meine Erklärung anhören? Ich habe dir sehr viel zu erzählen.«
»Mr. Norton«, entgegnete sie, »ich weiß nicht, welchen Zweck Sie durch diese makabre Vorspiegelung verfolgen, aber ich will jedenfalls nichts mehr davon hören.«
»Wenn es nur so einfach wäre«, sagte er. »Ich versuchte mir selbst vorzumachen, daß James Davenall nicht mehr existiert– und hatte keinen Erfolg damit. Jetzt machen andere den gleichen Fehler.«
»Entschuldigen Sie mich, Mr. Norton. Es gibt nichts mehr zu sagen.« Sie drehte sich um und ging zum Haus zurück. Während er ihr nachschaute, suchte ich in seinem Gesicht nach Anzeichen seiner betrügerischen oder teuflischen Absichten, konnte aber nur eine sehnsüchtige Trauer entdecken. Absurderweise kam ich mir deshalb bei meinen nächsten Worten fast hartherzig vor.
»Würden Sie jetzt gehen? Oder muß ich die Polizei holen?«
Er schien meine Frage zu ignorieren. »Ich bin in dem Hotel an der Paddington Station abgestiegen. Wenn Connie erst einmal Gelegenheit gehabt hat, darüber nachzudenken ...«
»Wir werden nicht über Sie nachdenken, Mr. Norton. Wir werden uns Mühe geben, so zu tun, als wären Sie nie hiergewesen. Ich möchte Ihnen raten, das gleiche zu tun. Das ist unser letztes Wort in dieser Angelegenheit.«
»Das glaube ich nicht.«
Bevor ich darauf noch etwas sagen konnte, drehte er sich um und marschierte flott durch das Seitentor und weiter die Zufahrt hinab. Kaum war er außer Sicht, eilte ich ins Haus.
Ich fand Constance im Salon. Sie stand vor dem holzgerahmten Spiegel auf dem Kaminsims, um den herum eine Anzahl Familienfotos gruppiert war: ihre Eltern, meine Eltern, ihr verstorbener Bruder, Patience mit einem Spielzeug im Alter von drei Monaten. Und unsere Hochzeit: der 1. Mai 1875. Eine Ansammlung von Trenchards und Sumners in ihren besten Posen in dem mit Palmen geschmückten Ballsaal eines Wiltshire-Hotels.
Ich legte meinen Arm um ihre Schultern. »Er ist jetzt weg. Tut mir leid, falls er dich aufgeregt hat.«
Sie schauderte. »Das ist es nicht.«
»Es ist doch vollkommen unmöglich, nicht wahr, daß er derjenige sein könnte, für den er sich ausgegeben hat? Ich weiß, daß Davenall ertrunken sein soll, aber ...«
Im Spiegel begegnete ich ihrem Blick. »Du hast es also auch gesehen, nicht wahr?«
»Ich hab' gar nichts gesehen. Das liegt bei dir. Du kanntest ihn.«
Sie wandte sich um und schaute mich an. »James ist tot. Wir alle wissen das. Das war ... eine gewisse Ähnlichkeit. Aber das reicht nicht. Und doch ...«
»Du kannst nicht absolut sicher sein, ja?«
»Vielleicht hätte ich ihn anhören sollen.«
»Dann wäre die Lüge sehr bald offenkundig geworden. So, wie die Dinge nun stehen, könnte er behaupten, wir hätten ihm keine faire Chance gegeben, seinen Fall darzulegen.«
Sie lehnte sich an mich und schaukelte leicht hin und her, während sie nachdachte. Die Uhr auf dem Kaminsims neben uns tickte mit übertriebener Feierlichkeit. Von oben aus dem Kinderzimmer drang das Geräusch von Patiences Füßen und das Spritzen von Wasser: Es war Badezeit für unsere Tochter.
»Er ist nichts weiter als ein Hochstapler, Connie. Es geht immerhin um den Titel eines Baronets – und um ein Erbe. Verschwundene Erben sind ein gefundenes Fressen für solche Kerle. Erinnerst du dich an den Tichborne-Unfug?«
Sie blickte auf, als hätte sie keines meiner Worte gehört. »Ich muß sicher sein können. Es ... wäre möglich. Wir müssen mit seiner Familie sprechen.«
»Also gut«, sagte ich. »Ich werde sie besuchen – wenn möglich noch heute abend. Damit sollte die Sache dann erledigt sein.
III
An diesem Abend stieg William Trenchard kurz nach sechs Uhr abends in der Wellington Road in eine Droschke und ließ sich zum Bladeney House, Chester Square, fahren, der Londoner Residenz von Sir Hugo Davenall. Er lehnte sich in den Sitz zurück und rauchte eine Pfeife, um seine Nerven zu beruhigen, während der Wagen flott durch die sonntäglich leeren Straßen fuhr.
Er wußte selbst nicht genau, weshalb er so nervös war. Gesellschaftlich gesehen lagen eindeutig Welten zwischen ihm und den Davenalls. Wäre Constance ihre Tochter gewesen, dann wäre eine Ehe mit dem Sohn eines Ladenbesitzers, der William nun einmal trotz all der geschäftlichen Erfolge des alten Lionel Trenchard war, keinesfalls in Frage gekommen. Genaugenommen hatte er nie ein Mitglied der Familie kennengelernt. Sein Wissen über sie basierte allein auf dem, was Constance ihm erzählt hatte. Vielleicht war das der Grund für seine augenblickliche Unsicherheit. Ein unangemeldeter Besuch an einem Sonntagabend konnte angesichts der zwingenden Gründe sicherlich verziehen werden, doch daß sich die Vergangenheit seiner Frau, die ihm stets – wenn auch aus tragischem Anlaß – so klar erschienen war, plötzlich als so undurchsichtig erwies, war etwas ganz anderes. Als der Wagen in die Baker Street bog und angesichts einer Parade der Heilsarmee in der Marylebone Road das Tempo verringerte, begann Trenchard in Gedanken das Wenige durchzugehen, was er tatsächlich wußte.
James Davenall und Constances verstorbener Bruder Roland Sumner hatten zur gleichen Zeit Oxford besucht. James machte Constance anschließend den Hof, und im Herbst 1870 wurde ihre Verlobung offiziell bekanntgegeben. Canon Sumner betrachtete diese Verbindung mit einer Adelsfamilie zu Recht als gesellschaftlichen Triumph und bereitete die Hochzeit seiner Tochter in der Kathedrale von Salisbury vor. Knapp eine Woche vor der Zeremonie, die im Juni 1871 stattfinden sollte, verschwand Davenall urplötzlich von der Bildfläche. Der einzige Hinweis bezüglich seiner Absichten, den er auf dem Familienlandsitz in der Nähe von Bath zurückließ, bestand aus einer Nachricht, die kaum einen Zweifel daran ließ, daß er beabsichtigte, sich das Leben zu nehmen. Seine Spur ließ sich bis London verfolgen. Ein Droschkenkutscher erinnerte sich, daß er ihn in der Nähe des Flußufers in Wapping abgesetzt hatte. Dort, so nahm man an, war er ins Wasser gegangen, und die Themse hatte seine Leiche ins Meer gespült. Nie wurde ein Grund für diese Tat gefunden; ihre vollkommene Unerklärlichkeit machte die Tragödie noch schlimmer.
Als Trenchard Constance kennenlernte, war sie immer noch wie betäubt vom Kummer, den Davenalls Verschwinden bei ihr ausgelöst hatte. Als wäre das noch nicht genug, starb ihr Bruder Roland fünf Monate danach an den Folgen eines Reitunfalls. Trenchard hoffte, sie nie wieder in dem damaligen Zustand zu sehen: eine durchsichtige, erstarrte Schönheit, ganz der Trauer hingegeben. Von diesem Tag an war der Weg, den sie gemeinsam gegangen waren, schwierig gewesen, aber letzten Endes war ihm reicher Lohn zuteil geworden; er hatte nicht die Absicht, umzukehren und den Weg zurückzugehen. Der Gedanke ließ seine Nerven vibrieren, während die Droschke die Park Lane hinabfuhr. Wenn es nach ihm ginge, würde nichts aus dieser Zeit – und schon gar nicht James Davenall – in ihrem Leben wieder auftauchen.
Was, so fragte er sich, würde Sir Hugo Davenall von Norton halten? Er hatte den Titel eines Baronets im Frühjahr 1881 geerbt – Trenchard erinnerte sich an einen diesbezüglichen Zeitungsartikel – und würde sich wohl kaum über die Bedrohung seiner Position freuen. Doch war es überhaupt eine echte Bedrohung? Nein, sagte sich Trenchard. Es war nichts weiter als der kaltblütige Versuch einer Täuschung, der von Anfang an kein Erfolg beschieden sein konnte. Somit war sein überstürzter Besuch am Chester Square eine ziemlich panische Reaktion, aber das konnte er nicht ändern.
Der Wagen blieb mit einem Ruck stehen. Sie standen vor einem Zaun, hinter dem sich die von Balkonen dominierte Fassade eines großen Regency-Hauses erhob. Trenchard stieg aus, bezahlte den Kutscher und sah sich um. Die Dämmerung senkte sich über den Platz, Tauben gurrten zwischen den Ziergiebeln und Säulen. Die Droschke fuhr los, und Trenchard blieb mit einem etwas albernen Gefühl vor der Tür dieses Herrschaftshauses zurück.
IV
In Baldeney House führte mich ein Diener mit strengem Gesicht in eine gekachelte Eingangshalle. Ich erinnere mich an das Licht, das eine geschwungene Treppe hinabflutete und die Silhouette einer Gestalt formte, die im Abendanzug langsam die Treppe herabgestiegen kam. Es war ein großer, schlaksiger junger Mann mit dunklen, wirren Haaren und blutunterlaufenen Augen. Er rauchte eine Zigarre, die er auch nicht aus seinem breiten Mund mit den vollen Lippen nahm, als er zu dem Dienstboten sagte: »Besuch, Greenwood?«
»Ein Mr. Trenchard, Sir. Ich habe noch nicht erkundet ...«
»Sir Hugo?« unterbrach ich ihn.
»Genau der.« Er blieb auf der letzten Stufe stehen, nahm die Zigarre aus dem Mund und deutete eine ironische Verbeugung an.
»Guten Abend, Sir. Ich bin mit der ehemaligen Verlobten Ihres verstorbenen Bruders, Miss Constance Sumner, verheiratet. Wir hatten Besuch von einem Mr. Norton ...«
»Norton?« Sein Kopf ruckte bei dem Wort hoch. Zigarrenasche fiel auf den Teppich. »Sie haben den Kerl also auch gesehen?«
»Ja, Er behauptet ...«
»Ich weiß verdammt gut, was er behauptet.« Seine Unterlippe zitterte deutlich sichtbar. »Der Mann ist ein Scharlatan.«
»Das ist mir klar.«
»Hmm?« Er blickte mich an. »Ja, natürlich. Dachte ich mir.« Er überlegte kurz, paffte an der Zigarre und sagte dann: »Kommen Sie rein, Trenchard. Ich kann nicht viel Zeit erübrigen, aber wird schon reichen, na?« Er schlug mir auf die Schulter und schob mich auf eine Tür zu, den Diener mit einer Handbewegung entlassend. »Wir sind im Musikzimmer, Greenwood.«
Wir kamen durch ein üppig möbliertes Vorzimmer mit Blick auf den Chester Square und wandten uns dann einer offenen Flügeltür zu. Dahinter sah ich zum Garten führende Glastüren. Irgend jemand spielte eine respektlose Ballade auf einem gut gestimmten Klavier.
»Ich wär' auch ohne den Quatsch ausgekommen«, quetschte Sir Hugo neben seiner Zigarre heraus. »Man hat damit nichts weiter als Ärger am Hals.«
Wir betraten das Musikzimmer. Ein junger Mann mit sandfarbenen Haaren wandte sich vom Klavier ab und lächelte uns zu. Auch er war im Abendanzug, im Gegensatz zu der zweiten Person im Raum, einem Mann in mittleren Jahren, der in einem Sessel neben der Verandatür saß und nun eine Zeitung beiseite legte und uns liebenswürdig lächelnd begrüßte.
»Dieser schreckliche Pianist ist ein Freund von mir, Trenchard«, sagte Sir Hugo. »Freddy Cleveland. Falls Sie sich überhaupt für Pferderennen interessieren, haben Sie wahrscheinlich schon mit einem seiner Klepper Geld verloren.«
Trotz seines jungenhaften Aussehens war Cleveland bei weitem nicht mehr so jung, wie ich auf den ersten Blick angenommen hatte. Beim Lächeln legten sich Faltenkränze um seine Augen. Ich hielt ihn für den affektierten, dümmlichen Typ, mit dem sich ein junger Baronet wohl anfreunden mochte; sofort fühlte ich mich inmitten ihrer bemüht geistreichen West-End-Witzeleien fehl am Platze.
»Mr. Trenchard sieht nicht so aus, als würde er die Rennbahn besuchen, Hugo«, sagte Cleveland und schüttelte mir die Hand.
»Das tue ich tatsächlich nicht.«
»Er ist wegen dieses verfluchten Viechs da«, warf Sir Hugo ein, »das sich in unseren Stall verirrt hat.« Er wandte sich dem dritten Mann zu. »Mein Cousin, Richard Davenall, zugleich auch mein juristischer Berater.«
Richard Davenall hatte einen Bart und graue Haare. Die Probleme, mit denen er in seinem Beruf konfrontiert wurde, hatten Falten in sein Gesicht gekerbt, seine Schultern hingen niedergeschlagen hinab, und seine meerblauen Augen zeigten einen nachsichtigen Ausdruck. Er schüttelte meine Hand bei weitem nicht mit der Energie, die die beiden anderen aufgewendet hatten, jedoch mit wesentlich mehr Überzeugung.
»Trenchard?« fragte er mit einem merkwürdigen Unterton. »Haben Sie nicht Constance Sumner geheiratet?«
»Jawohl, Sir, ich hatte die Ehre.«
»Ich habe mich gefreut, als ich hörte, daß sie geheiratet hatte ... nach allem, was geschehen war. Ist es richtig, daß Sie von Norton gehört haben?«
»Ja. Deshalb bin ich hier.«
»Wie reagierte Ihre Frau auf Norton?«
»Seine Behauptung entsetzte sie. Als er erklärte, er habe bereits seine Familie besucht, das heißt, die Familie des echten James ...«
»Da hielten Sie es für besser, eine kleine Geländeerkundung vorzunehmen«, sagte Sir Hugo. »Kann ich Ihnen nicht verdenken. Einen Drink?«
»Nein, besten Dank.«
»Freddy, sei ein guter Junge und hol mir einen Scotch mit Soda. Sind Sie sicher, daß Sie keinen wollen, Trenchard?«
»Ganz sicher. Danke.«
Während Cleveland zu dem Servierwagen mit den Getränken ging, ließ sich Sir Hugo in einen Sessel fallen und bedeutete mir mit einer Geste, dasselbe zu tun. Richard Davenall nahm wieder seinen Platz an der Verandatür ein. Cleveland kehrte mit einem großen Glas für Sir Hugo und einem weiteren Glas für sich selbst zurück und ging dann wieder zu dem Klavierhocker, von wo aus er uns mit einem kindlichen Grinsen betrachtete.
»Freddy findet die Situation erheiternd«, sagte Sir Hugo. »Schätze, an seiner Stelle würde es mir ähnlich gehen.«
»Die Sache hat durchaus ihre komische Seite«, sagte Cleveland. »Der Mann ist ein verdammt guter Schauspieler. Er besitzt Jimmys Geschmack, was die Kleidung anbelangt, und die gleiche sanfte Stimme.«
Sir Hugo nahm einen kräftigen Schluck. »Er ist ein Schauspieler, der seinen Text gelernt hat. Das ist alles.«
»Aber wirklich sicher kannst du dir nicht sein, oder?« fuhr Cleveland fort. »Das ist das Schöne daran. Weißt du, letzten Winter lief ich zufällig dem alten Cazabon im Zug nach Brighton in die Arme– zumindest glaubte ich das. Er sah aus wie Cazabon, redete wie Cazabon, stritt aber ab, Cazabon zu sein. Er behauptete, er sei ein Zahnarzt aus Haywards Heath. Als wollte er das beweisen, stieg er auch dort aus. Die beiden waren wie Perlen auf einer Schnur. Da sieht man's doch. Natürlich schuldete Cazabon mir Geld, also war er's vielleicht doch.« Er lachte heiser. Keiner schloß sich seinem Lachen an.
Ich beschloß, zum Kern der Sache vorzustoßen. »Sir Hugo, ich bin Ihrem Bruder niemals begegnet, doch meine Frau versichert mir, daß es völlig unmöglich ist, daß Norton mit Ihrem Bruder identisch ist. Vertreten Sie und Ihre Familie den gleichen Standpunkt?«
Sir Hugo starrte Cleveland immer noch mit beherrschtem Zorn an. »Selbstverständlich.«
Richard Davenall rettete mich. »Vielleicht darf ich Ihnen die Situation kurz erläutern, Trenchard. Dieser Norton tauchte vor fünf Tagen in Cleave Court in Somerset auf, wo Hugos Mutter lebt, und behauptete, ihr toter Sohn James zu sein. Lady Davenall durchschaute die Lüge sofort und schickte ihn weg. Am Freitag besuchte er mich in meinem Büro in Holborn. Gestern ...«
»Erschien er hier«, sagte Sir Hugo grimmig. »Ich hab' den Kerl rausschmeißen lassen.«
»Und keiner von uns«, fuhr sein Cousin fort, »nahm seine Behauptung auch nur einen Augenblick lang ernst. Ich denke, nach seinem Besuch bei Ihnen hat er die ganze Reihe jener, die er zu betrügen hoffte, abgeklappert.«
»Ich dachte, sein altes Kindermädchen habe ihn in die Arme geschlossen«, warf Cleveland ein, »und ihn Jamie genannt?«
Ein Schnauben von Sir Hugo. »Die Frau ist senil.«
»Es stimmt«, sagte Richard Davenall, »daß Nanny Pursglove in Norton ihren früheren Zögling erkannt hat. Sie lebt in einem Häuschen auf dem Grundstück, müssen Sie wissen, Trenchard, und Norton hat sie aufgesucht. Aber es stimmt auch, daß sie bereits über achtzig ist, sehr schlecht sieht und den starken Wunsch hat, James möge noch am Leben sein. Gegen die Aussage von James' eigener Mutter, seinem Bruder, ganz zu schweigen von seiner früheren Verlobten, zählt das praktisch nicht.«
»In diesem Fall, meine Herren«, sagte ich, »können wir Mr. Norton getrost vergessen, nicht wahr? Meine einzige Sorge ist, daß er meine Frau weiter beunruhigt.«
»Solange er keinen einzigen Fürsprecher aus James' engstem Kreis findet«, sagte Richard Davenall, »kann er nicht mehr als ein kleines Ärgernis sein. Doch aufgrund der vielen Informationen, die, er so sorgfältig gesammelt hat, kann sich der Ärger beträchtlich auswachsen.«
»Ich werde ihn nicht mit Geld abfinden«, sagte Sir Hugo mit überraschender Heftigkeit. »Von mir kriegt er keinen Penny.«
»Dann wendet er sich vielleicht an die Boulevardpresse und pflastert die Titelseiten mit seinen Ansprüchen. Wäre es nicht vorzuziehen ...«
»Nein!« Sir Hugo knallte sein Glas auf ein Tischchen, um seine Meinung deutlich zu machen. »Wenn man ihm nur schweigende Verachtung entgegenbringt, wird er in das Loch zurückkriechen, aus dem er gekommen ist.«
»Wie du meinst.«
»Jawohl, Richard, es wird genau so gemacht, wie ich es meine. Ich bin jetzt das Oberhaupt dieser Familie, wie du sehr wohl weißt.« In dem anschließenden Schweigen schien Sir Hugo zu erkennen, daß er möglicherweise etwas zu weit gegangen war. In versöhnlicherem Tonfall fuhr er fort: »Hast du herausgefunden, wer dieser Norton in Wirklichkeit ist?«
»Wir stehen erst am Anfang, Hugo. Falls es einen echten James Norton gibt, werden wir seine Spur verfolgen. Aber ich kann mir vorstellen, daß er seine Spuren sehr gut verwischt hat.«
»Da wir gerade von Spuren reden«, sagte Cleveland, »sollten wir uns nicht auch auf die Beine machen, Hugo? Gussie wird enttäuscht sein, wenn wir um neun nicht da sind.«
Ich nutzte die Gelegenheit und verabschiedete mich. Oberflächlich hatten sie mich beruhigt, doch ich wagte nicht länger zu bleiben, um nicht die Zerbrechlichkeit ihrer Überzeugung erkennen zu müssen. Die Davenalls, von denen ich so lange Zeit in Ehrfurcht erstarrt war, schienen in der Beziehung kein bißchen besser oder schlechter zu sein als jede andere Familie auch.
Als ich aufbrechen wollte, erbot sich Richard Davenall, mich zu begleiten. Wir ließen Sir Hugo zurück, der wehmütig in sein Whiskyglas starrte, während Cleveland in einem Spiegel über dem Klavier den Sitz seiner Schleife kontrollierte. Greenwood wartete in der Eingangshalle mit unseren Hüten und Handschuhen auf uns.
»Wo wohnen Sie, Trenchard?« fragte Davenall, als wir die Eingangsstufen hinabstiegen.
»St. John's Wood.«
»Ich muß nach Highgate. Fahren wir ein Stück zusammen? Wir können vorn an der Ecke eine Droschke nehmen.«
Ich war sofort einverstanden. Offensichtlich suchte er nach einer Gelegenheit, um mir ungestört von der kampflustigen Empörung seines Cousins seine Gedanken mitzuteilen. Langsam gingen wir in Richtung Grosvenor Place. Das Geräusch unserer Schritte hallte von den hohen Hausfronten zurück: die Dunkelheit hatte sich mit kühler Gleichgültigkeit herabgesenkt.
»Ich muß mich für Sir Hugo entschuldigen«, sagte Davenall. »Manchmal kommt er einem noch jünger vor, als er ist.«
»Ich glaube, er hat den Titel erst vor kurzem geerbt.«
»Stimmt. Vor knapp achtzehn Monaten. Ja, der Junge muß mit einer ganzen Menge fertig werden. Sir Gervases Krankheit hat sich sehr lange hingezogen – und dann mußte James auch noch offiziell für tot erklärt werden.«
»Wurde das erst kürzlich getan?«
»Es hätte bereits nach einer Frist von sieben Jahren getan werden können, vor allem angesichts der klaren Hinweise auf einen Selbstmord, doch Sir Gervase wollte nichts davon wissen.«
»Glaubte er nicht an den Tod seines Sohnes?«
»Er zweifelte daran, was tatsächlich recht merkwürdig war. Er war ein Mann, der sich keinerlei sentimentalen Gefühlen hingab. Auf alle Fälle wurden die notwendigen juristischen Maßnahmen erst in die Wege geleitet, als Sir Gervase tot war. Der Titel fiel Hugo deshalb mit einiger Verspätung zu. Wenn man bedenkt, daß zu all dem auch noch die ganze Besitzung verwaltet werden muß – ich fürchte, Sir Gervase hat den Dingen so ziemlich ihren Lauf gelassen –, kann Hugo schon einige entschuldigende Gründe für sein nervöses Verhalten vorbringen. Nichtsdestoweniger ...«
»Es ist nicht der Rede wert, Mr. Davenall. Ich bin froh, daß ich mir wegen dieser Sache keine Gedanken mehr machen muß.«
Natürlich machte ich mir trotzdem Gedanken – was, wie ich glaube, Richard Davenall auch spürte. Nachdem wir eine Droschke angehalten hatten und gemeinsam Richtung Norden fuhren, erzählte er mir freiwillig noch mehr von den Sorgen und Problemen seiner Familie. Für einen Anwalt war er seltsam offen und direkt, als hätte er in mir die Zuhörerschaft gefunden, die er brauchte, um seine eigenen Zweifel zum Ausdruck zu bringen.
»Es ist ein schwieriges Jahr für unsere Familie gewesen, Trenchard. Hugos Großmutter wurde im Februar von Einbrechern in ihrem eigenen Haus ermordet. Sie war uralt gewesen und hatte abseits in Irland gelebt, doch diese sinnlose Gewalttat warf einen Schatten auf unsere Familie. Durch sie erbte Hugo einen Landsitz in der Grafschaft Mayo. Sie war eine begehrte Erbin, als mein Onkel Lemuel sie vor siebzig Jahren heiratete, aber sie gewöhnte sich nie an das Leben in England und ging nach Irland zurück, als ihr Sohn halbwegs erwachsen war. Sir Gervase – nun ja, eigentlich wir alle – vernachlässigte sie, fürchte ich. Ich nehme an, ein großes Haus mit wenig Personal und mit mehr Anzeichen von Reichtum, als man sonst in dieser gottverlassenen Wildnis entdecken kann, muß die falsche Art von Aufmerksamkeit erregt haben.«
Ich glaubte zu erkennen, worauf er abzielte. »Sie meinen doch nicht diese schrecklichen Fenier, diese Geheimbündler?«
»Nein, das glaube ich nicht. Mary hat ihre Pächter niemals schlecht behandelt. Es wird sich wohl um Einbrecher gehandelt haben, denen sich Mary in den Weg gestellt hat. Sie war eine tapfere Seele. Hugo ist natürlich nicht meiner Meinung. Seit den Phoenix-Park-Morden sieht er hinter jeder Straßenlaterne Fenier. Von einer überfahrt will er nichts wissen.«
»Kann ich ihm nicht verdenken.«
»Ich auch nicht. Doch jetzt ist Mr. Norton aus seinem Loch gekrochen und macht es ihm auch noch in London ungemütlich. Es ist einfach seltsam ..., das Schicksal scheint es nicht gut mit uns zu meinen.«
Schicksal. Er hatte das Wort ausgesprochen, das wie Nebel um meine Fahrt zum Bladeney House und zurück wogte. Deshalb mußte ich ihm jetzt die Frage stellen. »Mr. Davenall, ich muß Sie etwas fragen. Ich weiß, was Sie in Sir Hugos Gegenwart sagten, aber dieser Norton ...«
»Sie möchten wissen, ob er James sein könnte?«
»Ja. Die Frage geht mir nicht aus dem Kopf.«
»Deshalb sind Sie ja auch heute abend vorbeigekommen. Wäre Ihre Frau sich absolut sicher gewesen, dann hätten Sie es nicht für nötig gehalten, eine zweite Meinung einzuholen.«
»Das stimmt. Ich kann nicht leugnen, daß mich der Mann durcheinandergebracht hat. Constance und ich hätten niemals geheiratet, wir hätten uns niemals kennengelernt ...«
»Wenn James am Leben gewesen oder zumindest nicht verschwunden wäre. Nun, seine eigene Mutter hat ihn nicht anerkannt, ebenso wenig wie sein Bruder. Was können Sie mehr verlangen?«
»Ihr unzweideutiges Urteil, denke ich – von einem Mann des Rechts.«
Die Droschke kam schwankend zum Stehen. Wir waren am Gloucester Gate angelangt, wo ich abgesetzt werden wollte. Davenall beugte sich aus dem Fenster und befahl dem Fahrer, einmal durch den Park zu fahren. Wie immer sonst sein Urteil lauten mochte, es war nicht unzweideutig, das war klar erkennbar. Mit einem leisen, aber hörbaren Seufzer ließ er sich wieder in den Sitz sinken.
»Sie scheinen zu zögern, Sir. Genau wie meine Frau, als ich sie um ihre Beurteilung bat.«
»Ich zögere aus dem gleichen Grund, Trenchard. Hugo war erst fünfzehn, als James verschwand. Außerdem muß ihm Norton als Bedrohung seines Titels und seines Reichtums erscheinen, da beides auf seinen Bruder übergehen würde, falls dieser noch am Leben wäre. Man kann also nicht von Hugo erwarten, daß er die Dinge nüchtern und sachlich beurteilt. Seine Mutter scheint jedenfalls keinen Zweifel daran zu haben, daß der Mann ein Betrüger ist. Ich habe selbst nicht mit Catherine gesprochen, aber ich gehe davon aus, daß sie in diesem Punkt absolut unnachgiebig ist. Natürlich hatte ich – im Gegensatz zu ihr – den Vorteil, daß ich zuvor gewarnt worden war. Als Norton in meinem Büro auftauchte, wußte ich, was auf mich zukam.«
»Ein Schwindler?«
»Ja. Das erwartete ich. Und dafür halte ich ihn immer noch. Denn was sonst könnte er schließlich sein? Es erscheint unvorstellbar, daß James sein Verschwinden geplant hat und dann elf Jahre später zurückkehrt. So unerklärlich sein Selbstmord auch war, wir können ihn nicht von einem reinen Glücksritter, wie geschickt er auch immer sein mag, in Frage stellen lassen.«
»Wenn er behauptet, James zu sein, muß er doch eine Erklärung für sein Verhalten haben.«
»Er sagt, er habe eine, aber ich weigerte mich, sie anzuhören. Falls es einmal dazu kommen sollte, dann nur in Anwesenheit von Zeugen, Trenchard. Ich möchte, daß wir uns seine Geschichte gemeinsam anhören, damit er sie nicht unseren individuellen Bedürfnissen entsprechend zurechtschneidern kann. Ich will, daß kein Raum mehr für irgendwelche Zweifel bleibt.«
»Ist denn jetzt ... Raum für Zweifel?«
»Das werde ich wohl zugeben müssen. Es ist leicht zu behaupten, daß Norton nicht der James ist, den wir kannten. Aber was wir kannten, war ein sorgloser junger Mann. Bei seinem Verschwinden war er dreiundzwanzig, wollte gerade heiraten, hatte anscheinend alles, was das Leben lebenswert macht. Doch wir wissen, daß dies nicht die Wahrheit war, daß auf tragische Weise irgend etwas – bis zum heutigen Tag Ungeklärtes – mit seinem Leben nicht stimmte. Was für eine Art Mensch könnten wir also elf Jahre später erwarten? Catherines Brief an Hugo bereitete mich auf einen aufgeblasenen Hochstapler vor, der sich auf eine vage physische Ähnlichkeit und ein gutes Gedächtnis für die Fakten, die er ausgegraben hat, verläßt. Doch so kam er mir nicht vor. Traurig, einsam, kultiviert, verwirrt, aber nicht überrascht von unserer Zurückweisung. Ja, ich muß es sagen: ein bißchen wie James.«
Das anschließende Schweigen wurde nur vom Hufgeklapper und vom Knirschen des Leders gestört. Es war eine lautlose, milde Nacht, in der jeder von uns die düstere und irritierende Möglichkeit ins Auge fassen mußte: Norton konnte trotz allem James Davenall sein. Vielleicht saß er jetzt irgendwo in der Stadt allein in seinem Hotelzimmer, starrte ins Leere und dachte darüber nach, welche Mauern seine Familie zur Begrüßung eines unwillkommenen verlorenen Sohnes aufgerichtet hatte. Die Davenalls und mich einte ein unwürdiger Wunsch: Er sollte tot bleiben. Ich wollte nicht, daß der Geist der verlorenen Liebe meiner Frau unser Leben kreuzte, geschweige denn, daß dieser Geist zu Fleisch und Blut wurde. Obwohl sie es nie ausgesprochen hatte, wußte ich, daß sie mich nur als zweite Wahl akzeptiert hatte, und das war für mich durchaus in Ordnung – solange der Tote auch tot blieb.
»Ich denke, ich werde hier aussteigen«, sagte ich.« Ein kleiner Spaziergang wird mir nicht schaden.«
Davenall beugte sich hinaus und gab dem Kutscher die Anweisung, zu halten. Dann hielt er mir die Tür auf. »Tut mir leid, daß ich Ihnen nicht das geben konnte, was Sie haben wollten, Trenchard.«
»Ein unzweideutiges Urteil, meinen Sie?« sagte ich beim Aussteigen. »Vielleicht habe ich zuviel verlangt.«
»Ich bin Anwalt«, erwiderte er. »Mein Berufsstand handelt mit Meinungen. Was Sie suchen, muß ein Gericht entscheiden.«
»Wird es dazu kommen?«
»Falls Norton weiterhin keine Fortschritte macht oder falls Sir Hugo meinen Rat, ihn abzufinden, annimmt – nein. Doch falls Norton glaubt, er könne gewinnen, oder falls er tatsächlich James ist, dann ist es durchaus möglich. Sehr gut möglich. Hier ist meine Karte.« Ich nahm sie entgegen. »Bleiben Sie in Kontakt. Vielleicht müssen wir noch mal miteinander reden.« Er klatschte mit der Hand gegen die Seite der Droschke, und sie trug ihn davon.
V
Die Avenue Road war zu Fuß zwanzig Minuten von der Stelle entfernt, an der Trenchard die Droschke verlassen hatte, doch er brauchte fast doppelt so lange. Er ging langsam, den Kopf gesenkt, mit den Füßen Blätter aufwirbelnd, während andere Blätter mit sanftem Rascheln in der nächtlichen Brise zu Boden fielen. Im Park schrie eine Eule, in der Ferne klapperte eine Droschke auf Marylebone zu. Und Trenchards Gedanken wanderten in die Vergangenheit, zu einem anderen milden Herbst vor zehn Jahren, zu Canon Sumners Salon in Salisbury, wo vereinzelte Sonnenstrahlen in schrägen Bahnen einfielen und Constance Sumner langsam ihre Trauer zu überwinden begann. Wäre Davenall damals zurückgekehrt, so hätte sie ihn sehnlichst erwartet.
»Sie erzählen mir«, hatte sie gesagt, »daß er tot ist. Doch das zu glauben erscheint mir wie Verrat.«
»Deine Weigerung, das zu glauben, ehrt dich«, hatte Trenchard erwidert. »Doch er hätte sicher nicht gewollt, daß du dich vom Leben abwendest, bloß weil er sich aus irgendeinem Grund zu sterben entschieden hat.«
Anfangs hatte sie sich dagegen gewehrt. Später, als sie seinem heilenden Charme erlegen war, hatte Canon Sumner Trenchards Bemühungen als einen wahrhaft christlichen Akt bezeichnet, und Trenchard hatte sich in seiner Dankbarkeit gesonnt. Jetzt hatte Norton ihn gezwungen, diese zarte und geduldige Werbung zu überdenken. Sein Verhalten war stets berechnender gewesen, als er sich selbst eingestehen wollte, denn ihre Trauer hatte sie verletzlich und verwundbar gemacht, und das hatte er ausgenützt. Schlimmer noch, da war auch das Vergnügen gewesen, die heimliche Befriedigung, sie einem anderen abzuwerben; ein ehebrecherischer Hauch lag in seinem offensichtlich so korrekten Vorgehen. Hätte er nicht auf schleichende, hinterhältige Weise ihre Zuneigung gewonnen, wäre sie vielleicht ihrer Erinnerung treu geblieben, hätte vielleicht das Unglaubliche so lange geglaubt, bis es schließlich Wahrheit geworden wäre.
Er bog in die Avenue Road, immer noch in Gedanken tief in seine unwillkommenen Erinnerungen verstrickt. Langsam ging er auf The Limes zu, bereitete die beruhigenden Worte vor, die er Constance sagen würde, um seine eigenen Zweifel vor ihr zu verbergen.
In dem Schatten, der vom letzten Baum vor dem Eingang zu The Limes geworfen wurde – ein Tümpel tintiger Schwärze, umgeben von mondhellem Grau –, stand James Norton und beobachtete den sich nähernden Trenchard. Beim Anblick des anderen hatte er sich hinter dem Baum versteckt, mußte aber doch angenommen laben, einer Entdeckung nicht ausweichen zu können. Doch Trenchard marschierte vorbei, ohne nach rechts oder nach links zu schauen, und bog in die Zufahrt zu seinem Haus ein.
Norton blieb einige Minuten lang regungslos stehen, bis er das ferne Zuschlagen der Haustür und das Geräusch eines Riegels hörte. Dann schien er zu lächeln. Vielleicht war es auch nur ein Mondstrahl, der seinen Mund streifte, als er sich zum erstenmal bewegte. Er griff in seine Tasche und zog ein silbernes Zigarettenetui hervor, an dem möglicherweise bei besseren Lichtverhältnissen ein verräterisches Monogramm zu erkennen gewesen wäre. Einen Augenblick später flackerte ein Streichholz auf, dann war ein schwacher, zufriedener Seufzer nach dem ersten Zug zu hören, gefolgt von dem Geräusch seiner Schritte, als er sich entfernte – ein beweglicher Schatten in der Stille der Nacht.
ZWEITES KAPITEL
I
In dieser Nacht schlief Constance Trenchard schlecht. Sie hatte lange auf die Rückkehr ihres Gatten von Bladeney House warten müssen. Auf ihre Fragen hin hatte er ihr zuerst beruhigende Antworten gegeben, doch dann war er ihr – für ihn ungewöhnlich – sehr reizbar erschienen. Schließlich waren sie schweigend zu Bett gegangen, erschreckt von der Erkenntnis, wie leicht und schnell ein Eindringling ihr seelisches Gleichgewicht stören konnte.
Fast beschämt mußte sich Constance am nächsten Morgen bei einem einsamen. Frühstück eingestehen, daß Williams offensichtlicher Kummer nicht der Grund war, weshalb sie so viele schlaflose Stunden zugebracht hatte. Es war nicht sein Gesicht gewesen, das sie immer vor sich gesehen hatte, sobald sie die Augen schloß, es waren nicht seine Worte, an die sie sich zu erinnern versuchte, die bei einer letzten, fernen Begegnung gesprochen worden waren. Sie beobachtete, wie die Sonnenstrahlen vom Fenster durch die von ihrem Kaffee aufsteigenden Dampfwolken schnitten, und spürte, wie ihre Gedanken zu einer Wiese in Somerset wanderten, die in dem zwanglosen Glanz eines Sommernachmittags erstrahlte. Juni 1871. So nah und doch so fern, so endlos fern. Sein Gesicht sah aus, als wäre es aus Elfenbein geschnitzt, als er sie anblickte, in seinen Augen ein verschleierter Kummer, der auch Verachtung sein konnte. Er zog seine Hand von ihr zurück. »So fängt es an«, sagte er zögernd. »Und so endet es.«
»Die zweite Postzustellung, Ma'am.« Es war Hillier mit ihrem breiten Grinsen. Auf einem Silbertablett brachte sie die Briefe.
Constance sah die Post durch. Alle Briefe waren für William, bis auf einen, der in schräger, korrekter Handschrift, die Erinnerungen in ihr weckte, an sie adressiert war. Die Ähnlichkeit der Schrift genügte, um sie den Brief aufreißen zu lassen, ohne erst nach dem Brieföffner zu greifen.
Great Western Royal HotelPraed StreetLONDON W.
1. Oktober 1882
Liebe Constance,
ich hoffe, meine Handschrift hat sich nicht ebenfalls so verändert, daß Du sie nicht mehr erkennst. Natürlich war ich nie ein großer Briefeschreiber, oder? Doch jetzt scheint mir das der einzige Weg zu sein, mit Dir in Verbindung zu treten.
Es tut mir leid, daß ich Dir durch mein unangemeldetes Auftauchen an diesem Nachmittag einen Schock versetzt habe. Doch wie hätte der Schock vermieden werden können? Ich kann nur sagen, daß ich vor elf Jahren aus guten Gründen verschwunden und nun aus guten Gründen wieder zurückgekehrt bin. Ich möchte Dir all das erklären, aber ich muß eine Gelegenheit abwarten, wo ich unter vier Augen mit Dir sprechen kann. Würdest Du mir diesen Gefallen tun–um der alten Zeiten willen? Ich werde hier im Hotel auf Dich warten, falls Du Dich zu einem Besuch in der Lage siehst. Selbstverständlich werde ich ohne Deine Billigung nicht mehr in The Limes vorbeikommen.
Niemand von uns kann vergessen, was auf jener Wiese geschah, nicht wahr? Vielleicht hätte ich Dir damals alles erklären sollen. Nachträglich wünsche ich mir mehr, als ich mit Worten ausdrücken kann, ich hätte es getan. Bitte gestehe mir die Möglichkeit zu, Deine Vergebung zu erlangen – und gib mir und Dir die Chance, mich wiederzuerkennen.
Für immer der Deine
James
Constance schob den Brief zurück in den zerfetzten Umschlag und erhob sich schwankend vom Tisch. Sie machte sich selbst darauf aufmerksam, daß sie kein junges Mädchen mehr war, das bei der Aussicht auf die Rückkehr ihres Verlobten in Ohnmacht fiel. Sie war eine erwachsene, vernünftige Frau und unterstrich das dadurch, daß sie mit ruhiger Präzision den Stuhl unter den Tisch schob. Dann wandte sie sich ab und ging zur Tür.
Im Flur wischte Hillier schwungvoll Staub. Sie summte im Rhythmus ihrer Arbeit und schaute lächelnd auf.
»Ein wunderschöner Morgen, Ma'am.«
»Ja, Hillier, ein wunderschöner Morgen. Sie können das Frühstück abräumen, wann Sie wollen. Wo ist Patience?«
»Im Kinderzimmer, Ma'am. Sie lernt das Alphabet.«
»Hat Mr. Trenchard gesagt, ob er zum Lunch kommt?«
»Er meinte nein, Ma'am.«
»Gut. Danke. Ich bin im Salon, falls Sie mich brauchen.«
»Sehr wohl, Ma'am.«
Das Mädchen machte sich wieder voller Energie an die Arbeit. Constance ging – nur für den Fall, daß das Mädchen sie beobachtete – gemessenen Schrittes den Flur entlang. Sie betrat den Salon und schloß die Tür hinter sich.
An der dem Fenster gegenüberliegenden Wand stand ein schlichtes Schreibpult aus Walnußholz. Constance hob den Deckel hoch, der nie verschlossen war, und holte aus einem der Fächer den Schlüssel zu der kleinen Schublade, die sie aus reiner Gewohnheit sicherte. Nach einer Umdrehung war die Schublade offen.
In dieser Schublade waren Constances wenige persönliche Briefe untergebracht: William, der seine Papiere in einem größeren Schreibtisch in seinem Arbeitszimmer aufbewahrte, respektierte diese Privatsphäre. Es war ein schlankes, von einem rosafarbenen Band zusammengehaltenes Bündel. Constance war keine sentimentale Sammlerin. Doch einen Brief von James Davenall hatte sie aufbewahrt, den sie schon lange nicht mehr gelesen hatte.
Jetzt zog sie diesen Brief hervor, ohne das Band zu lösen, und legte ihn neben Nortons Brief auf die Schreibunterlage. Mit äußerster Sorgfalt verglich sie die Handschriften. Der eine Brief war mit blauer, der andere mit schwarzer Tinte geschrieben. Sie hätte weder beschwören können, daß die Briefe von einer Person, noch, daß sie von verschiedenen Personen geschrieben worden seien. Zwischen ihnen lagen elf Jahre und weiß Gott was für Erfahrungen. Außerdem wußte Constance nur zu gut, daß James' Brief in viel größerer Hast geschrieben worden war als der von Norton. Sie öffnete ihn, um sich seinen Inhalt zu vergegenwärtigen. Sie erinnerte sich, daß es sich um eine eilig hingekritzelte Nachricht handelte, geschrieben auf dem Briefpapier seines Londoner Clubs.
16. Juni 1871
Liebste Connie,
Ich muß mich beeilen, um den Brief noch zur Post zu bringen, damit er Dich auch sicher morgen erreicht. Bis dahin bin ich in der gleichen Richtung unterwegs.
Der Grund für meinen plötzlichen Besuch in London und der Grund, weshalb ich nicht direkt nach Cleave Court zurückkehren will, sind identisch. Sei bitte – wenn Du mich liebst–morgen mittag am Aquädukt. Ich komme zu Fuß von Bathampton und treffe Dich dort.
Mit all meiner Liebe
James
Constance hatte kurz vor der Hochzeit einige Tage auf Cleave Court verbracht. Es irritierte sie, wie wenig Zeit sie und James allein miteinander verbrachten; stets war irgendein Mitglied des Davenall-Haushalts zugegen. Dann war James' plötzliche Abreise nach London gekommen, gefolgt von dieser seltsamen Aufforderung zu dem mittäglichen Rendezvous, genau eine Woche vor der Hochzeit. Sie hatte es nicht vergessen und, wie es schien, Norton ebenfalls nicht.
Sie tat den Brief wieder in den Umschlag und schob ihn zusammen mit Nortons Brief zurück in das Bündel. Dann legte sie das kleine Päckchen in die Schublade und sperrte sie sorgfältig wieder ab. Normalerweise lag der Schlüssel in einem der Fächer, doch diesmal ließ sie ihn in das kleine Filztäschchen gleiten, das an ihrem Gürtel baumelte. Anschließend holte sie sich Papier und eine Feder, öffnete das Tintenglas und begann selbst einen Brief zu schreiben.
Die Formulierung fiel ihr nicht leicht, und sie kam auch nicht schnell voran. Die Uhr zeigte schon elf, als sie endlich den Umschlag versiegelte und die Adresse auf das Löschblatt preßte. Sie atmete tief durch, erhob sich und verließ das Zimmer.
Wie jede andere Dame, so gab auch Constance für gewöhnlich ihre Post nicht selbst auf, doch der schöne Morgen schien in diesem Fall ein ausreichender Vorwand zu sein. Vielleicht würde Hillier gar nicht merken, daß sie ausgegangen war. Und so setzte sie lediglich einen Strohhut auf, um ihre Augen zu beschatten, trat aus dem Haus und marschierte in flottem Tempo auf den Briefkasten zu, der gerade hundert Meter entfernt war. Überrascht stellte sie fest, daß ihr ziemlich heiß war, und sie spürte dankbar die leichte Brise auf ihren erhitzten Wangen.
Am Briefkasten angekommen, warf sie noch einen Blick auf den Umschlag in ihrer Hand. Es war merkwürdig, dachte sie, nach dieser langen Zeit einen derartigen Brief zu schreiben. Sie schob ihn durch den Schlitz und hörte, wie er auf die anderen Briefe fiel.
II
Am Donnerstag nach meinem Besuch in Bladeney House befand ich mich im Büro über der Filiale in der Orchard Street, als ich von Nortons nächstem Schachzug hörte. Ich hatte am Fenster gestanden und unaufmerksam Parfitt, dem Manager, zugehört, der mir weitschweifig die ästhetischen und kommerziellen Vorteile eines neuen marmorartigen Mosaikdesigns für die Gefrierfleischabteilung erläuterte. Warum nur begriff dieser bedauernswerte Mann nicht, daß mein Vater und nicht ich vom Sinn einer solchen Ausgabe überzeugt werden mußte? Ich schaute auf die Straße hinunter und beobachtete den emsigen Verkehr, hörte das Rattern der Karren und den Ruf eines Zeitungsverkäufers, der Parfitts monotone Stimme übertönte, und fragte mich wie so oft in müßigen Momenten: Wo ist er jetzt? Was tut er?
Eine Art Antwort darauf erhielt ich früher als erwartet. Eine bekannte Gestalt tauchte aus der Oxford Street auf, überquerte die Straße und steuerte offensichtlich auf unseren Eingang zu. Er blickte auf, sah mich und berührte grüßend seine Hutkrempe. Es war Richard Davenall.
Ich schnitt dem armen Parfitt sofort das Wort ab und bat ihn, dafür zu sorgen, daß mein Besucher unverzüglich zu mir geführt wurde. Nach wenigen Minuten saß mir Davenall heftig keuchend gegenüber; er entschuldigte sich, daß er mich so ohne jede Vorwarnung überfallen hatte.
»Ich hätte es auch schriftlich erledigen können, aber ich nahm an, Sie würden ein Gespräch in der Sache vorziehen.«
»Sie haben also noch einmal von Norton gehört?«
»Mr. Norton hat einen Anwalt mit der Durchsetzung seiner Ansprüche beauftragt. Warburton von Warburton, Makepeace & Thrower. Ein angesehener Mann, auch wenn das mehr für seine Erfolge als für seine Methoden gilt. Die Kanzlei ist für ihr gelegentlich unorthodoxes Vorgehen bekannt. Es erscheint deshalb ganz logisch, daß Norton sie gewählt hat. Doch meiner Meinung nach schwächt das seine Position.«
»In welcher Beziehung?«
»Wäre James am Leben, dann würde er sich wohl kaum auf einen solchen Mann stützen. Abgesehen davon ist Warburton nicht gerade billig. Vielleicht haben Sie sich auch schon gefragt, woher Nortons Mittel kommen. Er geruht, in einem Eisenbahnhotel abzusteigen, das ist wahr, doch er beabsichtigt, einen teuren Rechtsstreit zu führen. Wie finanziert er das?«
»Haben Sie eine Vorstellung?«
»Nein. Mr. Norton bleibt ein unbeschriebenes Blatt. Aber wir werden bald sehen, wie unbeschrieben dieses Blatt ist. Das ist auch der Anlaß meines Besuches. Warburton hat eine offizielle Untersuchung von Nortons Ansprüchen beantragt, ein Treffen vor Zeugen zwischen ihm und den betroffenen Parteien. Ich dachte, Sie würden vielleicht gern dabeisein.«
»Unbedingt. Bedeutet das, daß Norton seinen Anspruch durch befriedigende Antworten auf detaillierte Fragen untermauern oder, falls er dazu nicht in der Lage ist, eingestehen muß, daß die ganze Sache ein Schwindel war?«
»Genau so ist es. Das Treffen findet am nächsten Mittwoch, dem elften, in Warburtons Kanzlei statt. Ich habe Sir Hugo vorgeschlagen, daß die Beteiligten am Abend zuvor in Bladeney House zusammenkommen, um das weitere Vorgehen miteinander abzustimmen. Die Untersuchung könnte einen gefährlichen Verlauf nehmen, doch es ist sicher einen Versuch wert, diesen Betrug gleich zu Beginn auffliegen zu lassen.«
»Das klingt zu gut, um wahr zu sein.«
Richard lächelte. »Ich fürchte, Sie könnten recht haben, Trenchard. Sir Hugo glaubt, Norton habe sich damit selbst die Schlinge um den Hals gelegt, doch ich bin der Meinung, er hätte sich nicht darauf eingelassen, wenn er nicht überzeugt wäre, ungeschoren davonzukommen.«