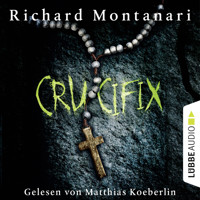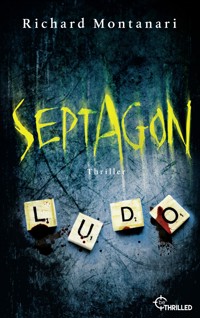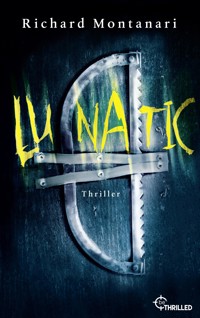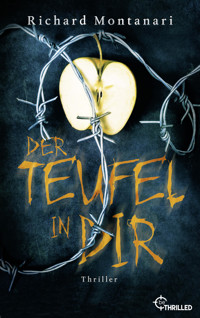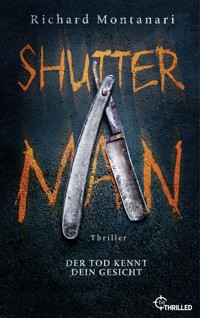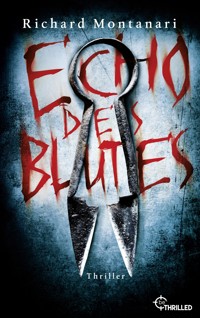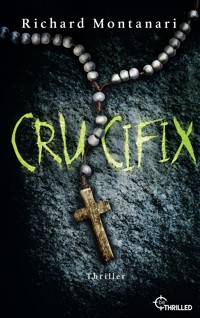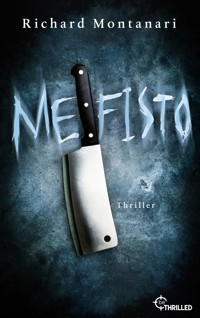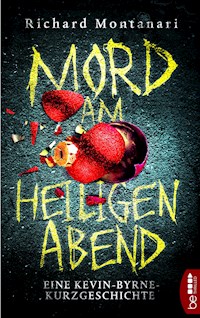3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Spannende Thriller mit Byrne und Balzano
- Sprache: Deutsch
Als er zwölf Jahre alt war, hat er zum ersten Mal getötet. Und er hat niemals damit aufgehört.
Die Detectives Kevin Byrne und Jessica Balzano werden zu einem bizarren Tatort gerufen: Einem Mann wurde ein Eisenbahnnagel in den Kopf geschlagen. Dann setzte der Mörder ihn blutüberströmt auf eine Bank in einem öffentlichen Park.
Das ist erst der Anfang einer Reihe von Morden, die zum Philadelphia State Hospital führen - und zu den Albträumen, die dort immer noch lauern. Das Krankenhaus war einst berüchtigt wegen seiner Insassen: psychisch kranke Kriminelle. Vor Jahren brannte es bis auf die Grundmauern nieder. Was niemand ahnt: Einer hat das Feuer überlebt. Und er hat die Stadt niemals verlassen ...
Nichts für schwache Nerven! Die spannungsgeladenen Thriller des Bestsellerautors Richard Montanari um das Ermittlerduo Byrne und Balzano:
Band 1: Crucifix
Band 2: Mefisto
Band 3: Lunatic
Band 4: Septagon
Band 5: Echo des Blutes
Band 6: Der Teufel in dir
Band 7: Der Abgrund des Bösen
Band 8: Tanz der Toten
Band 9: Shutter Man
Band 10: Mord am Heiligen Abend
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 550
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
EINS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ZWEI
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
DREI
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
VIER
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
Epilog
Über den Autor
Alle Titel des Autors bei beTHRILLED
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.
Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!
Dein beTHRILLED-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Die Detectives Kevin Byrne und Jessica Balzano werden zu einem bizarren Tatort gerufen: Einem Mann wurde ein Eisenbahnnagel in den Kopf geschlagen. Dann setzte der Mörder ihn blutüberströmt auf eine Bank in einem öffentlichen Park.
Das ist erst der Anfang einer Reihe von Morden, die zum Philadelphia State Hospital führen - und zu den Albträumen, die dort immer noch lauern. Das Krankenhaus war einst berüchtigt wegen seiner Insassen: psychisch kranke Kriminelle. Vor Jahren brannte es bis auf die Grundmauern nieder. Was niemand ahnt: Einer hat das Feuer überlebt. Und er hat die Stadt niemals verlassen …
Richard Montanari
DERABGRUNDDESBÖSEN
Aus dem amerikanischen Englischvon Karin Meddekis
Das Erste, was der Jäger im Schnee sah, war ein Schatten, eine lange, bläulich schimmernde Silhouette neben ein paar Ahornbäumen mitten auf der Wiese.
Es war tiefe Dämmerung an einem Tag Mitte März, und die Dunkelheit hatte noch nicht alle Tiere verschluckt und die Nacht noch nicht all ihre Opfer. Jedenfalls nicht die in dieser Größe.
Vorsichtig ging der Jäger weiter, und bei jedem Schritt knirschte die gefrorene Erde unter seinen Füßen. Das Knirschen hallte durch das Tal, und kurz darauf wurde es vom Schrei einer Eule übertönt. Es war ein trauriger Klagelaut, der ihn an das Mädchen erinnerte und an die Nacht, als sich alles verändert hatte.
Auf dem Berg wurde es still.
Als der Jäger sich den Bäumen näherte, tauchte der Schatten wieder auf. Er erkannte einen Mann, einen großen Mann, der keine zehn Meter von ihm entfernt stand.
Der Jäger wollte seine Armbrust anlegen, doch er konnte seine Arme nicht heben. Diese Lähmung hatte ihn schon einmal befallen, vor tausend schlaflosen Nächten. Damals, als er einen goldenen Schild auf der Brust getragen und Menschen gejagt hatte. In jener Nacht hätte er für dieses Leiden beinahe mit dem Leben bezahlt.
Als der große Mann ins Mondlicht trat, sah der Jäger sein Gesicht zum ersten Mal seit drei Jahren.
»Mein Gott«, sagte der Jäger. »Du.«
»Ich habe es gefunden.«
Zuerst glaubte der Jäger, der Mann würde eine fremde Sprache sprechen. So lange schon hatte er keine andere Stimme als seine eigene mehr gehört. Es dauerte nicht lange, bis er begriff, was diese vier Wörter bedeuteten. Er versuchte, die Wörter zu verdrängen und sich von ihrer Macht zu befreien, doch sie hatten sich schon ihren Weg in seine Vergangenheit und in seine Seele gebahnt.
Der Jäger ließ die Waffe fallen, sank auf die Knie und begann zu schreien.
EINS
1
Leise wie Staub bewegt er sich in der Stadt unter der Stadt durch die unterirdischen, dunklen Gewölbe, wo die toten Seelen flüstern und die Jahreszeiten niemals wechseln.
Am Tage geht er durch die Stadt, in der die Menschen wohnen. Er ist der Mann mit dem abgetragenen Mantel im Bus, der Mann in dem grauen Overall eines Arbeiters, der Mann, der Ihnen die Tür aufhält, der mit dem Finger an den Rand seiner Mütze tippt, wenn Sie eine Frau sind, und der höflich nickt, wenn Sie ein Mann sind.
Seine förmliche und zurückhaltende Art erinnert an vergangene Zeiten. Es ist weder Höflichkeit noch Aufmerksamkeit, und man kann es auch nicht als Zuvorkommenheit bezeichnen, obwohl die meisten Menschen, die ihm begegnen, sich zu seiner vornehmen Art äußern würden, wenn man sie fragte.
Nachts hat er die Abgründe der menschlichen Laster gesehen, und er weiß, dass es seine eigenen sind. Nachts geht er durch das Labyrinth seiner Steingänge und der dreckigen Räume und bezeugt Treffen in ruhigen Kellerräumen. Nachts irrt er durch die Traumarkaden.
Sein Name ist Luther.
Als er zwölf Jahre alt war, tötete er zum ersten Mal einen Menschen.
Und hörte nie wieder damit auf.
In fünf Tagen werden riesige Baumaschinen kommen, und die Erde wird zu beben beginnen. An diesem späten Wintermorgen steht er als Dritter in der Schlange an der Kasse in dem City Fresh Market in der West Oxford Street.
Die alte Frau steht vor ihm. Er schaut auf ihre Einkäufe: fünf Pakete Götterspeise in verschiedenen Geschmacksrichtungen, ein Viertelliter Sahne mit reduziertem Fettgehalt, dünne Spaghetti, ein Becher cremige Erdnussbutter.
Das Essen einer Krebskranken, denkt er.
Hinten in ihrer Strickjacke ist ein kleines Loch, aus dem mehrere Fäden herausragen. Darunter sieht er einen Riss in der Bluse. An der Stelle hat sie das Label herausgeschnitten, vermutlich weil es ihre Haut gereizt hat. Sie trägt bequeme, fest geschnürte Schuhe mit flachen Absätzen. Ihre Fingernägel sind kurz geschnitten und sehr sauber. Sie trägt keinen Schmuck.
Er beobachtet die Frau, die alle eingegebenen Preise auf dem LCD-Display überprüft und gar nicht bemerkt, dass sie für eine Verzögerung sorgt, oder es ist ihr gleichgültig. Er erinnert sich an ihren Eigensinn. Als sie bezahlt hat, nimmt sie ihre Einkaufstasche und geht ein paar Schritte auf den Ausgang zu. Sie überprüft den Kassenbon, um sicherzustellen, dass sie nicht betrogen wurde.
Der Mann beobachtet sie schon seit Jahren und hat gesehen, dass sich Falten in ihr Gesicht gegraben und Flecken auf ihren Händen gebildet haben. Die Arthrose zwingt sie, langsamer zu gehen. Damals schritt sie immer hoch erhobenen Hauptes durch die Gänge. Was einst wirkte wie herrisches Auftreten, das Vertrautheit oder Freundschaft verhinderte, ist nun dem schlechten Benehmen einer mürrischen alten Frau gewichen.
Als sie an der Tür ankommt, stellt sie ihre Tasche ab und knöpft ihren Mantel zu. Sie wird beobachtet, aber nicht nur von dem großen Mann hinter ihr.
Ein siebzehnjähriger Junge lungert in der Nähe eines Redbox-Filmautomaten herum, an dem man Filme ausleihen kann. Er beobachtet alles und lauert auf eine günstige Gelegenheit.
Als die Frau ihre Tasche wieder in die Hand nimmt, lässt sie ihre Kreditkarte auf den Boden fallen. Sie bemerkt es nicht.
Der Junge hingegen schon.
Träumen Sie?
Ja.
Wo sind Sie?
In Tallinn. In der Altstadt.
Welches Jahr haben wir?
Es ist 1958, neunzehn Jahre nach dem Ende der ersten Unabhängigkeit. Bis Weihnachten sind es noch fünf Tage. Die Lebensmittel sind knapp, aber die Lichter verströmen dennoch Freude.
Wohin gehen Sie?
Nach Lasnamäe. Dort werde ich einen Mann treffen.
Wer ist der Mann?
Ein blinder Mann, ein Deutsch-Balte. Ein Dieb. Er bestiehlt ältere Leute, die ohnehin nicht viel haben. Er hat einem Freund etwas gestohlen, und ich hole es heute Nacht zurück.
Wie ist das möglich? Wie kann ein blinder Mann so etwas tun?
Er weiß noch nichts von seiner Blindheit.
Luther hält Abstand, als er den Dieb die West Oxford Street hinunter zur Marston Street und dann Richtung Süden verfolgt. Viele der Gebäude in diesem trostlosen, verwahrlosten Viertel stehen leer und sind mit Brettern vernagelt.
Ehe sie die Jefferson Street erreichen, biegt der Dieb in eine Gasse ein und drückt mit der Schulter eine Tür auf.
Luther folgt ihm. Als sein Schatten die Mauer gegenüber von der zersplitterten Tür verdunkelt, bemerkt der Dieb ihn. Er erschrickt und dreht sich hastig um.
Sie sind allein.
»Du hast etwas, das dir nicht gehört«, sagt Luther.
Der Dieb mustert ihn von oben bis unten, schätzt ab, wie groß und wie stark er wohl ist, und sucht nach einer verräterischen Wölbung, die auf eine Waffe hinweist. Als er keine sieht, wird er mutig. »Wer sind Sie, verdammt?«
»Nur ein Fremder in zerlumpter Kleidung.«
Der Blick des Diebes wandert zur Tür und zurück zu Luther. »Ich hab Sie gesehen. Sie waren in dem Geschäft.«
Luther schweigt. Der Dieb tritt einen Schritt zurück, und das nicht unbedingt, um sich zu schützen, sondern um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel Platz ihm bleibt.
»Was wollen Sie?«, fragt der Dieb. »Ich hab zu tun.«
»Und was soll das sein?«
»Das geht Sie gar nichts an, verdammt.« Der Dieb bewegt die rechte Hand langsam zu seiner Gesäßtasche. »Vielleicht nehme ich Ihnen ja weg, was Sie haben. Vielleicht mach ich ja Sie fertig, Pendejo.«
»Vielleicht.«
Die Hand des Diebes nähert sich der Gesäßtasche. Jetzt wirkt er nervös. »Sie sprechen so komisch. Wo kommen Sie eigentlich her?«
»Von überall und nirgends. Ich komme von einem Ort, der genau unter deinen Füßen liegt.«
Der Dieb schaut auf den Boden, als läge die Antwort dort und als könnte dort plötzlich ein Reiseführer mit Eselsohren auftauchen.
Als er den Blick hebt, legt der Mann, der vor ihm steht, seinen Mantel ab, zieht den Schlapphut aus seiner Gesäßtasche und setzt ihn auf. Was gerade noch Neugier war, verwandelt sich nun in etwas anderes, in einen Albtraum. Der Dieb mustert den Mann in dem abgetragenen, braunen Anzug mit den ausgefransten Ärmeln, den schief aufgenähten Taschen und dem fehlenden Knopf. Er sieht die Blutflecken.
Blitzschnell greift der Dieb in seine Gesäßtasche und zieht eine Halbautomatik heraus, eine schwarze Hi-Point 9-mm. Doch ehe er sie entsichern kann, schlägt der Mann ihm die Waffe aus der Hand und wirft ihn brutal zu Boden.
Nachdem Luther den Dieb gebändigt hat, verharrt er einen Augenblick, bevor er die Waffe aufhebt. Er überprüft das Magazin und lädt die Waffe durch. »Was hattest du damit vor?«, fragt er.
Der Dieb ringt nach Atem. »Nichts.«
Luther legt die Waffe auf eine Holzpalette neben seinen Füßen.
»Mein Name ist Luther«, sagt er. »Ich halte es für wichtig, dass du das weißt.«
Der Dieb erwidert nichts.
»Ich sage das, weil ich aus Erfahrung weiß, dass das, was in diesem Raum passiert, einen Wendepunkt in deinem Leben darstellen wird. Du wirst vielen Menschen von diesem Ereignis erzählen, und sie werden dich fragen: ›Wie hieß der Mann?‹«
»Ich brauche nicht zu wissen, wer Sie sind.«
»Nun, ich habe dir nur gesagt, wie ich genannt werde, und nicht, wer ich bin.«
»Nehmen Sie einfach alles, was ich habe, Mann. Was ich gesagt habe, war nicht so gemeint. Ich hätte Sie nicht erschossen.«
Luther nickt. »Ich möchte dir eine Frage stellen. Wenn du nachts schläfst oder nach einem guten Essen einen Mittagsschlaf hältst, träumst du dann?«
»Was?«
»Es ist eine einfache Frage. Träumst du?«
»Nein, ich … Ja, ich träume.«
»Einige Menschen behaupten, sie träumen nicht, aber die Wahrheit ist, dass wir alle träumen. Was diese Menschen sagen wollen, ist, dass sie sich oft nicht an ihre Träume erinnern.«
Luther durchquert den Raum und lehnt sich gegen die Wand. Der Dieb späht auf die Waffe auf der Palette. In seinem Blick spiegelt sich die Erkenntnis, dass er es nicht schaffen wird, sie an sich zu reißen.
»Ich gebe dir ein Beispiel«, sagt Luther. »Weißt du, dass mitunter, wenn wir träumen, alles mit einer Situation beginnt, die sich mit einem Mal wie durch ein Wunder verändert? Vollkommen verändert? Das Träumen fällt nämlich tatsächlich in den Bereich der Magie.«
Der Dieb schweigt.
»In dem Traum bist du, sagen wir, ein berühmter Matador. Du stehst mit dem wilden Stier in der Arena, und Tausende jubeln dir zu. Du schwenkst die Muleta und hebst deinen Degen, um dem Stier den tödlichen Stich zu versetzen.
Plötzlich verfügst du über die Fähigkeit zu fliegen, über die Menge aufzusteigen, deinen Schatten auf die Landschaft zu werfen und das Salz des Meeres zu riechen. Ich behaupte, dass man solche Träume nur schwer abschütteln kann. Für die meisten von uns ist es eine große Enttäuschung aufzuwachen, eine solche göttliche Macht loszulassen und festzustellen, dass wir einfach der Mensch sind, der wir immer waren. Noch immer dem Chaos des irdischen Lebens ausgesetzt.«
Luther geht ein paar Schritte Richtung Tür, wirft einen Blick in die Gasse und fährt fort.
»Als ich heute das Haus verließ, träumte ich nicht von der Situation, in der wir uns nun befinden. Ich nehme jedoch an, dass du davon geträumt hast.«
»Nein, Mann«, sagt der Dieb. »Das habe ich nicht. Lassen Sie mich …«
»Und dennoch hast du diese Furcht erregende Waffe mitgenommen.«
»Nur zu meinem Schutz.«
»Vor wem? Vor alten Frauen mit Kreditkarten?«
Der Dieb schaut auf seine Hände. »Ich hatte nicht vor, sie zu benutzen.«
»Verstehe«, sagt Luther. »Im weitesten Sinne glaube ich dir sogar. Und darum könnte es doch noch gut für dich ausgehen.«
Die Augen des Diebes leuchten wieder. »Was muss ich tun?«
Luther geht auf ihn zu und hockt sich vor ihn hin. »Es gibt einen Traum von einem blinden Mann. Kennst du ihn?«
Der Dieb schüttelt den Kopf.
»Es heißt, wenn jemand von Blindheit träumt, bedeute es, dass es eine Wahrheit über ihn gibt, die er nicht akzeptieren will, oder dass er von seinem Weg im Leben abgekommen ist. Ich glaube, das trifft auf dich zu.«
Der Dieb beginnt zu zittern.
»Ich bin hier, um dir zu helfen, deinen Weg zu finden, Jaak Männik.«
»Wer?«
Luther antwortet ihm nicht. Er nimmt die Waffe des Diebes in die Hand, greift dann unter sein Jackett und zieht ein langes Messer mit einem Elfenbeingriff hervor.
»Nein«, sagt der Dieb. »Das können Sie nicht machen.«
»Du hast recht. Und darum wirst du es selbst tun. Du wirst dir die Augen ausstechen, während der Matador seinen Degen schwingt, und dann wirst du endlich sehen.«
»Sie sind verrückt, Mann!«
»Es steht weder dir noch mir zu, darüber zu entscheiden«, sagt Luther. Er hebt einen dreckigen Lappen vom Boden auf und reicht ihn dem Dieb. »Für das Blut.«
»Nein, Mann. Das kann ich nicht.«
»Nun, es ist auch eine schwierige Angelegenheit. Man muss extreme Vorsicht walten lassen. Wenn du das Messer zu tief hineinstößt, durchtrennst du den Sehnerv, ja, aber du könntest es auch in deinen Stirnlappen stoßen. Wenn du es machst, besteht die Möglichkeit – und so wie ich es verstanden habe, ist sie wirklich sehr groß –, dass du überleben wirst. Wenn ich es mache, wirst du nicht überleben, fürchte ich. Ich kann dir die Entscheidung nicht abnehmen.«
Luther steht wieder auf.
»Siehst du den alten Kalender an der Wand hinter mir?«, fragt Luther.
Der Dieb schaut auf die Wand. Dort hängt an einem Nagel ein vergilbter Kalender. Januar 2008. »Ja.«
»Siehst du das Datum vom fünfzehnten Januar?«
Der Dieb nickt.
Ohne ein weiteres Wort wirbelt Luther herum und feuert mit der Waffe genau in die Mitte des winzigen Quadrats vom fünfzehnten Januar. Dann dreht er sich wieder zu dem Dieb um, reicht ihm das Messer und tritt zurück.
»Sag mir, für welchen Traum entscheidest du dich? Willst du noch viele Jahre als blinder Mann leben oder hier an diesem furchtbaren Ort sterben?«
Luther riecht den Gestank des Urins, als der junge Mann sich in die Hose pinkelt. In der Kälte des ungeheizten Raums steigt vom Schoß des Diebes Dampf auf.
»Sie werden mich nicht töten, wenn … wenn ich es tue?«
»Nein. Du hast mein Wort.« Er schaut auf die Uhr. »Aber du musst es in den nächsten dreißig Sekunden tun. Mein Versprechen gilt nur für diesen Zeitraum.«
Der Dieb atmet tief ein und stoßweise aus. Dann richtet er zögernd das Messer auf sich.
»Ich kann das nicht!«
»Fünfundzwanzig Sekunden.«
Der Dieb beginnt zu schluchzen. Seine Hand zittert, als er das Messer näher an sein Gesicht heranführt. Er hebt die linke Hand, um die rechte zu stabilisieren, und starrt auf die Klinge wie auf einen brennenden Rosenkranz, auf dem die Sünden wie Perlen aufgereiht sind.
»Zwanzig Sekunden.«
Der Dieb beginnt zu beten.
»Dios te salve, Maria.«
»Fünfzehn Sekunden.«
»Llena eres de gracia.«
»Zehn Sekunden.«
»El Señor es contigo.«
»Fünf Sekunden.«
Genau in dem Augenblick, als die Spitze der Klinge das linke Auge um 11.05 Uhr durchbohrt, hält draußen eine Bahn mit einundzwanzig Fahrgästen an. Die Schreie des Diebs werden von dem Kreischen der Bremsen übertönt und von den Abgasen verschluckt.
Als dem Dieb das Messer aus den Händen fällt, herrscht Stille.
Der Dieb, der Ezequiel Rivera »Cheque« Marquez hieß, hatte immer geglaubt, dass der Tod, wenn er kommt, von einem gleißenden weißen Licht oder Engelsgesang begleitet wird. Als seine Mutter mit einunddreißig Jahren in einer osteopathischen Klinik in Camden, New Jersey, starb, wollte er es glauben. Vielleicht wollen es alle achtjährigen Kinder glauben.
Cheque Marquez erlebte diesen Augenblick keineswegs so. Der Tod war kein Engel in einem langen, wallenden Gewand.
Der Tod war ein Mann in einem abgewetzten, braunen Anzug.
Eine Stunde später steht Luther vor dem Haus der alten Frau. Von der gegenüberliegenden Straßenseite aus schaut er zu, wie sie das Laub von ihrer Veranda fegt. Er wundert sich, wie klein sie ist und wie groß sie ihm einst erschien.
Luther weiß, dass er sie das nächste Mal in ihrem Schlafzimmer mit den Spitzengardinen, dem süßlichen Geruch, der Tapete, die sich von den Wänden löst, den Mäusen und dem Körperpuder sehen wird. Bei dem Besuch wird er die Kreditkarte in ihr Portemonnaie zurückstecken.
In den kommenden Tagen muss alles an seinem Platz liegen. Alles muss so sein, wie es immer war. Luther hatte die Begegnung mit dem Dieb nicht geplant, aber wenn die Kreditkarte der alten Frau fehlte, könnte sich alles ändern. Es könnte bedeuten, dass sie ihren vorletzten Tag unter die Lupe nahmen.
Er hatte ihr Haus schon drei Mal besucht und am Fußende des Betts gesessen, während sie sich unruhig im Schlaf hin und her wälzte und Dämonen sie jagten. Welche, das konnte er nur erahnen. Vielleicht war er einer dieser Dämonen. Vielleicht wusste die Frau, dass er es sein würde, wenn ihre Zeit gekommen war.
Am Ende kommt immer irgendjemand.
2
Detective Jessica Balzano saß in einem hellen Raum und streckte die linke Hand in die Luft. Durch ein Fenster hinter ihr drang Straßenlärm herein. Zuerst dachte sie, sie wäre allein, doch dann stellte sie fest, dass rings um sie herum Menschen waren. Sie sah sie nicht, doch sie wusste es mit der gleichen Gewissheit, wie man etwas in einem Traum weiß. Wenn in einem Traum in jeder Ecke Gefahren lauern könnten, weiß man, dass man nur von diesen Gefahren träumt und dass einem nichts zustoßen wird. Man muss nur aufwachen, und dann ist es vorbei.
Aber das hier war kein Traum. Sie saß in einem Seminarraum und hob die Hand. Mindestens ein Dutzend Menschen starrten sie an.
Richtige Menschen.
»Miss Balzano?«, sagte jemand.
Der Mann, der vorne in dem Raum stand und ihren Namen kannte, war dünn, blass und um die sechzig. Er trug eine verwaschene blaue Strickjacke mit Schulterbesätzen und eine beigefarbene Kordhose, die an den Knien ausgebeult war. Er lächelte verhalten, als hätte er so etwas schon einmal gemacht und als wäre dies ein Scherz, über den alle anderen lachen konnten.
Alle außer Jessica Balzano.
Ehe Jessica antworten konnte, traf sie die Erkenntnis wie ein Schlag, und sie schämte sich entsetzlich. Sie lag nicht in ihrem gemütlichen kleinen Haus in Süd-Philadelphia neben ihrem Mann Vincent im Bett, während die beiden Kinder wohl behütet in ihren Zimmern im zweiten Stock schliefen. Stattdessen war sie an der Uni. Es war ihr zweites Studienjahr an der juristischen Fakultät.
Sie hatte gewusst, dass es so werden würde, aber sie hatte nicht gewusst, dass es so werden würde. Sie hatte auch geahnt, dass dies eines Tages geschehen würde, und jetzt war es geschehen. Sie war im Seminar eingeschlafen.
Jessica ließ den Arm sinken, und tausend Fragen schossen ihr durch den Kopf. Was war das für ein Seminar? Vertragsrecht? Schadensersatzrecht? Zivilprozessrecht?
Sie hatte keine Ahnung.
Jessica schaute auf die Tafel und sah ein Zitat von Louis Nizer: Bei einem Kreuzverhör gibt es ebenso wie beim Angeln nichts Unangenehmeres, als von seinem Fang ins Wasser gezogen zu werden.
Das half ihr jetzt auch nicht weiter.
»Miss Balzano?«, sagte der Professor. »Freiheitsberaubung?«
Gott segne ihn, dachte Jessica. Zum Glück hatte er die Frage wiederholt.
»Die drei Merkmale der Freiheitsberaubung sind: vorsätzliche Festnahme, Festnahme ohne Einverständnis und die rechtswidrige Festnahme«, antwortete Jessica.
»Sehr gut.« Der Professor zwinkerte ihr zu. Er arbeitete schon seit fünfundzwanzig Jahren als Dozent an der juristischen Fakultät. Jessica war nicht die erste Studentin, die in seinem Seminar einschlief. Sie würde auch nicht die letzte sein.
Jessica griff unter den Tisch und kniff sich so fest in das Fleisch zwischen Daumen und Zeigefinger, dass es fast zu bluten begann. Das war ein alter Trick, um nicht einzuschlafen, wenn man Nachtschicht hatte und von elf Uhr abends bis sieben Uhr morgens arbeiten musste. Der Leiter ihrer praktischen Ausbildung im ersten Jahr nach der Polizeiakademie hatte ihr den Trick beigebracht.
In den nächsten vierzig Minuten probierte Jessica jeden Trick, den sie jemals gelernt hatte, um wach zu bleiben. Zum Glück rief der Dozent sie nicht noch einmal auf, und irgendwie hielt sie bis zum Ende der Stunde durch.
Auf dem Weg zum Wagen sah Jessica eine kleine Gruppe ihrer Kommilitonen, die den Parkplatz Ecke Cecil B. Moor und Broad Street überquerten. Sie waren alle um die zwanzig, hellwach, glücklich und voller Lebensenergie. Jessica hätte sie am liebsten erschossen.
»Hey, Jessica«, sagte einer von ihnen. Er hieß Jason Cole und führte den inoffiziellen Titel des süßesten Jungen in der Klasse, in der es jede Menge Konkurrenz um diesen Titel gab. »Da hast du dich gerade aber gut aus der Affäre gezogen.«
»Danke.«
»Einen Augenblick lang dachte ich schon, du würdest dich total blamieren.«
Da liegst du gar nicht mal so falsch, dachte Jessica. »Keine Chance«, sagte sie und schloss den Wagen auf. »Ich war schon in schwierigeren Situationen.«
Jason lächelte. Er trug eine Zahnspange und sah damit noch süßer aus. »Wir setzen unser Seminar im Starbucks fort. Hast du Lust mitzukommen?«
Sie wussten natürlich alle, dass sie Polizistin war, und noch dazu Detective in der Mordkommission. Sie wussten auch, dass sie versuchte, drei Leben unter einen Hut zu bekommen – Detective, Mutter und Studentin. Es war eine organisatorische Meisterleistung, neben den Seminaren am frühen Morgen, am späten Abend und am Wochenende alle anderen beruflichen und familiären Verpflichtungen zu erfüllen. Jessica hätte sich gerne selbst bedauert. Dabei war es für viele Leute, die in ihrem Alter studierten, der ganz normale Wahnsinn. Jedenfalls wäre sie jetzt am liebsten nach Hause gefahren, um das Nickerchen fortzusetzen, das sie im Seminar begonnen hatte. Aber das war nicht möglich. Abgesehen von den tausend anderen Dingen, die sie noch erledigen musste, hatte sie eine Zwölf-Stunden-Schicht vor der Brust.
Es war ihr erster Tag nach einem zweiwöchigen Urlaub.
»Ich muss arbeiten«, sagte Jessica. »Vielleicht das nächste Mal.«
Jason hob den Daumen. »Wir halten dir einen Platz frei.«
Hundemüde stieg Jessica in ihren Wagen. Sie starrte auf die Fachbücher auf dem Sitz und fragte sich nicht zum ersten Mal in den vergangenen achtzehn Monaten, wie sie sich in eine solche Lage hatte bringen können.
Derzeit arbeitete Jessica vier Tage pro Woche in der Abteilung für besondere Ermittlungen. Diesem großzügigen Angebot ihres Captains hatte auch der Inspector zugestimmt und – was besonders wichtig war – ihr Ehemann Vincent. Meistens musste sie sich mit rund fünf Stunden Schlaf pro Nacht begnügen. Ein solches Leben als zweiundzwanzigjährige Studentin zu führen, war eine Sache, aber eine ganz andere, wenn jenseits der fünfunddreißig schon die Osteoporose in der Ferne lauerte.
In der Mordkommission des Philadelphia Police Departments gab es drei Abteilungen, und zwar eine, die in aktuellen Fällen ermittelte; eine andere für besondere Ermittlungen, wobei es sich größtenteils um ungelöste Fälle handelte; und die Fahndungsabteilung. Was die Dringlichkeit betraf, den Fall abzuschließen, und die Notwendigkeit, Überstunden zu machen, stellte die Abteilung für besondere Ermittlungen geringere Anforderungen als die anderen Abteilungen. Dennoch konnte die körperliche und psychische Belastung bei den Ermittlungen in ungelösten Fällen genauso stark sein wie bei neuen Mordfällen. Allerdings war es möglich, die Arbeitstage etwas besser zu strukturieren. Es bestand auch nicht der starke Druck, in den ersten achtundvierzig Stunden einen entscheidenden Durchbruch zu erzielen und um jeden Preis eine Verhaftung durchzuführen.
Diesen Beruf hatte Jessica sich ausgesucht, und sie erinnerte sich noch genau an den Augenblick, als sie diese Entscheidung traf. Sie war dreizehn Jahre alt gewesen und hatte mit ihrem Bruder Michael den Gerichtssaal im Rathaus besucht. Die beiden Kinder wollten dabei sein, wenn ihr Vater – damals Sergeant Peter Giovanni – vor dem Richter Liam McManus als Zeuge aussagte.
An jenem Tag saß Jessica in der hinteren Reihe. Sie verfolgte interessiert den Prozess, bei dem der Staatsanwalt und der Verteidiger sich einen wahren Schlagabtausch lieferten. Da Jessica in einer Polizistenfamilie aufgewachsen war, wusste sie, dass es viele Jobs gab, die zur Einhaltung und Durchsetzung der Gesetze beitrugen – Polizisten, Richter, Kriminaltechniker, Rechtsmediziner. Doch aus irgendeinem Grunde fühlte sie sich sofort zu dieser exklusiven Bühne hingezogen, denn was sich dort abspielte, war von entscheidender Bedeutung. Wenn alle anderen ihre Jobs gemacht hatten, kam es auf das klare, emotionslose Denken zweier Menschen an, um anhand der vorliegenden Beweise entweder auf schuldig oder unschuldig zu plädieren.
Die junge Jessica Giovanni war von diesem Beruf richtiggehend fasziniert gewesen. Beim anschließenden Mittagessen mit ihrem Bruder und ihrem Vater in Frank Clements Tavern, die sich damals gegenüber vom Old Original Bookbinder’s, dem berühmten Fischrestaurant, befand, hatte Jessica eine klare Vorstellung von ihrer Zukunft. Als sie in ihr Käsesteaksandwich biss, beobachtete sie fast ehrfürchtig, wie Rechtsanwälte, Staatsanwälte und Richter – und sogar ein zukünftiger Richter des Obersten Gerichtshofs von Pennsylvania – gemeinsam in der viel besuchten, verqualmten Kneipe saßen. Viele von ihnen kamen an ihren Tisch, um mit ihrem Vater zu plaudern.
An diesem Tag schmiedeten sie Pläne für ihre Zukunft: Michael würde Polizist werden und Jessica Staatsanwältin. So war es geplant. Es würde so ähnlich sein wie in der Krimiserie Law & Order, nur dass die Episoden in Süd-Philadelphia spielten. Peter Giovanni – einer der Polizisten mit den meisten Auszeichnungen in der Geschichte des Philadelphia Police Departments – trat als Lieutenant in den Ruhestand. Er würde den mürrischen ehemaligen Polizisten spielen, der seine San-Marzano-Tomaten im Garten züchtete, seine Kinder moralisch unterstützte und kernige Witze riss.
Alles lief nach Plan, bis zu diesem schrecklichen Tag im Jahr 1991, als Michael, der als Marine im Desert Storm kämpfte, in Kuwait ums Leben kam.
Plötzlich war Michael Giovanni, Jessicas wundervoller Bruder – ihr Beschützer, ihr Vertrauter und ihr größter Held –, nicht mehr da.
Jessica erinnerte sich gut daran, wie sie in der Nacht, als sie von Michaels Tod erfuhren, mit ihrem Vater im Wohnzimmer saß und er angestrengt versuchte, nicht vor ihr zu weinen. Als sie eine Woche später neben Michaels Sarg kniete, war ihr klar, dass sie ihren Traum, Juristin zu werden, auf Eis legen musste, und das vielleicht für immer. Nun würde sie diejenige sein, die in die Fußstapfen ihres Vaters trat. Sie hatte ihre Entscheidung, die Polizeiakademie zu besuchen, in den folgenden Jahren niemals bereut, nicht ein einziges Mal. Doch sie spürte, dass jetzt der richtige Zeitpunkt war, wenn sie jemals das Juraexamen ablegen wollte.
Ob sie nach dem Abschluss des Studiums jemals zum Juraexamen antreten würde, wusste sie nicht genau, aber sie war es ihrem Bruder schuldig, es wenigstens zu versuchen.
Jessica startete den Wagen und schaute auf die Uhr. Es war fünf vor zwölf. Ihr blieben noch fünf Minuten, wenn sie pünktlich im Roundhouse sein wollte. Und das bei dem Verkehr in Philadelphia! Sie öffnete das Handschuhfach und nahm ein Twix heraus. Viele Kalorien, viel Zucker und keine Nährstoffe.
Ja.
Mit dem Schokoriegel in der Hand fuhr Jessica Balzano vom Parkplatz und fädelte sich in den Verkehr in der Broad Street ein.
Wenn Gott ihr heute wohlgesinnt war – und sie war in vielerlei Hinsicht gesegnet, sodass sie in naher Zukunft nicht noch mehr von Gott erwarten konnte –, würde sie um Mitternacht zu Hause sein und im Bett liegen.
Gott erhörte sie nicht.
3
Als Jessica im Roundhouse ankam, dem Verwaltungsgebäude der Polizei Ecke Achte und Race Street, hielten sich in dem Großraumbüro nicht viele Kollegen auf. Die Detectives der Mordkommission, deren Schicht von sieben bis sechzehn Uhr ging, waren unterwegs. Die wenigen anwesenden Detectives telefonierten, verschickten Faxe oder saßen am Computer. Einige taten so, als würden sie eifrig arbeiten, damit die Chefin nicht mitbekam, dass ihre Ermittlungen ins Stocken geraten waren.
Kaum hatte Jessica den Mantel ausgezogen und sich auf ihren Stuhl gesetzt, da steuerte Sergeant Dana Westbrook, Jessicas unmittelbare Vorgesetzte, auch schon quer durchs Büro auf sie zu. Sie war Anfang fünfzig und hatte in der Elitetruppe der Marines gekämpft. Trotz ihrer Größe von gerade mal eins dreiundsechzig war Westbrook eine imposante Erscheinung. Seitdem sie die Nachfolge des in den Ruhestand getretenen Ike Buchanan übernommen hatte, hatte sie ihre Fähigkeiten in dieser von Männern dominierten Domäne – was sie vermutlich immer bleiben würde – bewiesen. Die Tatsache, dass Dana Westbrook beim Bankdrücken ihr eigenes Gewicht plus zwanzig Pfund drücken konnte, war dabei kein Nachteil.
Als Westbrook sich ihr näherte, sah Jessica den Ausdruck auf dem Gesicht ihrer Vorgesetzten. Der Ausdruck sagte: Es gibt Arbeit.
Keine Ruhe für die Rechtschaffenen, dachte Jessica.
Jessica und ihr Partner hatten gerade die Ermittlungen in einem Mordfall abgeschlossen. Daher lag im Augenblick nichts weiter an, als ein paar Unterlagen zu sortieren und abzuheften.
Es sah so aus, als würde sich das gleich ändern.
»Hey, Sergeant«, sagte Jessica.
»Guten Morgen, Jessica.«
Jessica spähte zu der Wanduhr hinüber. Der Morgen war definitiv vorbei. Sie fragte sich, ob Dana Westbrook einen Scherz machte oder diese Begrüßung aus Gewohnheit gewählt hatte. »Was liegt an?«
Westbrook hielt eine dünne Akte hoch. Jessica nahm an, dass es sich um eine Akte in einem Mordfall handelte, die im Jargon der Mordkommission meistens als »Mordakte« bezeichnet wurde. Sie war bei den Ermittlungen in einem Mordfall das A und O. Mit jedem neuen Fall wurde eine neue Akte angelegt. Nach dem Abschluss der Ermittlungen – falls sie überhaupt abgeschlossen wurden – sollte diese Akte jedes einzelne Blatt Papier enthalten, das den Fall betraf. Dazu gehörten kurze Zusammenfassungen, Zeugenaussagen, Ergebnisse der Obduktion und der toxikologischen Untersuchungen, Berichte der Ballistik, Fotos vom Tatort sowie von der Umgebung und sogar die handgeschriebenen Notizen der ermittelnden Detectives. Natürlich gab es Sicherungssysteme, kriminaltechnische Daten, die in verschiedenen Laboren auf Festplatten gesichert wurden. In der Regel bezogen sich bei einer Mordermittlung aber alle auf die Unterlagen in der Akte.
»Wir haben einen ungelösten Fall«, sagte Westbrook. »Etwa einen Monat alt.«
»Ich soll die Ermittlungen übernehmen?«, fragte Jessica.
Westbrook nickte.
»Gibt es neue Hinweise?«
Wenn in einem neuen Mordfall ermittelt wurde, legten sich alle mächtig ins Zeug, nicht nur die Detectives und die Bosse in der Mordkommission, sondern auch die Kollegen in der Kriminaltechnik und alle Mitarbeiter in den Laboren, die in den Fall involviert waren. Die Auffassung, dass die ersten achtundvierzig Stunden bei einer Mordermittlung von entscheidender Bedeutung waren, war keine Farce. Zeugen litten schon nach kurzer Zeit an Amnesie, die Natur begann die Spuren zu vernichten, Verdächtige suchten das Weite. Die traurige Wahrheit war, dass die Aufklärung eines Verbrechens immer schwieriger wurde, wenn die Ermittler innerhalb der ersten Woche keine verwertbaren Spuren fanden. Nach einem Monat galt ein Fall als ungelöst.
»Es gibt im Grunde keine richtige neue Spur«, sagte Westbrook. »Jedenfalls nichts Handfestes. Nachdem der leitende Ermittler den Tatort besichtigt und den ersten Bericht geschrieben hat, wurde das Haus des Opfers versiegelt.«
Jessica wusste nicht, was Westbrook meinte. Tatorte wurden immer versiegelt. Jedenfalls bis die Ermittler den Tatort wieder freigaben.
»Ich weiß nicht, ob ich Ihnen folgen kann.« Jessica schaute Westbrook fragend an.
»Wenn ich versiegelt sage, meine ich, das Eigentum wurde durch einen Gerichtsbeschluss vom Anwalt des Opfers versiegelt. Offenbar hatte das Opfer nur eine Angehörige, eine entfernte Cousine in New York, mit der er anscheinend nicht besonders gut auskam. Das Opfer starb, ohne ein Testament zu hinterlassen, und das bedeutet, dass die Cousine alles erbt, was das Opfer an Geld und Besitz hinterlassen hat. Am Tag des Mordes arrangierte sie zwischen ihrem Anwalt und dem Ermittler ein Treffen am Tatort. Als sie den Tatort verließen, wurde das Haus versiegelt.«
»Das Opfer wurde also nicht in seinem Haus getötet.«
»Nein«, sagte Westbrook. »Die Leiche wurde in einem Park im Nordosten gefunden.«
»Und warum jetzt?«
»Dem Bezirksstaatsanwalt ist es gelungen, das Siegel von dem Haus des Opfers entfernen zu lassen.« Westbrook gab Jessica einen kleinen Umschlag. »Hier sind die Adresse und der Haustürschlüssel.« Sie hielt die Akte hoch. »Alles andere ist hier drin.« Dana Westbrook legte die Akte auf den Schreibtisch. Normalerweise waren die Akten ein paar Zentimeter dick, aber diese schien nur drei oder vier Dokumente zu enthalten.
»Sieht ziemlich dünn aus, Sergeant«, sagte Jessica.
Westbrook schaute kurz auf den Boden und hob dann sofort wieder den Blick. »Es fehlen ein paar Unterlagen. Im Grunde fehlt das meiste.«
»Ich verstehe nicht. Warum fehlen die Unterlagen?«
Westbrook strich über ihren Pullover. »Das war einer der letzten Fälle von John Garcia.«
Jetzt verstand Jessica es.
4
Der Name des Toten war Robert August Freitag. Am Tag seiner Ermordung war er unverheiratet, kinderlos, eins siebzig groß und wog dreiundachtzig Kilogramm. In fünf Tagen wäre er siebenundfünfzig Jahre alt geworden. Er hatte braunes Haar und braune Augen.
Als Jessica die Akte aufschlug, sah sie als Erstes ein Bild des Opfers. Es ähnelte dem Porträtfoto einer Führungskraft, wie man sie oft in Jahresberichten oder auf Webseiten eines Unternehmens fand. Robert Freitag war ein sympathisch aussehender Mann mittleren Alters, dessen Schläfen allmählich ergrauten. Auf dem Foto trug er ein blaues Sakko, ein weißes Hemd, eine grün-weiß gestreifte Krawatte und eine Pilotenbrille mit Gleitsichtgläsern.
Freitag hatte bei einem Unternehmen namens CycleLife als Logistikmanager gearbeitet. In dem Bericht stand, dass er am 20. Februar 2013 von seinem Haus in der Almond Street in Port Richmond zu einem kleinen Lebensmittelgeschäft auf der Allegheny Avenue gegangen war. Dort hatte er Vollkornbrot, zwei Dosen Süßkartoffeln, ein Paket Duftkerzen und ein Snickers gekauft. Die Überwachungskameras zeigten, dass er das Geschäft um 18.22 Uhr wieder verlassen hatte.
Danach hatte ihn niemand mehr lebend gesehen.
Die Nachbarschaft war mit Sicherheit befragt worden. Die Anwohner und Mitarbeiter in den Geschäften in der Nähe des Hauses des Opfers wurden immer befragt. In der Akte fand Jessica aber keine entsprechenden Protokolle und ebenfalls keinen Obduktionsbericht. Freitags Leichnam hatte man eine Woche nach dem Mord eingeäschert.
In der Akte befanden sich keine Aufnahmen des Tatorts, aber eine kurze Beschreibung. Robert Freitags Leiche wurde am frühen Morgen von einem Jogger entdeckt. Der Tote saß auf einem alten Holzstuhl mitten auf einem Sportplatz im Priory-Park, einem dicht bewaldeten Gebiet im Nordosten Philadelphias, wenige Straßen vom Delaware River entfernt.
Jessica musste die Zusammenfassung zwei Mal lesen. Laut rechtsmedizinischer Untersuchung war der Tod durch den Blutverlust aufgrund eines Schädelbruchs eingetreten.
Tatsächlich hatte jemand ein fünfundzwanzig Zentimeter langes, verrostetes Stück Stahl in Freitags Hinterkopf gerammt.
Ein Kollege aus der Abteilung für Schusswaffen und Ballistik identifizierte die Mordwaffe als einen Schienennagel.
Die Kriminaltechniker sicherten und untersuchten eine Reihe von Schuhabdrücken im Schnee rund um das Mordopfer. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass ein Schuh der Größe 13, was der europäischen Größe 46 entsprach, die Abdrücke hinterlassen hatte. Vermutlich handelte es sich um einen in Europa hergestellten Arbeitsstiefel einer unbekannten Marke. Der Abdruck war in keiner Datenbank aufgeführt. Da in der Schneeschicht keine anderen Spuren gefunden wurden, gingen die Ermittler davon aus, dass der Mörder Robert Freitag in die Mitte des Sportplatzes getragen hatte. Aufgrund von Freitags Gewicht und der Tiefe der Spuren wurde angenommen, dass der Mörder zwischen fünfundachtzig und hundert Kilogramm wiegen musste.
Die Größe des Mörders, seine Nationalität, sein Geschlecht und sein Alter waren unbekannt. Das bedeutete, dass annähernd vierzig Prozent der erwachsenen Bevölkerung Philadelphias zum Kreis der Verdächtigen gehörten.
Jessica schaute auf den großen Briefumschlag, den Dana Westbrook auf ihren Schreibtisch gelegt hatte. Er enthielt eine Videokassette des Tatorts.
Der leitende Ermittler des Falls war ein alter Hase namens John Garcia gewesen. Während der Ermittlungen im Mordfall Robert Freitag war er eines Morgens in der Eingangshalle des Roundhouse zusammengebrochen. Er wurde auf dem schnellsten Wege in ein Krankenhaus gebracht. Die Ärzte diagnostizierten einen Hirntumor und führten eine Notoperation durch.
Die Operation misslang. John Garcia starb auf dem OP-Tisch.
Obwohl sie sich beide nicht als enge Freunde bezeichnet hätten, mochte Jessica John Garcia und hatte im Laufe der Jahre in ein paar Fällen mit ihm zusammengearbeitet.
In den Monaten vor dem Zusammenbruch und der anschließenden Operation war Jessica ebenso wie vielen anderen Kollegen in der Abteilung Garcias zunehmend sonderbares Verhalten aufgefallen, seine unvollständigen Sätze und seine merkwürdigen unlogischen Aussagen. Niemand sagte etwas, und alle schoben es auf Übermüdung.
Später erfuhren sie dann, dass Garcias Verhalten die traurige Folge des Tumors war, der in seinem Schädel wuchs. Seine persönlichen Notizen im Mordfall von Robert Freitag zeigten besonders krass das fehlende logische Vorgehen. Viele Notizen hatte Garcia sich nicht gemacht. In der Akte lagen nur drei zerrissene Blätter. Sie waren alle mit einer Reihe kindlicher Zeichnungen von Blumen, Eisenbahnen, Tieren und Häusern mit Schornsteinen, aus denen spiralförmig Rauch aufstieg, versehen.
Die Ermittlungsakte von Robert Freitag hätte Dutzende von Berichten und Zeugenaussagen enthalten müssen. Stattdessen enthielt sie nur ein paar Blätter mit Kritzeleien. Keine guten Voraussetzungen, um irgendwo ansetzen zu können.
Jessica klappte die Akte zu und legte sie auf den Stuhl neben sich. Während sie aus dem Fenster auf den Parkplatz hinter dem Roundhouse und den unaufhörlichen kalten Regen schaute, ging ihr eine Frage immer wieder durch den Kopf. Und diese Frage lautete: Warum?
In den meisten Mordermittlungen folgte die Frage nach dem Warum auf die Fragen nach dem Wer und dem Wann. Häufig brauchte Jessica nur die ersten Zeilen einer Zusammenfassung zu lesen, und schon wusste sie, warum jemand ermordet worden war. Der zufällige Beobachter wusste nicht, dass die Morde in Philadelphia größtenteils innerhalb eines kleinen Personenkreises verübt wurden – Drogen, Mafia, Prostitution, Gangs. Natürlich gab es hier zahlreiche Überschneidungen. Jessica und fast alle Detectives, die sie kannte – wobei es ein paar unrühmliche Ausnahmen gab –, nahmen jeden Mordfall in ihrem Revier ernst. Wenn jedoch ein ganz normaler Bürger ermordet wurde, rückte das Motiv in den Mittelpunkt.
Im Fall von Robert Freitag lagen auf die Fragen nach dem Wie, dem Wann und dem Wo klare Antworten vor. Er war am 20. Februar 2013 zwischen dreiundzwanzig Uhr und Mitternacht auf einem Sportplatz in einem Park im Nordosten von Philadelphia ermordet worden. Nach den spärlichen vorliegenden Ergebnissen der rechtsmedizinischen und kriminaltechnischen Untersuchungen musste der Mord im Priory-Park verübt worden sein.
In Philadelphia gab es eine Reihe von Parks, in denen Mordopfer häufig abgelegt wurden, nachdem die Mörder sie woanders getötet hatten. Doch offenbar deuteten die Spuren eindeutig darauf hin, dass Freitag in dem Park auch ermordet worden war. Das entsprach nicht der Regel.
Jessica schaute sich das letzte Blatt in der Akte an. Es war ein Ausdruck der Finanzen des toten Mannes. Solange Freitag lebte, schien er ein ziemlich undurchsichtiger Typ gewesen zu sein. Die Ermittlungen nach seinem Tod brachten zumindest in Bezug auf seine finanzielle Situation Klarheit. Seine einzige Angehörige, eine entfernte Cousine aus Forest Hills, New York, eine Frau namens Edna Walsh, war die Erbin seines nicht besonders großen Vermögens.
Außer den Wertgegenständen in seinem Haus besaß Freitag festverzinsliche Wertpapiere im Wert von sechstausend Dollar und ein Tagesgeldkonto mit einem Guthaben von etwa zweitausend Dollar zum Zeitpunkt seiner Ermordung. Er hatte kein Auto und die Hypothek für sein Haus seit drei Jahren abgezahlt.
Jessica spähte auf die Videokassette auf dem Schreibtisch. Sie hatte keine Lust, sich den Film anzusehen, aber sie musste es tun.
Sie nahm die Videokassette in die Hand, durchquerte das große Büro und betrat einen kleinen Raum neben dem Verhörraum A. In dem unordentlichen Raum standen vier Monitore und Videorekorder. Jessica nahm die Kassette aus der Hülle, legte sie ein und drückte auf Play.
Die erste Aufnahme zeigte die Angabe der Zeit und des Datums ebenso wie den Namen des Opfers und den des Tatortes. Ein paar Sekunden später begann der Film. Er war mit einer Handkamera aufgenommen worden, und die Kamera schwenkte zu einer Person, die in der Mitte des Sportplatzes saß, etwa dreißig Meter entfernt. Es handelte sich um das Mordopfer. Der Tote saß auf einem alten Holzstuhl und war mit einer durchsichtigen Plastikplane bedeckt.
Die Kamera näherte sich dem Mordopfer. Auf der Plastikplane lagen vorne zwei dicke Steine, damit sie nicht wegflog. Hinter dem Mordopfer hatte jemand – vermutlich ein Kollege der Kriminaltechnik – zwei dicke Äste wie Pfähle in die Erde gerammt. Als die Kamera genau auf das Opfer gerichtet war, sah Jessica die verschwommenen Farben des Fleisches unter der Plane, das sich rosa, rot und braun verfärbt hatte.
Immer wieder landeten Schneeflocken auf der Linse, und der Fotograf musste den Arm vorstrecken, um sie zu reinigen. Auf einem der Bilder fing die Kamera zwei Kriminaltechniker ein. Die beiden jungen Männer zogen sich ihre Regenjacken des Police Departments eng um ihre Körper, traten mit den Füßen auf den Boden und bliesen auf ihre Hände, obwohl sie Handschuhe trugen. In diesem Augenblick zweifelten sie garantiert sehr konkret an ihrer Berufswahl, nahm Jessica an.
Solche Situationen hatte sie auch schon erlebt.
»Okay«, sagte jemand in dem Film. Es hörte sich nach John Garcia an.
Einer der Kriminaltechniker bückte sich und entfernte die beiden großen Steine, die dafür sorgten, dass die Plastikplane nicht wegflog. Dann nahm er die beiden Ecken in die Hand. Sein Kollege zog die beiden Pfähle hinter dem Opfer aus dem Boden und hielt die beiden anderen Ecken der Plane fest. Sie schauten beide nicht in die Kamera, sondern vermutlich zu dem leitenden Detective. Langsam hoben die beiden Kriminaltechniker die Plastikplane hoch. Sie hielten sie über den Kopf des Mordopfers und bemühten sich, es vor dem Schnee zu schützen. Offenbar hatte jetzt ein Graupelschauer eingesetzt.
Als die Plastikplane das Gesicht des Opfers freigab, sah Jessica den Toten zum ersten Mal. Dieser Anblick würde ihr noch einige Albträume bescheren.
Robert Freitag war zum Zeitpunkt seines Todes sechsundfünfzig Jahre alt gewesen, doch durch einen Blick in sein Gesicht – oder dem, was davon übrig geblieben war – konnte man sein Alter unmöglich bestimmen. Es wies kaum noch menschliche Züge auf. Der Kopf war fast auf das Doppelte seiner normalen Größe angeschwollen. An der Stelle, wo die Nase gewesen war, sah Jessica nur noch unförmiges, dunkelblaues und violettrotes Gewebe. Die beiden Augenlider über den stark geschwollenen, weit geöffneten Augen waren gerissen. Auf den Augäpfeln hatte sich eine dickflüssige grüne Substanz gebildet, die aufgrund der schnell sinkenden Temperaturen allmählich zu gefrieren begann. Der Tote trug ein langärmeliges weißes Hemd, das fast überall von getrocknetem Blut und Fleischfetzen bedeckt war.
Jetzt umkreiste die Kamera den Toten, und Jessica warf zum ersten Mal einen Blick auf die Mordwaffe. Das, was sie darüber gelesen hatte, hörte sich schon entsetzlich an, aber noch schlimmer war der Anblick. Der Schienennagel, der aus dem Kopf des Opfers herausragte, hatte den Schädel des Mannes beinahe in zwei Teile gespalten. Festgefrorene Knochensplitter klebten auf der zerrissenen Kopfhaut. Am Hemdkragen des Toten hingen Fleischfetzen.
Plötzlich war Jessica – vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben – heilfroh, dass sie das Mittagessen hatte ausfallen lassen.
Als die Kamera wieder zur Vorderseite des Opfers schwenkte, sah Jessica etwas, das ihr vorhin nicht aufgefallen war. Da es in dieser trostlosen, winterlichen Umgebung vollkommen fehl am Platze war, wunderte sie sich, dass sie dieses Detail übersehen hatte. Aus den gefalteten Händen des Opfers ragte eine getrocknete Blume heraus. Eine weiße Blume mit einem gelben Blütenstempel in der Mitte. Jessica stoppte die Wiedergabe und überprüfte die Liste der aufgeführten Beweisstücke. Die Kriminaltechniker hatten alle Kleidungsstücke des Opfers, die Mordwaffe und den Stuhl, auf dem Freitag saß, aufgeführt. Eine Blume wurde nicht erwähnt.
Jessica schaute sich die Blume genauer an. Sie war keine besonders große Blumenkennerin. Wenn es um Zimmer- und Gartenpflanzen ging, hatte sie das Gegenteil eines grünen Daumens. Sie brauchte den Pflanzen nur einen bösen Blick zuzuwerfen, und schon gingen sie ein. Daher machte sie sich eine Notiz, sich dieses Bild auszudrucken.
Sie ließ den Film weiterlaufen. Ehe er zu Ende war, schwenkte die Kamera zu der Stelle, wo John Garcia stand. Für den Bruchteil einer Sekunde blickte Garcia genau in die Kamera, und Jessica spürte, wie sich ihr Herz zusammenzog. Vor einem Monat hatte sie ihn noch gesehen, und jetzt gehörte ihm ein Platz in dem Teil ihres Herzens, der verstorbenen Menschen vorbehalten war.
Jessica spulte den Film zurück und spielte ihn noch einmal ab. Als die Kamera wieder auf Johns Gesicht gerichtet war, drückte sie auf Pause.
Im Hintergrund war ein wenig unscharf der Leichnam von Robert August Freitag zu sehen. Im Vordergrund stand der Detective, der die Aufgabe hatte, den Mörder des Mordopfers zu finden. Achtundvierzig Stunden nach der Aufnahme des Films war John Garcia ebenfalls tot.
In den Augen des Mannes spiegelte sich Verwirrung, was auf den heimtückischen Tumor in seinem Kopf zurückzuführen war, doch Jessica sah auch die Güte in seinem Blick. John Garcia war ein überaus sympathischer Mensch gewesen.
Jessica drückte auf die Auswurftaste, zog die Kassette heraus und steckte sie wieder in den Umschlag. Wir kümmern uns um deinen Fall, John, murmelte sie. Ruhe in Frieden, mein Freund.
Jessica kehrte an ihren Schreibtisch zurück und steckte den kleinen Umschlag mit dem Schlüssel ein, den sie brauchte, um Zugang zum Haus des Opfers zu erhalten. Als sie ihren Mantel anzog, lief Dana Westbrook durchs Büro.
»Haben Sie Kevin gesehen, Sergeant?«
Westbrook zeigte in die Richtung, in der ungefähr der Nordosten Philadelphias lag, und sagte: »Er ist schon am Tatort. Er wartet auf Sie.«
»Im Priory-Park?«
Westbrook nickte. »Ja, im Priory-Park.«
5
Detective Kevin Francis Byrne stand im kalten Regen am Rande des Sportplatzes und dachte: Alle Tatorte ähneln sich.
Wenn er in seinen vielen Jahren bei der Mordkommission eine Wahrheit gelernt hatte, dann dass ein Ort, an dem ein Mord geschehen war – ob nun in einem Mietshaus in der Innenstadt, in einer Villa in Chestnut Hill oder auf einer saftigen, grünen Wiese –, nie wieder von Frieden erfüllt sein würde. Ein Wahnsinniger hatte den einst unberührten Ort erobert.
Für Byrne war es mehr als das. In seiner Zeit als Detective hatte er die grauenvollen Folgen der Gewalt kennengelernt, die zerstörten Leben, die Bürde der Verdächtigungen, des Hasses und des Misstrauens. Ein Stadtviertel vergaß so etwas nie mehr.
Schon vor langer Zeit hatte Byrne sich von der Vorstellung verabschiedet, dass ein Fall, soweit es die Familie betraf, jemals hundertprozentig abgeschlossen werden konnte. Für die Polizei, die Gerichte und die Politiker bedeutete das Abschließen eines Mordfalls eine Zahl in der Kriminalstatistik, eine Schlagzeile in der Zeitung, einen Slogan für eine Wahlkampagne. Für die Überlebenden war es ein nie endender Albtraum.
Manchmal vergaß Byrne einfache Dinge. Einmal hatte er über ein Jahr lang vergessen, zwei Anzughemden in der Reinigung abzuholen. Er erinnerte sich hingegen sehr detailliert an jeden Fall, in dem er jemals ermittelt hatte, und an jede persönliche Benachrichtigung der Angehörigen eines Mordopfers. Wenn Byrne durch die Stadt fuhr, wiesen ihn oft ein bestimmtes Gefühl und die Gänsehaut auf den Armen darauf hin, dass er am Tatort eines Mords vorbeikam. Seit mehr als zwanzig Jahren – seitdem er selbst länger als eine Minute für tot erklärt worden und dann ins Leben zurückgekehrt war – hatte er diese Intuitionen, diese vagen Gefühle, die ihn dunkle Pfade hinunterführten.
Als Byrne an diesem Tag am Tatort stand, sah er keine Blumen, keine Kränze, keine Kreuze, keine Erinnerung an das Böse, das hier geschehen war. Der Platz sah sicherlich so aus wie schon vor hundert Jahren.
Es war aber nicht mehr derselbe Ort.
Byrne folgte dem Weg, auf dem Robert Freitag seines Erachtens auf den Platz gelangt sein musste.
Als er die Unterlagen in der Akte gelesen hatte, war ihm als Erstes aufgefallen, dass es keine handgezeichnete Skizze des Tatorts gab. Sogar im Zeitalter von iPads und Nexus-Tablets war es immer noch üblich, eine Bleistiftskizze des Tatorts anzufertigen. Die besonders Ehrgeizigen brachten ihr eigenes Millimeterpapier mit.
Ob John Garcia so kurz vor dem Ende seines Lebens in der Lage gewesen war, eine solche Tatortskizze anzufertigen, wussten sie nicht.
Byrne fragte sich, wie Garcia sich wohl gefühlt haben mochte. Er selbst war zwei Mal von einer Kugel am Kopf getroffen worden. Das erste Mal hatte ihn die Kugel nur gestreift. Beim zweiten Mal war es wesentlich schlimmer gewesen. Nur durch viel Glück waren keine dauerhaften Schäden zurückgeblieben. Allerdings musste er sich nun für den Rest seines Lebens jährlich einer Kernspintomographie unterziehen. Angeblich handelte es sich bei der MRT um eine reine Vorsichtsmaßnahme, jedenfalls nach den Worten seiner Neurologen. Tatsächlich bestand für Kevin Byrne das Risiko einer Vielzahl neurologischer Krankheiten, wozu nicht zuletzt auch Aneurysmen und Hirntumore gehörten.
In vielen Nächten – viel zu vielen, ehrlich gesagt – durchforstete er schlaflos das Internet nach Horrorberichten über Aneurysmen und Tumore, und vor allem nach Anzeichen, die auf eine solche Erkrankung hinweisen könnten. In den ersten Tagen nach diesen Bushmill-getränkten Internetrecherchen war er davon überzeugt, dass er neun der zehn Symptome schon bei sich beobachtet hatte.
In letzter Zeit gab es ein Anzeichen, das sich hartnäckig hielt. Vermutlich hätte er mit seinen Ärzten darüber sprechen sollen, aber ihm fehlte der Mut dazu.
Als Byrne in diesem Augenblick am Rand des gefrorenen Platzes stand, hing ein Geruch in der Luft, und er war sich sicher, dass kein anderer ihn riechen konnte. Einerseits hoffte er, dass es eine vernünftige Erklärung dafür gab, und andererseits hoffte er, dass nicht.
Byrne schloss die Augen und atmete tief ein. Es bestand kein Zweifel. Der Geruch führte ihn in eine Zeit und an einen Ort, den er nicht sehen konnte. Eine Fülle von Empfindungen überschwemmten ihn, und er wusste, dass sie zu Erinnerungen gehörten, die nicht die Seinen waren.
Er glaubte den Geruch von Sackleinen und menschlichen Exkrementen zu riechen und etwas schwächer den von nassem Stroh.
6
Der Priory-Park im Nordosten der Stadt lag zwischen der Frankford Avenue und den Ufern des Delaware River. Das stark bewaldete, fünfundzwanzig Hektar große Gebiet verdankte seinen Namen dem Kloster, das Anfang des achtzehnten Jahrhunderts dort gestanden hatte. Bis auf eine kleine Steinkapelle im Nordwesten waren alle Gebäude längst abgerissen worden. Durch den dichten Wald schlängelte sich ein Nebenarm des Poquessing Creek, der im Delaware River mündete, nur ein paar hundert Meter vom östlichen Rand des Parks entfernt.
Als Jessica in die Chancel Lane einbog, sah sie die einsame Gestalt am südlichen Rand des Parks stehen. Es war zwar erst zwei Wochen her, seitdem sie ihren Partner gesehen hatte, aber es kam ihr irgendwie länger vor. Wenn man so eng zusammenarbeitete wie sie und Byrne, war es beinahe wie in einer Ehe. Zuerst empfand man die Zeit, in der man sich nicht sah, als eine willkommene Atempause. Doch schon nach einer Weile, wenn die Leute ringsherum nicht begriffen, was man sagen wollte, und Dinge nicht so sahen wie man selbst, begann man, den anderen ebenso zu vermissen wie die unkomplizierte Verständigung miteinander. In den letzten zwei Wochen hatte Jessica mehr als einmal etwas gesehen, gehört oder gelesen und spontan den Wunsch verspürt, es ihrem Partner zu erzählen.
Sicher, sie hatte ihren Mann Vincent, doch Vincent Balzano und Kevin Byrne hätten unterschiedlicher nicht sein können, nur dass sie beide zum Grübeln neigten. Ebenso wie ihr Ehemann stellte auch ihr Partner in der Mordkommission eine ideale Ergänzung zu ihrer eigenen Persönlichkeit dar.
In beiden Beziehungen konnte jeder mal ausflippen und auch mal launisch sein, aber nicht zur selben Zeit.
Im vergangenen Jahr war Byrne bei den Ermittlungen in einem Mordfall schwer verletzt worden und lange Zeit nicht arbeitsfähig gewesen. In all seinen Jahren bei der Polizei war er nie zuvor so lange im Job ausgefallen. Viele in der Abteilung waren überzeugt gewesen, dass er in den Ruhestand treten würde. Doch dann tauchte er eines Tages wieder im Roundhouse auf, als wäre nichts geschehen. Und wenig später ermittelte er gemeinsam mit Jessica in einem neuen Fall.
Jessica, die ihn wohl besser kannte als irgendjemand sonst in der Abteilung und vielleicht auf der ganzen Welt, hatte jedoch eine Veränderung bemerkt. Byrne gehörte zwar nicht zu den Detectives, die ständig witzige Bemerkungen machten, aber es kam hin und wieder vor. In den letzten sechs Monaten allerdings schien er noch ernster geworden zu sein. Ernst war vielleicht das falsche Wort. Sie hatte den Eindruck gewonnen, als wäre er ein wenig nachdenklicher als früher.
Als Jessica ihren Partner, der sich gegen den grauen Nebel abhob, am Rand des Sportplatzes stehen sah, wirkte er einsamer als jemals zuvor.
Es regnete unaufhörlich. Wie immer lag Jessicas Schirm – ein großer London Fog Auto Stick, den Vincent, Sophie und Carlos ihr im letzten Jahr zu Weihnachten geschenkt hatten – im Kofferraum. Der große, stabile Stockschirm hielt Regen und Wind stand. Warum sie ihn im Kofferraum aufbewahrte, wusste sie nicht. War es nicht einfacher, einen Regenschirm auf den Rücksitz zu legen?
Als Jessica den Wagen parkte, sah sie, dass Byrne einen dieser kleinen Regenschirme in der Hand hielt, die man sich in der Market Street für fünf Dollar kaufte, wenn man vom Regen überrascht wurde. Er schützte kaum seine breiten Schultern und hielt gerade einmal den Kopf einigermaßen trocken. Eine starke Windbö, und er würde umklappen. Der Wind frischte gerade auf. Jessica nahm ihren Notizblock, steckte ihn in die Manteltasche und drückte drei Mal auf den Stift. Das hatte sie sich vor Jahren angewöhnt, als wäre sie Dorothy und würde weinrote Pumps tragen. Jessica steckte den Stift ein, atmete tief durch und machte sich darauf gefasst, vom Regen augenblicklich bis auf die Haut durchnässt zu werden. Kurz entschlossen öffnete sie die Tür, lief zum Kofferraum, nahm den Schirm heraus und spannte ihn auf.
Sie überquerte die Straße und ging auf Byrne zu.
»Hey, Partner.«
Byrne drehte sich zu ihr um. Die Angst, die Jessica vor seinen gelegentlichen melancholischen Stimmungen hatte, war augenblicklich wie weggeblasen. Seine grünen Augen strahlten wie immer.
»Hey.«
»Soll das ein Schirm sein?«
Byrne lächelte. »Eine Notlösung. Ich freue mich, dass du wieder da bist.«
»Danke.« Jessica zeigte auf den Platz. »Bist schon über den Platz gelaufen?«
Diese Frage hätte sie ihrem Partner gar nicht zu stellen brauchen, denn sie wusste, dass er es getan hatte.
»Ja.« Byrne zeigte auf eine Stelle, die etwa zehn Meter von der Straße entfernt lag. »Dort wurde die Leiche gefunden.«
»Was ist mit der Akte?«, fragte Jessica. »Bist du auf dem Laufenden?«
»Soweit das möglich ist.«
»Konntest du etwas mit Johns Notizen anfangen?«
»Nicht viel.«
John Garcia hatte keinen Partner gehabt, und daher konnten sie niemanden zu dem Fall befragen. Seine seltsamen Kritzeleien würden wohl für immer ein Geheimnis bleiben.
»Und es gibt keine Hinweise, wo die fehlenden Unterlagen sein könnten?«, fragte Byrne.
»Nein. Ich habe in jeder Akte in der Schublade und in den Schubladen darüber und darunter nachgesehen. Aber nichts gefunden.« Jessica bemühte sich, den Schirm so zu halten, dass er sie beide vor dem eisigen Regen schützte. Plötzlich fegte eine Windbö über den Platz und durchnässte sie beide. Sie rückten ein Stück näher zusammen.
»Hast du dir den Film angesehen?«, fragte Jessica.
Byrne schüttelte den Kopf. Er wusste, dass Jessica ihn sich ansehen und ihn informieren würde, wenn es etwas gab, das er wissen musste. Gab es nicht.
»Bevor ich losgefahren bin, habe ich noch ein bisschen rumtelefoniert«, sagte Jessica. »Ich habe um die Sicherungskopien der fehlenden Unterlagen gebeten. Sie sind unterwegs.«
Bei diesen Unterlagen handelte es sich um die rechtsmedizinischen und toxikologischen Berichte ebenso wie um einen detaillierten Bericht der Abteilung für Schusswaffen und Ballistik über die Mordwaffe. Von all diesen Unterlagen existierten natürlich digitale Kopien, aber es würde eine Weile dauern, bis sie die bekamen. Der Mord an Robert Freitag galt inzwischen als ungelöster Fall. In der Stadt der Brüderlichen Liebe hatte es seitdem mehr als dreißig Morde gegeben, und jedes Opfer verdiente die Aufmerksamkeit aller Abteilungen in den ersten kritischen Tagen.
Jessicas Blick wanderte durch den Priory-Park. »Ist es zu spät, um heute noch meine Dienstmarke zurückzugeben?«
Byrne lächelte. »Das kannst du machen, aber ich glaube nicht, dass du eine volle Rückerstattung bekommst. Und dann gibt es da noch die Rücknahmegebühr.«
»Irgendwas ist immer.« Jessica schaute auf die Uhr. Sie war klitschnass und durchgefroren und wollte so schnell wie möglich hier weg. Andererseits wusste sie, dass es für ihren Partner wichtig war, genug Zeit an einem Tatort zu verbringen, und das auch an einem so nasskalten Tag wie heute. »Sollen wir zurückfahren?«, fragte sie dennoch.
»Klar.«
»Fährst du hinter mir her?«
»Nein, ich fahre mit dir. Ich will mich später noch mal hier im Park ein wenig umschauen und nachsehen, ob es von irgendeiner Stelle aus eine freie Sicht auf den Platz gibt.«
Im Westen standen die nächsten Häuser. Obwohl der Blick von diesen Häusern auf den Park durch dichte Bäume versperrt war, konnte es nicht schaden, die Bewohner zu befragen. Vielleicht hatte John Garcia schon mit einigen gesprochen, aber in der Akte befanden sich keine entsprechenden Protokolle. Sie mussten die Anwohner noch einmal befragen. Allerdings lieferten Befragungen in der Nachbarschaft einen Monat nach einem Mord selten nützliche Hinweise.
Die fehlenden Unterlagen und die seltsamen Notizen von John Garcia bedeuteten, dass sie nicht einmal bei Null begannen, sondern weit davor, denn es gab weder eine Leiche noch einen Tatort, die sie untersuchen konnten.
Der Tatort hatte seine Geheimnisse längst preisgegeben.
Zwanzig Minuten später bogen Jessica und Byrne in die Almond Street ein. Vor dem Reihenhaus von Robert Freitag hielten sie an.
Keiner der beiden hatte Lust, aus dem warmen Wagen auszusteigen.
»Ich hab ganz vergessen zu fragen«, sagte Byrne, »wie läuft es an der Uni?«
Jessica schüttelte den Kopf. »Frag mich nicht.«
»So schlimm?«
»Ich bin heute im Unterricht eingeschlafen.«
»Schlafen war meine Hauptbeschäftigung, als ich noch zur Schule ging.«
»Mit erhobener Hand?«
»Nein«, sagte Byrne. »Der Punkt geht an dich. Andererseits habe ich auch nie die Hand gehoben.« Er zeigte auf den Stapel Bücher. »Hat dir jemand angeboten, deine Bücher zu tragen?«
»Ich bitte dich. Ich hab Klamotten, die älter sind als diese Studenten.«
»Jess, du hast einen Pferdeschwanz und siehst keinen Tag älter aus als die anderen.«
Jessica schaltete den Motor aus. »Du bist ein fantastischer Lügner. Hast du jemals überlegt, Jura zu studieren?«
Byrne lächelte. »Und das Showgeschäft aufzugeben?«
Es war ein einstöckiges Haus aus den Zwanzigerjahren mit einer Steinfassade, das dritte Haus hinter der Kreuzung. Vier Sandsteinstufen führten zur Haustür hinauf, die ebenso wie die des Nachbarhauses von einem weißen Vordach geschützt wurde. Die beiden ebenerdigen Kellerfenster waren mit Glasbausteinen verkleidet und die Fenster auf der Vorderseite wie bei den meisten Häusern auf der Straße mit Eisenstäben gesichert.
Jessica öffnete die Fliegengittertür. Die Haustür selbst war mit einem orangefarbenen Aufkleber des Philadelphia Police Departments versiegelt, den John Garcia zwei Tage vor seinem Tod unterschrieben hatte.
Der Aufkleber war unversehrt. Niemand hatte Robert Freitags Haus seither betreten.
Jessica nahm den Briefumschlag aus der Tasche, den Dana Westbrook ihr gegeben hatte, riss ihn auf und ließ den Schlüssel in ihre Hand gleiten. Sie steckte ihn ins Schloss. Als sie die Tür aufschloss, drehte sie sich zu ihrem Partner um. »Du hast also noch keinen neuen Fall?«
Byrne schüttelte den Kopf. »Philly hat sich in der vergangenen Nacht gut benommen.«
»Kaum zu glauben.«
7
Jessica glaubte daran, dass Einsamkeit einen bestimmten Geruch hatte und einem trostlosen, stillen Vakuum glich. Beides deutete darauf hin, dass der Bewohner eines Ortes eine klare Linie zog zwischen dem Haus, in dem er sein einsames Leben lebte, und dem Rest der Welt.