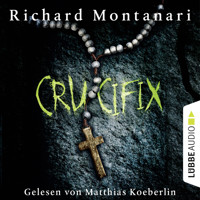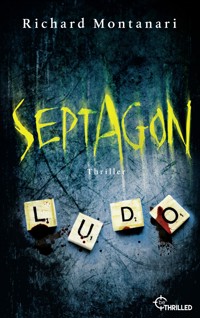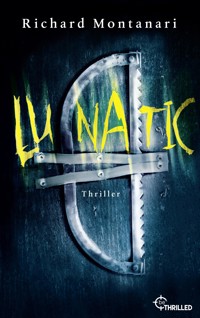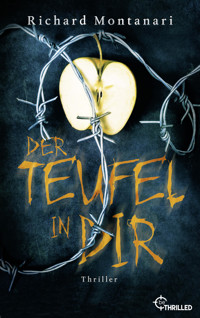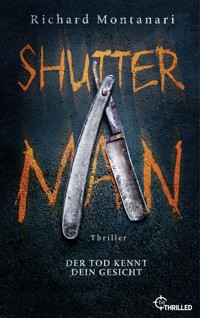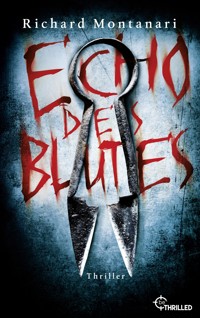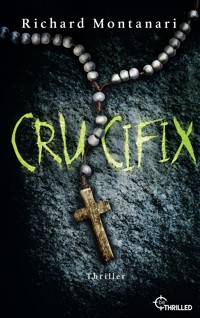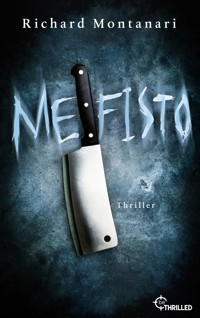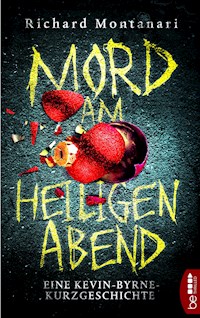3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Spannende Thriller mit Byrne und Balzano
- Sprache: Deutsch
Er ist galant, zuvorkommend, charmant - ein echter Gentleman. Mit einer formvollendeten Einladung zu einem "thé dansant" lockt er Jugendliche zu sich. Doch er will alles andere als tanzen. Er will nur eins: töten.
Kevin Byrne und Jessica Balzano jagen ihn, den Mörder, der bald schon drei Menschenleben auf dem Gewissen hat: ein Mädchen und zwei Zwillingsbrüder. Den Ermittlern bleiben nur mehr sieben Tage, bevor Mr. Marseille erneut zum Tanz bittet ...
Nichts für schwache Nerven! Die spannungsgeladenen Thriller des Bestsellerautors Richard Montanari um das Ermittlerduo Byrne und Balzano:
Band 1: Crucifix
Band 2: Mefisto
Band 3: Lunatic
Band 4: Septagon
Band 5: Echo des Blutes
Band 6: Der Teufel in dir
Band 7: Der Abgrund des Bösen
Band 8: Tanz der Toten
Band 9: Shutter Man
Band 10: Mord am Heiligen Abend
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 575
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Widmung
Zitat
Prolog
ERSTER TEIL: Anabelle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
ZWEITER TEIL: Mr. Marseille
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
Epilog
Danksagungen
Über den Autor
Alle Titel des Autors
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.
Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!
Dein beTHRILLED-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Er ist galant, zuvorkommend, charmant – ein echter Gentleman. Mit einer formvollendeten Einladung zu einem „thé dansant“ lockt er Jugendliche zu sich. Doch er will alles andere als tanzen. Er will nur eins: töten.
Kevin Byrne und Jessica Balzano jagen ihn, den Mörder, der bald schon drei Menschenleben auf dem Gewissen hat: ein Mädchen und zwei Zwillingsbrüder. Den Ermittlern bleiben nur mehr sieben Tage, bevor Mr. Marseille erneut zum Tanz bittet …
Richard Montanari
Tanz der Toten
Aus dem amerikanischen Englisch von Karin Meddekis
Für Mike DriscollGo raibh míle maith agat.
This is the wall of dollsSecret world of smallsLook at them all my friendYou’ll be one of them in the end.
Golden Earring, Wall of Dolls
Er wusste es in dem Augenblick, als sie die Bar betrat.
Es hatte nichts damit zu tun, wie sie gekleidet war. Davon hatte er sich viel öfter täuschen lassen, als er richtiggelegen hatte, und er hatte oft richtiggelegen. Nein, es hatte damit zu tun, wie sie mit den Absätzen auf dem Holzfußboden auftrat, und mit ihrem staksigen Gang. Außerdem sah er ihr an, dass sie schon viel zu viele traurige Loser mit ins Bett genommen hatte.
Tja, als Nutte darf man nicht wählerisch sein.
Frauen wie sie waren ihm in Raleigh, North Carolina, begegnet, in Vancouver und in Santa Fe. Natürlich kannte er nicht diese Frau, aber sie stand für alle Frauen, die er jemals getroffen hatte.
Die Bar war lang und wie ein U geformt. Er saß an einer der kurzen Seiten, lehnte sich mit der rechten Schulter an die Holzvertäfelung der Wand. Auf diese Weise wurde die lange Narbe auf seiner rechten Wange verdeckt. Er war ein Typ, dem so ziemlich alles egal war, aber der Narbe war er sich ständig bewusst. Sie war ein Geburtstagsgeschenk seines Dads. Wenigstens war sie unsichtbar, wenn er die rechte Schulter an die Wand lehnte.
Die Bar war fast leer. Es roch nach verkochtem Fisch und Meister Proper.
Die Frau setzte sich links von ihm an die Theke, ließ aber einen Hocker zwischen ihnen frei. Als sie ihre Handtasche auf den Boden fallen ließ und den Riemen eines ihrer abgetretenen Schuhe um ein Fußgelenk band, dudelte ein Song von Lynyrd Skynyrd aus der Jukebox. Vielleicht waren es auch die Allman Brothers. Mit dem Südstaatenrock der Siebziger kannte er sich nicht so gut aus. In Anbetracht seines Jobs war es seltsam, dass er sich nicht allzu sehr für Musik interessierte, aber er genoss die Stille. Davon gab es heutzutage viel zu wenig.
Offenbar erwartete die Frau, dass er den Barkeeper zu sich winkte und ihr einen Drink spendierte. Als er es nicht tat, rief sie ihn selbst. Der Keeper ließ sich Zeit. Wäre die Frau zehn Jahre jünger oder fünf Jahre hübscher gewesen, hätte der Mann sich vermutlich überschlagen. Als er nun zu ihr geschlurft kam, sagte sie nur: »Ein Seven and Seven.«
Es dauerte ziemlich lange, bis der Keeper zurückkam. Er legte eine Serviette auf den Tresen, stellte den wässrigen Cocktail darauf ab und wartete. Die Frau hob ihre Handtasche auf, fischte einen zerknitterten Zwanziger heraus und klatschte ihn mitten in einen nassen Fleck, den der Keeper nicht weggewischt hatte, weil es ihm völlig egal war.
Der Mann strich den feuchten Geldschein in aller Seelenruhe glatt, ging zur Kasse und kam mit dem Wechselgeld zurück, alles Eindollarscheine, die er in die Pfütze auf der Theke legte.
Arsch.
Der Mann, der am Tresen saß und alles beobachtete, hätte gern Zeit gehabt, sich näher mit dem Barkeeper zu befassen. Auf seine ganz spezielle Weise.
Ohne dass er sie dazu eingeladen hätte, rutschte die Frau zwei Songs später auf den freien Hocker neben ihm und schüttelte die Eiswürfel in ihrem fast leeren Glas.
»Wie heißt du?«, fragte sie ihn.
Er schaute sie an, sah sie jetzt zum ersten Mal richtig. Sie hatte stahlblauen Lidschatten aufgetragen, und ihr Lippenstift war für eine Frau ihres Alters viel zu rot. Er schätzte sie auf fünfundvierzig oder älter. Sie sah aus wie eine Frau, die sich nicht abschminkte, bevor sie schlafen ging, und ihr Gesicht nur wusch, wenn sie gelegentlich duschte. Trotz des dicken Make-ups sah er Aknenarben.
»Jagger«, erwiderte er.
Sie schaute ihn überrascht an. So war es bei allen.
»Jagger? Wie Mick Jagger?«
»Ja.«
Sie lächelte. Das hätte sie nicht tun sollen, denn dieses Lächeln ließ den kläglichen Rest von Attraktivität in ihrem Gesicht zerbröckeln. Stattdessen spiegelten sich nun jeder verkaterte Sonntagmorgen, jedes graue Handtuch und jedes vergilbte Bettlaken darauf.
Aber es war Samstagabend, und sie saßen in einer Bar mit schummrigem Licht, deshalb war es erträglich.
»Hast du auch so viel Geld wie Mick Jagger?«, fragte sie.
»Genug.«
Sie beugte sich näher an ihn heran. Ihr Parfum war zu süß und zu schwer, aber es gefiel ihm.
»Wie viel ist genug?«, fragte sie.
»Genug für die Nacht.«
Ihre Augen strahlten. Jetzt sah sie besser aus. Vielleicht war sie gar nicht so verlebt, auch wenn sie in einer Kaschemme wie dieser hier als Nutte anschaffte.
Er nickte dem Barkeeper zu und legte einen Fünfziger auf die Theke. Dieses Mal beeilte sich der Kerl – Überraschung! Er kam sofort mit neuen Drinks zurück, wischte sogar den Tresen trocken.
Die Frau sagte: »Die Frage ist, ob du die ganze Nacht kannst.«
»Ich muss nicht die ganze Nacht können. Ich muss nur können, bis die Parkuhr abgelaufen ist.«
Sie lachte. Ihr Atem roch nach Zigaretten, Pfefferminz und entzündetem Zahnfleisch.
»Du hast Humor«, sagte sie. »Das gefällt mir.«
Es spielt keine Rolle, was dir gefällt, dachte er. Das spielte seit über zwanzig Jahren keine Rolle.
Sie leerte ihr Glas, tippte mit ihren künstlichen Fingernägeln auf den Tresen und wandte sich ihm wieder zu. »Was hältst du davon, wenn wir eine Flasche kaufen und woanders unseren Spaß haben?«, fragte sie, als wäre sie gerade erst auf die Idee gekommen.
Er musterte sie. »Wir? Willst du dich an den Kosten beteiligen?«
Sie schlug ihm leicht auf die Schulter. »Ach, komm, hör auf.«
»Ich hab eine Flasche in meinem Truck.«
»Ist das jetzt eine Einladung, oder was?«
»Nur wenn du Lust hast.«
»Hört sich gut an.« Als sie vom Hocker rutschte, schwankte sie leicht und hielt sich am Handlauf fest. Offenbar hatte sie schon ein paar Drinks intus. »Ich gehe noch schnell für kleine Mädchen. Lauf nicht weg.«
Als sie mit wiegenden Hüften zum anderen Ende der Bar ging, gönnten die beiden alten Kerle, die dort saßen, ihr kaum einen Blick.
Er trank sein Bier aus, steckte das Geld ein und ließ genau neununddreißig Cent Trinkgeld für den Barkeeper liegen.
Ein paar Minuten später kam die Frau zurück. Sie hatte den Lidschatten und den Lippenstift nachgezogen und Parfum aufgelegt. Außerdem lutschte sie Pfefferminz.
Sie und der Mann traten hinaus in die kalte Nacht.
»Wo steht dein Truck?«, fragte sie.
Er zeigte auf den Fußweg, der sich durch den Wald schlängelte. »Da lang.«
»Du stehst auf dem Rastplatz?«
»Ja.«
Sie schaute auf ihre Schuhe, billige weiße High Heels, mindestens eine Nummer zu klein. »Hoffentlich ist der Weg nicht matschig.«
»Ist er nicht.«
Sie hakte sich bei ihm ein. In der anderen Hand hielt er eine Reisetasche. Sie überquerten den kleinen Parkplatz vor der Bar und verschwanden im Wald.
»Was ist in der Tasche?«, wollte die Frau wissen.
»Mein ganzes Geld.«
Wieder lachte sie.
Auf halbem Weg, weit weg vom Licht, blieb er stehen, öffnete die Tasche und nahm eine Halbliterflasche Southern Comfort heraus.
»Einen für unterwegs?«, fragte er.
»Gute Idee.«
Er schraubte den Verschluss ab und trank einen Schluck.
»Mund auf, Augen zu«, sagte er.
Sie tat es.
»Mach den Mund weiter auf.«
Er betrachtete sie, als sie mit aufgerissenem rotem Mund im trüben Mondlicht stand. Genau so wollte er sie in Erinnerung behalten. So behielt er sie alle in Erinnerung.
Mit einer schwungvollen Bewegung schob er die Rasierklinge in den Mund der Frau und goss ein Drittel der Flasche hinein. Der Whiskey spülte ihr die Klinge in den Rachen. Sie würgte, rang nach Atem, krümmte sich. Dabei rutschte die Klinge nach vorn und zerschnitt ihr Gaumen und Zunge.
Er stand neben ihr, während sie hustete und Blut und Whiskey versprühte. Schließlich spuckte sie die Rasierklinge in ihre Hand und schleuderte sie zu Boden.
Als sie den Blick zu ihm hob, sah er, dass die Klinge ihre Unterlippe durchgeschnitten hatte.
»Was hast du getan?«, kreischte sie. Wegen des tiefen Schnittes in der Unterlippe waren die Worte verzerrt. Dennoch verstand er, was sie sagte. Er verstand es immer.
Er drückte sie gegen einen Baumstamm. Sie sank zu Boden, rang nach Atem, spuckte Blut wie ein Fisch am Angelhaken.
Der Mann umkreiste sie. Heiß strömte das Adrenalin durch seine Adern.
»Was hast du denn gedacht, was wir hier machen?« Er stellte den rechten Fuß auf ihren Bauch und verlagerte sein Gewicht auf das rechte Bein. Wieder schoss ihr ein Schwall Blut aus Mund und Nase. »Hast du gedacht, wir ficken? Dass ich mein Ding in dein entzündetes Maul stecke?«
Er setzte sich rittlings auf ihren Unterleib.
»Das wäre ja so, als würde ich jeden von den Losern vögeln, mit denen du rumgemacht hast.«
Er lehnte sich zurück, um sein Werk zu begutachten. Dann trank er einen Schluck Bourbon, um die Kälte zu vertreiben. Dabei wandte er den Blick für den Bruchteil einer Sekunde von der Frau ab.
Das genügte ihr. Ihre Hand zuckte vor. Sie zog ihm die Rasierklinge übers Gesicht, schlitzte ihm die rechte Wange vom Auge bis zum Kinn auf.
Als Erstes spürte er den Schmerz. Dann Wärme. Dann Kälte. Aus der offenen Wunde stieg der Dampf seines eigenen Blutes in die frostige Luft und trübte seinen Blick.
»Miststück! Dreckige Schlampe!«
Er verpasste ihr eine schallende Ohrfeige. Dann noch eine, und noch eine. Auf ihrem Gesicht klebten Blut und Schleim. Ihr aufgerissener Mund mit der zerschnittenen Unterlippe schien zu grinsen.
Er überlegte, ob er sie mit einem Stein erschlagen sollte. Nein, noch nicht. Sie hatte ihm die Wange aufgeschlitzt, und dafür würde sie bezahlen.
Er trank die Flasche aus, wischte sie ab und schleuderte sie tiefer in den Wald. Dann riss er ihr das Top vom Körper und wischte sich das Gesicht damit ab.
»Das ist ein schlimmer Schnitt an deiner Unterlippe«, sagte er und griff in die Tasche. »Wir müssen sie desinfizieren. Hier gibt’s alle möglichen Bazillen, weißt du. Und du möchtest dir ja keine Entzündung einfangen. Das wäre nicht gut fürs Geschäft.«
Er zog eine große BernzOmatic aus der Tasche. Als die Frau die Lötlampe sah, versuchte sie voller Panik, sich zu befreien, aber ihr fehlte die Kraft. Wieder schlug der Mann ihr ins Gesicht, diesmal so fest, dass sie liegen blieb. Er zündete die Lötlampe mit einem Feuerzeug an und stellte sie ein, bis eine perfekte gelbblaue Flamme brannte.
»Sag mir, dass du mich liebst.«
Sie erwiderte nichts. Sie stand unter Schock.
Er führte die Flamme näher an ihr Gesicht heran.
»Sag es.«
»Ich … liebe dich«, nuschelte sie.
»Natürlich.«
Er fing mit ihrer Lippe an. Die Schreie der sterbenden Frau wurden vom Rauschen der Flamme verschluckt, während der Gestank verbrannten Fleisches in die kalte Luft stieg.
Als er den Gasbrenner an ihre Augen führte, war sie längst still.
Totenstill.
Die Wolken, die vorhin noch den Mond verdeckt hatten, waren verschwunden, als er aus dem Wald kam. Gemächlich ging er die vierhundert Meter bis zum Rastplatz, auf dem sein Lastwagen stand. Die drei Sattelschlepper, neben denen er den Laster am frühen Abend abgestellt hatte, waren verschwunden. An den Parkplatz grenzten eine Tankstelle und ein Schnellrestaurant, das rund um die Uhr geöffnet war.
Ehe der Mann ins Licht der Straßenlaternen trat, betrachtete er seine Kleidung. Die Daunenjacke war voller Blut, die Flecken schimmerten schwarz im Mondlicht. Er zog die Jacke aus, drehte sie auf die andere Seite und zog sie wieder an. Mit einer Handvoll Blätter, die er vom Boden klaubte, wischte er sich das Blut aus dem Gesicht.
Als er kurz darauf die Rückseite des Schnellrestaurants erreichte, sah er eine Frau neben dem Hinterausgang stehen. Sie entdeckte ihn ebenfalls.
Sie war eine der Kellnerinnen aus dem Restaurant. Ihre taubenblaue Dienstkleidung und der weiße Pullover leuchteten im hellen Licht der Laternen. Die Sachen sahen sauber, beinahe steril aus. Die Frau hatte Pause und polierte sich mit einer Sandblattfeile die Nägel.
»Ach du meine Güte«, rief sie.
Er konnte sich gut vorstellen, welchen Eindruck er auf sie machte.
»Hey«, sagte er.
»Ist was passiert?«
»Ich bin da hinten gegen einen Ast gelaufen, den ich im Dunkeln nicht gesehen habe«, antwortete er. »Ich fürchte, ich habe mich schlimm geschnitten.«
Ihm war schwindelig, nicht nur von dem warmen Whiskey und dem faden Bier. Er hatte tatsächlich Blut verloren.
Die Kellnerin warf einen Blick über die Schulter. Sie hatte gesehen, wie er aus dem Wald gekommen war. Schlecht für ihn, aber noch schlechter für sie.
Es war schon ziemlich spät. Obwohl der Mann erschöpft war, wusste er, was er zu tun hatte. Er würde kurzen Prozess mit ihr machen.
Er drehte sich um, ließ den Blick über den Parkplatz und die beschlagenen Fenster des Restaurants schweifen. Niemand beobachtete sie. Zumindest konnte er niemanden sehen.
»Sie haben nicht zufällig ein Pflaster?«, fragte er.
»Warten Sie mal …« Sie zog den Reißverschluss ihrer Handtasche auf und durchwühlte den Inhalt. »Nein, leider nicht. Ich kann Ihnen nur Kleenex anbieten, aber die helfen wahrscheinlich nicht. Sie bluten ganz schön. Sie sollten ins Krankenhaus.« Sie zeigte auf einen blauen Nissan Sentra, der auf dem Parkplatz stand. »Wenn Sie wollen, bringe ich Sie hin.«
Er zeigte mit dem Daumen auf seinen Laster. »Ich hab Verbandszeug in meinem Truck. Kennen Sie sich damit aus?«
Sie lächelte. »Das kriege ich schon hin. Ich habe ein paar jüngere Brüder und Schwestern, die sind immer mit irgendwelchen Schrammen nach Hause gekommen.«
Sie gingen zu dem Lastwagen auf der anderen Seite des Parkplatzes. Mehrmals musste der Mann das Tempo verlangsamen, weil ihm schwindelig wurde. Als sie endlich den Laster erreichten, schloss er die Beifahrertür auf, und die Kellnerin stieg ein.
»Das Verbandszeug liegt im Handschuhfach«, sagte er.
»Okay.«
Er schloss die Tür. Auf dem Weg zur Fahrerseite zog er ein scharfes, fünfzehn Zentimeter langes Buck aus der Messerscheide. Er öffnete die Fahrertür, zog sich hoch und drehte den Spiegel so, dass er sein Gesicht sehen konnte.
Er zuckte zusammen. Die Nutte hatte ihm die ganze Wange aufgeschlitzt.
Während die Kellnerin das Verbandszeug und die in Folie eingeschweißten, mit Alkohol getränkten Tupfer auf das Armaturenbrett legte, drehte er den Spiegel wieder in die ursprüngliche Position und spähte hinaus auf den Parkplatz. Keine anderen Fahrer, und aus dem Restaurant kam niemand.
Okay. Tu es. Jetzt sofort.
Doch ehe er das Messer aus der Scheide zog, sah er irgendetwas auf dem Parkplatz liegen, genau dort, wo der Weg in den Wald führte. Es war eine kleine rote Brieftasche in derselben Farbe und aus demselben Material wie die Handtasche der Kellnerin. »Gehört das Ihnen?«, fragte er.
Die Kellnerin blickte in die Richtung, in die sein Finger wies, legte das Verbandsmaterial aus der Hand und schaute in ihre Handtasche. »Oh, Mist. Ich muss sie verloren haben.«
»Ich hole sie.« Er konnte die Brieftasche aus verschiedenen Gründen nicht liegen lassen.
»Sie sind ein Schatz.«
Der Mann stieg aus und überquerte den Parkplatz. Sein Schädel brummte. Ihm fiel ein, dass er noch ein paar Schmerztabletten hatte. Er griff in die Tasche, zog das Tablettenfläschchen heraus und schluckte zwei Pillen trocken hinunter.
Er erreichte die Brieftasche, hob sie auf. Kurz überlegte er, ob er sie aufklappen sollte, um den Namen der Kellnerin zu erfahren, aber der spielte keine Rolle. Die Namen hatten nie eine Rolle gespielt.
Doch seine Neugier war stärker.
Als er die Brieftasche aufklappte, spürte er heißen Atem im Nacken und sah einen langen Schatten zu seinen Füßen.
Im gleichen Augenblick explodierte sein Schädel. Alles wurde von grellem rotem Licht verschlungen.
Kalt.
Als er die Augen aufschlug, lag er auf dem Rücken. Die Schmerzen im Kopf waren unerträglich. Die Welt roch nach feuchtem Kompost, Lehm und Kiefernnadeln. Schneeflocken wirbelten durch die Luft und blieben an seinen Wimpern haften.
Er versuchte aufzustehen, doch er konnte Arme, Hände und Füße nicht bewegen. Langsam drehte er den Kopf und sah den Leichnam der Prostituierten mit den ausgebrannten Augenhöhlen neben sich liegen. Irgendwelche Tiere hatten bereits an ihrem Gesicht genagt.
»Steh auf.« Die leise Stimme erklang dicht neben seinem linken Ohr.
Irgendwie gelang es ihm, den Kopf zu drehen, aber da war niemand.
»Ich … kann nicht.«
Seine Worte hörten sich an, als hätte jemand anders sie gesprochen.
»Stimmt, das kannst du nicht«, sagte die leise Stimme. »Ich habe dein Rückenmark durchtrennt. Du wirst nie wieder laufen können.«
Der Entsetzensschrei blieb ihm vor Schreck im Hals stecken.
Er ahnte, was ihn erwartete.
Er verlor jedes Zeitgefühl.
Irgendwann dämmerte der Morgen. Er schaute auf den wirbelnden Schnee.
Dann sah er die Axt. Die Stahlklinge leuchtete blutrot im ersten Licht des Tages.
Als die schwere Axt Augenblicke später auf ihn niedersauste, hörte er sie. Sie alle.
Er hatte gewusst, dass er sie an diesem Tag hören würde, jede Einzelne von ihnen.
Sie lockten ihn in die Dunkelheit, die toten Dinge, an einen Ort des Schreckens, an dem sich nichts Menschliches mehr regte.
Ein Ort, an dem sein Vater noch immer auf der Lauer lag.
Eine Hölle, in der die Schreie der Kinder niemals verstummten.
ERSTER TEILAnabelle
1
Wie jeden Tag öffneten Mr. Marseille und ich um kurz nach sechs Uhr, wenn es hell wurde, unsere Schlafaugen mit den dunklen Wimpern.
Jetzt, Mitte November, waren die Fenster noch nicht zugefroren. Das war in unserem Dachgeschoss meistens erst Ende Dezember der Fall. Dennoch waren die Fensterscheiben beschlagen, was dem Licht des frühen Morgens einen eigenartigen Zauber verlieh, als würden wir die Welt durch eine Kristallkugel betrachten.
Ehe wir uns für diesen Tag anzogen, malten wir unsere Namen auf die beschlagene Fensterscheibe. Die doppelten »L« in »Marseille« und »Anabelle« neigten sich einander zu wie winzige dorische Säulen. Es war unser Monogramm, solange wir uns erinnern konnten.
Die Stirn gefurcht, betrachtete Mr. Marseille die Farbmuster. Im Deckenlicht des großen Ladens sahen seine Augen azurblau aus, aber ich wusste, dass sie grün waren, so grün wie das Grün der Bäume, wenn der Frühling ins Land zieht, so grün wie das Gras eines Soldatenfriedhofs am vierten Juli.
An diesem Tag trugen wir unter den tristen Wintermänteln unsere Kleidung für die Teestunde – ich ein leuchtend rotes Kleid, er einen taubengrauen Anzug. Es waren die Farben, die wir jedes Mal trugen, wenn wir unserer liebsten Beschäftigung nachgingen und es in vollen Zügen genossen.
»Ich weiß nicht«, sagte Mr. Marseille. »Ich weiß es einfach nicht.«
Ich schaute auf die große Auswahl und erkannte die schwierige Situation. Es galt, sich zwischen einem halben Dutzend Farben zu entscheiden, die man aus einer Entfernung von einem Meter allesamt als gelb bezeichnen konnte. Ein blasses Gelb, nicht das Gelb der Sonnenblumen oder der Schulbusse oder der Taxis, nicht einmal das matte Gelb von reifem Getreide. Es waren Pastelltöne, die ein wenig ins Weiße hineinspielten. Sie hatten entsetzliche Namen: Buttercreme, Zitronensahne, Marzipan.
Mr. Marseille summte einen Song, unseren Song. Vermutlich ging ihm der Text immer wieder durch den Kopf, während er auf eine Eingebung hoffte.
Ich wurde durch eine Frau mit einem Kleinkind abgelenkt, die ich am Ende unseres Flures vorbeigehen sah. Die Frau trug eine kurze bauschige Jacke und knallenge Jeans. Offenbar hatte sie sich in Eile geschminkt und sich in einem Spiegel betrachtet, der ihr Aussehen nicht richtig wiedergegeben hatte, denn im unerbittlichen Licht des Ladens sah sie beinahe wie ein Clown aus. Das kleine Kind hüpfte hinter ihr her und starrte fasziniert auf ein überdimensionales Plätzchen, in das bunte Bonbons eingebacken waren.
Kurz nachdem die beiden aus meinem Blickfeld verschwunden waren, hörte ich, wie die Frau das Kind ermahnte, es solle sich beeilen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass der kleine Junge ihr gehorchte.
Der Gedanke an Mutter und Kind weckte in mir eine Sehnsucht, die ich nur zu gut kannte. Ich drängte sie rasch zurück und wandte mich wieder Mr. Marseille und seiner Begutachtung zu. Kurz entschlossen zeigte ich auf eines der Farbmuster in seiner Hand und fragte: »Was ist denn daran schlecht? Lichtgelb ist ein wundervoller Name. Das passt doch gut, n’est-ce pas?«
Mr. Marseille hob den Kopf. Sein Blick wanderte zuerst zu dem langen, leeren Gang, dann zu den zahllosen Farbdosen und schließlich zu mir.
»Das ist meine Entscheidung, und ich lasse mich nicht drängen«, sagte er leise, aber entschieden.
Ich hasste es, wenn Mr. Marseille böse auf mich war. Das kam nicht oft vor. Wir waren fast immer einer Meinung und hatten in jeder Hinsicht den gleichen Geschmack – vor allem, was Farben, Stoffe und unser Lied betraf. Wir waren Seelenverwandte. Als ich nun das Funkeln in seinen Augen sah, wusste ich, dass heute wieder einer dieser Tage war, den ich so schnell nicht vergessen würde.
Es war unser erster Tag dieser Art seit dem schrecklichen Augenblick letzte Woche, als meine Wangen so heiß geglüht hatten, dass sie wahrscheinlich leuchtend rot gewesen waren, rot wie das Blut eines jungen Mädchens.
Wir fuhren in unserem Wagen, einer weißen Limousine. Zwar besaßen wir keine Papiere, die uns als rechtmäßige Besitzer auswiesen, aber das spielte keine Rolle, denn nachdem Mr. Marseille vor ungefähr einer Stunde am Straßenrand gehalten hatte und ich eingestiegen war, wurde die Limousine unser Auto, wenn auch nur für kurze Zeit. Wie alle Menschen unseres Schlages war Mr. Marseille ein Experte im Ausleihen.
Mir fiel sofort auf, dass die Vordersitze nach Lakritz rochen, diesem süßen Lakritz. Die andere Sorte mag ich nicht. Sie ist mir zu bitter. Es gibt Leute, die können gar nicht genug davon bekommen. Aber wenn ich eines im Leben gelernt habe, ist es die Einsicht, dass man niemals den Geschmack eines anderen beurteilen oder gar verstehen kann.
Wir fuhren auf dem Benjamin Franklin Parkway, der prachtvoll gestalteten Hauptverkehrsstraße. Ich hatte mal gehört, sie sei nach dem Vorbild der Champs-Élysées in Paris gebaut worden. Gut, ich bin nie in Paris gewesen, habe aber viele Fotos von dieser Stadt gesehen, und es schien zu stimmen.
Genau wie Mr. Marseille sprach ich nur gebrochen Französisch, und manchmal machten wir uns einen Spaß daraus, uns tagelang nur in dieser Sprache zu unterhalten. Oft redeten wir auch darüber, eines Tages von der Stadt der brüderlichen Liebe, wie Philadelphia genannt wird, in die Stadt der Liebe zu fahren.
Die Bäume auf dem Benjamin Franklin Parkway, der sich vom beeindruckenden Museum of Art bis zum Swann Memorial Fountain erstreckte, waren jetzt, im Herbst, schon ziemlich kahl. Aber ich hatte den Parkway natürlich auch im Sommer gesehen, wann es so aussah, als würden die Bäume bis in alle Ewigkeit ihr grünes Laub tragen. Heute, an diesem Novembermorgen, war die Straße wunderschön, aber wenn man im Juli hierherkommt, ist sie atemberaubend.
Wir folgten den Mädchen in diskretem Abstand. Sie hatten eine Filmvorführung im Franklin Institute besucht und stiegen nun in einen Bus, der sie zurück zur Schule bringen sollte.
Um kurz nach zwölf hielt der Bus an der Ecke Sechzehnte und Locust. Ungefähr ein Dutzend Mädchen stiegen aus, alle in Schuluniform. Sie blieben an der Ecke stehen und unterhielten sich lebhaft, wie Mädchen dieses Alters es nun mal tun.
Kurz darauf hielten mehrere Pkws. Einige Mütter hatten sich bereit erklärt, die Mädchen abzuholen. Nachdem sie eingestiegen waren, fuhren die Wagen davon.
Das Mädchen, das unser Gast sein würde, ging mit einer Klassenkameradin die Straße in südlicher Richtung hinunter. Es war groß und schlaksig und trug eine magentarote Strickjacke, so grob wie ein Seemannspullover.
Wir folgten den beiden in unserem Wagen. In einer Gasse parkten wir, stiegen aus, bogen um die Ecke und folgten den Mädchen zu Fuß. In dem Alter trödeln sie gern, das war unser Vorteil. Es dauerte nicht lange, und wir hatten die beiden eingeholt.
Nachdem das große, schlaksige Mädchen sich an der Ecke Sechzehnte und Spruce von der Freundin verabschiedet hatte, stellten Mr. Marseille und ich uns hinter sie und warteten, dass die Ampel auf Grün schaltete.
Das Mädchen schaute zu uns.
»Hallo«, sagte Mr. Marseille.
Der Blick des Mädchens wanderte zwischen ihm und mir hin und her. Die Kleine spürte keine Bedrohung. Vielleicht hielt sie uns für ein Paar, nicht viel älter als sie selbst.
»Hey«, erwiderte sie.
Während wir warteten, dass die Ampel umsprang, knöpfte Mr. Marseille seinen Mantel auf und warf sich in Pose, sodass das perfekt geschnittene Revers seines Jacketts zu sehen war. Der sorgfältig gearbeitete Saum war mit einem Blindstich genäht. Ich muss es wissen, denn ich bin seine Schneiderin.
»Wow«, rief das Mädchen. »Ihr Anzug ist cool.«
Mr. Marseille strahlte. Er war nicht nur extrem anspruchsvoll, er war auch schrecklich eitel und immer um ein Kompliment verlegen.
»Nett, dass du das sagst. Sehr freundlich.«
Sie wusste offenbar nicht, was sie darauf erwidern sollte, denn sie schwieg und schaute auf die Fußgängerampel.
»Ich heiße Marseille«, fuhr er fort. »Das ist Anabelle, mein geliebtes Herz.«
»Ich bin Nicole«, sagte die Kleine.
Wie es seine Art war, beugte Mr. Marseille sich vor und küsste die Finger des Mädchens. Viele glauben, es sei üblich, den Handrücken einer Dame zu küssen, aber das stimmt nicht. Ein Gentleman weiß so etwas.
Nicole errötete.
Als sie mich anschaute, verbeugte ich mich leicht. Eine Dame reicht einer anderen nicht die Hand.
In diesem Augenblick sprang die Ampel um. Mr. Marseille ließ Nicoles Hand los und geleitete sie galant über die Straße.
Ich folgte den beiden.
Schweigend gingen wir die Straße hinunter bis zu der Stelle, wo die Gasse einmündete. Dort hatten wir unseren Wagen geparkt.
Mr. Marseille hob eine Hand, worauf er und ich stehen blieben. »Ich muss dir etwas gestehen«, sagte er zu Nicole.
Das Mädchen, das sich in Gesellschaft zweier ungewöhnlicher und interessanter Leute kein bisschen unwohl zu fühlen schien, blieb ebenfalls stehen. Mr. Marseilles Worte weckten ihre Neugier.
»Ein Geständnis?«, fragte sie.
»Ja. Wir haben uns nicht zufällig getroffen. Wir sind hier, um dich zum Tee einzuladen.«
Nicoles Blick schweifte zu mir, dann zurück zu Mr. Marseille.
»Sie möchten mich zum Tee einladen?«
»Ja.«
»Ich verstehe nicht …«
Mr. Marseille lächelte. Er hatte strahlend weiße Zähne und ein hübsches Lächeln, das dem trügerischen Lächeln einer Frau glich. Mit diesem Lächeln gelang es ihm, fremde Leute bei kleinen Verbrechen zu Komplizen zu machen. Sein Lächeln vermittelte anderen Menschen, jungen wie alten, ein gutes Gefühl. Ich habe noch nie eine Frau gesehen, die seinem Charme widerstehen konnte.
»Wir trinken jeden Tag um vier Uhr Tee«, sagte Mr. Marseille. »An den meisten Tagen ist es keine große Sache, doch ab und zu veranstalten wir eine besondere Teestunde, einen Thé dansant. Dann laden wir unsere Freunde und einen neuen Gast ein. Jemanden, von dem wir hoffen, dass wir ihn bald zu unseren Freundinnen und Freunden zählen können. Was meinst du? Leistest du uns Gesellschaft?«
Nicole sah verwirrt aus. Aber sie war noch immer freundlich, ein Zeichen ihrer guten Erziehung. Und das ist sehr wichtig. Mr. Marseille und ich sind der Meinung, dass Höflichkeit und gutes Benehmen von größter Bedeutung sind, um in der heutigen Welt zurechtzukommen. Wenn wir uns von jemandem verabschiedet haben, bleiben uns vor allem diese Eigenschaften in Erinnerung, wie bei einer teuren Seife der Geruch oder bei exklusiver Kleidung die Qualität des Stoffes.
»Ich glaube, Sie verwechseln mich mit jemandem«, sagte Nicole. »Trotzdem danke.« Sie schaute kurz auf die Uhr, hob den Blick dann wieder zu Mr. Marseille. »Tut mir leid, ich muss noch wahnsinnig viele Hausaufgaben machen.«
Dann ging alles blitzschnell. Mr. Marseille packte Nicoles Handgelenke und zog sie in die Gasse. Wie Sie sehen, hat Mr. Marseille unglaubliche Reflexe. Einmal habe ich beobachtet, wie er eine gemeine Stubenfliege mit der bloßen Hand aus der Luft geschnappt und in einen Topf mit kochendem Wasser geworfen hat, in dem sie ihr Leben aushauchte, während vom Topf silberne Rauchkringel aufstiegen.
Als er jetzt Nicole packte, schaute ich in ihre weit aufgerissenen Augen, die aussahen wie die Schlafaugen einer kostbaren Bru-Puppe. Erst jetzt fiel mir auf, dass die Iris mit winzigen goldenen Punkten übersät war.
Nicole würde eine echte Herausforderung für mich sein.
Schließlich war es meine Aufgabe – und meine große Leidenschaft –, die Augen und andere Körperteile nachzubilden.
Wir saßen an dem kleinen Tisch in unserer Werkstatt, Nicole, Mr. Marseille und ich. Unsere Freunde würden noch kommen. Es gab viel zu tun.
»Möchtest du noch Tee?«, fragte ich Nicole.
Das Mädchen öffnete den Mund, um etwas zu sagen, doch es kam kein Wort über ihre Lippen. Unser Spezialtee hatte nun mal diese Wirkung. Natürlich rührten Mr. Marseille und ich diesen Tee nicht an, aber wir hatten seine magische Wirkung schon oft beobachtet. Nicole hatte bereits zwei Tassen getrunken, und ich konnte nur erahnen, welche Farben sie nun sah: Alice vor der Kaninchenhöhle.
Ich schenkte ihr Tee nach.
»Hier. Du solltest ihn ein bisschen abkühlen lassen, er ist sehr heiß.«
Während ich die letzten Messungen vornahm, entschuldigte Mr. Marseille sich, um alles vorzubereiten, was wir für die Gala brauchten.
Wir waren nie glücklicher als in den Augenblicken, wenn ich mit der Nadel in der Hand die letzten Stiche machte und Mr. Marseille die letzten Vorbereitungen traf.
Wir parkten am Fluss und stiegen aus. Ehe wir unseren Gast zu seinem Platz begleiteten, verband Mr. Marseille mir die Augen. Ich konnte meine Aufregung und mein Entzücken kaum verbergen. Ich liebte diese Teestunde so sehr!
Mr. Marseille ebenfalls.
Mit kleinen Schritten ging ich den Weg hinunter. Als Mr. Marseille mir das Tuch abnahm, schlug ich die Augen auf.
Es war wunderschön. Mehr als wunderschön. Zauberhaft.
Mr. Marseille hatte die richtige Farbe ausgewählt. Manchmal dachte er tagelang über die richtige Farbe nach. Doch nachdem er die Rollen, Abstreifer und Pinsel entsorgt und den Malerkrepp abgezogen hatte, war es jedes Mal so, als hätte das Objekt, in das er so viel Arbeit gesteckt hatte, nie anders ausgesehen.
Kurz darauf halfen wir dem Mädchen – es hieß mit vollem Namen Nicole Solomon – aus dem Wagen. Dass sie an unserem Tisch saß bedeutete, dass sie jetzt an einem anderen Tisch fehlte und womöglich schmerzlich vermisst wurde. Tja, so spielt das Leben.
Als Mr. Marseille die Strümpfe aus der Tasche zog, verabschiedete ich mich. Mir stiegen Tränen in die Augen. Ich musste daran denken, dass Shakespeare unrecht hatte: Eine Trennung bereitet keinen süßen Schmerz. Nur Trauer.
Ich ging auf Mr. Marseille zu, der Handschuhe trug, und drückte ihm etwas in die Hand.
»Ich möchte, dass sie das bekommt«, sagte ich.
Mr. Marseille betrachtete den Gegenstand, den ich ihm gereicht hatte. Er schien überrascht. »Bist du sicher?«
Nein, war ich nicht, denn ich hatte es schon sehr lange und liebte es über alle Maßen. Nun aber hielt ich die Zeit für gekommen, dass der Vogel alleine flog.
»Ja«, sagte ich. »Ich bin sicher.«
Mr. Marseille berührte meine Wange. »Mein geliebtes Herz.«
Während Philadelphia schlief, betrachteten wir im Mondlicht die Umrisse von Nicoles Beinen, die mich an das doppelte »L« in »Anabelle« und »Mr. Marseille« denken ließen. Im Halbdunkel warfen die Beine blasse, parallele Schattenlinien auf die Mauer des Bahnhofs.
2
Sie kommen zurück. Immer.
Wenn es eine Wahrheit gab, die Detective Kevin Francis Byrne kannte – wie alle erfahrenen Polizisten überall auf der Welt –, dann die: Verbrecher kommen immer zurück, um ihre Waffen zu holen. Vor allem die teuren.
Natürlich kam es vor, dass die Umstände eine Rückkehr verhinderten. Der Verbrecher konnte tot sein, was eine zufriedenstellende Erklärung wäre. Oder er war inhaftiert worden, was nicht ganz so zufriedenstellend war, aber gut für die Allgemeinheit.
Natürlich ist es möglich, dass die Polizei das Versteck der Waffe kennt, sodass sie den Ort beobachten kann, bis der Täter auftaucht. Aber nach Kevin Byrnes Erfahrung hatte das noch keinen Verbrecher von der Rückkehr abgehalten, kein einziges Mal.
Es gibt Leute, die alle Polizisten für Trottel halten, denen es bestenfalls gelingt, Verbrecher zu schnappen, die noch dümmer sind als sie selbst. Obwohl diese Argumentation manche Leute überzeugt, entspricht sie nicht der Wahrheit. Kevin Byrne – wie die meisten anderen, die diesen Job eine halbe Ewigkeit machten –, drückte es anders aus: Die Dummen werden zuerst geschnappt.
Es war der zweite Tag, an dem die Gasse rund um die Uhr überwacht wurde. Byrne hatte freiwillig die Nachtschicht übernommen, die von Mitternacht bis acht Uhr morgens dauerte. Wegen seiner vielen Dienstjahre hätte er die Schicht an einen jüngeren Kollegen abgeben können, aber er hatte darauf verzichtet, wofür es zwei Gründe gab: Erstens hatte Byrne sich längst mit seinen Schlafproblemen abgefunden. Er versuchte, sie sich dadurch zu erklären, dass er zu denen gehörte, die nur vier oder fünf Stunden Schlaf brauchen. Zweitens war die Chance größer, dass der Mann, den sie suchten – ein gewisser Allan Wayne Trumbo –, die Waffe mitten in der Nacht holen würde.
Falls es noch einen dritten Grund gab, dann den, dass Byrne diese Sache sehr persönlich nahm. Schließlich ging es um Allan Wayne Trumbo, der wegen zweier bewaffneter Raubüberfälle und Totschlags schon zweimal gesessen hatte. Vor sechs Tagen hatte er einen kleinen Lebensmittelladen an der Ecke Frankford und Girard betreten, hatte dem Verkäufer eine Waffe an den Kopf gedrückt und den Inhalt der Kasse verlangt. Der Mann hinter der Ladentheke gab ihm das Geld. Auf der Überwachungskamera war zu sehen, wie Trumbo daraufhin einen Schritt zurücktrat, die Waffe hob und den Mann hinter der Theke erschoss. Ahmed Al Rashid, der Besitzer von Ahmed’s Grocery, war auf der Stelle tot.
Trumbo, das kriminelle Superhirn, riss sich vor der Überwachungskamera die Skimaske vom Kopf, griff in ein Regal und nahm ein Paket Mini-Donuts heraus. Coconut Crunch, um genau zu sein.
Als er auf den Bürgersteig trat, waren die Streifenwagen aus dem sechsundzwanzigsten Revier bereits unterwegs und nur noch wenige Straßen entfernt. Die Überwachungskamera der Polizei Ecke Marlborough und Girard zeigte, dass Trumbo seine Waffe in einen städtischen Abfallbehälter gleich hinter der Einmündung einer Gasse warf, einen halben Häuserblock von der Marlborough Street entfernt.
Es war zwar nicht Byrnes Fall, aber er kannte Ahmed, das Opfer, denn als junger Schutzpolizist war er Stammkunde in dem Laden gewesen. Byrne kannte keinen Polizisten, der bei Ahmed jemals eine Tasse Kaffee hätte bezahlen müssen. Das volle Glas mit dem Trinkgeld zeugte von seiner Großzügigkeit.
Dieses Geld ließ Trumbo ebenfalls mitgehen.
Die oberste Regel für jeden Detective der Mordkommission lautete, einen Fall niemals persönlich zu nehmen. Im Fall des kaltblütigen Mordes an Ahmed Al Rashid beschloss Byrne, diese Regel – wie schon oft – nicht zu beachten.
Byrne wusste, Trumbo würde zurückkommen, um die Waffe zu holen. Allerdings hatte Byrne nicht damit gerechnet, dass es so lange dauert.
Auf Wunsch des Philadelphia Police Departments, kurz PPD, hatte das Straßenreinigungsamt den Abfallbehälter, in dem sich Trumbos Waffe befand, seit dem Mord nicht angerührt. Seitdem Trumbo abgehauen war, stand dieser Abfallbehälter auf die eine oder andere Weise unter Beobachtung.
Die Ermittler hatten die Audio-Video-Abteilung des PPD gebeten, die beiden Überwachungskameras, die auf dieses Ende des Häuserblocks gerichtet waren, abzumontieren. Zur Mittagszeit rollten drei Polizeitransporter an, doch das Abbauen der Kameras dauerte dreimal so lange wie die Montage. Wenn man die Ermittler beobachtete und auf solche Dinge achtete, hätte man meinen können, Big Brother behielte diese kleine Ecke von Philadelphia momentan nicht im Auge.
Aber nur, wenn man dumm war.
Ungefähr eine Stunde, nachdem Trumbo die Waffe in den Abfallbehälter geworfen hatte, holten Detectives der Ballistik den .38er Colt dort heraus. Einsatzkräfte einer mobilen Einheit, die einen Block entfernt parkten, entfernten den Schlagbolzen und machten die Waffe unbrauchbar. Es war eine Vorsichtsmaßnahme. Falls dieser Einsatz missglückte – wovon allerdings niemand ausging –, sollte auf keinen Fall eine funktionsfähige Waffe wieder auf der Straße und in den Händen eines Täters landen, der damit bereits einen Mord begangen hatte.
Die Forensiker nutzten die Gelegenheit, den Colt auf Fingerabdrücke zu untersuchen. Zufrieden berichteten sie, die Waffe sei mit Trumbos Abdrücken förmlich übersät.
Kevin Byrne schaute auf die Uhr. Zehn nach drei in der Nacht. Sogar dieser Teil der Stadt schlief um diese Zeit. Byrne saß in einem unauffälligen schwarzen Toyota, den er vom Drogendezernat ausgeliehen hatte. Niemand hatte unscheinbarere Autos als die Leute vom Drogendezernat.
Ahmed’s Grocery hatte inzwischen wieder rund um die Uhr geöffnet. Schließlich mussten trotz der schrecklichen Tragödie Rechnungen bezahlt werden. Die Hintertür war jetzt verschlossen, aber Byrne hatte einen Schlüssel, falls er die Toilette benutzen wollte, die sich gleich am Hinterausgang befand.
Es war Viertel nach drei, als er pinkeln musste. Er stieg aus dem Wagen, schloss ihn ab und ging zum Hinterausgang des Ladens. Ein paar Minuten später verließ er ihn auf demselben Weg. Bevor er ins Licht trat, spähte er zum Wagen. Sein iPhone lag noch immer auf dem Armaturenbrett, wo er es hingelegt hatte. Falls Trumbo zurückgekommen war, um seine Waffe aus dem Abfallbehälter zu fischen, würde Byrne es wissen.
Nachdem er einen Blick in die Gasse geworfen hatte, ging er auf den Wagen zu. Kaum hatte er drei Schritte getan, hörte er ein unverkennbares Klicken: Der Hahn eines Revolvers wurde gespannt.
Byrne streckte die Arme zu beiden Seiten aus. Langsam drehte er sich um.
Vor ihm stand Allan Wayne Trumbo und richtete eine Smith & Wesson .22 auf ihn.
»Bist du Cop?«, fragte Trumbo.
Byrne nickte.
»Morddezernat?«
Byrne erwiderte nichts.
Trumbo stellte sich hinter ihn, streckte den Arm aus und zog ihm die Waffe aus dem Holster. Er legte sie auf die Erde und trat mit dem Fuß dagegen, sodass sie bis zur Mauer schlitterte. Dann stellte er sich wieder vor Byrne hin, ungefähr zwei Meter von ihm entfernt. Normalerweise stellte man sich nicht so nahe vor einen Mann wie Byrne. So etwas sieht man höchstens in Filmen und nur, wenn der Held dem Schurken die Waffe aus der Hand schlägt. Aber Byrne war kein Held.
»Ich hab den Alten nicht erschossen«, sagte Trumbo.
»Welchen Alten?«
»Red keinen Stuss, Mann. Ich weiß, warum du hier bist.«
Byrne straffte die Schultern und ließ Trumbo nicht aus den Augen. »Sie sollten darüber nachdenken.«
Trumbos Blick wanderte ziellos durch die menschenleere Gasse und zurück zu Byrne. Es war Straßentheater, und der Mann mit der Waffe spielte wie immer die Hauptrolle. »Was hast du gesagt?«
Byrne starrte auf die Waffe, um zu sehen, ob die Hände des Mannes zitterten, was nie ein gutes Zeichen war. Im Augenblick waren Trumbos Hände ruhig.
»Sie sollten über die nächsten Minuten Ihres Lebens nachdenken, Trumbo.«
»Wieso?«
»Wir wissen, dass Sie in dem Laden waren. Zwei Überwachungskameras haben Sie gefilmt, von vorne und von der Seite. Ich weiß nicht, warum Sie die Maske abgenommen haben, aber das ist Ihre Sache.« Byrne senkte unmerklich die Arme. »Schlimm genug, dass Sie Ahmed getötet haben. Dafür wandern Sie in den Knast. Aber wenn Sie einen Polizisten töten, verspreche ich Ihnen, dass Sie für den Rest Ihres Lebens keine fünfzehn Minuten mehr am Stück schlafen. Denken Sie darüber nach. Ihr Leben beginnt jetzt.«
Trumbos Blick schweifte zu der Waffe in seiner Hand, dann zurück zu Byrne. »Du willst mir sagen, was ich zu tun habe? Vielleicht erwischt es dich ja heute Nacht.«
»Vielleicht.«
Trumbo lächelte. Byrne spürte, wie ihm kalter Schweiß über den Rücken rann. Hatte er zu hoch gepokert?
»Betrachten Sie es als freundschaftlichen Rat«, sagte er zuversichtlich, obwohl er sich ganz und gar nicht so fühlte.
»Was denn? Wir sind jetzt Freunde?«
Byrne erwiderte nichts.
Trumbo wies mit dem Kinn auf den Chevy, der an der Einmündung der Gasse stand. »Ist das deiner?«
Byrne nickte.
»Hübsche Karre«, sagte Trumbo mit einem Grinsen. »Steckt der Schlüssel?«
Byrne schaute auf seine Jackentasche. »Links.«
»Okay. Hol die Schlüssel langsam raus. Mit zwei Fingern. Schön langsam, so wie ich deine Alte ficke.«
Ehe Byrne der Aufforderung nachkommen konnte, drang das helle Lachen einer jungen Frau durch die kalte Nacht. Das Geräusch klang in dieser Situation und zu dieser späten Stunde so sonderbar, dass beide Männer für einen Moment erstarrten. Sie drehten sich um. Ein betrunkenes Pärchen kam Arm in Arm auf sie zu.
Byrne schloss die Augen und wartete auf die drei Schüsse, von denen einer sein Leben beenden würde. Als er nichts hörte, schlug er die Augen wieder auf.
Der Mann, der die Gasse hinunterkam, war in den Dreißigern. Er hatte blondes Haar und einen Fu-Manchu-Schnurrbart – einen dieser Oberlippenbärte, die von den Mundwinkeln bis zum Kinn reichen. Er trug eine verblichene Levi’s und eine kurze Denimjacke. Den rechten Arm hatte er um eine hübsche, dunkeläugige Frau in einer engen schwarzen Jeans gelegt. Sie war ein paar Jahre jünger als er. Als sie Trumbo mit seiner Waffe sah, blieb sie stehen und riss vor Schreck die Augen auf.
»Wow«, sagte Fu Manchu und hob langsam die Hände.
»Was macht ihr hier?«, fragte Trumbo. »Verpisst euch.«
Byrne sah, dass die Frau bereits ihre hohen Schuhe ausgezogen hatte.
Ein paar Sekunden verharrten alle reglos.
»Warten Sie«, sagte die Frau dann. »Haben Sie gesagt, ich kann gehen?«
»Hast du was mit den Ohren? Ich hab gesagt, ihr sollt euch vom Acker machen.«
Die Frau ging ein paar Schritte rückwärts. Dabei ließ sie den Mann mit der Waffe nicht aus den Augen. Dann warf sie sich herum, rannte die Gasse bis zur nächsten Ecke hinunter und verschwand.
Während Trumbo abgelenkt war, bewegte Byrne sich unmerklich ein paar Zentimeter auf seine Waffe zu.
»Du auch«, sagte Trumbo zu Fu Manchu. »Das hier geht dich nichts an.«
Der Mann streckte die Arme zur Seite. »Verstanden, Boss. Kein Problem.«
»Geh deiner Tusse hinterher.«
Plötzlich schaute Fu Manchu Trumbo an, als hätte er ihn schon einmal gesehen. »Hey, dich kenne ich doch.«
»Du kennst mich?«, fragte Trumbo.
Der junge Mann lächelte. »Ja. Wir haben uns im Sommer 2009 getroffen.«
»Ich kenn dich aber nicht.« Die Waffe in Trumbos Hand begann zu zittern. Das war nach Byrnes Erfahrung nie ein gutes Zeichen. Und Erfahrungen in solchen Situationen hatte er so viele gesammelt, dass es für ein ganzes Leben reichte.
»Du bist Mickeys Cousin, stimmt’s?«, fragte Fu Manchu. »Der Cousin von Mickey Costello.«
»Ich weiß, wie mein Cousin heißt, verdammt. Woher kennst du Mickey?«
»Den habe ich kennengelernt, als du und ich uns das erste Mal gesehen haben. Damals haben wir die Autowerkstatt in der Cambria überfallen, weißt du noch? Mickey und ich haben Schmiere gestanden, und du und Bobby Sanzo habt den Transporter gefahren.«
Trumbo wischte sich den Schweiß von der Stirn und nickte. »Ja, stimmt. Du bist …«
»Spider.« Der junge Mann zog den Ärmel seiner Jeansjacke hoch, worauf das kunstvoll gestochene Tattoo einer Spinne in ihrem Netz zum Vorschein kam. Auf dem Handgelenk war eine Fliege, die in dem Netz gefangen war.
»Spider. Ich erinnere mich.« Jetzt schwitzte Trumbo stark. »Bobby ist tot.«
»Hab davon gehört.«
»Er wurde abgestochen, als er in Graterford saß.«
»Nein.« Fu Manchu schüttelte den Kopf. »Er saß in Dannemora. In New York.«
»Ach ja«, sagte Trumbo. »Dannemora.«
Es war ein Test gewesen, und Fu Manchu hatte bestanden.
»Was machst du hier, Bruder?«
Trumbo erklärte ihm kurz die Situation.
Fu Manchu zeigte auf den Abfallbehälter. »Der da?«
»Ja.«
»Warum holst du die Waffe nicht raus? Ich habe das hier.«
»Du hast was?«
Der Mann zog sein Hemd ein Stück hoch. Unter dem Hosenbund steckte eine 9-mm-Halbautomatik.
»Hübsch.«
»Hält den Regen ab.«
Wie in der Szene üblich, stieg Fu Manchus Ansehen ein wenig.
Trumbo wies mit dem Kinn auf Byrne. »Achte darauf, dass er sich keinen Millimeter bewegt.«
»Keinen Millimeter, Bruder.«
Trumbo steckte den Revolver im Rücken unter den Hosenbund seiner Jeans und ging zum Abfallbehälter, neigte ihn zur Seite und wühlte darin. Nach ein paar Sekunden griff er hinein und zog einen schmutzigen braunen Beutel heraus. Er hob ihn hoch, überlegte, ob das Gewicht stimmte, und schaute hinein.
»Ja.«
Ehe Trumbo sich wieder aufgerichtet hatte, ging Fu Manchu auf ihn zu und drückte ihm die Mündung der Glock an den Hinterkopf.
»He, Mann, was soll der Scheiß!«
»Wart’s ab.« Fu Manchu zog zuerst den Revolver unter Trumbos Hosenbund hervor und dann ein Paar Handschellen aus seiner Tasche. »Legen Sie die Hände auf den Rücken.«
Trumbos Blick huschte hin und her. Er hoffte noch immer, dass es ein Scherz war.
Es war keiner.
Kurz darauf kniete er auf dem Boden. Er war unbewaffnet, und Fu Manchu richtete eine Pistole auf seinen Kopf. Trumbo hatte keine Chance. Byrne sah die Resignation in den Augen des Mannes. Allan Wayne Trumbo hatte aufgegeben.
Nachdem Fu Manchu ihm die Handschellen angelegt hatte, griff er in seine Gesäßtasche und zog eine lederne Brieftasche heraus. Er klappte sie auf, hielt sie Trumbo vor die Augen. Der starrte auf den Dienstausweis und las den Namen laut vor.
»Joshua Bontrager?«
»Für Sie, Sir, Detective Joshua Bontrager.«
»Jesses, ein Cop?«
»Ja, ich bin Cop. Unser Herr und Erlöser aber war es nicht.«
Trumbo schwieg. Bontrager zog vorsichtig den falschen Schnurrbart von seiner Oberlippe.
Möglicherweise hatte Trumbo bemerkt, dass jemand die beiden Überwachungskameras abmontiert hatte. Doch ihm war entgangen, dass auf den Dächern der beiden Häuser links und rechts zwei neue Kameras installiert worden waren. Diese waren nun genau auf ihn und die anderen gerichtet. Die Gasse hatte unter Videoüberwachung gestanden, als Byrne vorhin für eine knappe Minute in Ahmed’s Grocery verschwunden war. Ganz in der Nähe hatte Josh Bontrager mit ein paar Kollegen in einem Transporter gesessen und alles beobachtet, um einzuschreiten, falls sie gebraucht wurden.
Und wie ich sie gebraucht habe, dachte Byrne.
Die junge Frau, die Bontrager begleitet hatte – Detective Maria Caruso –, bog mit zwei uniformierten Polizisten aus dem sechsundzwanzigsten Revier um die Ecke.
Sie schaute Bontrager an, der neben dem Verdächtigen stand. Trumbo kniete noch immer auf dem Boden. »Sieh mal einer an. Du knüpfst schon Freundschaften in der großen Stadt.«
Bontrager lächelte. »Wir sind nicht mehr in Berks County, Tante Emmy.«
Maria lachte, und die beiden klatschten sich ab.
Es war gut möglich, dass Allan Wayne Trumbo den Scherz nicht verstand.
Byrne dachte über die Situation nach. Sie hatten die Fingerabdrücke des Tatverdächtigen auf der Waffe, und diese wiederum waren in der Datenbank des FBI. Sie hatten den Verdächtigen geschnappt, der jetzt in einer schäbigen Gasse in Fishtown kniete – im Augenblick genau der richtige Ort für ihn.
In William Penns grüner Stadt war die Welt wieder in Ordnung.
Der echte James »Spider« Dimmock, gegen den ein Haftbefehl vorlag, saß in einer Zelle im Untergeschoss des Roundhouse, dem Verwaltungsgebäude der Polizei an der Ecke Achte und Race. Hätten Dimmock und Bontrager nebeneinander gestanden, hätte man kaum Ähnlichkeiten festgestellt. Doch für die Operation in dieser Nacht reichte es, wobei das Abzieh-Tattoo und der angeklebte Schnurrbart sehr hilfreich gewesen waren.
Zehn Minuten später ging Byrne die Gasse hinunter. Es musste eine Weile her sein, dass er so hundemüde gewesen war. Byrne steuerte auf den Streifenwagen zu, in dem der mit Handschellen gefesselte Allan Wayne Trumbo saß, öffnete die hintere Wagentür und blickte Trumbo in die Augen. Es gab vieles, was er gern gesagt hätte, aber er sagte er nur: »Er hatte fünf Kinder.«
Trumbo schaute ihn verwirrt an. »Wer?«
Byrne hob kurz den Blick zum Himmel, dann starrte er Trumbo fassungslos an. Er hätte den Dreckskerl liebend gern als Zielscheibe für seine Schießübungen benutzt. Zumindest hätte er ihm mit Freuden die Fresse poliert, weil der Mistkerl eine Waffe auf ihn gerichtet hatte, aber damit hätte er alles vermasselt. Stattdessen griff er in die Jackentasche, zog etwas heraus, das er in Ahmed’s Grocery gekauft hatte, und warf es Trumbo auf den Schoß.
Es war ein Paket Mini-Donuts.
Coconut Crunch, um genau zu sein.
Im Großraumbüro der Mordkommission, in dem sich manchmal mehr als fünfzig Personen aufhielten, herrschte oft unglaubliche Hektik. Byrne wunderte sich immer wieder, wie ruhig es dort mitten in der Nacht sein konnte. Die Mordkommission des Philadelphia Police Departments arbeitete in drei Schichten rund um die Uhr.
Um diese Zeit hielten sich hier nur eine Handvoll Detectives auf. Sie saßen an ihren Computern und gingen Hinweisen nach, füllten Formulare aus, schrieben Berichte oder machten sich Notizen für Verhöre am nächsten Tag.
Byrne rief den leitenden Detective im Mordfall Ahmed Al Rashid an und informierte ihn über die Festnahme. Der Mann hatte tief und fest geschlafen, aber wenn ein Detective hörte, dass einer seiner Fälle – und dann auch noch ein brutaler Mord – so gut wie gelöst war und die Akte bald geschlossen werden konnte, war er sofort hellwach. Der Detective, ein alter Hase namens Logan Evans, versprach, sich großzügig am Hochzeitsgeschenk für Byrnes Tochter zu beteiligen.
Byrne musste jetzt erst einmal zur Ruhe kommen. Nichts war beglückender und mehr dazu angetan, die positive Lebenseinstellung zu stärken, als davongekommen zu sein, nachdem man in die Mündung einer Waffe geblickt hatte.
Er zog einen Stapel Zeitungen zu sich heran, überflog die Titelseiten und schaute auf das Datum.
Die Zeitung, die er in der Hand hielt, war sechs Tage alt.
Wird hier eigentlich nie etwas weggeworfen?
Byrne blätterte den Stapel noch einmal durch, fand aber keine aktuellere Zeitung. Schließlich goss er sich Kaffee ein und legte die Füße auf den Tisch.
Es dauerte nicht lange, bis ihm ein kurzer Artikel ins Auge fiel. Es waren nur ein paar Zeilen, die ein Polizeireporter für den Inquirer geschrieben hatte. Überall auf der Welt waren Polizei und Polizeireporter durch eine Art Hassliebe verbunden. Manchmal brauchte man die Reporter, damit sie bestimmte Dinge schrieben. Manchmal aber hätte man ihnen am liebsten den Hals umgedreht, weil sie Informationen preisgaben, die zur Folge hatten, dass ein Verdächtiger sich aus dem Staub machte.
Dieser Artikel jedoch fiel in keine der beiden Kategorien:
ÜBERFÜHRTE KINDESMÖRDERIN WIRD HINGERICHTET
Byrne runzelte die Stirn. Jetzt sollte Valerie Beckert also doch durch die Giftspritze hingerichtet werden?
Er dachte an die zehn Jahre zurückliegende Geschichte. Byrne hatte im Mordfall Thomas Rule alleine ermittelt, weil sein damaliger Partner Jimmy Purify krankgeschrieben war. Wobei von Ermitteln kaum die Rede sein konnte. Es gab nicht viel zu ermitteln.
In einer heißen Augustnacht vor zehn Jahren ging in der Notrufzentrale der Polizei ein Anruf ein. Jemand meldete, dass im Fairmount Park eine Frau dabei beobachtet worden sei, wie sie etwas vergraben hatte. Ein Streifenwagen fuhr sofort zu der angegebenen Stelle. Die beiden Polizisten fanden heraus, dass das »Etwas«, das die damals neunzehnjährige Valerie Beckert vergraben hatte, ein totes Kind war. Ein vierjähriger Junge namens Thomas Rule.
Valerie Beckert wurde festgenommen.
Als Byrne am Tatort eintraf, saß die Frau auf einer Parkbank. Man hatte ihr Handschellen angelegt, und ihre Augen waren trocken. Byrne klärte die Verdächtige über ihre Rechte auf und fragte sie, ob sie etwas zu sagen habe.
»Ich habe ihn umgebracht.« Mehr sagte sie nicht.
Im Verwaltungsgebäude der Polizei, dem Roundhouse, unterschrieb Valerie ihr Geständnis und schilderte detailliert die Tat. Sie hatte den Jungen auf einem Spielplatz in der Nähe seines Wohnhauses entführt und später erdrosselt.
Zu ihrem Motiv äußerte sie sich nicht.
Auch auf die Frage, ob es weitere Opfer gab, gab Valerie Beckert keine Antwort.
Ihr Wagen, ein acht Jahre alter Chevy Kombi, wurde in die Werkstatt der Polizei gebracht und gründlich untersucht. Die Kriminaltechniker fanden zahlreiche verschiedene DNA-Spuren, zu denen auch die von Thomas Rule und Valerie Beckert gehörten. Die anderen konnten niemandem zugeordnet werden.
Die Kriminaltechniker suchten auch in Beckerts Haus in Wynnefield nach Spuren, einer großen Villa im Tudorstil mit sechs Schlafzimmern. Sie fanden nichts.
Falls Valerie weitere Kinder entführt und getötet hatte – und davon war Byrne überzeugt –, hatte sie ihre Opfer entweder nicht in ihrem Haus gefangen gehalten, oder sie hatte sämtliche Spuren sorgfältig beseitigt.
Die Mordkommission und das FBI versuchten durch den Nachweis von Methan festzustellen, ob im Keller des Hauses und im Umkreis von einer Quadratmeile um die Stelle im Fairmount Park, an der Valerie den toten Jungen verscharrt hatte, weitere Leichen vergraben waren. Sie fanden nichts.
Über Valerie Beckert wusste man nicht viel. Sie hatte keine Sozialversicherungsnummer und keine Steuernummer. Es existierten weder eine Geburtsurkunde noch Dokumente über Impfungen oder ihren Schulbesuch. Sie war nie verhaftet worden, und man hatte nie ihre Fingerabdrücke genommen.
Das Haus in Wynnefield war auf Valeries Namen eingetragen. Vorher hatte es einer Josephine Beckert gehört, vermutlich Valeries Tante. Ein Jahr vor Valeries Festnahme war Josephine den Gerichtsakten zufolge bei einem Unfall in ihrem Haus ums Leben gekommen.
Soweit Byrne wusste, stand das Haus in Wynnefield seit zehn Jahren leer. Der weit verbreitete Glaube, das Haus sei eine Art Gruselkabinett, lockte potentielle Käufer nicht gerade an.
Da es bis zu Valerie Beckerts Hinrichtung keine drei Wochen mehr waren, wurde das Haus vermutlich zwangsversteigert, falls es nicht bereits geschehen war, und dann wahrscheinlich abgerissen.
Es war mitten in der Nacht, aber Byrne kannte die stellvertretende Leiterin des Frauengefängnisses in Muncy, Pennsylvania, mit seinen eintausendvierhundert Plätzen.
Valerie Beckert saß in Muncy ein. Sie würde dort bleiben, bis die dritte Phase ihres Todesurteils begann. Dann würde man sie in die Justizvollzugsanstalt Rockview in Pennsylvania verlegen.
Byrne nahm das Telefon, wählte die Nummer und wurde mit Barbara Louise Wagner verbunden, der stellvertretenden Chefin des Frauengefängnisses. Wagner hatte früher beim Philadelphia Police Department als Detective in der Abteilung für Spezialermittlungen gearbeitet, bis sie beschlossen hatte, in den Strafvollzug zu wechseln.
Beide hielten sich nicht lange mit Smalltalk auf. Byrne kam schnell auf den Grund seines Anrufs zu sprechen.
»Du musst mir einen Gefallen tun, Barb.«
»Unter einer Bedingung.«
»Welche?«
»Wir beide fahren nach Wildwood, checken in einem billigen Hotel ein, und dann vögeln wir das ganze Wochenende bis zur Besinnungslosigkeit.«
Barbara Wagner war ungefähr in Byrnes Alter, vielleicht ein paar Jahre älter, und glücklich verheiratet. Sie hatte vier oder fünf erwachsene Kinder und mindestens ebenso viele Enkelkinder. Das hier war ein Spiel, das sie schon ewig spielten. Er ließ sich darauf ein. Das war für ihn jetzt genau das Richtige.
»Hört sich gut an«, sagte er.
»Ich habe noch dieses schwarze Negligé, das ich mir gekauft habe, als wir das erste Mal darüber sprachen.«
»Ich wette, du siehst darin besser aus als je zuvor.«
»Du bist ein Charmeur.«
Byrne lachte. »Das ist eine Begabung.«
»Was kann ich für dich tun, Detective?«
Byrne musste sich konzentrieren. »Ich brauche Informationen über einen Häftling.«
»Name?«
»Valerie Beckert.«
»Ah, unsere Frau der Stunde«, sagte Barbara. »Die Uhr tickt.«
»Ja. Dauert nicht mehr lange.«
»War das dein Fall?«
»Von einem Fall kann man kaum sprechen. Zumindest, was den kleinen Thomas Rule betrifft.«
»Tut mir leid, aber ich bin in der Sache nicht auf dem Laufenden. Klär mich bitte auf.«
Byrne schilderte die Umstände von Valeries Beckerts Verhaftung, erzählte vom Prozess und der Verurteilung und skizzierte die Details von Thomas Rules Ermordung.
»Mein Gott«, sagte Barbara leise.
»Ich bin Katholik, aber ich glaube, Gott muss an dem Tag ziemlich beschäftigt gewesen sein.«
»Was willst du wissen?«
Vor dem Telefonat hatte Byrne sich genau überlegt, was er sagen wollte, aber plötzlich war alles wie weggeblasen. Er musste improvisieren.
»Es gab weitere Opfer, Barb. Ich habe die Frau damals sechs Stunden lang verhört. Sie hat nicht nach einem Anwalt verlangt, und ich habe ihr nicht angeboten, einen Verteidiger hinzuzuziehen. Letztendlich war es auch egal. Ich habe nichts aus ihr herausbekommen.«
Barbara Wagner hörte ihm aufmerksam zu.
»Ich muss wissen, ob sie sich in Muncy jemandem anvertraut hat.«
»Okay«, sagte Barbara. »Aber du weißt, dass ihr nur noch in begrenztem Umfang Kontakte erlaubt sind?«
»Ja, weiß ich. In drei Wochen wird sie zu niemandem mehr Kontakt haben, dann nimmt sie ihre Geheimnisse mit ins Grab. Deshalb muss ich es vorher wissen. Die Familien der Opfer müssen es wissen.«
Byrne war sich bewusst, dass er sein Anliegen mit viel Nachdruck vorbrachte, aber er hatte das Gefühl, so handeln zu müssen.
»Verstehe«, erwiderte Barbara.
»Meinst du, man lässt mich zu ihr?«
»Schwer zu sagen. Wenn es nach mir ginge, wäre es kein Problem.«
»Ich weiß. Danke.«
Wenn der Tag der Hinrichtung eines verurteilten Mörders näher rückte, wurden immer weniger Besucher zugelassen. In den letzten Tagen durften nur noch der Pfarrer, der Anwalt und engste Familienangehörige zum Häftling. Byrne gehörte nicht dazu.
»Ich könnte einen Antrag stellen«, sagte Barbara. »Ihr Anwalt müsste allerdings seine Zustimmung geben.«
»Wie heißt er?«
»Kleinen Moment.«
Byrne hörte, dass Barbara auf der Tastatur tippte.
»Ihr derzeitiger Anwalt ist Brandon Altschuld.«
»Aus Philly?«
»Nein. Ein Pflichtverteidiger aus Allentown.«
Als Valerie damals wegen Mordes vor Gericht stand, war sie von einem ziemlich teuren Anwalt aus einer renommierten Kanzlei in Philadelphia verteidigt worden. Seitdem sich niemand mehr für den Fall interessierte, hatte ein Pflichtverteidiger diese Aufgabe übernommen.
»Ich schaue mal, ob ich etwas herausfinde«, sagte Barbara.
»Danke, Barb.«
»Du weißt, wie du mir danken kannst.«
Byrne lachte. »Ich habe meine Cargoshorts und meine Flip-Flops schon eingepackt.«
Er besaß weder Cargoshorts noch Flip-Flops. Vermutlich wusste Barbara das.
»Flip-Flops brauchst du vielleicht«, sagte sie. »Die Cargoshorts kannst du zu Hause lassen.«
Sie scherzten noch eine Weile, und Barbara Louise Wagner versprach, sich in ein oder zwei Tagen zu melden.
Byrne wandte sich wieder dem Zeitungsartikel zu. Dasselbe Foto war auch damals im Inquirer erschienen, als die Zeitung über Valerie Beckerts Verurteilung berichtet hatte. Auf dem Porträt blickte sie nicht direkt in die Kamera, sondern ein kleines Stück links daran vorbei. Sie sah keineswegs so aus, wie sie ausgesehen haben musste, als sie Thomas Rule ermordet hatte. In den Zeitungen würde sie für immer neunzehn Jahre alt sein.
In den letzten zehn Jahren hatte Byrne oft an die Frau gedacht. In der Zeit ihrer Festnahme hatte er eine Liste von zwölf vermissten Jungen und Mädchen erstellt, die in einem Umkreis von fünf Meilen um Valeries Haus im Nordwesten von Philadelphia wohnten. Diese Liste hatte er in den vergangenen Jahren immer wieder zur Hand genommen und nachgeforscht, ob die Kinder zu ihren Familien zurückgekehrt oder schlimmstenfalls ihre sterblichen Überreste gefunden worden waren.
Die gute Nachricht war, dass sechs der vermissten Kinder inzwischen wieder bei ihren Eltern waren.
Die schlechte Nachricht war, dass sechs Kinder noch immer vermisst wurden.
Byrne zückte seine Brieftasche und faltete die Karteikarte mit den Namen der sechs vermissten Kinder auseinander, wie schon so oft.
Wenn es darum ging, vermisste Kinder zu finden, waren die ersten Tage von entscheidender Bedeutung für die Ermittler. Je mehr Wochen oder gar Monate verstrichen, desto unwahrscheinlicher wurde es, dass die Kinder unversehrt gefunden wurden. Nach Jahren ging im Grunde niemand mehr davon aus.
Byrne dachte darüber nach, seinen Captain zu fragen, ob er einen Antrag beim FBI stellen könne, die Fälle der vermissten Kinder noch einmal aufzurollen. Die Akten waren offiziell nicht geschlossen worden, doch im Laufe der letzten zehn Jahre waren leider Tausende weiterer Fälle vermisster Kinder hinzugekommen.
Das Täterprofil von Kindesentführern zeigte, dass sie es meist auf Kinder eines bestimmten Alters und eines bestimmten Typs abgesehen hatten. Für weibliche Täter, die sehr viel seltener waren, gab es kein solches Profil.