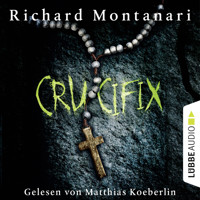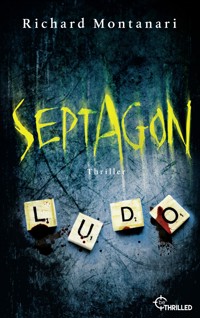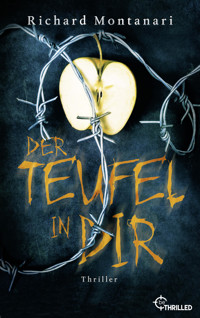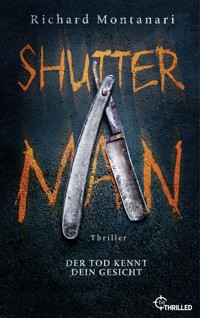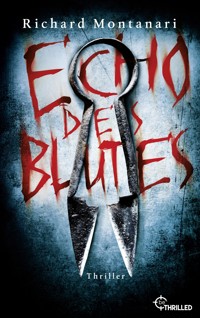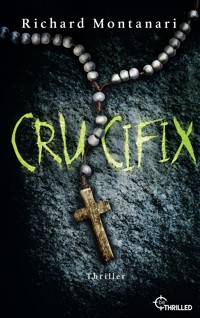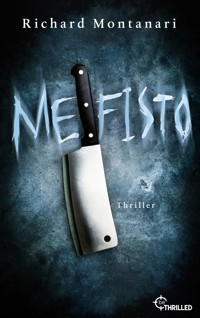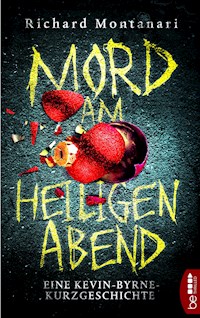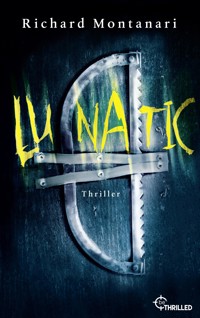
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Spannende Thriller mit Byrne und Balzano
- Sprache: Deutsch
Eine klare Nacht in Philadelphia. Eine schöne junge Frau in einem weißen Kleid sitzt am Ufer des Flusses und starrt mit großen Augen zum Mond. Auf den ersten Blick sieht sie aus wie eine Märchenfee, bedeckt von einer glitzernden Schicht aus Eis. Auf den zweiten Blick sieht man, dass ihre Schuhe fehlen. Und ihre Füße.
Eine Spur von weiteren Leichen führt den Schuykill River hinauf. Verzweifelt versuchen Jessica Balzano und Kevin Byrne, Detectives der Mordkommission, die Zeichen zu deuten, die der Täter hinterlässt. Was hat der Verrückte im Sinn, der im Licht des Vollmonds grausige Märchen inszeniert?
Nichts für schwache Nerven! Die spannungsgeladenen Thriller des Bestsellerautors Richard Montanari um das Ermittlerduo Byrne und Balzano:
Band 1: Crucifix
Band 2: Mefisto
Band 3: Lunatic
Band 4: Septagon
Band 5: Echo des Blutes
Band 6: Der Teufel in dir
Band 7: Der Abgrund des Bösen
Band 8: Tanz der Toten
Band 9: Shutter Man
Band 10: Mord am Heiligen Abend
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 523
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Über den Roman
Widmung
Prolog
Erster Teil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Zweiter Teil
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Dritter Teil
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
Vierter Teil
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
Epilog
Danksagungen
Über den Autor
Alle Titel des Autors bei beTHRILLED
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.
Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!
Dein beTHRILLED-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Eine klare Nacht in Philadelphia. Eine schöne junge Frau in einem weißen Kleid sitzt am Ufer des Flusses und starrt mit großen Augen zum Mond. Auf den ersten Blick sieht sie aus wie eine Märchenfee, bedeckt von einer glitzernden Schicht aus Eis. Auf den zweiten Blick sieht man, dass ihre Schuhe fehlen. Und ihre Füße.
Eine Spur von weiteren Leichen führt den Schuykill River hinauf. Verzweifelt versuchen Jessica Balzano und Kevin Byrne, Detectives der Mordkommission, die Zeichen zu deuten, die der Täter hinterlässt. Was hat der Verrückte im Sinn, der im Licht des Vollmonds grausige Märchen inszeniert?
Richard Montanari
LUNATIC
Aus dem amerikanischen Englischvon Karin Meddekis
Lunatic ist ein Roman. Namen, Personen, Ereignisse und Schauplätze der Handlung sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Geschehnissen, Orten sowie lebenden oder verstorbenen Personen ist rein zufällig.
Für Ajani
Anchi konjo nesh
Prolog
August 2001
In seinen Träumen leben sie noch. In seinen Träumen sind sie zu hübschen jungen Frauen herangereift, die Familien haben, Berufe, eigene Wohnungen. In seinen Träumen sind sie leuchtende Wesen unter einer goldenen Sonne.
Detective Walter Brigham schlug die Augen auf. Sein Herz fühlte sich wie ein harter, kalter Stein an. Er schaute auf die Uhr, obwohl es gar nicht nötig gewesen wäre. Er wusste, wie spät es war: 3.50 Uhr. Genau die Zeit, als er vor sechs Jahren den Anruf bekommen hatte, der die Trennungslinie zwischen jedem Tag davor und jedem Tag danach markierte.
Wenige Sekunden zuvor hatte er in seinem Traum am Waldrand gestanden, und der Frühlingsregen hing wie ein eisiger Schleier über seiner Welt. Jetzt lag er in seinem Schlafzimmer in West-Philadelphia wach im Bett. Er war schweißüberströmt. In der Stille war nur der regelmäßige Atem seiner Frau zu hören.
Walt Brigham hatte in seinen Dienstjahren viel gesehen. Einmal hatte er erlebt, wie der Angeklagte in einem Drogenprozess im Gerichtssaal versucht hatte, sein eigenes Fleisch zu essen. Ein anderes Mal hatte er den halb verwesten Leichnam einer Bestie in Menschengestalt gefunden – Joseph Barber, ein Pädophiler, Vergewaltiger und Mörder. Der Tote war in einem Wohnhaus in Nord-Philadelphia an ein Dampfrohr gebunden, dreizehn Messerstiche in der Brust. Ein anderes Mal hatte Walt Brigham einen Detective der Mordkommission gesehen, der in Brewerytown auf dem Bordstein gesessen hatte, lautlos weinend, einen blutverschmierten Babyschuh in der Hand. Der Mann war John Longo, Brighams Partner, ein narbiger Veteran in seinem Job. Es war Johnny Longos Fall gewesen, und Johnny hatte versagt.
Jeder Cop hatte solch einen ungelösten Fall, ein Verbrechen, das ihn von früh bis spät und bis in seine Träume hinein verfolgte. Wenn ein Detective nicht dem Alkohol verfiel, nicht an Krebs erkrankte oder von einer Kugel getroffen wurde, bescherte Gott ihm einen ungelösten Fall.
Für Walt Brigham begann dieser Fall im April 1995, an dem Tag, als zwei kleine Mädchen den Wald im Fairmount Park betraten und nie wieder herauskamen – das schlimmste Horrorszenario, das Eltern in ihren Albträumen quälen konnte.
Als Brigham die Augen schloss, stieg ihm der Geruch von feuchtem Lehm, Kompost und nassem Laub in die Nase. Annemarie und Charlotte trugen hübsche weiße Kleider. Beide waren neun Jahre alt.
Die Mordkommission hatte Hunderte von Personen vernommen, die an jenem Tag in dem Park gewesen waren, und die Beamten hatten zwanzig Säcke Müll in der Umgegend gesammelt und durchsucht. Brigham hatte ganz in der Nähe eine Seite gefunden, die aus einem Kinderbuch herausgerissen war. Seit diesem Augenblick ging der Vers ihm unaufhörlich durch den Kopf:
Kleine Mädchen, hübsch und fein,
tanzen einen Ringelreih’n.
Wie zwei Kreisel, summ, summ, summ,
dreh’n sie sich im Kreis herum.
Brigham starrte an die Decke. Er küsste seine Frau auf die Schulter, richtete sich auf und schaute durch das offene Fenster. Die Stadt war in Dunkelheit getaucht. Hinter dem Stahl, Glas und Beton sah er im Mondschein die dichten Baumkronen des Kiefernwaldes, durch den sich ein Schatten bewegte.
Hinter dem Schatten – ein Killer.
Eines Tages würde Walter Brigham diesem Killer gegenüberstehen.
Eines Tages.
Vielleicht schon heute.
Erster TeilIm Wald
1.
Dezember 2006
Er ist Moon, und er glaubt an Zauberei.
Nicht an die Zauberei, wie sie auf der Bühne gezeigt wird, mit Falltüren und doppelten Böden und Taschenspielertricks. Auch nicht an die gefährlichen und trügerischen Illusionen, wie sie durch Drogen entstehen. Nein, Moon glaubt an die Magie, die Bohnenstängel bis in den Himmel wachsen lässt, die aus Stroh Gold spinnt und einen Kürbis in eine Kutsche verwandelt.
Moon mag die hübsche junge Frau, die so gerne tanzt.
Er hatte sie lange Zeit beobachtet. Sie ist Anfang zwanzig, schlank und größer als ihre Altersgenossinnen. Sehr hübsch. Ihre Bewegungen sind voller Anmut.
Bestimmt weiß sie ebenso wie er, dass allen Dingen ein Zauber innewohnt, eine unsichtbare Eleganz – die makellose Schönheit eines Blütenblattes, die wundervolle Symmetrie eines Schmetterlingsflügels, die perfekte Geometrie des Himmels.
Am Tag zuvor hatte Moon gegenüber vom Waschsalon in der Dunkelheit gestanden und beobachtet, wie die junge Frau Wäsche in den Trockner stopfte. Moon hatte gestaunt, wie graziös sie sich dabei bewegte. Es war ein klarer, aber bitterkalter Abend gewesen, der Himmel ein konturloses schwarzes Gemälde über der Stadt.
Moon hatte die junge Frau beobachtet, wie sie dann mit der Wäschetasche über der Schulter durch die beschlagene Glastür aus dem Waschsalon hinaus auf den Bürgersteig getreten war. Sie überquerte die Straße, ging zur Bushaltestelle, blieb stehen und trat mit den Füßen auf, weil es so eisig kalt war. Niemals war sie hübscher gewesen. Als sie sich zu ihm umgedreht hatte, da hatte sie es gewusst, und Moon hatte seine Zauberkraft spüren können.
Als Moon jetzt am Ufer des Schuylkill River steht, spürt er diese Kraft erneut.
Er schaut auf das dunkle Wasser. Philadelphia ist eine Stadt mit zwei Flüssen, und in beiden schlägt dasselbe Herz: Der Delaware River ist muskulös, breitschultrig, zuverlässig. Der Schuylkill ist listig, verschlagen und tückisch. Er ist der verborgene Fluss. Sein Fluss.
Genauso wie die Stadt hat auch Moon viele Gesichter. In den nächsten zwei Wochen jedoch wird er unsichtbar bleiben, weil es nicht anders geht. In den nächsten zwei Wochen wird er mit der Umgebung verschmelzen – einer von unzähligen trüben Flecken auf einem tristen grauen Wintergemälde.
Moon legt das tote Mädchen vorsichtig ans Ufer des Schuylkill. Er küsst ein letztes Mal ihre kalten Lippen. Auch wenn sie noch so hübsch ist – sie ist nicht seine Prinzessin.
Er wird seine Prinzessin bald treffen.
Weil das Märchen nun mal so geht.
Er ist Moon. Und seine Prinzessin heißt Karen.
2.
Die Stadt hat sich verändert. Er war zwar nur eine Woche fort gewesen und hatte keine Wunder erwartet, doch nach mehr als zwanzig Jahren bei der Polizei in einer Stadt wie dieser, einer Stadt mit einer der höchsten Verbrechensraten des Landes, blieb immer noch die Hoffnung auf Besserung. Auf dem Weg in die Stadt hatte er zwei Unfälle und drei Schlägereien vor drei verschiedenen Kneipen gesehen. Gar nicht zu denken daran, was hinter manchen verschlossenen Türen vor sich ging.
Aaah, Urlaubszeit in Philly. Das wärmt einem das Herz.
Detective Kevin Francis Byrne saß am Tresen des Crystal Diner, eines kleinen, sauberen Coffee Shops in der Achtzehnten Straße. Seitdem das Silk City Diner geschlossen hatte, ging er spät abends am liebsten ins Crystal Diner. Aus den Lautsprecher erklang Silver Bells. Die bunten Lichter in den Straßen kündeten von Weihnachten, dem Fest der Liebe.
Friede, Freude, Eierkuchen.
Kevin Byrne brauchte etwas zu essen, eine heiße Dusche und Schlaf. Morgen früh um acht Uhr begann sein Dienst.
Auch Gretchen war da. Sie drehte Byrnes Tasse um und goss ihm Kaffee ein. Gretchen Wilde kochte vielleicht nicht den besten Kaffee in der Stadt, aber niemand sah besser aus, wenn er ihn eingoss. Ihr Parfum turnte unglaublich an, und ihre dunkelroten Lippen waren sexy. Gretchen war jetzt Mitte dreißig und viel attraktiver geworden, als sie es früher gewesen war, nachdem ihre jugendliche Schönheit fraulichere, weichere Züge angenommen hatte.
»Lange nicht gesehen«, sagte sie.
»Bin heute erst zurückgekommen«, erwiderte Byrne. »Ich hab eine Woche Urlaub in den Poconos gemacht.«
»War sicher schön.«
»Ja«, sagte Byrne. »Nur dass ich in den ersten drei Tagen nicht schlafen konnte. Es war so verdammt ruhig.«
Gretchen schüttelte den Kopf. »Städter.«
»Städter? Ich?« Byrne betrachtete sich auf der dunklen Fensterscheibe: Sieben-Tage-Bart, LL-Bean-Jackett, Flanellhemd, Timberland-Stiefel. »Ich dachte, ich sehe aus wie Lederstrumpf.«
»Du siehst aus wie ein Städter, der einen auf Lederstrumpf macht«, sagte Gretchen.
»Wie geht es Brittany?«, fragte Byrne.
Gretchens Tochter Brittany war fünfzehn, sah aber aus wie fünfundzwanzig. Vor einem Jahr war sie bei einer Razzia auf einer Party mit so viel Ecstasy erwischt worden, dass es für eine Klage wegen Drogenhandels gereicht hatte. In jener Nacht hatte Gretchen in ihrer Verzweiflung Byrne angerufen, worauf Byrne sich an einen Kollegen gewandt hatte, der ihm einen Gefallen schuldete. Als der Fall dann vor Gericht kam, lautete die Anklage nur noch auf einfachen Drogenbesitz, und Brittany wurde zu sozialem Dienst verdonnert.
»Ich glaube, es geht ihr gut«, sagte Gretchen. »In der Schule läuft es besser, und sie kommt auch nicht mehr mitten in der Nacht nach Hause. Jedenfalls unter der Woche.«
Gretchen war zweimal verheiratet gewesen, und sie war zweimal geschieden. Ihre beiden Ex-Männer waren gewalttätige Loser, denen die Drogen den Verstand geraubt hatten. Doch allen Widrigkeiten zum Trotz hatte Gretchen sich nicht unterkriegen lassen. Kevin Byrne bewunderte allein erziehende Mütter. Es war unbestritten der härteste Job auf Erden.
»Und wie geht es Colleen?«, fragte Gretchen.
Byrnes Tochter war das Licht seines Lebens. »Sie ist toll. Einfach toll. Jeden Tag eine neue Welt.«
»Das kenne ich.« Gretchen lächelte.
»Ich hab mich eine Woche lang von zweitklassigen Sandwiches ernährt«, sagte Byrne. »Was habt ihr an warmen, süßen Sachen zu bieten?«
»Anwesende ausgeschlossen?«
»Niemals.«
Gretchen lachte. »Ich gehe mal gucken, was wir haben.«
Sie verschwand in der Küche. Byrne schaute ihr nach. In ihrer engen pinkfarbenen Trikot-Uniform sah sie schnuckelig aus.
Byrne warf einen Blick auf die Uhr, eine große Multifunktions-Armbanduhr, auf der man alles Mögliche ablesen konnte, nach einigem Suchen sogar die Zeit. Die Uhr war ein Geschenk von Victoria.
Er kannte Victoria Lindstrom seit mehr als fünfzehn Jahren, seitdem sie sich bei einer Razzia der Sitte in einem Massagesalon, Victorias damaliger Arbeitsstätte, zum ersten Mal gesehen hatten. Damals war sie ein unsicheres, bildhübsches Mädchen von siebzehn Jahren gewesen, das kurz zuvor aus Meadville, Pennsylvania, in die Stadt gekommen war. Später hatte Victoria sich ein neues Leben aufgebaut – bis sie von einem Mann angegriffen worden war, der ihr Gesicht mit einem Cuttermesser brutal zerschnitten hatte. Es waren zahlreiche schmerzhafte Operationen erforderlich gewesen, um die Funktionen von Muskeln und Nervengewebe wiederherzustellen. Die Verletzung ihrer Seele war durch keine Operation zu heilen.
Sie waren einander erst kürzlich wieder begegnet. Victoria hielt sich zurzeit bei ihrer kränklichen Mutter in Meadville auf. Byrne hatte sich vorgenommen, sie anzurufen. Er vermisste sie.
Er rührte seinen Kaffee um und dachte an den morgigen Dienstbeginn. Er fragte sich, mit welchen neuen Fällen die Abteilung es wohl zu tun hatte, welche Fortschritte es in den laufenden Ermittlungen gab und welche Verhaftungen vorgenommen worden waren, falls überhaupt. Im Grunde hatte Byrne während des ganzen Urlaubs an seinen Job gedacht – einer der Gründe, weshalb er sein Handy nicht mitgenommen hatte: Er hätte mindestens zweimal täglich die Kollegen angerufen.
Byrne nippte von seinem Kaffee und ließ den Blick durch das Lokal schweifen. Nur eine Hand voll Gäste waren da: Ein Paar mittleren Alters, das in einer Nische saß. Zwei junge Frauen, die mit ihren Handys telefonierten. Ein Mann in der Nähe der Tür, der Zeitung las …
Es traf Byrne wie ein Schlag.
Er kannte den Mann. Er hieß Anton Krotz. Ein paar Jahre gealtert, seitdem Byrne ihn das letzte Mal gesehen hatte, ein paar Pfund zugenommen, ein wenig muskulöser. Doch es gab nicht den geringsten Zweifel, dass es Krotz war. Byrne erkannte das kunstvolle Skarabäus-Tattoo auf der rechten Hand des Mannes. Er erkannte die verrückten Hundeaugen.
Anton Krotz war ein kaltblütiger Killer. Sein erster aktenkundiger Mord war das Ergebnis eines stümperhaften Raubüberfalls auf ein kleines Kaufhaus in South Philly gewesen. Für eine Beute von siebenunddreißig Dollar hatte er die Kassiererin aus nächster Nähe erschossen. Er wurde zum Verhör aufs Revier gebracht, doch sie mussten ihn wieder laufen lassen. Zwei Tage später raubte er ein Juweliergeschäft in Center City aus. Die Erschießung der Inhaber, eines Mannes und einer Frau, glich einer regelrechten Hinrichtung. Die Überwachungskamera hatte die Morde aufgenommen – und den Täter. Ein riesiges Polizeiaufgebot legte die Stadt an jenem Tag beinahe lahm, aber Krotz gelang es irgendwie, durch die Maschen zu schlüpfen.
Als Gretchen nun mit einem großen Holländischen Apfelkuchen aus der Küche zurückkehrte, griff Byrne langsam nach seinem Dufflecoat auf dem Nachbarhocker, zog bedächtig den Reißverschluss auf und beobachtete Krotz aus dem Augenwinkel. Langsam zog er seine Waffe und legte sie sich auf den Schoß. Er hatte kein Handy dabei, kein Funkgerät; im Augenblick war er ganz auf sich allein gestellt. Und einen Mann wie Anton Krotz nahm niemand gerne allein hoch.
»Hast du hinten im Lokal ein Telefon, Gretchen?«, fragte Byrne leise.
Gretchen, die gerade den Apfelkuchen in Stücke schnitt, hob den Blick. »Ja, sicher. Im Büro.«
Byrne nahm seinen Kugelschreiber und schrieb auf ihren Block:
Ruf 911 an. Sag, dass ich hier Unterstützung brauche. Der Verdächtige heisst Anton Krotz. Sie sollen das Sondereinsatzkommando schicken. Hintereingang. Wenn du das gelesen hast, lache.
Gretchen las die Notiz durch und lachte.
»Der ist gut«, sagte sie.
»Ich wusste, dass er dir gefällt.«
Sie schaute Byrne in die Augen. »Ich hab die Schlagsahne vergessen«, sagte sie laut genug, aber nicht zu laut. »Bin gleich wieder da.«
Gretchen ging in die Küche, ohne Eile an den Tag zu legen. Byrne trank noch einen Schluck Kaffee.
Krotz hatte sich nicht von der Stelle gerührt. Byrne wusste nicht, ob der Mann ihn erkannt hatte oder nicht. Er hatte Krotz damals vier Stunden lang verhört, und dabei war viel böses Blut geflossen. Es war sogar zu körperlicher Gewalt gekommen. Nach einer solchen Begegnung vergaß keiner der Beteiligten den anderen so schnell.
Byrne durfte nicht zulassen, dass Krotz verschwand. Wenn er den Coffee Shop verließ, würde er untertauchen in der Anonymität der Stadt, und vielleicht würde sich eine solche Gelegenheit dann nie wieder bieten.
Als Byrne dreißig Sekunden später den Blick nach rechts wandte, sah er Gretchen in der Küchentür stehen. Er konnte an ihrer Miene erkennen, dass sie den Anruf getätigt hatte. Byrne ergriff die Pistole und legte den Arm hinter den Rücken, sodass Krotz die Waffe nicht sehen konnte.
In diesem Augenblick rief eine der beiden jungen Frauen: »Was!«
Erschrocken fuhr Byrne auf seinem Hocker herum und schaute zu ihr hinüber. Die Frau telefonierte noch immer über ihr Handy und hatte offenbar auf irgendeine sensationelle Nachricht aus dem Freundeskreis reagiert.
Als Byrnes Blick zurück zu Krotz wanderte, saß der nicht mehr auf seinem Platz.
Er hatte eine Geisel.
Die Geisel war die Frau aus der Nische hinter Krotz’ Platz. Krotz stand hinter der Frau, hatte ihr einen Arm um die Taille geschlungen und drückte ihr die Spitze eines Springmessers an den Hals. Die Frau war um die vierzig, zierlich und hübsch. Sie trug einen blauen Pullover, Jeans und Wildlederstiefel. An ihrem Finger steckte ein Ehering. Ihr Gesicht war verzerrt vor Todesangst und maßlosem Entsetzen.
Der Mann, mit dem sie in der Nische gesessen hatte, saß noch auf seinem Platz, wie erstarrt. Irgendwo im Lokal fiel eine Tasse zu Boden und zerplatzte mit lautem Knall.
Die Zeit dehnte sich wie in Zeitlupe, als Byrne mit der Waffe in der Hand vom Hocker rutschte und die Mündung auf Krotz richtete.
»Nett, dich zu sehen, Detective«, sagte Krotz. »Du siehst so anders aus. Ein bisschen … verwildert.«
Krotz hatte glasige Augen. Methadon, schoss es Byrne durch den Kopf. Er erinnerte sich, dass Krotz drogensüchtig war.
»Cool bleiben, Anton«, sagte Byrne.
»Matt!«, schrie die Frau.
Krotz schob das Messer näher an den Kehlkopf der Frau. »Halt’s Maul, Miststück!«, zischte er und bewegte sich mit der Geisel in Richtung Ausgangstür. Byrne sah Schweißperlen auf Krotz’ Stirn.
»Hör zu«, sagte Byrne. »Ich will nicht, dass was passiert …«
»Ach ja?«, rief Krotz. »Warum zielst du dann mit der Knarre auf mich, du Scherzkeks?«
»Du weißt doch, wie das läuft, Anton.«
Krotz’ Blick glitt über seine Schulter und dann zurück zu Byrne. Die Stille tat in den Ohren weh. Die Sekunden dehnten sich.
»Du willst doch nicht, dass ich die Maus hier vor den Augen der halben Stadt absteche?« Krotz knetete mit der freien Hand die Brust der Frau. »So einer bist du doch nicht, oder?«
Byrne drehte sich rasch um. Eine Hand voll Passanten schaute durch das große Fenster zur Straße ins Lokal. Die Leute hatten erkennbar Angst, doch ihre Furcht schien nicht so groß zu sein wie ihre Sensationsgier. Sie waren mitten im Reality-TV gelandet. Zwei telefonierten sogar über Handy. Das hier würde ein richtiges Medienereignis. Vielleicht floss sogar Blut.
Byrne ließ die Waffe nicht sinken. »Sag schon, Anton. Was hast du vor?«
»Ich würde die Tussi gerne flachlegen, aber der Zeitpunkt ist ein bisschen ungünstig.« Krotz lachte schrill und laut. Seine gelben Zähne, die an den Hälsen schwarz waren, wurden entblößt. Die Frau begann zu schluchzen.
»Was hast du vor?«, wiederholte Byrne seine Frage.
»Ich will hier raus, du Arsch. Was sonst?«
»Aber du weißt, dass es nicht so weit kommt, oder?«
Krotz packte seine Geisel fester. Byrne sah, dass die scharfe Schneide des Messers eine dünne rote Linie auf die Haut der Frau malte.
»Ich wüsste nicht, wie du mich daran hindern könntest, Detective«, sagte Krotz. »Ich hab die Lage unter Kontrolle.«
»Darum geht es nicht, Anton.«
»Sag es!«
»Was soll ich sagen?«
»›Sie haben die Situation unter Kontrolle, Sir.‹«
Byrne blieben die Worte beinahe im Hals stecken, doch er hatte keine Wahl. »Sie haben die Situation unter Kontrolle, Sir.«
»Ein Scheißgefühl, wenn man zu Kreuze kriechen muss, was?« Noch ein paar Zentimeter Richtung Tür. »Das hab ich mein ganzes beschissenes Leben lang getan. Weißt du, ich …«
»Wir reden später darüber«, sagte Byrne. »Jetzt müssen wir erst mal diese Geschichte hier klären, okay?«
»Ach ja. Hab ich doch glatt vergessen.«
»Lass uns überlegen, ob wir eine Lösung finden, die Sache so zu beenden, dass niemand verletzt wird. Wir sollten gemeinsam nach einer Lösung suchen.«
Krotz war jetzt knapp zwei Meter von der Tür entfernt. Er war kein besonders großer Mann; dennoch überragte er die Frau um Haupteslänge. Byrne hatte freies Schussfeld. Er strich mit dem Finger über den Abzug. Er könnte Krotz mit einem Schuss ausschalten. Eine Kugel, genau in die Stirn. Er würde zwar gegen alle Dienstvorschriften und sämtliche Verhaltensregeln bei einem Einsatz verstoßen, aber der Frau, die das Messer an der Kehle spürte, war das sicher ziemlich egal.
Wo zum Teufel blieb die Verstärkung?
»Du weißt so gut wie ich, dass man mir die Todesspritze verpasst, wenn ich jetzt aufgebe«, sagte Krotz.
»Das ist nicht unbedingt gesagt …«
»Doch, ist es!«, brüllte Krotz. Er zog die Frau noch näher an sich. »Lüg mich nicht an, du Arsch!«
»Das ist keine Lüge, Anton. Es kann alles Mögliche passieren.«
»Ja? Zum Beispiel? Dass der Richter mir ansieht, dass ich ’ne verkorkste Kindheit hatte und deshalb nur beschränkt schuldfähig bin?«
»Komm schon, Anton. Du weißt doch, wie es läuft. Zeugen haben Erinnerungslücken. Selbst Scheiße wird wieder aus dem Gerichtsaal gespült. Dass man einem Mörder den Goldenen Schuss setzt, steht nie im Voraus fest.«
»Red keinen Stuss!«
In diesem Augenblick sah Byrne aus dem Augenwinkel einen Schatten auf der linken Seite. Ein AR-15 im Anschlag, schlich ein Officer des SWAT-Teams sich von hinten an. Er befand sich außerhalb von Krotz’ Sichtfeld. Der Officer stellte Blickkontakt zu Byrne her.
Sobald ein SWAT-Officer am Tatort auftauchte, war das Gebäude umstellt. Wenn Krotz das Restaurant verließ, würde er nicht weit kommen. Byrne musste die Frau aus Krotz’ Gewalt befreien und ihm irgendwie das Messer wegnehmen.
»Hör zu, Anton. Ich lege meine Waffe auf den Boden, okay?«
»Sag ich doch die ganze Zeit. Leg die Knarre auf den Boden, und kick sie zu mir rüber.«
»Ich lege sie auf den Boden und hebe die Hände über den Kopf, okay?«
Byrne sah, dass der SWAT-Officer in Stellung ging. Die Schutzkappe entfernte. Das Auge ans Zielfernrohr drückte und anlegte.
Krotz bewegte sich noch ein paar Zentimeter auf die Tür zu. »Was ist jetzt? Leg die Knarre auf den Boden, oder ich mach die Schlampe kalt!«
»Sobald ich die Waffe auf den Boden lege, lässt du die Frau laufen.«
»Und dann?«
»Dann gehen wir beide hier raus.« Byrne legte seine Pistole auf den Boden und stellte einen Fuß darauf. »Wir reden miteinander. Okay?«
Einen Augenblick sah es so aus, als würde Krotz darüber nachdenken.
Dann ging alles so schnell, wie es begonnen hatte.
»Nee«, sagte Krotz. »Was hab ich davon?«
Er griff der Frau ins Haar, riss ihren Kopf zurück und schnitt ihr die Kehle durch. Ein Blutschwall spritzte durch das halbe Lokal.
»Nein!«, schrie Byrne.
Die Frau brach zusammen. Die Wunde am Hals sah wie ein groteskes rotes Lächeln aus. Eine Sekunde fühlte Byrne sich schwerelos, erstarrt, als wäre alles sinnlos, was er je gelernt und getan hatte, als wären all seine Erfahrungen auf den Straßen der Stadt nichts als himmelschreiende Lügen.
Krotz blinzelte. »Liebst du diese verdammte Stadt?«
Er wollte sich auf Byrne stürzen, doch ehe er auch nur einen Schritt machen konnte, feuerte der SWAT-Scharfschütze. Zwei Kugeln schlugen in Krotz’ Oberkörper. Er wurde nach hinten geschleudert. Das Blut spritzte aus seiner Brust. Ohrenbetäubender Lärm hallte durch das kleine Lokal. Krotz flog rücklings durch das von den Kugeln zerborstene Fenster auf den Bürgersteig. Die Schaulustigen sprangen entsetzt auseinander. Schrille Schreie waren zu hören. Zwei SWAT-Officers, die vor dem Restaurant in Position gestanden hatten, stürmten zu Krotz, stemmten ihre schweren Stiefel auf seinen Körper und richteten die Waffen auf seinen Kopf.
Krotz’ Brust hob sich – einmal, noch einmal –, dann rührte er sich nicht mehr, und die Wärme seines Körpers verdampfte in der kalten Luft. Ein dritter SWAT-Officer trat hinzu und fühlte nach dem Puls. Er hob die Hand. Krotz war tot.
Plötzlich nahm Byrne alles mit geschärften Sinnen wahr. Er roch das Schießpulver, vermischt mit dem Duft von Kaffee und dem scharfen Geruch von Zwiebeln. Er sah das schimmernde rote Blut auf dem Boden. Er hörte das Klirren, als die letzte Scherbe zu Boden fiel, und das leise Weinen eines Menschen. Als die kalte Luft von draußen ins Lokal strömte, hatte er das Gefühl, der Schweiß auf seinem Rücken würde zu Eis erstarren.
Liebst du diese verdammte Stadt?
Kurz darauf hielt ein Rettungswagen mit kreischenden Reifen vor dem Tatort, und Byrne erwachte aus seiner Erstarrung. Zwei Sanitäter rannten ins Lokal und zu der Frau auf dem Boden, doch es war längst zu spät: Sie war so tot wie ihr Mörder.
Nick Palladino und Eric Chavez, zwei Detectives der Mordkommission, stürzten mit gezogenen Waffen durch die Tür. Sie sahen Byrne. Sahen das Blutbad. Steckten die Waffen wieder ein. Chavez sprach in sein Funkgerät. Nick Palladino machte sich daran, den Tatort zu sichern.
Byrne schaute zu dem Mann hinüber, der mit dem Opfer in der Nische gesessen hatte. Der Mann starrte auf die tote Frau, die auf dem Boden lag, als würde sie schlafen, als könnte sie gleich wieder aufstehen und zu ihm kommen, als könnten sie beide zu Ende essen, die Rechnung bezahlen, in den Abend hinausgehen und die Weihnachtsbeleuchtung in den Straßen bewundern. Byrne sah eine kleine Portionspackung Sahne neben der Kaffeetasse der Frau. Sie wollte die Sahne in ihren Kaffee schütten, und fünf Minuten später war sie tot.
Byrne war schon häufig Zeuge von Schmerz und Verzweiflung geworden – Emotionen, die ein Mord verursacht hatte. Doch selten war es so kurz nach einer Tat gewesen. Der Mann hatte soeben gesehen, wie seine Frau brutal ermordet worden war. Er war nur wenige Schritte entfernt gewesen. Nun hob er den Blick, schaute zu Byrne. In seinen Augen spiegelte sich ein so unsäglicher Schmerz, wie Byrne ihn nie zuvor gesehen hatte.
»Es tut mir leid«, sagte er. Kaum hatte er die Worte ausgesprochen, fragte er sich, warum er sie gesagt hatte. Was sie bedeuteten.
»Sie haben meine Frau getötet«, sagte der Mann.
Byrne starrte ihn ungläubig an. Er hatte das Gefühl, einen Faustschlag in den Magen bekommen zu haben. Er konnte nicht fassen, was er gehört hatte. »Sir, ich …«
»Sie hätten ihn erschießen können, aber Sie haben gezögert. Ich habe es gesehen. Sie hätten ihn erschießen können, aber Sie haben es nicht getan.«
Der Mann rutschte aus der Nische heraus. Es dauerte einen Moment, bis er sicheren Stand hatte. Dann kam er langsam auf Byrne zu. Nick Palladino wollte ihm in den Weg treten, doch Byrne gab ihm ein rasches Zeichen, sich zurückzuhalten. Der Mann kam näher. Er war nur noch zwei Schritte entfernt.
»Ist das Ihr Job?«, fragte der Mann.
»Wie bitte?«
»Uns zu beschützen? Ist das Ihr Job?«
Byrne wollte dem Mann entgegnen, dass das Sondereinsatzkommando in Stellung gewesen sei und dass er wegen seiner Frau nicht auf den Abzug gedrückt habe. Doch ihm fiel beim besten Willen nichts ein, was er hätte sagen können.
»Laura«, sagte der Mann.
»Bitte?«
»Sie hieß Laura.«
Ehe Byrne noch ein Wort sagen konnte, schwang der Mann die Faust. Es war ein blindwütiger, armseliger, ungeschickter Schlag. Byrne sah die Faust auf sich zukommen und wich ihr mühelos aus. Doch in den Augen des Mannes spiegelten sich eine so unbändige Wut und so unsägliches Leid, dass Byrne sich beinahe wünschte, er hätte sich den Schlag eingefangen.
Ehe der Mann noch einmal ausholen konnte, packten Nick Palladino und Eric Chavez ihn und hielten ihn fest. Der Mann wehrte sich nicht. Er begann zu schluchzen und erschlaffte im Griff der Detectives.
»Lasst ihn los«, sagte Byrne. »Holt einen Arzt.«
Um drei Uhr früh war der Einsatz des SWAT-Teams beendet. Ein halbes Dutzend Detectives aus der Mordkommission war zur Unterstützung gekommen. Sie bildeten einen Kreis um Byrne und schirmten ihn vor den Medien und sogar vor den Vorgesetzten ab.
Byrne wurde vernommen; dann konnte er gehen. Im ersten Augenblick wusste er nicht, wohin er sollte, wohin er wollte. Nicht einmal der Gedanke, sich zu betrinken, war reizvoll, obwohl die Trunkenheit die schrecklichen Ereignisse des Abends vielleicht eine Zeitlang ausgeblendet hätte.
Vor gerade einmal vierundzwanzig Stunden hatte er auf der kalten, aber gemütlichen Veranda einer Hütte in den Poconos gesessen, die Füße hoch, einen halben Plastikbecher mit Old Forester in der Hand. Jetzt waren zwei Menschen tot. Es sah so aus, als würde er den Tod anziehen.
Der Mann hieß Matthew Clarke, Versicherungsvertreter, einundvierzig Jahre alt. Er hatte drei Töchter – Felicity, Tammy und Michele. Er war mit seiner Frau in die Stadt gekommen, um ihre älteste Tochter zu besuchen, die an der Temple University mit dem Studium begonnen hatte. Sie hatten das Crystal Diner aufgesucht, um Kaffee zu trinken und Zitronenpudding zu essen, das Lieblingsdessert seiner Frau, die auf dem Boden des Coffee Shops verblutet war.
Sie hieß Laura.
Sie hatte braune Augen.
Kevin Byrne hatte das Gefühl, als würde er diese Augen sehr lange Zeit nicht vergessen.
3.
Zwei Tage später
Das Buch lag auf dem Tisch. Es bestand aus harmloser Pappe, unschuldigem Papier und ungiftiger Tinte. Es steckte in einem Schutzumschlag, war mit einer ISBN-Nummer, einem Klappentext auf der Rückseite und einem Titel auf dem Buchrücken versehen. Es ähnelte in jeder Beziehung jedem anderen Buch auf der Welt.
Dennoch gab es einen Unterschied.
Detective Jessica Balzano, die seit zehn Jahren dem Philadelphia Police Department angehörte, nippte von ihrem Kaffee und starrte auf das furchterregende Objekt. In ihrem Job hatte sie es mit Mördern, Räubern, Vergewaltigern, Spannern, Einbrechern und anderen Musterbürgern zu tun gehabt. Sie hatte sich mit Fieslingen, Verrückten, Punkern und Gangstern geprügelt, hatte Psychopathen in dunklen Gassen gejagt, war von einem Irren mit einer schnurlosen Bohrmaschine bedroht worden und hatte in die Mündung einer 9-mm-Pistole geblickt, die auf ihre Stirn gerichtet war.
Und doch erschreckte sie das Buch auf dem Esstisch mehr als das alles zusammen.
Jessica hatte nichts gegen Bücher. Im Gegenteil. Normalerweise liebte sie Bücher. Meist steckte in ihrer Handtasche ein Taschenbuch, damit sie etwas zu lesen hatte, falls es im Job mal Leerlauf gab. Bücher waren eine großartige Sache.
Aber nicht dieses Buch, dieses glänzende, fröhliche gelb-rote Buch auf ihrem Esstisch, das Buch mit einem kleinen Zoo grinsender Papptiere auf dem Cover.
Das Buch gehörte ihrer Tochter Sophie.
Und das bedeutete, dass Sophie bald zur Schule gehen würde.
Nicht in die Vorschule, was Jessica so sehr begeistert hätte wie der Gedanke an die Kindertagesstätte oder den Kindergarten. Nein, in eine ganz normale Schule. Sicher, es war nur ein Einführungstag, um auf den Ernst des Lebens vorzubereiten, der im nächsten Herbst begann, doch alle Utensilien lagen dort. Auf dem Tisch. Vor ihren Augen. Buch, Frühstücksbox, Mantel, Fäustlinge, Federmäppchen.
Schule.
Fertig angezogen und für ihren ersten offiziellen Tag in der akademischen Welt gerüstet, kam Sophie aus ihrem Kinderzimmer. Sie trug einen marineblauen Faltenrock und einen Pullover mit rundem Halsausschnitt, ein Paar Schnürschuhe, eine Baskenmütze aus Wolle und einen dazu passenden Schal. Sie sah aus wie eine Miniaturausgabe von Audrey Hepburn.
Jessica klopfte das Herz bis zum Hals.
»Ist was, Mom?«, fragte Sophie, als sie auf ihren Stuhl rutschte.
»Alles klar, mein Schatz«, log Jessica. »Warum sollte etwas sein?«
Sophie zuckte mit den Schultern. »Du bist schon die ganze Woche so traurig.«
»Traurig? Warum sollte ich traurig sein?«
»Weil ich bald zur Schule gehe.«
Mein Gott, dachte Jessica. In meinem Haus lebt eine fünf Jahre alte Psychologin. »Ich bin nicht traurig, mein Schatz.«
»Alle Kinder gehen zur Schule, Mom. Wir haben doch darüber gesprochen.«
Ja, das haben wir, mein Schatz. Aber ich habe es nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden, weil du noch ein Baby bist. Mein Baby. Ein winziges, hilfloses kleines Wesen mit rosigen Fingern, das für alles die Hilfe seiner Mom braucht.
Sophie schüttete sich Müsli in eine Schale, goss Milch darüber und rührte alles mit dem Löffel um.
»Guten Morgen, meine Süßen«, sagte Vincent, als er in die Küche kam und seine Krawatte band. Er gab Jessica einen Kuss auf die Wange und streichelte Sophie über die Mütze.
Jessicas Ehemann war morgens immer gut gelaunt. Den Rest des Tages grübelte er meistens, aber morgens war er ein richtiger Sonnenschein. Genau das Gegenteil von seiner Frau.
Vincent Balzano war ebenfalls Kriminalbeamter und arbeitete im Drogendezernat Nord. Er war schlank und kräftig; Jessica hatte niemals einen Mann kennen gelernt, der so umwerfend sexy war wie Vincent – dunkles Haar, hellbraune Augen, lange Wimpern. Heute Morgen war sein Haar noch feucht, und er hatte es nach hinten aus der breiten Stirn gekämmt. Er trug einen dunkelblauen Anzug.
In den sechs Jahren ihrer Ehe hatten sie schon einige steile Klippen umschiffen müssen – fast sechs Monate waren sie getrennt gewesen –, aber nun waren sie wieder zusammen, und es funktionierte gut. Es war immer schwierig, wenn beide Partner bei der Polizei arbeiteten. Oft waren diese Ehen von vornherein zum Scheitern verurteilt.
Vincent goss sich eine Tasse Kaffee ein und setzte sich an den Tisch. »Lass dich anschauen«, sagte er zu Sophie.
Sophie sprang vom Stuhl und stellte sich wie ein winziger Soldat beim Appell vor ihren Vater hin.
»Dreh dich um«, sagte er.
Sophie drehte sich im Kreis, posierte wie eine kleine Dame, kicherte und stemmte eine Hand in die Hüfte.
»Da-da-dum, dreh dich im Kreis herum«, sagte Vincent.
»Da-da-dum«, wiederholte Sophie und drehte sich im Kreis.
»Du musst mir etwas erklären, kleine Lady.«
»Was?«
»Warum bist du so hübsch?«
»Meine Mom ist hübsch.« Beide schauten Jessica an. Es war ein eingeübter Dialog, um Jessica aufzumuntern, wenn sie betrübt war.
Mein Gott, dachte Jessica. Sie hatte das Gefühl, ihr Brustkorb würde gleich zerspringen. Ihre Unterlippe bebte.
»Ja, das ist sie«, sagte Vincent. »Eines der beiden hübschesten Mädchen auf der Welt.«
»Wer ist das andere?«, fragte Sophie.
Vincent zwinkerte ihr zu.
»Dad!«, sagte Sophie vorwurfsvoll.
»Komm, lass uns frühstücken.«
Sophie setzte sich wieder an den Tisch.
Vincent nippte von seinem Kaffee. »Freust du dich auf die Schule?«
»Ja, sehr.« Sophie löffelte sich das Müsli in den Mund.
»Wo ist dein Rucksack?«
Sophie hörte auf zu kauen. Der Rucksack! Wie sollte sie den Tag ohne Rucksack überstehen? Erst der Rucksack machte einen richtigen Menschen aus ihr. Vor zwei Wochen hatte sie mehr als ein Dutzend ausprobiert und sich schließlich für einen Strawberry Shortcake entschieden. Jessica hatte das Gefühl gehabt, Paris Hilton beim Auswählen einer Handtasche in einer Boutique von Jean Paul Gaultier zu erleben.
Eine Minute später war Sophie mit dem Essen fertig. Sie stellte ihre Schale ins Spülbecken und rannte in ihr Zimmer.
Vincent wandte sich seiner Frau zu, die mit einem Mal so zart besaitet war – dieselbe Frau, die einmal einen angesäuselten Trucker in einer Kneipe in Port Richmond mit einem Kinnhaken niedergestreckt hatte, weil der Bursche zudringlich geworden war; die Frau, die einmal live auf ESPN2 gegen ein Mannweib aus Cleveland, Ohio, geboxt hatte, ein neunzehnjähriges Muskelpaket mit dem Kampfnamen »Betonklotz« Jackson. Jessica hatte den Betonklotz nach vier Runden auf die Bretter geschickt.
»Komm her, mein großes Baby«, sagte Vincent.
Jessica kam durch die Küche zu ihm. Vincent klopfte auf seine Oberschenkel.
»Du kommst nicht besonders gut damit klar, stimmt’s?«
»Stimmt.« Jessica spürte, dass ihre Gefühle wieder in ihr aufloderten – ein heißes Brennen hinter dem Brustbein. Sie war Detective bei der Mordkommission in Philadelphia, doch bei dem Gedanken an die Einschulung ihrer Tochter bekam sie weiche Knie.
»Es ist doch nur ein Einführungstag«, sagte Vincent.
»Ja. Aber eine Einführung für die Schule.«
»Ja, und?«
»Sie ist noch nicht reif genug, um zur Schule zu gehen.«
»Ich sag dir was, Jess.«
»Und was?«
»Sie ist reif genug.«
»Aber … aber das heißt, dass es nicht mehr lange dauert, bis sie Make-up auflegt, ihren Führerschein macht und sich mit Jungen trifft …«
»Im ersten Schuljahr?«
»Du weißt, was ich meine.«
Jessica wusste genau, was los war. Gott stehe ihr bei und rette die Republik – sie wünschte sich ein zweites Kind. Seitdem der Zeiger ihrer biologischen Uhr auf die magische Dreißig zutickte, dachte sie darüber nach. Die meisten ihrer Freundinnen waren schon beim dritten Nachwuchs angelangt. Immer, wenn sie ein Baby in einem Kinderwagen oder in einem Tragegestell oder auf einem Kindersitz oder sogar im Fernsehen in einem Werbespot für Pampers sah, versetzte es ihr einen Stich.
»Halt mich fest«, sagte sie.
Vincent drückte sie an sich. Auch wenn Jessica sich für eine starke Frau hielt – Polizistin, Halbprofi-Boxerin und nicht zu vergessen ein taffes Mädchen aus South Philly –, fühlte sie sich niemals sicherer als in solchen Augenblicken.
Sie rückte ein Stück von Vincent ab und schaute ihm in die Augen. Dann küsste sie ihn. Leidenschaftlich und mit der stummen Botschaft: Lass uns ein Baby machen.
»Wow«, rief Vincent, dessen Lippen voller Lippenstift waren. »Wir sollten Sophie öfter zur Schule schicken.«
»Ich hab noch mehr zu bieten, Detective«, sagte Jessica in einem Tonfall, der für sieben Uhr morgens vermutlich ein wenig zu verführerisch war. Vincent war schließlich Italiener. Sie versuchte aufzustehen, doch er zog sie wieder auf seinen Schoß. Er küsste sie noch einmal, und dann schauten beide auf die Uhr.
Sophies Bus kam in fünf Minuten. Jessica würde sich erst eine Stunde später mit ihrem Partner Kevin Byrne treffen.
Zeit satt.
Byrne hatte eine Woche frei gehabt, und obwohl Jessica genug Arbeit gehabt hatte, zog die Woche sich ohne ihren Partner doch sehr in die Länge. Eigentlich hatte sie Byrne schon vor drei Tagen zurückerwartet, doch wegen des schrecklichen Zwischenfalls im Crystal Diner Coffee Shop hatte seine Rückkehr sich verzögert. Jessica hatte die Artikel im Inquirer und in den Daily News sowie die offiziellen Berichte gelesen. Ein Albtraum für jeden Polizisten.
Byrne wurde kurzfristig vom Dienst freigestellt. In ein oder zwei Tagen musste er sich einer Untersuchungskommission stellen. Bis jetzt hatten sie noch nicht ausführlich über die Sache gesprochen.
Aber das würden sie noch.
Als Jessica um die Ecke bog, sah sie Byrne mit zwei Bechern Kaffee in den Händen auf sie warten. Ihr erstes Ziel heute Morgen war ein Tatort in Juniata Park, wo 1997, vor fast zehn Jahren, ein Doppelmord in der Drogenszene verübt worden war. Anschließend war die Vernehmung eines älteren Mannes angesetzt, der ein möglicher Zeuge gewesen war. Es war Tag eins eines ungelösten Falles, den man ihnen zugeteilt hatte.
In der Mordkommission gab es drei Abteilungen: Eine ermittelte in neuen Fällen, eine andere fahndete nach Verdächtigen, und die Sonderermittlung bearbeitete unter anderem ungelöste Fälle. Die Zugehörigkeit eines Detectives zu einer dieser Abteilungen war normalerweise in Stein gemeißelt, aber mitunter, wenn alle Stricke rissen – was in Philly leider zu oft geschah –, konnte jeder Detective einer anderen Abteilung und einem anderen Fall zugeteilt werden.
»Entschuldigung, ich wollte mich hier mit meinem Partner treffen«, sagte Jessica. »Groß, glatt rasiert. Sieht aus wie ein Cop. Haben Sie den gesehen?«
»Was denn, stehst du nicht auf Bärte?« Byrne reichte ihr einen Becher. »Ich hab eine Stunde damit verbracht, ihn zu stutzen, damit er gepflegt aussieht.«
»Gepflegt?«
»Ja, nicht so wüst.«
»Verstehe.«
»Und? Was meinst du?«
Jessica lehnte sich zurück und betrachtete sein Gesicht. »Wenn ich ehrlich bin, finde ich, du siehst …«
»Vornehm aus?«
Jessica lag das Wort obdachlos auf der Zunge. »Ja. Genau.«
Byrne strich sich über den Bart. Er war noch ziemlich kurz, aber man sah schon jetzt, dass er fast grau sein würde. Solange er sich ihr nicht mit dem Duft von Just for men präsentierte, käme sie wohl damit klar.
Als sie auf den Taurus zuhielten, klingelte Byrnes Handy. Er klappte es auf, lauschte, zog seinen Block aus der Tasche und machte sich ein paar Notizen. Dann schaute er auf die Uhr. »Zwanzig Minuten.« Er klappte das Handy zu und steckte es ein.
»Arbeit?«, fragte Jessica.
»Ja.«
Der ungelöste Fall würde noch ein bisschen länger ungelöst bleiben. Sie gingen die Straße hinunter. Nach ein paar Minuten ergriff Jessica das Wort.
»Alles in Ordnung?«, fragte sie.
»Mit mir? Klar«, erwiderte Byrne. »Mir geht es prima. Mein Ischias macht mir ein bisschen zu schaffen, aber sonst ist alles bestens.«
»Kevin, hör mal …«
»Ehrlich, es ist alles in Ordnung«, beteuerte Byrne. »Ich schwöre.«
Er log, aber so war es bei Freunden nun mal, wenn sie wollten, dass der andere die Wahrheit erriet.
»Reden wir später darüber?«, fragte Jessica.
»Machen wir. Übrigens, warum siehst du so glücklich aus?«
»Ich sehe glücklich aus?«
»Lass es mich so ausdrücken: Mit deinem Gesicht könntest du dein Lächeln in Jersey auf dem Markt verkaufen.«
»Ich freue mich, meinen Partner zu sehen.«
»Schön.« Byrne stieg in den Wagen.
Jessica musste lachen, als sie sich an den hemmungslosen, leidenschaftlichen Sex mit ihrem Ehemann heute Morgen erinnerte. Ihr Partner kannte sie gut.
4.
Der Tatort war ein mit Brettern vernageltes Gewerbeobjekt in Manayunk, einer Gegend im Nordwesten von Philly, genau am Ostufer des Schuylkill River. Schon seit einiger Zeit schienen Sanierungs- und Stadtentwicklungsmaßnahmen hier ein Dauerzustand zu sein. Ziel war es, dieses Viertel, in dem einst die Arbeiter aus den Bergwerken und Fabriken gewohnt hatten, in ein Wohnviertel für die gehobene Mittelschicht der Stadt zu verwandeln. Der Name Manayunk war ein Ausdruck der Lenape, eines Indianerstamms, der hier einst gelebt hatte; er bedeutete »unser Platz zum Trinken«. Im vergangenen Jahrzehnt hatte dieser belebte Abschnitt der Main Street mit seinen Pubs, Restaurants und Nachtclubs – Philadelphias Antwort auf die Bourbon Street – sich alle Mühe gegeben, diesem vor langer Zeit verliehenen Namen Ehre zu machen.
Als Jessica und Byrne in die Flat Rock Road einbogen, sperrten bereits zwei Streifenwagen den Tatort ab. Die Detectives fuhren auf den Parkplatz und stiegen aus. Der Streifenbeamte am Tatort war Officer Michael Calabro.
»Guten Morgen, Detectives«, sagte Calabro und reichte ihnen das Tatortprotokoll. Sie unterschrieben beide.
»Was haben wir, Mike?«, fragte Byrne ihn.
Calabro war so bleich wie der Dezemberhimmel. Er war Ende dreißig, stämmig und kräftig und ein alter Hase in seinem Job. Jessica kannte ihn seit fast zehn Jahren. Calabro war nicht so leicht aus der Fassung zu bringen. Normalerweise hatte er für jeden ein Lächeln, sogar für die Schwachköpfe, mit denen er sich auf den Straßen herumplagen musste. Es war kein gutes Zeichen, wenn er so tief erschüttert war.
Calabro räusperte sich. »Weibliches Mordopfer.«
Jessica ging zurück zur Straße und betrachtete das große einstöckige Gebäude sowie die unmittelbare Nachbarschaft. Ein unbebautes Grundstück auf der gegenüberliegenden Straßenseite, daneben eine Pension und wiederum daneben ein Lagerhaus. Das Haus, in dem die Tat verübt worden war, war ein wuchtiges Gebäude, mit schmutzig braunen Ziegelsteinen verkleidet und mit Sperrholz verrammelt, das sich mit Wasser vollgesogen hatte. Sämtliche Holzflächen waren mit Graffitis beschmiert. Die Eingangstür war mit verrosteten Ketten und Vorhängeschlössern gesichert. Oben an der Dachverkleidung hing ein riesiges Schild: Zu Verkaufen oder zu vermieten. Delaware Investment Properties, Inc. Jessica schrieb sich die Telefonnummer auf und ging wieder zur Rückseite des Gebäudes. Ein eisiger Wind fegte über das Grundstück.
»Irgendeine Ahnung, was hier früher für ein Geschäft war?«, fragte sie Calabro.
»Das hat mehrmals gewechselt«, erwiderte er. »In meiner Jugend war hier ein Großhändler für Autoersatzteile. Der Freund meiner Schwester hat hier damals gearbeitet. Er hat uns oft was unter der Hand verkauft.«
»Was haben Sie damals für einen Wagen gefahren?«, fragte Byrne ihn.
Jessica sah ein Lächeln auf Calabros Gesicht. So war es immer, wenn Männer über die Autos sprachen, die sie als junge Burschen gefahren hatten. »Einen Trans Am, Baujahr ’76.«
»Nein!«, rief Byrne aus.
»Doch. Ein Freund von meinem Vetter hatte ihn 1985 zu Schrott gefahren. Als ich achtzehn war, hab ich ihm den Wagen für ein paar Dollar abgekauft. Ich hab vier Jahre daran herumgebastelt, dann sah er fast wieder wie neu aus.«
»Ein Trans Am 455?«
»Ja«, sagte Calabro. »Metallicschwarz mit T-Top.«
»Toller Wagen. Und wann hat Ihre Frau Sie nach der Hochzeit gezwungen, ihn zu verkaufen?«
Calabro lachte. »Kaum dass der Pfarrer gesagt hatte: ›Sie dürfen die Braut jetzt küssen.‹«
Wenn es galt, andere aufzumuntern und sie von schrecklichen Eindrücken abzulenken, denen Polizisten bei ihrer Arbeit oft ausgesetzt waren, war Kevin Byrne unübertroffen. Mike Calabro hatte in seinem Job schon viel gesehen, doch das bedeutete nicht, dass der nächste Fall ihn nicht berührte. Oder der übernächste Fall. So war es im Beruf eines Streifenpolizisten: Sobald man um eine Ecke bog, konnte sich das Leben für immer verändern. Jessica wusste noch nicht, was ihnen an diesem Tatort begegnen würde, aber sie wusste, dass Calabro dank Kevin Byrne an diesem Tag alles ein bisschen leichter nehmen würde.
Hinter dem Gebäude befand sich ein L-förmiger Parkplatz, der zum Fluss hin leicht abfiel und einst von einem Drahtzaun umschlossen gewesen war. Doch der Zaun war lange aufgeschnitten, umgerissen und verbogen worden oder anderen Spielarten des Vandalismus zum Opfer gefallen. Große Teile des Zauns fehlten. Überall lagen Müllsäcke, Autoreifen und Straßenabfälle herum.
Ehe Jessica weitere Fragen nach dem Mordopfer stellen konnte, glitt ein schwarzer Ford Taurus – dasselbe Modell wie der Dienstwagen, den Jessica und Byrne fuhren – auf den Parkplatz und hielt. Jessica kannte den Mann hinter dem Lenkrand nicht. Er stieg aus und kam zu ihnen.
»Sind Sie Detective Byrne?«, fragte er.
»Ja«, erwiderte Byrne. »Und wer sind Sie?«
Der Mann griff in seine Gesäßtasche und zog eine goldene Dienstmarke heraus. »Detective Joshua Bontrager«, sagte er. »Mordkommission.« Er grinste Byrne breit an und errötete.
Vermutlich war Bontrager um die dreißig, sah aber viel jünger aus. Er war ein schlanker, knapp eins achtzig großer Mann mit hellblondem Haar, das jetzt im Dezember seinen Glanz verloren hatte und zu eine Art Stachelfrisur geschnitten war, allerdings nicht im Stil von Gentlemen’s Quarterly, eher in Eigenproduktion. Seine Augen waren leuchtend grün. Er sah aus, als käme er vom Lande und hätte seinen Abschluss an einem Provinzcollege erworben. Bontrager drückte zuerst Byrnes und dann Jessicas Hand. »Sie müssen Detective Balzano sein«, sagte er.
»Ja«, sagte Jessica. »Freut mich.«
Bontragers Blick wanderte von einem zum anderen. »Das ist einfach toll, toll, toll! Großartig!«
Detective Joshua Bontrager sprühte vor Energie und Enthusiasmus. Angesichts der zahlreichen Stellenkürzungen, Frühpensionierungen und verletzungsbedingten Ausfälle – ganz zu schweigen von einer stetigen Zunahme der Gewaltverbrechen – war es gut, einen neuen Kollegen in der Abteilung zu haben. Auch wenn dieser Kollege aussah, als hätte er soeben bei einer Aufführung von Unsere Kleine Stadt an der örtlichen Highschool mitgewirkt.
»Sergeant Buchanan hat mich hergeschickt«, erklärte Bontrager. »Hat er Sie angerufen?«
Ike Buchanan war ihr Chef, zuständig für die Tagesschicht der Mordkommission. »Äh … nein«, sagte Byrne. »Hat man Sie in die Mordkommission versetzt?«
»Vorübergehend«, sagte Bontrager. »Ich soll im Wechsel mit Ihnen und einem anderen Team zusammenarbeiten. Jedenfalls, bis die Lage sich ein wenig entspannt hat.«
Jessica schaute sich Bontragers Kleidung genauer an. Seine Anzugjacke war dunkelblau, seine Hose schwarz, als hätte er diese Kombination aus zwei verschiedenen Hochzeitsanzügen zusammengestellt. Oder er hatte sich angezogen, als es noch dunkel gewesen war. Seine gestreifte kunstseidene Krawatte musste aus der Zeit der Carter-Regierung stammen. Seine Schuhe waren abgeschabt, aber robust, erst kürzlich neu besohlt worden und fest geschnürt.
»Was kann ich tun?«, fragte Bontrager.
Byrnes Gesichtsausdruck schien die Antwort förmlich zu schreien: Du kannst dich dahin verziehen, wo du herkommst.
»Darf ich fragen, wo Sie gearbeitet haben, ehe Sie der Mordkommission zugeteilt wurden?«, erkundigte Byrne sich stattdessen.
»Bei der Verkehrspolizei«, erwiderte Bontrager.
»Wie lange waren Sie da?«
Brust raus, Kinn hoch. »Acht Jahre.«
Jessica hätte Byrne gerne einen Blick zugeworfen, aber das konnte sie nicht. Sie konnte es einfach nicht.
»Also«, sagte Bontrager, der sich die Finger rieb, um sie zu wärmen. »Was kann ich tun?«
»Zunächst einmal müssen wir dafür sorgen, dass der Tatort abgesichert ist«, sagte Byrne. Er zeigte auf die Rückseite des Gebäudes und die kurze Zufahrt auf der Nordseite des Grundstücks. »Wenn Sie diesen Zufahrtsweg absperren könnten, wäre das eine große Hilfe. Wir müssen vermeiden, dass Schaulustige das Grundstück betreten und Spuren verwischen.«
Im ersten Augenblick dachte Jessica, Bontrager würde salutieren.
»Dann will ich mich mal darum kümmern!«, sagte er unternehmungslustig.
Mit diesen Worten wandte Detective Joshua Bontrager sich ab und rannte über das Grundstück zu dem Zufahrtsweg.
Byrne drehte sich zu Jessica um. »Wie alt der wohl ist? Siebzehn?«
»Der wird erst noch siebzehn.«
»Ist dir aufgefallen, dass er keinen Mantel trägt?«
»Ja.«
Byrne warf Officer Calabro einen Blick zu. Beide Männer zuckten mit den Schultern. Byrne zeigte auf das Gebäude. »Liegt das Mordopfer im Erdgeschoss?«
»Nein, Sir«, erwiderte Calabro. Er drehte sich um und zeigte auf den Fluss.
»Das Opfer liegt im Fluss?«, fragte Byrne.
»Am Ufer.«
Jessica blickte zum Schuylkill River. Die Böschung senkte sich zum Fluss hinunter, sodass sie das Ufer von ihrem Standort aus nicht sehen konnte. Durch die wenigen entlaubten Bäume auf dieser Seite konnte sie die Fahrzeuge auf dem Schuylkill Expressway am anderen Ufer erkennen. Sie drehte sich wieder zu Calabro um. »Haben Sie die unmittelbare Umgebung überprüft?«
»Ja«, sagte der Officer.
»Wer hat das Opfer gefunden?«
»Anonymer Anruf bei der Notrufzentrale.«
»Wann?«
Calabro schaute auf sein Protokoll. »Vor gut einer Stunde.«
»Wurde die Gerichtsmedizin verständigt?«, fragte Byrne.
»Ist unterwegs.«
»Gute Arbeit, Mike.«
Ehe Jessica hinunter zum Flussufer ging, machte sie mehrere Fotos von dem Gebäude. Sie fotografierte auch die beiden Wagen ohne Kennzeichen, die auf dem Parkplatz standen. Der eine war ein zwanzig Jahre alter Chevy der Mittelklasse, der andere ein verrosteter Ford Van. Jessica ging zu den beiden Wagen und legte eine Hand auf die Motorhauben. Eiskalt. Täglich wurden Hunderte von Fahrzeugen in Philadelphia gefunden, die abgemeldet und irgendwo wild abgestellt worden waren. Manchmal schienen es fast tausend zu sein. Jedes Mal lief jemand zum Bürgermeister oder zum Stadtrat, die immer schnell mit dem Versprechen dabei waren, herrenlose Wagen wegzuschaffen und leerstehende Bruchbuden abzureißen. Nur tat sich nichts.
Jessica machte noch ein paar Fotos. Als sie fertig war, streiften sie und Byrne Latexhandschuhe über.
»Bereit?«, fragte er.
»Bringen wir’s hinter uns.«
Sie gingen zum Rand des Parkplatzes. Von dort fiel das Grundstück leicht zum Ufer hin ab. Da die Frachtschiffe größtenteils über den Delaware und nicht über den Schuylkill River fuhren, gab es hier nur wenige Anlegestellen, doch da und dort waren kleine Stege und ein paar Pontons zu sehen. Als sie zum Ende des asphaltierten Bereichs gelangten, sahen sie den Kopf des Opfers, dann die Schultern, dann den Körper.
»Mein Gott«, sagte Byrne.
Es war eine junge blonde Frau, vielleicht Mitte zwanzig. Sie saß auf einem kurzen Steinsteg, die Augen weit aufgerissen. Es schien, als säße sie am Flussufer und betrachtete die Strömung.
Es bestand kein Zweifel, dass sie zu Lebzeiten sehr hübsch gewesen war. Jetzt war ihr totenbleiches Gesicht zu einer Maske erstarrt, und der eisige Wind hatte bereits Risse in ihre Haut gegraben. Ihre fast schwarze Zunge hing an einer Seite aus dem Mund heraus. Sie trug keinen Mantel, keine Handschuhe, keinen Hut, nur ein langes Kleid in einem verblichenen Rosa. Es sah sehr altmodisch aus und erinnerte an längst vergangene Zeiten. Das Kleid hing über ihren Füßen und berührte fast das Wasser. Die junge Frau schien schon eine Weile dort zu sitzen, wie in die Betrachtung des Flusses vertieft. Der Verwesungsprozess hatte bereits eingesetzt, war aber nicht so weit fortgeschritten, wie es bei wärmeren Temperaturen der Fall gewesen wäre. Dennoch hing der Gestank der Verwesung drei, vier Schritte um die Tote herum in der Luft.
Um den Hals der Frau war ein Nylongürtel geschlungen, der im Nacken verknotet war.
Jessica sah, dass einige entblößte Hautpartien des Opfers mit einer dünnen Schicht Eis überzogen waren, was dem Leichnam einen unnatürlichen Glanz verlieh. Es hatte gestern geregnet; anschließend war die Temperatur stark gesunken.
Jessica machte ein paar Aufnahmen und trat näher an die Tote heran. Sie würde den Leichnam nicht anrühren, bis der Gerichtsmediziner grünes Licht gegeben hatte, doch je eher sie die Tote unter die Lupe nehmen konnten, desto schneller konnten sie mit den Ermittlungen beginnen. Während Byrne sich am Rand des Parkplatzes umschaute, kniete Jessica sich neben die Leiche.
Das Kleid des Opfers war ein paar Nummern zu groß für den schlanken, zierlichen Körper. Es hatte lange Ärmel, einen abnehmbaren Spitzenkragen und eine Falte an den Bündchen.
Jessica verstand nicht, warum diese Frau im Winter in einem dünnen Kleid, das aus einem vergangenen Jahrhundert zu stammen schien und ihr überdies zu groß war, durch Philadelphia spazieren sollte.
Sie schaute auf die Hände der Frau. Keine Ringe. Jessica sah auch keine Schwielen, keine Narben und keine verheilten Schnitte. Die Frau hatte also nicht mit den Händen gearbeitet; jedenfalls hatte sie keine schwere handwerkliche Tätigkeit ausgeübt. Und sichtbare Tattoos gab es auch nicht.
Jessica trat ein paar Schritte zurück und machte vor dem Hintergrund des Flusses ein Foto von dem Opfer. In diesem Augenblick fiel ihr der Fleck neben dem Saum des Kleides auf, der wie Blut aussah. Ein einziger dicker Blutstropfen. Jessica hockte sich hin, nahm ihren Kugelschreiber heraus und hob den Saum des Kleides an. Was sie sah, nahm ihr den Atem.
»O Gott!«
Jessica kippte hintenüber und wäre beinahe in den Fluss gestürzt. Sie klammerte sich am Boden fest, fand Halt und richtete sich mühsam auf.
Byrne und Calabro, die ihren Schrei gehört hatten, rannten herbei.
»Was ist?«, fragte Byrne.
Jessica wollte es ihm sagen, doch die Worte blieben ihr im Hals stecken. Sie hatte in ihrem Job schon viel Grauenhaftes gesehen und glaubte, so leicht könne sie nichts mehr erschüttern – und normalerweise war sie auf fast jeden Schrecken vorbereitet, wenn sie es mit einem neuen Mordfall zu tun bekam. Der Anblick dieser toten jungen Frau, deren Fleisch bereits verweste, war schlimm genug. Doch was Jessica gesehen hatte, als sie das Kleid des Opfers anhob …
»Was hast du denn?«, fragte Byrne.
Es dauerte einen Moment, bis Jessica sich gefasst hatte. Dann beugte sie sich vor und hob den Saum des Kleides noch einmal hoch. Byrne hockte sich auf die Erde und verdrehte den Kopf. Er wandte den Blick sofort wieder ab. »Scheiße«, sagte er und stand auf. »Scheiße.«
Die Frau war nicht nur stranguliert und an einem eisigen Flussufer gleichsam deponiert worden – man hatte ihr die Füße amputiert. Und allem Anschein nach war dies erst kürzlich geschehen: Eine präzise chirurgische Amputation, genau über den Knöcheln. Die Wunden waren brutal ausgebrannt worden; die bleichen, erfrorenen Beine des Opfers waren bis zur Mitte geschwärzt.
Jessica schaute auf das eisige Wasser unterhalb des Opfers und dann ein paar Meter flussabwärts. Es waren keine Leichenteile zu sehen. Sie hob den Blick und schaute Mike Calabro an: Der Streifenpolizist schob die Hände in die Taschen und ging langsam zurück zum Eingang des Tatorts. Er war kein Detective. Er musste nicht bei der Leiche bleiben. Jessica glaubte Tränen in Calabros Augen gesehen zu haben.
»Ich will mal versuchen, der Gerichtsmedizin und der Spurensicherung ein bisschen Dampf zu machen«, sagte Byrne. Er zog sein Handy aus der Tasche und trat ein paar Schritte zur Seite. Jessica wusste, dass mit jeder Sekunde, die verstrich, wertvolle Spuren verloren gehen konnten.
Sie schaute sich den Gegenstand, den der Täter offenbar als Mordwaffe benutzt hatte, genauer an. Der Gürtel, der um den Hals des Opfers geschlungen war, war sieben bis acht Zentimeter breit. Er schien aus dicht gewebtem Nylon zu bestehen, ähnlich dem Material, aus dem Sicherheitsgurte hergestellt wurden. Jessica machte eine Nahaufnahme des Knotens.
Eine eisige Windbö fegte über sie hinweg. Sie schlang die Arme um ihren Körper und verharrte einen Augenblick regungslos. Ehe sie sich abwandte, zwang sie sich, die Beine der Frau noch einmal aus der Nähe zu betrachten. Die Schnitte sahen sauber aus, als wären sie mit einer sehr scharfen Säge ausgeführt worden. Jessica konnte nur hoffen, dass die Amputation nach Eintritt des Todes erfolgt war. Sie hob den Blick zum Gesicht der Toten. Sie waren nun miteinander verbunden, sie und die ermordete Frau. Jessica hatte schon in vielen Mordfällen ermittelt, doch sie war mit jedem Opfer für alle Zeit verbunden. Niemals würde sie vergessen, was der Tod aus diesen Menschen gemacht hatte und wie sie stumm darum baten, ihnen möge Gerechtigkeit widerfahren.
Kurz nach neun traf Dr. Thomas Weyrich mit dem Fotografen ein, der umgehend seine Aufnahmen machte. Ein paar Minuten später gab Weyrich den Leichnam frei, und die Detectives konnten mit ihren Ermittlungen beginnen. Sie versammelten sich oben auf der Böschung.
»Meine Güte«, sagte Weyrich. »Eine schöne Bescherung.«
»Ja«, sagte Byrne. »Allerdings.«
Weyrich steckte sich eine Marlboro an und nahm einen kräftigen Zug. Er war ein erfahrener Mann, der schon seit vielen Jahren in der Gerichtsmedizin des Philadelphia Police Departments arbeitete. Doch selbst für ihn war dies kein alltäglicher Fall.
»Wurde sie erdrosselt?«, fragte Jessica.
»Das mit Sicherheit auch«, erwiderte Weyrich. Er würde den Nylongürtel erst abnehmen, wenn der Leichnam in die Gerichtsmedizin gebracht worden war. »Es gibt Anzeichen von winzigen Einblutungen in den Augen. Aber ich kann erst mehr dazu sagen, wenn sie bei mir auf dem Tisch liegt.«
»Wie lange sitzt sie schon hier?«, wollte Byrne wissen.
»Ich würde sagen, mindestens achtundvierzig Stunden, vielleicht länger.«
»Und ihre Füße? Wurden sie vor oder nach Eintritt des Todes amputiert?«
»Das weiß ich erst, wenn ich die Wunden untersucht habe, aber nach dem wenigen Blut am Fundort zu urteilen, würde ich sagen, dass die Amputation post mortem vorgenommen wurde, und wahrscheinlich auch nicht hier. Hätte die Frau noch gelebt, müsste sie festgebunden worden sein, und ich sehe keine Druckstellen an den Beinen.«
Jessica ging zurück ans Ufer. Auf dem gefrorenen Boden waren keine Fußabdrücke oder Blutspuren zu sehen. Ein paar dünne Blutstropfen von den Beinen des Opfers waren an die bemooste Steinmauer gespritzt und sahen wie zwei dünne, dunkelrote Ranken aus. Jessica warf einen Blick über den Fluss. Der Anlegesteg war vom Expressway aus teilweise verdeckt, was erklären könnte, warum niemand gemeldet hatte, dass eine Frau seit zwei Tagen regungslos am gefrorenen Flussufer saß. Das Opfer war nicht bemerkt worden – zumindest wollte Jessica das glauben. Die Vorstellung, dass die Menschen in ihrer Stadt eine Frau in der eisigen Kälte hatten sitzen sehen, ohne etwas zu unternehmen, ließ sie schaudern.
Sie mussten so schnell wie möglich die Identität der Frau in Erfahrung bringen. Sie würden den Parkplatz, das Flussufer und das Gelände rings um das Gebäude durchkämmen und eine gründliche Überprüfung der Läden in der Nähe sowie der Wohnhäuser auf beiden Seiten des Flusses vornehmen. Doch bei einem offenbar sorgfältig ausgewählten Tatort wie diesem war es unwahrscheinlich, dass der Täter die Handtasche mit den Papieren des Opfers hier irgendwo achtlos hingeworfen hatte.
Jessica kauerte sich hinter die Ermordete. Die Körperhaltung der Toten erinnerte sie an eine Marionette, deren Fäden durchgeschnitten worden waren, sodass die Puppe zu Boden gesunken war, und als warteten Arme und Beine nun darauf, wieder mit den Fäden verbunden zu werden, damit die Marionette zu neuem Leben erweckt werden konnte.
Jessica betrachtete die Fingernägel der Toten. Sie waren kurz, sauber und mit einem Klarlack überzogen. Die Gerichtsmedizin würde sorgfältig untersuchen, ob unter den Fingernägeln irgendwelches Material haftete, doch mit dem bloßen Auge sah es nicht so aus. Die Fingernägel deuteten jedenfalls darauf hin, dass die Frau nicht obdachlos oder mittellos gewesen war. Ihre Haut und ihr Haar wirkten sauber und gepflegt.
Das wiederum bedeutete, dass diese Frau jetzt irgendwo hätte sein müssen. Bei ihrer Familie. Bei Freunden. Bei Kollegen. Es bedeutete, dass sie vermisst wurde. Es bedeutete, dass es irgendwo in Philadelphia oder einer anderen Stadt ein Puzzle gab, dessen letztes fehlendes Teil diese Frau war.
Mutter. Tochter. Schwester. Freundin.
Opfer.
5.
Der Wind weht vom Fluss herüber, fegt über die gefrorenen Böschungen und bringt die tiefen Geheimnisse des Waldes mit sich. Moon prägt sich diesen Augenblick ein, um sich stets daran zu erinnern. Er weiß, dass am Ende nur die Erinnerung bleibt.
Moon steht in der Nähe und beobachtet den Mann und die Frau. Sie forschen nach, sie stellen Vermutungen an, sie machen sich Notizen. Der Mann ist groß und kräftig. Die Frau ist schlank und hübsch und clever.
Moon ist ebenfalls clever.
Der Mann und die Frau mögen viel zu sehen bekommen, doch sie können nicht sehen, was der Mond sieht. Jeden Abend geht er aufs Neue auf und erzählt Moon von seinen Reisen. Jede Nacht malt Moon ein Bild nach seinen Vorstellungen. Jede Nacht wird eine neue Geschichte erzählt.
Moon hebt den Blick zum Himmel. Die kalte Sonne versteckt sich hinter den Wolken.
Auch Moon ist unsichtbar.
Der Mann und die Frau tun ihre Arbeit, schnell und präzise. Sie haben Karen gefunden. Bald werden sie die roten Schuhe finden, und dann ist dieses Märchen erzählt.