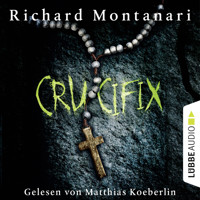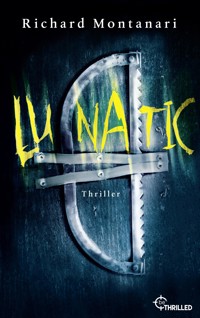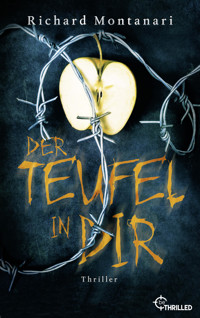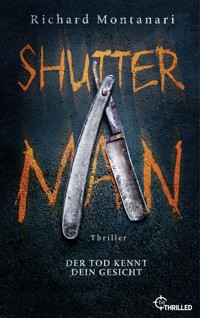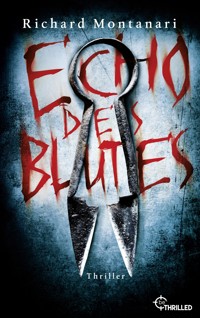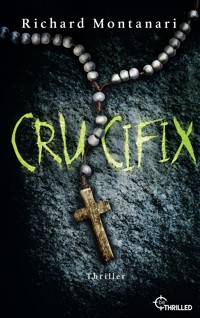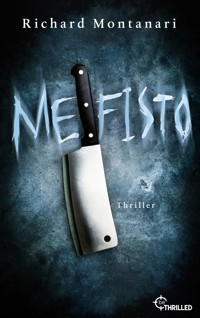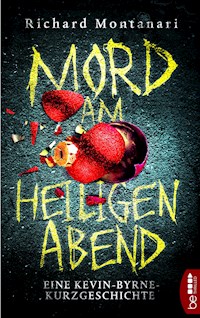Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lübbe Audio
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Spannende Thriller mit Byrne und Balzano
- Sprache: Deutsch
Das Spiel beginnt. Das Spielbrett: eine ganze Stadt. Die Spielzüge: tödlich.
Die Detectives Jessica Balzano und Kevin Byrne stehen vor einem Rätsel: In einem Keller wird die Leiche eines jungen Mädchens gefunden, Todesursache Ertrinken - doch weit und breit gibt es kein Wasser. Der einzige Hinweis ist ein Wort, gebildet aus vier Scrabble-Steinen: LUDO. Bald taucht eine weitere Tote auf, mit Säbeln durchbohrt - doch am Tatort gibt es keinen Tropfen Blut.
Die Detectives ahnen, dass es ein Muster hinter diesen mysteriösen Morden gibt - und dass der Mörder ein grausames Spiel spielt. Um ihn zu stoppen, müssen sie ihm um einen Zug voraus sein ...
»Ein gnadenlos fesselnder Thriller.« FRAnKFuRTER STADTKuRiER
Nichts für schwache Nerven! Die spannungsgeladenen Thriller des Bestsellerautors Richard Montanari um das Ermittlerduo Byrne und Balzano:
Band 1: Crucifix
Band 2: Mefisto
Band 3: Lunatic
Band 4: Septagon
Band 5: Echo des Blutes
Band 6: Der Teufel in dir
Band 7: Der Abgrund des Bösen
Band 8: Tanz der Toten
Band 9: Shutter Man
Band 10: Mord am Heiligen Abend
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:6 Std. 47 min
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Prolog
ERSTER TEIL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
ZWEITER TEIL
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
DRITTER TEIL
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
Über den Autor
Alle Titel des Autors bei beTHRILLED
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.
Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!
Dein beTHRILLED-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Die Detectives Jessica Balzano und Kevin Byrne stehen vor einem Rätsel: In einem Keller wird die Leiche eines jungen Mädchens gefunden, Todesursache Ertrinken – doch weit und breit gibt es kein Wasser. Der einzige Hinweis ist ein Wort, gebildet aus vier Scrabble-Steinen: LUDO. Bald taucht eine weitere Tote auf, mit Säbeln durchbohrt – doch am Tatort gibt es keinen Tropfen Blut.
Die Detectives ahnen, dass es ein Muster hinter diesen mysteriösen Morden gibt – und dass der Mörder ein grausames Spiel spielt. Um ihn zu stoppen, müssen sie ihm um einen Zug voraus sein …
Richard Montanari
SEPTAGON
Aus dem amerikanischen Englischvon Karin Meddekis
INDER DUNKELHEIT, in den schwarzblauen Tiefen der Nacht, hört er ein Raunen: leise, klagende Töne, die hinter der Holzvertäfelung, dem Sims und den ausgetrockneten, wurmstichigen Holzlatten hin und her huschen, zitternd und scharrend. Zuerst versteht er die Wörter nicht, so, als würden sie in einer fremden Sprache gesprochen, doch als die Abenddämmerung dem Morgengrauen weicht, erkennt er jede Stimme, jeden Ton und jeden Klang – wie eine Mutter, die ihr Kind auf einem vollen Spielplatz sofort an der Stimme erkennt.
In manchen Nächten hört er den Schrei, einen einzigen Schrei, der durch die Dielen nach oben schallt und ihn von Zimmer zu Zimmer verfolgt, die große Treppe hinunter und durch die Eingangshalle, durch die Küche und die Vorratskammer bis in die gesegnete Stille des Kellers. Dort, unter der Erde, unter den Gerippen Tausender Jahrhunderte begraben, akzeptiert er seine schrecklichen Sünden. Vielleicht ist es sogar die Feuchtigkeit, die anklagt – eisige Tropfen auf den Steinen, die wie Tränen auf Brokat schimmern.
Als die Erinnerungen lebendig werden, denkt er an Elise Beausoleil, das Mädchen aus Chicago. Er erinnert sich an ihren Stolz, ihre geschickten Hände und daran, wie sie in den letzten Sekunden verhandelt hat, als wäre sie noch immer das hübscheste Mädchen auf dem Highschool-Ball. Elise Beausoleil in ihren hohen Stiefeln und dem Trenchcoat. Sie hatte gerne gelesen. Jane Austen sei ihre Lieblingsschriftstellerin, hatte sie gesagt, dicht gefolgt von Charlotte Brontë. In ihrer Handtasche fand er ein vergilbtes Exemplar von Villette.
Er hielt Elise in der Bibliothek gefangen.
Manchmal erinnert er sich an Monica Renzi, an ihre dicken Arme und Beine und an die Körperbehaarung, an den wohligen Schauer des Hochgefühls, als Elise nach dem Warum fragte und er überschwänglich die Hand hob wie eine ihrer spöttelnden Mitschülerinnen. Monica war die Tochter eines Ladenbesitzers aus Scranton und bevorzugte rote Kleidung. Schüchtern und jungfräulich. Monica hatte ihm einmal gesagt, er erinnere sie an einen jungen Banker in einem dieser alten Filme, die sie sich samstagabends mit ihrer Großmutter anschaute.
Das Solarium war Monicas Zimmer.
Er erinnert sich an den Nervenkitzel der Jagd, an den bitteren Kaffee, den er in Bahnhöfen und an Endhaltestellen von Bussen trank, und an die Hitze, den Lärm und Staub der Vergnügungsparks, an die Nationalfeiertage, die Jahrmärkte und die kalten Vormittage im Auto. Er erinnert sich an die Erregung auf den Fahrten durch die Stadt, die zarte Beute in Händen, als das verlockende Rätsel beginnt.
In der winzigen Zeitspanne zwischen Licht und Schatten, im grauen Beichtstuhl der Morgendämmerung, erinnert er sich manchmal an alles.
Jeden Morgen tritt im Haus Stille ein. Der Staub legt sich, die Schatten weichen, die Stimmen verhallen.
An diesem Morgen duscht er, zieht sich an, frühstückt und geht durch die Eingangstür hinaus auf die Veranda. Die ersten Knospen sprießen, und die Narzissen am Gartenzaun begrüßen ihn. Ein Hauch von Frühling liegt in der Luft.
Hinter ihm erhebt sich ein stattliches viktorianisches Haus, dessen Schönheit längst verblüht ist. Die Gärten rings um das Haus sind überwuchert, die Gehwege von Unkraut bewachsen, die grün angelaufenen Dachrinnen voller Schmutz und verrottetem Laub. Dieses Haus ist das Museum seines Lebens, zu einer Zeit erbaut, als solchen herrschaftlichen Häusern mit eigenem Charakter noch Namen gegeben wurden, die in das Bewusstsein der Gegend, in die Seele der Stadt und die Geschichte der Region eingingen.
An diesem verrückten Ort, wo Mauern sich bewegen und Treppen ins Nirgendwo führen, wo man durch Wandschränke in verborgene Werkstätten gelangt und Porträts einander mit ernsten Mienen in der mittäglichen Stille beobachten, kennt er jeden Korridor, jede Türangel, jede Schwelle, jedes Fenster, jedes Ornament.
Dieser Ort heißt Faerwood. In jedem dieser Räume wohnt eine rastlose Seele. Und in jeder Seele wohnt ein Geheimnis.
Er steht inmitten eines belebten Einkaufszentrums und nimmt die unterschiedlichen Düfte wahr, die die Luft erfüllen: die Gastronomiemeile mit ihren unzähligen Schätzen; das Kaufhaus mit den Lotionen und Pudern und scheußlichen Toilettenartikeln; der Duft junger Frauen. Er beobachtet das übergewichtige Paar in den Zwanzigern, das einen Kinderwagen schiebt, und bedauert die unmerklich ältere Frau.
Um zehn vor neun am Abend huscht er in ein kleines Geschäft. Es ist hell erleuchtet, und die Luft ist noch immer heiß. Die Regale sind vom Boden bis zur Decke mit Keramikfiguren und Rosen aus Kunstseide voll gepackt. Eine ganze Wand wird von Ständern eingenommen, in denen Glückwunschkarten stecken.
In dem Geschäft ist nur eine Kundin. Er ist ihr schon den ganzen Abend gefolgt, hat die Traurigkeit in ihren Augen gesehen, die Last auf ihren Schultern bemerkt und die Müdigkeit in ihren Schritten.
Sie ist die Ertrinkende.
Langsam nähert er sich ihr, wählt ein paar Karten aus, kichert leise, als er sie betrachtet, und stellt sie zurück in den Ständer. Er schaut sich um. Niemand beobachtet sie.
Es ist Zeit.
»Du siehst verwirrt aus«, sagt er.
Sie hebt den Blick. Sie ist groß und dünn. Ihre Haut hat eine wunderschöne Blässe. Ihre aschblonde Haarpracht ist lässig hochgesteckt und wird von einer weißen Plastikspange gehalten. Ihr Hals ist wie aus Elfenbein geschnitzt. Sie trägt einen lila Rucksack.
Sie antwortet nicht. Er hat sie eingeschüchtert.
Geh weiter.
»Die Auswahl ist einfach zu groß«, sagt sie nervös. Er hat damit gerechnet. Schließlich ist er ein Unbekannter auf ihrem Spielbrett fremder Figuren. Sie kichert und kaut an einem Fingernagel. Süß. Er schätzt sie auf siebzehn. Das beste Alter.
»Sag mir, für welchen Anlass«, bittet er sie. »Vielleicht kann ich helfen.«
Argwohn flackert in ihren Augen. Jetzt geht sie auf Distanz. Sie wirft einen Blick durch den Laden, um sich zu vergewissern, dass niemand zuhört. »Na ja, ich ...«, beginnt sie. »Mein Freund ist ...«
Schweigen.
»Er ist was?«, fragt er, um das Gespräch in Gang zu halten.
Zuerst will sie es ihm nicht sagen, dann aber redet sie doch. »Er ist eigentlich gar nicht mein Freund. Er betrügt mich.« Sie steckt eine Haarsträhne hinters Ohr. »Na ja ... so richtig betrügt er mich nicht. Noch nicht.« Sie wendet sich zum Gehen, dreht sich dann aber wieder um. »Er hat sich mit Courtney verabredet, meiner besten Freundin. Diese Schlampe.« Ein roter Schimmer erscheint auf ihrem makellosen Teint. »Ich weiß gar nicht, warum ich Ihnen das alles erzähle.«
Heute Abend ist er leger gekleidet: verwaschene Jeans, schwarzes Leinenjackett, Mokassins, ein bisschen mehr Gel im Haar als sonst, eine silberne Halskette mit einem ägyptischen Schlaufenkreuz, dem Symbol des Lebens, eine schicke Brille. Er sieht noch ziemlich jung aus. Außerdem flößt er anderen Menschen Vertrauen ein. So war es schon immer.
»So ein Schuft.«
Das falsche Wort? Nein. Sie lächelt. Eine Siebzehnjährige, reif für ihr Alter.
»Eher ein Idiot«, sagt sie und kichert nervös. »Ein Volltrottel.«
Er beugt sich ein Stück zurück, vergrößert den Abstand zwischen ihnen um ein paar wichtige Zentimeter. Und schon entspannt sie sich. Sie ist zu dem Schluss gekommen, dass er keine Bedrohung darstellt.
»Glaubst du, eine ironische Karte wäre das Richtige?«
Sie denkt darüber nach. »Wahrscheinlich«, sagt sie. »Vielleicht. Ich weiß nicht. Ja, glaub schon.«
»Bringt er dich zum Lachen?«
Jungen, mit denen man sich anfreundet, tun das meistens. Sogar die, die ein bildschönes siebzehnjähriges Mädchen betrügen.
»Ja«, sagt sie. »Er ist ziemlich lustig. Manchmal.« Sie hebt den Blick, schaut ihm in die Augen. Ihm zerspringt beinahe das Herz. »Aber in letzter Zeit nicht mehr.«
»Ich finde die hier nicht schlecht«, sagt er. »Sie könnte genau das richtige Gefühl ausdrücken.« Er nimmt die Karte aus dem Ständer, betrachtet sie noch einmal kurz und reicht sie ihr dann. Die Karte ist ein bisschen gewagt. Durch sein Zögern will er ihrem Altersunterschied Rechnung tragen und ihr zu verstehen geben, dass er sich durchaus bewusst ist, ihr noch nie begegnet zu sein.
Sie nimmt die Karte, klappt sie auf, liest den Text und muss lachen. Sie legt eine Hand auf den Mund. Nur ein leises Prusten ist jetzt noch zu hören. Sie errötet verlegen.
In diesem Augenblick verschwimmt ihr Bild, wie er es jedes Mal erlebt. Ihr Gesicht zerfließt, als würde man es durch eine Fensterscheibe betrachten, über die Regen läuft.
»Die ist perfekt«, sagt sie. »Super. Danke.«
Er beobachtet sie, als sie zur nicht besetzten Ladenkasse und dann zur Videokamera schaut. Sie dreht der Kamera den Rücken zu, steckt die Karte in ihre Tasche und schaut ihn lächelnd an. Er kann sich keine reinere Liebe vorstellen.
»Ich brauche noch eine andere Karte«, sagt sie. »Aber ich weiß nicht, ob Sie mir da auch helfen können.«
»Du würdest dich wundern, was ich alles kann.«
»Sie ist für meine Eltern.« Sie stemmt die Hände in die Hüften. Erneut steigt Röte in ihr hübsches Gesicht, doch sie verblasst sofort wieder. »Ich bin nämlich ...«
Er hebt eine Hand, um sie zu unterbrechen. Es ist besser so. »Ich verstehe.«
»Echt?«
»Ja.«
»Wieso?«
Er lächelt. »Ich war auch mal so jung wie du.«
Sie öffnet den Mund, um zu antworten, schweigt dann aber.
»Es wird alles wieder gut«, sagt er. »Du wirst sehen. So ist es immer.«
Sie wendet kurz den Blick ab. Es scheint, als hätte sie soeben eine Entscheidung getroffen und als wäre ihr eine schwere Last von den Schultern genommen worden. Sie schaut ihn wieder an, lächelt traurig und sagt: »Danke.«
Anstatt etwas zu erwidern, schaut er sie nur liebevoll an. Die Deckenbeleuchtung zaubert einen goldenen Schimmer in ihr Haar.
Im nächsten Moment weiß er es.
Er wird sie in der Speisekammer gefangen halten.
Zehn Minuten später folgt er ihr unbemerkt auf den Parkplatz. Er achtet genau auf den Schatten, das Licht und das schwarzblaue Halbdunkel des Abends. Regen hat eingesetzt, ein leichter Nieselregen, und es sieht nicht so aus, als würde ein Schauer daraus.
Er blickt ihr nach, als sie die Straße überquert und sich unterstellt. Kurz darauf steigt sie in einen Bus, der zum Bahnhof fährt.
Er legt eine CD ein, und die Klänge von Vedrai, Carino erfüllen das Wageninnere. Sie erfreuen seine Seele, wieder einmal, und versüßen ihm den Augenblick, wie nur Mozart es vermag.
Er folgt dem Bus in die Stadt. Mit entflammtem Herzen nimmt er die Jagd wieder auf.
Sie ist Emma Bovary. Sie ist Elizabeth Bennet. Sie ist Cassiopeia und Cosette.
Sie gehört ihm.
ERSTER TEIL
DAS SCHATTENHAUS
Ein geräumiges und vornehmes Haus –aber tot, tot, tot.
WALTWHITMAN
1.
DIETOTEJUNGE FRAU saß in einer Glasvitrine, eine blasse, zarte Rarität, von einem Wahnsinnigen auf ein Regal gesetzt. Als sie noch gelebt hatte, war sie eine hübsche junge Frau mit feinem blonden Haar und kobaltblauen Augen gewesen. Im Tod flehten ihre Augen um Gnade und ausgleichende Gerechtigkeit.
Das Letzte, was diese Augen gesehen hatten, war ein Ungeheuer.
Ihr Grab war ein stickiger Keller in einem leer stehenden Haus in den Badlands. Dieses fünf Quadratmeilen große, trostlose Gebiet zerstörten Lebens in Nord-Philadelphia erstreckte sich ungefähr von der Erie Avenue nach Süden bis zur Girard und von der Broad Street bis zum Fluss im Osten.
Die Tote hieß Caitlin Alice O’Riordan. Am Tag ihrer Ermordung war sie siebzehn Jahre alt.
Für die Detectives Kevin Byrne und Jessica Balzano von der Mordkommission des Philadelphia Police Departments begann damit die Arbeit an einem neuen Fall.
Bei der Mordkommission gab es drei Abteilungen – eine, die neue Fälle übernahm, eine zweite, die flüchtige Täter suchte, sowie die Sonderermittlung, die unter anderem ungelöste Fälle bearbeitete. Die Detectives der Sonderermittlung gehörten zum fünften Dezernat und waren eine Art Elitetruppe aus Ermittlern, die vom Captain aufgrund ihrer besonderen Fähigkeiten, ihrer hohen Aufklärungsrate und ihres kriminalistischen Geschicks ausgewählt worden waren. Eine Ermittlung in einem ungelösten Fall betrachteten sie als zweite und womöglich letzte Chance, ein Unrecht zu ahnden und einen Hurensohn zu schnappen, der ihren Kollegen beim ersten Versuch durch die Lappen gegangen war und der nun im Gefühl der Sicherheit selbstzufrieden grinsend durch die Straßen Philadelphias schlenderte. Eine Sonderermittlung war eine Kampfansage, die unmissverständlich zum Ausdruck brachte, dass der Staat Pennsylvania und die Stadt der brüderlichen Liebe noch eine Rechnung offen hatten.
Der Mordfall Caitlin O’Riordan war ein solcher ungelöster Fall – der erste Fall dieser Art, den Kevin Byrne und Jessica Balzano übernahmen.
Als die beiden vor dem Haus in der Achten Straße eintrafen, waren das gelbe Flatterband, das den Tatort absperrte, die Streifenwagen, die den Verkehr abriegelten, die blau-weißen Transporter der Spurensicherung und die Beamten, die den Eingang bewachten und alles protokollierten, bereits seit Monaten verschwunden.
Sie hatten die Berichte und das Autopsieprotokoll gelesen und sich die Fotos und Videoaufnahmen angeschaut. Und nun setzten sie sich auf die Fährte des Killers. Ihre Ermittlungen würden erst richtig beginnen, wenn sie den Raum betraten, in dem Caitlin O’Riordans Leiche gefunden worden war.
Als die ersten Ermittlungen aufgenommen worden waren – damals, vor vier Monaten –, hatte die Polizei das Gebäude versiegelt, die Türen ausgetauscht und mit Vorhängeschlössern versehen. Die Fenster wurden mit Sperrholz vernagelt und zusätzlich mit dicken Schrauben gesichert. Das Einfamilien-Eckhaus hatte oft den Besitzer gewechselt. Zuletzt war dort ein kleiner, schmuddeliger Gemischtwarenladen untergebracht gewesen, wo man Babynahrung, Chips, Windeln, Dosenfleisch, Zeitschriften und Lotteriescheine kaufen konnte. Doch der Verkaufsschlager des Ladens, sein Lebenselixier, waren jene drei Dinge gewesen, die ein Cracksüchtiger brauchte: Scheuerschwämme, Wegwerffeuerzeuge und einzeln verpackte Teerosen. Die Rosen wurden in langen schmalen Glasröhrchen verkauft, die zu Crackpfeifen zweckentfremdet wurden, kaum dass die Kunden den Laden verlassen hatten. Eine schnelle und einfache Methode, einen Crackstein zu verbrennen, wobei der Rauch durch die Stahlwolle der Scheuerschwämme gefiltert wurde. Alle Gemischtwarenläden in den Badlands führten diese Teerosen, was aus diesem Teil Nord-Philadelphias vermutlich den romantischsten Ort der Welt machte. Von den Teerosen wurden jeden Tag Hunderte verkauft.
Der Laden hatte vor gut drei Jahren dichtgemacht, und es hatte sich kein neuer Besitzer gefunden. Die Fassade des Gebäudes war noch immer leuchtend grün angestrichen, und auf dem Schaufenster stand noch die paradoxe Öffnungszeit:
Verkauf rund um die Uhr täglich von 12.00 – 20.00 Uhr
Jessica schloss das Vorhängeschloss am Eingang auf und schob das rostige Wellblechtor hoch. Dann trat sie ein, gefolgt von Byrne. Sofort schlug ihnen ein unangenehmer Geruch nach Schimmel und Moder entgegen, vermischt mit den kreidigen Ausdünstungen von feuchtem Putz. Die Temperatur draußen betrug an diesem Tag im späten August fast dreißig Grad. Im Gebäude waren es vierzig Grad oder mehr.
Abgesehen von einer dicken Staubschicht war das Erdgeschoss bemerkenswert sauber und aufgeräumt. Der größte Teil des Mülls war längst als Beweismaterial gesichert und abtransportiert worden.
Linker Hand stand der Ladentisch. Dahinter befand sich eine Reihe leerer Regale, über denen Schilder hingen – Kools, Budweiser, Skoal – sowie eine Tafel, auf der ein halbes Dutzend chinesische Gerichte zum Mitnehmen angeboten wurden.
Die Kellertreppe befand sich im hinteren Teil des Hauses auf der linken Seite. Ehe Jessica und Kevin die Treppe hinunterstiegen, knipsten sie ihre Taschenlampen an. Es gab hier keinen Strom, kein Gas, kein Wasser. Die Versorgungsbetriebe hatten sämtliche Lieferungen eingestellt. Bleiche Sonnenstrahlen, die hier und da durch die Ritzen zwischen den Sperrholzbrettern fielen, mit denen die Fenster vernagelt waren, wurden von der stummen Dunkelheit verschluckt.
Der Raum, in dem man Caitlin O’Riordan gefunden hatte, lag am Ende des Kellers. Vor vielen Jahren waren die kleinen Fenster auf Höhe der Straße zugemauert worden. Seitdem herrschte hier unten völlige Dunkelheit.
In einer Ecke des Raumes stand eine Glasvitrine, ein handelsüblicher Getränkekühlschrank, in dem Bier, Limo und Milch gekühlt wurden. Er war über eins achtzig hoch, mit Seitenwänden aus Stahl. In diesem gläsernen Sarg war Caitlins Leichnam entdeckt worden. Sie hatte auf einem Holzstuhl gesessen und mit weit aufgerissenen Augen ins Nichts gestarrt. Zwei Jugendliche hatten hier unten nach Kupferdraht gesucht, den sie verscherbeln konnten, und die Leiche dabei zufällig entdeckt.
Byrne zog seinen Notizblock und einen Fineliner aus der Tasche. Er klemmte sich die Taschenlampe unter den Arm und fertigte eine detaillierte Skizze des unterirdischen Raumes an, wie es den Ermittlungsbeamten in einem Mordfall vorgeschrieben war. Obwohl auch Fotos und Videoaufnahmen vom Tatort gemacht wurden, stützten sich während der Ermittlungen sämtliche Polizei- und Justizbeamten – bis hin zu den Richtern während der Verhandlungen – auf die Tatortskizze. In der Regel fertigte Byrne diese Skizze an. Jessica gab zu, nicht einmal mit einem Zirkel einen Kreis ziehen zu können.
»Ich bin oben, falls du mich brauchst«, sagte sie nun.
Byrne hob den Blick. Die Dunkelheit des Raumes lag wie ein schwarzer Schleier über seinen breiten Schultern. »Ist gut, Jess.«
Jessica breitete die Akten auf dem Ladentisch aus. Sie war dankbar, dass das helle Sonnenlicht durch die geöffnete Tür fiel, und froh über die leichte Brise, die in den Laden wehte.
Auf der ersten Seite der Akte war ein großes Foto von Caitlin, ein Farbfoto in DIN A4. Immer wenn Jessica dieses Foto betrachtete, musste sie an den Film Freiwurf mit Gene Hackman denken, doch es wäre ihr schwergefallen, den Grund dafür zu nennen. Vielleicht, weil das Mädchen auf dem Foto aus dem ländlichen Pennsylvania stammte. Vielleicht, weil das Gesicht des Mädchens eine Offenheit spiegelte, ein Vertrauen, wie es in den USA der Fünfzigerjahre verankert gewesen zu sein schien – lange vor Caitlins Geburt, ihrem Leben und ihrem Tod –, eine Zeit, als Mädchen noch Sattelschuhe und Kniestrümpfe, Strickwesten und Blusen mit Peter-Pan-Kragen trugen.
So sehen Jugendliche heute nicht mehr aus, dachte Jessica.
Nicht in Zeiten von MySpace und Katalogen von Abercrombie & Fitch und Regenbogenpartys. Nicht in der heutigen Zeit, in der sie sich eine Tüte Doritos und eine Cola kaufen und in Lancaster County in einen Bus steigen konnten, um anderthalb Stunden später in einer Stadt auszusteigen, in der sie sich vollkommen verlieren würden – eine vertrauensvolle Seele, die niemals eine Chance bekam.
Schätzungen zufolge war Caitlin zwischen Mitternacht und sieben Uhr morgens am 2. Mai gestorben. Genauer konnte der Gerichtsmediziner den Todeszeitpunkt nicht bestimmen, da Caitlin seit mindestens achtundvierzig Stunden tot gewesen war, als ihr Leichnam gefunden wurde. Das Mädchen wies keine äußeren Verletzungen auf, keine Hautrisse oder Abschürfungen, keine Spuren, die darauf hindeuteten, dass es gefesselt worden war, keine Wunden, die darauf schließen ließen, dass es mit seinem Angreifer gekämpft hatte. Unter den Fingernägeln waren keine Hautpartikel oder anderes organisches Material entdeckt worden. Außerdem gab es keinen Hinweis auf sexuellen Missbrauch.
Und Caitlin war vollständig bekleidet gewesen. Sie trug eine ausgefranste Jeans, Reeboks, eine schwarze Jeansjacke, ein weißes T-Shirt sowie einen lilafarbenen Nylon-Rucksack. An ihrem Hals hing eine Kette mit einem silbernen Claddagh-Anhänger. Sie war zwar nicht besonders wertvoll, doch dass die Tote sie trug, sprach gegen eine etwaige Theorie, dass sie Opfer eines außer Kontrolle geratenen Raubmordes geworden war.
Dafür sprach auch die Todesursache, denn Caitlin O’Riordan war ertrunken. Mordopfer in Nord-Philadelphia starben normalerweise nicht auf diese Weise. Sie wurden erschossen, erstochen, mit einer Machete in Stücke gehauen, mit einem Baseballschläger zu Tode geprügelt, mit einem Brecheisen erschlagen, von einem Laster überfahren, mit einem Eispickel abgestochen, mit Benzin übergossen und bei lebendigem Leibe verbrannt ... Das alles passierte, und noch mehr. Jessica hatte schon einiges erlebt. Bei einem Mord in North Philly, in dem sie ermittelt hatte, war das Opfer mit einem verrosteten Rasenkantenschneider erschlagen worden.
Aber ertränkt? Selbst wenn ein Mordopfer im Delaware River schwamm, war der Tod zumeist durch eine der genannten Mordmethoden herbeigeführt worden.
Jessica überflog den Laborbericht. Das Wasser in Caitlins Lungen war sorgfältig untersucht worden. Es enthielt Fluoride, Chlor, Zinkorthophosphate, Ammoniak sowie Spuren einer halogenierten Säure. Dem Bericht beigefügt waren zwei Seiten mit grafischen Darstellungen und Diagrammen. Den Untersuchungen des kriminaltechnischen Labors und des Gerichtsmediziners zufolge war Caitlin nicht im Delaware oder im Schuylkill River ertrunken, ebenso wenig im Wissahickon Creek oder in irgendeinem der vielen Brunnen, für die Philadelphia bekannt war. Auch nicht in einem Schwimmbad oder in einem privaten Swimmingpool.
Caitlin war in ganz normalem Leitungswasser ertrunken.
Bei den ersten Ermittlungen vor vier Monaten hatte man das Wasserwerk von Philadelphia kontaktiert und erfahren, dass das Wasser in Caitlins Lungen nach Aussage der Umweltbehörde mit größter Wahrscheinlichkeit aus der Stadt der brüderlichen Liebe stammte. Die drei Aufbereitungsanlagen in Baxter, Belmont und Queen Lane hatten wegen eines Öltanker-Unfalls im März technische Modifizierungen bei der Trinkwassergewinnung vorgenommen, sodass die entsprechenden Daten vorlagen.
In diesem Gebäude hier gab es kein fließendes Wasser. Es gab keine Badewannen, keine Plastikwannen, keine Eimer, kein Aquarium und keine Kanister – kein einziges Gefäß, das groß genug gewesen wäre, um einen Menschen darin zu ertränken.
Im Roundhouse, dem Polizeipräsidium an der Ecke Achte und Race Street, hatten die Detectives sogar darüber diskutiert, ob es sich um einen »richtigen« Mord handelte. Jessica und Byrne gingen zwar davon aus, räumten jedoch zumindest die Möglichkeit ein, dass Caitlin bei einem Unfall ertrunken sein könnte, vielleicht in einer Badewanne, und dass ihr Leichnam nach dem Unfall an den Ort transportiert worden war, an dem man ihre Leiche aufgefunden hatte. In diesem Fall hätten sie es mit Leichenschändung und nicht mit Mord zu tun.
Eines jedoch stand zweifelsfrei fest: Caitlin O’Riordan war nicht freiwillig hierhergekommen.
Am Fundort wurde keine Handtasche gefunden, keine Brieftasche – nichts, um die Identität des Opfers zu bestimmen. Caitlin war anhand des Fotos identifiziert worden, das vom FBI auf seiner Website veröffentlicht worden war.
Caitlin war die ältere der beiden Töchter von Robert und Marilyn O’Riordan aus Millersville, Pennsylvania, einem Ort mit etwa achttausend Einwohnern, fünf Meilen südwestlich von Lancaster. Caitlins zwei Jahre jüngere Schwester hieß Lisa.
Ihr Vater, Robert O’Riordan, betrieb ein eigenes kleines, gutbürgerliches Restaurant an der George Street in der Stadtmitte von Millersville. Marilyn, die Mutter, war Hausfrau und ehemalige Schönheitskönigin eines Nachbarortes. Beide engagierten sich in der Kirchengemeinde. Sie waren zwar nicht reich, besaßen aber ein schmuckes Haus in einer ruhigen Seitenstraße.
Caitlin O’Riordan war von zu Hause weggelaufen.
Am 1. April hatte Robert O’Riordan eine Notiz von seiner Tochter gefunden. Caitlin hatte sie mit rotem Filzstift auf Briefpapier geschrieben, das mit einem Hundemotiv, Scottish Terriern, bedruckt war. Die O’Riordans hatten zwei Hunde dieser Rasse. Das Mädchen hatte die Notiz in seinem Zimmer an den Spiegel geklebt.
Liebe Mom, lieber Dad (und Lisa natürlich, Entschuldigung, Lisey ☺),
es tut mir leid, aber ich muss es tun.
Ich pass auf mich auf. Und ich komme zurück. Versprochen.
Ich schicke euch eine Karte.
Am 2. April wurden zwei Polizeibeamte des Millersville Police Departments zum Haus der O’Riordans geschickt. Als sie dort eintrafen, wurde Caitlin seit neunzehn Stunden vermisst. Die beiden Polizeibeamten fanden keine Hinweise auf eine Entführung oder ein Gewaltverbrechen. Sie nahmen die Aussagen der Familie und der Nachbarn auf, die im Umkreis von einer Viertelmeile wohnten, und schrieben einen Bericht. Der Fall ging durch die unterschiedlichen Abteilungen. Nach zweiundsiebzig Stunden wurde er an das FBI-Büro in Philadelphia weitergeleitet.
Trotz einer – wenn auch sehr bescheidenen – Belohnung und der Tatsache, dass das Foto des Mädchens in den Lokalzeitungen und auf verschiedenen Websites veröffentlicht wurde, gab es auch zwei Wochen nach Caitlins Verschwinden noch keinen Hinweis darauf, wo sie sich aufhalten könnte oder was aus ihr geworden war. Sie war spurlos verschwunden.
Als der April zu Ende ging, gab es keinerlei Ermittlungsansätze mehr. Die Behörden gingen davon aus, dass Caitlin O’Riordan einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen war.
Am 2. Mai bestätigten sich die schlimmsten Befürchtungen.
Der leitende Ermittler im Fall Caitlin O’Riordan, Detective Rocco Pistone, war vor zwei Monaten in den Ruhestand getreten. Im gleichen Monat starb sein Partner Freddy Roarke an einem Schlaganfall, als er sich ein Pferderennen im Philadelphia Park anschaute. Er brach genau vor der Absperrung zusammen, nur wenige Meter von der Ziellinie entfernt. Die Stute mit dem poetischen Namen Heaven’s Eternity, auf die Freddy zwanzig Dollar gesetzt hatte, siegte mit drei Längen Vorsprung. Freddy Roarke holte seinen Gewinn nie ab.
Pistone und Roarke waren nach Millersville gefahren und hatten Caitlins Schulkameraden und Freunde, ihre Lehrer und Nachbarn und die Gemeindemitglieder befragt. Niemand erinnerte sich, dass Caitlin jemals einen Freund in Millersville oder Philadelphia oder eine Internetbekanntschaft erwähnt hatte. Die Detectives befragten auch einen siebzehnjährigen Jungen aus Millersville namens Jason Scott. Scott sagte aus, dass sie sich zum Zeitpunkt von Caitlins Verschwinden gelegentlich getroffen hatten, wobei er das Wort »gelegentlich« hervorhob. Er erklärte, Caitlin habe die Freundschaft viel ernster genommen als er. Scott gab außerdem zu Protokoll, dass er zum Zeitpunkt von Caitlins Ermordung in Arkansas gewesen sei, wo er seinen Vater besucht habe. Die Detectives bestätigten diese Aussage. Der Fall konnte nicht gelöst werden.
Auch im August 2008 gab es noch keine Verdächtigen, keine Spuren und keine neuen Hinweise. Jessica blätterte die letzte Seite der Akte um und fragte sich zum hundertsten Mal in den letzten zwei Tagen: Warum ist das Mädchen nach Philadelphia gefahren? War es bloß der Reiz der Großstadt?
Noch wichtiger aber war die Frage, wo Caitlin sich in den letzten dreißig Tagen aufgehalten hatte.
Um kurz nach elf Uhr klingelte Jessicas Handy. Es war ihr Chef, Sergeant Ike Buchanan. Byrne war mit seiner Skizze des Kellers fertig und verließ gerade das Haus, um auf dem Bürgersteig frische Luft zu schnappen. Jessica schaltete den Lautsprecher ihres Handys ein.
»Was gibt’s, Chef?«, fragte sie.
»Wir haben ein Geständnis«, sagte Buchanan.
»In unserem Fall?«
»Ja.«
»Ich verstehe nicht ... wer?«
»Wir haben einen Anruf auf der anonymen Hotline bekommen. Der Anrufer hat der diensthabenden Kollegin gesagt, er habe Caitlin O’Riordan getötet und wolle sich stellen.«
Die anonyme Hotline war eine relativ neue Einrichtung der Polizeibehörde, um die Bürger nach dem Motto »Gemeinsam gegen das Verbrechen« stärker in die Verbrechensbekämpfung einzubeziehen. Ziel war es, den Bürgern von Philadelphia die Möglichkeit zu bieten, anonym mit der Polizei in Verbindung zu treten, ohne befürchten zu müssen, auf irgendeine Weise mit Kriminellen in Kontakt zu kommen. Manche Leute benutzten die Leitung auch als Beichtstuhl.
»Ich bitte Sie, Chef, so was passiert doch ständig«, sagte Jessica. »Besonders in einem Fall wie diesem.«
»Dieser Anruf war anders.«
»Anders? Inwiefern?«
»Erstens wusste der Anrufer Dinge über den Fall, die nie an die Öffentlichkeit gegeben wurden. Er hat gesagt, dass an der Jacke des Opfers ein Knopf fehle. Der dritte von unten.«
Jessica nahm zwei Tatortfotos des Opfers zur Hand. Tatsächlich fehlte an Caitlins Jacke ein Knopf – der dritte von unten.
»Stimmt, der Knopf fehlt«, sagte Jessica. »Aber vielleicht hat der Anrufer die Tatortfotos gesehen, oder er kennt jemanden, der sie gesehen hat. Woher wollen wir wissen, dass seine Informationen aus erster Hand sind?«
»Er hat uns den Knopf geschickt.«
Jessica warf ihrem Partner einen Blick zu.
»Er war heute Morgen in der Post«, fuhr Buchanan fort. »Wir haben ihn ins Labor gegeben. Er wird zurzeit untersucht, aber Tracy meint, es bestehe nicht der geringste Zweifel. Es ist der Knopf von Caitlins Jacke.«
Tracy McGovern war die stellvertretende Leiterin des kriminaltechnischen Labors.
»Wer ist der Mann?«, fragte Jessica.
»Er heißt Jeremia Crosley. Wir haben den Namen überprüft. Es liegt nichts gegen ihn vor. Er hat gesagt, wir könnten ihn an der Ecke Zweite und Diamond verhaften.«
»Und die genaue Adresse?«
»Eine genaue Adresse hat er nicht genannt. Er sagte, wir würden das Haus an der roten Tür erkennen.«
»Eine rote Tür? Was zum Teufel bedeutet das?«
»Das werden Sie herausfinden«, sagte Buchanan. »Rufen Sie mich an, wenn Sie da sind.«
2.
DER AUGUSTIST der grausamste Monat, überlegte Jessica.
Für T. S. Eliot war der April der grausamste Monat, aber der Dichter war auch nie Detective der Mordkommission in Philly gewesen.
Im April gibt es noch Hoffnung. Blumen. Regen. Vögel. Die Phillies. Immer die Phillies. Zehntausend Niederlagen, aber es blieben doch die Phillies. Der April bedeutete, dass es in gewissem Maße eine Zukunft gab.
Der August hingegen hat nur die Hitze zu bieten, sonst nichts. Eine unerbittliche, nervtötende Hitze, die einem fast den Verstand raubt. Diese feuchte, unangenehme Hitze, die sich wie eine modrige Plane über die Stadt legt und alles mit Schweiß, Gestank, Grausamkeit und Aggressionen überzieht. Eine Schlägerei im März ist im August ein Mord.
In den zehn Jahren, die Jessica diesen Job nun schon machte – die ersten vier Jahre als Streifenbeamtin im dritten Revier –, hatte sie stets das Gefühl gehabt, dass der August der schlimmste Monat des Jahres war.
Sie standen an der Ecke Zweite und Diamond, mitten in den Badlands. Mindestens die Hälfte der Gebäude des Straßenzuges waren mit Brettern vernagelt oder wurden zurzeit renoviert. Es war keine rote Tür zu sehen, nichts, das Red Door Tavern oder ähnlich hieß, kein Werbeplakat für ein Red-Lobster-Fischrestaurant oder für Pella-Türen, kein Schild in einem Fenster, das ein Produkt mit einem Namen anbot, das die Wörter rot oder Tür enthielt.
Niemand stand an der Ecke und wartete auf sie.
Bald hatten sie sämtliche Häuserblocks in verschiedenen Richtungen abgeklappert. Den einzigen Weg, den sie noch nicht eingeschlagen hatten, war die Zweite Straße in südliche Richtung.
»Warum tun wir das?«, fragte Jessica.
»Der Boss sagt, wir sollen es tun, also tun wir’s.«
Sie gingen die Zweite einen halben Block weit in südliche Richtung hinunter. Auch hier gab es jede Menge leerer Ladenlokale und verfallene Häuser. Sie kamen an einer Hinterhofwerkstatt mit gebrauchten Autoreifen, einem ausgebrannten Pkw und einem aufgebockten Kleinlaster vorbei; daneben befand sich ein kubanisches Restaurant.
Die andere Straßenseite bot ein graues Einerlei aus heruntergekommenen Reihenhäusern, die zwischen Sandwichbuden, Perückenläden und Nagelstudios eingequetscht waren. Einige Geschäfte waren geöffnet; die meisten jedoch hatten ihren Betrieb für immer eingestellt. An allen Eingängen, die sämtlich mit verrosteten Gittern versehen waren, hingen verblasste, handgeschriebene Schilder. In den oberen Stockwerken waren mehrere zerbrochene Fensterscheiben mit Bettlaken verhängt.
Nord-Philadelphia, dachte Jessica. Gott schütze Nord-Philadelphia.
Als sie an einer Brachfläche vorbeikamen, die von einer Bretterwand umschlossen wurde, blieb Byrne stehen. Die schiefe Wand, die aus zusammengenageltem Sperrholz, verrostetem Metall und Plastikplanen bestand, war mit Graffiti übersät. An einem Ende befand sich eine leuchtend rote Tür, die mit Draht an einem Pfosten befestigt war. Die Tür sah aus, als wäre sie vor Kurzem gestrichen worden.
»Jess«, sagte Byrne. »Schau mal.«
Jessica trat ein paar Schritte zurück. Sie sah auf die Tür und warf dann einen Blick über die Schulter. Sie und Byrne waren fast einen ganzen Häuserblock von der Diamond Street entfernt. »Das hat doch nichts zu bedeuten, oder?«
»Dieser Typ soll doch gesagt haben, wir könnten ihn in der Nähe der Zweiten und Diamond hopsnehmen und dass wir das Haus an einer roten Tür erkennen. Und das ist definitiv eine rote Tür. Die einzige weit und breit.«
Sie gingen ein paar Meter weiter Richtung Süden, bis sie zu einer Stelle kamen, wo die Mauer niedriger war, sodass sie hinüberspähen konnten. Das Grundstück sah aus wie alle Brachflächen in Philadelphia – Unkraut, Steine, Reifen, Plastiktüten, verrostete Elektrogeräte, die obligatorische ausrangierte Toilette.
»Siehst du hier irgendwo einen Killer herumstehen?«, fragte Jessica.
»Keinen einzigen.«
»Ich auch nicht. Sollen wir wieder gehen?«
Byrne dachte kurz nach. »Ich sag dir was. Wir drehen eine Runde. Dann können wir wenigstens sagen, wir hätten unsere Pflicht getan.«
Sie gingen bis zur Ecke, umrundeten die Brachfläche und liefen zur Rückseite bis zu einem verrosteten Maschendrahtzaun, der das unbebaute Grundstück von einer Gasse trennte. Eine Ecke des Zauns war aufgeschnitten und aufgerollt. Darüber hingen drei Paar alte, an den Schnürsenkeln zusammengebundene Turnschuhe über einem Elektrokabel.
Jessica blickte auf das Grundstück. An der Mauer des Gebäudes auf der Westseite, wo einst ein bekannter Musikladen untergebracht gewesen war, standen ein paar ausrangierte Backsteinpaletten, eine Leiter mit nur noch drei Sprossen sowie mehrere defekte Elektrogeräte. Jessica beschloss, die Sache schnell hinter sich zu bringen. Byrne zog den Maschendrahtzaun hoch, worauf Jessica sich duckte und durch die Lücke kroch. Ihr Partner folgte.
Die beiden Detectives schauten sich auf dem Grundstück um. Byrne nahm die linke Hälfte, Jessica die rechte. Fünf Minuten später trafen sie sich in der Mitte. Die Sonne stand hoch am Himmel und brannte unbarmherzig. Der Nachmittag war bereits angebrochen.
»Nichts?«, fragte Jessica.
»Nichts.«
Jessica zog ihr Handy aus der Tasche. »Okay«, sagte sie. »Jetzt bin ich neugierig. Ich will den Anruf des angeblichen Killers auf unserer Hotline hören.«
Zwanzig Minuten später traf Detective Joshua Bontrager ein. Er hatte einen Kassettenrekorder mitgebracht.
Josh Bontrager war erst seit achtzehn Monaten bei der Mordkommission, hatte seine Qualitäten jedoch schon unter Beweis gestellt. Er brachte Begeisterungsfähigkeit und die unverbrauchte Energie eines jungen Mannes mit auf die Straße. Doch sein Lebenslauf hatte noch etwas anderes zu bieten – etwas, das fast jeder im Department als einzigartig und beeindruckend betrachtete. Niemand in der Mordkommission des Philadelphia Police Departments – und vermutlich in keiner anderen Mordkommission im Bundesstaat – konnte damit aufwarten.
Joshua Bontrager stammte aus einer Amish-Familie.
Er war vor Jahren aus der Kirche ausgetreten und aus keinem anderen Grunde nach Philadelphia gekommen, aus dem auch andere Leute die Berks County oder die Lancaster County verließen: Er wollte in der Stadt sein Glück versuchen. Josh wurde Cop und arbeitete ein paar Jahre bei der Verkehrspolizei, ehe er – damals noch vorübergehend – zur Mordkommission versetzt worden war, um bei Nachforschungen zu helfen, die die Ermittler den Schuylkill River hinauf bis ins ländliche Berks geführt hatte. Bontrager war bei den Ermittlungen angeschossen worden, erholte sich aber vollständig. Und er hatte sich so hervorragend geschlagen, dass die Vorgesetzten beschlossen, ihn in der Mordkommission zu behalten.
Jessica erinnerte sich an den Tag, als sie Josh zum ersten Mal gesehen hatte: Hose und Anzugjacke passten nicht zusammen, seine Frisur sah aus, als wäre er unter einen Rasenmäher geraten, und seine Schuhe waren klobig und ungeputzt. Inzwischen trug Bontrager einen modernen Haarschnitt und schmucke Anzüge, und er legte das Verhalten eines alten Hasen bei der Mordkommission an den Tag.
Auch wenn Josh Bontrager ein echter Städter geworden war, würde er den Ruf des ersten Amish-Cops in der Geschichte Philadelphias niemals loswerden.
Bontrager stellte den Kassettenrekorder auf einen verrosteten Grill, der aus einem 250-Liter-Fass und einem alten Rost bestand und mitten auf der Brachfläche aufgestellt war. Ein paar Sekunden später hatte er das Band zurückgespult. »Seid ihr bereit?«
»Es kann losgehen«, sagte Jessica.
Bontrager drückte auf PLAY.
»Hotline, Philadelphia Police Department«, sagte eine Polizistin.
»Ja, hallo, mein Name ist Jeremia Crosley. Ich habe Informationen für Sie, die Ihnen bei einem Mordfall helfen könnten, in dem Sie ermitteln.«
Es war die Stimme eines gebildeten weißen Mannes zwischen dreißig und vierzig. Der Akzent war typisch für Philadelphia, doch es schimmerte noch etwas anderes durch.
»Könnten Sie Ihren Nachnamen bitte buchstabieren, Sir?«
Der Mann buchstabierte ihn.
»Würden Sie mir Ihre Adresse nennen?«
»2097 Dodgson Street.«
»Wo ist das bitte?«
»In Queen Village. Aber da bin ich jetzt nicht.«
»Um welchen Fall handelt es sich?«
»Den Fall Caitlin O’Riordan.«
»Fahren Sie bitte fort, Sir.«
»Ich habe sie umgebracht.«
An dieser Stelle atmete jemand kurz und tief ein. Ob der Anrufer oder die Polizistin, war nicht zu erkennen. Jessica hätte gewettet, dass es die Polizistin gewesen war. Selbst ein Cop, der diesen Job schon vierzig Jahre machte und in Tausenden von Fällen ermittelt hatte, hatte solche Worte vermutlich noch nie gehört.
»Und wann haben Sie die Tat verübt, Sir?«
»Im Mai dieses Jahres.«
»Erinnern Sie sich an das genaue Datum?«
»Ich glaube, es war der zweite Mai.«
»Erinnern Sie sich an die Tageszeit?«
»Daran erinnere ich mich nicht.«
Daran erinnere ich mich nicht, dachte Jessica. Er hätte auch einfach »nein« sagen können. Sie machte sich eine Notiz.
»Wenn Sie Zweifel haben, dass ich die Wahrheit sage, kann ich Ihnen einen Beweis liefern.«
»Und welchen, Sir?«
»Ich habe etwas von ihr.«
»Sie haben etwas?«
»Ja. Einen Knopf von ihrer Jacke. Der dritte von unten. Ich habe Ihnen den Knopf geschickt. Er müsste heute in der Post sein.«
»Wo sind Sie jetzt, Sir?«
»Das sage ich Ihnen gleich. Ich brauche aber eine Zusicherung.«
»Ich kann Ihnen nichts versprechen, Sir. Aber ich höre mir gerne an, was Sie zu sagen haben.«
»Wir leben in einer Zeit, in der die Welt des Einzelnen nicht mehr anerkannt wird. Ich habe sieben Mädchen. Ich habe Angst um sie. Ich habe Angst um ihre Sicherheit. Versprechen Sie mir, dass ihnen nichts zustößt?«
Sieben Mädchen, dachte Jessica.
»Wenn Ihre Mädchen weder für diese Tat noch für eine andere die Verantwortung tragen, werden sie nicht in die Sache hineingezogen. Das verspreche ich Ihnen.«
Der Anrufer zögerte wieder kurz, ehe er fortfuhr.
»Ich bin jetzt in der Nähe Zweite und Diamond. Es ist kalt hier.«
Es ist kalt hier, dachte Jessica. Was bedeutete das? Die Temperatur war schon auf über dreißig Grad gestiegen.
»Welche Anschrift, Sir?«
»Das weiß ich nicht. Aber Sie können sich an der roten Tür orientieren.«
»Sir, wenn Sie kurz dranbleiben würden ...«
Der Anrufer legte auf. Josh Bontrager drückte auf STOP.
Jessica schaute ihren Partner an. »Was hältst du davon?«
Byrne dachte kurz nach. »Ich weiß es nicht. Frag mich noch mal, wenn uns der vollständige Laborbericht über diesen Knopf vorliegt.«
Jede Person, die der Polizei Informationen lieferte, wurde routinemäßig in den polizeilichen Datenbanken überprüft, vor allem Personen, die anriefen, um ein Gewaltverbrechen zu gestehen. Den Worten ihres Chefs zufolge lag gegen einen Jeremia Crosley nichts vor. Er hatte sich in der Stadt Philadelphia weder einer Straftat noch einer Verkehrsübertretung schuldig gemacht. Die von ihm angegebene Adresse in Queen Village existierte nicht. Es gab keine Dodgson Street.
»Okay«, sagte Jessica schließlich. »Und jetzt?«
»Ich schlage vor, wir fahren zurück zum Tatort in der Achten Straße«, sagte Byrne. »Ich will mir alles noch einmal genau ansehen. Wir nehmen das Band mit und spielen es den Leuten in der Gegend vor. Vielleicht erkennt jemand die Stimme. Anschließend können wir vielleicht noch mal nach Millersville fahren.«
Am Tag zuvor waren sie in Millersville gewesen und hatten mit Robert und Marilyn O’Riordan gesprochen, um den Eltern zu versichern, dass es mit den Ermittlungen nun voranging. Es war keine offizielle Vernehmung gewesen; die O’Riordans waren im Zuge der ersten Ermittlungen bereits mehrere Male vernommen worden. Robert O’Riordan war mürrisch und wenig hilfsbereit gewesen, und seine Frau hatte beinahe apathisch bei ihnen gesessen. Die beiden waren durch die schreckliche Trauer und den unersetzlichen Verlust wie gelähmt. Jessica hatte das oft erlebt, und jedes Mal versetzte es ihr einen Stich.
»Okay, so machen wir’s.« Jessica nahm den Kassettenrekorder an sich. »Danke, dass du das hergebracht hast, Josh.«
»Kein Problem.«
Ehe Jessica sich umdrehte, um zum Wagen zu gehen, legte Byrne ihr eine Hand auf den Arm.
»Jess.«
Byrne zeigte auf das zerbeulte, rostige Wrack eines Kühlschranks, der an der Mauer vor dem ehemaligen Musikgeschäft stand. Es war ein altes Modell aus den Fünfzigern oder Sechzigern; die Seitenverkleidung war abgerissen. Es sah so aus, als wäre das Gerät einst taubenblau, vielleicht auch grün gewesen, doch das Alter, der Rost und der Ruß hatten es dunkelbraun gefärbt. Die Kühlschranktür hing schief an einem verbogenen Scharnier. Jessica sah oben an der Tür ein verwittertes Firmenlogo. Der verblasste Schriftzug des Firmennamens war noch zu erkennen, obwohl die Chrombuchstaben längst verschwunden waren.
Crosley.
Die Marke stammte aus den Zwanzigerjahren. Jessica erinnerte sich an einen Crosley-Kühlschrank im Haus ihrer Großmutter in der Christian Street. Heute sah man Geräte dieses Herstellers kaum noch.
Mein Name ist Jeremia Crosley.
»Könnte das ein Zufall sein?«, fragte Jessica.
»Das können wir nur hoffen«, erwiderte Byrne, doch Jessica sah ihm an, dass er nicht daran glaubte. Die Alternative führte sie in eine Richtung, die niemand einschlagen wollte.
Byrne öffnete die Kühlschranktür.
Auf dem einzigen noch vorhandenen Trenngitter stand ein Glasgefäß, das zur Hälfte mit einer trüben roten Flüssigkeit gefüllt war. In dieser Flüssigkeit schwamm etwas.
Jessica wusste, was es war. Sie war bei vielen Autopsien dabei gewesen.
Es war das Herz eines Menschen.
3.
ALSSIEAUFDIE Spurensicherung warteten und damit begannen, sich alles genauer anzusehen, machte Josh Bontrager Fotos mit einer Digitalkamera: von der Brachfläche, von den Graffiti auf der Bretterwand, vom Kühlschrank, von der Gegend und von den Schaulustigen, deren Menge rasch anwuchs. Jessica und Byrne hörten sich noch dreimal das Band an, doch es lieferte keine Anhaltspunkte, was die Identität des Anrufers anging.
Der Fund, den sie soeben gemacht hatten, warf viele Fragen auf, aber sie wussten zumindest, dass das Herz nicht von ihrem Opfer stammte: Caitlin O’Riordans Leichnam wies keinerlei Verstümmelungen auf.
Es ist kalt hier, rief Jessica sich die Worte des Anrufers in Erinnerung. Der Mann hatte über den Kühlschrank gesprochen.
»He, Leute.« Bontrager zeigte hinter den Kühlschrank. »Da liegt was.«
»Und was?«, wollte Jessica wissen.
»Keine Ahnung.« Josh drehte sich zu Byrne um. »Fass mal mit an.«
Sie stellten sich beide an je eine Seite des sperrigen Geräts. Als sie es ein Stück von der Mauer weggezogen hatten, kroch Jessica in die Lücke. Der Staub und Dreck vieler Jahre hatten sich dort angesammelt, wo einst der Kompressor gewesen war.
Genau an der Stelle lag ein Buch. Ein dickes Buch mit einem schwarzen Einband ohne Schutzumschlag. Der Leineneinband war von Wasserflecken übersät. Jessica zog einen Latexhandschuh an und hob das Buch vorsichtig vom Boden auf. Es war eine gebundene Ausgabe der Neuen Oxford-Bibel.
Jessicas Blick glitt über die Vorder- und Rückseite. Keine Widmungen oder sonstigen Inschriften. Sie schaute auf den unteren Rand. Ein rotes Leseband markierte eine Seite fast genau in der Mitte der Bibel. Vorsichtig klappte Jessica sie an dieser Stelle auf.
Das Buch Jeremia.
»Scheiße«, sagte Byrne. »Was ist denn das?«
Jessica spähte auf die erste Seite des Buches Jeremia. Die Schrift war so klein, dass sie kaum etwas erkennen konnte. Sie zog ihre Brille aus der Tasche und setzte sie auf.
»Josh? Bist du mit diesem Teil des Alten Testaments vertraut?«
Beim Philadelphia Police Department galt Joshua Bontrager zu Recht als der Experte in Fragen der Religion.
»Ein bisschen«, sagte er. »Jeremia war eine Art Schicksals- und Untergangsprophet. Er hat den Niedergang des Königreichs Juda vorhergesagt und so was. Ich habe schon häufig gehört, dass einige seiner Botschaften zitiert wurden.«
»Zum Beispiel?«
»›Trügerisch ist das Herz, mehr als alles, und unheilbar ist es.‹ Das ist eines der bekanntesten Zitate. Es gibt viele unterschiedliche Übersetzungen dieser Textstelle, aber diese ist am weitesten verbreitet. Tolle Auffassung, was?«
»Er hat etwas über das Herz geschrieben?«
»Unter anderem.«
Jessica blätterte ein paar Seiten weiter. Im einundvierzigsten Kapitel des Buches Jeremia befanden sich mehrere Markierungen auf der Seite. Drei kleine Quadrate, die mit unterschiedlichen Stiften gemalt worden waren: gelb, blau und rot. Ein Wort war ebenso wie zwei zweistellige Zahlen mit einem Textmarker hervorgehoben.
Das hervorgehobene Wort war Shiloh. Darunter standen auf der linken Seite des Textes zwei Zahlen.
45 und 14.
Jessica blätterte das Buch Jeremia behutsam durch und schaute sich den Rest der Bibel flüchtig an. Andere durch Lesezeichen gekennzeichnete Seiten oder hervorgehobene Wörter oder Zahlen entdeckte sie nicht.
Sie schaute Byrne an. »Sagt dir das was?«
Byrne schüttelte den Kopf, doch Jessica sah, dass er angestrengt nachdachte.
»Josh?«
Bontrager schaute auf den Text und überflog die Seite. »Nein, tut mir leid.« Er sah ein wenig verlegen aus. »Verrate es meinem Dad nicht, aber ich habe die Bibel schon eine ganze Weile nicht mehr in die Hand genommen.«
»Wir müssen das von der Dokumentenabteilung überprüfen lassen«, sagte Jessica. »Wir sollten das finden, meinst du nicht auch?«
»Ja«, sagte Byrne und klang nicht besonders glücklich dabei.
Jessica hätte sich gerne eingehender darüber unterhalten, doch Byrne äußerte sich nicht weiter dazu, und auch Josh Bontrager schwieg. Das war gar nicht gut.
Als die Spurensicherung den Fundort eine Stunde später abgesperrt hatte, fuhren sie zurück zum Roundhouse. Die Ereignisse des Vormittags – die Möglichkeit einer Festnahme im Mordfall Caitlin O’Riordan und der Fund eines menschlichen Herzens auf einer von Unkraut überwucherten Brachfläche in den Badlands – umschwirrten einander wie zwei Schwärme Schmeißfliegen an einem heißen Sommernachmittag in Philadelphia. Und ein uralter Name sowie vier mysteriöse Zahlen bewirkten, dass sie vor einem noch größeren Rätsel standen als ohnehin schon.
Shiloh.
4514.
Was bedeutete diese Botschaft?
Jessica zerbrach sich den Kopf darüber.
Sie hatte das Gefühl, dass weitere Botschaften folgten.
4.
Zwei Monate zuvor
EVE GALVEZWUSSTE im Voraus, was der Therapeut gleich sagen würde. Sie wusste es jedes Mal.
Was für ein Gefühl löst das bei Ihnen aus?
»Was für ein Gefühl löst das bei Ihnen aus?«, fragte er.
Er war jünger als die anderen, besser gekleidet, und er sah besser aus. Und das wusste er genau. Dunkles Haar, etwas zu lang, das sich über dem Kragen lockte. In seinen sanften, hellbraunen Augen spiegelte sich Mitgefühl. Er trug ein schwarzes Jackett und eine anthrazitfarbene Hose, und er hatte Aftershave aufgelegt, aber nicht zu viel für diese Tageszeit. Irgendetwas Italienisches, dachte Eve Galvez, etwas Teures und Exklusives. Doch eitle Männer beeindruckten Eve nicht. Sie schätzte den Therapeuten auf vierundvierzig. Sie konnte andere Menschen gut einschätzen.
»Ein schlechtes Gefühl«, sagte Eve.
»Schlecht ist kein Gefühl.« Er hatte einen Akzent, der vermuten ließ, dass er in den reichen Vororten im Westen Philadelphias lebte, aber nicht von Geburt an. »Ich spreche über Gefühle«, fügte er hinzu. »Welche Gefühle löst der Vorfall bei Ihnen aus?«
»Okay.« Eve ließ sich darauf ein. »Ich spüre ... Wut.«
»Schon besser. Wut auf wen?«
»In erster Linie auf mich selbst, weil ich mich in diese Situation gebracht habe. Zugleich aber auch Wut auf die ganze Welt.«
Eines Abends war Eve nach der Arbeit alleine nach Old City gefahren. Um sich umzuschauen. Wieder einmal. Mit einunddreißig gehörte sie schon zu den älteren Frauen im Club, doch mit ihrem dunklen Haar, den dunklen Augen und der tollen Figur, die sie ihren regelmäßigen Pilates-Übungen verdankte, interessierten sich noch viele Männer für sie. Schließlich aber war es ihr dort zu laut und zu unruhig geworden. Sie nahm an der Bar zwei Drinks – die trank sie immer, auch wenn es ihr nicht gefiel – und trat hinaus in die Dunkelheit. Später am Abend suchte sie noch die Bar im Omni Hotel auf und machte den Fehler, sich von dem falschen Mann einen Drink spendieren zu lassen. Wieder einmal. Das Gespräch war langweilig, und der Abend dehnte sich endlos. Schließlich entschuldigte sich Eve und sagte, sie müsse sich kurz frisch machen.
Als sie das Hotel ein paar Minuten später verließ, sah sie ihn auf dem Bürgersteig stehen. Er folgte ihr fast vier Häuserblocks die Vierte Straße hinunter, wobei er die Entfernung allmählich verringerte und sich immer wieder in der Dunkelheit versteckte.
Das Glück war auf ihrer Seite – obwohl Glück in Eve Galvez’ Leben eine sehr geringe Rolle spielte –, denn als der Mann sich weit genug genähert hatte, um sie zu packen, fuhr langsam ein Streifenwagen vorbei. Eve winkte die Polizisten heran. Augenblicke später war der Mann verschwunden.
Das war verdammt knapp gewesen, und Eve hasste sich dafür. Sie war sonst cleverer. Zumindest wollte sie das glauben.
Und jetzt saß sie in der Praxis des Therapeuten, und er drängte sie zu antworten.
»Was glauben Sie, wollte er von Ihnen?«, fragte er.
»Er wollte mich vögeln«, sagte Eve nach kurzem Zögern.
Das Wort hallte durchs Zimmer. So war es immer in guter Gesellschaft.
»Woher wissen Sie das?«
Eve lächelte. Nicht das Lächeln, das sie in ihrem Job auflegte oder das sie Freunden und Kollegen schenkte, und auch nicht das Lächeln, das sie auf der Straße zeigte. Dies war ein anderes Lächeln. »Frauen wissen so was.«
»Alle Frauen?«
»Ja.«
»Junge und alte?«
»Und alle dazwischen.«
»Ich verstehe«, sagte er.
Eve schaute sich in dem kleinen Raum um. Die Praxis befand sich in einem renovierten zweistöckigen Haus in der Chestnut Street zwischen der Zwölften und Dreizehnten. Im Erdgeschoss gab es drei kleine Räume einschließlich eines kleinen Wartezimmers mit verblichenen Ahornböden und einem offenen Kamin samt Zubehör aus Messing. Auf dem Beistelltisch aus Rauchglas lagen neue Exemplare von Psychology Today, In Style und People. Zwei Glastüren führten in ein als Büro genutztes Schlafzimmer, das in einem pseudo-europäischen Stil eingerichtet war.
Als Eve noch auf der Couch therapiert wurde, hatte sie alle möglichen Mittel bekommen – Clonazepam, Diazepam, Flurazepam. Nichts hatte geholfen. Schmerzen, wie sie beginnen, wenn die Kindheit allmählich zu Ende geht, können nicht gelindert werden. Wenn die Nacht dem Morgen weicht, tritt man schließlich hinaus in die Dunkelheit, ob man bereit ist oder nicht.
»Es tut mir leid«, sagte sie. »Ich möchte mich für meine ordinäre Ausdrucksweise entschuldigen. Das war unhöflich.«
Er machte ihr weder Vorhaltungen, noch nahm er die Entschuldigung an. Das hatte sie auch nicht erwartet. Stattdessen schaute er auf seinen Schoß, überflog ihre Akte und blätterte ein paar Seiten um. Da stand alles. Das war einer der Nachteile, wenn man einem Gesundheitssystem unterworfen war, das jeden Arzttermin, jedes Rezept, jede Physiotherapie, alle Röntgenstrahlen, Schmerzen, Leiden, Diagnosen und Behandlungen erfasste.
Wenn Eve etwas gelernt hatte, dann die Einsicht, dass es zwei Gruppen von Menschen gab, denen man nichts vormachen konnte: Ärzte und Banker. Beide wussten, wenn etwas aus dem Gleichgewicht geraten war.
»Haben Sie an Graciella gedacht?«, fragte der Therapeut.
Eve versuchte, sich zu konzentrieren und ihre Gefühle im Zaum zu halten. Sie kämpfte gegen die Tränen an, doch sie waren nicht mehr aufzuhalten. Sie rannen ihr über die Wangen aufs Kinn, auf den Hals und auf den Stoff des Ohrensessels. Sie fragte sich, wie viele Tränen wohl schon auf diesen Sessel getropft und wie viele Rinnsale des Kummers ins Polster eingedrungen waren.
»Nein«, log sie.
Er legte den Stift aus der Hand. »Erzählen Sie mir von dem Traum.«
Eve zog ein paar Papiertücher aus der Box und tupfte sich die Augen. Dabei warf sie einen verstohlenen Blick auf die Uhr. In der Praxis eines Psychiaters gab es selten Wanduhren. Es war die achtundvierzigste Minute einer fünfzigminütigen Sitzung. Der Arzt wollte sie fortsetzen. Auf eigene Kosten.
Was hat das zu bedeuten?, fragte Eve sich. Psychiater überzogen niemals die Zeit. Es wartete immer der nächste Patient, eine Jugendliche mit Essstörungen, eine frustrierte Hausfrau oder irgendein masturbierender Künstler, der mit dem Bus fuhr und nach Mädchen in Faltenröcken Ausschau hielt. Oder es wartete jemand mit zwanghaften Verhaltensstörungen, der jeden Morgen, bevor er zur Arbeit fuhr, sieben Runden durchs Haus drehen musste, um zu überprüfen, ob er das Gas abgedreht und auch nicht vergessen hatte, hundertmal die Fransen seines Teppichs zu kämmen.
»Eve?«, wiederholte er. »Der Traum?«
Es war kein Traum. Das wusste er so gut wie sie. Es war ein Albtraum, eine grässliche Horrorshow, die jede Nacht, jeden Mittag und jeden Morgen lief und im Mittelpunkt ihrer Gedanken und ihres Lebens stand.
»Was wollen Sie darüber wissen?«, fragte Eve, um Zeit zu gewinnen. Sie spürte Übelkeit im Magen.
»Ich will alles hören«, sagte er. »Erzählen Sie mir von dem Traum. Erzählen Sie mir von Mr Ludo.«
Eve Galvez schaute auf das Outfit auf ihrem Bett. Die Hose, der Baumwollblazer, das T-Shirt und die Nikes machten zusammen ein Fünftel ihrer Garderobe aus. Sie reiste in diesen Tagen mit leichtem Gepäck, obwohl sie sich früher fast zwanghaft neue Klamotten gekauft hatte. Und Schuhe. Damals war ihr Briefkasten mit Modezeitschriften vollgestopft. In ihrem Wandschrank hatten so viele Kostüme, Blazer, Pullover, Blusen, Röcke, Mäntel, Hosen, Westen, Jacken und Kleider gehangen, dass kein Millimeter Platz mehr darin gewesen war. Jetzt hatte sie im Schrank reichlich Platz für ihre vielen Leichen. Und sie brauchte jede Menge Platz.
Außer der spärlichen Garderobe besaß Eve ein Schmuckstück, an dem sie sehr hing, ein Armband, das sie nur nachts trug. Es gehörte zu den wenigen Dingen, die sie in Ehren hielt.
Das hier war ihre fünfte Wohnung in zwei Jahren, ein billiges, zugiges Dreizimmerapartment im Nordosten Philadelphias. Es gab einen Tisch, einen Stuhl, ein Bett und einen Schrank. An den Wänden hingen keine Bilder und keine Poster. Obwohl Eve einen Job, eine Aufgabe und zahlreiche Verantwortlichkeiten anderen Menschen gegenüber hatte, kam sie sich manchmal wie eine Nomadin vor, eine Frau, die sich von den Fesseln des Stadtlebens befreit hatte.
Beweisstück Nummer eins: vier Packungen Macaroni & Cheese von Kraft, deren Verfallsdatum schon vor zwei Jahren abgelaufen war. Immer wenn sie den Vorratsschrank öffnete, wurde sie daran erinnert, dass sie mit Lebensmitteln umzog, die sie nie mehr essen würde.
Unter der Dusche dachte sie über die Sitzung bei ihrem Psychiater nach. Sie hatte ihm von dem Traum erzählt. Nicht alles – alles würde sie nie jemandem erzählen –, aber sicherlich mehr, als sie beabsichtigt hatte. Sie fragte sich, warum das so war. Der Mann war keineswegs einsichtiger als die anderen und hatte keine besondere Antenne, die bewies, dass er mehr draufhatte als seine Kollegen.
Und doch hatte sie mehr erzählt als jemals zuvor.
Vielleicht machte sie wirklich Fortschritte.
Sie geht durch eine dunkle Straße. Es ist drei Uhr morgens. Eve weiß genau, wie spät es ist, denn sie hat auf dem Boulevard den Blick gehoben – eine Traumstraße ohne Namen und ohne Nummer – und die Uhr oben am Rathausturm gesehen.
Ein Stück weiter wird die Straße noch dunkler, die Konturen sind noch verschwommener und die Schatten länger, wie auf einem riesigen Stillleben von Chirico. Auf beiden Straßenseiten sind leere Ladenlokale, geschlossene Coffeeshops, an deren Theken noch immer Kunden stehen, von Eis überzogen, in erstarrten Posen, während sie ihre Kaffeetassen an die Lippen führen.
Sie gelangt an eine Kreuzung. Auf allen vier Seiten blinkt die Straßenbeleuchtung rot. Sie sieht eine Puppe, die auf einem kleinen Bauernstuhl sitzt. Die Puppe trägt ein zerrissenes pinkfarbenes Kleid, das am Saum beschmutzt ist. Auch Knie und Ellbogen der Puppe sind schmutzig.
Plötzlich weiß Eve, wer sie ist und was sie getan hat. Die Puppe gehört ihr. Es ist eine Crissy-Puppe, an der sie als Kind besonders gehangen hat. Sie, Eve, ist von zu Hause ausgerissen. Sie ist vierzehn Jahre alt und ohne Geld und irgendeinen Plan in die Stadt gekommen.
Auf der Mauer zu ihrer Linken tanzt ein Schatten. Sie dreht sich danach um und sieht einen Mann, der sich rasch nähert. Im Licht des Mondes bewegt er sich wie eine heiße Windbö auf sie zu.
Jetzt ist er hinter ihr. Sie weiß, was er den anderen angetan hat. Sie weiß, was er ihr antun wird.
»Venga aqui!«, hört sie die dröhnende Stimme hinter sich, dicht an ihrem Ohr.
Angst und Übelkeit steigen in ihr auf. Sie kennt die vertraute Stimme. Sie rauscht wie ein dunkler Tornado durch ihr Herz. »Venga, Eve! Ahora!«
Sie schließt die Augen. Der Mann reißt sie herum und schüttelt sie heftig. Er wirft sie zu Boden, doch sie berührt den dampfenden Asphalt gar nicht. Stattdessen fällt sie hindurch, stürzt im freien Fall kopfüber durch den leeren Raum, während die bunten Lichter der Stadt durch ihr Hirn wirbeln.
Sie fällt durch eine Decke auf eine schmutzige Matratze. Ein paar wundervolle Augenblicke lang ist die Welt still. Rasch kommt Eve wieder zu Atem und hört die Stimme eines jungen Mädchens, das im Zimmer nebenan ein bekanntes Lied singt. Es ist ein spanisches Wiegenlied: A La Nanita Nana.
Sekunden später wird die Tür aufgerissen. Ein leuchtend rotes Licht überschwemmt den Raum. Eine schrille Sirene hallt durch Eves Kopf.
Und der wahre Albtraum beginnt.
Eve stieg aus der Dusche, trocknete sich ab, ging ins Schlafzimmer, öffnete den Schrank und nahm den Aluminiumkoffer heraus. In dem Koffer lagen vier Waffen in Schaumstoffeinsätzen. Alle Waffen waren sorgfältig gepflegt und geladen. Sie wählte eine Glock .17 aus, die sie in einem Chek-Mate-Sicherheitsholster an der rechten Hüfte trug, sowie eine Beretta .21, die sie in einem Apache-Knöchelholster mit sich führte.
Sie zog sich an, knöpfte den Blazer zu und betrachtete sich im großen Wandspiegel. Es gab kein Zurück mehr. Um kurz nach ein Uhr nachts betrat Eve Galvez das Treppenhaus.
Sie drehte sich um, und als sie in ihre fast leere Wohnung schaute, erfüllte dumpfe Melancholie ihr Inneres. Einst hatte sie so viel besessen ...
Eve schloss die Tür hinter sich ab und lief den Gang hinunter. Ein paar Minuten später durchquerte sie die Eingangshalle, passierte die Glastüren und trat hinaus in den warmen Abend Philadelphias.
Zum letzten Mal.
5.
DIE KRIMINALTECHNIKBEFAND sich an der Ecke Achte und Poplar Street, nur wenige Querstraßen vom Roundhouse entfernt. Das dreitausendsechshundert Quadratmeter große Gebäude war für die Analyse aller labortechnisch relevanten Beweismittel zuständig, die das Philadelphia Police Department im Laufe einer Ermittlung sammelte. In den verschiedenen Laboren wurden in drei großen Bereichen Analysen durchgeführt: materielle Beweismittel wie Farbe, Fasern und Schussrückstände; biologische Beweismittel wie Blut, Sperma und Haare; sonstige Beweismittel wie Fingerabdrücke, Dokumente und Schuhabdrücke.
Die Kriminaltechnik des Philadelphia Police Departments war ein selbstständiger Dienstleistungsbetrieb, der über zahllose hochmoderne Testgeräte verfügte, um Analysen und Untersuchungen vorzunehmen.
Sergeant Helmut Rohmer war der unbestrittene Herrscher der Dokumentenabteilung. Er war Anfang dreißig, gut eins neunzig groß und hundertfünfundzwanzig Kilo schwer – ein Riese, der fast nur aus Muskeln bestand. Er hatte kurz geschorenes, stark blondiertes Haar, das beinahe weiß war. Beide Arme waren mit kunstvollen Tattoos verziert, wobei es sich größtenteils um Varianten roter Rosen, weißer Rosen und des Wortes »Rose« handelte. Blumen und Blütenblätter schlängelten sich über Rohmers gewaltige Armmuskeln. Auf Polizeifeten oder bei Treffen des Polizeisportvereins, wo Helmut Rohmer regelmäßig trainierte, hatte ihn noch nie jemand mit einer Person namens Rose oder Rosie oder Rosemary gesehen. Daher wurde dieses Thema peinlich vermieden. In der Regel trug Rohmer schwarze Jeans, Doc Martens und ärmellose schwarze Sweatshirts. Nur nicht, wenn er vor Gericht erschien. Dann trug er einen abgetragenen marineblauen Anzug mit schmalem Revers, der aus der Zeit stammte, als REO Speedwagon noch die Charts gestürmt hatte.
Hier war kein Platz für Kugelschreiberetuis oder schmuddelige Laborkittel. Helmut Rohmer sah wie ein Roadie von Metallica aus oder wie die Comic-Zeichnung eines Hells Angels von Frank Miller. Aber wenn der Sergeant sprach, klang er wie Johnny Mathis. Er bestand darauf, »Hell« genannt zu werden, und unterzeichnete sogar interne Mitteilungen damit. Niemand wagte, Einwände zu erheben.
»Das ist eine sehr verbreitete Ausgabe der Neuen Oxford-Bibel«, sagte Hell nun. »Man kann sie überall kaufen. Ich habe dieselbe Ausgabe zu Hause.« Das Buch lag auf dem glänzenden Stahltisch und war auf der Seite aufgeschlagen, auf der die Verlagsangaben standen. »Dieses Exemplar hier wurde Anfang der Siebziger gedruckt, aber man findet es in fast jedem Secondhand-Buchladen im Lande, in Universitätsbuchhandlungen und in Buchläden, die Bücher zum halben Preis anbieten. Überall.«
»Meinen Sie, man könnte irgendwie herausfinden, wo diese Bibel gekauft wurde?«, fragte Jessica.
»Ich fürchte nein.«