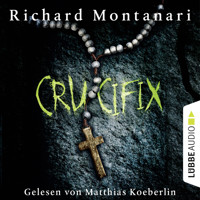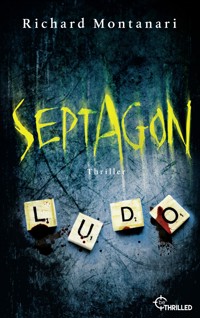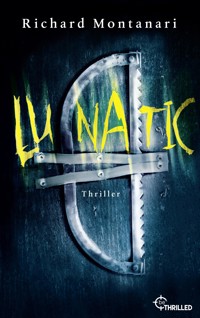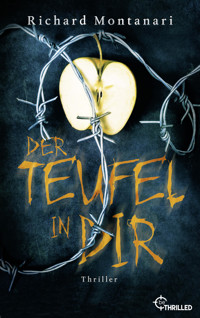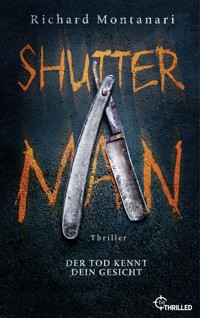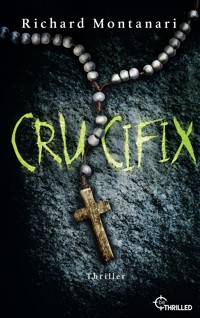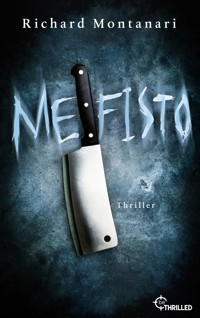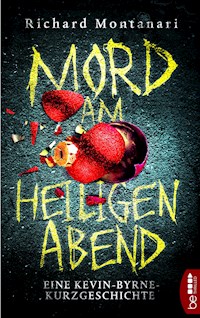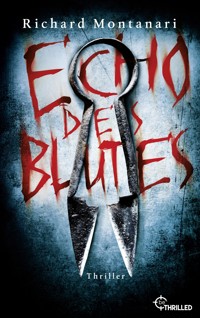
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Spannende Thriller mit Byrne und Balzano
- Sprache: Deutsch
Wenn die Vergangenheit dich einholt, musst du schnell sein.
In einer der ärmsten Gegenden Philadelphias wird die verstümmelte Leiche eines Mannes gefunden. Die Stirn und die Augen des Opfers sind von weißem Papier umhüllt, das an der einen Seite mit rotem Lack versiegelt wurde und an dessen anderer Seite eine Acht aus Blut zu finden ist. Der Körper der Leiche wurde von Kopf bis Fuß grob und gewaltsam rasiert. Schnell ist klar: Das ist das Werk eines Sadisten.
Als Kevin Byrne und Jessica Balzano den Fall übernehmen, stellen sie fest, dass der Mord eine Verbindung zur Vergangenheit aufweist. Und der Fall wurde niemals abgeschlossen ...
»Sie blättern die Seiten um, als ob ihr Leben davon abhängt.« DAILY MAIL
Nichts für schwache Nerven! Die spannungsgeladenen Thriller des Bestsellerautors Richard Montanari um das Ermittlerduo Byrne und Balzano:
Band 1: Crucifix
Band 2: Mefisto
Band 3: Lunatic
Band 4: Septagon
Band 5: Echo des Blutes
Band 6: Der Teufel in dir
Band 7: Der Abgrund des Bösen
Band 8: Tanz der Toten
Band 9: Shutter Man
Band 10: Mord am Heiligen Abend
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 614
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Zitat
PROLOG
ERSTER TEIL – ALLEGRO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
ZWEITER TEIL – SCHERZO
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
DRITTER TEIL – RONDO
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
Epilog
Danksagung
Über den Autor
Alle Titel des Autors bei beTHRILLED
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.
Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!
Dein beTHRILLED-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
In einer der ärmsten Gegenden Philadelphias wird die verstümmelte Leiche eines Mannes gefunden. Die Stirn und die Augen des Opfers sind von weißem Papier umhüllt, das an der einen Seite mit rotem Lack versiegelt wurde und an dessen anderer Seite eine Acht aus Blut zu finden ist. Der Körper der Leiche wurde von Kopf bis Fuß grob und gewaltsam rasiert. Schnell ist klar: Das ist das Werk eines Sadisten.
Als Kevin Byrne und Jessica Balzano den Fall übernehmen, stellen sie fest, dass der Mord eine Verbindung zur Vergangenheit aufweist. Und der Fall wurde niemals abgeschlossen …
Richard Montanari
ECHODESBLUTES
Aus dem amerikanischen Englischvon Karin Meddekis
Der Mann
Alles erscheint mir übel,bis ich mich schlaflos niederlege und sterbe.
Das Echo
Leg dich nieder und stirb.
William Butler Yeats
Der Mann und das Echo
PROLOG
Wo Licht ist, ist auch Schatten. Wo Geräusche sind, ist auch Stille.
Von dem Augenblick an, als Detective Kevin Francis Byrne den Anruf bekam, schwante ihm, dass diese Nacht sein Leben für immer verändern würde und dass er sich an einen Ort begab, wo das abgrundtief Böse seine dunklen Spuren hinterlassen hatte.
»Bist du bereit?«
Byrne warf Jimmy einen Blick zu. Detective Jimmy Purify, der auf dem Beifahrersitz des verbeulten und verkratzten Ford des Police Departments saß, war nur ein paar Jahre älter als Byrne. Doch in den Augen des Mannes spiegelten sich tiefe Weisheit und hart erkämpfte Erfahrungen. Jimmy hatte in diesem Job nicht einfach seine Zeit abgesessen, sondern sich tatsächlich immer voll eingesetzt. Sie kannten sich schon eine ganze Weile, doch es war der erste Fall, in dem sie als Partner ermittelten.
»Ich bin bereit«, sagte Byrne.
Er war es nicht. Sie stiegen aus und gingen auf den Eingang des großen, gepflegten Hauses in Chestnut Hill zu. Diese vornehme Wohngegend im Nordwesten der Stadt war ein historisches Viertel und zu einer Zeit gebaut worden, als Philadelphia nach London die zweitgrößte englischsprachige Stadt der Welt war.
Der erste Polizist, der am Tatort ankam, war ein blutiger Anfänger namens Timothy Meehan. Er stand in der Eingangshalle, geschützt vor dem kalten Herbstwind, der über das Grundstück fegte. Die Garderobe brach unter der Last der vielen Mäntel, Hüte und Schals fast zusammen. Dem Geruch nach zu urteilen, mussten die Sachen schon eine ganze Weile dort hängen. Noch vor wenigen Jahren hatte Byrne denselben Job gemacht wie Officer Meehan. Er erinnerte sich gut, was es für ein Gefühl war, wenn die Detectives am Tatort eintrafen, an diese Mischung aus Neid, Erleichterung und Bewunderung. Die Chancen, dass Meehan eines Tages Byrnes Job machen würde, waren gering. Es erforderte schon eine gewisse Charakterstärke, um an diesem Job festzuhalten, und das vor allem in einer Stadt wie Philly. Die meisten Polizisten in Uniform, zumindest die cleveren, schauten sich irgendwann nach einem anderen Betätigungsfeld um. Byrne unterschrieb das Tatortprotokoll, betrat die warme Eingangshalle und nahm die Bilder, die Geräusche und die Gerüche in sich auf. Er würde diesen Tatort nur jetzt zum ersten Mal betreten und diese Luft atmen, die unbändige Gewalt rot gefärbt hatte. Als Byrne einen Blick in die Küche warf, sah er einen blutüberströmten Mordtatort, scharlachrote Wandgemälde auf marmorierten weißen Kacheln, das niedergemetzelte Opfer auf dem Boden. Während Jimmy den Rechtsmediziner und die Kriminaltechniker an den Tatort rief, durchquerte Byrne die Eingangshalle. Der Officer, der dort stand, war ein erfahrener Streifenbeamter um die fünfzig, der mit dem Job zufrieden war, ohne besonderen Ehrgeiz zu haben. In diesem Augenblick beneidete Byrne ihn. Der Polizist wies mit dem Kopf auf das Zimmer auf der anderen Seite des Korridors.
Und jetzt hörte Byrne die Musik.
Sie saß auf einem Stuhl hinten im Raum. Die Wände waren mit waldgrünen Seidentapeten verkleidet, und auf dem Boden lag ein feiner burgunderroter Perser. Die Einrichtung bestand aus massiven Möbeln im Queen-Anne-Stil. Es duftete nach Jasmin und Leder.
Byrne wusste, dass der Raum überprüft worden war, doch er schaute sich dennoch aufmerksam um. In einer Ecke stand eine antike Vitrine mit facettierten Glastüren, deren Fächer mit kleinen Porzellanfiguren dekoriert waren. In einer anderen Ecke lehnte ein wunderschönes Cello. Auf der goldenen Oberfläche schimmerte Kerzenlicht. Die schlanke, elegante Frau Ende zwanzig hatte glänzendes rotbraunes Haar, das ihr bis auf die Schultern fiel, und Augen in der Farbe hellen Kupfers. Sie trug ein langes schwarzes Kleid, High-Heel-Slings und eine Perlenkette. Das Make-up war ein wenig aufdringlich – wie das einer Schauspielerin, hätten manche gesagt –, doch es schmeichelte ihren feinen Zügen und ihrer blassen Haut.
Als Byrne den Raum betrat, musterte die Frau ihn, als wäre er ein Gast, den sie zum Thanksgiving-Dinner erwartete, ein ungeliebter Cousin aus Allentown oder Ashtabula. Das war nicht der Fall. Byrne war hier, um sie zu verhaften.
»Hören Sie es?«, fragte die Frau. Ihre Stimme hatte einen fast mädchenhaften Klang.
Byrne warf einen Blick auf die durchsichtige CD-Hülle, die auf einer kleinen Ablage aus Holz über der teuren Stereoanlage lag. Chopin: Nocturne in G-Dur. Dann sah er sich das Cello genauer an. Auf den Saiten und dem Griffbrett waren frische Blutflecken, ebenso auf dem Bogen, der auf dem Boden lag. Sie hatte anschließend gespielt.
Die Frau schloss die Augen. »Hören Sie genau hin«, sagte sie. »Die Blue Notes.«
Byrne lauschte. Er hatte diese Melodie nicht vergessen und erinnerte sich noch gut, wie sie ihn damals berauschte und gleichzeitig erschütterte.
Kurz darauf verstummte die Musik. Byrne wartete, bis der letzte Ton verhallt war. »Stehen Sie jetzt bitte auf, Ma’am«, forderte er sie auf.
Als die Frau die Augen öffnete, stockte Byrne einen kurzen Augenblick der Atem. Als Streifenpolizist hatte er es auf den Straßen von Philadelphia schon mit den unterschiedlichsten Menschen zu tun gehabt, von seelenlosen Drogendealern bis zu aalglatten Betrügern, von geschickten Dieben, die auf das Einschlagen und Ausrauben von Schaufenstern spezialisiert waren, bis zu vollgekifften Jugendlichen, die wild durch die Gegend bretterten. Doch nie zuvor hatte er einen Menschen getroffen, der so losgelöst von dem Verbrechen war, das er soeben begangen hatte. In ihren hellbraunen Augen sah Byrne Dämonen, die von Schatten zu Schatten sprangen.
Die Frau stand auf, drehte sich zur Seite und streckte die Hände nach hinten. Byrne nahm die Handschellen, klammerte sie ihr um die schmalen weißen Handgelenke und drückte sie zu.
Sie drehte sich wieder zu ihm um. Schweigend standen sie sich gegenüber, nur ein paar Zentimeter voneinander entfernt. Sie waren sich nicht nur fremd, sie wussten auch nicht, was für ein scheußliches Spektakel sie erwartete.
»Ich habe Angst«, sagte sie.
Byrne hätte ihr gerne gesagt, dass er sie verstand und dass wir alle Augenblicke der Wut kannten, in denen die Mauern der Vernunft bebten und Risse bekamen. Er wollte ihr sagen, dass sie für ihr Verbrechen büßen musste, wahrscheinlich für den Rest ihres Lebens und vielleicht sogar mit ihrem Leben. Er wollte ihr auch sagen, dass sie mit Würde und Respekt behandelt werden würde, solange sie sich in seiner Obhut befand.
Er sagte nichts dergleichen.
»Ich bin Detective Kevin Byrne«, sagte er stattdessen. »Alles wird gut.«
Es war der 1. November 1990.
Diese Behauptung bewahrheitete sich nicht.
ERSTER TEIL
ALLEGRO
1.
SONNTAG, 24. OKTOBER
Hören Sie es?
Hören Sie genau hin. Hinter dem Lärm des Weges, hinter dem unaufhörlichen Summen und Brummen der Menschen und Maschinen hören Sie die Geräusche des Gemetzels, die Schreie der Bauern kurz vor ihrem Tod, das Flehen eines Kaisers, dem ein Schwert an die Kehle gehalten wird.
Hören Sie es?
Wenn man geweihten Boden betritt, den der Wahnsinn mit Blut getränkt hat, hören Sie es: Nanking, Thessaloniki, Warschau. Wenn Sie genau hinhören, werden Sie begreifen, dass es immer da ist und niemals vollkommen zum Verstummen gebracht werden kann, weder durch Gebete, noch durch Gesetze und auch nicht durch den Lauf der Zeit. Die Geschichte der Welt und die Chroniken ihrer Verbrechen sind die langsame, düstere Musik der Toten.
Da.
Hören Sie es?
Ich höre es. Ich bin der, der im Schatten geht und dessen Ohren an die Nacht gewöhnt sind. Ich bin der, der sich in den Räumen versteckt, wo Verbrechen begangen wurden und in denen niemals wieder Stille einkehrt, denn alle Ecken beherbergen jetzt und für alle Zeit wispernde Geister. Ich höre Fingernägel, die über Granitwände kratzen, das Tröpfeln von Blut auf Natursteinfliesen, die zischende Luft, die in eine tödliche Brustwunde dringt. Manchmal wird das alles zu viel und zu laut, und dann muss ich es herauslassen.
Ich bin der Mann, der alles hört.
Jedes Geräusch.
Sonntagmorgens stehe ich früh auf, dusche und frühstücke zu Hause. Ich trete auf die Straße. Es ist ein herrlicher Herbsttag. Der Himmel ist klar und strahlend blau. In der Luft liegt der zarte Duft von welkem Laub.
Als ich die Pine Street hinuntergehe, spüre ich das Gewicht der drei Mordinstrumente im Rücken unter dem Hosenbund. Ich betrachte die Augen der Passanten oder zumindest jener, die meinen Blick erwidern. Immer wieder bleibe ich stehen, lausche intensiv und höre die Geräusche der Vergangenheit. In Philadelphia wohnt der Tod an so vielen Orten. Ich sammle die geisterhaften Geräusche wie andere Menschen Kunstwerke, Andenken an den Krieg oder Liebhaber sammeln.
Wie bei so vielen anderen auch, die sich im Laufe der Jahrhunderte mit der Kunst abgeplagt haben, bleibt meine Arbeit größtenteils unbemerkt. Daran soll sich etwas ändern. Dies wird mein Meisterwerk sein, an dem alle anderen für immer gemessen werden. Es hat schon begonnen.
Ich schlage den Kragen hoch und setze meinen Weg fort.
Klipp-klapp, klipp-klapp.
Wie ein Skelett bahne ich mir rasselnd den Weg durch die belebten Straßen.
Kurz nach acht bin ich auf dem Fitler Square, auf dem sich wie erwartet viele Menschen aufhalten – Radfahrer, Jogger, die Obdachlosen, die sich aus einer nahe gelegenen Passage hierhergeschleppt haben. Einige dieser Obdachlosen werden den Winter nicht überleben. Bald werde ich ihren letzten Atemzug hören.
Ich stehe in der Nähe der Widderskulptur am östlichen Ende des Platzes, beobachte alles und warte. Nach ein paar Minuten sehe ich sie: Mutter und Tochter.
Sie sind genau das, was ich brauche.
Ich überquere den Platz, setze mich auf eine Bank, packe die Zeitung aus und falte sie zwei Mal. Es ist unbequem mit den Mordinstrumenten im Kreuz. Ich verändere meine Haltung, als der Geräuschpegel steigt: das Flattern und Gurren der Tauben, die sich um einen Mann scharen, der ein Brötchen isst; die Hupe eines Taxis; das laute Dröhnen eines Basslautsprechers. Ich schaue auf die Uhr und stelle fest, dass nicht mehr viel Zeit bleibt. Bald wird mein Kopf von Schreien erfüllt sein, und dann kann ich nicht mehr das tun, was ich tun muss.
Ich betrachte die junge Mutter und ihr Baby, wechsle einen Blick mit der Mutter und lächle.
»Guten Morgen«, sage ich.
Die Frau lächelt zurück. »Hallo.«
Das Kind liegt in einem teuren Baby-Jogger mit einem wasserdichten Verdeck und einem Einkaufskorb. Ich stehe auf, überquere den Weg und spähe hinein. Es ist ein Mädchen, das in einem rosafarbenen Strampler und mit einer passenden Mütze auf dem Kopf unter einer schneeweißen Decke liegt. Über seinem Kopf baumeln helle Plastiksterne.
»Und wer ist dieses kleine Filmsternchen?«, frage ich.
Die Frau strahlt. »Das ist Ashley.«
»Ashley. Sie ist sehr hübsch.«
»Danke.«
Ich achte darauf, dem Baby nicht zu nahe zu kommen. Noch nicht. »Wie alt ist sie?«
»Vier Monate.«
»Das ist ein fantastisches Alter«, erwidere ich augenzwinkernd. »Ich glaube, das war die beste Zeit meines Lebens.«
Die Frau lacht.
Es hat geklappt.
Ich schaue zum Baby-Jogger. Das Baby lächelt mich an. Ich sehe so vieles in seinem engelhaften Gesicht. Aber es ist nicht der hübsche Anblick, der mich antreibt. Die Welt ist voll von schönen Bildern, atemberaubenden Aussichten, die oft in Vergessenheit geraten, sobald man die nächste idyllische Landschaft sieht. Ich habe vor dem Tadsch Mahal, der Westminster Abbey und dem Grand Canyon gestanden. Einmal habe ich einen ganzen Nachmittag vor Picassos Guernica verbracht. All diese herrlichen Bilder verblassen in relativ kurzer Zeit in den düsteren Winkeln der Erinnerungen. Doch ich erinnere mich ganz deutlich an das erste Mal, als ich jemanden vor Angst habe schreien hören, an das Jaulen eines Hundes, der von einem Auto angefahren wurde, den sterbenden Atem eines jungen Polizisten, der auf einem heißen Bürgersteig verblutete.
»Schläft sie nachts schon durch?«
»Nicht ganz«, erwidert die Frau.
»Meine Tochter schlief schon mit zwei Monaten durch. Wir hatten nie Probleme mit ihr.«
»Sie Glückspilz.«
Ohne die geringste Eile an den Tag zu legen, greife ich in meine rechte Manteltasche, umfasse das, was ich brauche, und ziehe es heraus. Die Mutter steht nur zwei Schritte von mir entfernt auf meiner linken Seite. Sie sieht nicht, was ich in der Hand halte.
Das Baby strampelt unter der Decke mit den Beinen. Ich warte. Ich bin ein sehr geduldiger Mensch. Das Baby muss ruhig sein und darf sich nicht bewegen. Bald beruhigt es sich wieder und starrt mit seinen blauen Augen zum Himmel hoch.
Ich strecke die rechte Hand langsam aus, um die Mutter nicht zu erschrecken. Dann berühre ich behutsam die linke Handfläche des Babys. Die Kleine schließt ihre winzige Faust um meinen Finger und gluckst. Wie ich gehofft habe, beginnt sie darauf, vor Vergnügen zu kreischen.
Alle anderen Geräusche verstummen. In diesem Moment gibt es nur das Baby und diese himmlische Atempause von den Dissonanzen, die mich bei Tage bestürmen.
Ich drücke auf Aufnahme, halte das Mikrofon ein paar Sekunden vor den Mund des kleinen Mädchens, sammle die Töne, sammle einen Augenblick, der sonst im Nu verloren gegangen wäre.
Die Zeit vergeht nur langsam, zieht sich in die Länge wie eine nachklingende Coda.
Ich ziehe meine Hand zurück. Ich möchte nicht zu lange bleiben, um die Mutter nicht zu beunruhigen. Vor mir liegt ein ganzer Tag, und nichts kann mich davon abhalten, das zu tun, was ich tun muss.
»Sie hat Ihre Augen«, sage ich.
Das kleine Mädchen hat eindeutig nicht ihre Augen, doch keine Mutter widerspricht einem solchen Kompliment.
»Danke.«
Ich schaue auf den Himmel und die Häuser am Fitler Square. Es ist Zeit. »Es hat mich gefreut, mit Ihnen zu plaudern.«
»Mich auch«, erwidert die Frau. »Schönen Tag noch.«
»Danke. Den werde ich haben.«
Ich greife noch einmal in den Baby-Jogger, nehme eine der winzigen Hände des Babys in meine und schüttele sie leicht. »Es war schön, dich kennenzulernen, kleine Ashley.«
Mutter und Tochter kichern.
Es ist alles in Ordnung.
Kurz darauf gehe ich die Dreiundzwanzigste Straße hinauf Richtung Delancey Street. Ich nehme das digitale Aufnahmegerät heraus, stöpsle den kleinen Stecker für die Ohrhörer ein und spiele die Aufnahme ab. Gute Qualität mit wenig Hintergrundgeräuschen. Die Stimme des Babys ist klar und deutlich.
Als ich in den Transporter steige und in den Süden von Philadelphia fahre, denke ich über diesen Morgen nach und freue mich, dass sich alles gut zusammenfügt.
In mir leben Harmonie und Melodie Seite an Seite, gewaltige Stürme an einem sonnenbeschienenen Ufer.
Ich habe den Beginn des Lebens eingefangen.
Jetzt nehme ich das Ende auf.
2.
»Ich heiße Paulette, und ich bin Alkoholikerin.«
»Hallo, Paulette.«
Ihr Blick wanderte über die Gruppe. Heute waren mehr Leute gekommen als in der letzten Woche. Es waren fast doppelt so viele wie beim ersten Mal, als sie das Gruppentreffen in der Methodistenkirche vor fast einem Monat besucht hatte. Vorher war sie bei drei Treffen an drei unterschiedlichen Orten gewesen – im Norden, im Westen und im Süden von Philadelphia. Sie erfuhr jedoch schnell, dass die meisten Menschen, die regelmäßig zu Treffen der Anonymen Alkoholiker gingen, irgendwann eine Gruppe fanden, in der sie sich wohlfühlten und in der sie blieben.
Etwa zwanzig Personen, unter denen sich ebenso Männer wie Frauen, Junge wie Alte, Nervöse wie Ruhige befanden, saßen in einem lockeren Kreis. Die Jüngste war eine Frau um die zwanzig und der älteste Teilnehmer ein Mann in den Siebzigern, der in einem Rollstuhl saß. Schwarze, Weiße, Hispanoamerikaner und Asiaten nahmen an dem Treffen teil. Die Alkoholsucht kann Menschen aller Nationalitäten, jeden Geschlechts und Alters gleichermaßen treffen. Die Größe der Gruppe wies darauf hin, dass Feiertage bevorstanden. Wenn irgendetwas dazu angetan war, Gefühle wie Unzulänglichkeit, Groll und Wut wachzurufen, dann waren es Feiertage.
Der Kaffee schmeckte wie immer scheußlich.
»Einige von euch haben mich bestimmt schon mal hier gesehen«, begann sie und versuchte, einen unbeschwerten Ton anzuschlagen. »Ach, wem will ich denn hier was vormachen? Vielleicht irre ich mich auch. Vielleicht ist es egoistisch, nicht wahr? Vielleicht denke nur ich, ich sei nichts wert, und sonst denkt das niemand. Vielleicht ist genau das das Problem. Jedenfalls habe ich heute zum ersten Mal den Mut zu sprechen. Hier bin ich also, und ihr könnt euch anhören, was ich zu sagen habe. Zumindest für eine Weile. Ihr habt Glück.«
Als sie ihre Geschichte erzählte, wanderte ihr Blick über die Leute hinweg. Rechts von ihr saß ein junger Mann Mitte zwanzig mit stahlblauen Augen, in einer zerrissenen Jeans und einem bunten Ed-Hardy-T-Shirt, unter dem sich die Muskeln abzeichneten. Sie schaute mehrmals zu ihm hinüber und sah, dass sein Blick über ihren Körper glitt. Er war vielleicht Alkoholiker, mit Sicherheit aber auf ein Abenteuer aus. Neben ihm saß eine Frau um die fünfzig. Geplatzte Äderchen im Gesicht zeugten von jahrzehntelangem starkem Alkoholmissbrauch. Sie ließ das Handy immer wieder über ihre verschwitzte Handfläche rollen und trat mit einem Fuß zu einem längst verhallten Takt auf den Boden. Ein paar Plätze weiter saß eine kleine Blondine in einem grünen Sweatshirt mit dem Aufdruck der Temple University. Sie hatte eine sportliche Figur, und das Gewicht der Welt war nur eine Schneeflocke auf ihren Schultern. Neben ihr saß Nestor, der Gruppenleiter. Nestor hatte das Treffen mit seiner eigenen kurzen, traurigen Geschichte eröffnet und dann gefragt, ob noch jemand sprechen wolle.
Ich heiße Paulette.
Als sie ihre Geschichte beendete, klatschten alle höflich. Anschließend standen andere Teilnehmer auf, sprachen und weinten. Es wurde wieder geklatscht.
Nachdem alle ihre Geschichten erzählt und ihre Gefühle herausgelassen hatten, streckte Nestor beide Arme zur Seite aus. »Lasst uns danken und beten.«
Sie reichten sich die Hände, sprachen ein kurzes Gebet, und dann war das Treffen vorüber.
»Es ist nicht so einfach, wie es aussieht, nicht wahr?«
Sie drehte sich um. Es war der Typ mit den stahlblauen Augen. Es war kurz nach zwölf, und sie standen vor dem Haupteingang der Kirche zwischen zwei verkrüppelten braunen Nadelbäumen, denen die Jahreszeit schon zu schaffen machte.
»Weiß nicht«, erwiderte sie. »Es fiel mir jedenfalls nicht leicht, mich dazu durchzuringen.«
Der Typ lachte. Er hatte eine kurze cognacfarbene Lederjacke angezogen und eine bernsteinfarbene Serengeti-Sonnenbrille über den Saum seines T-Shirts gehängt. Er trug schwarze Stiefel mit dicken Sohlen.
»Ja, ich glaube, du hast recht.« Er faltete die Hände vor der Brust und wippte auf den Absätzen. Ich bin in Ordnung, mach dir keine Sorgen, sollte die Pose ihr vermitteln. »Es ist eine Weile her, seitdem ich es zum ersten Mal gemacht habe.« Er reichte ihr die Hand. »Du heißt Paulette, richtig?«
»Und ich bin Alkoholikerin.«
Der Typ mit den stahlblauen Augen lachte. »Ich auch, und ich heiße Danny.«
»Freut mich, dich kennenzulernen, Danny.« Sie schüttelten sich die Hand.
»Eines kann ich dir jedenfalls versprechen«, erklärte er ihr, ohne gefragt worden zu sein. »Es wird einfacher.«
»Der Verzicht?«
»Ich wünschte, das könnte ich behaupten. Nein, ich meine das Sprechen. Sobald du dich in die Gruppe integriert hast, wird es etwas einfacher, deine Geschichten zu erzählen.«
»Geschichten? Im Plural? Ich dachte, das wäre es gewesen.«
»Nein, das ist ein Irrtum. Es ist ein Prozess, der eine ganze Weile andauert.«
»Okay. Und wie lange?«
»Hast du den Mann in dem roten Flanellhemd gesehen?«
Danny meinte den alten Mann in den Siebzigern, der im Rollstuhl saß. »Was ist mit dem?«
»Er kommt seit sechsunddreißig Jahren zu den Treffen.«
»Mein Gott. Er hat seit sechsunddreißig Jahren keinen Alkohol getrunken?«
»Das behauptet er jedenfalls.«
»Und er hat noch immer das Bedürfnis zu trinken?«
»Das hat er gesagt.«
Danny schaute auf seine Uhr, einen auffallend großen Fossil-Chronografen. Die Geste sah nicht ganz so kalkuliert und einstudiert aus, wie sie es wahrscheinlich war. »Hör zu. Ich brauche erst in ein paar Stunden wieder zu arbeiten. Darf ich dich zu einer Tasse Kaffee einladen?«
»Ich weiß nicht«, entgegnete Paulette misstrauisch.
Danny hob die Hände. »Ganz unverbindlich. Nur eine Tasse Kaffee.«
Sie lächelte. »Irish?«
»Böse Paulette. Böse, böse Paulette.«
Sie lachte. »Okay.«
Sie wählten ein Lokal in der Germantown Avenue und suchten sich einen Tisch am Fenster. Ihr Gespräch drehte sich um Filme, Mode und die Wirtschaft. Paulette aß einen Obstsalat. Er trank einen Kaffee und aß einen Cheeseburger. Weder das eine noch das andere hatte einen Stern verdient. Etwa eine Viertelstunde später hielt Paulette ihr iPhone hoch und tippte auf den Touchscreen. Sie wählte keine Nummer und verschickte keine SMS oder E-Mail. Sie nahm weder einen Eintrag in die Kontaktliste vor, noch fügte sie einen Termin in iCal hinzu. Stattdessen machte sie ein Foto von dem Typen mit den stahlblauen Augen. Heute Morgen hatte sie die Option ausgeschaltet, die das Geräusch einer klickenden Kamera mit dem Vorgang selbst verband. Anschließend schaute sie scheinbar enttäuscht aufs Display, als stimme etwas nicht. Das war nicht der Fall. Das Foto, das der junge Mann nicht sehen konnte, war perfekt.
»Probleme?«, fragte er.
Paulette schüttelte den Kopf. »Nein, ich bekomme nur in dieser Gegend nie ein Signal.«
»Vielleicht bekommst du draußen ein Signal«, sagte Danny. Er stand auf und zog sich die Jacke über. »Willst du es mal probieren?«
Sie drückte auf eine andere Taste, wartete, bis der Fortschrittsbalken auf der rechten Seite ankam, und sagte: »Klar.«
»Komm«, sagte Danny. »Ich bezahl schnell.«
Sie gingen langsam die Straße hinunter und sahen sich schweigend die Schaufenster an.
»Wolltest du nicht telefonieren?«, fragte Danny.
Sie schüttelte den Kopf. »Ist nicht wichtig. Wollte nur meine Mutter anrufen. Sie sagt mir sowieso nur immer, was für eine Loserin ich bin. Das kann warten.«
»Wir könnten verwandt sein«, meinte Danny. »Eng verwandt. Ich glaube, wir haben dieselbe Mutter.«
»Du kamst mir gleich bekannt vor.«
Danny schaute sich um. »Wo hast du geparkt?«
»Hier entlang.«
»Soll ich dich zum Auto bringen?«
Paulette blieb stehen. »Nein, nein.«
»Wie bitte?«
»Du willst mir doch wohl nicht erzählen, dass du ein Gentleman bist, oder?«, sagte sie in kokettem Ton.
Danny hob die Hand und streckte wie ein Pfadfinder drei Finger in die Luft. »Nein, bin ich nicht. Ich schwöre.«
Sie kicherte. »Klar.«
Sie bogen an einer Ecke in eine düstere Gasse ein und steuerten auf den Parkplatz zu. Noch bevor sie drei Schritte gegangen waren, sah sie einen Revolver aufblitzen.
Mit seinen starken Armen presste Danny sie gegen die Mauer und näherte sich ihrem Gesicht bis auf wenige Zentimeter.
»Siehst du den roten Sebring da hinten?«, flüsterte er und wies mit dem Kinn auf den Chrysler, der am Ende der Gasse parkte. »Hör genau zu, was ich sage. Wir gehen jetzt zu dem Wagen, und du steigst ein. Wenn du Schwierigkeiten machst oder auch nur einen einzigen Laut von dir gibst, schieße ich dir eine Kugel in den Kopf, kapiert?«
»Ja.«
»Zweifelst du an meinen Worten?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Ich will, dass du es laut sagst. Ich will, dass du sagst: ›Ich habe es verstanden, Danny.‹«
»Ich habe es verstanden, Danny.«
»Gut, gut«, sagte er. »Paulette.« Er legte eine Hand auf ihren Körper und lehnte sich zurück. »Weißt du, du hast echt geile Titten. Du hast zwar so ein schlabberiges Scheißding an, um sie zu verbergen, aber das klappt nicht. Und du bist eine verdammte Säuferin. Weißt du, wie heiß mich das macht?«
Sie starrte ihn an.
»Ich persönlich habe noch nie in meinem Leben getrunken. Ich habe nur diese Schwäche für schwache Frauen. Hatte ich schon immer.«
Er strich mit der linken Hand langsam über ihre rechte Hüfte, mit der anderen umklammerte er die Waffe. Er lächelte.
»Ich glaube, wir machen es gleich hier. Was meinst du?«
»Du tust mir doch nichts?«
»Nein. Aber gib es zu, Paulette. Es ist doch sehr erregend, es in der Öffentlichkeit zu tun, und dann auch noch mit einem völlig Fremden.« Er zog den Reißverschluss seiner Hose herunter. »Und das ist der Grund, warum du trinkst, nicht wahr? Weil du dich selbst hasst? Weil du eine Nutte bist?«
Sie wusste nicht, ob das wirklich Fragen waren, und schwieg.
Er fuhr fort.
»Natürlich. Und weißt du was? Ich wette, du hast im Laufe der Jahre ganz schön gesoffen und mit vielen Typen in dunklen Gassen gevögelt. Stimmt’s?«
Das war jetzt auf jeden Fall eine Frage. Als sie ihm keine Antwort gab, zog er den Revolver unter dem Hosenbund hervor und stieß ihn ihr zwischen die Beine. Mit voller Wucht.
»Beantworte meine Frage, verdammt!«
»Ja.«
Er stieß ihr immer wieder den Revolver zwischen die Beine. »Sag es.«
»Ich habe mit vielen Typen in dunklen Gassen gevögelt.«
»Und es hat dir Spaß gemacht.«
»Und es hat mir Spaß gemacht.«
»Weil du eine Scheißnutte bist.«
»Weil ich eine Scheißnutte bin.«
»Das dachte ich mir.« Er steckte die Waffe wieder unter den Hosenbund. »Kanntest du die andere Frau? Sie hat es mir schwer gemacht. Sie hätte nicht zu sterben brauchen.«
»Die andere Frau?«
»Die Rothaarige. Die Dicke. Marcy oder so ähnlich stand in den Zeitungen. Sie roch wie eine billige Nutte, und das war sie auch.«
Er beugte sich vor und schnüffelte an ihrem Haar.
»Du riechst nicht billig. Du riechst gut.«
Ein Schatten kroch langsam über die Erde, bis er vor ihren Füßen ankam. Danny sah es und wirbelte herum.
Hinter ihm stand, keine zwei Schritte entfernt, die kleine Blondine aus der Gruppe der Anonymen Alkoholiker, die mit dem grünen Kapuzenshirt der Temple University. Sie hielt eine Glock 17 in der Hand, die auf Dannys Brust gerichtet war.
»Ich heiße Nicci«, sagte die Blondine. »Und ich bin Polizistin.«
»Hi, Nicci«, begrüßte Detective Jessica Balzano sie.
Während des Undercover-Einsatzes in den vergangenen drei Wochen hatte Jessica Paulette gespielt, um den Killer der Anonymen Alkoholiker zu schnappen. Sie hieß nur Paulette – ohne Familiennamen. Jessica stellte schnell fest, dass bei den Anonymen Alkoholikern niemand einen Familiennamen hatte.
Hinter Detective Nicolette Malone standen zwei weitere Detectives und ein erfahrener Streifenbeamter namens Stan Keegan. An beiden Enden der Gasse standen zwei Streifenwagen.
Danny warf Jessica einen Blick zu. Seine Hände zitterten jetzt. »Du bist Polizistin?«
Jessica trat zurück, zog ihre Waffe aus dem Rückenholster unter dem Hosenbund und richtete sie auf ihn. »Hände hinter den Kopf!«
Danny zögerte. Sein Blick wanderte von einer Seite zur anderen.
»Brauchst du eine Einladung?«
Danny erstarrte.
»Wie du willst«, sagte Jessica. »Aber wenn du nicht tust, was ich sage, wirst du hier sterben. Und dann auch noch in einem Ed-Hardy-T-Shirt. Mit offener Hose. Deine Entscheidung.«
Der Verdächtige, der mit richtigem Namen Lucas Anthony Thompson hieß, schien nun zu begreifen, in welcher Lage er sich befand. Entweder verließ er diese Gasse in Handschellen oder in einem Sarg. Sein Wille war gebrochen. Er ließ die Schultern hängen und faltete die Hände hinter dem Kopf.
Jessica hatte das schon hundertmal erlebt. Und es wärmte ihr immer wieder das Herz.
Sie hatten ihn geschnappt!
Nicci Malone trat vor, zog die Waffe unter dem Hosenbund des Verdächtigen hervor und reichte sie Officer Keegan, der sie in eine Beweistüte steckte. Dann trat Nicci dem Verdächtigen die Beine weg. Er stürzte bäuchlings zu Boden. Sofort darauf drückte Nicci ihm ein Knie ins Kreuz und legte ihm Handschellen an.
»Kaum zu glauben, wie blöd du bist«, sagte sie.
Jessica steckte ihre Waffe ins Holster und trat vor. Sie packten beide einen Arm des Verdächtigen und rissen ihn hoch.
»Wir verhaften dich wegen Mordes an Marcia Jane Kimmelman«, sagte Jessica. Sie las ihm seine Rechte vor. »Hast du das verstanden?«
Thompson nickte. Er war noch immer wie benommen.
»Du musst laut antworten«, sagte sie. »Du musst laut ›Ja‹ sagen.«
»Ja.«
»Ich möchte, dass du sagst: ›Ja, ich habe es verstanden, Detective Balzano.‹«
Thompson sagte kein Wort. Er hatte sich noch nicht von dem Schock erholt.
Gut, dachte Jessica. Den Versuch war es wert. Sie griff in die Hosentasche und zog ein kleines Aufnahmegerät heraus. Sie spulte zurück und drückte auf Play.
Kanntest du die andere Frau? Sie hat es mir schwer gemacht. Sie hätte nicht zu sterben brauchen.
Jessica schaltete das Gerät aus. Thompson ließ den Kopf hängen.
Sie hatten genug gegen ihn in der Hand. Eine Augenzeugin, eine verwertbare DNA-Probe, die Ergebnisse der Ballistik. Die Aufnahme war nur das Tüpfelchen auf dem i. Die Staatsanwaltschaft liebte derartige Beweise. Manchmal war eine Aufnahme auch ausschlaggebend.
Als Thompson von Streifenbeamten abgeführt wurde, lehnte Officer Stan Keegan sich gegen die Mauer, verschränkte die Arme über seiner breiten Brust und grinste übers ganze Gesicht.
»Was ist denn daran so lustig?«, fragte Jessica.
»Ihr beide«, sagte er. »Ich überlege die ganze Zeit, wer von euch beiden Batman und wer Robin ist.«
»Batman? Träum weiter, Sterblicher«, erwiderte Jessica. »Ich bin Wonder Woman.«
»Und ich bin She-Hulk«, meinte Nicci.
Die beiden Frauen stießen ihre Fäuste aneinander.
Neben dem Streifenwagen stand ein junger Mann und sprach mit einem der uniformierten Polizisten. Es war ein großer, schlaksiger, dunkelhaariger Typ, der überschüssige Energie zu haben schien. Er hatte einen digitalen Camcorder bei sich, der ziemlich teuer aussah. Jessica überlegte kurz, und dann fiel ihr ein, wer das war und was er hier machte.
Sie hatte in der letzten Woche sein Memo bekommen und es dann ganz vergessen. Jemand von der Pennsylvania State University drehte einen Dokumentarfilm über die Mordkommission nach dem Motto: normaler Arbeitstag eines Detectives. Sie waren von höchster Stelle angewiesen worden zu kooperieren. In dem Memo stand, dass der Filmemacher sie eine Woche lang begleiten würde.
Als Jessica auf den jungen Mann zuging, bemerkte er sie. Er strich sich mit der freien Hand übers Haar und reckte sich.
»Hallo«, sagte er. »Ich bin David Albrecht.«
»Jessica Balzano.«
Sie reichten sich die Hand. David Albrecht trug ein langärmeliges T-Shirt mit dem Logo der Nittany Lions und eine Kette mit einem goldenen Kreuz. Er war glatt rasiert bis auf einen kleinen blondierten Fleck unter der Unterlippe. Und dieses winzige Unterlippenbärtchen war das Einzige, was seinen femininen Gesichtszügen einen männlichen Touch verlieh.
»Ich kenne Sie irgendwoher«, sagte er und schüttelte begeistert ihre Hand.
»Ach ja? Und woher?«, fragte Jessica und zog ihre Hand zurück, ehe er ihr den Arm abriss.
Albrecht lächelte. »Ich habe recherchiert. In diesem Artikel vor ein paar Jahren im Philadelphia Magazine über die neue Generation der weiblichen Detectives stand auch etwas über Sie. Erinnern Sie sich?«
Jessica erinnerte sich gut an den Artikel. Sie hatte sich dagegen gewehrt, den Kampf jedoch verloren. Natürlich war sie nicht gerade versessen darauf, dass Details ihres Privatlebens veröffentlicht wurden. Auch ohne dies dienten Polizisten und vor allem Detectives Verrückten oft genug als Zielscheibe.
»Ich erinnere mich«, sagte Jessica.
»Und ich habe den Fall des Rosenkranzmörders intensiv verfolgt.«
»Verstehe.«
»Damals ging ich noch zur Highschool«, sagte Albrecht. »Ich habe eine katholische Schule besucht. Der Fall hat uns alle furchtbar mitgenommen.«
Highschool, dachte Jessica. Der Typ ging damals zur Highschool. Ihr kam es vor, als wäre es gestern gewesen.
»Das war übrigens ein tolles Foto von Ihnen auf dem Cover der Zeitschrift«, fuhr Albrecht fort. »Wie Lara Croft. Viele Mitschüler von mir hatten Ihr Foto eine Zeit lang an der Wand hängen.«
»Sie wollen also einen Film drehen?«, fragte Jessica, um das Thema zu wechseln.
»Ich will es versuchen. Es ist etwas ganz anderes, eine Dokumentation oder einen Kurzfilm zu drehen. Bisher habe ich hauptsächlich Webisodes gemacht.«
Jessica wusste nicht genau, was Webisodes waren.
»Sie sollten mal auf meine Seite gehen und sich ein paar ansehen«, schlug Albrecht vor. »Ich glaube, sie werden Ihnen gefallen.«
Er reichte ihr eine Karte mit seinem Namen und einer Webadresse.
Jessica war so höflich, einen Blick auf die Karte zu werfen, ehe sie sie einsteckte. »Okay«, sagte sie. »Ich habe mich gefreut, Sie kennenzulernen, David. Wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung.« Das meinte sie selbstverständlich nicht ernst. Sie deutete auf den Polizei-Transporter, der soeben eingetroffen war. »Jetzt muss ich aber.«
Albrecht hob eine Hand. »Kein Problem. Ich wollte mich nur kurz vorstellen.« Er strich sich wieder übers Haar. »Ich bleibe in Ihrer Nähe, aber Sie werden es gar nicht merken. Ich verspreche Ihnen, dass ich Ihnen nicht in die Quere komme. Ich mache mich unsichtbar.«
Unsichtbar, dachte Jessica. Da war sie aber gespannt.
Zwei Stunden später hatten sie den Papierkram erledigt, die Berichte geschrieben und den Verdächtigen im Verwaltungsgebäude der Polizei Ecke Achte und Race Street – im sogenannten Roundhouse – abgeliefert. Jetzt saß das Team im Restaurant Hot Potato Café auf der Girard Avenue.
Außer Jessica und Nicci Malone waren auch der erfahrene Detective Nick Palladino und Detective Dennis Stansfield – ein relativ neuer Kollege – mit dabei. Dennis Stansfield war Anfang vierzig und – zumindest seiner Meinung nach – der Traum aller Frauen. Seine Anzüge aus dem Ausverkauf saßen nie richtig, und er legte immer zu viel Aftershave auf. Zu seinen zahlreichen nervtötenden Angewohnheiten gehörte es, dass er ständig auf dem Sprung zu sein schien, als müsste er gerade woanders sein oder hätte etwas anderes zu tun, was viel wichtiger war als ein Gespräch mit den Kollegen.
Dennis Stansfield war erst ein paar Monate in der Abteilung und hatte sich noch mit niemandem angefreundet. Keiner wollte mit ihm zusammenarbeiten. Seine unangenehme Art war einer der Gründe. Seine nachlässige Arbeitsweise und seine verblüffende Fähigkeit, Zeugen dazu zu bringen, vollkommen dichtzumachen, waren zwei andere.
Jessica und Nicci saßen auf einer Seite des Tisches, Stansfield und Nick Palladino auf der anderen.
Nick Palladino, der von allen Dino genannt wurde, arbeitete schon eine halbe Ewigkeit beim Police Department Philadelphia. Er war ein Junge aus South Philly und verfügte über das Talent, Betrüger und Diebe aufzuspüren, an denen es in Philadelphia nicht mangelte.
Sie mussten alle noch ein paar Stunden arbeiten und tranken nur Kaffee oder Cola. Sie stießen miteinander an.
Lucas Anthony Thompson, sechsundzwanzig Jahre alt, wohnhaft in Port Richmond, war jetzt Gast mit Vollpension in den Zellen im Untergeschoss des Roundhouse. Er wurde des vorsätzlichen Mordes und der Vergewaltigung einer jungen Frau namens Marcia Jane Kimmelman angeklagt. Zeugenaussagen zufolge hatten die beiden sich bei einem Treffen der Anonymen Alkoholiker im Westen von Philadelphia kennengelernt. Da sich dort keiner mit Nachnamen vorstellte, wusste niemand, wer Thompson war. Sie hatten eine grobe Beschreibung, aber das war auch alles.
Auf einem unbebauten Grundstück in der Baltimore Avenue in der Nähe der Siebenundvierzigsten Straße fanden sie Marcias Leichnam. Sie war vergewaltigt und aus nächster Nähe mit einer.38er durch einen Kopfschuss getötet worden. Drei Monate später griff Thompson nach einem Treffen der Anonymen Alkoholiker in Kingessing eine andere junge Frau namens Bonnie Silvera an, die als Sekretärin bei Comcast arbeitete. Diese Frau überlebte. Die DNA ihres Angreifers, die anhand seines Spermas ermittelt werden konnte, stimmte mit der von Marcia Kimmelmans Mörder überein. Bonnie Silvera lieferte der Polizei eine detaillierte Beschreibung von Thompson. Daraufhin wurde eine Undercover-Operation eingeleitet, an der ein Dutzend Detectives beteiligt waren, die in sechs Stadtteilen ermittelten.
»Wie hast du ihn identifiziert?«, fragte Dino.
Nicci gab die Frage an Jessica weiter. »Erkläre es unserem Genie.«
»Die Audio-Videoabteilung hat uns ein bisschen geholfen«, sagte Jessica. »Als ich mit Thompson in dem Café saß, habe ich mit dem Handy ein Foto von ihm gemacht. Dieses Bild habe ich per MMS an Niccis Handy geschickt. Nicci und zwei Streifenbeamte saßen einen halben Block entfernt mit Bonnie Silvera im Transporter. Ein paar Sekunden später erhielt Nicci das Foto und zeigte es Bonnie. Die Zeugin erkannte ihren Angreifer zweifelsfrei wieder. Nicci schickte mir die Nachricht, dass wir ihn hatten und dass es losging.«
»Du hast diese Show abgezogen?«, fragte Dino.
Jessica pustete auf ihre Fingernägel und polierte sie demonstrativ an ihrer Bluse.
»Mein Gott, du bist eine gefährliche Frau.«
»Sag das der Welt.«
»Ich sollte es deinem Mann sagen.«
»Als ob der das nicht wüsste. Er streicht gerade den Zaun hinter unserem Haus. Später bitte ich ihn, mir ein Schaumbad einzulassen.«
Detective Dennis Stansfield, der sich vermutlich ausgeschlossen fühlte, meldete sich zu Wort. »Neulich habe ich in irgendeiner Zeitung eine Statistik gesehen, nach der die Durchschnittsamerikanerin in ihrem Leben zweiundvierzigeinhalb Kilometer Schwanz in sich aufnimmt.«
Wenn Jessica etwas hasste, dann einen Cop, der Witze über Sex riss, nachdem sie soeben über eine Vergewaltigung gesprochen hatten. Es war sogar noch schlimmer: Vergewaltigung und Mord. Eine Vergewaltigung hatte nichts mit Sex zu tun. Eine Vergewaltigung war ein brutaler Übergriff, der Macht demonstrieren sollte.
Stansfield schaute Jessica an. Hoffte er tatsächlich, dass sie jetzt nervös wurde, errötete und wegen seines blöden Witzes in Verlegenheit geriet? Sollte das ein Scherz sein? Jessica war in South Philly geboren und aufgewachsen, und dann auch noch als Tochter eines Cops. Sie konnte schon mit fünf Jahren fluchen wie ein Kutscher und kam immer total verdreckt vom Spielen nach Hause.
»Zweiundvierzig Kilometer, hm?«, fragte Jessica.
»Zweiundvierzigeinhalb«, erwiderte Stansfield.
Jessicas Blick glitt von Nicco zu Dino und zurück zu Stansfield. Dino schaute auf den Tisch. Er wusste nicht genau, was jetzt kam, aber er war sicher, dass irgendetwas kommen würde.
»Nur damit ich das richtig verstehe«, sagte Jessica und straffte die Schultern.
»Klar.«
»Wird bei diesen zweiundvierzigeinhalb Kilometern jedes einzelne Eindringen gezählt, oder werden die Schwänze aller Männer im Leben einer Durchschnittsamerikanerin addiert?«
Jetzt errötete Stansfield selbst ein wenig. »Hm, das weiß ich nicht. Das stand nicht in der Statistik.«
Nichts ruinierte einen dreckigen Witz so gründlich wie eine Diskussion darüber oder Analysen. »Nicht sehr wissenschaftlich, nicht wahr?«
»Hm, das war …«
»Wenn man jetzt jedes Eindringen zählt«, fuhr Jessica unbeirrt fort, »könnte das schon ein einziges heißes Wochenende bringen.« Sie lehnte sich zurück und verschränkte die Arme. »Wenn man allerdings jeden Schwanz nur einmal zählt … Da muss ich rechnen.« Sie wechselte einen Blick mit Nicci und zeigte auf Stansfield. »Wie oft gehen zehn Zentimeter in zweiundvierzig Kilometer?«
»Zweiundvierzigeinhalb«, sagte Nicci.
»Stimmt. Zweiundvierzigeinhalb.«
Jetzt war Stansfield so rot wie eine italienische Tomate. »Zehn Zentimeter? Hm, das glaube ich kaum, meine Liebe.«
Jessica drehte sich zu der Frau um, die am Nebentisch saß. »Hi, Kathy, habt ihr ein Lineal im Büro?« Kathy war Mitinhaberin des Hot Potato Cafés.
»Klar«, erwiderte Kathy augenzwinkernd. Auch sie war in Philly aufgewachsen und hatte das ganze Gespräch verfolgt. Wahrscheinlich hätte sie liebend gern ihren Senf dazugegeben.
»Okay, okay«, sagte Stansfield.
»Kommen Sie, Dennis«, sagte Jessica. »Legen Sie Ihr großes, heißes Prachtexemplar auf den Tisch.«
Auf einmal musste Stansfield ganz schnell weg. Er schaute auf die Uhr, trank seinen Kaffee aus, murmelte Tschüss und machte sich davon.
An einem Tag wie diesem waren Jessica alle Cro-Magnon-Männchen dieser Welt vollkommen gleichgültig. Sie hatten einen Mörder in Gewahrsam genommen und einen Haufen Beweise gegen ihn. Kein Bürger oder Polizist war im Verlauf der Verhaftung verletzt worden, und auf den Straßen trieb sich ein Verbrecher weniger herum. Besser ging es kaum.
Zwanzig Minuten später trennten sie sich. Jessica ging allein zu ihrem Wagen. Sie hatte den Einsatz gemeinsam mit ihren Kollegen mit Bravour gemeistert. In solchen Situationen durfte man keine Schwäche zeigen. Die erschreckende Wahrheit war jedoch, dass jemand eine Waffe auf sie gerichtet hatte. Im Bruchteil einer Sekunde hätte alles vorbei sein können, wenn der Schütze abgedrückt hätte.
Jessica trat in einen Hauseingang und überzeugte sich davon, dass sie nicht beobachtet wurde. Als sie die Augen schloss, glitt eine Woge der Angst über sie hinweg. Sie hatte ihren Ehemann Vincent, ihre Tochter Sophie und ihren Vater Peter vor Augen. Peter Giovanni, der schon seit Jahren im Ruhestand war, und Vincent Balzano waren beide Cops und kannten die Risiken. Jessica stellte sich vor, wie sich beide über ihren Sarg in der St.-Paul’s-Kirche beugten. Sie hörte die Klänge der Dudelsäcke.
Mein Gott, Jess, dachte sie. Lass es sein. Wenn du zulässt, dass deine Gedanken diese Richtung einschlagen, bist du verloren. Andererseits war sie im Grunde eine toughe Frau, oder nicht? Sie war Detective beim Philadelphia Police Department. Sie war die Tochter von Peter Giovanni.
Verdammt, vor ihr musste man sich in Acht nehmen.
Als sie dann an ihrem Wagen ankam, zitterten ihre Beine nicht mehr. Noch bevor sie die Tür öffnen konnte, bemerkte sie jemanden auf der anderen Straßenseite. Es war David Albrecht, über dessen Schulter die Kamera hing. Er filmte sie.
Los geht’s, dachte Jessica. Das wird eine lange Woche.
Als sie einstieg und den Motor startete, klingelte ihr Handy. Sie meldete sich und erfuhr etwas, was sie schon immer vermutet hatte.
Sie war nicht die Einzige in ihrer Familie, vor der andere sich in Acht nehmen mussten.
3.
Ich höre, dass ein Lieferwagen in die Einfahrt fährt. Kurz darauf klopft es an der Tür. Ich öffne sie. Vor mir steht ein Mann um die vierzig, der schon einen kleinen Bauchansatz hat. Er trägt einen roten Blouson, eine mit Farbflecken übersäte Jeans und ein paar schmutzige Laufschuhe mit ausgefransten Schnürsenkeln. Er hält ein Klemmbrett in der Hand.
»Mr. Marcato?«, fragt der Mann.
Marcato. Ich muss lächeln, als ich den Namen höre.
»Ja.« Ich reiche ihm die Hand. Die Hand des Mannes ist rau und von Schwielen und Farbflecken übersät. Er riecht nach Nikotin und Terpentin.
»Ich bin Kenny Beckman«, sagt er. »Wir haben telefoniert.«
»Stimmt. Kommen Sie doch rein.«
Im Eingangsbereich stehen nur ein paar Plastikmülltonnen und verstaubte Glasvitrinen.
»Puh, was ist denn das für ein Gestank?«, fragt Beckman.
»Das kommt von nebenan. Da war früher mal eine Metzgerei. Ich glaube, die haben in dem Laden Fleisch vergessen, das jetzt verrottet. Ich muss es ihnen sagen.«
»Das sollten Sie tun. Sie können hier kein Geschäft betreiben, wenn es so stinkt.«
»Natürlich nicht.« Ich zeige auf den Raum. »Wie Sie sehen, ist ganz schön was zu tun.«
»Das kann man wohl laut sagen.«
Langsam durchquert Beckman den Raum und streicht über die halb verfallene Wand und über die verstaubten Fensterbänke. Mit der Taschenlampe beleuchtet er die Fußbodenleisten. Er zieht einen Zollstock aus der Tasche, nimmt ein paar Maße und schreibt sie auf das Klemmbrett.
Ich beobachte ihn aufmerksam und versuche einzuschätzen, wie schnell und beweglich er ist.
»Die Bodenbalken hängen durch«, sagt er nach etwa einer Minute. Er hüpft mehrmals auf und nieder, um die morsche Stelle zu finden. Die alten Balken knarren unter seinem Gewicht. »Als Erstes müssen wir die Balken abstützen. Erst wenn der Boden eben ist, kann ich mit den anderen Arbeiten beginnen.«
»Machen Sie alles, was notwendig ist, um das in Ordnung zu bringen.«
Beckman lässt den Blick noch einmal durch den Raum gleiten, um sich eine endgültige Meinung zu bilden. »Es ist eine Menge Arbeit, aber ich glaube, das kriegen wir hin.«
»Gut. Mir wäre es am liebsten, wenn Sie gleich anfangen.«
»Hört sich gut an.«
»Sie wurden mir übrigens wärmstens empfohlen.«
»Ach ja? Von wem denn? Falls Sie mir die Frage gestatten.«
»Ich erinnere mich nicht mehr genau. Es ist schon eine Weile her.«
»Wie lange?«
»Es war am 21. März 2002.«
Als ich das Datum nenne, versteift Kenneth Beckman sich. Er tritt einen Schritt zurück und schaut auf die Tür. »Verzeihung? 2002? Habe ich das richtig verstanden?«
»Ja.«
»März 2002?«
»Ja.«
Er schaut wieder auf die Tür. »Das ist unmöglich.«
»Und warum?«
»Schon allein aus dem Grund, weil ich damals noch gar nicht im Geschäft war.«
»Das kann ich Ihnen erklären«, sage ich. »Kommen Sie. Ich möchte, dass Sie sich noch etwas ansehen.« Ich zeige auf den dunklen Korridor, der zum letzten Zimmer im Erdgeschoss führt. Beckman zögert. Vielleicht spürt er, dass hier etwas nicht ganz stimmt, ohne es genau benennen zu können. Aber er braucht den Auftrag, auch wenn er für einen Sonderling arbeiten soll, der in Rätseln spricht.
Wir gehen den Korridor hinunter. Als wir vor dem Zimmer ankommen, stoße ich die Tür auf. Hier ist der Gestank noch viel intensiver.
»Verdammt!«, ruft Beckman und weicht zurück. Er greift in die Gesäßtasche, zieht ein schmutziges Taschentuch heraus und presst es sich auf den Mund. »Warum zum Teufel stinkt es hier so?«
Der kleine, quadratische Raum ist makellos sauber. In der Mitte stehen zwei Stahltische, die beide im Boden verschraubt sind. Die pechschwarzen Wände wurden aufwendig schallgedämpft. Die niedrige Decke ist mit Akustikplatten verkleidet, die ich per Post bei einer Schweizer Firma bestellt habe, die sich darauf spezialisiert hat, die besten Aufnahmestudios der Welt auszurüsten. Über den Tischen hängt ein Mikrofon. Der Boden ist mit Hochglanzlack gestrichen, aus praktischen Gründen in roter Farbe. Unter den Tischen befindet sich ein Abflussloch.
Auf einem der Tische liegt unter einer weißen Plastikplane eine Gestalt auf dem Rücken, die bis zum Hals zugedeckt ist.
Als Beckman die Leiche sieht und begreift, was das ist, bekommt er weiche Knie.
Ich drehe mich zur Wand um und nehme ein Foto ab. Es ist ein Zeitungsausschnitt und die einzige Dekoration in dem Raum. »Sie war hübsch«, sage ich. »Keine ausgesprochene Schönheit wie zum Beispiel Grace Kelly, aber hübsch unter der ganzen Schminke.« Ich zeige ihm das Foto. »Finden Sie nicht?«
Das unbarmherzige Neonlicht beleuchtet Beckmans vor Angst verzerrtes Gesicht.
»Sagen Sie mir, was passiert ist«, fordere ich ihn auf. »Finden Sie nicht, es ist an der Zeit?«
Beckman weicht zurück und hebt abwehrend die Hand. »Sie sind verrückt, Mann. Ein Psychopath. Ich hau ab.« Er dreht sich um und versucht, die Tür zu öffnen. Sie ist verschlossen. Er drückt und zieht, drückt und zieht und wird immer hektischer, doch die Tür bleibt verschlossen. »Machen Sie die verdammte Tür auf!«
Anstatt die Tür zu öffnen, trete ich vor und ziehe das Tuch von dem Leichnam auf dem Tisch. Der Verwesungsprozess hat bereits eingesetzt. Die Augen sind in die Augenhöhlen gesunken; die Haut ist fahl und hat die Farbe überreifen Korns angenommen. Die Gestalt ist noch als Mensch zu erkennen, obwohl sie ausgemergelt ist und an der Schwelle zur vollständigen Verwesung steht. Die Hände sind grau und schrumpelig, die steifen Finger flehend ausgestreckt. Der ekelerregende Gestank löst bei mir keinen Brechreiz aus. Mittlerweile freue ich mich sogar immer ein wenig darauf.
Ich schaue auf den Zeigefinger der linken Hand des Leichnams. Er trägt das kleine Tattoo eines Schwans. Ich wende mich Beckman zu und sage in meinem besten gebrochenen Italienisch:
»Benvenuto al carnevale!«
Willkommen im Karneval.
Beckman taumelt und prallt gegen die Wand. Der Anblick der Leiche und der frische Verwesungsgestank erschrecken ihn zu Tode. Er versucht zu sprechen, doch die Worte bleiben ihm in der Kehle stecken.
Ich hebe den Taser und drücke ihn auf die Seite von Beckmans Brust. Blaue Blitze zucken durch die Luft. Der Mann bricht auf dem Boden zusammen.
Einen Augenblick lang herrscht Stille.
Grabesstille.
Ich ziehe die drei Mordinstrumente aus den Scheiden und lege sie neben den Profi-Haartrimmer auf den Tisch. Dann öffne ich den Geheimschrank, der hinter einer Tür mit Magnetschloss versteckt ist und in dem die Aufnahmegeräte stehen. Der Anblick des mattschwarzen Lacks der sechs staubfreien antistatischen Komponenten törnt mich geradezu an. Die Wärme, die die Geräte ausstrahlen – ich wärme immer alles mindestens eine Stunde vor einer Session vor –, treibt mir Schweißperlen auf die Stirn. Vielleicht ist es auch nur die Vorfreude.
Beckman ist an den Tisch gefesselt. Ich habe ihm Klebeband auf den Mund geklebt. Sein Kopf steckt in einer neurochirurgischen Kopfzwinge. Dieses Präzisionsgerät wird benutzt, um den Kopf des Patienten während eines stereotaktischen Eingriffs zu fixieren, bevor die Elektroden platziert werden. Bei dieser OP muss der Kopf absolut unbeweglich sein. Vor einem Jahr habe ich das Gerät bei einer deutschen Firma bestellt und per internationaler Postanweisung bezahlt. Ich habe es über mehrere Nachsendeaufträge erhalten.
Ich streife einen Operationskittel über, stelle mich neben den Tisch und klappe ein scharfes Rasiermesser auf. Mit dem Zeigefinger der linken Hand drücke ich auf die weiche Haut auf der Stirn des Mannes. Beckman brüllt in den Knebel, doch es ist nichts zu hören.
Das wird sich ändern.
Mit sicherer Hand füge ich ihm einen ersten Schnitt auf der Stirn zu, genau unterhalb des Haaransatzes. Ich lasse mir Zeit. Ich schaue zu, wie die Haut sich langsam teilt und das glänzende rosafarbene Gewebe darunter sichtbar wird. Die chirurgische Kopfzwinge funktioniert hervorragend. Der Mann kann den Kopf keinen Millimeter bewegen. Mit einem Fußpedal drücke ich auf Aufnahme und ziehe ihm anschließend den Knebel aus dem Mund.
Der Mann schnappt nach Luft. Aus den Mundwinkeln rinnt rosafarbener Schaum. Er hat sich auf die Zunge gebissen.
Er beginnt zu schreien.
Ich überprüfe die Lautstärke und reguliere sie ein wenig. Beckmann schreit wie am Spieß. Jetzt rinnt über beide Seiten seines Gesichts Blut auf den polierten Stahltisch und tropft dann auf den lackierten Boden.
Ein paar Minuten später wische ich das Blut mit einem Alkoholtupfer von Beckmans Stirn. Ich beginne mit der Arbeit an seinem rechten Ohr. Als ich fertig bin, nehme ich ein Maßband, messe von dem Schnitt auf der Stirn hinunter zum Ohr und markiere die Stelle mit einem roten Filzstift. Dann nehme ich das zweite Mordinstrument in die Hand und halte es ins Licht. Der Bohrer aus Carbonstahl schimmert dunkelblau.
Nach einem letzten Check der Lautstärke beginne ich mit dem vorletzten Akt. Bedächtig und besonnen – largo, könnte man sagen – fahre ich fort, in der Gewissheit, dass nur ein paar Schritte von hier auf der anderen Seite der Mauer das Leben in der Stadt Philadelphia seinen Lauf nimmt, ohne dass sie etwas von der Symphonie ahnt, die in diesem unscheinbaren Haus komponiert wird.
Sind nicht die größten Kunstwerke der Geschichte in bescheidener Umgebung entstanden?
Klipp-klapp, klipp-klapp.
Ich bin der rhythmische Tod.
Als der Bohrer die höchste Drehzahl erreicht und die rasiermesserscharfe Spitze sich der Haut nähert, die den Stirnknochen genau über dem rechten Auge bedeckt, erreichen die Schreie von Kenneth Arnold Beckman ein wunderbares Volumen, eine zweite Oktave. Die Stimme trifft nicht den richtigen Ton, aber das kann ich später noch korrigieren. Im Augenblick besteht kein Grund zur Eile. Nicht im Geringsten.
Wir haben den ganzen Tag Zeit.
4.
Sophie Balzano saß am einen Ende der langen Couch und sah noch kleiner aus als sonst.
Jessica betrat das Sekretariat, sprach mit der Sekretärin, betrat dann das Büro und sprach mit einer von Sophies Lehrerinnen der Sonntagsschule. Nach dem kurzen Gespräch kehrte sie zurück und setzte sich neben ihre Tochter. Sophie starrte auf ihre Schuhe.
»Möchtest du mir erzählen, was passiert ist?«, fragte Jessica.
Sophie zuckte mit den Schultern und schaute aus dem Fenster. Sie hatte langes Haar, das mit einer hübschen Spange im Nacken zusammengehalten wurde. Die Siebenjährige war etwas kleiner als ihre Freundinnen, dafür aber schnell und clever. Jessica war ohne Schuhe circa eins zweiundsiebzig, und sie hatte diese Größe irgendwann zwischen der sechsten und siebten Klasse erreicht. Sie fragte sich, ob es ihrer Tochter ähnlich ergehen würde.
»Schatz? Du musst Mama sagen, was passiert ist. Ich kann dir nur erklären, wie du es beim nächsten Mal besser machen kannst, wenn ich weiß, was passiert ist. Deine Lehrerin hat gesagt, du hast gerauft. Stimmt das?«
Sophie nickte.
»Hast du dir wehgetan?«
Sophie schüttelte den Kopf, allerdings recht verhalten. »Nein, es ist alles in Ordnung.«
»Sprechen wir im Auto darüber?«
»Okay.«
Als sie die Schule verließen, sah Jessica, dass einige Schüler die Köpfe zusammensteckten. Anscheinend hatte auch heutzutage und in dieser Altersstufe eine Rangelei auf dem Schulhof Tuscheleien zur Folge.
Sie fuhren die Academy Road hinunter. Als sie in die Grant Avenue einbogen und der Verkehr wegen einer Baustelle zum Erliegen kam, fragte Jessica: »Kannst du mir sagen, worum es bei dem Streit ging?«
»Es ging um Brendan.«
»Brendan Hurley?«
»Ja.«
Brendan Hurley ging in Sophies Klasse. Der dünne, ruhige Junge mit der Brille schien wie dazu geschaffen, von Mitschülern gehänselt zu werden. Sonst wusste Jessica nicht viel über ihn. Zum letzten Valentinstag hatte Brendan Sophie eine Karte geschenkt. Eine große, glitzernde Karte.
»Was ist mit Brendan?«, fragte Jessica.
»Ich weiß nicht«, sagte Sophie. »Ich glaube, es könnte sein …«
Der Verkehr lief weiter. Sie bogen vom Boulevard ab und in die Torresdale Avenue ein.
»Was, mein Schatz? Du glaubst, Brendan könnte was sein?«
Sophie schaute aus dem Fenster und dann zu ihrer Mutter. »Ich glaube, er ist schwuuul«, flüsterte sie.
Oje, dachte Jessica. Sie war auf vieles vorbereitet. Gespräche über das friedliche Miteinander, über Nationalitäten und Klassenunterschiede, über Geld und sogar über Religion. Auf ein Gespräch über geschlechtliche Identität war sie überhaupt nicht vorbereitet. Die Tatsache, dass ihre Tochter das Wort im Flüsterton sagte, sprach Bände. Offenbar hielten Sophie und ihre Klassenkameraden dieses Thema für ein heißes Eisen, über das man sich besser nicht laut äußerte. »Verstehe. Und wie kommst du darauf?«, fragte Jessica.
Sophie strich ihren Rock glatt. Es war nicht leicht für sie. »Er läuft wie ein Mädchen«, sagte sie schließlich. »Und er wirft auch die Bälle wie ein Mädchen.«
»Okay.«
»Aber das tue ich doch auch, oder?«
»Ja, tust du.«
»Dann ist es doch nicht schlimm.«
»Nein. Es ist überhaupt nicht schlimm.«
Sie fuhren in die Einfahrt, und Jessica schaltete den Motor aus. Sie hatte keine Ahnung, was Sophie über die sexuelle Orientierung eines Menschen wusste. Schon allein der Gedanke an den Begriff »sexuelle Orientierung« in Verbindung mit ihrem kleinen Mädchen ließ sie ausflippen.
»Was ist denn passiert?«, fragte Jessica.
»Dieses Mädchen hat gemeine Sachen über Brendan gesagt.«
»Welches Mädchen?«
»Monica«, sagte Sophie. »Monica Quagliata.«
»Geht sie in deine Klasse?«
»Nein. Sie ist in der dritten. Sie ist sehr groß und stark.« Sophie ballte die Fäuste – bewusst oder unbewusst.
»Was hast du zu ihr gesagt?«
»Ich hab gesagt, sie soll aufhören, so was zu sagen. Dann hat sie mich geschubst und mich Schlampe genannt.«
Dieses Miststück, dachte Jessica. Insgeheim hoffte sie, dass Sophie es diesem kleinen Biest ordentlich gezeigt hatte. »Was hast du dann getan?«
»Ich hab sie auch geschubst. Sie ist hingefallen, und alle haben gelacht.«
»Hat Brendan auch gelacht?«
»Nein. Brendan hat Angst vor Monica Quagliata. Alle haben Angst vor Monica Quagliata.«
»Aber du nicht.«
Sophie schaute aus dem Fenster. Es hatte zu regnen begonnen. Sie fuhr mit dem Finger über die beschlagene Scheibe und wandte den Blick dann wieder ihrer Mutter zu. »Nein. Ich nicht.«
Ja, dachte Jessica. Meine mutige kleine Tochter. »Ich möchte, dass du mir zuhörst, okay, Liebling?«
Sophie setzte sich gerade hin. »Kommt jetzt wieder einer deiner Vorträge?«
Jessica hätte beinahe gelacht, doch sie hielt sich im letzten Augenblick zurück. »Ja, ich glaub schon.«
»Okay.«
»Ich möchte, dass du daran denkst, dass eine Prügelei immer der allerletzte Ausweg ist, okay? Wenn du dich verteidigen musst, ist es in Ordnung. Immer. Und manchmal müssen wir auch auf Menschen aufpassen, die nicht selbst auf sich aufpassen können. Verstehst du, was ich meine?«
Sophie nickte, doch sie sah verwirrt aus. »Und was ist mit dir, Mama? Du hast dich doch ständig geprügelt.«
Oh, Scheiße, dachte Jessica. Die Logik einer Siebenjährigen.
Nachdem Sophie geboren wurde, hatte Jessica das Boxen für sich entdeckt. Dieser Sport unterstützte auch hervorragend ihre Bemühungen, nach der Schwangerschaft wieder abzunehmen. Aus irgendeinem Grund gefiel ihr diese Sportart. Sie ging sogar so weit, ein paar Amateurboxkämpfe zu bestreiten, ehe sie sich von ihrem großartigen Onkel Vittorio überreden ließ, in den Profisport einzusteigen. Wenn für weibliche Boxerinnen über fünfunddreißig keine Seniorenklasse eingerichtet wurde, lagen diese Zeiten nun endgültig hinter ihr. Jetzt hatte Jessica sich bei Joe Hand’s Gym angemeldet, wo sie sich auf eine Reihe von Schaukämpfen vorbereitete, um Geld für die Police Athletic League zu sammeln. Diese Organisation widmete sich der Jugendarbeit, wobei der Schwerpunkt auf sportlichen Aktivitäten lag.
Weder das eine noch das andere half ihr im Augenblick, ihrer Tochter den Unterschied zwischen Prügeln und Boxen zu erklären.
Plötzlich sah Jessica einen Schatten im Außenspiegel.
Vincent lief mit einer Pizzaschachtel von Santucci’s die Einfahrt hinauf. Ihr Mann mit den karamellbraunen Augen, den langen Wimpern und dem durchtrainierten Körper ließ Jessicas Herz noch immer höher schlagen. Jedenfalls an den Tagen, an denen sie nicht den Wunsch hatte, ihn umzubringen. Manchmal trug er Anzug und Krawatte, rasierte sich sorgfältig und kämmte sein dunkles Haar nach hinten. An anderen Tagen machte er auf betont lässig. Heute war einer dieser lässigen Tage. Jessica musste zugeben, dass sie ihn dann unwiderstehlich fand. Für einen verheirateten Mann sah Detective Vincent Balzano wirklich verdammt gut aus.
»Liebling?«, sagte Jessica.
»Ja, Mama?«
»Du weißt, worüber wir gerade gesprochen haben? Über den Unterschied zwischen Prügeln und Boxen?«
»Was ist damit?«
Jessica tätschelte die Hand ihrer Tochter. »Frag deinen Vater.«
Sie wohnten seit über fünf Jahren in Lexington Park im Nordosten von Philadelphia, wenige Straßen vom Roosevelt Boulevard entfernt. An guten Tagen brauchte Jessica fünfundvierzig Minuten bis zum Roundhouse. An schlechten Tagen – und das war meistens der Fall – noch länger. Doch das sollte sich bald ändern.
Sie hatten beschlossen, in ein Haus in South Philly zu ziehen, ein dreigeschossiges Reihenhaus, das alten Freunden gehörte. Auf diese Weise wechselten Häuser in Philadelphia oft die Besitzer. Es kam selten vor, dass sie im Kleinanzeigenteil der Zeitungen ausgeschrieben wurden.
Das Haus stand in unmittelbarer Nähe ihrer neuen Kirche, der Sacred Heart of Jesus, wo auch Sophies neue Schule war. Neue Freunde, neue Lehrer. Jessica fragte sich, welche Auswirkungen der Umzug wohl auf das kleine Mädchen haben würde.
Jessicas Vater, Peter Giovanni, gehörte zu den Cops mit den meisten Auszeichnungen in der Geschichte des Philadelphia Police Departments. Er lebte noch immer Ecke Sechste und Catharine in South Philly in dem Haus, in dem Jessica aufgewachsen war. Noch war Peter ein rüstiger, aktiver Mann, der sich in der Gemeinde engagierte. Doch er wurde älter, und eines Tages würde es für ihn eine große Anstrengung sein, die Fahrt zu seiner einzigen Enkeltochter auf sich zu nehmen. Aus diesem und vielen anderen Gründen zogen sie wieder zurück nach South Philly.
Als ihre Tochter fest schlief und Vincent sich mit seinen Brüdern im Keller vergnügte, stand Jessica auf der obersten Stufe der schmalen Treppe zum Speicher.
Es kam ihr fast so vor, als stecke ihr ganzes Leben in diesen Kartons in dem vollgestellten, verwinkelten Raum unter dem Dach. Fotos, Andenken, Auszeichnungen, Geburts- und Sterbeurkunden, Zeugnisse.
Sie nahm einen der Kartons, einen weißen Geschenkkarton von Strawbridge’s, um den grünes Garn gewickelt war, in die Hand. Mit diesem Garn hatte ihre Mutter früher ihr Haar im Herbst, wenn die Sommersonne ihrem brünetten Haar einen kastanienbraunen Ton verliehen hatte, zusammengebunden.