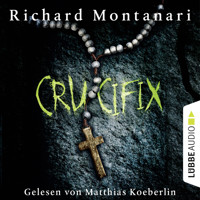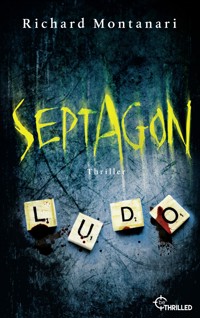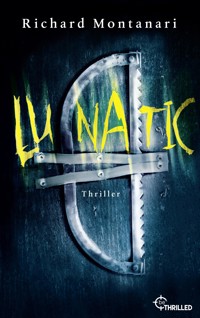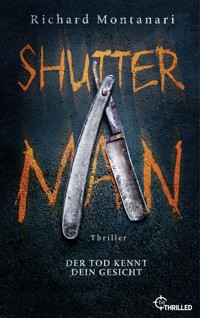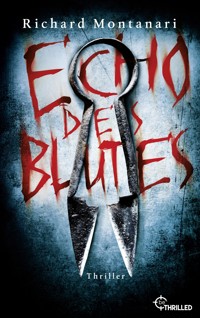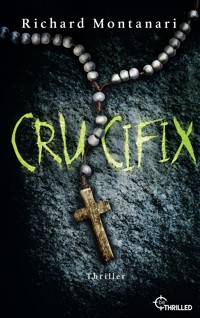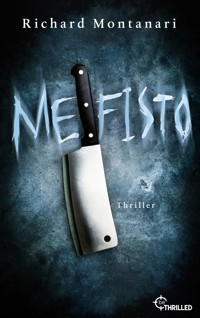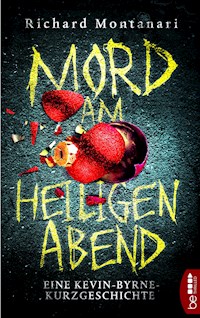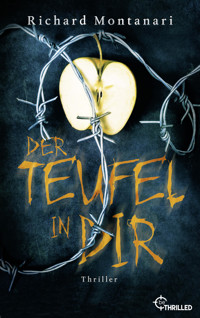
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Spannende Thriller mit Byrne und Balzano
- Sprache: Deutsch
Wenn du einen Pakt mit dem Teufel schließt, holt er sich deine Seele.
Ein nackter Mann sitzt blutüberströmt auf einem Stuhl. Rostiger Stacheldraht verursacht tiefe Wunden in seinem Fleisch. Dampf steigt aus seinen Verletzungen auf, als sein warmes Blut auf die eisige Februarluft trifft. Er lebt noch, als die Detectives Jessica Balzano und Kevin Byrne am Tatort eintreffen. Aber nicht mehr lange. Seine letzten Worte sind: "Er lebt."
Danny bleibt nicht das letzte Opfer des Killers. Und bei der Jagd auf ihn werden die beiden Detectives selbst zum Spielball ...
Nichts für schwache Nerven! Die spannungsgeladenen Thriller des Bestsellerautors Richard Montanari um das Ermittlerduo Byrne und Balzano:
Band 1: Crucifix
Band 2: Mefisto
Band 3: Lunatic
Band 4: Septagon
Band 5: Echo des Blutes
Band 6: Der Teufel in dir
Band 7: Der Abgrund des Bösen
Band 8: Tanz der Toten
Band 9: Shutter Man
Band 10: Mord am Heiligen Abend
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 479
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Zitat
Widmung
Erster Teil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Zweiter Teil
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Dritter Teil
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
Offenbarung
Danksagungen
Über den Autor
Alle Titel des Autors bei beTHRILLED
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.
Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!
Dein beTHRILLED-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Ein nackter Mann sitzt blutüberströmt auf einem Stuhl. Rostiger Stacheldraht verursacht tiefe Wunden in seinem Fleisch. Dampf steigt aus seinen Verletzungen auf, als sein warmes Blut auf die eisige Februarluft trifft. Er lebt noch, als die Detectives Jessica Balzano und Kevin Byrne am Tatort eintreffen. Aber nicht mehr lange. Seine letzten Worte sind: »Er lebt«.
Danny bleibt nicht das letzte Opfer des Killers. Und bei der Jagd auf ihn werden die beiden Detectives selbst zum Spielball …
Richard Montanari
DERTEUFELIN DIR
Aus dem amerikanischen Englischvon Karin Meddekis
EINTROTZIGES HERZSCHAFFTSICHVIEL LEID,UNDDER FREVLERHÄUFT SÜNDEAUF SÜNDE.
ECCLESIASTICUS 3,27
FÜR NICOLETTA
Wenn du an diese Nacht zurückdenkst, an diese seltenen Augenblicke der Gnade, wenn das Gewicht deiner Sünden unerträglich wird und dein Herz sich vor dem Licht verstecken will, rasen die Bilder mit höllischem Lärm vorbei, als hättest du alles von einem vorbeifahrenden Zug aus gesehen und gehört. Es kommt dir so vor, als wärst du nur ein Beobachter der Schrecken, die sich in dem feuchten, blutigen Keller zugetragen haben, und nicht an einer Tat beteiligt, bei der zwei Menschen starben.
Wenn du an diese Nacht zurückdenkst, wird dir die volle Schuld der Lebenden bewusst.
In der Kirche halten sich zu dieser frühen Stunde nur drei weitere Büßer auf: ein älterer Mann in einem zerknitterten grauen Anzug, der in der ersten Bankreihe sitzt und dessen Einkaufstasche geduldig in der Reihe hinter ihm wartet; ein Mann und eine Frau Anfang zwanzig, beide kniend, mit geschlossenen Augen und flehend gefalteten Händen. Die Aura der Trauer und des Verlusts, die sie umhüllt, ist beinahe sichtbar.
Du hast die Geschichte so oft wiederholt, dass sie allmählich einer Fabel ähnelt, deshalb möchtest du sie nicht erzählen. Es war ein brutaler Albtraum, und nun, da du weißt, dass du die Worte zum ersten Mal laut sagen wirst, spürst du, dass sich etwas in dir regt.
Du hältst einen Rosenkranz in der Hand, betest aber nicht, lässt die Perlen nur durch die Finger gleiten, damit die Hände etwas zu tun haben, damit sie nicht zittern.
Dreißig Jahre.
Wie können dreißig Jahre in einem einzigen Sonnenaufgang verglühen?
Nun stehst du im Herbst des Lebens, deine Kinder sind schon lange aus dem Haus, deine Freunde tot oder liegen im Sterben, und die Liebe deines Lebens ruht seit drei kalten Wintern unter der Erde.
ERSTER TEIL
DIEUNGEHORSAMEN KINDER
UNDAUSDER HANDDES ENGELSSTIEGDER WEIHRAUCHMITDEN GEBETENDER HEILIGENZU GOTTEMPOR.
OFFENBARUNGDES JOHANNES 8,4
1.
Ehe die Nacht das junge Mädchen mit ihren großen, schwarzen Flügeln umschloss und das Blut sein heiliger Wein wurde, war es in jeder Beziehung ein Kind des Lichts. Jenen, die das Mädchen in diesen Jahren kannten, schien sie ein fleißiges, ruhiges und höfliches Kind zu sein. Manchmal beobachtete sie stundenlang die Wolken und war – wie nur ganz junge Menschen es können – blind für die schreckliche Armut ringsum, die Ketten, die sie und ihresgleichen über fünf Generationen zu Sklaven gemacht hatten.
Das Mädchen war sechs Jahre alt, ehe es ein eigenes Paar Schuhe trug. Ihr erstes Kleid bekam sie mit acht.
Die meiste Zeit lebte das Mädchen innerhalb der hohen Steinmauern seiner Gedanken, einem Ort, an dem es keine Schatten und keine Dämonen gab.
Als sie dreizehn war, begegnete sie in einer mondlosen Nacht, als die Kerzen gelöscht waren, zum ersten Mal der Dunkelheit. Es war nicht die Dunkelheit, die auf den Tag folgt und die sich mit einem schwarzvioletten Schimmer auf die Erde senkt – es war die Dunkelheit, die in jenen Menschen lebt, die auf abgelegenen Straßen reisen und die Verrückte, Gefallene und Unredliche um sich sammeln, deren Leben sich in der Gosse abspielt.
In dieser Nacht wurde ein Samen im Geist und im Körper des Mädchens gesät.
Und nun, viele Jahre später, weiß die junge Frau, dass sie an diesen Ort des Elends und der Erbärmlichkeit, in dieses Haus der sieben Kirchen gehört.
Hier gibt es keine Engel.
Auf diesen Straßen wandelt der Teufel. Sie kennt ihn gut – sein Gesicht, seine Berührung, seinen Geruch –, denn nach ihrem dreizehnten Geburtstag, als Gott sich abwandte, wurde sie dem Teufel übergeben.
*
Sie hatte den jungen Mann über eine Woche beobachtet. Zum ersten Mal sah sie ihn in der Broad Street, eine hagere Gestalt, die sich vor einer Granitmauer abzeichnete. Er war Bettler. An seinem ausgezehrten, beinahe skelettartigen Körper und seiner gespenstischen Gestalt war nichts Bedrohliches. Er murmelte wirres Zeug, wenn er Passanten und Pendler ansprach, die den Bahnhof betraten oder verließen. Zweimal wurde er von Polizisten begleitet. Er leistete keinen Widerstand, gab keine Antworten. Sein Verstand schien von Rauschgift zerfressen zu sein, sodass er den Versuchungen der Straße hilflos ausgesetzt war.
Nach der abendlichen Rushhour lief er meistens die Market Street hinunter Richtung Delaware River. Dann sprach er die Leute an, die aussahen, als würden sie sich erweichen lassen, ihm ein paar Münzen oder eine Zigarette zu schenken.
Die junge Frau folgte ihm stets in sicherem Abstand. Wie die meisten Bettler nahm man ihn kaum wahr, abgesehen von denen, die sein Schicksal teilten oder die ihn benutzen wollten. Wenn er gelegentlich in einem Obdachlosenasyl eine Unterkunft fand, blieb er über Nacht. Doch jeden Tag um halb sieben nahm er seinen Platz vor der Market East Station ein, und der tägliche Kreislauf der Verzweiflung und Erniedrigung begann von Neuem.
Einmal folgte sie ihm in ein Lebensmittelgeschäft in der Dritten Straße und schaute zu, als er sich verpackte Hefeteilchen, Donuts und Brownies in die Taschen stopfte, wobei er aus den Winkeln seiner gelblich verfärbten Augen unverwandt auf den gewölbten Spiegel am Ende des Gangs spähte. Sie beobachtete, wie er in einer Gasse in der Nähe alles verschlang, um sich kurz darauf zu erbrechen.
Als die Wettervorhersage an diesem Tag Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt ankündigte, wusste sie, dass es an der Zeit war.
*
Der junge Mann steht zitternd in einem Hauseingang an der Achten Straße. Er trägt vier dünne Pullover übereinander und darüber eine Cabanjacke, deren Schulternähte aufgerissen sind.
Sie nähert sich ihm, bleibt ein paar Schritte entfernt im Schatten stehen.
Er hebt den Blick. In seinen wässrigen Augen sieht sie sich selbst.
»Haben Sie ein bisschen Kleingeld übrig?«, fragt er.
Er ist Mitte zwanzig und furchtbar abgemagert. Die Haut um seine Augen ist lila verfärbt, die Bartstoppeln in seinem Gesicht sind bereits grau, das Haar unter seiner Rollmütze ist fettig. Er hat sich die Fingernägel wund gekaut. Auf dem Handrücken haben sich Blasen gebildet.
Sie bleibt im Schatten stehen und streckt die Hand aus, die in einem Handschuh steckt. Zuerst ist der junge Mann skeptisch, doch als sie ins Licht tritt, sodass er ihre Augen zum ersten Mal sieht, weiß er Bescheid. Er nimmt ihre Hand, wie ein Verhungernder ein Stück Brot entgegengenommen hätte.
»Erinnerst du dich an dein Versprechen?«, fragt sie.
Er zögert, ehe er antwortet. Das tun sie immer. In diesem Augenblick kann sie beinahe hören, wie sein Gehirn arbeitet, als er fieberhaft nachdenkt. Eine einsame Träne rinnt über seine errötete Wange, als es ihm schließlich einfällt.
»Ja.«
Sie senkt den Blick, sieht den dunklen Fleck vorne auf seiner Hose. Er hat sich eingenässt. Auch so etwas erlebt sie nicht zum ersten Mal. Viele von ihnen können den Urin nicht mehr halten.
»Komm mit«, sagt sie. »Ich zeige dir, was du tun musst.«
Der junge Mann tritt unsicheren Schrittes vor. Sie hilft ihm. Er ist furchtbar dürr, besteht fast nur noch aus Haut und Knochen.
Am Eingang der Gasse bleibt sie stehen und dreht den jungen Mann zu sich um, sodass er ihr ins Gesicht schaut. »Er muss deine Worte hören. Den genauen Wortlaut.«
Seine Lippen zittern. »Kann ich die Worte nicht zu Ihnen sagen?«
»Nein. Du hast den Pakt mit ihm geschlossen, nicht mit mir.«
Der junge Mann wischt sich mit dem Handrücken über die Augen. »Also gibt es ihn wirklich.«
»Natürlich.« Sie zeigt auf die dunkle Nische am Ende der Gasse. »Willst du ihn jetzt treffen?«
Der junge Mann schüttelt den Kopf. »Nein. Ich habe Angst.«
Sie mustert ihn schweigend. Ein kurzer Moment vergeht.
»Darf ich eine Frage stellen?«, murmelt er dann.
»Natürlich.«
Er atmet tief ein und langsam aus. Sein Atem ist warm, feucht und bitter. »Wie soll ich Sie nennen?«
Darauf gibt es viele Antworten. Früher hätte man sie Magdalena nennen können. Zu einer anderen Zeit Babylon. Zu wieder einer anderen Zeit Legion.
Anstatt die Frage zu beantworten, nimmt sie ihn in die Arme. Sie denkt an die kommenden Tage, die letzten Tage, und was sie jetzt tun werden. Ephesus, Smyrna, Pergamon. Alles hat eine Ordnung. Wenn es keine Ordnung gäbe, würde sie sicherlich verrückt werden und mitten unter den schlechten Menschen leben, den Gottlosen, den Vertriebenen, den vom Herrn Verlassenen.
Von einem langen, einsamen Schatten verfolgt, tauchen sie in der Stadt unter. Der Winterwind wirbelt um sie her, doch die junge Frau spürt die Kälte nicht mehr.
Es hat begonnen.
Der Same, das Fleisch. Der Knochen, der Staub.
Ordnung.
2.
Der schwarzhäutige Junge sah aus, als hätte er keine Chance.
Detective Kevin Francis Byrne hatte es schon oft gesehen, diesen leeren Blick, die verkrampften Schultern, die Hände, die sich bei der geringsten Provokation zu Fäusten ballten. Byrne wusste, dass diese Anspannung durch einen chronisch verhärteten Muskelstrang in der Rückenmitte verursacht wurde. Der Junge hatte traurige Augen, und seine Schultern waren vor Angst gebeugt.
Für diesen Jungen – wie für Millionen andere wie ihn – lauerten an jeder Ecke Feinde. Jedes Geräusch bedeutete eine Gefahr, und in der Nacht hörten sie überall leise Stimmen flüstern:
Was mir gehört, gehört mir. Was dir gehört, gehört mir auch. Du weißt es nur noch nicht.
Der Junge war elf Jahre alt, hatte aber die Augen eines alten Mannes. Er trug einen dunkelblauen Kapuzenpullover mit ausgefransten Bündchen an den Ärmeln und eine weite, ausgebeulte Jeans, die längst aus der Mode war. Seine rostfarbenen Timberlands waren ausgelatscht und zu groß für seine Füße. Byrne fiel auf, dass die Boots mit zwei verschiedenen Schnürsenkeln zugebunden waren. Einer war aus Leder, der andere aus Nylon. Byrne fragte sich, ob der Junge damit irgendeinem modischen Trend folgte, oder ob es aus der Not heraus geschah.
Der Junge lehnte sich gegen die schmutzige rote Ziegelsteinmauer eines Türeingangs, wartete und beobachtete alles – ein weiteres Gespenst, das durch die Straßen Philadelphias geisterte.
Als Byrne die Zwölfte Straße überquerte und den Kragen um den Hals straffzog, um sich vor dem kalten Februarwind zu schützen, dachte er an das, was er gleich tun würde. Kürzlich hatte er sich bereiterklärt, an einem Mentoring-Programm namens »Philly Brothers« teilzunehmen. Heute war sein erstes Treffen mit dem Jungen.
In all seinen Dienstjahren hatte Kevin Byrne einige der schlimmsten Ungeheuer zur Strecke gebracht, die sich jemals auf den Straßen dieser Stadt herumgetrieben hatten, doch vor dem heutigen Treffen fürchtete er sich. Es ging um mehr, um viel mehr als nur darum, dass ein Mann sich mit einem Jungen traf, der auf die schiefe Bahn zu geraten drohte.
Byrne hatte ein Foto des Jungen in der Jackentasche, eine zwei Jahre alte Aufnahme aus der Schule. Er beschloss, das Foto nicht aus der Tasche zu ziehen. Es würde den Jungen nur in Verlegenheit bringen.
Als Byrne sich dem Türeingang näherte, in dem der Junge stand, verstärkte sich die Anspannung in seinen Schultern. Der Junge hob den Blick, schaute Byrne aber nicht in die Augen. Stattdessen richtete er den Blick auf eine Stelle ungefähr in der Mitte von Byrnes Stirn. Das war ein alter Verkäufertrick. Byrne fragte sich, wo der Junge das gelernt hatte und ob es ihm überhaupt bewusst war.
»Bist du Gabriel?«, fragte Byrne.
»Man nennt mich G-Flash«, sagte der schwarze Junge, als wäre das allgemein bekannt, während er von einem Bein aufs andere trat.
»Okay, G-Flash«, sagte Byrne. »Ich heiße Kevin, und ich bin dein Philly …«
»Brother«, fiel der Junge ihm ins Wort, verzog das Gesicht und steckte die Hände in die Taschen seines Kapuzenshirts, um Byrne nicht die Hand geben zu müssen. Der hatte die Hand schon ausgestreckt. Jetzt schwebte sie zwischen ihm und dem Jungen in der Luft, und er wusste nicht, wohin damit.
»Ich hatte einen richtigen Bruder«, fügte der Junge leise, beinahe flüsternd hinzu.
Byrne zog die Hand zurück, schaute sich um und überlegte, was er sagen sollte. »Hat es mit dem Bus hierher gut geklappt?«, fragte er schließlich.
Der Junge grinste abfällig. »Ich saß nur drin. Hab die Karre nicht gefahren.«
Ehe Byrne etwas erwidern konnte, schaltete ein Streifenwagen des Philadelphia Police Departments das Blaulicht und die Sirene ein. Der Wagen stand einen halben Block entfernt. Die einzigen beiden Menschen in weitem Umkreis, die nicht den Blick hoben, als der Streifenwagen losjagte, waren Byrne und der Junge. Beide kannten Blaulicht und Sirenen nur zu gut.
Byrne schaute auf die Uhr, obwohl er genau wusste, wie spät es war. »Sollen wir was essen gehen?«
Der Junge zuckte mit den Schultern.
»Worauf hast du Appetit?«, fragte Byrne.
Wieder ein Schulterzucken.
»Chinesisch? Hühnchen? Ein Riesenbaguette?«
Der Junge warf einen Blick über die Schulter. Er schien sich zu Tode zu langweilen. »Hört sich alles ganz toll an.«
»Was ist mit Schweinebraten?«, fragte Byrne. »Magst du Schweinebraten?«
Byrne sah, dass der Junge beinahe unmerklich einen Mundwinkel verzog. Der Hauch eines Lächelns? Gott bewahre. Der Junge mochte Schweinebraten.
»Komm«, sagte Byrne. »Ich weiß, wo es die besten Schweinebraten-Baguettes der Stadt gibt.«
»Ich hab kein Geld.«
»Ich lade dich ein.«
Der Junge trat gegen einen imaginären Kieselstein. »Ich will nicht, dass Sie mich zu irgendwas einladen.«
Byrne seufzte. »Ich sag dir was. Heute bezahle ich das Essen. Wenn wir uns mögen – aber dafür gibt es keine Garantie, ich mag nicht viele Menschen –, bezahlst du bei unserem nächsten Treffen. Wenn nicht, schicke ich dir eine Rechnung über den halben Betrag.«
Jetzt deutete der Junge tatsächlich ein Lächeln an. Um es zu überspielen, blickte er die Filbert Street hinunter. Die Zeit dehnte sich, doch jetzt war Byrne gewappnet. Der Junge hatte keine Ahnung, mit wem er es zu tun hatte. Byrne hatte die letzten zwanzig Jahre seines Lebens als Detective bei der Mordkommission verbracht, die Hälfte davon bei Beschattungen. Er hatte mehr Geduld als ein Betonklotz.
»Okay«, sagte der Junge schließlich. »Hier draußen ist es sowieso arschkalt.«
*
Als Byrne und der Junge in der Schlange bei DiNic’s warteten, sagte keiner von beiden ein Wort. Trotz der vielen Hintergrundgeräusche – ein halbes Dutzend verschiedener Sprachen, das Klappern der Teller, das Surren der Schneidemaschinen, das Kratzen der Pfannenwender auf den Bratrosten – empfand Byrne das Schweigen zwischen ihm und dem Jungen als Belastung. Er wusste aber nicht, was er sagen sollte. Seine Tochter Colleen, die ihr Studium an der Gallaudet University begonnen hatte, war mit vielen Vorteilen aufgewachsen, die dieser Junge nicht besaß – sofern man es als Vorteil bezeichnen konnte, Kevin Byrne zum Vater zu haben.
Der Junge, der neben ihm stand, mit ungerührtem Blick, die Hände noch immer in den Taschen vergraben, war in der Hölle aufgewachsen.
Byrne wusste, dass Gabriels Vater im Leben seines Sohnes nie eine Rolle gespielt hatte. Seine Mutter, Tanya Wilkins, war gestorben, als Gabriel drei Jahre alt gewesen war. Tanya, eine Prostituierte und Drogensüchtige, war in einer eisigen Januarnacht in einer Gasse in Grays Ferry erfroren, nachdem sie das Bewusstsein verloren hatte. Und Gabriels einziger Bruder Terrell hatte vor zwei Jahren Selbstmord begangen.
Seitdem wurde Gabriel von einer Pflegefamilie zur anderen weitergereicht. Ein paar Mal war er mit dem Gesetz in Konflikt gekommen, meist wegen kleinerer Ladendiebstähle, doch es gab keinen Zweifel, in welche Richtung der Weg führte.
Als sie an der Theke standen, bestellte Byrne für jeden ein Riesenbaguette. Die Baguettes von DiNic’s waren so groß, dass Byrne erst wenige Male eins ganz geschafft hatte. Trotzdem bestellte er für jeden eins und bedauerte es sogleich, denn er begriff, dass er angeben wollte.
Der Junge riss die Augen auf, als er das riesige Baguette sah, das er mit niemandem teilen musste. Dazu gab es eine Portion Pommes und eine Limo. Doch er setzte sofort wieder eine kühle Miene auf, als könnte ihn nichts und niemand beeindrucken.
Sie suchten sich einen Tisch, setzten sich und machten sich über die Baguettes her.
Während sie schweigend aßen, überlegte Byrne, worüber er sich mit dem Jungen unterhalten könnte. Sport? Die Flyers, die Eishockeymannschaft der Stadt? Die Sixers, das Basketballteam? Das wäre ein unverfängliches Thema gewesen. Stattdessen schwieg er.
Zehn Minuten später hob er den Blick zu Gabriel, der bereits das halbe Sandwich verdrückt hatte. Byrne fragte sich, wann der Junge zum letzten Mal etwas gegessen hatte.
»Das schmeckt, stimmt’s?«, sagte Byrne.
Gabriel zuckte mit den Schultern. Byrne nahm an, dass der Junge mitten in seiner Trotzphase steckte. Mit vierzehn, fünfzehn Jahren war Byrne ihm ähnlich gewesen. Alles war ein Rätsel, jede Frage ein Verhör. Doch die Zeiten hatten sich geändert. Die Elfjährigen schienen die neuen Fünfzehnjährigen zu sein.
Als sie fertig gegessen hatten, schob Gabriel die Ärmel seines Kapuzenshirts hoch. Byrnes Blick huschte unwillkürlich über Arme, Hände und Hals des Jungen auf der Suche nach Tattoos, Brandnarben oder anderen Wunden, die der Beweis für die Aufnahme in eine Straßengang hätten sein können. Wenn es jemals einen Jungen gegeben hatte, der prädestiniert dafür war, in eine Gang aufgenommen zu werden, dann war es Gabriel Hightower.
Doch Byrne sah weder Tätowierungen noch Wunden.
Nach dem Essen saßen sie sich wieder schweigend gegenüber, und das Ende des ersten Treffens nahte bereits. Zwischen ihnen stand ein kleines Boot auf dem Tisch, das Gabriel mit flinken Fingern aus dem Papier gefaltet hatte, in das die Baguettes gewickelt waren.
»Darf ich es mir mal angucken?«, fragte Byrne.
Der Junge stieß es mit dem Zeigefinger in Byrnes Richtung.
Byrne nahm das Papierboot in die Hand. Es war geschickt und säuberlich gefaltet. Gabriel schien so etwas nicht zum ersten Mal gemacht zu haben. »Das ist cool.«
»Man nennt es Origami«, erklärte Gabriel. »Ist Chinesisch oder so.«
»Du hast Talent«, sagte Byrne. »Das ist richtig gut.«
Der Junge zuckte wieder mit den Schultern.
Byrne fragte sich, wo der Weltrekord im Schulterzucken lag.
*
Als sie auf die Straße traten, hatten die meisten Leute ihre Mittagspause beendet, und es waren nicht mehr so viele Menschen unterwegs. Byrne hatte den Rest des Tages frei und überlegte kurz, ob er dem Jungen vorschlagen sollte, noch etwas anderes zu unternehmen, ließ es dann aber. Er nahm an, dass Gabriel nach dem heutigen Treffen erst einmal genug von ihm hatte.
»Komm«, sagte Byrne. »Ich fahr dich nach Hause.«
Gabriel trat einen halben Schritt zurück. »Ich hab Geld für den Bus.«
»Ich muss sowieso in die Richtung«, log Byrne. »Ist kein Umweg für mich.«
Der Junge wühlte in seinen Taschen nach dem Geld.
»Ich fahre keinen Streifenwagen, wenn es das ist«, sagte Byrne. »Ich fahre ’ne alte Scheißkarre, einen klapprigen Taurus mit ausgeleierten Stoßdämpfern, und das Radio kann man auch in der Pfeife rauchen.«
Bei dem Wort »Scheißkarre« lächelte der Junge.
Byrne zog den Schlüssel aus der Tasche. »Komm. Das Geld für den Bus kannst du dir sparen.«
Byrne ging voraus und überquerte die Straße. Er nahm sich vor, sich nicht umzudrehen, um zu sehen, ob Gabriel ihm folgte.
Als er die Filbert schon ein ganzes Stück hinuntergegangen war, sah er einen kleinen Schatten neben sich auftauchen.
*
Das Wohnviertel, in dem Gabriel Hightower lebte, lag in der Indian Avenue zwischen der Dritten und Vierten Straße, versteckt in einer verwahrlosten Gegend von North Philly, den sogenannten Badlands. Byrne fuhr die Dritte Straße Richtung Norden. Auf der ganzen Fahrt sprach keiner von beiden ein Wort. Erst als Byrne in die Indiana Avenue einbog, sagte Gabriel: »Sie können mich hier rauslassen.«
Das Haus war noch einen ganzen Block entfernt.
»Ich fahre dich bis vor die Tür. Kein Problem. Okay?«
Der Junge erwiderte nichts.
»Dann eben nicht.« Byrne gab nach und hielt an. Sie waren jetzt einen halben Block von einer der berüchtigtsten Drogengegenden der Stadt entfernt. Es dauerte nicht lange, bis Byrne zwei junge Burschen sah, die nach Polizisten Ausschau hielten. Einer der beiden, ein Jugendlicher von vielleicht achtzehn Jahren, versuchte, sich möglichst unauffällig zu verhalten. Byrne starrte ihn an, woraufhin der junge Bursche ein Handy aus der Tasche zog und in die andere Richtung davonschlenderte. Vermutlich hatte er Byrne als Polizisten identifiziert.
Byrne legte den Leerlauf ein.
»Okay, G-Flash«, sagte er und schaute zu Gabriel hinüber. Der verdrehte die Augen und schüttelte den Kopf. Byrne verstand den Wink. Es war schon schlimm genug, sich mit einem älteren weißen Mann herumzutreiben, erst recht mit einem älteren weißen Cop. Noch schlimmer war allerdings, wenn dieser ältere weiße Typ auch noch den nur in Insiderkreisen gebräuchlichen Spitznamen laut aussprach.
»Gabriel reicht, okay?«
»Abgemacht«, sagte Byrne.
Sie schwiegen wieder. Byrne hatte das Gefühl, dass sie den Rest des Tages im Wagen sitzen würden, wenn er nicht bald etwas sagte. »Normalerweise ist es so, dass man sich drei Mal trifft, um zu sehen, wie es läuft. Wie sieht’s aus? Hast du Lust, mit mir noch mal was zu unternehmen?«
Anstatt die Frage zu beantworten, starrte Gabriel auf seine Hände.
Byrne beschloss, ihm die Entscheidung zu erleichtern. »Ich sag dir was. Ich ruf dich in den nächsten Wochen an, und wir überlegen gemeinsam, was wir machen. Wir können es ja erst mal offenlassen. Einverstanden?«
Er hielt Gabriel die Hand hin. Entweder schüttelte der Junge sie diesmal, oder er ließ es wieder bleiben, was einer endgültigen Abfuhr gleichkam.
Gabriel zögerte einen Augenblick, ehe er Byrnes Hand ergriff. Es war kein richtiger Händedruck, eher die Andeutung. Dann schob Gabriel sich die Kapuze auf den Kopf und stieg aus dem Wagen. Ehe er die Tür zuschlug, blickte er Byrne mit seinen jungen, alten Augen an. »John’s ist auch gut«, sagte er.
Im ersten Moment wusste Byrne nicht, was er meinte. Wer ist John? Dann fiel es ihm ein: Gabriel sprach über John’s Roast Pork.
»John’s? Du meinst in der Synder?«
Der Junge nickte.
»Stimmt«, sagte Byrne. »John’s ist wirklich gut. Wenn du willst, können wir da mal hingehen.«
Gabriel schickte sich an, die Tür zu schließen, verharrte dann aber und dachte nach. Schließlich beugte er sich in den Wagen, als wollte er Byrne ein Geheimnis anvertrauen. Byrne stellte fest, dass er unwillkürlich den Atem anhielt.
»Ich weiß, dass Sie über mich Bescheid wissen«, sagte Gabriel.
»Was soll ich über dich wissen?«
»Oh, Mann.« Gabriel schüttelte den Kopf. »Die Weißen haben immer ’ne Akte, wenn sie mit mir reden. Sozialarbeiter, Anwälte, Lehrer, Leute, die für die Stadtverwaltung arbeiten. Leute vom Jugendamt. Die schauen alle in die Akte, bevor sie mit mir sprechen. Da muss doch irgendwas drinstehen.«
»Ja«, sagte Byrne und versuchte ein Lächeln zurückzuhalten. »Ein paar Dinge weiß ich.«
»Hm, es gibt da aber noch etwas, was Sie wissen sollten. Das steht allerdings nicht in der Akte.«
»Und was ist das?«
»Er hat sich nicht weggeknallt.«
»Was soll das heißen?«, fragte Byrne. »Wer hat sich nicht weggeknallt?«
Gabriel blickte die Straße in beide Richtungen hinunter und drehte sich kurz um. »Mein Bruder Terrell«, sagte er dann. »Er hat sich nicht weggeknallt, wie alle sagen.«
Nach diesen Worten schlug er die Tür zu und ging mit schnellen Schritten über eine schneebedeckte Brachfläche davon. Geschickt wich er einem ausrangierten Kühlschrank und anderem Gerümpel aus.
Kurz darauf sah Byrne nur noch den ausgeblichenen Kapuzenpullover des Jungen, dann war Gabriel Hightower verschwunden.
*
Abends machte Byrne sich ein Fertiggericht in der Mikrowelle warm: Hühnchen, für seinen Geschmack zu süß, mit faden Erbsenschoten. Nach dem Essen wurde er unruhig und verließ das Haus. Er fuhr zum American Pub im Centre Square Building. Ein freier Tag warf ihn jedes Mal regelrecht aus der Bahn. Oft arbeitete er sieben, acht Tage hintereinander. Hinzu kamen die unvermeidlichen Überstunden, die der Job als Detective bei der Mordkommission des Philadelphia Police Departments verlangte. Wenn er dann endlich mal Zeit hatte, auszuschlafen, zu lesen oder die Wäsche zu waschen, wurde er nervös und interessierte sich mehr für seine aktuellen Fälle als für das Entspannen. Byrne gab es nicht gerne zu, aber der Job war sein Leben. Er war mit Herz und Seele Polizist.
An diesem Abend fragte er sich, ob sich in einem aktuellen Fall bereits Zeugen gemeldet hatten.
Gegen halb zwölf verließ er den Pub.
Anstatt nach Hause zu fahren, fuhr er Richtung Norden.
*
Am frühen Abend hatte Byrne im Büro angerufen und ein paar Informationen darüber erhalten, was Gabriels Bruder Terrell zugestoßen war.
Nach dem Tod ihrer Mutter waren die beiden Jungen bei zwei verschiedenen Pflegefamilien untergebracht worden. Terrell, der die Central Highschool besucht hatte, war dem Vernehmen nach ein guter Schüler gewesen, wenngleich er unter Hyperaktivitätsstörungen gelitten hatte – ein Begriff, der zu der Zeit allerdings kaum benutzt worden war.
Mit fünfzehn fand Terrell ein Ventil für seine nervöse Energie: die Leichtathletik. Nachdem er eine volle Saison trainiert hatte, war er ein Klassesprinter über die 100 und 200 Meter, gefürchtet von der Konkurrenz. In seinem zweiten Jahr auf der Highschool gewann er sämtliche Titel in Philadelphia, im dritten Jahr führte er seine Mannschaft bei den Landesmeisterschaften zum Sieg. Sogar von der fernen University of California in Los Angeles kamen Scouts, um das Talent zu beobachten.
Eines Abends, als Terrell die Werkstatt fegte – er jobbte in Teilzeit bei einer Autolackiererei –, kamen zwei Männer herein. Sie feuerten auf den Besitzer James DuBois und schossen Terrell zwei Kugeln in den Bauch. DuBois war auf der Stelle tot. Terrell wurde mit dem Rettungswagen ins Jefferson Hospital gebracht. Nach vier Stunden galt sein Zustand wieder als stabil.
Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Wie nicht anders zu erwarten, hatten die Nachbarn nichts gesehen und gehört. Noch ein Phantomkiller in Philadelphia.
Doch es kursierte das Gerücht, dass ein Drogendealer namens DeRon Wilson aus North Philly den Anschlag aus Rache verübt hatte, weil Terrell seiner Gang nicht beitreten wollte. Dadurch fühlte Wilson sich in seiner Ehre gekränkt.
Eine Woche später wurde Terrell im Rollstuhl aus dem Jefferson Hospital entlassen. Er ging wieder zur Schule, war aber nicht mehr mit dem Herzen dabei, denn seine Sprinterkarriere war zu Ende, bevor sie richtig angefangen hatte. Zwar konnte er mithilfe eines Stocks wieder gehen, doch sein Traum von einem Sportstipendium löste sich in Wohlgefallen auf.
Nach der Highschool arbeitete Terrell kurzfristig als Mechaniker in Camden und nahm später andere Jobs an, hielt es aber bei keinem lange aus. Auf Niedriglohnjobs folgte die Erwerbsunfähigkeit.
Dann kamen die Drogen.
Kurz nach Mitternacht an seinem neunzehnten Geburtstag steckte Terrell Hightower sich den Lauf einer 9-mm-Pistole in den Mund und drückte ab. An seinem Hals hingen zwei Dutzend Medaillen, die er bei Wettkämpfen im Südosten Pennsylvanias gewonnen hatte.
Mit diesen Bildern im Kopf hielt Byrne an der Ecke Dritte und Indiana. Er wusste, dass man ihn von allen Seiten sehen konnte und dass er bereits entdeckt worden war. Er wollte gesehen werden.
Byrne griff ins Handschuhfach, nahm einen 38er-Colt-Revolver heraus und überprüfte die Trommel.
In dieser Stadt war man entweder der Jäger oder der Gejagte, wie in allen Städten.
Byrne legte die Waffe auf den Beifahrersitz. Ein Satz ging ihm nicht aus dem Kopf:
Terrell hat sich nicht weggeknallt, wie alle sagen.
3.
Ein eisiger Luftzug fegt durch den Keller. Der junge Mann sitzt steif auf einem Holzstuhl. Er ist nackt: Adam, der in diesen trostlosen, kalten Garten Eden verbannt wurde. Unzählige flüsternde Stimmen sind hier zu hören, das letzte Flehen der Treulosen.
Er ist schon den ganzen Tag hier.
Sie mustert ihn und sieht die Knochen unter seiner Haut. Es ist der Augenblick, auf den sie ihr Leben lang gewartet hat. In ihren Fingerspitzen lebt nun eine alte Magie, eine Macht, die ihr Gewalt über Diebe, Wüstlinge und Wucherer verleiht.
»Es ist Zeit«, sagt sie.
Der junge Mann bricht in Tränen aus.
»Du musst ihm sagen, was du gesagt hast. Wort für Wort. Ich möchte, dass du genau nachdenkst. Es ist sehr wichtig.«
»Ich … ich erinnere mich nicht«, sagt der junge Mann.
Sie geht zu ihm, legt ihm einen Finger unter das Kinn, blickt ihm in die Augen. »Möchtest du, dass ich dir sage, was du gesagt hast?«
Der junge Mann nickt. »Ja.«
»Du hast gesagt: ›Ich würde alles tun, damit ich kein Aids bekomme. Dafür würde ich sogar dem Teufel meine Seele verkaufen.‹«
Er antwortet nicht. Sie erwartet auch keine Antwort.
Der junge Mann späht auf den Durchgang zu dem anderen Raum. »Ich kann ihn nicht ansehen. Wenn es geschieht, kann ich ihn nicht ansehen.«
Sie zieht ihren Mantel aus, faltet ihn behutsam und legt ihn auf die Altardecke auf dem Boden.
»Dein Name hat in der Bibel eine Bedeutung«, sagt sie. »Weißt du das?«
Er schüttelt den Kopf. »Nein.«
»Dein Name bedeutet: ›Gott ist mein Richter.‹« Sie greift in die Tasche, zieht die Spritze heraus und bereitet sie vor. »Nach den Worten der Bibel wurde Daniel nach Babylon gebracht. Es heißt, dass er Träume deuten konnte.«
Als ein paar Sekunden später die ersten Blutstropfen auf den Boden fallen so wie an jenem schrecklichen Tag in Golgatha, weiß sie, dass man die Schreie der ungehorsamen Kinder bald in der Stadt hören wird.
Jeder Schwur muss eingehalten werden.
Der Teufel ist nach Philadelphia zurückgekehrt.
4.
Reiß dich zusammen, Jess, sonst stirbst du hier und jetzt.
Detective Jessica Balzano hob den Blick. In den Augen des Fleischberges, der weniger als drei Meter von ihr entfernt stand, loderte die reinste Form der Bösartigkeit, die sie je gesehen hatte, und Jessica hatte schon eine Menge gesehen. Während ihrer Dienstjahre beim Philadelphia Police Department musste sie es mit Gangstern und Psychopathen jeder Art aufnehmen und gegen Männer kämpfen, die doppelt so viel wogen und dreimal so kräftig waren wie sie. Jessica ging stets als Siegerin aus diesen Kämpfen hervor.
Wie das möglich war? Es lag an der Kombination aus Wendigkeit, Schnelligkeit, einem ausgezeichneten peripheren Sehvermögen und der angeborenen Fähigkeit, die nächste Bewegung des anderen vorauszuahnen. Dieses Talent hatte Jessica auf den Straßen, in Uniform und bei der Mordkommission stets gute Dienste erwiesen.
Heute nicht. Wenn sie sich jetzt nicht zusammenriss, und zwar schnell, war sie tot.
Die Glocke ertönte.
»Mach schon«, sagte Joe. »Zeig noch mal, was du draufhast.«
Jessica stand in Joe Hands Boxklub in der Dritten Straße in Northern Liberties im Ring. Die letzte der drei Runden eines Trainingsfights begann. Jessica trainierte für einen bevorstehenden Schaukampf beim jährlichen Boxturnier des Polizeisportvereins.
Ihre heutige Gegnerin war eine Neunzehnjährige namens Valentine Rhames, die im Rock Ministry Boxing Club in der Kensington Avenue boxte.
Jessica war keine Expertin, ging aber davon aus, dass Mädchen wie Valentine keinen Bizepsumfang von fünfunddreißig Zentimetern und Schultern wie ein Raubritter haben sollten, von den riesigen Fäusten ganz zu schweigen. Diese Frau aber war gebaut wie Schwarzenegger.
Der bevorstehende Schaukampf wurde ausgetragen, um Geld für die Jugendarbeit des Polizeisportvereins zu sammeln – eine karitative Sache, eine Sache des Herzens, verdammt noch mal, da sollte doch niemand verletzt oder gar totgeschlagen werden. Doch kaum war das Läuten der Glocke verklungen, das die dritte Runde einläutete, stürmte Valentine durch den Ring, und es sah ganz so aus, als hätte sie nichts davon mitbekommen.
Jessica wich dem Angriff mühelos aus. Obwohl der Kopfschutz ihr Gesichtsfeld seitlich begrenzte, gelang es ihr, eine kräftige Rechte auf Valentines Kopfseite zu landen. Ein verbotener Schlag, wenn man es mit den Regeln genau nahm, aber darüber würde Jessica später nachdenken. Fall es ein Später für sie gab.
Zwei Minuten später ertönte die Glocke erneut. Der Kampf war zu Ende, und Jessica lebte noch. Sie war schweißüberströmt und hatte Schmerzen am ganzen Körper.
Frisch wie der junge Morgen fiel ihre Gegnerin ihr um den Hals und rief: »Danke für das Training, Ma’am!«
Ma’am?
Jessica hätte Valentine am liebsten aus dem Ring geprügelt, nur hatte sie gerade erst genau diese Möglichkeit gehabt und kläglich versagt.
Ma’am.
*
Jessica und Vincent Balzano verbrachten die ersten acht Jahre ihrer Ehe mit einem Kind. Lange Zeit glaubte Jessica, dass es bei diesem einen Kind bleiben würde.
Drei Jahre lang versuchte Jessica, schwanger zu werden, sprach mehrmals mit ihrem Hausarzt, las fast jedes Buch über dieses Thema und konnte sich eben noch zurückhalten, einen Spezialisten für künstliche Befruchtungen aufzusuchen.
Und dann geschah im letzten Jahr ein Wunder. Sie adoptierten einen zweijährigen Jungen namens Carlos, und für beide begann ein neues Leben.
Zu Jessicas Verwunderung verdoppelte sich durch das zweite Kind nicht die Verantwortung als Mutter, sie vervierfachte sich. Irgendwie war es vier Mal so viel Arbeit und erforderte vier Mal so viel Organisation, Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme. Jessica dachte noch immer über ein zweites Baby nach, obwohl sie im Laufe des Jahres an diesem Wunsch zu zweifeln begann. Sie war mit nur einem Bruder in einer kleinen Familie aufgewachsen – klein nach den Maßstäben einer katholischen Familie mit italienischen Wurzeln in South Philly. Deshalb waren ein Junge und ein Mädchen mit einem Altersunterschied von ein paar Jahren genau richtig.
Dennoch wünschte Jessica sich noch ein Kind.
Vor einem Jahr waren sie aus Lexington Park im Nordosten der Stadt zurück nach Süd-Philadelphia gezogen, in die Gegend, in der Jessica aufgewachsen war. Der Umzug brachte eine Reihe von Vorteilen. Sie wohnten nur einen Block von Sophies Schule entfernt, der Sacred Heart of Jesus, und bis zum italienischen Markt war es auch nicht weit. Das bedeutete Brot von Sarcone’s, Sfogliatelle und Cannoli von Termini’s, Käse von DiBruno’s.
Als Jessica heute Morgen die Müslischalen auf den Tisch stellte, stürmte ihr Ehemann in die Küche. Im Nu hatte er sich einen Power-Riegel geschnappt, schüttete den Kaffee in seinen Trinkbecher für unterwegs und warf sich den Mantel über. Er küsste Jessica auf die Wange, sagte: »Ich liebe dich, mein Schatz«, und verschwand durch die Tür.
Jessica trank einen Schluck Kaffee und schaute aus dem Fenster. Als sie ihren Mann beobachtete, wie er die Straße überquerte und in seinen geliebten restaurierten Pontiac Trans Am stieg, überlegte sie, welche Botschaften in diesem »Ich liebe dich, mein Schatz« steckten. Oberflächlich betrachtet bedeutete die Aussage, dass er sie liebte, und diese Worte konnte sie gar nicht oft genug hören. Doch es versteckte sich noch mehr hinter der Botschaft: Für meine kleine Bekundung der Zuneigung machst du das Frühstück, du ziehst beide Kinder an, du machst ihnen Sandwiches, schließt das Haus ab und bringst sie zur Schule und zur Vorschule. Dann sieh zu, dass du pünktlich zur Arbeit kommst und deinen Job vernünftig machst, der mindestens genauso anstrengend ist wie meiner, manchmal sogar noch anstrengender.
Ich liebe dich, mein Schatz.
Vincent Balzano war ein tüchtiger Cop. Das war einer der Gründe, weshalb er zu den gefürchtetsten und angesehensten Detectives des Drogendezernats Nord gehörte. Vincent konnte einen Zeugen so geschickt vernehmen, dass der munter drauflosplauderte und gar nicht bemerkte, dass er längst als Verdächtiger galt. Jessica kannte alle Tricks ihres Mannes, und Vincent kam mit seinem italienischen Charme und seinem guten Aussehen meistens durch, weil sie es zuließ.
Als das Frühstück mehr oder weniger beendet war, brachte Jessica ruck, zuck die Küche in Ordnung, stellte das Geschirr in die Spüle und wischte über die Arbeitsflächen. Sophie und Carlos saßen am Tisch. Sie hatten noch ein paar Minuten Zeit, bevor sie aufbrechen mussten.
»He«, sagte Sophie zu ihrem kleinen Bruder. »Weißt du noch, wie das Spiel geht?«
Carlos nickte. Der Dreijährige lernte gerade, sich selbst zu kämmen und einen Scheitel zu ziehen, worauf er größten Wert legte, denn er war eitel. An diesem Tag jedoch war sogar der gewundene Schuylkill River im Vergleich zu seinem Scheitel ein kerzengerader Fluss.
»Okay.« Sophie ballte die rechte Hand zur Faust und hielt sie vor den Oberkörper. »Das ist ein Stein.«
Carlos machte es seiner Schwester nach und ballte seine kleine Faust. »Stein.«
Sophie streckte die Hand aus und richtete die Handfläche nach unten. »Das ist Papier.«
»Papier.« Carlos streckte die rechte Hand mit der Handfläche nach oben aus, korrigierte sich dann und hielt sie nach unten.
Sophie bildete mit Zeige- und Mittelfinger ein V. »Und das ist die Schere.«
Carlos folgte wieder ihrem Beispiel. »Schere.«
»Okay. Weißt du noch, was was schlägt?«
Carlos nickte.
»Sollen wir anfangen?«, fragte Sophie.
»Ja.«
Sophie versteckte die rechte Hand hinter dem Rücken, und Carlos tat es ihr gleich. »Eins, zwei, drei«, sagte Sophie und streckte die geballte Faust vor. »Stein!«
Carlos streckte ebenfalls die Hand aus, mit gespreiztem Zeigefinger und Daumen, und rief: »Pistole!«
Sophie verdrehte die Augen. Ihr Blick schweifte von ihrer Mutter zurück zu ihrem Bruder. »Pistole gibt’s nicht, Carlos.«
»Nein?«
»Nein. Das Spiel heißt ›Stein, Papier, Schere‹.«
Carlos kicherte.
Sophie warf Jessica einen weiteren Blick zu. Jessica zuckte mit den Schultern.
»Jungs«, sagte Sophie.
*
Das Roundhouse, das Verwaltungsgebäude des Philadelphia Police Departments, lag an der Ecke Achte und Race Street. Als Jessica um kurz nach acht das Gebäude betrat, herrschte bereits reges Treiben. Zum Glück hatte das Summen in ihren Ohren aufgehört. Vermutlich würde es wieder anfangen, sobald sie in den Ring stieg – also in den nächsten Tagen. Sie gab es nicht gerne zu, aber sie erholte sich nicht mehr so schnell wie noch vor ein paar Jahren.
Dennoch hatte sie sich gegen eine durchtrainierte Neunzehnjährige nicht schlecht geschlagen und nur ein paar blaue Flecken davongetragen. Das heißt, ihr tat die rechte Seite weh, wenn sie tief Luft holte, aber sonst …
Vielleicht wurde sie doch zu alt für diesen Sport.
*
Bei der Mordkommission arbeiteten neunzig Detectives in drei Schichten. Die Mordrate in Philadelphia war in den letzten Jahren gesunken, nicht aber die der Gewalttaten. Dank neuer Traumazentren in den Städten konnte die Zahl der Todesopfer jedoch gesenkt werden. Opfer, die in der Vergangenheit möglicherweise gestorben wären, wurden nun schneller notfallmäßig versorgt. Die Tötung eines Menschen war schließlich nichts anderes als eine schwere Körperverletzung mit tödlichen Folgen.
Der heilige Michael, der Schutzpatron der Polizei, musste wohl Einsehen mit Jessica und Byrne gehabt haben, die an drei ungelösten Fällen gearbeitet hatten. Jetzt saßen drei Verdächtige in Untersuchungshaft, und in den nächsten beiden Wochen waren in allen Fällen Vorverhandlungen angesetzt.
In diesem glorreichen Augenblick hatten Jessica und Byrne praktisch alle anstehenden Arbeiten erledigt.
In den meisten Berufen war es eine gute Sache, einen leeren Schreibtisch zu haben, weil man dann ein reines Gewissen haben konnte, wenn das Gehalt überwiesen wurde. Für einen Detective der Mordkommission jedoch bedeutete es, dass man den nächsten Fall übernehmen musste. Wenn in der Stadt der Brüderlichen Liebe in den nächsten Minuten jemand eine Schusswaffe, ein Messer oder einen Knüppel in die Hand nahm und einem anderen Menschen Gewalt antat, war es ihre Aufgabe, in diesem Fall zu ermitteln. Dann musste Jessica dafür sorgen, dass der Schuldige geschnappt und vor Gericht gestellt wurde, und dass man die Angehörigen des Opfers unterrichtete. Sie musste versuchen, ihnen Trost zu spenden und alles tun, damit ihnen in ihrem Schmerz und ihrer Wut nicht die Sicherungen durchbrannten.
Mit diesen Gedanken setzte Jessica sich an den Computer. In einem ihrer Fälle ging es um einen Doppelmord in Juniata Park. Laut Zeugenaussagen war am Tatort ein zweiter Mann mit einer Waffe in der Hand beobachtet worden, doch die Kriminaltechniker konnten lediglich den Einsatz einer einzigen Waffe nachweisen. Da Jessica nur eine grobe Beschreibung des zweiten Verdächtigen vorlag, beschloss sie, mit den Komplizen des Mannes zu beginnen, der in Untersuchungshaft saß. Sie scrollte durch die Verbrecherdatei und schaute sich immer sechs Fotos auf einmal an. Keiner von den Typen kam als zweiter Täter infrage.
Nach ein paar Minuten erfolgloser Recherche in der Verbrecherdatei klingelte das Telefon auf Jessicas Schreibtisch. Sehnsüchtig starrte sie auf den Spinat-Wrap mit Ei und Schinken. Sie hatte noch nicht einmal hineingebissen.
Wenn der Anruf einen neuen Fall einläutete, musste sie ihn übernehmen. Jessica hob den Hörer ab und drückte auf die Taste, um das Gespräch anzunehmen.
»Mordkommission. Balzano.«
Zuerst hörte sie nur ein leises Rauschen wie bei einem Regenschauer.
Jessica wartete. Und wartete. Nichts.
»Hier ist die Mordkommission, Detective Balzano.«
»Ein Gott«, sagte der Anrufer.
Er flüsterte so leise, dass Jessica nicht heraushören konnte, ob es ein Mann oder eine Frau war.
»Wie bitte?«, sagte Jessica. »Könnten Sie ein bisschen lauter sprechen?«
»Sieben Kirchen.«
Es hörte sich an, als hätte der Anrufer »sieben Kirchen« gesagt. »Es tut mir leid, ich verstehe nichts. Rufen Sie wegen eines Falles an?«
Ein paar Sekunden lang schwieg der Anrufer. Jessica wollte schon auflegen, als sie wieder etwas hörte:
»Sie finden den Ersten von den Toten an der Ecke Amber und Cumberland.«
Ein Toter. Der Erste von den Toten. Das weckte Jessicas Aufmerksamkeit.
Sie nahm ihr Notizheft und begann zu schreiben. »Ecke Amber und Cumberland, haben Sie gesagt?« Korrekt hätte es heißen müssen Cumberland Street Ost, aber das sagte kein Mensch. Jessica nahm an, dass sie mit jemandem sprach, der in Philadelphia zu Hause war. Aber nicht unbedingt.
»Unter der Taube«, flüsterte der Anrufer.
»Okay. Die Taube. Hab verstanden. Wir überprüfen das. Inzwischen könnten Sie …«
»Wir werden nicht noch einmal miteinander sprechen.«
Mit diesen Worten legte der Anrufer auf.
Jessica hielt den Hörer noch einen Moment in der Hand und versuchte zu verdauen, was sie gerade gehört hatte. War das ein schlechter Scherz? Vielleicht ja, vielleicht auch nicht. Die Spinner riefen normalerweise beim Notruf an. Dieser Anrufer hatte ihre direkte Durchwahl gewählt.
Der Erste von den Toten.
Jessica legte auf.
Plötzlich stand sie einer ganz neuen Situation gegenüber.
Die Mordkommission des Philadelphia Police Departments hatte die Aufgabe, in jedem verdächtigen Todesfall außerhalb eines Krankenhauses oder Hospizes zu ermitteln. Manchmal stellte sich dann heraus, dass es sich um Selbstmord oder um einen schlechten Scherz handelte. Jessica hatte beides schon häufig erlebt.
Sie überlegte einen Moment, ob sie Dana Westbrook, ihre Vorgesetzte, informierten sollte. Schließlich hatte der Unbekannte sich nicht beim Notruf gemeldet, sondern bei der Mordkommission.
Jessica hatte keine andere Wahl. Als sie zum Büro von Sergeant Westbrook ging, vergaß sie ihren Spinat-Wrap von Così, der mittlerweile bestimmt kalt geworden war.
*
»Und Sie haben nicht herausgehört, ob es ein Mann oder eine Frau war?«
»Nein«, sagte Jessica. »Der Anrufer hat geflüstert.«
»Was hat er gesagt?«
Dana Westbrook war Anfang fünfzig, eine fitte, durchtrainierte, clevere Frau. Obwohl die eins fünfundsiebzig große Jessica ihre Vorgesetzte um fast zehn Zentimeter überragte, konnte man Dana Westbrook nicht als klein bezeichnen. Und Gott stehe jedem bei, der sie verärgerte oder seine Arbeit nicht anständig machte.
Frauen, die bei Polizeibehörden arbeiteten, egal, wo auf der Welt, wussten, dass sie doppelt so hart arbeiten mussten wie Männer, wenn sie eine Uniform trugen. Das war eine unumstößliche Tatsache. Wenn sie in leitender Position tätig waren, mussten sie in noch stärkerem Maße zeigen, was in ihnen steckte. Jessica beneidete Dana Westbrook nicht um ihren Posten, den sie auch niemals anstreben würde. Die Arbeit als Detective war hart genug.
Jessica blätterte in ihrem Notizheft. »Der Anrufer hat ›ein Gott‹ gesagt, und dann irgendwas über ›sieben Kirchen‹.«
»Sieben Kirchen?«
»Ja.«
»Irgendeine Ahnung, was das bedeuten soll?«
»Nein.«
Westbrook dachte kurz nach und spielte mit ihrem Stift. »Kennen Sie die Kreuzung? Könnte es mit einer laufenden Ermittlung zu tun haben?«
Daran hatte Jessica natürlich auch schon gedacht, es aber nicht angesprochen, weil sie keine Lust hatte, der Sache nachzugehen. »Nicht, dass ich wüsste, Sergeant.«
»Und das andere, was er gesagt hat? Der ›Erste von den Toten‹?«
»›Der Erste von den Toten‹. Und dann: ›Wir werden nicht noch einmal miteinander sprechen.‹«
»›Wir werden nicht noch einmal miteinander sprechen‹. Hat er das genau so gesagt? Hat er nicht gesagt: ›Wir sprechen nicht noch einmal miteinander‹?«
Scheiße, dachte Jessica. Sie führte sich alle Fakten vor Augen und versuchte, die Sache aus der Perspektive ihrer Vorgesetzten zu betrachten. Es sah ganz so aus, als würde sie dem Anruf nachgehen müssen, ob es ihr gefiel oder nicht.
Westbrook schaute einen Moment aus dem Fenster, während sie den Stift zwischen den Fingern hielt und ihn von einer Seite auf die andere schwenkte. Jessica erinnerte diese Bewegung der Finger an eine Technik der Cheerleader. Sie hatte nie den Mut gehabt, Dana Westbrook – diese knallharte Frau, die in der Elitetruppe der Marines und bei der Operation Desert Storm gekämpft hatte –, zu fragen, ob sie jemals Cheerleader gewesen war.
»Überprüfen Sie die Sache«, sagte Westbrook. »Wenn nichts dahintersteckt, betrachten Sie es als kleinen Ausflug nach Kensington. Ich habe gehört, da soll es um diese Zeit sehr schön sein.«
Jessica lächelte. Westbrook war ihren Untergebenen gegenüber stets loyal und hatte immer einen Scherz auf den Lippen. »Alles klar, Sergeant.«
Zehn Minuten später verließ Jessica das Büro und nahm ihren Mantel, die Autoschlüssel und ein Funkgerät von der Ladestation. Am Schreibtisch der Sekretärin blieb sie kurz stehen. Sie schrieb den Ort und die Information über die Taube auf ein leeres Blatt ihres Notizhefts, riss es heraus und reichte es der Sekretärin. »Schicken Sie bitte einen Streifenwagen zu dieser Adresse«, sagte sie. »Könnte etwas sein.«
Auf dem Weg zum Aufzug lief sie Kevin Byrne in die Arme.
*
Als sie gemeinsam nach Kensington fuhren, informierte Jessica ihren Partner über die Einzelheiten des Anrufs.
»Hat es sich nach dem Hilferuf eines Selbstmörders angehört?«, fragte Byrne.
»Schon möglich. Aber warum ruft er bei der Mordkommission an? Warum nicht die Hotline für Suizidgefährdete?«
»Was ist so dramatisch daran, dass er die Polizei anruft?«
Da hatte er auch wieder recht.
»Aber er hat die direkte Durchwahl der Mordkommission gewählt«, gab Jessica zu bedenken.
»Nicht gut«, sagte Byrne.
»Gar nicht gut.«
Die Durchwahlnummern der Mordkommission waren nirgendwo veröffentlicht – in keiner Broschüre, keinem Branchenverzeichnis und mit Sicherheit in keinem Telefonbuch. Wenn jemand eine dieser Durchwahlnummern kannte, musste er eine Visitenkarte haben, auf der die Nummer stand. Normalerweise gingen alle Anrufe über die Zentrale.
»Und du hast die Stimme nicht erkannt?«, fragte Byrne.
»Nein. Allerdings habe ich auch nicht viel davon gehört. Der Anrufer hat geflüstert.«
»Und wie hat er sich ausgedrückt? ›Der Erste von den Toten‹?«
»Ja.«
»Auch nicht gut.«
»Wer zum Teufel sagt ›von den Toten‹?«
Es war eine rhetorische Frage. Keiner der beiden wollte es wirklich wissen.
»Hat der Anrufer deinen Namen genannt?«, fragte Byrne.
Jessica erinnerte sich nicht genau. Im Gegensatz zu Anrufen beim Notruf 911 wurden Telefonate mit der Mordkommission nicht automatisch aufgezeichnet und gespeichert. Deshalb hatten sie keinen Mitschnitt. »Nein. Ich glaube nicht.«
»Hast du Geräusche im Hintergrund gehört? Fernsehen? Radio? Irgendwelche Musik?«
»Nein«, sagte Jessica. »Ich habe auch nicht besonders darauf geachtet. Der Anruf kam wie aus heiterem Himmel.«
Byrne schwieg einen Augenblick, um die Informationen zu verarbeiten.
»Ach ja, ich hab ganz vergessen, dich zu fragen. Hast du eigentlich diese Sache mit den Philly Brothers übernommen?«, fragte Jessica.
Byrne antwortete nicht sofort. Jessica kannte ihren Partner schon eine Weile und wusste, dass es nur ein Teil der Geschichte war, was sie gleich hören würde. Sie wusste auch, dass Byrne ihr alles erzählen würde, wenn er bereit dazu war.
»Ja«, sagte er. »Hab ich.«
»Und?«
»Lief ganz gut, glaube ich. Gabriel ist elf. Ich hatte das Gefühl, mit einem außerirdischen Wesen zu sprechen.«
»Was hat er für einen Hintergrund?«
»Seinen Vater kannte er gar nicht, die Mutter ging auf den Strich und erfror mit einer Überdosis. Gabriels älterer Bruder hat sich eine Knarre in den Mund gesteckt.«
»Mein Gott.«
»Keine Tattoos und keine Narben«, sagte Byrne. »Jedenfalls habe ich keine gesehen.«
»Meinst du, er ist gefährdet?«
»Heutzutage sind sie alle gefährdet. Bei Gabriel weiß ich es nicht genau. Er scheint clever zu sein, aber das war nur mein erster Eindruck. Ich glaube, er hat in der ganzen Zeit, als wir zusammen waren, keine fünfzig Worte gesprochen.«
»Triffst du dich noch mal mit ihm?«
Byrne zögerte. Jetzt würde er ihr wieder nur eine halbe Geschichte präsentieren. »Als ich das Thema angesprochen habe, hat er vor sich hin gestarrt. Ich rufe ihn auf jeden Fall an und werde es versuchen.«
An einer Ampel Ecke Achte und Spring Garden hielten sie an. Ein eisiger Wind fegte über den Wagen hinweg. Jessica stellte die Heizung höher.
»Andererseits«, fuhr Byrne fort, »bin ich wahrscheinlich nicht der ideale Philly Brother. Ein großer weißer Cop mittleren Alters. Ich glaube nicht, dass der Junge mir in absehbarer Zeit sein Herz ausschüttet.«
»Was redest du da? Du bist ein ganz toller Typ.«
»Stimmt genau.«
»Ja, bist du. Ich hab gehört, dass das Philadelphia Magazine wieder den attraktivsten Junggesellen in Philadelphia sucht. Ich werde dich vorschlagen.«
Byrne lächelte. »Wirst du nicht.«
»Oh doch.«
»Vergiss nicht zu sagen, dass ich in einer Dreizimmerwohnung hause und meine Socken und Unterwäsche in einem Aktenschrank aufbewahre.«
»Vor deinem Haus wird sich eine ganze Horde wilder Weiber versammeln. Ich sehe jetzt schon, dass die Kollegen von der Streife die Menge kaum noch bändigen können.«
»Und vergiss nicht, den Leuten von der Zeitung zu sagen, dass ich mal den Zitronenreiniger mit meinem Deo verwechselt habe.«
Jessica lachte. »Ist mir an dem Tag gleich aufgefallen, dass du wie ein ganzer Zitronenhain riechst.«
*
Kensington lag im Nordosten der Stadt. Hier gab es früher eine florierende Schiffsbauindustrie, ehe sich Fabriken und Holz verarbeitende Betriebe ansiedelten. Als diese Betriebe schlossen, brachen für Kensington harte Zeiten an. Schon bald gehörte es zu den größten Problemvierteln der Stadt, in dem Verfall und Trostlosigkeit herrschten. Noch immer kämpfte Kensington darum, wieder auf die Beine zu kommen.
Da die Amber Street eine Einbahnstraße war, fuhren Jessica und Byrne zuerst zur York Street und dann zurück. Als sie sich der Adresse näherten, sah Jessica einen Streifenwagen mit flackerndem Blaulicht in der Amber stehen. Je länger das Blaulicht blinkte, desto mehr Menschen wurden in einer Straße wie dieser aus den Häusern gelockt. Doch die Einsatzkräfte konnten keine Menschenmenge gebrauchen.
Ehe Jessica aus dem Wagen stieg, betrachtete sie das Haus. Es war ein frei stehendes, zweistöckiges Gebäude aus Buntsandstein, wie es sie in Kensington zu Dutzenden gab. Die beiden Fenster auf der Vorderseite waren mit Brettern vernagelt. Rechter Hand verlief eine kleine Gasse. Über dem Eingang befand sich ein kleiner Glockenturm.
Jessica und Byrne stiegen aus, überquerten die Straße und befestigten die Dienstmarken an ihren Mänteln. Ehe sie den Bürgersteig auf der anderen Seite erreichten, stieß Byrne seine Partnerin an und wies mit dem Kopf zu der hohen Mauer eines alten Lagerhauses neben dem Backsteinbau. Jemand hatte eine große graue Taube, die auf einem Olivenzweig saß, auf diese Mauer gemalt.
Augenblicklich fielen Jessica die Worte des Anrufers ein: Sie finden den Ersten von den Toten Ecke Amber und Cumberland. Unter der Taube.
Die junge Streifenbeamtin, eine Latina Mitte zwanzig, ging neben ihrem Wagen nervös auf und ab. Als Jessica die Augen der jungen Frau sah, wusste sie sofort, dass etwas nicht stimmte. Die Frau sah aus, als hätte sie ein Ungeheuer gesehen.
Auf ihrem Namensschild stand P/O A. MARTINEZ.
»Guten Morgen«, sagte Byrne.
»Guten Morgen, Sir.«
»Was können Sie mir sagen?«
Police Officer Martinez atmete tief ein und aus. Kleine weiße Wölkchen bildeten sich in der frostigen Luft. Martinez zeigte auf das Haus hinter sich und erklärte, sie habe den Anruf entgegengenommen und die Gasse abgesucht, aber nichts gefunden. Erst als sie sich an die Information »unter der Taube« erinnerte, habe sie das Bild auf der Mauer entdeckt und festgestellt, dass die Tür einen Spalt offen stand.
»Im Keller habe ich einen Mann gefunden«, berichtete Martinez. »Ein Weißer, Mitte zwanzig.« Sie schauderte. »Da ist viel Blut geflossen, sehr viel Blut.«
Jessica und Byrne wechselten einen Blick. Also war der Anrufer doch kein Spinner gewesen.
»Der Mann war tot?«, fragte Byrne.
»Ja, Sir.«
»Haben Sie den Puls überprüft?«
Die Streifenbeamtin schaute überallhin, nur nicht zu Byrne. »Nein, Sir. Aber er ist …«
»Sie wissen nicht genau, ob der Mann tot ist?«
Martinez zögerte. »Nein, Sir. Aber da ist …«
»Haben Sie Verstärkung angefordert und das Gebäude überprüft?«
Martinez räusperte sich. »Ich habe den Keller überprüft.«
»Alleine?«
Die junge Frau sah aus, als wäre sie kurz davor, ihre Dienstmarke zurückzugeben. Byrne legte ihr tröstend eine Hand auf die Schulter. »Schon okay. Wo genau liegt die Leiche?«
Martinez riss sich zusammen. »Unter der Treppe. Die Kellertreppe runter und dann rechts.«
Byrne zeigte auf die Tür. »Haben Sie das Haus durch diese Tür betreten?«
»Ja, Sir.« Martinez nickte.
»Haben Sie sich zu erkennen gegeben?«
»Ja.«
Byrne blickte zu dem Haus. Es war eines der typischen kleinen, zu einem Geschäftshaus umgebauten Gebäude mit einer Fläche von vermutlich knapp zweihundert Quadratmetern. »Rufen Sie zwei weitere Streifenwagen hierher, Officer«, wies er Martinez an. »Und machen Sie das Blaulicht aus.«
»Jawohl, Sir«, sagte Martinez verlegen, ging zu ihrem Streifenwagen und stellte das Blaulicht ab. Dann drückte sie auf das Mikro an ihrer Schulter. Wäre sie schon länger bei der Polizei gewesen, hätte sie sofort Verstärkung an den Tatort ihres vermutlich ersten Mordfalles gerufen.
Ein paar Minuten später traf der zweite Streifenwagen ein. Die Besatzung war seit Jahren dabei; Jessica und Byrne hatten schon mehrmals mit ihnen zusammengearbeitet. Byrne forderte die Beamten auf, das Erdgeschoss, den ersten Stock und den Turm des Gebäudes zu überprüfen.
Als die beiden Polizisten das Erdgeschoss gecheckt hatten und mit der Überprüfung des ersten Stocks und des Turms begannen, stiegen Jessica und Byrne die verfallene Betontreppe hinauf und betraten das Haus. Jessica ließ den Strahl ihrer Maglite über den Türrahmen gleiten. Das Holz um das Schloss herum war vor Kurzem abgesplittert. Wahrscheinlich hatte der Täter das Haus durch diese Tür betreten.
Das Erdgeschoss bestand aus einem großen, quadratischen Raum mit einer dilettantisch eingezogenen Trennwand in der Mitte. Die einst großen Fenster auf beiden Seiten waren schon vor langer Zeit zugemauert worden. Tageslicht fiel nur noch durch zwei kleine Fenster im oberen Teil der hinteren Wand. Auf die Zwischenwand in der Mitte hatte jemand ein mittlerweile verblasstes Bild gemalt, ein von Wolken umhülltes Kruzifix an einem unnatürlich blauen Himmel, das in einem himmlischen goldenen Licht erstrahlte, das sich von unten über das Kreuz ergoss.
Zwei alte Holzstühle standen sich in der Mitte des Raumes gegenüber. Auf dem umgedrehten Karton daneben lagen verbrannte Streichhölzer und kleine, verkohlte Kügelchen aus Aluminiumfolie.
Weitere Möbel gab es nicht, auch keine Lampen. Der Fußboden war mit moderigen Zeitschriften, Zeitungen und Fast-Food-Abfällen übersät. In einer Ecke lag ein alter tragbarer Fernseher mit einem zertrümmerten Bildschirm und heraushängenden Schaltern auf der Seite.
»Der erste Stock und der Turm sind sauber«, meldete einer der Streifenpolizisten, als er die Treppe herunterkam. »Sollen wir hier im Erdgeschoss bleiben?«
»Nein«, sagte Byrne. »Sichern Sie die Vorder- und Rückseite.«
»Ja, Sir.«
Die beiden Polizisten gingen an der Eingangs- und der Hintertür in Position. Officer Martinez übernahm die Aufgabe, das Tatortprotokoll zu führen.
Der dritte Streifenwagen war gerade eben angekommen. Die beiden Officer kümmerten sich bereits darum, die Schaulustigen vom Tatort fernzuhalten. Währendessen machten Jessica und Byrne sich bereit, das Kellergeschoss in Augenschein zu nehmen.
Sie trafen sich an der Treppe und schalteten ihre Taschenlampen ein. Jessica öffnete die Tür. Sie würde als Erste hinuntergehen. So hielten sie es immer; der heutige Tag bildete keine Ausnahme.
Sie leuchteten die Treppe mit den Taschenlampen aus. Die lautlose, beklemmende Dunkelheit unter ihnen schien das Licht zu verschlucken.
Der Keller, dachte Jessica. In vielen Fällen war er der Hort des Schreckens. Man gewöhnte sich nie an den Keller.
Jessica blieb stehen, umklammerte den Griff ihrer Waffe. Byrne stellte sich auf die andere Seite der Tür.
Draußen war es kalt, aber hier unten herrschten Temperaturen wie in Alaska. Ihr Atem bildete weiße Schwaden in der Luft. Trotz der Kälte spürte Jessica den warmen Schweiß auf ihrem Rücken.
Auf der obersten Treppenstufe blieb sie kurz stehen. Das alte Holz knarrte unter ihrem Gewicht. Sogar hier oben nahm Jessica den unverkennbaren metallischen Geruch des Blutes wahr.
Sie atmete tief ein, legte eine Hand auf das Geländer.
In diesem Augenblick hörten sie den Schrei.
5.
»Polizei!«, rief Jessica. »Ist da jemand?«
Keine Antwort.
Jessica zog ihre Waffe, richtete sie nach unten in die Dunkelheit und stieg langsam die Stufen hinunter, wobei sie dem Strahl der Taschenlampe folgte und auf zerbrochene oder fehlende Bretter achtete. Auf einer Stufe lag das Plastikspielzeug eines Kindes – eine Ente, der ein Fuß fehlte und um deren Hals ein schmutziges Band gebunden war. Zwei Stufen tiefer lag eine große Kugel aus trockenem, zerrissenem Zeitungspapier, in der vermutlich eine Mäusefamilie gewohnt hatte.