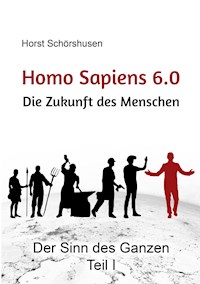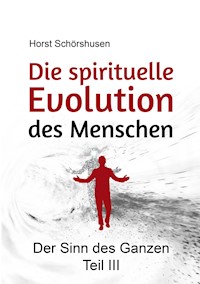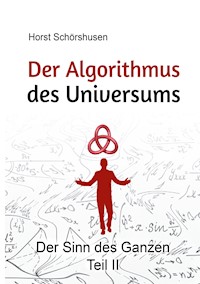
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Der Sinn des Ganzen
- Sprache: Deutsch
Im zweiten Teil seiner Trilogie zum Sinn des Ganzen beschäftigt sich Horst Schörshusen mit dem Ursprung unseres Universums und der geheimnisvollen Welt der Quanten. Dabei geht er insbesondere den Fragen nach dem Wesen der Zeit, der Information und den höheren Dimensionen nach und deckt eine verborgene Wirklichkeit auf. Beschreibt die moderne Physik möglicherweise eine materielose und zeitlose Welt, die mit den Jenseitsbeschreibungen der alten Schriften und den Nahtoderfahrungen vergleichbar ist? Kann es sein, dass ein Teil unserer nicht bewussten Persönlichkeit als quantenmechanisches Wellenphänomen beschrieben werden könnte und Teil einer höher dimensionalen Welt ist? Die Möglichkeit zur Verschränkung von Photonen könnte vielleicht erklären, warum wir spirituell fühlende Wesen sind. Die Quantenphysik hat anscheinend den Geist in der Materie wieder entdeckt. Wird das Universum durch einen nicht-linearen Algorithmus gesteuert? Was kann das zur Beantwortung der Frage nach dem Sinn des Ganzen beitragen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 237
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zum Autor:
Horst Schörshusen
Politologe und ehemaliger Politiker, war lange Jahre in Leitungsfunktionen in der niedersächsischen Landesverwaltung tätig. Hat Politikwissenschaften und Soziologie in Hamburg studiert. Wohnt in Hannover, ist verheiratet und hat drei Kinder.
Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit wissenschaftlichen und spirituellen Themen. Hat bereits zwei Bücher zum Thema „Sinn des Ganzen“ geschrieben und eine eigene Philosophie dazu entwickelt. Jetzt hat er dazu eine Trilogie veröffentlicht.
Webseite zur Buchreihe: www.sinn-des-ganzen.de
Für
Marco, Rabea
Lara und Christine
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Die verborgene Wirklichkeit
Die Frage nach dem Sinn
Das fehlende Wissen über das Ganze
Die Wirkung des Kleinen
Geheimnisvolles Universum
Mysteriöse Eigenschaften des Kosmos
Urknall – Schöpfung oder Zufall?
Dunkle Energie und dunkle Materie
Schwarze Löcher
Merkwürdige Gravitationskraft
Wunderbare Naturkonstanten
Unerklärte physikalische Phänomene
Der Algorithmus des Universums
Seltsamer Mikrokosmos
Die vier Grundkräfte des Universums
Das Standardmodell der Teilchenphysik
Konstante Lichtgeschwindigkeit
Das Periodensystem der Elemente
Die „Schönheit“ der Struktur
Quantenphysikalische Phänomene
Die Idee von Strings und Multiversen
Welt der Widersprüche
Die Zeit – Das große Rätsel
Höhere Dimensionen
Die 6 Dimensionen von Burkhard Heim
Gibt es ein holografisches Universum?
Information und Entropie
Das Wesen von Information
Mysteriöse Informationsübertragung
Intuition und Verstand
Verwendete Literatur
Quellenverzeichnis
Einleitung
Die verborgene Wirklichkeit
Ich glaube, dass die Corona-Krise der Jahre 2020 und 2021 der Anfang für etwas sehr Wichtiges wird, nämlich die Überprüfung unserer Einstellungen zum Leben, zum Arbeiten und zum Sterben. Vieles wird auf den Prüfstand gestellt werden müssen. Wir werden uns verstärkt fragen, welche Rollen die Naturwissenschaften, die globalisierte Ökonomie und die verschiedenen Religionen zu einem überlebenswichtigen Verständnis von uns selbst spielen und warum wir bisher bei der Rettung unseres Planeten versagt haben.
Wir werden möglicherweise erkennen, dass unsere heutige Wahrnehmung der Welt mit der wirklichen Welt wenig gemein hat und dass uns diese Wahrnehmung daran hindert, den nächsten Evolutionsschritt des Homo sapiens bewusst vorzubereiten. Der Physiker und Philosoph Carl Friedrich von Weizsäcker (1912 – 2007) schrieb:
„Es ist wohl möglich, dass die heutige Weltkultur sich zugrunde richten wird. Die Frage, die wir jetzt stellen, ist aber: Wenn sie überlebt, welcher inneren Logik müssten dann ihre Wahrnehmungen folgen?“ 1
Unsere Welt ist gerade nicht ein linear berechenbares System mit einfachen Wechselbeziehungen, sondern in hohem Maße unbestimmt, unbekannt und überraschend. Der menschliche Verstand wirkt dabei wie ein Filter. Mehrdimensionales wird auf möglichst eindimensionale Ursache-Wirkungsketten reduziert. Unwahrscheinliches wird am besten herausgerechnet. So entstand eine Kontroll-Illusion, die den Homo sapiens und seine Techniken aber auch groß gemacht haben. Dabei sind allerdings menschliche Gefühle und die Intuition als subjektive Beigabe entwertet worden.
Heute merken wir, dass das blinde Vertrauen in unsere rationale Auffassungsgabe verhindert, unser geistiges Potenzial weiter zu entwickeln und zu nutzen. Einerseits werden wir „Künstliche Intelligenzen" schaffen, die uns viele Aufgaben abnehmen können. Andererseits werden wir an uns selbst arbeiten, um unsere Fähigkeiten zur emotionalen Intelligenz auszubauen und unsere Intuition verstärkt zu nutzen, um komplexe mehrdimensionale Phänomene zu verstehen. In diesem Sinne stehen wir möglicherweise am Tor zur Weiterentwicklung des Homo sapiens.
Der Homo sapiens ist mit seinem auf Logik und Mustererkennung programmierten Gehirn sehr weit gekommen. Die Fähigkeit, Ursache-Wirkungsketten zu erkennen, hat die mechanistische Wissenschaft vorangebracht und uns viele Anwendungen beschert. Die Entwicklung des Universums zeigt sich in der Zunahme von Vielfalt und Komplexität. Wir tun so, als hätten wir ein geschlossenes System vor uns, von dem wir ein Teil sind. Wir unterstellen, dass der Erhaltungssatz zur Energie auch universell gilt, obwohl wir heute viele energetische Prozesse - besonders in den Schwarzen Löchern und dem „Null-Energie-Feld“ – studieren können, die darauf hinweisen, dass das System Universum nicht geschlossen ist. Offene Systeme müssen anders beschrieben werden, weil sie permanent Informationen und Energie mit anderen Systemen austauschen. Wenn diese Systeme dann noch aus vielen verschiedenartigen Elementen bestehen, die in Wechselwirkung zueinander treten, macht eine Beschreibung mit Hilfe von Ursache-Wirkungsketten keinen Sinn mehr. Es gibt Wissenschaftsrichtungen wie die Kybernetik und die Systemtheorie, die sich mit komplexen offenen Systemen beschäftigen und beispielsweise folgendes feststellen:
„Die Wechselwirkungen zwischen den Elementen eines komplexen Systems sind spezieller Art: Sie sind nicht linear.“ 2
Wir sind Teil eines mysteriösen Universums. Dieses ist nach menschlichen Maßstäben riesig, sehr alt und in einem ultrakurzen Augenblick entstanden. Die sichtbare materielle Welt ist nur ein kleiner Teil davon. Die Raumzeit dehnt sich immer noch aus und beschleunigt sich sogar.
Wenn wir wollen, können wir überall Teile einer künstlichen Intelligenz bzw. eines übermenschlichen Algorithmus entdecken. Dieser verbirgt sich möglicherweise im strukturierten Aufbau der Elementarteilchen, der wirkenden Grundkräfte, der Naturkonstanten und dem genetischen Code. Vielleicht ist das alles auch nur das Ergebnis von zufälligen Entwicklungen aufgrund minimaler Abweichungen. Gibt es vielleicht unendlich viele Paralleluniversen und wir leben in einem davon, in dem das Unwahrscheinliche Wirklichkeit geworden ist?
Es gibt viele Denkmodelle über das Wesen des Universums, die sich aber gegenseitig ausschließen. Welche Rolle spielt dann die Gattung Homo sapiens in dieser riesigen Welt? Hat der Mensch noch eine Zukunft und werden die von uns geschaffenen künstlichen Intelligenzen auf ihre Schöpfer Rücksicht nehmen?
Hat ein Mensch unter fast 8 Mrd. Menschen überhaupt eine Bedeutung oder kommt es auf einen einzelnen Menschen nicht mehr an? Wenn es nur darum gehen sollte, dass die Gattung Mensch überlebt, wie dies von einigen Evolutionsbiologen postuliert wird, dann wäre die Frage nach dem Sinn eines einzelnen Lebens wohl überflüssig. Möglicherweise wäre dann die Entwicklung von einzigartigen Individuen mit einem „Selbst-Bewusstsein“ das eigentliche Problem. Ich-bewusste Menschen würden dann nämlich nicht erkennen können, dass sie zu einem Ganzen gehören und sich wie Krebszellen verhalten und anderen Zellen die Lebensgrundlagen rauben.
Schon jetzt gibt es einen internationalen Wettbewerb um die optimale Gesellschaftsform. Wir sind uns sicher, dass die sogenannten freiheitlichen Marktwirtschaften und Demokratien die Probleme der Zukunft am besten lösen können. Es gibt aber auch Länder wie die Volksrepublik China, die die Zukunft in einem zentralistisch kontrollierten Staatskapitalismus sehen und individuelle Menschenrechte als gefährlichen Luxus bewerten. China behauptet, dass sie die Herausforderungen der Zukunft (Umweltprobleme, Wohlstandsverteilung, Pandemien und Überbevölkerung) besser bewältigen können als die westlichen Industrieländer. Möglicherweise lässt sich der Freiheitsgedanke nur retten, wenn diese Systeme gleichzeitig Erfolge bei den Themen Umweltpolitik, Gesundheits- und Sozialpolitik vorweisen könnten. Die Krise der Politik zeigt sich nämlich nicht nur bei der Bearbeitung von komplexen gesellschaftlichen
Problemen, sondern auch an der fehlenden Entscheidungsfreudigkeit und reduzierten globalen Verantwortung.
Vielleicht gefährden wir uns und unseren Planeten nur deshalb, weil wir ein Fehler eines Evolutionsprozesses sind? Wir sind offensichtlich die einzige Spezies auf unserer Erde, die einen freien Willen besitzt und sich nicht programmgerecht verhalten muss. Bisher haben wir aber nicht gelernt, dass diese Freiheit auch eine neue Verantwortung bedeutet. Eine Verantwortung nicht nur für das Überleben unserer Art, sondern eine Verantwortung für das Ganze.
Vielleicht sollten wir die nächste staatenbildende Art hinter den staatenbildenden Insekten wie Termiten, Ameisen und Bienen etc. werden? Diese bieten ihren Mitgliedern höchstmögliche Überlebenssicherheit in einem feudalistischen System mit einer klaren Arbeitsteilung. Entweder gehört man darin zur Klasse der Arbeiter oder der Klasse der Soldaten oder man produziert Nachkommen oder man befruchtet irgendwann einmal die „Königin“. Die Teile kümmern sich nur um das Überleben dieses einen Staates und sehen in konkurrierenden Systemen eher eine Gefahr, die beseitigt werden muss.
Auf den Menschen übertragen, beschreibt dies eine Organisationsform von Nationalstaaten, die um die Ressourcen der Welt konkurrieren. Es gibt nicht wenige politische Kräfte, die diese Lebensform als naturgegeben ansehen und trotz der internationalen Arbeitsteilung und Vernetzung in das vergangene Zeitalter der von Familien, Eliten bzw. Clans dominierten Nationalstaaten zurückwollen. Für einzelne selbsternannte Eliten ist das sicher eine angenehme Vorstellung und ein wünschenswertes Ziel.
Aktuell könnte man den Eindruck gewinnen, dass diesen machtvollen und finanzstarken Netzwerkern die Zukunft gehört und sich alle anderen deren Zielen unterordnen müssten. Mit Sicherheit wären dann die Menschheit und die Erde als Ganzes dem Untergang geweiht. Niemand wäre dann nämlich bereit, die Verantwortung für das globale Ganze zu tragen. Die einzelnen Gruppen wären nur an den wachsenden Vorteilen für sich selbst interessiert.
Vor diesem Hintergrund steht eine vorurteilsfreie Inventur und Bewertung unserer philosophischen und politischen Weltbilder und Überlebensstrategien auf der Tagesordnung. Dabei müssen wir wieder einmal erkennen, dass sich die Welt nicht um uns dreht.
Dieses Buch behandelt den zweiten Baustein zu einem neuen Verständnis unserer Welt und zum Sinn des Ganzen. Dabei geht es um die mysteriösen Gesetze, die im Makro- und Mikrokosmus wirken und insbesondere durch die Quantenphysik neu bewertet werden müssen. Die Welt, in der wir alle leben, ist ein großartiges und geheimnisvolles Konstrukt. Um den Sinn des Ganzen zu verstehen, ist ein überarbeitetes Verständnis des heutigen Wissens unserer Naturwissenschaften erforderlich. In den letzten 100 Jahren hat sich unser Weltbild fundamental verändert. Dies müsste auch unser eigenes Selbstverständnis als Mensch verändern. Doch selbst die Generation, die aktuell in der Schule auf ihre zukünftige Lebens- und Arbeitswelt vorbereitet wird, erfährt hiervon verhältnismäßig wenig.
Gerade die „Generation Z" - die zwischen 1997 und 2012 Geborenen - ist die Generation des Internets und der Sozialen Netzwerke mit einem fast unbeschränktem Zugang zum Wissen der Menschheit. Keine Generation hat mehr Möglichkeiten zur Wissensentwicklung bekommen. Die Informationsflut nimmt weiter exponentiell zu. Die Entscheidung, was für die Zukunft wirklich wichtig ist und in den „Kerncurricula“ (Rahmenrichtlinien) der Schulen behandelt werden sollte, ist vor diesem Hintergrund sicher schwierig. Die Vorgaben der Kultusministerien fuhren schon jetzt dazu, dass die Jugendlichen fast keine Freizeit mehr haben und der Unterrichtsstoff eigentlich vermindert werden müsste. Möglicherweise erfahren die Schülerinnen und Schüler auch etwas über Quantenphysik und über unsere astrophysikalische Wirklichkeit. Dabei wird Astrophysik meistens nur als „Lernplanalternative“ angeboten.
Bildungspolitisch wäre es schwer zu verantworten, wenn die Schülerinnen und Schüler vor ihrer spezialisierten Berufs- und Ausbildungswahl kein Gefühl für ihr Lebensumfeld bekommen würden, das vom Universum und der Quantenwelt flankiert wird. Es scheint, dass sich die Einstellungen der Pädagogen zu diesen Weltbild-Themen langsam ändern. Der Philologenverband hat beispielsweise 2020 sein Magazin „Profil“ schwerpunktmäßig „Eine neue pädagogische Astronomie und Astrophysik für einen Unterricht der Zukunft“ benannt und besonders die interdisziplinäre Verknüpfung mit vielen anderen Fächern herausgestellt:
„Hier wird deutlich, dass astronomische Kenntnisse unverzichtbar sind, will man die Fragen nach der Orientierung des Menschen in der Welt, nach seinem Denken und Handeln, nach dem Sinn seines Lebens beantworten.“ 3
Der Physik- und Religionslehrer Peter Maier hat nach seiner eigenen Darstellung bei der Verknüpfung von Naturwissenschaft und Religion eine „Sternstunde der Pädagogik“ erlebt. In einer 8. Klasse hat er die Schöpfungsmythen früherer Völker und der Bibel (Genesis) mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Urknall, den Schwarzen Löchern und der Evolutionstheorie verbunden und seine Schülerinnen und Schüler aufgefordert, dazu Fragen zu stellen („Wer hat recht?). „Die Köpfe rauchten“, es kamen Fragen über Fragen. Nicht alle Fragen konnten beantwortet werden. Es kamen Fragen wie: Gibt es noch andere Planeten mit Lebewesen? Gibt es einen Gott und hat er immer noch einen Einfluss auf die Welt? Was ist die Zukunft des Menschen auf der Welt? Was geschieht nach ihrem Tod? Warum zerstören die Menschen ihre eigene Umwelt? Warum sind wir überhaupt da? Peter Maier spricht von „magischen Stunden, die mit großer Wahrscheinlichkeit Lehrern wie Schülern dauerhaft in Erinnerung bleiben“ 4.
Irgendwann im Leben werden wir uns vielleicht auch die spannende Frage nach dem Sinn des Ganzen stellen. Genau wie ich es getan habe. Natürlich kann man bei der Beantwortung dieser Frage zu unterschiedlichen Antworten kommen. Allein schon deshalb, weil jeder Mensch ein anderes kulturelles Umfeld und andere Vorinformationen hat. Ich bin deshalb weit davon entfernt, Antworten zu liefern, zu denen es keine Alternativen gibt. Mir geht es dabei um Denkanstöße.
Die nachfolgende Darstellung dessen, was wir heute über unser Universum und den Mikrokosmos wissen, zeigt sehr anschaulich, dass selbst die Physik mit ihren Wahrheiten hadert. Es kommt hier viel Seltsames und Geheimnisvolles ans Licht. Ich habe dieses Buch „Der Algorithmus des Universums“ genannt, weil sich dieser Eindruck in allen neuen physikalischen Kenntnissen verdichtet. Dabei habe ich die Gewissheit gewonnen, dass in unserer Welt Zufälle aber auch Programme wirken. Es gibt viele Freiheitsgrade und die Zukunft bleibt unbestimmt. Es gibt allerdings auch nicht-lineare Regeln, die etwas Besonderes sind. Dieser zweite Teil meiner Trilogie über den Sinn des Ganzen behandelt deshalb das makro- und mikrokosmische Umfeld, in dem wir leben und beschreibt die Gesetze, die auch für uns gelten, weil wir ein Teil des Universums sind.
Im ersten Teil meiner Trilogie zum Sinn des Ganzen habe ich mich mit der Entwicklung und dem Wesen des Menschen beschäftigt. Dabei ging es um den Mechanismus der Evolution und die Zukunft als Homo sapiens. Es ging um die Suche nach Glück, der Rolle der menschlichen Intuition und des Verstandes, dem Unterschied zu den Tieren und Pflanzen und dem Wettbewerb mit „Künstlichen Intelligenzen“. Hier wurde deutlich, dass der Mensch ein mehrdimensionales und programmiertes Wesen ist, das einen freien Willen besitzt und mittels der Intuition auch ganzheitliche Informationen verarbeiten kann.
Im dritten Teil meiner Trilogie geht es dann um die „Verdrängte Wirklichkeit“ und die spirituelle Seite des Menschen. Dabei beschäftige ich mich intensiv mit den Botschaften alter Schriften und Religionen und vergleiche diese mit den heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Der Sinn des Ganzen erschließt sich dann, wenn man die vielen Hinweise auf eine jenseitige Welt und die Möglichkeit der Wiedergeburt einbezieht. Dabei geht es darum, die spirituelle und intuitive Seite unserer Persönlichkeiten wiederzuentdecken und die Vernetzung sämtlichen Lebens zu erfahren. Quantenphysik und Mystik schließen sich nicht gegenseitig aus, sondern ergänzen einander.
Die Frage nach dem Sinn
Durch die Globalisierung und die internationale Arbeitsteilung treten seit 2004 fast jährlich neue weltweite Pandemien auf. Das ist etwas, das uns 2020 und 2021 besonders beschäftigt hat.
Seit 1950 hat sich die Weltbevölkerung verdreifacht. 2019 lebten 7,8 Mrd. Menschen auf der Erde. Jährlich kommen etwa 80 Mio. dazu (Geburten abzüglich Sterbefälle). Die durch Viren verursachten Pandemien haben diese Entwicklung nur unwesentlich beeinflusst. Die weltweite Corona-Pandemie wird aber trotzdem im Bewusstsein bleiben und das menschliche Verhalten nachhaltig verändern. Unternehmen werden die internationale Arbeitsteilung überdenken und möglicherweise wird es weniger Großveranstaltungen und Reisen geben.
Schon 2012 wurde der Bundestag über eine mögliche Pandemie mit mehreren Millionen Toten per Drucksache informiert. Da die Eintrittswahrscheinlichkeit als „bedingt wahrscheinlich“ eingestuft wurde (ein Mal innerhalb von 100 bis 1000 Jahren), hat man die empfohlenen Maßnahmen nicht veranlasst.5 Etwas Ähnliches hatten wir bei der Bewertung von Kemschmelzunfällen in Atomreaktoren gehört. Auch damals hat man diesen möglichen Unfalltyp einfach ignoriert. Bis uns Tschernobyl und Fukushima die Wahrheit vor Augen führten. Der Homo sapiens neigt nun einmal dazu, sich die Welt schön zu zeichnen.
Viele Menschen werden nun das Gefühl nicht los, dass ihr Leben leichter aus den Fugen gerät, als sie sich das vorstellen konnten und das der Tod trotz hoher Lebenserwartung nicht planbar ist. Plötzlich denken viele Menschen auch einmal über ihre eigene Sterblichkeit nach. Das relativiert die hedonistischen Ziele zum guten und glücklichen Leben. Die Corona-Krise hat tatsächlich eine alte philosophische Debatte Wiederaufleben lassen: Die Frage nach dem Sinn unseres Lebens vor dem Hintergrund der eigenen Sterblichkeit.
Plötzlich wird der Focus auch mal wieder nach innen gerichtet. Corona hat uns auf den Teppich unserer eigentlichen Existenz zurückgeholt und wir stellen uns wieder existenziell wichtige Fragen. Es könnte sein, dass die Philosophie ein unerwartetes Comeback erlebt und die zersplitterten Naturwissenschaften interdisziplinär zusammenfuhrt. Das Ganze ist wohl mehr als die Summe seiner Teile.
Die Fähigkeit zur Selbstanalyse ist etwas typisch Menschliches. Die Antworten werden aber nicht befriedigen, wenn der Kreis zu klein gezogen wird.
Schaue ich mir isoliert mein eigenes Leben an, dann kann ich nur sagen, ob ich mich in meiner Haut wohl gefühlt habe oder nicht und ob ich meine Lebensziele erreichen konnte. Viele Menschen geben sich damit zufrieden und zählen ihre Errungenschaften auf: Abitur, hohes Gehalt, Auto, Haus und Familie. Als Statusbeschreibung kann dies reichen. Suche ich nach dem Lebenszweck, dem Grund meines Lebens, meiner Bestimmung, meiner Berufung, meiner Mission oder sogar dem Daseinszweck und Existenzgrund, muss ich den Kreis erweitern. Wenn ich meinen Wert für andere Menschen oder den Nutzen für die Gesellschaft erfassen wollte, wird die Menge der Fragestellungen noch größer.
Das fehlende Wissen über das Ganze
Ein Blatt an einem tausendjährigen Baum wird nicht nach einem Sinn fragen, sondern die naturgemäße Rolle eines Blattes übernehmen. Dies bedeutet, Sonnenenergie mit Hilfe von Wasser und Kohlendioxid in Glucose und Sauerstoff umzuwandeln. Im Herbst fällt das Blatt zu Boden und wird von Mikroorganismen in seine Bestandteile zerlegt. Neuer Dünger für den Baum und andere Pflanzen. Im Frühling wachsen neue Blätter, die möglicherweise auch über die Baumwurzeln aufgenommene Atome aus dem alten Blatt enthalten. Ein vollendetes Kreislaufsystem. Der Nutzen dieses Blattes für den einen Baum ist damit noch nicht abschließend beschrieben. Wasser verdunstet über die Blätter und kühlt die Luft. Die Blätter erzeugen Schatten und Schutz vor Regen für die Welt darunter, sind Nahrung für andere Tiere und Wohnstätten für manche Insekten.
Wenn ein Blatt Bewusstsein hätte, dann würde allein schon diese Liste ein gutes Lebensgefühl zurücklassen. Das Blatt könnte erkennen, dass es nützlich war und grundsätzlich keinen Schaden angerichtet hat. Vielleicht würde sich das Blatt im Verwesungszustand auf dem Boden noch fragen, ob danach noch etwas passiert. Es wäre niemand da, diese Frage zu beantworten. Das Blatt würde wahrscheinlich nicht wissen können, was ein Baum ist und noch weniger ahnen, dass der Baum zu einem Wald gehört und dieser irgendwo auf der Erde steht. Erst recht kann das Blatt nicht wissen, dass diese Erde nur ein winziger Punkt im Universum ist. Das Blatt benötigt dieses Wissen auch nicht, um ein Blatt zu sein. Zum Glück für das Blatt.
Menschen funktionieren anders. Wir haben ein Bewusstsein, das uns ständig über die Schulter schaut und bewertet, was wir tun. Dabei lernt das Bewusstsein, welche Wirkungen wir durch unser Handeln erzeugen und wie wir unsere Ziele noch besser erreichen können. Wir denken voraus, planen, erwarten Reaktionen und haben Gefühle, die uns mitteilen, ob es gut oder schlecht läuft. Wir können unseren Instinkten, unserer Intuition oder unserem Gewissen folgen. Wir können tun, was wir immer tun oder entscheiden, einen anderen Weg zu gehen. Im Unterschied zu einem Blatt haben wir Bewusstsein, einen freien Willen und einen Hang dazu, Grenzen zu überschreiten. Für unser Handeln müssen wir Verantwortung tragen und uns dafür rechtfertigen, was wir tun oder was wir unterlassen.
Wir bewerten uns und andere entsprechend einem inneren Wertesystem. Einem System, das Gut und Böse, nützlich und schädlich, freundlich und feindlich, sinnvoll und sinnlos unterscheidet. Dieses Wertesystem ist mit unserer Ich-Persönlichkeit und unserer Lebensgeschichte untrennbar verbunden. Die Sinn-Frage scheint zum Wesen des Menschen zu gehören. Wir können uns dem nicht grundsätzlich entziehen. Wir können uns aber entscheiden, wie weit wir den Kreis um uns ziehen, um unsere Bedeutung zu erfassen. Wir müssen nicht unbedingt die Frage nach dem Sinn des Ganzen stellen, aber wahrscheinlich kommen wir auch an dieser Frage nicht vorbei.
Wenn das Ganze keinen Sinn hätte, dann brauchen wir möglicherweise keine Antwort zum Sinn unseres eigenen Lebens zu suchen. Oder könnte ein Teil des Ganzen einen Sinn haben, wenn das Ganze sinnlos wäre? Was wäre das Blatt ohne den Baum, der Baum ohne den Wald, der Wald ohne die Erde und die Erde ohne das Universum?
Wenn wir das Ergebnis von Vorgängen aus der Vergangenheit und der Wirkung von Zufällen wären, dann sind wir unweigerlich mit diesen Ereignissen und Personen verknüpft und vernetzt. Wenn jeder Mensch eine unvergleichliche Schöpfung eines Superorganismus - häufig Gott oder Allah genannt - wäre, dann wäre die Antwort auf die Sinnfrage eine Beschreibung der Motive dieser übermenschlichen Intelligenz. Wenn diese Intelligenz ihre Motive vor uns verbergen möchte, hätten wir keine Chance, die Bedeutung unserer Existenz zu erfahren. Dann können wir nur daran glauben, dass diese übermenschliche Intelligenz nichts Sinnloses in unsere Welt setzt und am Ende alles gut ausgeht.
Viele Menschen glauben an eine göttliche Intelligenz, die ihre wahren Motive verbirgt und uns steuert. Alles, was wir tun und erleben, wäre dann ein Ausdruck eines geheimen Plans. Wir nennen dies dann Schicksal. Wir hätten keinen echten freien Willen und würden uns dies aber vielleicht einbilden. Dann müssten wir keine Verantwortung für unser Handeln tragen. Das Leben könnte schön einfach sein, wenn wir keinen freien Willen hätten und uns der Schöpfer fuhren würde. Es gibt nicht nur viele gläubige Menschen, die das so sehen. Auch die Gehirnforschung und die Biologie sprechen uns je nach der Denkrichtung einen "Freien Willen" ab. Danach wären wir letztendlich hormon- und enzymgesteuerte Automaten, die sich entsprechend den äußeren und inneren Reizen verhalten. Da diese Wissenschaftsrichtungen an eine von Zufällen und Wahrscheinlichkeiten gesteuerte Welt glauben, kommen sie ohne eine übermenschliche Intelligenz aus. Hier erübrigt es sich, die Sinnfrage zu stellen.
Wenn wir aber an eine übermenschliche Intelligenz glauben, die die Evolution des Lebens irgendwann einmal in Gang gesetzt hat und den Homo sapiens mit echter Willensfreiheit ausgestattet hätte, dann bleibt die Sinnfrage im Raum. Wir wären dann Teil eines Systems, das sich durch die Entscheidungen der einzelnen sich selbst bewussten Elemente entwickelt. Dieses System würde sich teilweise chaotisch verhalten und sich nicht-linear entfalten. Wir hätten keine einfachen linearen und verbundenen Ursache-Wirkungs-Ketten, die bei einer Wiederholung immer das gleiche Ergebnis produzieren würden.
John Briggs schreibt in seinem Buch zur „Entdeckung des Chaos“:
„In einer nichtlinearen Gleichung kann die winzige Änderung einer Variablen eine völlig unverhältnismäßige, ja katastrophale Wirkung auf andere Variablen haben.“ 6
Nicht-lineare Systeme verhalten sich wie Wolken oder Strömungen. Schon kleinste Abweichungen reichen aus, um die Entwicklung des gesamten Systems in eine andere Richtung zu beeinflussen. Auf die menschliche Gesellschaft übertragen bedeutet dies, dass auch ein 16-jähriges Mädchen, das allein vor einem Parlamentsgebäude für Klimaschutz demonstriert, eine internationale Bewegung auslösen kann. Dies ist dann so unwahrscheinlich wie ein Flügelschlag eines Schmetterlings, der einen Hurrikan auslöst, aber passieren kann es eben doch. Dann gibt es keinen Plan und die Zukunft ist unbestimmt. Dies bedeutet aber auch, dass jede noch so unbedeutende Entscheidung, Einfluss nehmen kann auf den Lauf der Welt. Das stärkt die Bedeutung eines jeden einzelnen Menschen und macht Hoffnung, erzeugt aber auch Zukunftsängste.
Die Wirkung des Kleinen
Es ist also nicht unbedingt die Größe einer Ursache, die die Welt in ihrer Geschichte beeinflusst. Auch kleine, scheinbar unbedeutende Dinge können unsere Welt maßgeblich verändern. Das Corona-Virus ist beispielsweise besonders klein und hat sich durch Mutation gegenüber bekannten Viren so verändert, dass unser Immunsystem es zuerst nicht erkennt. Viren sind eigentlich leblos und können sich ohne eine lebendige Wirtszelle nicht vermehren. Viren enthalten nur ein einfaches Programm mit dem Befehl „Kopiere mich“. Damit überschreiben sie Programme, die in unseren Zellen wichtige Stoffe für unseren Körper produzieren. Das ist dann so, als wenn ich mich als Vorstand eines Nudelherstellers ausgebe und dafür sorge, dass ab jetzt nur noch kleine Steine produziert werden (die garantiert niemand braucht...). Viren wollen offensichtlich nur häufig kopiert werden.
Darin ähneln sie einer besonderen Art von Spam-Mails, die unsere Computer verseuchen und sich über unsere Kontaktlisten verbreiten. Unsere Computer werden dann auch oft zwangsweise zum Mitglied von Bot-Netzen, mit denen man dann echten Schaden anrichten kann. Natürlich haben die menschlichen Viren-Programmierer das Ziel, dabei Gewinne auf unsere Kosten zu machen. Das können wir den Corona-Viren nicht unterstellen. Möglicherweise ist der Nebeneffekt, dass menschliche Organe wegen Überforderung versagen, nicht der eigentliche Zweck der Aktion. Scheinbar tut hier ein Teil der Natur etwas Unsinniges. Das Ergebnis ist bisher immer das Gleiche: Die Viren werden zu 99 % irgendwann von den menschlichen Immunsystemen erfolgreich getötet. Ein Teil der Viren mutiert und greift ein paar Jahre später erneut an.
Pandemien sind ein Lebensrisiko
Viren und Bakterien gab es schon vor dem Menschen. Wir leben mit vielen Arten friedlich zusammen. Aber es gibt immer mal wieder Mutationen, die unser Immunsystem noch nicht kennt. Vielleicht können deshalb die neuartigen Impfstoffe besonders wirksam sein, weil sie mit Hilfe der mRNA-Botenstoffe das Immunsystem schon informieren, bevor die gefährlichen Viren eintreffen. Wir dürfen uns da aber nichts vormachen. Die heutige menschliche Welt ist einfach für Pandemien gemacht. Diese werden damit zum ständigen Lebensrisiko.
1918 hatten US-Soldaten die „Spanische Grippe“ nach Europa eingeschleppt. Weltweit starben daran etwa 50 Mio. Menschen, weil man keine Kontaktsperre verordnen wollte. Kinos blieben zum Beispiel in Deutschland geöffnet, um die Frustration nach dem verlorenen Krieg nicht noch zu steigern.
1957 wütete die „Asiatische Grippe“ in Deutschland und forderte rund 30.000 Tote.
Pandemien gibt es, seit Menschen zu Siedlern wurden. So soll es große Seuchen schon 1400 v. Chr. in Ägypten, 430 v. Chr. in Griechenland (ein Drittel der Einwohner Athens sollen gestorben sein), um 1350 in Europa (die Pest soll 25 Mio. Menschen getötet haben), 1520 in Mexiko (Pocken-Viren sollen bis zu 8 Mio. getötet haben) und 1890 sogar überall auf der Welt („Russische Grippe“ mit rund 1 Mio. Toten) gegeben haben. Die sogenannte dritte Pest-Pandemie soll ab 1894 weltweit 12 Mio. Menschen getötet haben.
An den AIDS Viren (HIV) starben seit 1980 weltweit 36 Mio. Menschen. Die Grippewelle 2017/18 (Influenza) hat weltweit bis zu 650.000 menschliche Opfer gekostet (in Deutschland: 25.000). Bisher wurden solche Katastrophen als höchst unwahrscheinlich eingestuft, so dass man auch nicht über nachhaltig wirksame Gegenmaßnahmen nachgedacht hat.
Der Finanzmathematiker Nassim Nicholas Taleb (*1960) hatte sich schon 2007 mit der „Macht höchst unwahrscheinlicher Ereignisse“ am Beispiel der Börsenkatastrophen beschäftigt und den Bestseller „Der Schwarze Schwan“ geschrieben. Er sieht hier einen geistigen blinden Fleck des Homo sapiens:
„Es handelte sich um eine psychische, vielleicht sogar biologische Blindheit. Das Problem lag nicht in der Natur der Ereignisse, sondern in unserer Wahrnehmungsweise“ 7.
Tatsächlich haben wir Schwierigkeiten, uns auf nicht-lineare und eher unwahrscheinliche Entwicklungen einzustellen. Wir erwarten Kontinuität und Ordnung und einfache Ursache-Wirkungsketten. Chaotische Entwicklungen und unerwartete Ereignisse mögen wir nicht, weil wir uns darauf nicht gut vorbereiten können.
In unserer Welt gibt es ohne Zweifel Chaos, aber auch Naturgesetze. Es gibt Vorgänge, die sich exakt berechnen lassen und welche, bei denen nur Wahrscheinlichkeiten berechnet werden können. Es ist sofort ersichtlich, dass dann die Beantwortung nach dem Sinn so eines Systems schwieriger wird. Vor diesem Hintergrund könnte man gut beraten sein, die Sinnfrage gar nicht erst zu stellen.
In der Tat wird diese Frage oft nicht mehr ernsthaft gestellt und ist selbst bei philosophischen Texten meistens nur ein rhetorisches Instrument. Aber Corona hat diese Haltung etwas in Zweifel gezogen. Der Philosoph Richard David Precht (*1964) hat 2020 sein Buch „Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens“ veröffentlicht und kommt am Ende seiner Ausführungen zum Ergebnis:
„Der Sinn des Lebens besteht nicht in schonungsloser Expansion und Ausbeutung aller Ressourcen für vergleichsweise geringen Glückszuwachs. Der Sinn des Lebens ist das Leben selbst, aber nicht im biologischen, sondern im existenziellen Sinn.“ 8
Von einem Philosophen hätte ich wirklich mehr erwartet. Er hat es nicht einmal für nötig gefunden, den „Sinn“ begrifflich zu fassen und zu definieren.
Was meinen wir damit, wenn wir nach dem Sinn fragen? Umgangssprachlich bezeichnen wir damit häufig die Bedeutung eines Vorgangs, eines Dings oder auch von Symbolen, um eine allgemein anerkannte Erkenntnis oder Definition auszudrücken. Wenn ich z.B. sage: "Es ergibt Sinn, die Kartoffeln zu kochen, weil sie dann bekömmlicher sind" wird dem niemand widersprechen. Beim Kochen bzw. Braten von Fisch sähe die Sache schon wieder anders aus, weil es im asiatischen Raum viele Menschen gibt, die bestimmte Fisch-Sorten lieber roh zu sich nehmen.
Handlungen haben je nach Kultur und Zeit unterschiedliche Bedeutungen. Wenn wir uns einige religiöse Rituale der Mayas anschauen, dann haben wir Schwierigkeiten bei der Beantwortung der Sinnfrage. Beim christlichen Abendmahl wissen wir zumindest, dass wir symbolisch den Leib und das Blut Christi aufnehmen und darüber eine Verbindung zu Gott herstellen. Das lässt sich rational nicht erklären, aber für die Beteiligten ist der Sinn erlebbar.
Der Sinn eines Gegenstands meint hingegen oft den Nutzen, den sein Gebrauch stiftet. Auch diese Sinn-Wahrnehmung verändert sich im Laufe der Zeit. Menschen des 19. Jahrhunderts hätten große Schwierigkeiten, den Sinn eines Computers bzw. Handys zu begreifen, obwohl der Nutzen (Datenverarbeitung bzw. Kommunikation) grundsätzlich nicht unbekannt sein dürfte. Wir werden die Zeiten vielleicht noch erleben, in denen die wenigsten noch eine Stadtkarte lesen und einen Computer mit einer Tastatur bedienen können. Irgendwann hat niemand mehr einen Führerschein, weil alle Fahrzeuge autonom unterwegs sind.
Der Sinn von Schriftzeichen und Symbolen erschließt sich auch nur im kulturellen und historischen Kontext. Wenn wir ein Kreuz mit einem langen Strich sehen, dann wissen wir, dass das eine symbolhafte Darstellung der Kreuzigung von Jesus Christus und ein Symbol für die christliche Bewegung ist. Der Sinn vieler Symbole aus der Vergangenheit erschließt sich uns heute hingegen oft nicht mehr.
Der Sinn einer Handlung, eines Gedankens, eines Gegenstandes, eines Symbols oder einer Struktur ist also immer an Menschen einer